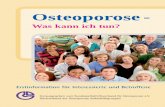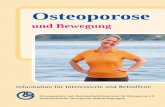Ambulante Physiotherapie bei Osteoporose
-
Upload
j-teichmann -
Category
Documents
-
view
220 -
download
1
Transcript of Ambulante Physiotherapie bei Osteoporose

Z Rheumatol 2012 · 71:319–325DOI 10.1007/s00393-012-0964-1© Springer-Verlag 2012
U. Lange1 · U. Müller-Ladner2 · J. Teichmann3
1 Professur für Internistische Rheumatologie, Osteologie, Physikalische Medizin, Universität Gießen,
Abteilung für Rheumatologie und Klinische Immunologie, Kerckhoff-Klinik, Bad Nauheim2 Lehrstuhl für Innere Medizin, mit Schwerpunkt Rheumatologie, Justus-Liebig-Universität Giessen,
Abteilung für Rheumatologie und Klinische Immunologie, Kerckhoff-Klinik, Bad Nauheim 3 Klinik für Innere Medizin I, Klinikum Lüdenscheid
Ambulante Physiotherapie bei OsteoporoseUnzureichende Evidenz des Therapieerfolges
Die physikalische Medizin mit ihren ele-mentaren Reizen ist im Praxisalltag bei zahlreichen Erkrankungen am Bewe-gungssystem – aufgrund von Progre-dienz, Funktionsdefiziten und Schmer-zen – unentbehrlich. Multimodale Thera-piekonzepte ohne physikalische Behand-lungsformen sind stets inkomplett, da die-se Therapieform durch nichts ersetzt wer-den kann und teilweise Priorität vor einer Pharmakotherapie hat [1, 2].
Im akutstationären wie auch rehabilita-tiven Bereich existieren Kontrollmechanis-men, u. a. durch Visiten, für den differen-zialindikativen Einsatz diverser Physiothe-rapeutika. Dieser Aspekt ist von elemen-tarer Bedeutung, da physikalische Thera-piemaßnahmen keineswegs ein einfaches Adjuvans darstellen. Sie benötigen, wie an-dere Therapieformen auch, eine sorgfälti-ge Überwachung, da sie als eigenständi-ge Behandlungsformen eigenen Indika-tionen und Kontraindikationen unterlie-gen. Zudem sind physikalisch-therapeuti-sche Maßnahmen primär nicht entlastend, serielle Applikationen benötigen inter-ponierte Behandlungspausen, und der Therapieerfolg ist von der richtigen Wahl der Therapieformen und krankheitsspezi-fischen Durchführungskriterien abhängig sowie von einem individuell an den Be-handlungsfortschritt angepassten Thera-pieplan [1, 2]. Unabdingbare Vorausset-zung hierzu ist eine Kommunikation zwi-schen Arzt, Therapeut und Patient.
Im ambulanten Bereich stellt sich diese notwendige Kommunikation oft schwie-
rig dar, und bis heute existieren hierzu keine verlässlichen Daten. Diese Situation könnte zukünftig einen Dissens zwischen dem Arzt und dem ambulanten Physio-therapeuten oder auch gegenüber den Pa-tienten herbeiführen.
In Anlehnung an eine kürzlich durch-geführte Studie, die eine insuffiziente Ko-operation zwischen dem Physiotherapeu-ten und dem behandelnden Arzt bei Heil-mittelverordnungen mit Indikationen auf orthopädischem und unfallchirurgischem Gebiet aufzeigte [3], galt das Interesse der vorliegenden Studie Patienten mit vorlie-gender Osteoporose und folgenden Fra-genstellungen:1. Wie oft haben Sie in den letzten
12 Monaten eine ambulante physikali-sche Therapieverordnung erhalten?
2. Wie häufig war die Therapieberichts-quote, die explizit schriftlich bei allen Verordnungen angefordert wurde?
3. Wurden die verordneten Maßnahmen auch so umgesetzt oder geändert? Er-folgte bei einer Änderung auch eine Rücksprache mit dem verordnenden Arzt?
4. Wurden die Patienten bei aktiven Verordnungsmaßnahmen zur Selbst-therapie angeleitet?
5. Wie oft wurden Folgeverordnungen angefordert?
6. Kam es unter den ambulanten Ver-ordnungen zu Komplikationen?
7. Lässt sich der Erfolg der ambulanten physikalischen Maßnahmen im Rah-men der bestehenden Kooperation
zwischen Arzt und Physiotherapeut suffizient beurteilen?
Methodik
Es wurde eine prospektive Analyse von 475 ambulanten Verordnungen bei ge-setzlich kassenversicherten Patien-ten aus der osteologischen Ambulanz-sprechstunde mit überregionalem Ein-zugsgebiet im Jahr 2010 bezüglich der verpflichtend und bei allen 475 Verord-nungen explizit schriftlich angeforderten Therapieberichte (Rückmeldungsquote), dem Informationsgehalt der Therapiebe-richte sowie der laut Patienten durchge-führten Therapiemaßnahmen durchge-führt. Im Verordnungszeitraum wurden die Heilmittelverordnungen mit einer maximalen Therapiedauer von 3 Wo-chen ausgestellt (insgesamt 6 Verord-nungen, 2 davon pro Woche). Somit war sichergestellt, dass die letzte Verordnung am 31.12.2010 ausgestellt wurde und in-nerhalb der nächsten 2 Wochen initi-iert werden musste, so dass bis Ende des 1. Quartals im Jahr 2011 alle Therapiebe-richte gesammelt wurden.
Alle Patienten, die eine Heilmittelver-ordnung erhielten, wurden nach den Ver-ordnungen ambulant wieder einbestellt. Dabei galt die Evaluation der Beurtei-lung des Behandlungserfolges, welche Art der Behandlung durchgeführt wur-de, der Verträglichkeit und aktiven Maß-nahmen im Hinblick auf die Fähigkeit zur Demonstration von Eigenübungen, um so
RedaktionU. Müller-Ladner, Bad Nauheim U. Lange, Bad Nauheim
319Zeitschrift für Rheumatologie 4 · 2012 |
Originalien

die Effizienz der verordneten Therapie zu überprüfen.
Die Berechnung der Rückmeldungs-quote erfolgte anhand der Menge an ein-gegangenen Therapierückmeldungen be-zogen auf die Gesamtverordnungen. Zu-dem wurde die schriftliche Nachforde-rungsquote an Heilmittelverordnungen auf den Rückmeldeformularen erfasst. In Anlehnung an Goebel u. Schulz [3] wurde eine zusätzliche Beurteilung der Qualität der rückläufigen Therapieberichte in fol-gende Kategorien vorgenommen:1. ausführlich mit hilfreichen Zusatz-
informationen (z. B. Besserung oder Verschlechterung der Situation durch die ambulante Intervention; Verträg-lichkeit der Verordnung, Koopera-tion des Patienten, Möglichkeiten der Eigentherapie des Patienten; Vor-schläge mit Begründung zur Thera-pieänderungen usw.),
2. Bericht ohne Information über den Behandlungsverlauf während der Therapie,
3. Bericht mit Wunsch der Therapieän-derung im Sinne einer passiven Be-handlung des Patienten ohne weitere Begründung,
4. Bericht mit Therapieänderung im Sinne einer mehr aktiven Mitarbeit des Patienten.
Eventuelle Komplikationen der differen-zialindikativen Verordnung wurden bei den Wiedervorstellungen oder im Rah-men einer telefonischen Rückmeldung erfasst. Nicht als Komplikationen wur-den ein „Nichtansprechen“ der Verord-nungen oder eine „kontinuierliche“ Be-schwerdeverschlimmerung gewertet. Ge-wertet wurde dagegen ein akutes, in direk-tem Zusammenhang mit der physiothera-peutischen Intervention stehendes Ereig-nis oder eine denkbare Reaktion auf die Maßnahmen (z. B. denkbare Verbrennun-gen im Rahmen einer elektrotherapeuti-schen Verordnung, Allergien im Rahmen einer Iontophorese usw.).
Resultate
Es wurden im Beobachtungszeitraum 475 ambulante Verordnungen durch-geführt, wobei 87% der Patienten anga-ben, in den letzten 12 Monaten keine am-bulanten Heilmittelverordnungen erhal-ten zu haben. Von den 475 durchgeführ-ten ambulanten Verordnungen gingen im Beobachtungszeitraum 46 Rückmeldun-gen (9,7%) ein (. Tab. 1). Je nach Ver-ordnung schwankte die Rückmeldequote deutlich: Krankengymnastik (KG; 20,4%), KG mit Gerät (9,1%), KG im Unterwasser-bewegungsbad (14,3%), manuelle Thera-
pie (22,2%), Elektrotherapie (20%), Wär-metherapie (12,8%) und klassische Mas-sage (6,8%). Bei 38 Rückmeldungen wur-den im Therapiebericht Folgeverordnun-gen empfohlen (82,6%). Bei den 141 Ver-ordnungen zur Übungstherapie konnten nur 38 Patienten (27%) diese Übungen adäquat demonstrieren oder mündlich formulieren. Von den 46 Rückmeldun-gen waren 4 mit hilfreichen Zusatzinfor-mationen für den verordnenden Arzt ver-sehen (. Abb. 1), die meisten Rückmel-dungen erfolgten jedoch ohne Zusatz-informationen (. Abb. 2). Die Beurtei-lung der 46 Therapieberichte in den ge-nannten Kategorien ist in . Tab. 2 dar-gestellt.
An Komplikationen während der phy-siotherapeutischen Behandlung wurden bei der Wiedervorstellung von den Pa-tienten 4-mal allgemeines Unwohlsein und 3-mal Druckgefühl im Bereich der Wirbelsäule angegeben. Zwei Patienten berichteten über Symptome einer Wir-belkörperfraktur, die während des The-rapiezeitraumes auftraten, ohne dass dies dem Arzt von Therapeutenseite aus mit-geteilt wurde.
Bei den insgesamt 141 verordneten Übungstherapien wurden nach Anga-be der Patienten diese in 31 Fällen (22%) nicht durchgeführt, sondern stattdessen passive Behandlungen appliziert (Elekt-rotherapie, Packungen/Rotlicht, Massa-ge), ohne dass eine Rücksprache mit dem Arzt erfolgte.
Diskussion
Die Osteoporose wurde durch die Weltge-sundheitsorganisation (WHO) in die Lis-te der 10 häufigsten Erkrankungen aufge-nommen. Bei manifester Osteoporose mit vertebralen und/oder extravertebralen Frakturen stehen Schmerzen im Vorder-grund des Krankheitserlebens und – ent-sprechend der internationalen Klassifika-tion der Funktionsfähigkeit und Behinde-rung (ICF) der WHO – Einschränkungen der Aktivitäten im täglichen Leben sowie der Teilhabe am sozialen und gesellschaft-lichen Leben [4]. Schmerzen und Funk-tionsstörungen am Bewegungssystem re-sultieren häufig in Behinderungen mit konsekutiver Krankheitslast für die Be-troffenen. Folglich kommt es zu weit rei-
Tab. 1 Ärztliche Verordnungen und die schriftliche Rückmeldungsquote in Form eines Therapieberichts durch den Physiotherapeuten in Abhängigkeit vom Physiotherapeutikum
Verordnungsart Verordnungsanzahl Rückmeldungen Quote (%)
Klassische Massage 132 9 6,8
Wärmetherapie (Fango/Rotlicht) 148 19 12,8
Krankengymnastik (einzeln) 98 20 20,4
Krankengymnastik mit Gerät 22 2 9,1
Krankengymnastik im Unterwasser-bewegungsbad
21 3 14,3
Manuelle Therapie 9 2 22,2
Elektrotherapie 45 9 20Gesamtverordnungen (Mehrfachnennungen aufgeführt): 475, nur in 46 Fällen erfolgte die verpflichtende und angeforderte Therapieberichtsrückmeldung (9,7%).
Tab. 2 Qualität der Therapieberichte nach den Kategorien 1 bis 4
Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4
Anzahl Berichte (n=46) 4 38 3 1Kategorie 1: ausführlich mit hilfreichen Zusatzinformationen (z. B. Besserung oder Verschlechterung der Situation durch die ambulante Intervention; Verträglichkeit der Verordnung, Kooperation des Patienten, Mög-lichkeiten der Eigentherapie des Patienten; Vorschläge mit Begründung zur Therapieänderungen usw.), Kate-gorie 2: Bericht ohne Information über den Behandlungsverlauf während der Therapie, Kategorie 3: Bericht mit Wunsch der Therapieänderung im Sinne einer passiven Behandlung des Patienten ohne weitere Begründung, Kategorie 4: Bericht mit Therapieänderung im Sinne einer mehr aktiven Mitarbeit des Patienten.
320 | Zeitschrift für Rheumatologie 4 · 2012
Originalien

chenden ökonomischen Folgen sowohl für die Betroffenen als auch die Gesellschaft. Trotz steigender Behandlungsprävalenz mit zunehmendem Lebensalter und einer Fülle von medikamentös wirksamen Anti-Osteoporotika zeigt sich eine abnehmen-de Behandlungsprävalenz [5]. Dieser As-pekt verdeutlicht, dass neben der verbes-serungswürdigen medikamentösen The-rapie anderen Therapieverfahren, wie z. B. dem differenzialindikativen Einsatz phy-sikalisch-medizinischer Maßnahmen, ein unverändert hoher Stellenwert zukommt.
Hier sind jedoch die in den Bundes-ländern unterschiedlichen Rahmenbe-dingungen, wie die Heilmittelrichtlinien, und die geringen Richtgrößenvolumina für Heilmittelausgaben oft als ein limi-tierender Faktor zu sehen, die in den ver-gangenen Jahren oft keine bedarfsgerech-te Verordnung ermöglichten.
Für das Krankheitsbild der Osteo-porose existiert bis dato keine verlässliche Datenquelle, die Trends und Praxisva-riationen der Verordnungen in Deutsch-land widerspiegelt. Eine für die Rheuma-
tologen wichtige Datenquelle zur phy-sikalisch-medizinischen Verordnung in Deutschland stellt die Kerndokumenta-tion der regionalen Kooperativen Rheu-mazentren dar. Diese zeigt für die Jahre von 1994 bis 2004 beim Krankheitsbild der rheumatoiden Arthritis einen erheb-lichen Rückgang der ambulanten Verord-nungen im Mittel um 3–9% (für KG in der Gruppe, Bewegungsbad, Funktions-training, Ergotherapie, Massagen, Bäder, Packungen und Elektrotherapie), ledig-lich bei der Einzelkrankengymnastik er-
Z Rheumatol 2012 · 71:319–325 DOI 10.1007/s00393-012-0964-1© Springer-Verlag 2012
U. Lange · U. Müller-Ladner · J. Teichmann
Ambulante Physiotherapie bei Osteoporose. Unzureichende Evidenz des Therapieerfolges
ZusammenfassungStudienziel. Analysiert wurden anhand der Vorschriften der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung die existierende und explizit angeforderte Rückmeldungsquo-te, Kooperation und Verordnungstreue von ambulanten Physiotherapeuten gegenüber dem verordnenden Arzt im Bereich einer ambulanten osteologischen und rheumato-logischen Schwerpunktpraxis und die Frage nach der Beurteilbarkeit der Effizienz der je-weiligen Therapie.Methode. Hierzu wurden prospektiv 475 Heilmittelverordnungen in einem überregio-nalen Einzugsgebiet bezüglich der verpflich-tend angeforderten Therapieberichte (Rück-meldungsquote), dem Informationsgehalt der Therapieberichte sowie der laut Patien-ten durchgeführten Therapie beurteilt. Zudem
wurde die Quote angeforderter Folgeverord-nungen wie auch die Fähigkeit der Patienten, die zu erlernenden Übungen eigenständig durchzuführen, analysiert. Abschließend soll-te die Effizienz der Heilmittelverordnung be-urteilt werden.Ergebnisse. Es zeigte sich eine Rückmelde-quote von 9,7%. Je nach Heilmittelverordnung schwankte diese erheblich (von klassische Massage 6,8%, Wärmetherapie 12,8%, KG oh-ne oder mit Geräten oder im UWB 9,1–20,4% bis Elektrotherapie 20%). Selbsterlernte Übun-gen, die den Patienten bei den 141 verordne-ten Übungsbehandlungen zu vermitteln wa-ren, konnten lediglich von 38 (27%) adäquat demonstriert werden. Von den 46 Therapiebe-richten wurden vier mit hilfreichen Informatio-nen für den Arzt versehen. Bei 38 der 46 Rück-
meldungen (82,6%) wurden Folgeverordnun-gen empfohlen.Schlussfolgerungen. Die Daten belegen, dass im ambulanten Bereich keine suffizien-te Kooperation zwischen verordnendem Arzt und behandelndem Physiotherapeuten be-steht. Die geringe Rückmeldequote erschwert die valide Beurteilung der Effizienz der Heil-mittelverordnungen. Daher ist dringend – neben einer Verbesserung der Aus-, Fort- oder Weiterbildung – ein Kontrollmechanismus zur Verordnung von physikalischen Therapiemaß-nahmen zu implementieren.
SchlüsselwörterPhysikalische Therapie · Osteoporose · Heilmittelverordnung · Arzt-Therapeuten- Kooperation · Kontrollmechanismen
Physiotherapy in outpatients with osteoporosis. Insufficient evidence for therapy success
AbstractAim. This prospective study analyzed the quality and number of physiotherapeutic re-ports, the cooperation between physiothera-pists and rheumatologists/osteologists as well as the correctness of the physiotherapy in re-lation to the respective prescription within the German medical healthcare system. Further-more, it was evaluated whether reported in-formation is sufficient to evaluate outpatient physiotherapy.Method. In 475 physiotherapeutic prescrip-tions for conservative treatment of patients with osteoporosis, the report quality was eval-uated prospectively. The types of prescription and actually performed physiotherapy were compared. The ability of the patients to dem-onstrate the exercises, as had to be learned during therapy, was analyzed and also the
number of mandatory documented ques-tioned follow-up forms. Furthermore, the effi-ciency of different types of physiotherapy was evaluated.Results. Only 46 reports from 475 prescrip-tions were received, i.e., the obligation to re-port was performed only in 9.7% of the cas-es. Depending on the type of physiotherapy, there was a different range in reporting (clas-sical massage 6.8%, thermotherapy 12.8%, ac-tive muscle training with weights and resis-tant exercises or in water 9.1–20.4% and elec-trical field treatment 20%). In 141 prescrip-tions the patients should have learned to do the exercises by themselves as a home pro-gram. However, only 38 patients (27%) were able to demonstrate this at the reassessment appointment. In addition in 38 cases of the
46 reports, i.e. in 82.6%, the physiotherapist asked for another prescription.Conclusion. The data illustrate that for outpa-tient treatment of osteoporosis patients there is insufficient cooperation between physio-therapists and rheumatologists and/or oste-ologists. Owing to this shortcoming, the effi-ciency of physiotherapy could not be evaluat-ed due to lack of prescription reports. There-fore, new control mechanisms as well as suffi-cient education in prescription of physiothera-py should be implemented.
KeywordsPhysical therapy · Osteoporosis · Prescription · Physician-therapist cooperation · Control mechanisms
Zusammenfassung · Abstract
321Zeitschrift für Rheumatologie 4 · 2012 |



gab sich eine Zunahme um 5% [6]. Eine Befragung internistischer Rheumatologen ergab im Jahr 2007 eine weitere Reduk-tion von krankengymnastischen Verord-nungen [7] mit anhaltender Tendenz [8].
Die aktuelle nationale wie auch inter-nationale Literatur enthält keine Studie zur Beurteilbarkeit der Effektivität ambu-lanter physikalischer Therapiemaßnah-men bei Patienten mit Osteoporose. Die in dieser prospektiven Untersuchung ge-wonnen Resultate sind alarmierend und stimmen nachdenklich. Vor der ambulan-ten Verordnung gab ein Großteil der Pa-tienten (87%) an, in den letzten 12 Mona-ten keine ambulante Therapieverordnung erhalten zu haben, obwohl sie mehrfach bei Haus- und Fachärzten darum gebeten hatten. Als Begründung wurde meist an-gefügt, dass dafür kein Budget vorhanden sei. Dieses ärztliche Verordnungsverhal-ten passt durchaus zu den oben genann-ten Daten der rheumatologischen Kern-
dokumentation bei Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis. Kommt es hin-gegen zu ärztlichen Heilmittelverordnun-gen, zeigt sich in der durchgeführten Pro-spektivstudie eine defizitäre Kommunika-tion zwischen Arzt und Physiotherapeut. Eine verpflichtende und schriftlich bei al-len Verordnungen explizit angeforderte Rückmeldungsquote von nur 9,7% ist als Hauptkritikpunkt beim Kooperationsde-fizit aufzuführen, wobei eine „fehlende“ Erreichbarkeit des verordnenden Arz-tes nicht angeführt werden kann, da die Ambulanz täglich von 7:00 bis 17:00 Uhr geöffnet und telefonisch erreichbar war. Dieses Resultat verwundert, da sicher-lich eine suffiziente Rückmeldung an den Arzt potenzielle Zusatzargumente liefern könnte, weitere Verordnungen zu tätigen bzw. eine Praxisbudgetüberschreitung zu begründen. Beunruhigend ist auch der teilweise durchgeführte Wechsel von akti-ven Maßnahmen auf passive Formen oh-
ne Absprache mit dem Arzt. Nachdenk-lich stimmt, dass nach den Heilmittelver-ordnungen für Übungsbehandlungen nur bei 26,9% der Patienten die Fähigkeit be-stand, die Trainingsübungen eigenständig fortzuführen. Die Gründe hierfür können einerseits darin gesehen werden, dass es den Physiotherapeuten nicht gelang, die Patienten zur aktiven Mitarbeit zu moti-vieren, oder basiert auf einer mangelhaf-ten Patientencompliance.
Bei 38 Therapieberichtsrückmeldun-gen wurde von Seiten des Physiothera-peuten zur Fortführung der Heilmittel-verordnung geraten. Dabei wurde 36-mal lediglich auf dem Formularvordruck das Kreuz unter „Ja“ bei Fortsetzung der Therapie gesetzt und nur 2-mal erfolg-te eine Begründung. Bei diesem Vorge-hen fragt man sich, ob im Sinne des „Pa-tienten“ gehandelt wurde oder eventu-ell aus finanziellen Aspekten (Honorie-rungsgründe).
Abb. 2 8 Beispiel für einen Therapiebericht ohne Informationswert für den Arzt (Kategorie 2)
Abb. 1 8 Beispiel für einen ausführlichen und hilfreichen Therapiebericht (Kategorie 1)
324 | Zeitschrift für Rheumatologie 4 · 2012
Originalien

Abschließend ist zu konstatieren, dass bei der ambulanten Verordnung bei Os-teoporosepatienten – ähnlich wie bei der ambulanten Heilmittelverordnung für or-thopädische/unfallchirurgische Patienten – die Ärzte aufgrund der geringen Rück-meldungsquote eine valide Ergebnisbe-urteilung nicht differenziert vornehmen können. Dies erscheint umso gravieren-der, wenn man bedenkt, dass die Verant-wortung für die Heilmittelverordnung beim Arzt liegt und die Verantwortung für die Durchführung beim Physiothera-peuten!
Erfreulicherweise traten unter der Durchführung der Heilmittelverordnung nur bei 9 Fällen Nebenwirkungen auf. In 2 Fällen kam es zu Symptomen einer neu-en Wirbelkörperfraktur, ohne dass dies dem verordnenden Arzt mitgeteilt wurde.
Die gewonnenen Daten untermau-ern die dringende Notwendigkeit einer verbesserungswürdigen Kommunika-tion zwischen Arzt und Physiotherapeut, denn, wie schon einleitend erwähnt, phy-siotherapeutische Maßnahmen sind kei-neswegs ein einfaches Adjuvans. Sie be-nötigen wie andere Therapieformen auch eine sorgfältige Überwachung und haben als eigenständige Behandlungsformen eigene Indikationen sowie Kontraindika-tionen und sind primär nicht entlastend. Es besteht im ambulanten Bereich drin-gend Optimierungsbedarf in Bezug auf die Kooperation und Absprache zwischen verordnendem Arzt und Physiotherapeu-ten, damit zukünftig die Heilmittelverord-nungen entsprechend beachtet und um-gesetzt werden und die Effizienz der Ver-ordnung optimal beurteilt werden kann.
Folgende Möglichkeiten würden sich als Kontrollmechanismen anbieten:1. verbindliche schriftliche Rückmel-
dung des Physiotherapeuten wie bis-her, allerdings erfolgt die finanziel-le Entlohnung durch die Kostenträger erst bei erbrachtem Nachweis,
2. eine an Therapieeinheiten gekoppel-te Absprache (hierdurch könnten u. a. Folgeverordnungen besser avisiert werden),
3. jede ambulante physikalische Thera-piepraxis benennt einen Arzt mit ent-sprechender Expertise als Koope-rationspartner, der die verordneten Maßnahmen aktiv bergleitet.
Hierdurch könnte eine kontinuierliche Kontrolle der Behandlungsverträglich-keit, der Belastungsanpassung an den Krankheitszustand der Patienten wie auch eine Optimierung der Kommunika-tion zwischen Arzt, Physiotherapeut und Patient erreicht werden.
Fazit für die Praxis
F Patienten mit Osteoporose beklagen, dass im ambulanten Bereich trotz er-heblicher Funktionseinschränkungen oft keine physikalisch-medizinischen Verordnungen durchgeführt werden.
F Möglicherweise spielen die regional differierenden Rahmenbedingungen, wie Heilmittelrichtgrößen und prak-tizierte Regressforderungen der Kas-senärztlichen Vereinigungen, aber auch die interindividuell verschiede-nen Verfahrensweisen der Ärzte bei Heilmittelverordnungen eine domi-nierende Rolle.
F Eine Verbesserung der bedarfsge-rechten Verordnung von Heilmittel-leistungen bei Osteoporose wie auch eine stärkere Ausschöpfung des ärzt-lichen Behandlungsspielraumes er-scheint vielfach notwendig.
F Die Kommunikation zwischen verord-nendem Arzt und durchführendem Physiotherapeuten ist im ambulanten Bereich dringend verbesserungsbe-dürftig. Nur so kann eine zeitnahe An-passung der Heilmittelverordnung an die aktuelle Patientensituation/das aktuelle Krankheitsstadium erfolgen.
F Ein ausführlicher und mit hilfreichen Zusatzinformationen versehener The-rapierückbericht bietet den Ärzten zu dem eigenen Befund potenzielle Zu-satzargumente bei der Verordnung und evtl. eine Begründung bei Praxis-budgetüberschreitungen.
F Im ambulanten Bereich wird durch die geringe Rückmeldungsquote die differenzierte ärztliche Ergebnisbe-urteilung der Heilmittelverordnun-gen erschwert.
F Um zukünftig Heilmittelverordnun-gen optimal gestalten zu können, sind fundierte Kenntnisse unabding-bar. Sie können über existierende Fort- und Weiterbildungskurse ge-
wonnen oder vertieft werden (u. a. Weiterbildungskurs Physikalische Me-dizin und Rehabilitation der Rheuma-Akademie, Kurse zur Zusatzbezeich-nung Physikalische Medizin und Bal-neologie oder die Tätigkeit in Kliniken mit physikalisch-medizinischen Ein-richtungen).
Korrespondenzadresse
Prof. Dr. U. LangeProfessur für Internistische Rheumatologie, Osteologie, Physikalische Medizin, Universität Gießen, Abteilung für Rheumatologie und Klinische Immunologie, Kerckhoff-KlinikBenekestr. 8, 61231 Bad [email protected]
Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Literatur
1. Lange U (2007) Grundlagen und allgemeine Wir-kungsweise der physikalischen Medizin. In: Uhle-mann C, Lange U, Seidel R (Hrsg) Grundwissen Re-habilitation, Physikalische Medizin, Naturheilver-fahren, 1. Aufl. Huber, Bern, S 71–74
2. Lange U, Uhlemann C, Berg W et al (2008) Diffe-renzialindikative Verordnung physikalischer Medi-zin in der Rheumatologie. In: Lange U (Hrsg) Phy-sikalische Medizin in der Rheumatologie unter Be-rücksichtigung evidenzbasierter Daten, 1. Aufl. Li-gatur, Stuttgart, S 41–56
3. Goebel D, Schultz W (2011) Ambulante Physiothe-rapie in Orthopädie und Unfallchirurgie: Kann der Erfolg überhaupt beurteilt werden? Z Orthop Un-fall 149:17–21
4. Braun J, Zochling J, Grill E et al (2007) Die Interna-tionale Klassifikation für Funktionsfähigkeit, Behin-derung und Gesundheit und ihre Bedeutung für die Rheumatologie. Z Rheumatol 66:603–610
5. Häussler B, Gothe H, Mangiapane S et al (2006) Versorgung von Osteoporose-Patienten in Deutschland: Ergebnisse der BoneEVA-Studie. Dtsch Arztebl 103:A2542–2548
6. Mau W (2008) Ambulante Verordnung von phy-sikalisch-medizinischen Maßnahmen bei Patien-ten mit rheumatoider Arthritis und ankylosieren-der Spondylitis aus der Sicht von Rheumatolo-gen und Betroffenen. In: Lange U (Hrsg) Physikali-sche Medizin in der Rheumatologie unter Berück-sichtigung evidenzbasierter Daten, 1. Aufl. Ligatur, Stuttgart, S 9–14
7. Mau W, Müller A (2008) Rehabilitative und ambu-lante physikalisch-medizinische Versorgung von Rheumakranken. Ergebnisse der Befragung von Patienten mit rheumatoider Arthritis oder anky-losierender Spondylitis und Rheumatologen. Z Rheumatol 67:542–553
8. Mau W, Müller A (2010) Stand der ambulanten Ver-sorgung mit physikalisch-medizinischen Leistun-gen und Ergotherapie bei Rheumakranken. arthri-tis + rheuma 6:305–312
325Zeitschrift für Rheumatologie 4 · 2012 |





![SB OSTEOPOROSIS DEreviewed.ppt [Schreibgeschützt] - DE.pdf · Epidemiologie der Osteoporose • Anzeichen für Osteoporose sind die Verminderung der Knochenmasse und Spontanfrakturen](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5d5c6dd588c993f93e8bc5fb/sb-osteoporosis-schreibgeschuetzt-depdf-epidemiologie-der-osteoporose-.jpg)