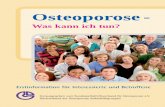auf #05 – Was tun? Was tun! Wie Wissenschaft wirkt.
-
Upload
zeppelin-universitaet -
Category
Documents
-
view
241 -
download
19
description
Transcript of auf #05 – Was tun? Was tun! Wie Wissenschaft wirkt.

Wie Wissenschc aa wiww rkr tWWWiiiiieee e e WWWiiiiisssssssssseeeeennnnnsssssccccchhcccchhhaacchhhaaaaaaaa wwwiiwwwwiiirrwwiiiirrrkkrrrkkkttkkkkrrkkktttktttt
Medium für Zwischenfragen der Zeppelin Universität

Unsere Sensor ik-Produkte s ind gekenn-zeichnet durch e ine hohe Innovat ionskraf t und e ine e inz igar t ige Fer t igungst ie fe.
Unsere Stärke s ind unsere gut 500 Mi tar-bei ter innen und Mi tarbei ter, von denen uns 94% als Arbei tgeber wei terempfehlen würden (Studie „Great Place to Work® 2012“) .
Unser Credo. Neben dem wir tschaf t l i chen Er fo lg fühlen wir uns sehr der Region und der Umwel t verpf l i chtet . Das bedeutet für uns , dass wir ausschl ießl ich in Deutsch-land produzieren – und das kl imaneutra l : www.elobau.com
07561 970-0 07561 970-100
GmbH & Co. KG Zeppel instr. 44 88299 Leutki rch
– E in Par tner der Zeppel in Univers i tä t und Förderer e ines Studienplatzes

Unsere Sensor ik-Produkte s ind gekenn-zeichnet durch e ine hohe Innovat ionskraf t und e ine e inz igar t ige Fer t igungst ie fe.
Unsere Stärke s ind unsere gut 500 Mi tar-bei ter innen und Mi tarbei ter, von denen uns 94% als Arbei tgeber wei terempfehlen würden (Studie „Great Place to Work® 2012“) .
Unser Credo. Neben dem wir tschaf t l i chen Er fo lg fühlen wir uns sehr der Region und der Umwel t verpf l i chtet . Das bedeutet für uns , dass wir ausschl ießl ich in Deutsch-land produzieren – und das kl imaneutra l : www.elobau.com
07561 970-0 07561 970-100
GmbH & Co. KG Zeppel instr. 44 88299 Leutki rch
– E in Par tner der Zeppel in Univers i tä t und Förderer e ines Studienplatzes
04-08 Noch die sicherste Bank ist ein unsicheres Geschäft Dirk Baecker üBer Die Ursachen Der Finanzkrise
10-13 Vier Hochzeiten und drei Todesfälle stephan a. Jansen zU FUsionen UnD üBernahmen UnD ihre Folgen
14-16 Warum die Stasi die Wirtschaft bis heute schwächt interview mit marcel tyrell üBer zerstörtes vertraUenskapital UnD Dessen langzeitschäDen
18-19 Bundesbürger wissen nur wenig über Wirtschaft peter kenning, inga woBker & mirJa hUBert üBer minimales wirtschaFtswissen UnD Die konseqUenzen Für verBraUcher
20-27 Kerzen, Konsum und Kapitalismus nico stehr & marian aDolF üBer Die moralisierUng Der märkte UnD Deren aUswirkUng Für wirtschaFt UnD gesellschaFt
29-32 Weshalb Zeitungen zuverlässig überraschen müssen interview mit klaUs schönBach üBer Die zeitUngskrise UnD erFolgsFaktoren Für reDaktionen UnD verlage
34-37 Konzert und Oper brauchen eine Verjüngungskur martin trönDle & markUs rhomBerg zUr krise im kUltUrBetrieB UnD Deren verDrängUng
38-39 Der Hang zum Überhang Joachim Behnke üBer Die notwenDigkeit eines neUen wahlrechts
42-45 Die vielen Schlaglöcher der Verkehrspolitik interview mit alexanDer eisenkopF üBer versäUmnisse Der vergangenheit UnD aUFgaBen Für Die zUkUnFt
46-47 Warum der Weg zum Ziel mit Steinen gepflastert ist anJa achtziger üBer gUte vorsätze – warUm sie oFt scheitern, wie sie gelingen
48-49 zuzehn Das zehnJährige Bestehen Der zeppelin Universität
50-53 Was zu tun war und was zu tun bleibt höhepUnkte Des FrühJahrssemesters
54-55 auf und ZU Das „meDiUm Für zwischenFragen“ UnD seine themen
56 Impressum macher UnD ansprechpartner
Was tun? Was tun!

Zur künstlerischen Intervention von Patricia Reed
Wie wirkt Wissenschaft? fragt das aktuelle auf-Maga-zin. Ein Kompendium aus den zehn einflussreichsten Forschungsbeiträgen von ZU-ProfessorInnen. Die in Berlin lebende Künstlerin Patricia Reed (*1977, Otta-wa) hat sich aus ihrer Perspektive mit den Bedingun-gen und Folgen befasst und ihre Beobachtungen in grafische und visuelle Formen übersetzt.
Quellen. Zu jedem Artikel suchte sie den ursprüngli-chen Erscheinungsort auf und unterlegte das frühere Layout als farbige Grafik dem aktuellen Magazinbei-trag. Mit dieser Reminiszenz führt Reed in die Artikel ein. Jeder Beitrag schwebt so rekontextualisiert über seinem eigenen Schatten und reflektiert die Wichtig-keit des Zitiert- und Publiziertwerdens für den Ein-fluss von wissenschaftlichem Material.
Diagramme. Den Beiträgen ordnet Patrica Reed korre-spondierende Diagramme zu und greift damit eine Darstellungsform auf, wissenschaftliche Aktivitäten einem nichtfachkundigen Publikum leicht verständ-lich zu machen. Ihre Zeichnungen sind Vermittlun-gen der Inhalte und zugleich höchst subjektive Inter-pretationen.
Interferenzen. Auf der Titelseite sowie zwei Doppel-seiten spielt Patricia Reed mit Interferenzmustern. Hier wird die Überlagerung von Wellenlinien zum Bild dafür, wie sich Bezugssysteme, mit denen wir die Welt reflektieren und unsere Umgebung verarbeiten, durch die Wirksamkeit von neuem wissenschaftli-chem Wissen verändern. Bisherige Wahrnehmungs-muster werden zerstört, und es entsteht eine neue
„Linse“ zur Beobachtung von Natur oder Gesellschaft.
Farbwellen. Auch mit dem kontinuierlichen Farbverlauf, der sich als Hintergrund durch alle Seiten zieht, kommt die Kategorie Zeit ins Spiel. Zeit ist hier in eine Farbska-la übersetzt, welche auf das Zeitspektrum der ZU und ihrer Forschung anspielt. Der Zeitraum erscheint als farbige Welle, welche in ihrer Bewegung zwischen den Farbpolen dem Magazin eine Richtung verleiht.
Ulrike ShepherdKuratorin am artsprogram der Zeppelin Universität

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Justus von Liebig hatte natürlich recht. Wir auch! Und von Heimwerkermärkten wissen wir: Es gibt immer was zu tun!
In dieser 5. Jubiläumsausgabe von auf zum 10. Geburtstag der Zeppelin Universität und im Sinne der aktuellen Mittelfrist-Strategie der ZU als zivilgesellschaftlicher Akteur für soziale Innovationen geht alles ums Tun, um die wissenschaftliche Wirksamkeit für Ge-sellschaft. Zehn wirkungsmächtige, erfolgreiche, also folgenreiche Beiträge aus zehn Jahren Forschung.
Wir fragen nochmals nach: Was war nach der Forschung anders? Welche Diskurse in der Wissenschaft und welche Reaktionen in der Praxis wurden provoziert, also hervorgerufen?
„Was tun?“ fragte sich auch schon vor genau 150 Jahren der russische Schriftsteller Nikolai Gawrilowitsch Tschernyschewski in seinem gleichnamigen Roman. Darin geht er der Frage nach, wie idealistische Menschen die Welt im Kleinen verändern können. Die dar-in entwickelten Gedanken bewegten einen anderen Russen so sehr, dass er zu Ehren Tschernyschewskis sein Hauptwerk ebenso „Was tun?“ nannte: Wladimir Iljitsch Ulja-now, genannt Lenin.
Was ist zu tun angesichts einer Finanz- und Wirtschaftskrise und der einhergehenden auch politischen Krise? Was ist zu tun, wenn sich Märkte moralisieren? Was ist zu tun, wenn Tageszeitungen ihre Form suchen? Und was ist zu tun, damit Wahlen auch wieder den tatsächlichen Wählerwillen spiegeln? Wohl so einiges, aber lesen Sie selbst!
Wie immer ist die ZU und auf bei diesem Tun auf die Künste angewiesen: Die Berliner Künstlerin Patricia Reed zeigt ihre künstlerischen Interventionen und Interferenzen zu diesen Forschungstaten.
Und wer wissen will, was sich an der ZU getan hat: Einen kurzen Überblick über die High-lights der Universitätsentwicklung finden Sie natürlich auch.
Wir wünschen auch Ihnen viel zu tun und natürlich viel Vergnügen bei der Lektüre.Tatkräftige und wirkungsvolle Grüße vom Bodensee
Ihr Stephan A. JansenPräsident der Zeppelin Universität
„Die Wissenschaft fängt eigentlich erst da an, interessant zu werden, wo sie aufhört.“JUstUs von lieBig, „chemische BrieFe“, 1858
„Die Wissenschaft fängt eigentlich erst da an, interessant zu werden,wo sie anfängt zu wirken.“zeppelin Universität, strategie, 2013

2008
4
Am 15. September 2008 ging in den USA mit Lehman Brothers eine der größten Investmentbanken der Welt in die Pleite und löste die größte globale Finanz- und Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit aus. Grund waren gigantische Fehlspekulationen auf dem Immobilienmarkt und windige Finanzprodukte. Die Pleite erschütterte auch das Vertrauen in eine gesamte Industrie – die Geldinstitute. Grund genug zu der Frage, die Dirk Baecker nur drei Monate später in der Neuauflage seines gleichnamigen Buch stellte: „Womit handeln Banken?“. Und er kommt zu dem Schluss: „Noch die sicherste Bank ist ein unsicheres Geschäft.“
Noch die sicherste Bank ist ein unsicheres Geschäft 1
Professor Dr. Dirk Baecker, Lehrstuhl für Kulturtheorie und -analyse
Die Theorie, mit der dieses Buch arbeitet, fand damals und findet seither weder in der ökonomischen Theorie noch in der Praxis der Ban-ker Resonanz. Die Annah-me einer Autopoiesis der Wirtschaft, zu der die Au-
topoiesis der Organisation von Banken quer steht, widerspricht Kongruenzerwartungen, die davon aus-gehen, dass Banken wie auch andere Unternehmen letztlich nichts anderes tun, als entweder nach allen Regeln der Verantwortung die Vernunft der Wirtschaft nur zu exekutieren, das ist die optimistische Variante, oder nach allen Regeln des Gewinnstrebens die Mög-lichkeiten der Wirtschaft nur auszubeuten, das ist die pessimistische Variante.

2008
5
Sie stellen fest, dass Ihre Studie keine Resonanz in ökonomi-scher Theorie und bei Bankern gefunden hat. Welche Erklärung haben Sie dafür? „Die Banker dürfen nicht zugeben, dass sie die Risiken aktiv produzieren, die sie dann zu beherrschen versuchen. Und die ökonomische Theorie verfügt, trotz Arrow, über kein Kon-zept selbstreferentiell riskanter Entscheidungen.“ dirk baecker
_1 Aus dem Vorwort zur Neuauflage von: Baecker, Dirk (2008): Womit handeln Banken? Eine Stu-die zur Risikoverarbeitung in der Wirtschaft, mit einem Vorwort von Niklas Luhmann, Berlin: Suhrkamp.
Welche Bedeutung hat die doppelte Selbstreferenz?
Die Annahme der Autopoiesis, die ursprünglich von Humberto R. Ma-turana und Francisco J. Varela für die Erklärung des Lebens entwi-ckelt worden war und von Niklas Luhmann in die Soziologie impor-tiert worden ist, läuft darauf hin-aus, Systeme als ebenso blind wie raffiniert beschreiben zu können. Autopoiesis heißt, dass diese Sys-teme die Elemente, aus denen sie bestehen, im Netzwerk der Ele-mente, aus denen sie bestehen, aus den Elementen herstellen, aus denen sie bestehen. Man be-achte die doppelte und dennoch durch das Netzwerk gebrochene Selbstreferenz. Diese gebrochene Selbstreferenz zwingt die Syste-me, nach Irritationen zu suchen
– Hunger im Fall des Lebens, Zah-lungsunfähigkeit im Fall der Wirtschaft, Illiquiditä-ten im Fall der Banken – die es erlauben, sich auch dann zu reproduzieren, wenn man nur die Informa-tionen hat, die man selber produziert. Einen Input an Informationen gibt es in dieser Theorie nicht. Das macht sie so realistisch. Niemand kann aus seiner Haut heraus, so wenig man mit seinem Bewusstsein die Außenwelt erreichen kann. Man kann nur über sie nachdenken und benötigt dazu eigene Gedanken. So re-agiert auch die Wirtschaft au-topoietisch, sich selber hervor-bringend, nur auf Zahlungen im Netzwerk von Zahlungen, immer wieder neu stimuliert durch die mitlaufende Beob-achtung der Möglichkeit von Zahlungsunfähigkeit. Und so reagieren auch Banken nur auf Zahlungsversprechen, eigene und fremde, im Netzwerk von Zahlungsversprechen, immer wieder neu stimuliert durch die mitlaufende Beobachtung des Risikos, dass die Zahlungsverspre-chen, die eigenen und die fremden (Passiva und Ak-tiva), nicht gehalten werden können.
Gibt es eine wechselseitige Logik von Zahlungs- und Entscheidungsdynamiken? Jeder Realismus unter den Beobachtern der Wirtschaft kann sich zwar viel darauf einbilden, den eingangs genannten Optimismus und Pessimismus für zwei Varianten Desselben zu halten, aber damit wird die eigentliche Pointe verschenkt, die darin besteht, zwi-
schen den Zahlungsdynamiken der Wirtschaft auf der einen Seite und der Entscheidungsdynamik in Banken und Unternehmen auf der anderen Seite eine im besten Sinne wechselseitig parasitäre Logik zu unterstellen, die eine messerscharf kluge Ausbeutung von Nischenoptionen mit Blindheit für alles Andere und alles Weitere kombiniert. Die von Banken ange-botenen Kredithebel werden von Unternehmen und Anlegern auf eine Art und Weise mit Investitionsbe-reitschaft und Liquiditätsofferten beantwortet, die

2008
6
Welche Konsequenzen hat der Zeitfaktor?
Die Konsequenz dieser expliziten Berücksichtigung des Zeitfaktors ist ebenso schlicht wie weitreichend. Eben-so wie jeder Konsument, jeder Arbeiter und jedes Un-ternehmen bekommt auch die Bank eine aktive Rolle in der Produktion ihrer Vermögensrisiken zugeschrie-ben. Risiken, das war der Vorschlag von Niklas Luh-mann, den ich in dieser Studie aufgreife, sind keine unangenehmen Begleitumstände der unsicheren Welt, wie sie ist, sondern das Ergebnis der Entscheidung von wirtschaftenden Akteuren. Wenn eine Bank keine Einlagen annehmen würde, stünde sie nicht vor dem Risiko eines Runs auf die Bank, falls sich herumspricht, dass sie nicht mehr zahlungsfähig ist. Noch William Bagehot konnte sich nicht genug darüber wundern, dass immer wieder Leute bereit sind, ihr Geld auf eine Bank zu tragen. Und wenn eine Bank keine Kredite vergeben würde, stünde sie nicht vor dem Risiko, dass der Kreditnehmer das Geld verschleudert oder es ihm gelingt, sich abzusetzen. Das passiert im Übrigen auch im Normalgeschäft oft genug und wurde früher durch hinreichend satte Margen, als diese angesichts man-gelnder Alternativen auf dem Kapitalmarkt noch durchgesetzt werden konnten, und wird heute durch rechtzeitige Verbriefung und Weiterverkauf des zwei-felhaften Kredits aufgefangen.
Nur wenn man sich diese Produktion von Risiken durch das ganz alltägliche Bankgeschäft vor Augen hält, wird auch deutlich, wie attraktiv es für eine Bank sein muss, sich statt eigener Risiken auf die Produktion von Risi-ken für Kunden zu kaprizieren und diesen gegen ergeb-nisunabhängige Kommissionen Vermögensanlage-chancen zu verkaufen. Allerdings geht auch das nicht risikolos, weil man sich jetzt darauf konzentrieren muss, Kunden dafür zu finden, dass man die angeblich bes-seren Vermögensanlagechancen zu bieten hat als die Konkurrenz. Unter Umständen setzt man dann Ver-sprechungen in die Welt, die man nicht rechtzeitig und unauffällig genug korrigieren kann, falls sich andere als die erwarteten Entwicklungen einstellen.
Unterliegt man bei Banken einer Selbsttäuschung?
Das Buch wirbt dafür, die Beobachtung, strategische Reflexion und Überwachung der Geschäftspolitik einer Bank von der Unterscheidung zwischen Risiko und Sicherheit auf die Unterscheidung zwischen Risiko und Gefahr umzustellen. Solange man in Bankgeschäften unterstellt, man könne sich auf einer sicheren Seite bewegen, unterliegt man einer Selbst- und/oder Fremdtäuschung, die ironischerweise auch dann noch vorliegt, wenn man suggeriert, man könne sich mit Sicherheit für eine bestimmte Risikopräferenz ent-scheiden, um etwa hohe Risiken für hohe Gewinnaus-
sich für die Banken in die Beobachtung eines Marktes übersetzt, von dem man nicht mehr in Rechnung stellt, dass man ihn selbst geschaffen hat.
Die Herausforderung für die Theorie der Wirtschaft besteht angesichts dieser nur noch ökologischen, das heißt nischennachbarschaftlichen Dynamik, der kei-ne übergeordnete Vernunft zu Hilfe eilt, darin, nicht einfach auf die Annahme einer Abkopplung der „Sym-bolökonomie“ von der „Realökonomie“ umzustellen. Man kennt nicht zuletzt aus der jüngst so beliebt ge-wordenen Hirnforschung genug Beispiele, in denen die Fluktuationen, die Turbulenzen und die Volatilität eines Systems nicht etwa für die Verselbständigung bloß imaginärer Operationen sprechen, sondern für die Probleme der Bearbeitung eines höchst realen Strukturübergangs. Verwirrung und Blasen positiver Rückkopplung sind Formen, in denen komplexe Sys-teme ihre Reproduktion strukturieren, wenn diese auf lineare Weise nicht mehr möglich ist. In dieser Situa-tion hilft es deswegen nicht weiter, sich auf den an-geblich so gesunden Menschenverstand zu verlassen und das System durch Maßnahmen welcher Art auch immer wieder in die Linearität zurück zu zwingen.
Was heißt eigentlich Wirtschaften?
Der Ausgangspunkt der Theorie der Wirtschaft, mit der das Buch arbeitet, ist die Annahme, dass die Wirt-schaft sich in der Gesellschaft nicht darin erschöpft, mit dem Problem der Knappheit der Ressourcen an-gesichts der unendlichen Bedürfnisse der Menschen einigermaßen effizient umzugehen und durch Ge-winnsignale dafür zu sorgen, dass unsere Arbeit dort investiert wird, wo am ehesten Kundenwünsche zu befriedigen sind. Vielmehr wird die eigentliche Leis-tung (und Blindheit) der Wirtschaft erst dann deut-lich, wenn man zusätzlich den Zeitfaktor berücksich-tigt und in Rechnung stellt, dass Wirtschaften darin besteht, für zukünftige Möglichkeiten der Bedürfnis-befriedigung jetzt schon Vorsorge zu treffen, und dies paradoxerweise dadurch, dass man jetzt auf die Be-friedigung von Bedürfnissen verzichtet. Wirtschaften heißt, Bedürfnisaufschub in Vermögensaufbau um-zusetzen, entweder indem man spart oder indem man arbeitet. Nur wenn man diesen Zeitfaktor be-rücksichtigt, wofür von Xenophon bis Carl Menger, John Maynard Keynes und G.L.S. Shackle immer wie-der kluge Ökonomen geworben haben, versteht man die dem Wirtschaften zwangsläufig inhärente Unge-wissheit. Und nur wenn man diese Ungewissheit versteht, versteht man, was es heißt, wenn im Buch im Anschluss an Maurice Allais davon gesprochen wird, dass Banken mit Versprechen, genauer: mit Zah-lungsversprechen, handeln. Noch die sicherste Bank ist ein unsicheres Geschäft.

2008
7
_Mehr vom Autor unter zu.de/baecker
sichten und niedrige Risiken für geringe Gewinnaus-sichten einzugehen. Sobald man auf die Unterschei-dung zwischen Risiko und Gefahr umstellt, macht man sich und anderen deutlich, dass es Sicherheit zum einen nicht gibt und man zum anderen die Risiken selbst produziert, auf die man sich einlässt, und dass es genau deswegen darauf ankommt, sie zu struktu-rieren und zu überwachen. In der Praxis des Bankge-schäfts ist dies selbstverständlich, in der strategischen Reflexion, in Verkaufsgesprächen mit den Kunden, im Design der Instrumente des Risikomanagements und in der Diskussion mit Aufsichtsorganen jedoch nicht.
Es fehlt der Rückbezug des Risikos auf die eigene Ent-scheidung. Läge dieser Rückbezug vor, könnte man die Strukturierung des Risikos durch die Auswahl geeig-neter Geschäftspartner, durch die Absicherung in Haf-tungsfragen und Vermögenswerten, durch die Garan-tie von Korrekturen und Rückzugsmöglichkeiten sowie durch die gleichzeitige Einnahme von Gegenpositio-
nen (Hedging) als das beschreiben, was sie tatsächlich ist: eine Form des Umgangs mit den Gefahren wirt-schaftlichen Handelns, die daraus entstehen, dass niemand weiß, was gespielt wird, und man daher laufend mit unliebsamen Überraschungen rechnen muss, die sowohl auf gesellschaftliche als auch auf natürliche Umstände und nicht zuletzt auf deren Kom-bination zurückgerechnet werden können.
Welche Sicherheit gibt es überhaupt?
Die einzige Sicherheit, die in dieser Situation zu gewin-nen ist, besteht darin, dass man sich bewusst auf Risi-kostrukturen einlässt, die aus der Vernetzung hinrei-chend vieler Akteure bestehen, die in der Lage sind, die Teilrisiken, die sie eingehen, sowohl offen zu legen als auch zu verstehen und aus eigenen Mitteln zu beherr-schen. Das ist das Gegenteil dessen, was der gegenwär-tigen Finanzkrise, dem Anlass der Neuauflage des Buches, zugrunde liegt. Denn die gegenwärtige Malai-se ist daraus entstanden, dass man im großen Stil so-wohl Kreditnehmer im Hypothekengeschäft als auch

2008
8
Wo lassen Sie Ihr Geld? „Ich geb’s aus, das erscheint mir am sichersten. Und meine Familie hilft mir dabei.“ dirk baecker
Geldanleger im Interbankengeschäft gewonnen hat, die ihre Risiken weder verstanden haben noch aus eigenen Mitteln beherrschen können.
Für die Gefahren kann letztlich nur der Staat, das heißt der politisch kalkulierte Rückgriff auf die Zwangszah-lungen der Steuerpflichtigen, geradestehen. Auch das ist eine Lehre aus der gegenwärtigen Finanzkrise, die nur wiederholt, was man außerhalb der Wirtschafts-wissenschaften immer schon wusste. Die Wirtschafts-wissenschaften, die sich hier als in ihrer Autonomie-behauptung der Wirtschaft (Gleichgewichtstheorie!) ideologisch befangene Beobachter erweisen, unter-schätzen systematisch das Ausmaß, in dem die Risi-kokalküle der Wirtschaft auf flankierende Maßnah-men der Politik angewiesen sind. Nicht nur wird die Geldmengenpolitik der Notenbanken zu einer bloß
technisch begründeten Randbedingung der Wirt-schaft marginalisiert, sondern man übersieht auch die aktive wirtschaftliche Rolle des Staates in der Kredit-aufnahme und Geldanlage, in der Arbeitsplatzsiche-rung (zur Not durch eigene Beschäftigungsangebote), im eigenen Konsum und in der eigenen Produktion von Gütern und Dienstleistungen.
Welche neue Rolle kommt dem Staat zu?
Und in der Tat, solange man davon ausgeht, dass der Zweck der Wirtschaft die Versorgung mit knappen Gütern ist, kann man die Rolle des Staates marginali-sieren, weil er dann nur ein Akteur unter anderen ist. Wenn man jedoch davon ausgeht, dass die Funktion der Wirtschaft darin besteht, Vorsorge für die Zukunft zu treffen, stellt sich sofort die Frage, welche Zukunft in welcher Fristigkeitsstruktur in Rechnung gestellt werden kann. In dieser Situation ist der Staat kein Ak-teur unter anderen, sondern ein seinerseits höchst riskanter, weil Verlässlichkeit signalisierender, im Zu-griff auf die Zwangszahlungen der Steuerpflichtigen abgesicherter Garant bestimmter Zukünfte, an denen sich alle anderen Wirtschaftsakteure orientieren. Da-rauf kann man nicht verzichten, das kann man jedoch
auch nicht wirklich kalkulieren.
In der Wirtschaft schließen wir Wetten auf andere ab, deren Erfolge nur in Gren-zen von uns selbst abzusichern sind. In der Wirtschaft gibt es den anderen als
anderen; sie ist ein verteiltes System, in dem sich Fehl-einschätzungen über kurz oder lang selber korrigieren. In der Politik schließen wir Wetten auf uns selber ab, ohne zu wissen, worin unsere Erfolgsaussichten beste-hen. In der Politik gibt es den anderen nur als den an-deren Staat; sie ist ein asymmetrisches System, in dem sich der politische Wille zu Aggregationseffekten auf-schaukeln kann, die nur langfristig, wenn überhaupt, wieder aus der Welt zu schaffen sind.
Welche Theorie der Wirtschaft brauchen wir zukünftig?
Wir brauchen daher eine Theorie der Wirtschaft, die nicht so tut, als könne sich die Wirtschaft von der Politik und dem Rest der Gesellschaft abnabeln, son-dern die auch und gerade die Rationalität der Wirt-schaft, ihre kleinen, scharfen Kalküle, zurückbezieht auf die gesellschaftlichen Voraussetzungen, in die sie eingebettet ist. Die Anomalien ansonsten effizi-enter Märkte entstehen daraus, dass man die Gesell-schaft insgesamt in Rechnung stellen muss, wenn es darum geht, für eine ungewisse Zukunft dennoch gegenwärtig Vorsorge zu treffen. Banken haben es, weil sie mit Zahlungsversprechen handeln, mit ei-nem potenzierten Zeitfaktor zu tun. Davon, dass da-mit ein eigener Produzent von Risiken und Gefahren auftritt, handelt das Buch. Darin, dass zusätzliche Berechnungen eine zusätzliche Unberechenbarkeit schaffen, liegt die Pointe des Buches. Denn wer rech-net, wird in der Gesellschaft auch berechnet. Und es kann dauern, bis die Akteure aus den Kulissen treten, die auf die neuen Rechnungen ihre eigenen Wetten abgeschlossen haben.

Jubiläumsjahr 2013: 10 Jahre Zeppelin Uni, 175. Geburtstag von Graf Zeppelin – was verbindet die Luftschifffahrt und Tognum?
a) Schöne Aussichten
c) Sichere Motoren d) Heiße Luft
b) Himmlische Nähe
Wir gratulieren „ZU“ zehn Jahren!Neues schaffen. Weiter denken. Vorwärtskommen. Die Zeppelin Universität feiert ihr zehnjähriges Bestehen und wir gratulieren natürlich von ganzem Herzen. Was uns bislang und auch künftig verbindet, ist nicht nur der Namensgeber der Universität und unsere regionale Verankerung in Friedrichshafen, sondern auch die Förderung von Innovation und jungen Talenten. Im Jahr 1908 empfahlen Wilhelm und Karl Maybach dem Grafen Ferdinand von Zeppelin eine neue Motorkonstruktion, um die Luftschifffahrt sicherer zu machen und legten so den Grundstein für die Luftfahrzeug-Motorenbau GmbH und damit für die heutige Tognum AG. Mit den Marken MTU, MTU Onsite Energy und L’Orange sind wir heute einer der weltweit führenden Anbieter von hochinnovativen Motoren, Einspritzsystemen, Antriebslösungen und dezentralen Energieanlagen.
Bewegen wir gemeinsam von Friedrichshafen aus die Welt!
Willkommen bei der Tognum AG in Friedrichshafen. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.Tognum AG • Personalmarketing • Regine Siemann • Maybachplatz 1 • 88045 [email protected] • Tel. 07541/90-7888
www.tognum.com

2004
10
Vier Hochzeiten und drei Todesfälle Professor Dr. Stephan A. Jansen, Lehrstuhl für Strategische Organisation und Finanzierung | SOFIund Leiter des „Civil Society Center | CiSoC“
Unternehmenskäufe und Fusionen: Kaum ein Phänomen hat die weltweite Unternehmenslandschaft im ausklingenden 20. Jahrhundert so stark geprägt wie dieses. Stephan A. Jansen hat deren Erfolgsfaktoren und Kardinalfehler eingehend untersucht und 2004 daraus folgend sein Buch „Management von Unternehmenszusammenschlüssen – Theorien, Thesen, Tests und Tools“ bei Klett-Cotta veröffentlicht. Und er kommt zu dem Schluss: Unternehmensübernahmen verursachen oftmals Schluckbeschwerden.
Seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts ist das Phänomen der Unternehmensüber-nahmen beobachtbar. Und zwar in Wel-len. Die Forschung dazu brandete hinge-gen erst in den 1990er Jahren so richtig auf – mit Verzug dann auch in Deutsch-
land. Eine erste differenzierte Analyse zum Management von Unterneh-mensübernahmen insbesondere mit dem Fokus auf die sogenannte Post-Merger-Phase für den deutschen Markt wurde im Jahr 2000 vorge-legt und 2004 umfangreich veröffentlicht. In dieser Analyse wurden insgesamt 103 Unternehmenszusammenschlüsse anhand eines ausführ-lichen Fragebogens untersucht, die in der bislang transaktionsstärksten Welle zwischen 1994 und 1998 vereinbart wurden. Ein eigenes Sample wurde mit den kleinen und mittleren Unternehmen vorgenommen.
Vor allem folgende Fragen standen im Vordergrund: Was sind die Er-folgsfaktoren, was sind die Kardinalfehler beim Management von Fusionen? Sind rein nationale Fusionen erfolgreicher als internationa-le? Ist es besser, mit einem gleichstarken Partner zu fusionieren oder ein kleineres Unternehmen zu übernehmen? Und: Gibt es Unterschie-de im Ergebnis zwischen Dienstleistern und der klassischen Industrie? Welche Rolle spielt der Kunde bei Fusionen?
Beginnen wir mit der ernüchternden Bilanz vorab: Nur in 44 Prozent der Fälle gelang den untersuchten Unternehmen eine relative Umsatz-steigerung im Vergleich zur Branche, lediglich 24 Prozent der börsenno-tierten Studienteilnehmer konnte eine relative Steigerung ihres Börsen-wertes im Nachgang der Fusion erreichen (sogenannte „Outperfor-mance“). Damit scheiterten drei von vier Hochzeiten an der Börse, was möglicherweise auch den dann wieder abnehmenden Trend zu solchen Zusammenschlüssen erklären könnte.
Die Ergebnisse im Schnell-Überblick:

2004
11
_Mehr vom Autor unter zu.de/jansen
Aufgaben mit signifikant positivem Einfluss auf die relative Umsatzsteigerung (Branchen-Outperformance)
Korrelation (Pearson) Signifikanz
Aufgaben mit signifikant positivem Einfluss auf die relative Börsenwertsteigerung (Branchen-Outperformance)
Korrelation (Pearson) Signifikanz
Harmonisierung der Gehalts- und Incentivestrukturen
0,4040,000**
Konsolidierung des betrieblichen Berichtwesens
0,5720,001**
Konsolidierung des betrieblichen Berichtwesens
0,3250,002**
Einsatz von Integrations- und Projektteams 0,4570,013*
Ableitung einer Integrationsplanung im Vorfeld
0,2730,010*
Aufsetzung neuer Strategien der Kundenzusammenarbeit
0,3980,033*
Proaktives Fluktuationsmanagement 0,2710,011*
Wissenschaftliche Dokumentation des Post Merger Managements
0,3820,041*
Entwicklung von Instrumenten zum Wissenstransfer
0,2230,037
* Korrelation auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant** Korrelation auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant
Noch als Student 1997 gründeten Sie das deutschlandweit erste „Institute for Mergers & Acquisitions | IMA“. Was hat Sie an dem Thema so fasziniert? „Es war damals ein besonderes Gesell-schaftsspiel über Geld, Macht und Liebe – und die Forschung dazu etwas zu betriebswirtschaftlich verengt.“ stephan a. jansen
Was sind die Ziele von Fusionen?
Kostensynergien hatten bei den Zielstellungen von Fusionen deutlichen Vorrang vor gemein-samem Wachstum und Innova-tionen. Zu den drei entschei-denden strategischen Zielen der Unternehmenszusammen-schlüsse zählten bei 70 Prozent der Befragten die Erhöhung der (glo-balen) Marktpräsenz, Kostensynergien im Bereich der Leistungser-stellung (39 Prozent) und im Bereich der Vermarktung (31 Prozent).
Wachstumssynergien waren nur für 16 Prozent der analysierten Unter-nehmen das Hauptmotiv, der Erwerb von Know-how nur für 7 Prozent und die Erhöhung der Innovationskraft gar nur für 4 Prozent.
Welche sind die Erfolgsfaktoren?
Ein erfolgreiches Post Merger Management zeichnet sich durch schnel-le Entscheidungen zur zukünftigen Führungsstruktur aus. Überra-schend dabei: Unternehmenskulturelle Aspekte haben einen eher un-bedeutenden Einfluss auf den Erfolg. Unternehmen, die bereits mehre-re Akquisitionen in der gleichen Größenordnung durchgeführt haben und damit über entsprechende Fusionserfahrung verfügen, messen dem Thema Kultur sogar eine signifikant geringere Bedeutung bei. Für 57 Prozent aller Befragten zählte nach eigener Einschätzung die schnel-le Entscheidung über die künftige Führungsstruktur zu den wichtigs-ten Aufgaben, bei 47 Prozent die Erarbeitung einer externen und in-ternen Kommunikationsstrategie und bei 27 Prozent der Einsatz von Integrationsteams. Im Hinblick auf die erfolgreichen Zusammen-schlüsse lassen sich folgende Faktoren ableiten, die einen signifikant positiven Einfluss auf den Fusionserfolg haben:
Faktoren mit signiFikant positivem einFlUss aUF Den FUsionserFolg (vgl. Jansen 2004, S. 206).

2004
1212
Es wird nun weniger geheiratet. Gibt es neue Beziehungs-formen? „Ja, in Deutschland wird weniger auf Augen-höhe geheiratet, aber es sind mit Hedge Fonds, Private Equity und Staatsfonds neue Lebensabschnittsgefähr-ten in diesen Heiratsmarkt gekommen, und die BRIC-Staaten flirten heftig.“ stephan a. jansen
Fehler mit signifikant negativem Einfluss auf die relative Umsatzsteigerung (Branchen-Outperformance)
Korrelation (Pearson) Signifikanz
Aufgaben mit signifikant positivem Einfluss auf die relative Börsenwertsteigerung (Branchen-Outperformance)
Korrelation (Pearson) Signifikanz
Schlechte Planung des Integrationspro-zesses
-0,4280,000**
Keine neuen Konzepte der Kundenkooperation
-0,4450,020*
Unzureichende Kommunikationsstrategie -0,2470,021*
Unzureichende Kommunikationsstrategie -0,4070,032*
Zu starke Zentralisierung der Koordination (Überlastung der Entscheidermannschaft)
-0,2460,022*
Fehlende Absprache der Vertriebsaktivitä-ten (kein Abgleich von Kundenstämmen)
-0,3840,048*
Nur Top-down-Kommunikation -0,2190,044*
* Korrelation auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant** Korrelation auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant
Welche Fehler werden begangen?
Bisherige Erklärungsansätze für die unverändert hohe Misserfolgsquote waren eher aus Einzelerfahrungen abgeleitet, so dass aufgrund mangelnder Forschung auf diesem wichtigen Bereich stereotype Erklärungs-muster entstanden sind – wie beispielsweise „Kultur-differenzen“, „schwache zentrale Managementfüh-rung“ oder „fehlende Prozess-geschwindigkeit“. All diese Erklärungsansätze bestätigen sich interessanterweise in der durchgeführten Studie nicht: Für 31 Prozent der Befragten zählen die unzureichende Ein-bindung der Mitarbeiter, für 27 Prozent eine unzureichende Kommunikation und für je-weils 19 Prozent eine schlechte Planung des Integrationsprozesses sowie eine zu star-ke Zentralisierung der Entscheidungsprozesse zu den drei gravierendsten Fehlern von Unternehmen im Rahmen des Integrationsmanagements.
Faktoren mit signiFikant negativen einFlUss aUF Den FUsionserFolg
(vgl. Jansen 2004, S. 212).
Was sind die Instrumente?
Vor allem richtige Kommunikationskonzepte, aber auch Stärken-Schwächen-Analysen sowie die Check-listen und Pflichtenhefte wurden von den Studien-teilnehmern als zentrale Instrumente für ein erfolg-reiches Fusionsmanagement eingestuft. Weiterhin standen Potentialeinschätzungsverfahren für die Mitarbeiter und darauf abgestimmte Trainingssys-teme hoch im Kurs. Auch hier: Die derzeit verstärkt diskutierte kulturelle Due Diligence wurde lediglich von 2 Prozent als ein wichtiges Instrument eingestuft.
Welche Ergebnisse zeigt die vergleichende Analyse?
Fusionen unter gleichstarken Partnern sind tenden-ziell erfolgreicher an der Börse und beim Umsatz. Der mögliche Grund: Nahezu allen Aufgaben im Post Mer-ger Management wird bei den sogenannten „Mergers
of Equals“ eine deutliche höhere Bedeutung beige-messen – vor allem der Integrationsplanung, dem Einsatz von Integrationsteams, der Entwicklung von Instrumenten zum Wissenstransfer und dem Aufbau zusätzlicher F&E. Die Integrationstiefe gleichwertiger Partner ist dabei deutlich höher im Sinne einer nur geringen Integration gewesen und die Integrations-geschwindigkeit dafür signifikant langsamer.
Zusammenschlüsse mit einem internationalen Partner weisen eine signifikant höhere Börsenwertsteigerung gegenüber nationalen Zusammenschlüssen auf: Wäh-rend keine der internationalen Fusionen eine negative Börsenwertentwicklung verzeichnen musste, haben
43 Prozent der rein nationalen Zusam-menschlüsse entsprechende Kurs-rückgänge erlitten. Der Umsatz ent-wickelte sich jedoch tendenziell leicht schlechter im Vergleich zu den rein nationalen Fusionen.
Welchen Einfluss hat die Branche?
Bei 51,9 Prozent der Zusammenschlüs-se von Dienstleistern und Handel stie-gen die Umsätze relativ zur Branche, gegenüber nur 40,7 Prozent im Indus-trie- und Konsumgütersektor. Grund: Bei ihnen stehen „Wachstumssyner-gien“ und die „Nutzung neuer Absatz-/
Vertriebswege“ deutlich vor den „Kostensynergien“. Dies zeigt sich auch bei der deutlich geringeren Tendenz zur Personalreduktion nach der Fusion. Sie wählten zudem wesentlich häufiger den Zusammenschluss mit einem gleichwertigen Partner.
Welche Bedeutung hat die Größe der Käufer?
Beim Vergleich der Größe des Käuferunternehmens zeigen sich für diejenigen unter 1 Mrd. DM Umsatz (hier als kleine und mittlere Unternehmen (KMU) definiert) folgende Auffälligkeiten:
(a) Bindungsrichtung: KMU akquirierten häufiger ver-tikal bzw. konglomeral als börsennotierte Konzerne (19,4 Prozent im Vergleich zu 6,9 Prozent). (b) Erfolgs-maße: Beim Umsatz realisierten KMU-Käufer eine deutlich bessere Umsatzentwicklung (immerhin 54,5 Prozent im Vergleich zu gerade einmal 38,9 Prozent

2004
13
_Jansen, stephan a. (2009): Akquisitionen und Fusionen von und durch Familienunternehmen – Ausgewählte Theorien, Thesen und Test, in: Kirchdörfer, Rainer / Lorz, Rainer / Wiedemann, Andreas / Kögel, Rainer (Hrsg.): Familienunternehmen in Recht, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – Festschrift für Brun-Hagen Hennerkes, München: Beck, S. 389 – 416._Jansen, stephan a. (2008): Mergers & Acquisitions: Un-ternehmensakquisition und -kooperation – Eine strategi-sche, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, Wiesbaden: Gabler, 5. überarbeitete und ergänzte Auflage.
_Jansen, stephan a. (2004): Management von Unterneh-menszusammenschlüssen – Theorien, Thesen, Tests und Tools, Stuttgart: Klett-Cotta.
bei börsennotierten Großunternehmen). (c) Ziele: Der Einfluss der Mar-keting- und Vertriebsziele auf die Entscheidung für einen Zusammen-schluss war bei den KMU-Käufern signifikant höher ausgeprägt (85,7 Prozent im Gegensatz zu 56,7 Prozent). Bei der strategischen Ausrich-tung der mittelständischen Zusammenschlüsse stand entgegen der Logik der Groß-Fusionen die Realisierung von Kostensynergien weit hinter der Realisierung von Wachstumssynergien. (d) Aufgabenfokus: KMU wiesen einen starken Kunden- und Lieferantenfokus in der Inte-gration auf, nahmen aber kaum Beratung in Anspruch. (e) Instrumente: KMU setzen weniger Post Merger-Instrumente ein. (f) Integrationstiefe und -geschwindigkeit: KMU-Käufer hatten eine signifikant niedrigere Integrationstiefe (38,2 Prozent nur mit Teilintegration mit lediglich 15 Prozent bei börsen notierten Großtransaktionen), sind dabei aber nicht schneller.
Schützt Erfahrung vor Misserfolgen?
Nun könnte man vermuten, dass sich bei den vielen Misserfolgen zu-mindest bei Akquisitionserfahrenen eine Lernkurve einstellen müsste. Aber: Vorherige Akquisitionserfahrung hatte bei den analysierten Un-ternehmen keinen Einfluss auf den Erfolg nachfolgender Zusammen-schlüsse. Dies könnte auch an der fehlenden Reflexion zum Beispiel im Sinne des Post-Merger-Audits liegen. Schluckbeschwerden lassen sich vermutlich nur vor- und nachsorgend (Due Diligence und Post Merger Audit) sowie mitfühlend (Prozessmanagement) einigermaßen in den Griff bekommen – und vielleicht hilft dabei sogar die Forschung.

2010
14
Auch mehr als 20 Jahre nach Vollendung der deutschen Einheit und trotz milliardenschwerer Aufbauprogramme hinkt die Wirtschaft in den neuen Bundesländern dem Westen gegenüber immer noch hinterher. Ein Grund dafür könnte in einem von Marcel Tyrell und Marcus Jacob 2010 erforschten Phänomen liegen: in den Nachwirkungen des Stasi-Spitzelsystems. Es hat offenbar Folgen bis heute, indem es eine der wichtigsten Voraussetzungen für gedeihlichen Handel und wirtschaftliches Wachstum nachhaltig zerstörte: gegenseitiges Vertrauen und damit sogenanntes Sozialkapital.
Warum die Stasi die Wirtschaft bis heute schwächt Interview mit Professor Dr. Marcel Tyrell, Lehrstuhl für Unternehmer- und Finanzwissenschaften
Herr Tyrell, Sie haben gemein-sam mit Marcus Jacob eine Stu-die veröffentlicht, in der Sie das Sozialkapital in den neuen Bundesländern untersucht ha-ben. Was versteht man eigent-lich unter Sozialkapital?Sozialkapital ist ein Begriff, der insbesondere durch die Soziolo-gen Pierre Bourdieu und Robert Putnam in den wissenschaftli-chen Diskurs eingeführt wurde. Während Bourdieu als Sozialka-pital die Ressourcen bezeichnet,
die eingesetzt werden, um in einem institutionellen Zusammenhang die gegenseitige Akzeptanz und An-erkennung zu fördern, versteht Putnam darunter je-doch vor allem die Facetten des gesellschaftlichen Zusammenlebens wie Netzwerke, Normen oder auch Vertrauen, die dazu führen, dass Individuen kooperativ agieren, um gemeinsame Interessen zu verfolgen. In den Wirtschaftswissenschaften wird Sozialkapital eher analog zu Putnam als ein Faktor gesehen, der die gemeinsamen Wertvorstellungen und Erwartungen beinhaltet, die es einer Gruppe ermöglichen, Gesamt-wohlfahrt erhöhende Aktivitäten zu initiieren, ohne dass es zu Trittbrettfahrerverhalten kommt. Insofern
ist es auch Vertrauenskapital: Es bezeichnet das Aus-maß des Vertrauens, das Menschen in andere Men-schen setzen.
Und was war der genaue Forschungsansatz?Wir haben untersucht, ob die fortdauernde ökonomi-sche Disparität zwischen Ost- und Westdeutschland auch etwas damit zu tun hat, dass diese Form des Vertrauenskapitals durch die SED-Diktatur systema-tisch unterminiert wurde. Vorbild für unsere Unter-suchungen waren dabei ökonomische Studien, die, angeregt durch Putnam, das bereits seit Jahrhunder-ten bestehende wirtschaftliche Gefälle zwischen Nord- und Süditalien auch dadurch erklären, dass historisch gewachsen sehr unterschiedliche Niveaus an Sozialkapital zwischen diesen Regionen herrschen. Ob ein ähnlicher Erklärungszusammenhang auch für Deutschland konstatiert werden kann, stand im Mit-telpunkt unserer Arbeit.
Welcher Faktoren haben Sie sich dabei bedient – und was sagen diese aus?Die Schwierigkeit besteht darin, dass Sozialkapital ein Konstrukt ist, welches kaum beobachtet, geschweige denn direkt gemessen werden kann. Wir haben Fak-toren zur Messung herangezogen, wie sie üblicher-weise in der Forschung verwendet werden, also die

2010
15
_Mehr vom Autor unter zu.de/tyrell
Haben Sie spezielle regionale Unterschiede in den neuen Bundesländern beim Sozialkapital ausgemacht? „Das Sozi-alkapital scheint in den weiter südlich liegenden neuen Bundesländern wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-gen stärker ausgeprägt zu sein. Dies sind auch die vergleichs-weise wirtschaftlich erfolgreichen Länder.“ Marcel tyrell
Wahlbeteiligung, die Bereitschaft, Organe zu spen-den, oder sich in Organisationen zu engagieren. Dies sind natürlich unvollkommene Indikatoren, um Ge-meinsinn zu messen, aber trotz allem die besten, die uns insbesondere geographisch feingegliedert auf Kreisebene zur Verfügung standen.
Welche Rolle spielte die frühere Staatssicherheit in der Forschungsarbeit?Wichtig ist herauszuarbeiten, welche Faktoren Sozial-kapital grundsätzlich beeinflussen können. Es gibt die Faktoren, die aus der Literatur bekannt sind, nämlich der Grad der Urbanisierung, die Zuwanderung in eine Region und die konfessionelle Bin-dung der Bewohner in einer Region, welche wir in unserer Studie berück-sichtigt haben. Dann stellte sich uns die Frage, ob auch die Staatssicher-heit etwas mit dem mal mehr und mal minder ausgeprägten Sozialka-pital zu tun haben könnte. Wir erho-ben auf Basis einer Studie der Birth-ler-Behörde die Zahl der Inoffiziellen Mitarbeiter (IM) der Staatssicherheit auf Kreis-Ebene und stellten fest, dass die in den letz-ten Jahren der DDR regional sehr unterschiedlich ver-teilt waren. Die Dichte der IM schwankte zwischen 2 und 16 pro 1000 Einwohner. Folgt daraus, dass sich aus dem unterschiedlichen Wirken der Staatssicherheit damals – für welche die IM-Dichte ein wichtiger Indi-kator ist – heute noch Auswirkungen auf das Sozial-kapital messen lassen?
Und wie war das Ergebnis?Wir konnten feststellen, dass im Durchschnitt, aber nur im Durchschnitt, gilt: Je höher die IM-Dichte in einer Region war, desto geringer ist das Sozialkapital
auch noch 20 Jahre später. Es gab zwar geringfügige Unterschiede, je nachdem welchen Indikator (Wahlbe-teiligung, Organspenden oder Mitgliedschaft in Ver-einen) wir in die empirische Untersuchung einbezogen, aber das veränderte nichts an der Hauptaussage.
Was schlussfolgern Sie daraus?Die Überwachung und Bespitzelung durch die Stasi hat nachhaltig Sozialkapital zerstört und dies insbe-
sondere dadurch, dass sie vielfach im Verborgenen agiert hat. Das hat Misstrauen in die Gesellschaft gesät und damit Vertrauen zerstört. Und da dies in den Köp-fen der Menschen tief verankert ist und teilweise auch generationenübergreifend weitergegeben wird, sind die Auswirkungen ebenso nachhaltig.
Was bedeutet dies für die weitere wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Bundesländern?Dies haben wir in einem nächsten Schritt untersucht. Die Intensität der Überwachung hat laut unserer Stu-die einen starken Negativeffekt – über den Umweg des Sozialkapitals – auf die Wirtschaftsentwicklung und
-leistung. Der Grund ist klar: Ausgeprägtes So-zialkapital bildet auch die Grundlage erfolg-reichen wirtschaftli-chen Handelns. Miss-trauen erschwert hin-gegen effiziente Koope- ration, und dies macht bestimmte wirtschaft-liche Aktivitäten, die mit komparativen Kos-ten- und Produktions-vorteilen verbunden sind, ineffizient. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung leidet dau-erhaft.

Die ePaper-App von impulse wissen
impulse wissen jetzt auch digital lesen:Die App bietet Ihnen die Möglichkeit, die neuen Ausgaben als ePaper herunterzuladen und bequem auf dem Tablet oder Smartphone zu lesen. Nutzen Sie dabei Social-Media-Funktionen wie das Posten auf der Facebook-Fanpage, das Anschauen von Videos im Youtube-Channel der impulse-Redaktion sowie die Anbindung an Twitter.Für unsere Printabonnenten ist das Herunterladen der Ausgabe in der App kostenfrei.
www.impulse.de/app
2010
16
Welche Konsequenzen sollte die Politik aus der Studie zie-hen? „Man sollte sich auch seitens der Politik ernsthaft die Frage stellen, ob mit aller Macht eine vollständige wirt-schaftliche Konvergenz zwischen Ost- und Westdeutsch-land angestrebt werden sollte. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten könnten unangemessen hoch sein.“ Marcel tyrell
_Mehr zur Studie unter zu.de/sozialkapital
das Misstrauen, welches uns entgegenschlug. Uns wurden oft finstere Absichten mit der Studie unter-stellt, und dies zeigte mir letztlich, wie relevant und aktuell unsere Forschung ist. Das Misstrauen war ge-waltig, obwohl die Studie in keinerlei Weise gegen die weit überwiegende Mehrheit der Bürger gerichtet war, die nicht mit der Stasi zusammengearbeitet haben.
Wie waren eigentlich die Resonan-zen aus Wissenschaftskreisen?Hier waren die Reaktionen positiv aber auch insistierend. Der Diskurs drehte sich in der Hauptsache dar-um, ob wir mittels unserer empiri-schen Spezifikation der Analyse einen Kausalzusammenhang oder eine Korrelation nachgewiesen ha-ben. Dies ist eine der Hauptfragen.
Die „story-line“ wurde jedoch kaum bestritten.
Hat die Studie in irgendeiner Form einen Fortgang gefunden?Sowohl die Entstehung als auch die Zerstörung von Sozialkapital wird nicht nur in Deutschland, sondern auch international immer intensiver untersucht, und dies ist eine originär interdisziplinäre Fragestellung. Gerade aktuell beschäftigen wir uns genauer mit der Fragestellung, wie Sozialkapital und Familienunter-nehmertum zusammenhängen, denn unseres Erach-tens gibt es auch hier einen noch unerforschten Zu-sammenhang.
Lässt sich ein Verlust von Sozialkapital heilen?Wirtschaft funktioniert nur mit den Menschen und den unmittelbaren und mittelbaren Erfahrungen, die sie machen. Deshalb geht es im Kern darum, gezielt den Aufbau und die Stärkung von Gemeinsinn zu fördern. So lässt sich ein solcher Verlust auch nur langfristig heilen, aber es kann gelingen.
Könnte staatliches Handeln helfen?Der Staat kann helfen, den Gemeinschaftssinn durch die Schöpfung von Gemeinschaftsgütern zu stärken, damit Vertrauen entstehen kann. Es reicht deshalb nicht, Autobahnen zu bauen, ein Gewerbegebiet an-zulegen oder Geldtransfers zu leisten. Das ist oft nur Symbolpolitik und verändert nichts in den Köpfen vieler Menschen.
Sie erfuhren damals im Zuge der Veröffentlichungen teils heftige Angriffe aus den neuen Ländern. Welcher Art waren die und wie haben Sie sie erlebt?Ich war verblüfft über die Schärfe der Reaktionen und

Die ePaper-App von impulse wissen
impulse wissen jetzt auch digital lesen:Die App bietet Ihnen die Möglichkeit, die neuen Ausgaben als ePaper herunterzuladen und bequem auf dem Tablet oder Smartphone zu lesen. Nutzen Sie dabei Social-Media-Funktionen wie das Posten auf der Facebook-Fanpage, das Anschauen von Videos im Youtube-Channel der impulse-Redaktion sowie die Anbindung an Twitter.Für unsere Printabonnenten ist das Herunterladen der Ausgabe in der App kostenfrei.
www.impulse.de/app

2013
18
Bundesbürger wissen nur wenig über WirtschaftProfessor Dr. Peter Kenning, Dr. (des.) Inga Wobker, Lehrstuhl für Marketing, und Diplom-Kauffrau Mirja Hubert, Forschungszentrum Verbraucher, Markt und Politik | CCMP
Wie bezeichnet man das Wirtschaftssystem der Bundes-republik Deutschland? Was versteht man unter Subven-tionen? Wie heißt eigentlich der aktuelle Bundeswirtschafts-minister? Und wie hoch ist derzeit in etwa die Arbeitslosen-quote? Fragen, von denen man meinen müsste, sie könnte wohl jeder beantworten. Dem ist jedoch überhaupt nicht so. Ein Forscherteam um Peter Kenning, Mirja Hubert und Inga Wobker hat das sogenannte „Minimale ökonomische Wissen“ der Deutschen über mehrere Jahre hin untersucht – mit verblüffen-den und sich 2013 noch dazu verschlechternden Ergebnissen.
Forscher so zusammen: „Das minimale Wirtschafts-wissen ist in Deutschland immer noch sehr lücken-haft. Man sollte dringend nach Wegen suchen, die Menschen stärker für das Verständnis wirtschaftli-cher Zusammenhänge zu motivieren und sie so zu befähigen, Fehlentscheidungen zu vermeiden.“
Wie steht es ums Konsumentenwissen?
Es beginnt schon damit, dass etwas über 30 Prozent der Bundesbürger nicht wissen, wer der aktuelle Bun-deswirtschaftsminister ist. Oder fast ein Viertel noch nie davon gehört hat, in einer sozialen Marktwirt-schaft zu leben. Oder fast die Hälfte nicht einmal in etwa angeben konnte, wie hoch die Arbeitslosenquo-te derzeit ist. Bei den Fragen ging es aber nicht nur um aktuelles wirtschaftliches Wissen, sondern auch um schlichtes, handfestes Konsumentenwissen wie bei der Frage: Wenn Sie als Verbraucher in einem Laden ein Produkt gekauft haben und es Ihnen nicht mehr gefällt, wie lange haben Sie dann normalerweise ein Rückgaberecht? Nicht einmal ein Drittel wusste die richtige Antwort: Es gibt gar keinen Anspruch auf Rückgabe. Der Rest schwankte mit Angaben zwischen einer und drei Wochen angeblichen Rückgaberechts.
Wie schnitten die Befragten ab?
Insgesamt wurden 1014 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet befragt. Erhoben wurden dabei zudem Daten zu Alter, Geschlecht, Haushaltsnettoeinkom-
Stellen wir uns einmal vor: Sie haben 3000 Eu ro Schulden gemacht. Dafür zahlen Sie einen Sollzins von 12 Prozent pro Jahr. Jeden Monat tragen Sie 30 Euro ab. Wann werden Sie die Schulden getilgt haben? Das Ergebnis ist
– um es gleich vorweg zu nehmen – ebenso ernüch-ternd wie das, was Peter Kenning, Mirja Hubert und Inga Wobker im Rah-men ihrer neuerlichen Studie 2013 über das mini-male ökonomische Wis-sen (Minimal Economic
Knowlegde) erlebten, die in Kooperation vom For-schungszentrum Verbraucher, Markt und Politik an der ZU, dem Lehrstuhl für Marketing, der TU Dresden und dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin durchgeführt wurde.
Wie steht es um die Grundkenntnisse in Ökonomie?
Mit 24 Fragen wollten die Forscher herausfinden, wie es um die grundlegenden Kenntnisse in Sachen Öko-nomie bei den Bundesbürgern steht. Das Ergebnis: erschreckend schlecht. Erstmals wurden dabei Ver-gleichswerte einer Erhebung von vor zwei Jahren herangezogen wie auch geschlechterspezifische Un-terschiede und ein Vergleich zwischen dem bundes-deutschen Durchschnitt und dem des Landes Baden-Württemberg angestellt. Die Ergebnisse fassen die

2013
19
_Mehr vom Autor unter zu.de/kenning
Wie sind Sie eigentlich auf dieses Forschungsthema gekom-men? „Auf einem Workshop der VW-Stiftung bei einem Vor-trag von Lutz Bachmann. Er hatte mit Gerd Gigerenzer für die medizinische Forschung analog einen Minimal Medical Knowledge-Indikator entwickelt und getestet. Gigerenzer und ich haben dann entschieden, dieses Forschungsprojekt auf den ökonomischen Bereich zu übertragen.“ peter kenning
men und Bildungsabschluss. Jedem Teilnehmer wur-den jeweils 24 Fragen zu den Themen Finanzen, Ar-beitsmarkt, Konsum und Staat gestellt. Dabei war ein maximaler Wert des minimalen ökonomischen Wis-sens von 100 zu erreichen. Der Durchschnitt der Be-fragten kam am Ende auf einen Wert von 57,4 – gera-de etwas mehr als die Hälfte dessen an Wirtschafts-kenntnissen, die jeder Bürger im täglichen Leben eigentlich braucht. Im Vergleich zur früheren Erhe-bung von vor zwei Jahren bedeutete dieser Wert sogar noch eine Verschlechterung: Damals kam der Durch-schnitt auf 59,4 Punkte. Mögliche Gründe für diese leicht negative Entwicklung sieht das Forscherteam in einer oftmals „mangelhaften Berücksichtigung ökonomischer Themen in den Schulen sowie einem bisweilen problematischen Medienkonsum“.
Was schlussfolgert daraus?
„Nicht nur in der Verbraucherbildung wird auf die Be-deutung des Verständnisses grundlegender wirt-schaftlicher/ökonomischer Prozesse für die Qualität von Konsumentscheidungen hingewiesen: Konsumen-ten sollten sich nicht nur in Themenbereichen ausken-nen, die für sie unmittelbar relevant sind, sondern auch über minimale notwendige Kenntnisse in Bezug auf ökonomische Prozesse im Allgemeinen verfügen“, erläutern Hubert, Wobker und Kenning den Hinter-grund der Studie. „Eine solche hinreichende ökonomi-sche Bildung erhöht die Teilhabe und Konsumkompe-tenz und stärkt damit nicht nur das Individuum, son-dern ebenso Gesellschaft und Politik.“
Gibt es Unterschiede bei den Geschlechtern?
Verteilt ist das ökonomische Wissen – auch das ergab die Studie – geschlechterspezifisch übri-gens eher ungleich. Frauen schnitten deutlich schlechter ab als Männer. Sie schätzten überdies selbst ihr Wissen in Sachen Wirtschaft als we-sentlich schlechter ein und erzielten zudem ei-nen im Durchschnitt um sieben Punkte schlech-teren Wert. Den Grund dafür sehen die Wissen-schaftler vornehmlich darin, dass sich Frauen beim Thema Geld häufig noch weniger in der Verant-wortung sähen als Männer und dem Thema Ökonomie auch weniger Interesse entgegenbrächten. Weitere Er-gebnisse der Studie: Mit Alter und Einkommen nimmt das minimale ökonomische Wissen ebenso zu wie mit dem Bildungsabschluss.
Was zeigt der Vergleich für Baden-Württemberg?
Erstmals erhoben wurden zudem Vergleichswerte zwischen der Bundesrepublik gesamt und dem Land Baden-Württemberg. Dabei zeigte sich, dass die Men-schen im Land der Häuslebauer und Tüftler signifi-kant besser abschnitten als der Bundesdurchschnitt. Kam dieser am Ende auf einen Wert von 57,38, so er-reichten die Baden-Württemberger einen Wert von 60,95. Warum ist das so? „Die Gründe dafür sind noch nicht abschließend erforscht. Unsere Daten zeigen aber, dass Unterschiede in den beruflichen Werdegän-gen, also Studium/Ausbildung und im Beruf ursäch-lich dafür sein könnten“, vermutet das Forscherteam.
Und im Land der Häuslebauer dürfte denn auch die Lösung der Eingangsfrage nach den Schulden und deren Rückzahlung weniger ein Problem gewesen sein. Die richtige Antwort, wann denn nun unter den genannten Bedingungen die Schulden getilgt seien, lautet natürlich: nie!

2007
20
In den entwickelten Gesellschaften haben sich die Realeinkommen in den vergangenen 50 Jahren vervier- bis verfünffacht. Waren und Dienstleistungen gleichen heute kaum mehr denen, die vor 50 Jahren existierten. Nicht nur der Umfang, sondern auch das „Wo und Wie“ des Konsumierens und Produzierens haben sich radikal verändert. Dennoch stammen viele wichtige Vorstellungen von den Eigenschaften des Marktes und angeblich typischem Marktverhalten aus einer Welt, die kaum Wohlstand und kein allgemeines Bildungswesen, sondern vor allem Armut, Machtlosigkeit, Hunger und Analphabetismus kannte. Diesen Widerspruch versuchte Nico Stehr 2007 in seinem Buch „Die Moralisierung der Märkte“ aufzulösen.
Kerzen, Konsum und Kapitalismus Professor Nico Stehr PhD, Karl-Mannheim-Lehrstuhl für Kulturwissenschaften, und Junior-Professor Dr. Marian Adolf, Lehrstuhl für Medienkultur
Das, was wir als eine „Mo-ralisierung der Märkte“ be-schreiben, tritt deutlicher hervor, wenn man sich die zentralen, jahrzehntelang gültigen Annahmen des Marktes in Soziologie und Ökonomie vergegenwär-tigt. Folgt man etwa der Beschreibung von Märkten in der Tradition der klassi-schen deutschen Soziologie, erscheinen diese als nack-
te, menschenleere Räume. So unterstreicht Georg Sim-mel ([1901] 1989: 290-291) in seiner monumentalen
„Philosophie des Geldes“, dass „der indizierte Partner für das Geldgeschäft – in dem man mit Recht sagt, die Gemütlichkeit aufhört – die uns innerlich völlig indif-ferente, weder für noch gegen uns engagierte Persön-lichkeit [ist].“ Der Markt hat sich durch das Medium Geld von menschlichen Attributen fast völlig eman-zipiert, denn es stellt „das Moment der Objektivität der Tauschhandlungen gleichsam in reiner Abgelöstheit und selbständiger Verkörperung dar“ (Simmel, [1901] 1989: 601). In einem vergleichbaren Ansatz charakte-risiert Max Weber ([1922] 1972: 382-383) in dem unvoll-endeten Kapitel „Die Marktgesellschaftung“ in „Wirt-schaft und Gesellschaft“ die „Marktgemeinschaft als solche [… als] die unpersönlichste praktische Lebens-beziehung, in welche Menschen miteinander treten können […]. Wo der Markt seiner Eigengesetzlichkeit überlassen ist, kennt er nur Ansehen der Sache, kein Ansehen der Person, keine Brüderlichkeits- und Pie-tätspflichten, keine der urwüchsigen, von den persön-lichen Gemeinschaften getragenen menschlichen Beziehungen.“

2007
21
Wie ist die Sicht der klassischen Ökonomie?
In der klassischen Ökonomie trifft man auf Märkten zwar lebendige Menschen, aber die Machtverteilung unter den Marktteilnehmern ist eindeutig und un-verrückbar: In einer Antwort auf vier kritische Bespre-chungen seiner die Makroökonomie wie auch die Wirtschaftspolitik nachhaltig beeinflussenden „The General Theory of Employment, Interest and Money“ (1936) macht John Maynard Keynes (1937) darauf auf-merksam, dass es unter den zeitgenössischen Ökono-men zwar kaum noch bekennende Anhänger des Say’schen Gesetzes gibt (welches besagt, dass das Angebot seine eigene Nachfrage generiert). Allerdings fügt Keynes hinzu, dass die Ökonomen seiner Gene-ration dieses Theorem dennoch stillschweigend wei-ter akzeptieren.
An diesem Sachverhalt hat sich in den darauf folgen-den Jahrzehnten kaum etwas verändert. Auch heute noch beobachten wir eine systematische Überschät-zung der Macht des Angebots sowie der Macht jener Maßnahmen, die dazu dienen sollen, dem Say’schen Gesetz Nachdruck zu verleihen. Dazu gehören bei-spielsweise Marketing und Werbung, aber auch die These von der essentiellen Hilf- und Ahnungslosigkeit der Konsumenten sowie ihrer Ausbeutung und Ent-fremdung durch die Macht des Kon-sumerismus.
Wie kommt die Moral ins Spiel?
Was uns zum Begriff der Moral bringt, über deren genauen Sinn sich keine schnelle Übereinkunft
erzielen lässt. Sich moralisch zu verhalten heißt, sich in einer bestimmten auf Werte bezogenen Weise zu entscheiden. Zu den besonders relevanten Elementen solcher Entscheidungen gehört mit Sicherheit der Verweis oder Bezug auf andere Akteure. Zwar ist es schwierig, dem Begriff der Moral auf abstrakte Weise näherzukommen; dies kann nur fallweise geschehen. Objektiv gesehen gibt es in modernen Gesellschaften eine Vielfalt von im Entscheidungsverhalten nicht aufeinander reduzierbare Werte. Diese sind noch dazu unter spezifischen Bedingungen oder in bestimmten Situationen unvereinbar, was, ganz elementar ge-dacht, zum Beispiel für die Werte Freiheit und Gleich-heit zutrifft.
Diese Unbestimmtheit hat zur Folge, dass es in mo-dernen Gesellschaften eine Pluralität von Märkten gibt, auf denen der Trend zur Moralisierung in un-terschiedlicher Weise und mit verschiedenen Wer-ten von Konsumenten und Produzenten praktiziert wird. Gleichzeitig gilt, obwohl bestimmte, hand-lungsbestimmende moralische Imperative wie bei-spielsweise Nachhaltigkeit nicht vollumfänglich durchgesetzt werden, dass diese Werte den Markt und das gesellschaftliche Leben sehr wohl verän-dern. Werte wie Gerechtigkeit, Loyalität, Freiheit oder Solidarität sind nicht schon deshalb Wahnvor-
stellungen oder Scheinwerte, weil sie kaum jemals vollständig durch-gesetzt werden. Der These der Moralisierung der Märkte geht es auch nicht darum zu argumentie-ren, warum die beobachteten Ein-stellungen und Handlungsweisen der Marktakteure moralisch sind.



2007
24
Nach „Heuschrecken“ und „Raubtierkapitalismus“ nun die „Moralisierung der Märkte“: Handelt es sich vielleicht um eine Art Pendelbewegung? „Nein. Während es über viele Jahrzehnte zu den Tugenden des Marktes im Kapita-lismus gehörte, dass er die Leidenschaften der Menschen ausgrenzte, ist die Zukunft des Kapitalismus an eine Prä-senz der Moral an den Märkten gekoppelt.“ nico stehr
Hier geht es alleine darum, dass die Handelnden be-stimmte, an den Märkten wirksame Präferenzen als moralische, und somit nicht als rein ökonomische, Präferenzen verstehen.
Was heißt Moralisierung der Märkte?
Moralisierung der Märkte heißt beispielsweise, dass ein Immobilieneigentümer sein Haus nicht an den höchsten Bieter, sondern an einen Interessenten ver-kauft, dessen Nutzungskonzept ihm zusagt. Morali-sierung der Märkte bedeutet, dass der Produzent von Schokoriegeln den Produktionsprozess radikal ändert, weil sich die Konsumenten über die bisherige Produk-tion heftig beschwert haben. Eine Moralisierung der
Märkte entdeckt man auch bei Familien, die es vor-ziehen, bei Kerzenlicht und nicht bei elektrischem Licht zu essen, oder in Restaurants, in denen die Ker-zen anscheinend nie ausgehen. Die für die Kerzenin-dustrie erfreulichen Wachstumsraten lassen sich kaum als Ergebnis rein rationalen Kaufverhaltens erklären. In der Vergangenheit war Weihnachten der wichtigste Absatzmarkt der Kerzenproduzenten, heu-te ist der Kerzenverkauf saisonunabhängig und somit ein erfolgreiches Ganz-Jahres-Produkt. Moralisierung der Märkte bedeutet aber auch, dass junge, gut aus-gebildete Menschen ihre Kreativität und ihren Leis-tungswillen in den Dienst gemeinwohlfördernder Projekte stellen und sich damit immer öfter gegen reputations- und einkommensträchtige Karriere-chancen in großen kommerziellen Unternehmen entscheiden – wie zuletzt unter dem Stichwort „Ge-neration Y“ diskutiert.
Welche moralische Basis haben Märkte?
Vor einem Jahrhundert gab der typische Haushalt in einem OECD-Land etwa 80 Prozent seines Einkom-mens für Ernährung, Kleidung und Unterkunft aus. Heute beträgt dieser Anteil an den Konsumausgaben
zwischen 30 und 40 Prozent. Es gibt kaum etwas, das die moderne Ökonomie und Gesellschaft signifikan-ter beeinflusst als die Entscheidungen der Konsu-menten am Markt. Obwohl es nicht überrascht, dass hierdurch Art und Umfang der Produktion mitbe-stimmt werden, ist der Konsument lange Zeit nicht nur von professionellen Ökonomen als isoliertes, un-informiertes, vor allem aber rein rational handelndes Einzelwesen verstanden worden, dessen Kaufent-scheidung – oder auch Kaufenthaltung – Ergebnis eng umschriebener finanzieller Überlegungen sei. Saubillig sollte es sein!
Waren es bis vor wenigen Jahren noch Dritte-Welt-Läden, kleine Verkaufsstände und winzige Bioläden,
in denen fair gehandelter Kaffee, Bioscho-kolade oder unbehandelte Baumwollpro-dukte ein Nischendasein fristeten, so haben ökologische und fair gehandelte Produkte heute eine Millionenklientel und weisen dreistellige Wachstumsraten auf. Inzwischen führen die großen Einzel-handelsketten in vielen europäischen Ländern Hunderte von fair gehandelten Produkten in ihrem Sortiment. Neben Le-bensmittel haben auch andere Waren sowohl in der Zusammensetzung der Roh-
stoffe als auch in den Produktionsabläufen zuneh-mend moralische Qualitäten. Das Marktvolumen dieser Produkte und Dienstleistungen steigt nach-haltig und rapide.
Gibt es eine neue Nachhaltigkeit sozialer Normen?
Sofern man von einer Moralisierung der Märkte in modernen Gesellschaften sprechen kann, und nicht, wie manche befürchten, von einer Verdrängung ethischer Maxime durch den Markt, rücken heute soziale Normen in den Vordergrund, die ein vom egoistischen Maximiergehabe oder Geltungskon-sum abweichendes Verhalten vorschreiben. Zu die-sen wirksamer werdenden Normen des Marktes gehören Fairness, Gesundheit, good will, Ängste und Nachhaltigkeit ebenso wie Ausgleich, Loyalität, Ra-che, Exklusivität, Originalität, Solidarität, Alter und Mitgefühl.
Und doch stammen die bis heute maßgeblichen Ideen von den Eigenschaften des Marktes und dem angeb-lich typischen Marktverhalten aus einer Zeit, in der weder Wohlstand noch Bildung verbreitet waren, sondern ausgesprochene Armut, umfassende Macht-

2007
25
_Mehr von den Autoren unter zu.de/stehrzu.de/adolf
losigkeit, Hunger und Analphabetismus vorherrsch-ten. Zugleich ist seit dem 18. Jahrhundert die Behaup-tung, Wohlstand demoralisiere, zu einem Gemein-platz geworden – genau wie der verwandte, heute oft nur noch unterschwellig präsente Befund, dass der Kapitalismus eine prinzipiell unmoralische Veran-staltung sei. Eine Versöhnung von Kapitalismus und Moral kann es deshalb, so diese Fundamentalkritik, genau so wenig geben wie etwa eine Konvergenz von ökonomischen und ökologischen Zielen.
Welches Bild bietet der Verbraucher?
Auch heute noch wird von den Verbrauchern ein trostloses Bild gezeichnet: Demnach leidet die Mehr-heit der Menschen entweder unter materiellem Man-gel oder, aus einer oft asketischen Sicht, an Übersät-tigung durch Konsumgüter. Konsumenten werden immer noch als hilflose, unmündige, unsichere, ma-nipulierte und somit schlecht beratene Käufer darge-stellt. Mit der Entdeckung des Teilzahlungssystems war demzufolge die Kritik verbunden, dass sich die Konsumenten überschulden werden, um somit nicht
nur ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zugunsten einer unmittelbaren Befriedigung von Bedürfnissen auf Spiel zu setzen.
Das gesellschaftliche Substrat der Moral und die Schubkraft für eine Moralisierung der Märkte sind dagegen die veränderten Lebensumstände des Men-schen. Diese These mag zwar strittig sein, unbestrit-ten aber ist, dass sich der Lebensstandard der meisten Menschen Jahrhunderte lang nur unwesentlich ver-ändert hat. Im Gegensatz dazu leben wir gegenwärtig nicht nur aus ökonomischer Sicht, sondern auch was den Bildungsstandard der Bevölkerung anbelangt, in einem historisch unverwechselbaren Zeitalter, jeden-falls in den so genannten entwickelten Gesellschaf-ten. Obwohl Wohlstand und Bildung – insbesondere die wachsende Wissenheit (knowledgeability) der Menschen (siehe Stehr, 2013) – weder hier noch an-derswo gleich verteilt sind, sind beide weiter verbrei-tet als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und diese schlagen sich als veränderte Lebensum-stände und Sozialstrukturen, Verhaltensweisen und Werte nieder.

2007
26
Bekommen Waren eine Würde?
Auch im Zeitalter der Moralisierung der Märkte sind Waren keine menschlichen Wesen. Da aber die Pro-duktion und Konsumption von Gütern mit einer Viel-zahl von menschlichen Werten in enger Verbindung steht, diese manchmal mit den ihnen innewohnen-den Eigenschaften geradezu verschmelzen, sind Wa-ren zunehmend hybride Gebilde. Mit anderen Worten: Heute sind es zunehmend die intrinsischen Eigen-schaften von Waren, die nützlich sind. Dazu zählen beispielweise Waren wie biologisch kultivierte Le-bensmittel und Rohstoffe, fair gehandelte Erzeugnis-se oder Strom aus erneuerbaren Quellen, denen, wie dem Menschen, eine bestimmte Würde zugeschrie-ben werden. Sodann sind Waren in zunehmendem Maße nicht mehr nur tauschbare Gegenstände oder Mittel des menschlichen Handelns. Am Markt erhält-
liche Dinge sind Symbole einer sich abzeichnenden partiellen Überwindung von Entfremdung und Ver-dinglichung, wie besonders handwerklich hergestell-te Gegenstände veranschaulichen.
Allerdings verändert die Moralisierung der Märkte sich nur die Symbolik der Waren, sondern auch ihre Materialität. Fair gehandelter Kaffee repräsentiert auch in diesem Fall die veränderte Materialität der Ware Kaffee. Der Kaffee ist seinem Wert nach hinter dem Ölmarkt die zweitwichtigste legal gehandelte Ware der Welt. Das Kaffeetrinken ist Teil eines äußerst komplexen, globalen kulturellen, sozialen und öko-nomischen Beziehungsgeflechts.
Eine Moralisierung der Märkte heißt aber nicht, dass moralisch „höhere“, „zivilere“, „humanere“, „friedliche“ oder sogar „nachhaltige“ Normen plötzlich das öko-nomische Geschehen insgesamt und auf allen Märk-ten dominieren. Es ist aber unumstritten, dass sich solche, von Vielen als moralisch überlegen einge-schätzte Verhaltensweisen von Konsumenten und Produzenten nicht nur in entwickelten Gesellschaf-ten zunehmend beobachten lassen.

2007
27
Bibliographie
_keynes, J.m. ([1930] 1963): Essays in Persuasion. New York: W.W. Norton._simmel, georg ([1901] 1989): Die Philosophie des Gel-des. Gesammelte Schriften Band. Frankfurt am Main: Suhrkamp._stehr, nico (2013): Die Freiheit ist eine Tochter des Wis-sens. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft._weBer, max ([1922] 1976): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Fünfte revidierte Auflage. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Ihre These hatte eine starke öffentliche Resonanz. Was hat Sie im Zuge dessen besonders zum Nachdenken gebracht? „Dass viele Beobachter weiter trotz gewaltiger gesamtgesellschaftlicher Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten von einer nahezu unveränderten Reali-tät des Marktgeschehens überzeugt sind.“ nico stehr
nenten des Produktionsprozesses, wie das „natürliche Kapital“, mit in die Produktionsgleichung aufgenom-men werden. So kann die These von der Moralisierung der Märkte als eine Art Schaukelbewegung von Ange-bot und Nachfrage verstanden werden, als ein gemein-samer „Tanz“ von Produzenten und Konsumenten. Das Verständnis der symbolischen und organisatorischen Dynamik des Marktes in modernen Gesellschaften setzt voraus, dass man die beobachteten Verhaltens- und Einstellungsveränderungen der Marktteilnehmer in eine Beziehung zum gesamtgesellschaftlichen Wan-del setzt. Auf jeden Fall ist ein absolut formulierter Gegensatz oder Konflikt von Wohlstand und Moral, wie er immer noch in vielen Augen unumstößlich gilt, angesichts der Dynamik gesellschaftlichen Wandels nicht haltbar.
Gibt es Risiken der Umkehr?
Sollte sich das Wirtschaftswachstum und die fast un-unterbrochene Verbesserung im Lebensstandard der Bevölkerung aller in den vergangenen Jahrzehnten allerdings umkehren, so kommt es mit Gewissheit zu Gefühlen eines „irritierten Wohlstands“, der auch eine Stagnation des Trends zur Moralisierung der Märkte bewirken kann. Eine Stagnation oder sogar massive wirtschaftliche Rückschläge können dazu führen, dass wieder vorrangig materielle Präferenzen und Anreize am Markt eine gewichtige Rolle spielen. Die Risiken einer Umkehr sind also nicht auszuschließen, und doch sind wir vorsichtig optimistisch, dass der Trend zu eine Moralisierung der Märkte nachhaltig ist, sofern gilt: nur wenn Wohlstand und Bildung gesellschaftlich gerecht verteilt sind und auch in Zukunft immer brei-tere Schichten der Bevölkerung erfassen.
Wo zeigt sich Kontinuität, wo Wandel?
Man kann sicherlich nicht unterstellen, dass neue Konventionen und Orientierungsmuster von allen Akteuren prompt geteilt werden oder dass sich ein solcher Konsens gleichsam naturwüchsig herausbildet. Bestimmte Ver-
haltensnormen werden weiter die von Minoritäten sein, Gruppen jedoch, denen zusehends Meinungsfüh-rerschaft zukommt. Auch in Zukunft werden sich die Orientierungsmuster ökonomischen Handelns von Produzenten und Konsumenten unterscheiden. Nicht alle Märkte sind gleich, noch verändern sie sich alle zur selben Zeit, im gleichen Tempo oder in allen Regi-onen dieser Welt. Bei einigen Marktformen, wie zum Beispiel beim Finanzmarkt, greifen Normen, Richtli-nien, Regulierungs- und Lenkungsmaßnahmen, die auf eine Moralisierung des Marktverhaltens hinaus-laufen, nur sehr zögerlich, vielleicht sogar nur unter sehr viel umfassenderen, globalen Anstrengungen.
Aus der Sicht der Ökonomen ist die Moral einer Ge-sellschaft Teil der institutionellen Infrastruktur die-ser Gesellschaft – genau wie das Rechtssystem oder die scientific community. Unsere These besagt, dass die strikte Einteilung in marktendogene und -exoge-ne Normen uns heute nicht mehr weiter hilft, weil sie seit jeher impli-ziert, dass die Wirksamkeit von spe-zifischen gesellschaftlichen Nor-men auf ein bestimmtes soziales Umfeld beschränkt sei. Märkte tra-gen beispielsweise zur Gestaltung der Kultur bei, wenn wir etwa an das vielfältige Sammeln verschie-denster Gegenstände durch Men-schen denken, während kulturelle Prozesse wieder-um die Märkte beeinflussen. Kulturelle Normen und Prozesse werden in der Sprache der Ökonomie zu Transaktionskosten, das heißt zu Kosten der Bezie-hungen zwischen den Menschen, insofern sie das Marktverhalten der Akteure mitbestimmen.
Was bedeutet dies für den Kapitalismus?
Und doch signalisiert die Moralisierung der Märkte keinesfalls einen Bruch mit dem Kapitalismus. Die eine kapitalistische Wirtschaftsordnung kennzeichnenden Merkmale, wie die des Privateigentums an den Pro-duktionsmitteln oder ein auf Gewinnerzielung ausge-richtetes Verhalten, werden allenfalls modifiziert, vielleicht abgemildert, aber nicht aufgehoben. Der Kapitalismus wird zum Beispiel dadurch modifiziert, dass einst als selbstverständlich angesehene Kompo-

Jetzt scannen, lesen und Probeabo bestellen.Oder direkt unter www.brandeins.de

Jetzt scannen, lesen und Probeabo bestellen.Oder direkt unter www.brandeins.de
2005
29
Weshalb Zeitungen zuverlässig überraschen müssenInterview mit Professor Dr. Klaus Schönbach, Honorarprofessor für Medienwissenschaften und bis 2010 Inhaber des BBDO-Lehrstuhls für Medienwissenschaften
Auflagen und Werbeerlöse im Sinkflug, Schließungen von Redaktionen oder ganzen Blättern: In der Zeitungsbranche jagt seit Jahren eine Hiobsbotschaft die nächste. Haben Zeitungen überhaupt noch eine Zukunft? Durchaus, sagt Klaus Schönbach – wenn es ihnen gelingt, ihren Lesern „zuverlässige Überraschungen“ zu präsentieren, wie er 2005 erstmals publizierte.
gen genießen. Einer der Väter meines Faches, der Ber-liner Professor Emil Dovifat, hat diesen Begriff schon in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geprägt. Aber zugleich legen wir Wert darauf, dass die Überraschung geordnet ist, kritisch beurteilt und ge-wichtet wird durch Leute, die davon etwas verstehen, die die überraschende Nachricht in einen Kontext einbetten, sachkundig erklären, be-greifbar und greif-bar machen. Erfolgreiche Zeitungen liefern uns also durchaus überraschende Information. Sie kanalisie-ren und strukturieren diese aber, verhindern, dass sie aus purem Zufall besteht. Und sie sorgen dafür, dass das Überraschende nicht allzu unverträglich oder verstörend ausfällt. Und erst dann können wir uns über diese Überraschungen ja auch freuen.
Betrifft die Sehnsucht nach „zuverlässigen Überra-schungen“ nur Zeitungen oder findet sie sich auch in anderen Lebensbereichen?Der französische Wissenschaftler Abraham Moles machte uns schon 1958 klar, dass jede ästhetische Er-fahrung neue und unerwartete Elemente braucht – aber Vorsicht: nicht zu viele! Mit anderen Worten: Wir finden Gemälde, Gedichte und Musik schön, wenn sie nicht zu vertraut sind, sondern uns auch mit Neuem überraschen. Sobald jedoch die Überraschung zu weit geht, wenden wir uns ab – mit Unverständnis oder sogar Verärgerung. Ein ganz alltägliches Beispiel für unsere Freude an zuverlässigen Überraschungen: Die Meisten kaufen ihre Lebensmittel immer noch im Laden ein, obwohl man sich doch schon seit geraumer Zeit die Einkaufsliste nach Hause liefern lassen kann – und manchmal sogar ohne Mehrkosten. Es fehlt,
Herr Schönbach, Sie haben für die Medien, insbesondere die Zeitung, das Prinzip der „zuverlässigen Über-raschung“ erforscht. Was verstehen Sie eigentlich darunter?Erfolgreiche Zeitungen bieten zu-verlässige Überraschungen. Überra-schung kann Spaß machen, als Freu-de an etwas Neuem, so nicht Erwar-
tetem. Diese Freude gehört zum typisch Spielerischen, das auch erwachsene Menschen auszeichnet im Unterschied zu erwachsenen Tieren. Deshalb suchen wir sogar nach Überraschung, bewahren uns eine kindliche Freude an ihr. Der Hirnforscher Manfred Spitzer geht sogar so weit zu behaupten, dass alle menschlichen Glücksgefühle letzten Endes nichts Anderes seien als die Freude über neue oder zumin-dest nicht alltägliche Erfahrungen.
Überraschungen bergen aber auch ein Problem: nicht alle sind freudig, viele sogar böse …Deshalb verlangen wir zwar nach Überraschungen, aber auch nach deren Zähmung. Sie soll nicht nur un-liebsame Überraschungen herausfiltern, sondern auch verhindern, dass wir durch zuviel Überraschung überwältigt werden, durch das total Unglaubwürdi-ge, durch Anarchie und absolutes Chaos.
Was heißt das für unsere aktuellen Informationen über öffentliche Angelegenheiten?Schön wäre es, wenn sie möglichst oft neu, manch-mal vielleicht sogar unerhört wären. Daraus entsteht nämlich die „Nachrichtenfreude“, mit der wir Zeitun-

2005
30

2005
31
Wie erleben Sie im Medienkonsum selbst die „zuverlässige Überraschung“? „Für mich ist die Zuverlässigkeit überraschender Neuigkeiten über das aktuelle Geschehen so wichtig, dass ich ausschließlich hocheffiziente Quellen nutze: ,heute‘ oder ,heute-journal‘, FAZ, Volkskrant, FAZ und Bild online. Zweck: so viel Zeitersparnis wie möglich. Ich surfe nie nach Nachrichten.“ klaus schönbach
_Mehr vom Autor unter zu.de/schönbach
denke ich, der Überraschungseffekt beispielsweise des Supermarktes. Er überrascht mit neuen Produk-ten oder solchen, die einem zuhause nicht eingefallen waren, und kann damit Einkaufende von ihren Plä-nen abbringen – eine oft durchaus angenehm über-raschende Erfahrung. Denn zugleich ist das Überra-schungspotential des Supermarktes geordnet und damit eingedämmt genug, dass es uns nicht mit Cha-os überfällt. Oder Zoos statt Safaris mit gefährlichen wilden Tieren, die Buchhandlung statt Amazon …
In jüngster Zeit ist viel vom Untergang der Zeitungs-branche die Rede. Hätten Zeitungen wieder mehr Zukunft, wenn sie in „zuverlässige Überraschungen“ investierten? Und was würde dies konkret bedeuten?In zuverlässige Überraschungen investieren heißt, die Vielfalt der Informationsquellen sichern und da-mit die Chance der Redaktion, Überraschungen über-haupt zu erfahren. Dazu können übrigens auch die berüchtigten „Leserreporter“ beitragen, aber nur, wenn die überraschenden Augenzeugenberichte, Bil-der und Meinungen der Bürger von Profis verantwor-tungsvoll ausgewählt, bearbeitet und eingebettet werden. Deshalb wäre für Zeitungen kontraproduk-tiv ein sogenannter interaktiver, dialogischer, sogar
„kollaborativer“ Journalismus, der das Publikum un-bedingt zum Mitmachen bei der Produktion der Zei-tung animieren will. Wir hören ja immer wieder gutgemeinte Vorschläge, die schwindende Leser-schaft lasse sich halten oder sogar zurückgewinnen, wenn die Empfänger diese Inhalte nur stärker mit-gestalten dürften. Ich bezweifle aber, dass es beson-ders attraktiv ist, statt der Profis einfach andere Bür-ger zu hören. Sicher hat das manchmal einen hohen Unterhaltungswert nach dem Motto: Was manche Leute für einen Quatsch daherschreiben ... Aber
„news as conversation“, also Nachrichten über die Welt erst aus einer vielstimmigen Diskussion entste-hen lassen, zu der ich zum Überfluss auch noch selbst beitragen soll – das ist für die Meisten einfach zu riskant, aber auch zu viel der Mühe. Sie wollen „ge-zielt faul“ sein dürfen, wollen vorsortierte Informa-tionen geboten bekommen, gut aufgemacht und von
Experten erklärt, vor allem aber: verifiziert. Sind es nur Gerüchte, oder wirklich Fakten?
Mit der Einführung der „Leser-Reporter“ kam eine weitere Debatte auf: die um die Professionalität und die Entprofessionalisierung des Journalismus’…Zeitungen müssen auf Professionalität bestehen und damit den Unterschied zu Weblogs betonen und ge-rade nicht verschwimmen lassen. Professionalität heißt: Journalisten erst mal gut ausbilden und dann
auch sorgfältig und ge-wissenhaft arbeiten las-sen. Eben nicht denken, dass Zeitungsleser vor allem unterhalten wer-den wollen – das wol-len sie nicht, jedenfalls kaum von der Zeitung: Wo Information drauf-steht, sollte Informati-
on auch drin sein. Sicher vertraut das Publikum dabei weniger dem einzelnen Journalisten als seiner Qua-litätskontrolle durch die Redaktion der „Tagesschau“, des „Spiegel“ oder der „Waiblinger Kreiszeitung“. Denn traditionelle Medien sind einfach wichtige Marken, die vertrauenswürdige und gleichbleibende Qualität versprechen und dieses Versprechen natürlich auch halten müssen.
Was bedeutet das für die Zukunft der Zeitung?Das Vertrauen der Leser in die Zuverlässigkeit der Marke stärken – also keine Vermischung von Wer-bung und redaktionellem Inhalt, auf Unabhängigkeit bestehen gegenüber Politik, Verbänden, Firmen und Vereinen. Nicht den einzelnen Journalisten zur eier-legenden Wollmilchsau machen wollen, jemand, der für alle Kommunikationskanäle tolle Beiträge liefern können muss. Schreiben ist halt doch etwas anderes als sprechen oder filmen. Und eigentlich immer Elie Wiesels Fragen stellen: Biete ich Informationen an, die zu Informiertheit führen? Und ist das dann eine Informiertheit, die zu Wissen führt? Und führt dieses Wissen zu Weisheit? Natürlich kann diese professio-nelle Leistung einer Tageszeitung auch online ange-boten werden. Denn die „Lizenz“ der Tageszeitung, das, wofür wir sie bezahlen, besteht ja im Grunde nicht in einem bestimmten Übertragungskanal, des-sen sie sich bedienen muss – als auf Papier gedruck-te Information etwa. Die Aufgabe einer Zeitung ist nicht eine bestimmte Form, sondern die Universali-tät ihrer Themen und professioneller Journalismus, der diese Themen bearbeitet – wo auch immer.

„Nur was zu Ende gedacht ist, bringt auch ein Ergebnis.“Napoleon I. Bonaparte
agora42 – Das philosophische Wirtschaftsmagazin
www.agora42.de 2005
32
Die Zeitungsbranche redet sich seit Jahren selbst ins Grab. Ha-ben Sie eine Erklärung dafür? „Die Renditen sinken in den letzten Jahren durchaus, und gedruckte Zeitungen haben ja tatsächlich Probleme. Nur: Jammern hilft nicht. Ich vermisse zündende Ideen, wie guter Journalismus auch ungedruckt an die Frau und den Mann zu bringen ist.“ klaus schönbach
Welche Konsequenz hat die „zuverlässige Überra-schung“ in der Konkurrenz von Tageszeitung und Internet?Zeitungen, die zuverlässige Überraschungen anbie-ten wollen, sollten das Internet gerade nicht imitie-ren, also nicht in zwei Fehler verfallen – zum Einen die Überraschung vermindern, indem sie die Zeitung
zur täglichen Zeitschrift machen: montags mit ei-nem Schwerpunkt im Sport, mittwochs in Autos und Technik, freitags in neuen Büchern und CDs und samstags in Reisen und Immobilien. Viel zu vorher-sehbar. In 15 Jahren unserer eigenen, internationalen Forschung zu den Erfolgsfaktoren von Tageszeitun-gen kommt immer wieder als Rezept zum Vorschein: Zeitungen müssen in ihren Themen so vielfältig wie möglich sein, am besten täglich und eben nicht an bestimmte Wochentage gebunden. Kompaktforma-te finde ich dafür übrigens oft zu klein – sie bieten zu wenig Überraschung auf einen Blick, dafür zuviel Zuverlässigkeit. Genauso falsch machen es allerdings Online-Zeitungen, die mit der Überraschung über-treiben, weil sie wie „newssites“ ein Sammelplatz unverbundener Nachrichten sind, aus denen wir bitte selbst etwas machen sollen. Gerade, dass die Tageszeitung ein Angebot liefert, das sich uns als Ganzes aufdrängt, ist das Wunderbare; dass die Zei-tung so genutzt werden will, wie sie ist – mit dem frechen Anspruch des „take it or leave it“.
Die Zeitungslandschaft ist zweifellos im Umbruch. Wozu würden Sie aus Sicht der Wissenschaft raten?Zeitungen sollten Leser abholen, wo immer es geht. Arroganz hilft nicht mehr, wie zum Beispiel die Auf-fassung, Gratiszeitungen seien grundsätzlich von Übel. Die Forschung aus den Niederlanden und Schweden zeigt: Diese Zeitungen sind erstens gar nicht schlecht, man kann zweitens wirklich Geld mit ihnen verdienen, vor allem aber, drittens: Jugendliche und Menschen aus unteren Bildungsschichten lesen wegen dieser Gratiszeitungen überhaupt wieder Zei-tung. Deshalb auch Lesern mehr Flexibilität erlauben:
warum nur die Alternative „Abonnement für alle Tage“ oder eben gar keins? Meine niederländischen Kollegen haben herausgefunden, dass Abos nur für Samstag oder für Freitag und Samstag oder für Sams-tag und Montag sich auszahlen und offenbar Leser davon abhalten, ihrer Zeitung gänzlich den Rücken zu kehren. Dazu gehört auch, zur Kenntnis zu nehmen,
dass Artikel nicht von der Schlagzeile herunter gelesen werden, kontinuier-lich bis zu einem bestimmten Punkt, wo der Artikel dann verlassen wird. Sondern Leser springen stattdessen hin und her, auch zwischen Artikeln, lesen etwas aus der Mitte eines Beitrags oder von ganz unten. Gute Zeitungen sollten diese „Unsitte“ den Lesern sogar er-leichtern, durch benachbarte Beiträge zu ähnlichen Themen und einer gut
erkennbaren Untergliederung längerer Artikel. Und schließlich sollte man nicht glauben, dass Beiträge, die wirklich nicht gelesen wurden, unwichtig sind. Die Zeitung wird ja als universales Informationsan-gebot geschätzt. Das kann man unmöglich jeden Tag von vorne bis hinten nutzen – aber es muss da sein, denn man weiß ja nie: Plötzlich möchte man etwas über das Schicksal Venezuelas nach Chavez wissen, oder das Kreuzworträtsel wird an einem verregneten Sonntagnachmittag dringend gebraucht.
Und wie ist Ihr Ausblick?Ich bin ganz optimistisch: So lange wir soziale Wesen sind, vielleicht sogar Bürger, muss man sich keine gro-ßen Sorgen um Zeitungen machen – jedenfalls als Anbieter einer immer wieder auf den neuesten Stand gebrachten zuverlässigen Überraschung. Ihre Ver-triebsform wird sich sicher ändern: Sie erscheinen früher oder später auf E-Papier. Aber so lange uns Neu-gier auf die Welt um uns herum antreibt, gepaart mit Bequemlichkeit und dem Wunsch, vertrauen zu dür-fen, gehen Zeitungen nicht unter, jedenfalls solche mit guten Journalistinnen und Journalisten nicht. Diese Zeitungen bleiben die verlässlichen Gefährten, die mich mit Neuigkeiten überraschen, aber auch helfen, mich in einer komplizierten Welt zurechtzufinden. Um ein solches Medium muss uns nicht bange sein.

„Nur was zu Ende gedacht ist, bringt auch ein Ergebnis.“Napoleon I. Bonaparte
agora42 – Das philosophische Wirtschaftsmagazin
www.agora42.de

2009
34
Konzert und Oper brauchen eine Verjüngungskur
Junior-Professor Dr. Martin Tröndle, Lehrstuhl für Kulturbetriebslehre und Kunstforschung, und Junior-Professor Dr. Markus Rhomberg, Lehrstuhl für Politische Kommunikation
Deutschlands Konzert- und Opernhäusern droht ein dramatischer Niedergang. Zu diesem Schluss kommt Martin Tröndle. Nach einer dreijährigen Forschungsarbeit in Kooperation mit Experten aus Publikumsforschung und Musikbetrieb forderte er 2009 angesichts einer massiven Überalterung des Publikums: „Wir müssen das Konzert verändern, wenn wir es erhalten wollen.“ Und gemeinsam mit Markus Rhomberg erforschte er die Reaktionen des Kulturbetriebs darauf.
„Silbersee ist mittler-weile die gängige Me-tapher für das ergraute Publikum klassischer
Konzerte – Veranstaltungen, die aufgrund ihrer ge-ringen sozialen Attraktivität Jüngere kaum anziehen können“, stellt Tröndle in seiner Studie fest. Er beruft sich auf eine Reihe von Untersuchungen, dass das Durchschnittsalter des Konzert-Publikums zwischen 55 und 60 Jahren liegt. Dabei ist das Durchschnitts-alter des Klassik-Publikums in den vergangenen 20 Jahren dreimal so schnell angestiegen (um rund 11 Jahre) wie das Durchschnittsalter der Bevölkerung (rund 3,4 Jahre).
Martin Tröndle: „Prognosen für die Zukunft verhei-ßen nichts Gutes: Demnach wird das Klassik-Publi-kum in den nächsten 30 Jahren um mehr als ein Drit-tel zurückgehen – es stirbt schlichtweg aus.“ Das ei-gentliche Problem der Konzert- und Opernhäuser sei deshalb der mangelnde Nachwuchs in jüngeren Al-tersgruppen; solchen vor allem, die eine völlig andere musikalische Sozialisation erlebt haben, „in der Pop- und Rockmusik die Hauptrolle spielt und der Bezug zu klassischer Musik tendenziell immer geringer wird“.

2009
35
Gibt es ein „Alters-Gen“ für Klassik?
Der Kunstmusikbetrieb profitiert derzeit noch von der Umkehrung der Alterspyramide. Das wird sich aber dramatisch ändern, wenn die nach 1960 Geborenen vermehrt zum Zielpublikum werden. „Denn die Präferenz für Klassik geht in diesen Altersgruppen – je jünger sie werden – kontinuierlich zurück“, sagt Tröndle. Dies jedoch sei kein Alters-, sondern ein Kohorteneffekt. Für Tröndle gibt es kein „Klassik-Gen“, durch das man im Alter von allein auf den Geschmack für klassische Musik käme.
In der öffentlichen Kulturförderung macht die Förderung der Musik den größten Teil aus. So gaben Bund, Länder und Gemeinden zuletzt mehr als zwei Milliarden Euro für die Musikförderung aus – das sind rund 30 Prozent der Gesamtausgaben für Kultur. Nur circa ein Prozent dieser Summe aber, kritisiert Tröndle, werden in der Musikförderung für Innovationen ausgegeben, also dafür neue Angebotsformen zu entwickeln.
Was ist der Hintergrund der drohenden Krise?
Tröndle schreibt in seinem Buch „Das Konzert“ (transcript Verlag): „Obwohl sich die Rahmenbedingungen des Konzerts etwa durch die technische Reproduzierbarkeit von Musik, den Siegeszug des Visuellen und des Virtuellen, ein verändertes Arbeits- und Freizeitverhalten, die Ausdifferenzierung und Pluralisierung der Lebensstile oder die Ökonomisierung nahezu aller Lebensbereiche maßgeblich gewandelt haben, dominiert das standardisierte bürgerliche Konzertwesen, dessen Höhepunkt zwischen 1870 und 1910 lag, bis in die Gegenwart den Musikbetrieb.“ Form und Ablauf des Konzerts, bis dahin immer wieder variiert, seien im Konzertritual bis heute nahezu unverändert erhalten geblieben.

2009
36
Wegen Ihrer Studie wurden Sie heftig angegriffen – wie geht ein Wissenschaftler eigentlich mit solchen Anwürfen um?
„Zunächst etwas irritiert, dann habe ich das innerlich schmun-zelnd zur Kenntnis genommen. Denn auch als Wissenschaftler freut es, wenn die Forschung einen ‚impact‘ zeigt. Wer schreibt schon gerne für die Schublade.“ Martin tröndle
Wie erneuern sich andere Kunstsparten?
Dass sich der klassische Konzertbetrieb in den vergan-genen hundert Jahren kaum den veränderten Rezep-tionsbedingungen angepasst hat, könnte für Tröndle der Hauptgrund für dessen Krise sein. Tröndle: „Und das hieße auch, dass die Krise der klassischen Musik weniger eine der Musik selbst ist, als vor allem eine ihrer Darbietungsformen.“
Bekräftigt sieht der Kulturwissenschaftler seine These beim Blick auf andere Kunstsparten: Das Theater bei-spielsweise habe als eine künstlerische Methode zur Transformation des historischen Materials das Regie-theater entwickelt. Im Bereich der Bildenden Kunst sei
der Beruf des Kurators entstanden, der sich auf Aus-stellungskontexte und Vermittlungsfragen speziali-sierte. Beide, so Tröndle, „haben dazu angestoßen, das Selbstverständnis dieser Kunstsparten, sowohl die Art des Zeigens und Präsentierens als auch das Inszenieren und Interpretieren, neu zu denken und konstant weiter zu entwickeln.“
Wie bekommt das Konzert Zukunft?
Derlei Transformation und das Er-proben von Methoden der Aktua-lisierung, um neue Präsentations-formen, also neue Aufführungs-formate zu entwickeln, sind im klassischen Musikbetrieb kaum vorhanden, beklagt Tröndle. Dabei gehe es nicht um eine „Eventisie-rung“ des Konzerts, sondern dar-um, „die Kunstform Konzert als
ästhetisch-soziale Präsentationsform zeitgemäß wei-ter zu entwickeln, um der Musealisierung des Konzerts und der steten Veralterung des Publikums entgegen-zuwirken“. Tröndle: „Man muss das Konzert verändern, um es zu erhalten.“

2009
37
_Mehr von den Autoren unter zu.de/troendlezu.de/rhomberg
Finden Sie vier Jahre nach Ihrer Studie Veränderungen im Kulturbetrieb und, wenn ja, wo und welche? „Das neue Ver-ständnis hat dazu geführt, dass heute anders darüber nach-gedacht wird, wie man klassische und neue Musik aufführt. Mittlerweile ist ,Das Konzert‘, wie mir eine Kollegin sagte, zur ,Bibel‘ der Veranstalter avanciert.“ Martin tröndle
Welches Echo hatte die Studie?
Die Studie wurde im Gefolge lebhaft bis heftig disku-tiert von den Medien wie auch vom Kulturbetrieb selbst
– und hatte 2011 eine weitere Studie zur Folge. Martin Tröndle und Markus Rhomberg untersuchten gemein-sam in einer Inhaltsanalyse die Berichterstattung von überregionalen und regionalen Zeitungen sowie Ra-diobeiträgen über Tröndles Thesen. „Zukunftssorgen macht man sich anscheinend im Klassikbetrieb nicht“, stellten Tröndle und Rhomberg danach fest. Sie ent-deckten drei Verhaltenskategorien, wie der Klassikbe-trieb auf die demografischen Entwicklungen reagiert: Viele versuchen diese Entwicklungen zu verdrängen, zu verdecken und zu verschweigen. Andere reagieren darauf, indem sie mehr Ressourcen fordern, um ihr Überleben zu sichern. Und nur ganz wenige beschäftigen sich mit Innovationen und Refor-men, um eine nachhaltige Ent-wicklung des Konzertbetriebs zu fördern.
Die nach wie vor weit verbreitete Zuversicht wird von den Klassik-verantwortlichen jedoch nicht belegt, sie stützt sich vielmehr allein auf persönliche Erfahrungen oder ältere Erhebun-gen, haben die beiden Autoren der Studie festgestellt. Die Klassikverantwortlichen zweifeln den prognosti-schen Wert demografischer Daten an, vergleichen die-sen unter anderem mit der Aussagekraft von „Wetter-berichten“. „Es zeigen sich zwei Realitäten: Jene vieler Intendanten, die eine Krise verdrängen – und jene der Wissenschaft“, schlussfolgern die Studienautoren.
Welches Bild ergibt sich daraus über den Kulturbetrieb?
Dieser offensichtliche Kontrast der wissenschaftli-chen Studien und den Selbstaussagen vieler Intendan-ten eröffnen zwei mögliche Interpretation, berichten Tröndle und Rhomberg: „Die erste geht von der Prä-misse aus, dass die in den Medien gefundenen Aussa-gen tatsächlich die Meinung der Akteure abbildet. Das bedeutete, man will den gesellschaftlichen Wandel und das damit einhergehende Krisenszenario für die Klassik nicht sehen.“ Es ergibt sich das Bild eines rela-tiv geschlossenen Betriebs, geprägt durch ein elitäres
Kulturverständnis, das sich an einer glanzvollen his-torischen Vergangenheit orientiert. Verstärkt könnte diese Haltung gegebenenfalls auch dadurch werden, dass ein Großteil der Intendanten selbst das Rentenal-ter erreicht haben wird, noch bevor der Publikums-schwund voll durchschlägt. „Diese Haltung könnte man als ‚Verdrängungsstrategie‘ beschreiben“, erklä-ren Tröndle und Rhomberg. Eine zweite Interpretation geht davon aus, dass den Intendanten das Problem durchaus bewusst ist, sie die Problematik aber nicht öffentlich diskutieren wollen, sie also verdecken.
„Denn zum einen könnte solch eine Diskussion die Spargelüste mancher Kämmerer und Finanzminister wecken, zum anderen sinkt die Attraktivität eines Hauses, wenn potentielle Geldgeber wissen, dass des-sen Publikum in den kommenden Jahren stark dezi-miert wird“, erklären die Studienautoren.
Wie könnten Lösungsansätze aussehen?
In der Debatte in den Medien wird aber auch mit mög-lichen Lösungsansätzen argumentiert: „Dabei finden sich sowohl Elemente, die sich mit der ‚popkulturellen Sozialisation‘ der Jugendlichen beschäftigen, als auch Elemente, die sich mit heutigen Erscheinungen wie der Medialisierung gesamter Lebensbereiche befassen“, schildern die Wissenschaftler. Viele Jüngere erlebten eine völlig andere musikalische Sozialisation. Es sei eben nicht die klassische Musik als solche, die die Ju-gend abschrecke, sondern das Ritual des Konzerts selbst.

2012
38
Der Hang zum ÜberhangProfessor Dr. Joachim Behnke, Lehrstuhl für Politikwissenschaft
Erst auf Druck des Bundesverfassungsgerichts reformierte eine große Mehrheit im Bundestag am 21. Februar 2013 das umstrittene Wahlrecht, das erst im Dezember 2011 verabschiedet und mit dem Urteil vom Juli 2012 für verfassungswidrig erklärt worden war. Das Phänomen des sogenannten negativen Stimmgewichts und der Überhangmandate hatten zum Vorwurf geführt, beides verfälsche den Wählerwillen. Zu den Kritikern des Wahlrechts von 2011 gehörte Joachim Behnke: „Dies ist das Wahlsystem meines Missvergnügens“, sagte er. Aber auch nach der Reform der Reform steht es seiner Ansicht nach mit dem Wahlrecht nicht zum Besten.
Das Urteil des Bundesver-fassungsgerichtes vom 25. Juli 2012 war deutlich: Das Wahlrecht verstoße „gegen die Grundsätze der Gleich-heit und Unmittelbarkeit der Wahl sowie der Chan-cengleichheit der Parteien“. Grund seien die Effekte des negativen Stimmgewichts. Der Politik gab das Gericht den Auftrag: „Der Gesetzge-ber ist daher gehalten, Vor-kehrungen zu treffen, die
ein Überhandnehmen ausgleichsloser Überhangman-date unterbinden.“
Negatives Stimmgewicht, Überhangmandate, – diese Begriffe kannte vor der Debatte um das Wahlrecht fast nur Insider. Joachim Behnke befasst sich seit Jahren in der Forschung mit ihnen – und vor allem ihren Folgen.
Was bewirkt das negative Stimmgewicht?
Beim negativen Stimmgewicht handelt es sich um den Effekt, dass eine Partei mehr Sitze erhalten kann, wenn sie weniger Stimmen erhält und umgekehrt. Beim alten Wahlgesetz, das vor 2001 galt, war die we-sentliche Ursache für den Effekt das Auftreten der sogenannten Überhangmandate. Denn der Effekt des negativen Stimmgewichts fand im alten Wahlgesetz auf der Ebene der so genannten Unterverteilung statt, wenn die Mandate, die einer Partei bundesweit ins-gesamt zustanden, auf die einzelnen Landeslisten verteilt wurden. „Wenn nun eine Partei in einem Bun-desland, in dem sie Überhangmandate erhält, etwas weniger Stimmen gehabt hätte, dann hätte dies zur Folge, dass in der internen Verteilung ein Sitz zum Beispiel von Baden-Württemberg nach Niedersachsen wandert“, erläutert Behnke, „da aber wegen der Über-
hangmandate die Partei in Baden-Württemberg kei-nen Sitz weniger erhält, bekommt sie insgesamt sogar einen Sitz mehr, obwohl sie insgesamt weniger Stim-men erhalten hat.“ Der Effekt des negativen Stimm-gewichts trat im alten Wahlgesetz also als Folge des Umstands auf, dass Überhangmandate nicht durch entsprechende Zweitstimmenkontingente abgedeckt waren.
Was ist das Problem bei Überhangmandaten?
Der Begriff der Überhangmandate ist zunehmend ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt, seitdem sich im Bundestag wie in den Landtagen immer stärker Fünf-Parteien-Parlamente etabliert haben. Denn Überhang-mandate sind zu einem Problem geworden. Überhang-mandate nämlich können immer öfter darüber ent-scheiden, welche Bündnisse in den Parlamenten die Mehrheit stellen – unabhängig vom eigentlichen Wäh-lerwillen und Wahlausgang. Behnke: „Dank Über-hangmandaten können Minderheiten zur Mehrheit werden und Mehrheiten in die Minderheit geraten“.
Überhangmandate entstehen insbesondere dann, „wenn eine Partei mit weniger als 50 Prozent der Zweit-stimmen in einem Bundesland annähernd alle Direkt-mandate in diesem Bundesland gewinnen kann“, er-klärt Behnke. Das bedeutet: Sie erhält durch die gewon-nenen Direktmandate mehr Sitze im Parlament, als ihnen laut Zweitstimmenergebnis eigentlich zustün-den. Bei der bisher letzten Bundestagswahl im Septem-ber 2009 hätte dies beinahe zu einem grotesken Ergeb-nis geführt: CDU/CSU und FDP hätten aufgrund der Überhangmandate ein Ergebnis von gerade einmal 45 Prozent der Stimmen zum Wahlsieg gereicht. Aber auch so führte das Wahlergebnis zu einer nie dagewe-senen Flut von Überhangmandaten: Es gab den Rekord-wert von 24 Überhangmandaten, 21 davon für die CDU und drei für die CSU. Behnke: „Überhangmandate sind also mehr denn je präsent als Begleitphänomen von

2012
39
Der Hang zum ÜberhangProfessor Dr. Joachim Behnke, Lehrstuhl für Politikwissenschaft
_Mehr vom Autor unter zu.de/behnke
Bundestagswahlen – mit folgenschweren Konsequen-zen.“ Denn: Viele sehen darin die Gefahr der Verfäl-schung des eigentlichen Wählerwillens.
Um dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Juli 2012 Genüge zu tun, verabschiedete der Bundes-tag im Februar 2013 ein neues Wahlrecht mit den Stimmen der Fraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen, die Linkspartei stimmte da-gegen. Die Reform konzentrierte sich vor allem auf einen Punkt: die Überhangmandate. Sie werden nach dem neuen Wahlrecht fortan vollständig ausgeglichen.
Welche Folgen hat das neue Wahlrecht?
Ob dies den Wählerwillen künftig besser wider-spiegeln wird, bleibt offen. Fest steht jedoch, dass der nächste Bundestag deutlich größer werden könnte. Behnke hat nachgerechnet: Die normale Größe des Bundestags beträgt 598 Sitze; wegen der Überhangmandate nach der vergangenen Wahl liegt sie aktuell bei 622 Sitzen. Im nächsten Bundestag könn-te es 642 werden – oder sogar noch deutlich mehr. Laut Behnke gibt es einen Hebeleffekt bei den Überhang- und Ausgleichsmandaten insbesondere im Hinblick auf das Abschneiden der CSU. Behnke geht davon aus, dass jedes Überhangmandat, das zwischen Main und
Isar von den Christsozialen errungen wird, mit bis zu 20 Mandaten bundesweit ausgeglichen werden muss. Allein bei sechs bis sieben dieser Überhangmandate müsse man in einem künftigen Bundestag mit bis zu 750 Sitzen rechnen – fast 130 mehr als bisher. Das Aus-maß des Zuwachses wird erst durch einen Vergleich wirklich deutlich: Es entspräche der Anzahl der Man-date, die derzeit das bevölkerungsreichste Bundesland, Nordrhein-Westfalen, insgesamt innehat.
Wie könnte eine nachhaltige Lösung aussehen?
Behnke hielte ein Parlament in dieser Größenordnung für maßlos aufgebläht: „Dann leidet die Effektivität, die ja auch wichtig ist für ein Parlament – so viele Abgeordnete brauchen wir nicht.“ Behnke blickt im Vergleich besonders in Richtung USA: Dort sitzen im Repräsentantenhaus 435 Mitglieder bei 311 Millionen Einwohnern. „Das jetzige Modell sollte nur eine Über-gangslösung für die kommende Wahl sein“, meint Behnke deshalb und hält einen neuen Anlauf in der nächsten Legislaturperiode für nötig. Für ihn wäre es
„die eleganteste Lösung, dass Überhangmandate erst gar nicht entstehen“ – etwa, indem die Wahlkreise vergrößert würden. Genügen würden seiner Ansicht nach statt bisher 299 künftig 220 bis 240 Wahlkreise. Behnke: „Der Anteil der Direktmandate an allen Man-daten im Parlament sollte sich bei 40 Prozent einpen-deln. Dann entstehen keine Probleme mit Überhang-mandaten.“ Ebenfalls wäre es möglich, aus den Ein-erwahlkreisen Zweipersonenwahlkreise zu machen, indem man zwei Wahlkreise zu einem zusammen-legt, in dem dann zwei Kandidaten direkt gewählt würden. Auch diese Lösung führte dazu, dass Über-hangmandate aller Voraussicht nach erst gar nicht mehr entstehen würden. Dafür jedoch müssten die Wahlkreise von der Politik neu zugeschnitten werden – und das kann dauern und ist für gewöhnlich mit reichlich Parteigezerre verbunden; wie auch schon vorher die Reform des Wahlrechts.
Warum tun sich die Parteien mit einer Änderung des Wahlrechts so schwer? „Weil die Materie so komplex und unsexy ist, dass man als Politiker keinen Anreiz hat, sich da-rin zu vertiefen. Wahlrechtsfragen sind aber auch Macht-fragen, und es gibt daher immer Interessen, die bei gewissen Änderungen etwas zu verlieren haben.“ joachiM behnke



2006
42

2006
43
Die vielen Schlaglöcher der VerkehrspolitikInterview 1 mit Professor Dr. Alexander Eisenkopf, Phoenix-Lehrstuhl für Allgemeine BWL & Mobility Management
_1 in gekürzter Form erschienen in der Deutschen Verkehrs-Zeitung, Nr. 30, 2013
Ein zweistelliger Milliardenbetrag fließt jährlich in Deutschland in Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur von Straße und Schiene – und doch offenbaren sich allerorten Mängel. Seit mehr als einem Dutzend Jahren forscht Alexander Eisenkopf zu diesem Phänomen, seit 2006 gehört er dem Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesverkehrsminister an. Im Interview spricht er über Mängel in der Verkehrsinfrastruktur, Nutzerfinanzierung und die Schwierigkeiten, Bürgern den Nutzen von Bauprojekten zu vermitteln.
Herr Eisenkopf, wenn in der EU von Verkehrsinfra-strukturproblemen die Rede ist, dann gilt Deutsch-land meist als Land, in dem es besser aussieht als anderswo. Ist dieser Eindruck korrekt?Man könnte sagen, wenn der Blinde sich mit dem Einäugigen vergleicht, sieht der Einäugige immer bes-ser aus. Die Verkehrsinfrastruktur hat unsere Wett-bewerbsposition in den letzten Jahrzehnten maßgeb-lich positiv beeinflusst. Jetzt müssen wir uns leider an die Brust schlagen und feststellen, dass es nicht mehr so gut läuft.
Wie steht es denn um Deutschlands Straßen, Schie-nen- und Wasserwege?Mein Eindruck ist, dass wir seit geraumer Zeit auf Pump leben. Bei der Infrastruktur zeigen sich die Schwächen, besonders beim Erhalt, erst mit Verzöge-rung. Man kann die Ausgaben also über einen länge-ren Zeitraum schleifen lassen, und das System funk-tioniert dennoch einigermaßen. Aber irgendwann haben wir die ersten größeren Schäden. Also nicht nur Schlaglöcher auf den Straßen, sondern auch Pro-bleme mit Schleusen oder mit Eisenbahn- und Auto-
bahnbrücken. Bei allen Verkehrsträgern ist über die Jahre keine entsprechende Infrastrukturpolitik be-trieben worden, die zum einen die Substanzerhaltung gewährleistet und auf der anderen Seite auch den notwendigen Ausbau garantiert. Zur Erinnerung: Die sogenannte Pällmann-Kommission hat schon im Jahr 2000 festgestellt, wir brauchen pro Jahr mindestens vier Milliarden Euro für die Verkehrswege des Bundes. Passiert ist kaum etwas.
Sind deutsche Verkehrsminister ihrem Job nicht ge-wachsen?Ich könnte dran erinnern, dass der Posten des Ver-kehrsministers erfahrungsgemäß als letzter im Ka-binett besetzt wird. Und zwar vor allem nach Partei-en-, landsmannschaftlichen und sonstigen Proporz-überlegungen. Wir hatten Legislaturperioden, in denen die Verkehrsminister so schnell wechselten, dass man sich deren Namen gar nicht merken konnte. Ich glaube aber andererseits, dass jeder Verkehrsmi-nister im Grunde seines Herzens weiß, dass die Infra-struktur wichtig ist und dass man dort investieren

2006
44
Welche persönlichen Konsequenzen ziehen Sie als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesverkehrsminister aus den Ergebnissen Ihrer Forschung? „Ich versuche Klartext mit dem Minister zu reden.“ alexander eisenkopf
muss. Er kann sich aber am Kabinettstisch nicht durchsetzen. Im politischen Geschäft ist die Infra-strukturproblematik daher nach hinten gerutscht.
Woran liegt das?Betrachten wir es mal grundsätzlich: Bei den Aus-gaben des Staates stehen die konsumtiven Verwen-dungen mittlerweile im Vordergrund. Das Geld fließt vor allem in Dinge, die Bürger direkt wahrnehmen. Also in Transferleistungen, in die soziale Sicherung. Die Investitionen stagnieren dagegen auf niedrigem Niveau. Hinzu kommt das Problem der Euro-Rettung. Die Politik ist auf Wähler angewiesen und verfolgt deshalb eine Strategie der Wählerstimmen-Maxi-mierung. Das heißt, ein Politiker wird das Programm
umsetzen, das ihm die meisten Wählerstimmen ga-rantiert. Und wenn in einer Gesellschaft mehr Trans-ferempfänger als Steuerzahler leben, dann hat das eine Politik zur Folge, bei der die Infrastruktur erst mal hintan steht.
Spielt der Verkehr in der öffentlichen Wahrnehmung eine zu defensive Rolle? Er muss sich jedenfalls immer exkulpieren. Er wird primär wahrgenommen als Verursacher externer, etwa die Umwelt belastender Effekte. Das gilt vor al-lem für den Güterverkehr. Der gedankliche Schluss, dass die Ebay-Sendung oder das Buch von Amazon, das ich gerne und womöglich noch am gleichen Tag hätte, Infrastruktur braucht, ist den Leuten nur schwer zu vermitteln. Und ob eine Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal nicht funktioniert, das interessiert den Normal-bürger nicht so richtig. Genauso wenig wie die Frage, ob die Laster über die eine oder die andere Rhein-brücke fahren müssen.
Tut die Politik da zu wenig?Die Politik hat sich bei der Einführung der Lkw-Maut unglaubwürdig gemacht. Die Maut hat nicht dazu ge-führt, dass im gleichen Maße die Investitionsetats gestiegen sind, sondern die Straßengebühr hat Steuer-mittel substituiert. Meine These wäre, wenn man eine Pkw-Maut einführen würde, dann könnte das auf Ak-zeptanz stoßen bei Bevölkerung und Autofahrern, wenn sichergestellt wäre, dass die erhobenen Mittel auch tatsächlich in den Straßenbau wandern. Aber die Bürger können da eben nicht sicher sein. Deshalb ist die Akzeptanz der Pkw-Maut derzeit schwierig.
Nur deshalb? Haben wir nicht in Deutschland eine tiefe Abneigung gegen Nutzerfinanzierung?
Ja, das stimmt. Aber heilige Kühe wer-den von Zeit zu Zeit auch mal geschlach-tet. Ich glaube, dass die Pkw-Maut für die nächste Legislaturperiode ohnehin gesetzt ist. Das wird eine neue Bundes-regierung als erstes großes Projekt in Angriff nehmen. Die meisten Parteien können sich eine Pkw-Maut bereits vor-stellen, und auch in der CDU ist man radikale Kurswechsel mittlerweile ge-
wohnt. Und die Bürger sind – wie gesagt – bereit für eine Maut oder Vignette, wenn sie wirkliche Verbes-serungen sehen durch das, was sie zahlen, und ihr Geld nicht irgendwo versickert.
Hat die Politik überhaupt eine Alternative – vor dem Hintergrund von Haushaltszwängen und Schulden-bremse?Es ist klar, dass wir mehr Nutzerfinanzierung brau-chen. Wir haben derzeit ja schon Elemente davon, den-ken Sie an die Lkw-Maut. Wir müssen das ausdehnen. Heute haben wir noch ein sehr ertragreiches Aufkom-men an Mineralöl- und Kfz-Steuer. Dabei ist die Mine-ralölsteuer keine konstante Größe. Die bestehenden CO2-Emissionsziele bedeuten gegenüber den Flotten von heute eine deutliche Reduzierung von Emissionen. Und wenn sich das perspektivisch durchsetzt im Fahr-zeugbestand, dann sinkt das Mineralölsteueraufkom-men. Folge ist, dass wir in Zukunft, wenn wir an den Steuersätzen nichts ändern, hier ein geringeres Mit-telaufkommen haben werden. Das heißt, wir brauchen in jedem Fall ein ergänzendes Finanzierungsinstru-ment, die Nutzerfinanzierung.

2006
45
Mussten Sie schon einmal Annahmen revidieren? „Annahmen sind dazu da, revidiert zu werden – auch wenn es schmerzhaft ist.“ alexander eisenkopf
_Mehr vom Autor unter zu.de/eisenkopf
Was heißt das für den Lkw-Verkehr?Wir haben schon die Diskussion über neue Mautsätze, und der Verkehrsminister ist bestrebt, noch vor Ende der Legislatur eine neue Mauthöhenverordnung zu verabschieden und damit einen Pflock einzurammen. Denn es ist erkennbar, dass eine andere Regierung mit einer möglicherweise anderen politischen Cou-leur darauf dringen würde, zu höheren Sätzen zu kommen oder das Thema „Externe Effekte“ noch mit einzubringen. Die wären wegen der EU-Vorgaben jetzt erstmalig zusätzlich berechenbar.
Wie hoch ist der Investitionsbedarf im Schienennetz?Der Daehre-Kommission zufolge brauchen wir etwa zwei Milliarden Euro per annum an zusätzlichen Mitteln – das scheint mir auf Deutschland bezogen realistisch. Damit würde das Schienennetz deutlich leistungsfähiger. Die Frage ist eher: Wo soll das Geld investiert werden? In Projekten wie Stuttgart 21? Wir brauchen eigentlich einen Entlastungskorridor für die Rheinschiene, bei dem noch nicht einmal klar ist, wo er überhaupt laufen soll, wir brauchen im Süden einen Zulauf zu den Alpentunneln, wir brauchen Trassen für den Hafenhinterlandverkehr im Norden, kurz wir haben extrem viele Baustellen, wo das Geld benötigt wird. Und dann ist da noch die Frage: Wo soll es eigentlich herkommen?
Darf ich Ihnen die Frage zurückgeben?Die Politik spielt offenbar mit dem Gedanken, was in der Infrastruktur erwirtschaftet wird, dort auch wie-der zu reinvestieren. Das wäre aber ein fundamentaler Paradigmenwechsel. Dass es der Politik gelingen wird, die Deutsche Bahn dazu zu zwingen, wird nicht funktionieren. Bleibt allenfalls die Dividende der Bahn, die der Staat erhält, und sonst wird nichts anderes übrigbleiben, als öffentliche Mittel in die Hand zu nehmen.
Sind Infrastrukturprojekte in Deutschland noch durchsetzbar?Es geht uns offensichtlich immer noch zu gut. Wir schalten unsere Atomkraftwerke ab, wir verzichten auf Fracking, was in den USA, in China und sogar in anderen EU-Staaten ein Thema ist, um die Energiever-sorgung auf ein anderes Bein zu stellen. Wir wollen
nicht einmal einen Feldversuch mit dem Lang-Lkw. Das heißt, wir sind wirtschaftlich und finanziell in der Position, dass wir glauben, wir könnten uns leisten, bestimmte Dinge nicht zu tun. Und von daher würde ich sagen, dass wir auch gegenüber bestimmten Infra-strukturprojekten diese Verweigerung ausleben.
Warum ist es so schwer, Teilen der Bevölkerung den Nutzen von Infrastruktur zu vermitteln? Der Nutzen von Infrastrukturprojekten ist diffus, der verteilt sich über viele. Den Schaden oder die Kosten, die tragen aber wenige. Hinzu kommt: Die fühlen sich nicht selten auch noch verschaukelt. Etwa wenn eine Phalanx von Befürwortern und Experten gewaltige Kostenstei-gerungen bis zum letzten Moment leugnet. Wie etwa bei Stuttgart 21. So etwas ist aber über das Bahnhofspro-jekt hinaus üblich. Damit machen sich Planer und Be-fürworter unglaubwürdig. Deshalb glaube ich, dass der gesellschaftliche Grundkonsens aufgekündigt ist, dass wir bestimmte Dinge hinnehmen müssen, wenn wir eine prosperierende Volkswirtschaft wollen.
Sind die üblichen Kostensteigerungen von der Pla-nung bis zur Realisierung zwangsläufig?Das ist schwierig zu beantworten. Sie haben hier ein Geflecht von unterschiedlichsten Faktoren, das sich nicht sauber aufdröseln lässt. Wir sehen häufig die Selbstüberschätzung von Managern und auch Politi-kern, die glauben, im Budgetrahmen bleiben zu kön-nen. Manchmal werden Kosten auch eher zu vorsichtig, der Nutzen dagegen zu vollmundig beschrieben, um
ein Projekt überhaupt auf den Weg bringen zu können. Denken Sie an die Auftritte der DB-Manager während der Schlichtung bei Stuttgart 21. Wie vehement sie bis zuletzt Mehrkosten bestritten haben. Aus heutiger Sicht muss man sagen: Entweder waren die Protago-nisten dumm oder sie haben gelogen. Planer und Ma-nager haben sich mit ihrem Verhalten selbst in die Ecke gestellt. Mit der Folge, dass in der öffentlichen Wahr-nehmung niemandem und nichts mehr geglaubt wird. Selbst wenn eine Kalkulation richtig ist.

46
Warum der Weg zum Ziel mit Steinen gepflastert istProfessorin Dr. Anja Achtziger, Lehrstuhl für Sozial- und Wirtschaftspsychologie
Jahreswechsel, Geburtstage, einschneidende Ereignisse: Sie alle dienen gern dazu, gute Vorsätze für die künftige Lebensgestaltung zu fassen. Doch warum gehen diese so oft schief? Anja Achtziger hat dies untersucht und ihre Befunde unter anderem in dem 2011 erschienenen Aufsatz „Motivation und Volition“ zusammengefasst. Und sie fand heraus, mit welchen einfachen Mitteln gute Vorsätze dennoch gelingen können.
2011
Das Setzen von Zie-len ist ein Thema, das den meisten von uns nicht völlig un-bekannt ist. Wir set-zen Ziele, mehr oder
weniger bewusst und durchdacht, in ganz unter-schiedlichen Bereichen des täglichen Lebens. Man beabsichtigt, die Wäsche an einem bestimmten Tag zu waschen, die Kinder zur Schule zu bringen, im Sport ein bestimmtes Trainingsprogramm zu absol-vieren etc. Am meisten sind uns Ziele im Berufsleben gegenwärtig. Hier tauchen selbst gesetzte Ziele auf (zum Beispiel ein bestimmtes Manuskript zu einem bestimmten Zeitpunkt fertiggestellt zu haben), aber auch Ziele, die von außen gesetzt werden (zum Bei-spiel Zielvereinbarungen mit dem jeweiligen Arbeit-geber etc). In der Wissenschaft wird unter Zielen ein erwünschter Endzustand oder Standard verstanden, der erreicht werden soll unabhängig davon, ob es sich um einen selbst gesetzten oder einen von außen kom-menden Standard handelt. Hierbei werden allgemein formulierte Ziele (zum Beispiel „Ich will das Examen möglichst gut bestehen!“) und hoch spezifische Ziele („Ich will eine bestimmte Stückzahl an Produkten innerhalb von einer Stunde/einem Tag anfertigen!“;
„Ich will in der Mathematikprüfung die Note Sehr gut erreichen!“) unterschieden.
Gelingen oder scheitern Vorsätze öfter?
Das Problem, das die meisten von uns mit ihren Zielen haben, ist es, dass wir es meistens nicht schaffen, die-se auch wirklich in die Tat umsetzen. Das gilt natür-lich besonders für eher unangenehme Ziele (zum Beispiel nach einer Operation wieder Sport zu treiben, abzunehmen, mit dem Rauchen und/oder Trinken aufzuhören etc). Die Alltagserfahrung, dass viele Zie-le nicht realisiert werden, wurde auch von der moti-vationspsychologischen Forschung bestätigt. Man schätzt über viele Situationen hinweg, dass rund nur 30 Prozent aller Ziele auch wirklich erreicht werden.
Was sind die Gründe fürs Scheitern?
Für dieses Nichterreichen von Zielen gibt es verschie-dene Gründe. Einer davon ist der, dass man sich im Vorfeld zu wenig Gedanken darüber gemacht hat, ob man das Ziel auch wirklich erreichen möchte. Das heißt: Ist das Ziel überhaupt wichtig und relevant? Ist es attraktiv, das Ziel zu erreichen? Ist das Ziel die gan-zen Mühen, den ganzen Einsatz, die ganze Zeit, die man investiert, wert? Was habe ich davon, wenn ich es tatsächlich erreichen würde? Bin ich dann stolz auf mich? Finden meine Freunde, Familie, Arbeitskolle-gen, das heißt Leute, die mir wichtig sind, es gut, dass ich es tatsächlich schaffe, mehr Sport zu treiben? Bes-sert sich meine Gesundheit dann wirklich?
Ein weiterer Grund, warum man Ziele häufig nicht erreicht, ist, dass man sich zu wenig Gedanken ge-macht hat, wie und wann man die Erreichung des Ziels überhaupt angehen will. Sprich: Man macht sich

47
_Mehr vom Autor unter zu.de/achtziger
Welche guten Vorsätze haben Sie selber schon gebrochen und welche auch erreicht? „Unser Streben nach Zielen ist meist durch eine gewisse Flexibilität gekennzeichnet. Das heißt, wir erkennen sehr wohl, wenn ein anderes, gerade wichtigeres Ziel auftaucht. Dann wechselt man vernünfti-gerweise auf das aktuell als dringlicher, wichtiger einge-schätzte Ziel und erledigt das. Solche Phänomene mögen nach außen hin manchmal nach gebrochenen Vorsätzen aussehen, sind es aber bei genauerer Betrachtung eigent-lich nicht.“ anja achtziger
2011
zu wenig die Situationen bewusst, in denen man ziel-relevantes Verhalten zeigen könnte, und macht sich nicht völlig klar, welches konkrete Verhalten in die-sen Situationen uns überhaupt dem Ziel näher brin-gen könnte. Wenn jemand beispielsweise mehr Sport treiben möchte, sollte er sich erst einmal genau klar-machen, zu welchen Tagen und Uhrzeiten für ihn das überhaupt am günstigsten ist (zum Beispiel Freitags-abend 19 Uhr). Danach soll-te man sich klar vor Augen führen, wie man beispiels-weise um diese Uhrzeit an diesem Tag die Jogging-schuhe und -Kleidung aus dem Schrank holt, sie an-zieht und losläuft.
Welchen Aufschluss gibt die Forschung?
Die Forschung hat gezeigt, dass Personen, die sich Fra-gen zur Attraktivität und Wichtigkeit von Zielen stel-len, bevor sie überhaupt mit der Planung des Strebens nach Zielen beginnen, ihre Ziele häufiger erreichen als andere. Das heißt – in die Beantwortung solcher Fragen Zeit und Energie zu investieren, ist schon mal der halbe Weg zum Ziel. Sich mit den Fragen zur Wich-tigkeit und Attraktivität von Zielen auseinanderzu-setzen, erhöht das sogenannte „Commitment“ (die Selbstverpflichtung) auf das jeweilige Ziel. Das ist der erste wichtige Schritt in Richtung Zielerreichung, denn diese Erhöhung der Selbstverpflichtung führt dazu, dass das Ziel einem wieder schneller ins Ge-dächtnis kommt und generell nicht so schnell verges-sen wird wie ein Ziel, das weniger attraktiv und wich-tig ist oder das generell auf diese Weise nicht durch-dacht wurde. Schon alleine dadurch erhöht sich ihre Umsetzungswahrscheinlichkeit. Wenn man dann noch Handlungspläne bezeihungsweise Vorsätze
bildet, die versuchen, günstige Situationen für das Streben in Richtung Ziel und konkretes Verhalten, das uns näher an das Ziel bringt, zu fassen, kann eigent-
lich nicht mehr viel schiefgehen. Mit anderen Worten, das konkrete Durch-planen wann, wo und auf welche Art und Weise man ein Ziel verfolgen will, erhöht deutlich die Wahrscheinlichkeit, das Ziel auch tatsächlich zu erreichen.
Gibt es eine Art Anleitung?
Um das hier noch etwas klarer darzustellen, kann man folgender Anleitung zum Fassen von Vorsätzen folgen (nachdem man sich über das zu erreichende Ziel klar wurde in puncto Wichtigkeit, Machtbarkeit und Attraktivität).
1. Verknüpfen Sie eine für Sie günstige Situation der Zielerreichung mit dem konkreten zielrelevanten Ver-halten anhand eines Wenn-Dann-Satzes. Beispiels-weise „Wenn es Freitagsabends 19 Uhr ist, dann ziehe ich sofort die Joggingausrüstung an und laufe los!“. Ein solches Vorgehen hat sich in der Selbstkontrollfor-schung am besten bewährt, um Menschen in der Er-reichung ihrer Ziele zu unterstützen. Die Formulie-rung von Vorsätzen in Form von Wenn-Dann-Sätzen hilft dabei, zielrelevante Situationen zu erkennen, die für die Umsetzung des Ziels sehr gut geeignet sind.
2. Formulieren Sie ihre Vorsätze möglichst einfach und genau. Möglichst kurze und klare Aussagen sind hier am besten.
3. Schreiben Sie jeden Wenn-Dann-Vorsatz dreimal auf, um ihn im Gedächtnis zu verankern. Und stellen Sie sich die relevante Situation intensiv vor. Versu-chen Sie sich auch vorzustellen, wie Sie das im Dann-Teil des Vorsatzes beschriebene Verhalten ausführen.

48
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Januar 2007StudierendeMitarbeiterPartneruniversitäten
Oktober 2005StudierendeMitarbeiterPartneruniversitäten
September 2003StudierendeMitarbeiterPartneruniversität
3475330
1513616
19151
Juni 2003Gründung der Zeppelin Universität,Finanzierungsabsicherung durch die Zeppelin GmbH, Berufung von Prof. Dr. Stephan A. Jansen als Gründungspräsident
Mai 2006Eröffnung des 3. Departments„Public Management & Governance“
Dezember 2007ZU wird Stiftungsuniversität Verabschiedung derZukunftsstrategie „zuzwölf“
September 2007Eröffnung des Dr. Manfred Bischoff Institutesfür Innovationsmanagement der EADS
Januar 2008Einweihung des Neubaus aufdem Campus Seemooser Horn
Mai 2008Erstmals vertreten im CHE-Hochschulrankingund in allen drei Departments im Spitzenfeld gelistet
Juni 2006Erste Auszeichnung von dreienals innovativer Ort im „Land der Ideen“ von Bundespräsident Dr. Horst Köhler
Dezember 2006Gründungsversammlungder Zeppelin Universitäts-Gesellschaft ZU|G
September 2003Start zweier Bachelor-Studiengänge in Wirtschaftswissenschaften und Kommunikations- und Kulturwissenschaften
November 2004Start der Reihe BürgerUniversitätmit Gästen von Thomas Gottschalk bis Dr. Norbert Lammert
Eine Auswahl der wichtigsten Meilensteine 2003 bis 2013

49
Mai 2008Erstmals vertreten im CHE-Hochschulrankingund in allen drei Departments im Spitzenfeld gelistet
2009
2010
2011
2012
2013
September 2012StudierendeMitarbeiterPartneruniversitäten
August 2013StudierendeMitarbeiterPartneruniversitäten
Mai 2011StudierendeMitarbeiterPartneruniversitäten
September 2009StudierendeMitarbeiterPartneruniversitäten
1008201
70
1152225
73
77315765
62013558
September 2011Verleihung von Promotions- und Habilitationsrecht sowie Start der vier vierjährigen Bachelor
Oktober 2008Eröffnung des Deutsche Telekom Institute for Connected Cities
Oktober 2009Eröffnung der Räumlichkeitenim Fallenbrunen 18 als Übergangslösung
Februar 2010Mehr als 100 Gründungen von ZU-Studierenden
Januar 2011ZU hat 65 Partnerunisweltweit. Neu dabei:Sciences Po in Paris
August 2010Eröffnung ZU Professional School, Start des berufsbegleitendenMaster für Family Entrepreneurship
Juli 2012Übergabe des Vorstandsvorsitzes der ZU-Stiftung von Ernst Susanek an Thomas Sattelberger
Juni 2013Spatenstich für den neuen ZU HauptCampus
Januar 2012Gründung der ZU Graduate Schoolund Start des Promotionsprogramms
Oktober 2012Eröffnung der ContainerUni im Fallenbrunnen
Juni 201220-Millionen-Spende der ZF Friedrichshafen AG für den neuen HauptCampussowie 10,5-Millionen-Spendevon der Karl Schlecht Stiftung
Februar 2011Wettbewerbsgewinn„Deutschlands engagiertesteHochschule“ mit 200.000 € Preisgeld
Mai 2011Alle Studiengänge im CHE-Ranking unterden besten 6; Wissen-schaftsrat empfiehlt eigenständiges Promotionsrecht für die ZU
Februar 2009Erste institutionelle Akkreditierungeiner süddeutschen Privathochschuledurch den Wissenschaftsrat

50
Was zu tun war undwas zu tun bleibtHöhepunkte des Frühjahrsemesters
2013
Welche neuen Bücher von ZU-Wissenschaft-lern sind erschienen?
Fragile Stabilität. Stabile Fragilität hieß das Forschungs-Jahresthema 2012 der ZU, die wichtigsten Arbeiten dazu sind in Buch-form im Springer VS Verlag, Heidelberg, erschienen. Herausgegeben von Stephan A. Jansen, Eckhard Schröter und Nico Stehr, befasst sich der Band mit der Fragilität der modernen Gesellschaft, also die wachsen-de Unfähigkeit staatlicher sowie anderer großer gesellschaftlicher Institutionen, gegenwärtig – und voraussichtlich auch in Zukunft – ihren Willen durchzusetzen. Dabei kommt es, je nach Standort in der Gesellschaft, zu einer stabilen Fragilität oder der fragilen Stabilität der sozialen, politischen, kulturellen und ökonomi-schen Verhältnisse.
Hat das Theater eine gesellschaftliche Funktion? Dirk Baecker bejaht diese Frage in seinem Buch Wozu Theater? (Verlag The-ater der Zeit, Berlin). Er sieht diese Funktion in der Reflexion auf Verhältnisse der Beob-achtung zweiter Ordnung, der Beobach-tung von Beobachtern, die das Theater auf ganz einmalige Weise leistet. Ebenfalls von Dirk Baecker erschienen: Beobachter unter sich. Eine Kulturtheorie (Suhrkamp Verlag, Berlin). Er beschreibt darin unter anderem das Wissen der Beobachter, die
Schwierigkeiten mit der Negation, eine Archäologie der Medien und das Ganze der Gesellschaft.
Mit der Entscheidungs- und Spielthe-orie (UTB, Stuttgart) befasst sich Jo-achim Behnke in seinem Buch glei-chen Titels. Im Fokus stehen strate-gische Entscheidungen rationaler Akteure. Der Band führt in die grund-
legenden Konzepte ein und zeigt die Band-breite möglicher Anwendungen in den So-zialwissenschaften auf, zum Beispiel Wir-ken von Wahlsystemen, sicherheitspoliti-sche Arrangements und Durchführung von Verhandlungen.
Wissensarbeit und Arbeitswissen – Zur Eth-nografie des kognitiven Kapitalismus (Cam-pus Verlag, Frankfurt a. M./New York) lautet der Titel des Buches von Gertraud Koch, das sie als Mitherausgeberin veröf-fentlicht hat. Ausgehend von der Erkennt-nis, dass Wissen prozessual und kon-textabhängig ist, werden in diesem Band dessen Erzeugung und Nutzung mit eth-nografischen Methoden untersucht.
In überarbeiteter und ergänzter Form er-schien Klaus Schönbachs Persuasive Kom-munikation (Springer VS, Heidelberg).Er geht darin der Frage nach, wie und warum es gelingt, Menschen dazu zu bewegen, etwas für uns zu tun – ein Produkt zu kau-fen, zu helfen, sich (ver)führen zu lassen.
Eckhard Schröter wiederum legte als Mit-herausgeber das Buch Zur Organisation öffentlicher Aufgaben – Effizienz, Effektivität und Legitimität (Verlag Barbara Budrich, Leverkusen-Opladen/Toronto) vor. In hand-buchartiger Form liefert der Band präg-nante und kompetente Beiträge zu zentra-
len Fragestellungen des öffentlichen Ma-nagements.
Als Mitherausgeber veröffentlichten Mar-tin Tröndle und Karen van den Berg das Jahrbuch Kulturmanagement 2012 zum Schwerpunkt Zukunft Publikum (transcript Verlag, Bielefeld) und beleuchteten darin die Rolle des Publikums zwischen „großem Unbekannten“ und „passivem Störfaktor“.
Welche neuen Forschungseinrichtungen gab es?
Im Beisein von Ministerialdirektor Wolf-gang Reimer vom Ministerium für Länd-lichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg wurde das neue Forschungszentrum Verbraucher, Markt und Politik | CCMP an der ZU eröff-net. Es will künftig die Verbraucherfor-schung in Baden-Württemberg stärken und Beiträge für die strategische und evi-denzbasierte Ausrichtung der Verbrau-cherpolitik leisten. Geleitet wird das CCMP von Lucia Reisch, Gastprofessorin für Kon-sumverhalten und Verbraucherpolitik an der ZU und international anerkannte Ver-braucherforschungs-Expertin.
Ebenfalls feierlich eröffnet wurde das neue Leadership Excellence Institute Zeppelin LEIZ an der ZU. Das von der Karl Schlecht Stiftung mit einer Großspende geförderte Institut wird Plattform für interdisziplinä-re, interkulturelle und intersektorale For-schung, Lehre und Weiterbildung zu den Herausforderungen der Führung. Das LEIZ wird geleitet von Josef Wieland, der zu-gleich Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Institutional Economics – Organisational Governance, Integrity Management & Transcultural Leadership ist.

51
_02
_01
_01 Ministerialdirektor Wolfgang Reimer (l.) im Gespräch mit der Institutsleiterin des CCMP, Lucia Reisch, und Stephan A. Jansen (r.), Präsident der ZU
_02 Großförderer Karl Schlecht (l.) und der wissenschaftliche Insititutsleiter des LEIZ, Josef Wieland (r.)
2013
Mit welchen Themen befassten sich wissen-schaftliche Kongresse?
Ob über künstliche Intelligenz, soziale Her-kunftsabhängigkeiten oder europäischen Fußball: Um diese und andere spannende, studentische Forschungsthemen ging es im Februar bei der ersten Forschungskon-ferenz von Studierenden für und mit Stu-dierenden. Thema dieser Forschungskon-ferenz für interdisziplinäre Fragen (ZUfo) mit Teilnehmern aus ganz Europa: Pfadab-hängigkeiten.
15 Jahre Klimapolitik unter den Vorzei-chen des Kyoto-Protokolls – und doch kein Rückgang der Treibhausgase erkenn-bar: Wo sind die neuen, zukunftsfähigen Wege in der Klimapolitik? Damit beschäf-tigte sich das Symposium 2013 des Euro-päischen Zentrums für Nachhaltigkeits-forschung | ECS im März. Zu den namhaf-ten Referenten zählten Professor Dr. Steve Rayner (Oxford University), Professor Dr. Klaus Hasselmann (ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorolo-gie in Hamburg) und Professor Dr. Dick Pels (Soziologe, Publizist und Direktor der Wissenschaftsstiftung der niederländi-schen Grünen).
Sozialunternehmertum lässt längst die Grenzen zwischen Zivilgesellschaft, Staat
und Wirtschaft verschwimmen. Aber wie sieht die Rolle im Vergleich und in Koopera-tion mit der internationalen Entwicklungs-hilfe insbesondere mit Blick auf die Schwel-len- und Entwicklungsländer aus? Darum ging es bei einer von Lisa Hanley PhD und Professor Dr. Stephan A. Jansen des „Civil Society Center | CiSoC“ in Zusammenarbeit mit der Siemens Stiftung am Wilson Cen-ter in Washington D. C. ebenfalls im März ausgerichteten internationalen Konferenz. Repräsentanten aus der Praxis wie Welt-bank, Inter-American Development Bank und der UN debattierten mit Vertretern der Universitäten Cornell, Harvard, Ox-ford, Stanford sowie den ZU-Partneruni-versitäten aus Kolumbien, Südafrika und Mexico. Der Stadt-Friedrichshafen-Lehrstuhl für Verwaltungswissenschaft und Verwal-tungsmodernisierung von Professor Dr. Eckhard Schröter richtete im April eine zweitägige Konferenz zu den sozialen Fol-gen der politischen Umwälzungen in der arabischen Welt aus. Die Tagung war Teil des dreijährigen Projektes Brücke zur ara-bischen Welt, das die ZU gemeinsam mit der American University Beirut durch-führt im Rahmen des „Baden-Württem-berg-Stipendiums für Studierende – BWS plus“, einem Programm der Baden-Würt-temberg Stiftung.
Ebenfalls im April veranstaltete das Fried-richshafener Institut für Familienunter-nehmen (FIF) zum nunmehr fünften Male seinen Friedrichshafener FamilienFrühling. Der Unternehmerkongress für die ganze Familie stand unter dem Thema Das Ge-schäftsmodell Familienunternehmen: Aus-lauf- oder Zukunftsmodell? Zu den Vortra-genden und Diskutanten gehörten Profes-sor Dr. Berthold Leibinger, Gesellschafter der Trumpf GmbH & Co. KG in Ditzingen, Stefan Heidbreder, Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen, Professor Dipl.-Ing. Karl Schlecht, Gründer und ehe-maliger Inhaber der Putzmeister Holding GmbH in Aichtal, und Hans Wall, Gründer und ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender des Außenwerbungsunternehmens Wall AG in Berlin.
Influencing EU Politics: Mobilization and Representation of European Civil Society war schließlich das Thema einer zwei-tägigen Konferenz im Mai, ausgerichtet vom Lehrstuhl für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Politikfeld- und Ver-waltungsforschung von Professor Dr. Pa-trick Bernhagen in Kooperation mit der Universität Göteborg. Es diskutierten in-ternationale, namhafte Referenten unter anderem von den Universitäten Amster-dam, Antwerpen, Aarhus, Dublin, Stock-holm, Ljubljana und Newcastle.

52
„Das etwas andere Stipendium der Zeppelin Universität bürstet gegen den Strich. Ein Signal der Einsicht und ein Zeichen des Nachdenkens. Im Zeitalter der Hochstapelei (Sloterdijk), der Antragsexzellenz, der Ver-selbständigung von Zertifizierungen aller Art und der Verkennzahlung aller Lebensbereiche ist es überfällig, wieder genauer hinzusehen: We-niger wiegen und mehr Mut zum Wägen, das ist die Botschaft aus Friedrichshafen.“ Forschung & Lehre, 07/13
2013
_03
_04
Welche prominenten Gäste sprachen zu welchen Themen?
Mehrere tausend Besucher aus der Region folgen regelmäßig den mehr als ein Dut-zend verschiedenen Formaten der ZU – Veranstaltungen mit zumeist prominen-ten Referenten. In der Bürger-Universität berichtete der Direktor des Victoria and Albert Museums in London, Martin Roth, über die gesellschaftliche Aufgabe von Museen; David Pountney, der Intendant der Bregenzer Festspiele, und der Kunst-wissenschaftler Jan Assmann diskutier-ten „Die Zauberflöte: Machwerk, Märchen-oper, Mysterienspiel.“ Und in einer musi-kalischen Bürger-Uni wagte das Ensemble Unidas „Renaissance und Gegenwart: eine musikalische Gegenüberstellung“.
Im Diskursformat „RedeGegenRede“ auf dem Berliner ZU-HauptstadtCampus strit-ten Alfred Kieser und Bruno S. Frey mit dem CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele über Sinn und Unsinn von Rankings. Und zum vieldiskutierten Thema „Managerge-hälter“ setzte sich Daimler-Arbeitsdirektor Wilfried Porth mit den ZU-Professoren
Anja Achtziger, Peer Ederer, Christian Opitz und Marcel Tyrell auseinander.
Was gab es an Auszeichnungen?
Die ZU ist im Juni mit dem Zertifikat „audit familiengerechte hochschule“ der beruf-undfamilie gGmbH ausgezeichnet wor-den. Mit dem Zertifikat erhielt die ZU die Bestätigung, dass sie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auch für die Studie-renden ein Umfeld bietet, in dem sich Be-ruf, Studium und Familie sehr gut verein-baren lassen. Die offizielle Verleihung der Urkunde erfolgte in Berlin. Mit Google bekam die ZU einen weiteren namhaften Partner im Bereich der „Digital Education Trend Group“. Hier geht es der Universität um die Erforschung und Bereitstellung digitaler Bildungsangebote jenseits der Informationslogistik. Die ZU war eine von fünf Hochschulen in ganz Europa, die mit dem „Google Coursebuilder Award“ aus-gezeichnet wurden und gefördert werden.
Das neue Stipendienprogramm der Diver-sitätsstipendien der ZU erhielt vom Stif-terverband für die Deutsche Wissenschaft
die „Hochschulperle des Monats“ (vgl. Zitat aus Forschung & Lehre). Und ein ZU-Team, bestehend aus den Studierenden Tim Bi-bow, Niklas Boukal, Charlotte Cassel, Fa-bian Frauenderka, Michael Ganslmeier und Jelena Hok, gewann den Publikums-preis beim „GWA Junior Agency Award“, Deutschlands anspruchsvollstem Nach-wuchswettbewerb der Kommunikations-branche.
Wie geht die Campus-Entwicklung weiter?
Mit Beginn des Frühjahrssemesters wurde die neue ContainerUni mit Ansprachen, Musik, Ausstellungen und Performances feierlich eröffnet. Vier Container-Gebäude und ein Hangar aus Fertigbauteilen mit elf Seminarräumen, rund 60 Büros für Wis-senschaftler und Verwaltung, fünf Pro-jekt- und Besprechungsräume, Arbeits- und Aufenthaltsflächen mit „Mundvoll“-Café und ein Open-Test-Haus mit studen-tischen Arbeitsräumen auf einer Fläche von rund 2500 Quadratmetern entstanden und bilden die ContainerUni der ZU. Für gut zwei Jahre ist sie das provisorische Zuhause der ZU im Fallenbrunnen. Denn

53
„Für ZF ist die Förderung der Universität an unserem Stammsitz gelebtes Corporate Citizenship. Für die Sicherung der Standortattraktivität, die re-gionale Infrastruktur und die Innovationskultur sind die ZU und der neue HauptCampus ein entscheidender Beitrag.“ Dr. steFan sommer, VorstanDsVorsitzenDer Der zF FrieDrichshaFen ag
Veranstaltungsvorschau Herbst 2013
17.09.2013 | 18.00 – 20.00 UhrBürgerUniversitätDirk Niebel, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und EntwicklungSeeCampus, Friedrichshafen
10.10.2013 | 19.30 – 21.30 UhrBürgerUniversitätKathrin Menges, Mitglied des Vorstands, HenkelSeeCampus, Friedrichshafen
17.10.2013 | Beginn: 18.30 UhrZU|G Fundraising DinnerRené Obermann, CEO der Deutschen TelekomSeeCampus, Friedrichshafen
30.10.2013 | 19.15 – 21.00 UhrFriedrichshafener BildungsgesprächeProf. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann, Präsident des Goethe-InstitutsContainerUni, Friedrichshafen
14.11.2013 | 12.00 – 14.00 UhrBürgerUniversitätGiovanni di Lorenzo, Chefredakteur, DIE ZEITSeeCampus, Friedrichshafen
_03 BürgerUni mit Martin Roth, Direktor des Victoria & Albert Museums in London
_04 Wilfried Porth, Daimler-Arbeitsdirek-tor, zum Thema „Managergehälter“
_05 Spatenstich für den neuen Haupt-Campus mit Oberbürgermeister Andreas Brand, ZF-Vorstandsvorsitzender Stefan Sommer, ZU-Geschäftführung Stephan A. Jansen und Katja Völcker (v. l. n. r.)
2013
_05
so lange wird es dauern, bis der zukünftige HauptCampus der ZU, ebenfalls im Fried-richshafener Ortsteil Fallenbrunnen, fer-tiggestellt sein wird. Dafür fiel im Mai der Startschuss mit der Baugenehmigung durch die Stadt Friedrichshafen, und im Juni erfolgte der erste Spatenstich. Damit haben die Um- und Ausbauarbeiten des ehemaligen Kasernengebäudes begonnen für 17 Seminarräume, eine große Biblio-thek, Mensa und Büros für mehr als 120 Mitarbeiter. Ermöglicht wird das Projekt durch die Zusage einer Großförderung in zweistelliger Millionenhöhe durch die ZF Friedrichshafen AG.
Während der gesamten Bauzeit informiert die ZU im Internet auf einem eigens ein-gerichteten Bau-Blog unter der Adresse hauptcampus.de: Dort kann man beispiels-weise den Baufortschritt per Livebild und Checkliste verfolgen, aber auch regelmä-ßig spannende Hintergrundinformatio-nen zum neuen HauptCampus und seiner Entstehungsgeschichte erfahren.

54
_Mehrwertige mediale Angebote der ZU
Die Zeppelin Universität versteht sich als Universität in der Gesellschaft, die als Präsenzuniversität auch für diejenigen erreichbar sein möchte, die sich gerade nicht auf dem Bodensee-Campus aufhalten können.
Folgende mediale Angebote stehen Ihnen kostenfrei rund um die Uhr zur Verfügung:
_Digitale Forschungsdelikatessen online, informativ und leicht verdaulich unter zu-daily.de
_ZU on iTUnes U Auf www.zuonitunesu.de sind Audio- und Videopod-casts unserer wichtigsten Aktivitäten zum Download erhältlich. Schauen und hören Sie einmal herein!
_ZU App Laden Sie sich die App der ZU im Appstore herunter. Die App umfasst den Veranstaltungskalender der Universi-tät, die neuesten Podcasts sowie alle News aus der ZU.
_auf – das digitale Archiv Unter zu.de/auf können Sie auf alle bisherigen Ausga-ben der auf zugreifen.
_welle20.deHier können Sie das studentische Radio der ZU rund um die Uhr erreichen. Hören Sie hinein!
undWomit befasst sich das „Medium für Zwischenfragen“?
Was tun? Was tun! ist die nunmehr fünfte Ausgabe des Magazins auf. Das Magazin für Zwischenfragen, also über das noch Un-wissbare oder eben das nicht mehr Wiss-bare sowie das Fragwürdige, erscheint seit Herbst 2011 zweimal im Jahr und gibt da-bei Einblicke in die Geistesgegenwart der Arbeit der ZU. auf ist ein monothemati-sches Wissensmagazin und beinhaltet eine Mischung aus intelligent trivialisier-ten Originalbeiträgen von Wissenschaft-lern der ZU und ihres Netzwerkes sowie journalistisch übersetzte Beiträge und In-terviews über deren Forschung. Besonders daran ist auch, dass jedes Heft mit Inter-ventionen von Künstlern begleitet wird.
Begonnen hatte es mit der Ausgabe „Macht und Mitsprache“ vor zwei Jahren. Das Heft – wie alle weiteren folgenden – hatte zum Ziel, Debatten im wahrsten Sinne der Wor-tes „auf-zu-machen“, neue Perspektiven auf alte Themen zu eröffnen und zum Nach-denken und Vormachen anzuregen. Die zweite Ausgabe im Januar 2012 widmete sich dem Thema „Positive Distanz“ – es ging um den Mythos der Nähe und mögli-che Distanzgewinne sowie um Grenzen der Grenzüberschreitung. Die dritte Ausgabe im September 2012 rückte „Bürger. Macht. Staat.“ in den Blickpunkt. Sie befasste sich mit Protest, Partizipation, Organisation und Kommunikation sozialer Innovatio-nen zwischen Bürgern und Staat. Und um
„Stabile Fragilität. Fragile Stabilität“ ging es im vierten Heft im Januar 2013. Denn, so machten es die Wissenschaftler aus: Das Fragile ist die neue Stabilität – und Fragili-täten erfordern die nächsten Agilitäten.
Begleitet wurden die Hefte 1 bis 3 vom ös-terreichischen Künstler Ruediger John und die Hefte 4 und 5 von der kanadischen Künstlerin Patricia Reed. Von Beginn an waren deren Arbeiten fester Bestandteil des Heft-Konzeptes, das von Ruediger John mitentwickelt worden war: „Konzeption
des Magazins ist es auch, eine künstleri-sche Mitwirkung als Forschungsbeitrag und Kommentierung der Themen zu inte-grieren. Die visuellen künstlerischen Ele-mente im Magazin haben als solche den Auftrag, ein kritischer ästhetischer Beitrag zu dieser zu sein – eben nicht einfach Illus-trationen oder Ornamente. So werden den wissenschaftlichen Forschungsbeiträgen die künstlerischen als Erkenntnisarbeit ebenbürtig gestellt.“
Das jeweils aktuelle Heft gibt es nicht nur online und im ausgewählten Fachbuchhan-del, sondern auch in mehr als 200 Bahn-hofsbuchhandlungen der Republik. Und alle Hefte zum (Nach-)Bestellen unter:zu.de/auf

Medium für Zwischenfragen der Zeppelin Universität
9 772192 797006
0 1
AusgAbe #01ISSN 2192-7979
DeutSchlaND 6 euRSchweIz 8 chFeuRopa 8 euR
auf #
01 – Med
iuM
für Zw
ischen
fragen
der Zeppelin
un
iversität
04-07 Wenn die Mehrheit zur Minderheit wird WelcheKonsequenzenhatdasnegativeStimmgewichtfürdiePolitik?
08-09 Der Untergang im „Silbersee“ WarumgehtdemKunstmusikbetriebderNachwuchsaus?
10-11 Verdrängen, Verdecken und Verschweigen WiegehtdieKlassikmitdemPublikums-schwundum?
12-15 Der lange Schatten der Stasi WeshalbistVertrauenskapitalfürdieWirtschaftsowichtig?
16-19 Wie wenig wir über Wirtschaft wissen WelcheFolgenhatdiesfürdenKonsumenten?
20-23 Öffnet die Daten-Bestände! WiekönnenmehramtlicheInformationendenBürgernhelfen?
24-27 Wie Deutschlands nächste Unternehmergeneration denkt WashaltenFirmennachfolgervonWerten,Bildung,KarriereundgesellschaftlichemEngagement?
28-29 Was Experten wirklich wissen WarumsindFachleutemehrdennjegefragt? 30-33 Die Vermessung von Sozialunternehmen
in Deutschland WeshalbboomenGeschäftsmodelleohne
Gewinnabsicht? 34-37 Von Marken und Managern,
Gott und Gemeinderäten WorüberforschenStudierende?
38-41 Ein Magazin als künstlerisches Experiment WarumundinwelcherFormkonzipierteRuedigerJohndiesePublikation?
42-85 Was weiter wichtig war DieZU2009-2011
Macht und Mitsprache
auf #02 – M
ediu
M fü
r Zwisch
enfrag
en d
er Zeppelin u
niv
ersitätpo
sitive d
istan
Z
Medium für Zwischenfragen der Zeppelin Universität
9 772192 797006
0 2
9 772192 797006
0 2
AusgAbe #02ISSN 2192-7979
DeutSchlaND 6 euRSchweIz 8 chFeuRopa 8 euR
Positive Distanz
Ansteckende Soziophysik
Negative Aposiopese
Grenzwertiges Management
55
auf #01 Macht und MitspracheSeptember 2011ISSN 2192-7979
auf #02 Positive DistanzJanuar 2012ISSN 2192-7979
auf #03Bürger.Macht.Staat? September 2012ISSN 2192-7979
auf #04Stabile Fragilität. Fragile Stabilität. Januar 2013ISSN 2192-7979
auf #05Was tun? Was tun!September 2013ISSN 2192-7979

56
Impressum
HerausgeberProfessor Dr. Stephan A. Jansen, Präsident ZUTim Göbel, Vizepräsident ZU
Chefredaktion Rainer Böhme
Anschrift der RedaktionZeppelin UniversitätUniversitätskommunikationAm Seemooser Horn 20D-88045 Friedrichhafen
Künstlerische InterventionPatricia Reed
Projektleitung & Art DirectionPhilipp N. Hertel
Ansprechpartner für AnzeigenPeter Aulmann | [email protected]
AbonnementsMarilena Davis | [email protected]
FotosRainer Böhme, Florian Gehm, Bertram Rusch
Auflageca. 5.000 Exemplare
Nächste AusgabeJanuar 2014
Druck Bodensee Medienzentrum GmbH & Co. KGLindauer Straße 11D-88069 Tettnang
Gedruckt auf Munken Polar 120 g/m2
Gebunden durch halbmatt gestrichenes Drive Silk 350 g/m2 mit partieller Relieflackierung
FontsThe Sans, The Mix, The Serif | Lucas de GrootMinion Pro | Robert SlimbachUnivers | Adrian Frutiger
© Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck der Beiträge nur mit ausdrücklicher Genehmigung, Quellenangabe und unter Einsendung eines Belegexemplars an die Redaktion.

WIR PUNKTEN. bodensee medienzentrumGmbH & Co. KGwww.bodensee-medienzentrum.de
WIR PUNKTEN. bodensee medienzentrumGmbH & Co. KGwww.bodensee-medienzentrum.de
WIR PUNKTEN. bodensee medienzentrumGmbH & Co. KGwww.bodensee-medienzentrum.de

AusgAbe #05issn 2192-7979
DeUtschlanD 6 eUrschweiz 8 chFeUropa 8 eUr