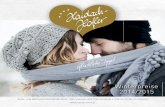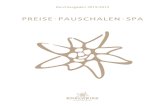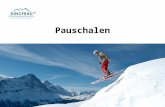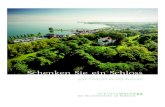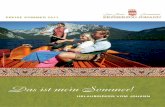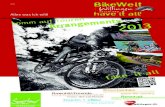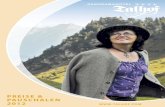Beitrag zur Methodik der pauschalen Bestimmung von Wärmedurchgangskoeffizienten bei bestehenden...
Transcript of Beitrag zur Methodik der pauschalen Bestimmung von Wärmedurchgangskoeffizienten bei bestehenden...

399© Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin · Bauphysik 35 (2013), Heft 6
Fachthemen
DOI: 10.1002/bapi.201310079
Beitrag zur Methodik der pauschalen Bestimmung von Wärmedurchgangskoeffizienten bei bestehenden Wohngebäuden
Heike Kempf
Aufgrund unzureichender oder fehlender Datengrundlagen im Wohngebäudebestand dürfen beim öffentlich-rechtlichen Nach-weis nach der Energieeinsparverordnung pauschale Kennwerte wie der Wärmedurchgangskoeffizient verwendet werden. Diese können aus einer Tabelle der Regeln zur vereinfachten Daten-aufnahme des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-entwicklung (BMVBS) entnommen werden. Die vorliegende Unter suchung zeigt, dass es sich bei den derzeitig pauschalen Wärmedurchgangkoeffizienten um einen zu vereinfachten Ansatz handelt. Diese Wärmedurchgangskoeffizienten nehmen einen nicht vernachlässigbaren Einfluss auf die Anforderungsgrößen, die zur Erstellung des Energiebedarfsausweises notwendig sind. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die derzeitige Tabelle um wei-tere Daten, wie beispielsweise die Dicke der Bauteile, zu ergän-zen.
Contribution to the methodology of the general terms at coefficients of heat transfer in existing residential buildings. Due to an insufficient or missing data base concerning existing residential buildings it is permitted to use general values, e. g. for the heat transfer coefficient (U-value) according to the German Energy Saving Ordinate. The values for simplified data acquisition are provided by the German Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development. The present study shows that the cur-rent general heat transfer coefficient results from a too simplified approach, with considerable influence on the calculated energy demand. This is the reason to extend the existing data table with further data, e. g. thickness of building component.
1 Einleitung
Zur Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs (QP) und des spezifischen auf die wärmeübertragende Umfassungs-fläche bezogenen Transmissionswärmeverlustes (H'T) dür-fen beim öffentlich-rechtlichen Nachweis, wenn energeti-sche Kennwerte – wie beispielsweise der Wärmedurch-gangskoeffizient (U-Wert) für bestehende Bauteile – nicht vorliegen, gesicherte Erfahrungswerte für Bauteile ver-gleichbarer Altersklassen verwendet werden. Die Anforde-rungsgrößen (QP und H'T) der Energieeinsparverordnung (EnEV) bilden die Grundlage zur Erstellung von Energie-bedarfsausweisen. Die Vereinfachungen für die Ermittlung der energetischen Eigenschaften, die vom Bundesministe-rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einver-nehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden
sind [1], gehören zu den Daten, die in diesem Fall Anwen-dung finden dürfen. Bei der Anwendung dieser Werte wird unterstellt, dass die Regeln der Technik eingehalten sind. Zu einer weiteren Möglichkeit, U-Werte vereinfacht zu er-mitteln, gehört die Verwendung von Katalogen, die regio-naltypische Aufbauten enthalten, wie z. B. [2]. Nachfol-gend werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie der U-Wert vereinfacht bestimmt werden kann. Die Unter-suchungen in diesem Beitrag zeigen, dass es sich bei dem Ansatz in [1] um unzureichende Angaben handelt und welchen Einfluss diese auf die Anforderungsgrößen neh-men.
2 Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten
Der U-Wert, der einen spezifischen Kennwert eines Bau-teils widerspiegelt, bildet die Grundlage zur Berechnung der Anforderungsgrößen der EnEV. Für den öffentlich-rechtlichen Nachweis wird der U-Wert gemäß EN ISO 6946 berechnet. Hauptsächlich wird die Berechnung durch die Wärmeleitfähigkeit und die Dicke der Bauteilschichten beeinflusst. Aufgrund von fehlenden Unterlagen, d. h. feh-lende Angaben über die Wärmeleitfähigkeit, der verwende-ten Materialien, so wie es bei älteren bestehenden Wohn-gebäuden oftmals der Fall ist, kann es sinnvoll sein, auf zusätzliche Daten zur Vereinfachung zurückzugreifen. Hierzu zählt die in der EnEV beschriebene Vereinfachung des BMVBS [1]. In einer dort aufgeführten Tabelle 2 mit Pauschalwerten für den Wärmedurchgangskoeffizienten nicht nachträglich gedämmter Bauteile im Urzustand können Pauschalwerte für U-Werte von Bauteilen in Ab-hängigkeit von der Art und der Funktion des Bauteils (z. B. Dach, Außenwand), der Massivbauweise oder Holzbau-weise und der Baualtersklasse des Gebäudes oder des Bau-teils (z. B. 1958 bis 1968) abgelesen werden. Somit ergibt sich beispielsweise für eine massive Außenwand eines Wohngebäudes, welches ca. 1950 errichtet wurde, ein U-Wert von 1,4 W/(m2K).
Nach [5] können weitere Quellen für eine vereinfachte Ermittlung des U-Wertes zum Einsatz kommen, wie z. B. [2]. Hierbei handelt es sich um einen Katalog mit regional-typischen Aufbauten. Darin werden die Bauteile in Abhän-gigkeit von der Konstruktion, der Dicke und dem Material, der Baualtersklasse und der entsprechenden Region (z. B. Typologie Schleswig-Holstein PLZ-Gebiete 22-25) darge-stellt.

H. Kempf · Beitrag zur Methodik der pauschalen Bestimmung von Wärmedurchgangskoeffizienten bei bestehenden Wohngebäuden
400 Bauphysik 35 (2013), Heft 6
3 Defizite der vereinfachten Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten
Die derzeit vorhandenen regionalen Kataloge zur verein-fachten Ermittlung des U-Wertes enthalten regional abhän-gige U-Werte für verschiedene Bauteile. Durch die Berück-sichtigung der Bauteildicke und des Materials sind diese U-Werte wesentlich genauer als die pauschalen Werte vom BMVBS dargestellt. Ein Problem der Kataloge liegt darin, dass die regionalen Daten nicht ausreichend und vor allem nicht flächendeckend vorhanden sind. Durch einen regio-nal abgedeckten Katalog wäre eine einfache und schnelle Erfassung der Kennwerte der Gebäudehülle möglich.
Bei der derzeitigen Tabelle 2 in [1] liegt das Defizit darin, dass es sich um zu ungenaue Werte handelt, was im Folgenden aufgezeigt wird. Begründet ist die Ungenauig-keit der Werte u. a. darin, dass die Bauteile (z. B. Außen-wand, Dach) lediglich in zwei Bauarten (massive Kon-struktion oder Holzkonstruktion) unterteilt werden. Der U-Wert ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Im We-sentlichen sind das die Dicke der Bauteile und das Mate-rial bzw. die Wärmeleitfähigkeit. Damit ist die Tabelle le-diglich für eine sehr grobe Einschätzung der energetischen Kenngröße anwendbar. Ein weiteres Defizit der Tabelle liegt in der Klassifizierung der Baualtersklassen. Die Ta-belle endet im Jahr 1995 bzw. es wird keine weitere Eintei-lung über das Jahr 1995 hinaus vorgenommen. Mit Einfüh-rung der EnEV sowie deren Novellierungen haben sich jedoch die Anforderungen an die energetischen Kenn-werte, wie die U-Werte der Bauteile, weiter verschärft.
Ein Ansatz zur Verbesserung der pauschalen Tabelle der Bekanntmachung für typisierte Nichtwohngebäude wurde bereits in [3] dargestellt. Dort werden fünf Kon-struktionen zusätzlich in die vorhandene Tabelle aufge-nommen sowie die Baualtersklassen nach 1995 erweitert. Dies stellt in den Bereichen der Klassifizierung der Baual-tersklassen einen deutlichen Verbesserungsansatz dar, je-doch nicht für die Konstruktionen der Bauteile. Weiterhin wurde ein Katalog mit opaken Bauteilen und Datenblät-tern erstellt. Dieser stellt jedoch nur einen geringfügigen Lösungsansatz zur Vereinfachung und damit zur pauscha-len Ermittlung der U-Werte dar.
4 Auswirkungen des pauschalen Ansatzes
Die in der derzeitigen Tabelle des Bundesministeriums ent-haltenen U-Werte für den Wohngebäudebestand können von den tatsächlichen Werten abweichen. Dies kann Ein-fluss auf die Beurteilung des Gebäudes nehmen, z. B. bei der Einhaltung der Anforderungen nach EnEV. Weiterhin wird die Zielsetzung des Energiebedarfsausweises, die Ver-gleichbarkeit der Gebäude untereinander, beeinflusst. Die Problemstellungen und deren Auswirkungen werden in den nachfolgenden Untersuchungen dargestellt. Zur besse-ren Veranschaulichung beziehen sich die weiteren Unter-suchungen nur auf die zuvor genannte massive Außen-wand eines Wohngebäudes, welches 1950 errichtet wurde. Damit fällt diese Außenwand in die Baualtersklasse 1958–1968. Nach dem pauschalen Ansatz kann aus der Tabelle ein U-Wert von 1,4 W/(m2K) abgelesen werden. Da keine Angaben zur Dicke oder zum Material des Bauteils in den Tabellen gemacht werden, gilt dieser U-Wert somit für jede
massive Außenwand aus der entsprechenden Baualters-klasse, unabhängig von der tatsächlichen Dicke oder dem Material (Wärmeleitfähigkeit).
Dicke und MaterialJe nach Region und Baualtersklasse kann eine massive Außen wand sehr unterschiedlich ausgeführt worden sein, z. B. als – 24 cm Vollziegel, – 24 oder 30 cm Kalksand-Lochstein, – zweischalig als Ziegelsplittbeton mit ruhender Luft-
schicht (11,5/6/11,5 cm), – Bimshohlblocksteine 24/30/38 cm, – Hochlochziegel 24/30/36 cm, – Bimsvollsteine 24/30 cm.
Aufgrund der unterschiedlichen Materialien und der unter-schiedlichen Dicken der tatsächlich vorkommenden Außen-wände ergeben sich entsprechend unterschiedliche U-Werte. Das Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen zeigt Bild 1.
Bild 1 zeigt auf der horizontalen Achse die untersuch-ten Außenwände in massiver Bauweise. Diese weisen ent-sprechend verschiedene Dicken und Materialen auf. Die berechneten U-Werte nach EN ISO 6946 sind auf der senkrechten Achse dargestellt. Die horizontale Linie in der Grafik gibt den pauschalen U-Wert von 1,40 W/(m2K) aus Tabelle 2 in [1] wieder. Aus den Berechnungen ergeben sich U-Werte von 1,10 bis zu 1,98 W/(m2K). Damit sind Abweichungen von bis zu 40 % zu verzeichnen. Anhand dieser Differenzen lässt sich erkennen, dass die derzeitige Tabelle einen zu stark pauschalierten und damit zu unge-nauen Ansatz darstellt. Durch Unterschiede im U-Wert ergeben sich entsprechende Abweichungen in den Anfor-derungsgrößen QP oder H'T, da diese vom U-Wert der Bau-teile beeinflusst werden.
Den Einfluss, den ein veränderter U-Wert auf die An-forderungsgrößen (QP und H'T) nehmen kann, wird in den Bildern 2 und 3 verdeutlicht. Den Untersuchungen liegt dabei ein freistehendes Wohngebäude zugrunde. Die grundlegenden Randbedingungen, d. h. Abmessungen, Bauteilaufbauten, Orientierung usw., bleiben in den Be-rechnungen konstant, nur der U-Wert der Außenwand wird verändert. Somit kann der Einfluss des U-Wertes bei Veränderung der Kenngröße aufgezeigt werden. Die jewei-lige horizontale Linie zeigt den Primärenergiebedarf bzw. den Transmis sionswärmeverlust, welcher sich durch den pauschalen Wert von 1,40 W/(m2K) ergibt. Mit Änderung des U-Wertes gegenüber dem Pauschalwert ändern sich die zuvor genannten Kenngrößen. Die Veränderungen können sich mit bis zu 10 % Abweichung im Ergebnis widerspie-geln. Diese sind immer in Abhängigkeit von den vorhande-nen Flächenanteilen der Bauteile zu sehen. Gerade Außen-wände und Dachflächen können aufgrund ihres großen Anteils an Fläche im Verhältnis zur gesamten Gebäudeflä-che einen größeren Einfluss als andere Bauteile auf das Ergebnis nehmen.
Die differierenden Anforderungsgrößen können einen nicht vernachlässigbaren Einfluss auf die Vergleichbarkeit der Gebäude untereinander, auf Modernisierungsempfeh-lungen und auf die zu erwartenden Einsparungen an Ener-gie nehmen. Sicherlich wird man nie ein exaktes Ergebnis

H. Kempf · Beitrag zur Methodik der pauschalen Bestimmung von Wärmedurchgangskoeffizienten bei bestehenden Wohngebäuden
401Bauphysik 35 (2013), Heft 6
Bild 3. Auswirkungen unterschiedlicher U-Werte auf den Transpissionswärmeverlust H′T am Beispiel eines freistehenden Wohngebäudes und Markierung bei pauschalem U-Wert 1,4 W/(m2K)Fig. 3. Effects of different heat transfer coefficient of on the transmission heat loss H′T of a free-standing residential building; lump U-value of 1.4 W/(m2K)
Bild 2. Auswirkungen unterschiedlicher U-Werte auf den Jahres-Primärenergiebedarf QP am Beispiel eines freistehenden Wohngebäudes und Markierung bei pauschalem U-Wert 1,4 W/(m2K)Fig. 2. Effects of different heat transfer coefficients on the annual primary energy demand QP of a free-standing residential building; lump U-value of 1.4 W/(m2K)
Bild 1. Wärmedurchgangs koeffi zienten verschiedener massiver Außenwände aus der Baualtersklasse 1958–1968 und pau-schaler U-Wert 1,4 W/(m2K)Fig. 1. Heat transfer coefficient of various solid external walls of the building age 1958–1968; lump U-value of 1.4 W/(m2K) highlighted

H. Kempf · Beitrag zur Methodik der pauschalen Bestimmung von Wärmedurchgangskoeffizienten bei bestehenden Wohngebäuden
402 Bauphysik 35 (2013), Heft 6
Die weitere Einteilung der Konstruktion ist ein wich-tiger Aspekt, da die Rohdichten und damit die Wärmeleit-fähigkeiten der Bauteile stärker voneinander abweichen können. Zusätzlich sollten verschiedene Dicken mit aufge-nommen werden. Mit Hilfe dieser weiteren Einteilungen lässt sich der U-Wert weiterhin pauschal und schnell, aber mit einer höheren Genauigkeit ermitteln.
Eine weitere Klassifizierung der Baualtersklasse sollte vor allem aufgrund der Verschärfungen der Anforderungen der Wärmeschutzverordnung bzw. Energieeinsparverord-nung wie folgt vorgenommen werden: bis 1918, 1919–1948, 1949–1957, 1958–1968, 1969–1977, 1978–1983, 1984–1994, 1995–2001, 2002–2006, ab 2007. Dabei gilt es noch, wie zuvor erwähnt, die Zeiträume von 1919 bis 1977 weiter zu untersuchen und ggf. weiter zu unterteilen.
Ein weiterer Ansatz zur pauschalen U-Wert-Ermitt-lung liegt in dem Ausbau der regionalen Kataloge. Anhand dieser ist eine einfache und schnelle Ermittlung möglich und spiegelt relativ genaue Werte wider. Diese könnten sowohl für den öffentlich-rechtlichen Nachweis als auch für die Energieberatung Einsatz finden. Die Kataloge soll-ten für alle Regionen zur Verfügung stehen. Gegebenen-falls könnten weitere Unterteilungen der Gebiete erfolgen bzw. es können verschiedene Regionen zusammengelegt werden. Regionale Karten könnten in Zusammenarbeit mit ansässigen Energieberatern, Handwerkern, der Ver-braucherzentrale sowie mit den entsprechenden Städten oder auch durch Zusammenarbeit mit Universitäten oder anderen Hochschulen erfolgen. Wichtig dabei sind eine feste Datengrundlage und damit feste Randbedingungen (z. B. Klimadaten, Beiwerte für die mittleren internen
durch die Verwendung von pauschalen Werten erzielen, jedoch sollten die auftretenden Differenzen minimiert wer-den.
BaualtersklasseIn Bild 4 ist der Verlauf der U-Werte einer massiven Außen-wand für die derzeitigen Baualtersklassen aus der Tabelle des Bundeministeriums dargestellt.
Aus Bild 4 wird ersichtlich, dass es in den Zeiträumen von 1919 bis 1957 und von 1958 bis 1978 zu größeren Sprüngen im Verlauf des U-Werts in Abhängigkeit von der Zeitdauer kommt. Diese sind genauer zu betrachten und ggf. weiter zu untergliedern. Die Tabelle endet mit dem Jahr 1995 bzw. es werden keine weiteren Einteilungen vor-genommen, obwohl es nach 1995 weitere Änderungen in den Anforderungen der Verordnungen gab. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Baualtersklassen entsprechend zu ergänzen.
5 Methodik und Zielsetzung
Ein möglicher Ansatz zur Anpassung der Tabelle 2 des Bundesministeriums in [1] zur pauschalen Ermittlung eines U-Wertes in bestehenden Wohngebäuden besteht darin, dass eine weitere Unterteilung der Bauteile hinsichtlich Bauart in Abhängigkeit der Dicke vorgenommen wird. Ge-rade bei der Dicke des Bauteils handelt es sich um eine Größe, die vor Ort gemessen werden kann. Ein Auszug zur Verbesserung wird in Tabelle 1 anhand einer massiven Außen wand in der Baualtersklasse von 1958–1968 aufge-zeigt.
Bauteil Konstruktion Baualtersklasse 1958 bis 1968
Wärmedurchgangskoeffizient [W/(m2K)]
d = 36 cm d = 30 cm d = 24 cm
Außenwand 2-schaliges Mauerwerk 1,10 1,20 1,40
Hohlblocksteine, Hochlochziegel, Bimssteine oder ähnliches 1,20 1,40 1,60
Vollziegel massiv, Ziegelmauerwerk, Hüttensteine 1,50 1,70 1,90
Tabelle 1. Pauschale Ermittlung des Wärmedurchgangs koeffizienten einer massiven Außenwand der Baualtersklasse 1958 bis 1968Table 1. General determination of the heat transfer coefficient for a solid external wall realized between 1958 and 1968
Bild 4. U-Wert bei einer massiven Außenwand nach der Tabelle 2 in [1] Fig. 4. Heat transfer values coefficient of a solid external wall according to Table 2 of [1]

H. Kempf · Beitrag zur Methodik der pauschalen Bestimmung von Wärmedurchgangskoeffizienten bei bestehenden Wohngebäuden
403Bauphysik 35 (2013), Heft 6
Literatur
[1] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Daten-verwendung im Wohngebäudebestand vom 30. Juli 2009.
[2] Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V.: Katalog regional-typischer Materialien im Gebäudebestand mit Bezug auf die Baualtersklasse und Ableitung typischer Bauteilaufbauten. 2., berichtigte Version, 20. Oktober 2009.
[3] Thiel, D., Riedel, D.: Typisierte Bauteilaufbauten – Präzisie-rung der Pauschalwerte für Wärmedurchgangskoeffizienten aus der Bekanntmachung der Regeln der Datenaufnahme im Nichtwohngebäudebestand. Forschungsinitiative Zukunft Bau. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2011.
[4] Verordnung zur Änderung der Energieeinsparverordnung vom 29. April 2009 (EnEV 2009).
[5] Deutsche Energie-Agentur (dena): Leitfaden Energieausweis Teil 1 – Energiebedarfsausweis: Datenaufnahme Wohngebäude. 2. Aufl. Dezember 2009.
Autorin dieses Beitrages:Dr.-Ing. Heike KempfArbeitsgruppe Baukonstruktion, Bauphysik und IngenieurholzbauUniversität Siegen, Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät, Department BauingenieurwesenPaul-Bonatz-Straße 9–11, 57076 Siegen
Wärme gewinne) zu schaffen, damit eine Vergleichbarkeit der Gebäude im öffentlich-rechtlichen Nachweis gewähr-leistet werden kann.
6 Zusammenfassung und Fazit
Um den Zeitaufwand bei fehlender Datengrundlage so ge-ring wie möglich zu halten, können die Regeln zur verein-fachten Datenaufnahme des Bundesministeriums zu-grunde gelegt werden. Jedoch muss bei pauschalen Ansät-zen auf die Genauigkeit geachtet werden. Aufgrund der sich nachweislich ergebenden Differenzen in den Anforde-rungsgrößen der EnEV ist die Tabelle 2 in [1] zur pauscha-len Ermittlung der U-Werte derzeitig als kritisch zu be-trachten. Der vorgestellte Ansatz zur Verbesserung der Tabelle zur Ermittlung des pauschalen U-Wertes stellt eine einfache, schnelle aber ansatzweise genauere Ermittlung der U-Werte dar. Der Einsatz gilt für die Ausstellung von Energiebedarfsausweisen und könnte ggf. auch für die Energieberatung in Betracht gezogen werden, wobei ein regional abhängiger Katalog für die Energieberatung zu bevorzugen wäre. Wichtig jedoch ist, feste Randbedingun-gen für die Erstellung von Energieausweisen zu schaffen, um damit die Vergleichbarkeit der Gebäude untereinander gewährleisten zu können.