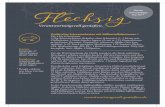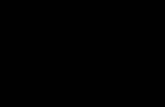Bevor Der Marker Kamen. 1
-
Upload
tristan-sharp -
Category
Documents
-
view
224 -
download
4
description
Transcript of Bevor Der Marker Kamen. 1

12
Bevor die Märker kamenAus der Vorgeschichte der Grafen von Altena-Mark und Isenberg
und der Entstehung der Grafschaften Mark und Limburg
Teil VIII: Dietrich von Isenberg kontra Adolf von der Markoder: Die Isenberger Wirren
Durch seine kölntreue Haltung war esGraf Adolf I. 1226 gelungen, den größtenTeil der altenaischen Besitzungen undRechte, die sein Großvater Graf Ever-hard von Altena vor der AltenaischenTeilung besessen hatte, für sein Haus zuretten und in seiner Hand wieder zu ver-einigen1). Bei den ehemals Isenbergi-schen Vogteien war ihm weniger Glückbeschieden. So ging die Vogtei über die
Reichsabtei Essen und dem zugehöri-gen Stift Rellinghausen seinem Haus aufvorerst unabsehbare Zeit verloren. Eshandelte sich hierbei immerhin um Ein-künfte aus insgesamt 22 Curien (Hofhal-tungen) mit 1062 Hufenhöfen in 698 Ort-schaften Westfalens2). Auch die Vogteiüber die 5 Curien der Abtei Werden, mit
ihren 164 Mansen in 110 Orten, konnte ernicht gewinnen3). Die dem Stift Kaufun-gen gehörige große curtis Herbede muss-te er auch unter die Verluste verbuchen.Deren Vogtei über ihre 59 Mansen in 23Orten vergab die Äbtissin 1226/27 anArnold von Didinckhoven4). Wer die Vog-teien über die westfälischen Güter derKlöster Siegburg, Fischbeck und Möllen-beck erhalten hat, ist mir nicht bekannt.
Als Vogt über die Curia Ekelo der AbteiSt. Pantaleon zu Köln, mit ihren 24 Man-sen in 16 Ortschaften, ist Graf Adolf I.jedenfalls nachgewiesen. Hier scheint ersich ganz in der Tradition seines Vorgän-gers Friedrichs von Isenberg, als ein„Bedrücker des Hofes Ekelo“ erwiesenzu haben. Wie Erzbischof Heinrich vonMolenark 1227 bekundete, hatte sichAdolf jedoch bereiterklärt, gegen einejährliche Zahlung von 2 Mark auf weitere„ungerechte Forderungen“ zu verzich-ten5).
So konzentrierte sich Adolf voll und ganzauf die Sicherung seiner weltlichen Be-sitzungen. Anstelle der zerstörten Burg
Isenberg ließ er im Go Hattingen durchseinen Drosten und Heerführer Ludolfvon Bönen schon am 1. Mai 1226 denGrundstein zur neuen Hauptfeste desGoes legen - der Burg Blankenstein a.d.Ruhr, einige Kilometer östlich von Hattin-gen6). Zuvor hatte Adolf am Aschermitt-woch, dem 4. März 1226, als Ersatz fürdie zerstörte Stadt Nienbrügge, die StadtHamm gegründet; unweit seiner Haupt-residenz, der Burg Mark a.d. Lippe7).
Etwa zeitgleich änderte Adolf I. auch sei-nen Namen. So ließ er den Titel einesGrafen von Altena fahren und nanntesich von nun an nur noch „Comes deMarcha - Graf von der Mark“. Graf Adolfließ den Namen „ALTENA“ aus seineralten Messingpetschaft herausschleifenund durch „MARCHA“ ersetzen. Um dieunterschiedlichen Schrifthöhen von demneuen Namen und der alten Umschriftetwas anzugleichen wurde der gesamteSiegelstock abgeschliffen, wodurch dasBildrelief an Plastizität verlor und derfeine, netzartig gerautete Hintergrund desBildfeldes zerstört wurde. Gleichzeitigwurde der Topfhelm des Reiters zu ei-nem „moderneren“ Kübelhelm mit Seh-schlitz umgearbeitet. Das Wappen mitdem wachsenden Löwen und demSchachbalken wurde aber beibehalten.Angeblich soll Graf Adolf den Namen undTitel eines Grafen von Altena durch Fried-rich von Altena-Isenberg als entehrt be-trachtet haben. Das dürfte aber m.E. insReich der Fabel gehören, da ja nachAdolfs Tod, 1249, sein jüngerer SohnOtto (1249-1264) wieder den Titel einesGrafen von Altena trug und mit dem altenkombinierten Wappen, mit Löwe undSchach, siegelte. Dagegen führte derältere Bruder Engelbert I. (1249-1277)den Titel eines „Grafen von der Mark“und siegelte erstmals nur mit dem märki-schen Schach. Daraus folgt, dass GrafAdolf I. dem von ihm angenommenenTitel eines Grafen von der Mark nur denhöheren Rang, vor dem Titel eines Gra-fen von Altena, einräumte. Über das „Wa-rum“ lässt sich nur spekulieren.
Mochte sich auch Graf Adolf I. als Grafvon der Mark bezeichnen, eine Graf-schaft Mark, als territoriales Gebilde, vonder er seinen Titel herleiten konnte, exis-
Burg Blankenstein um 1600. Rekonstruktions-zeichnung von R. Stirnberg.
Burg und Freiheit Blankenstein. Lageplan vonW. Rauterkus, 1951

13
tierte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht.Die ihm unterstellten Comitate Altena,Hövel und Bochum waren Freigrafschaf-ten, Gerichts- und Verwaltungsbezirke.Zwar hatte er in ihnen, sofern sie inner-halb des Erzbistums Köln lagen, zumgrößten Teil die dortige Gogerichtsbar-keit an sich gebracht, die später zurRechtsgrundlage einer Territorialherr-schaft wurde, doch war ihm dies im gro-ßen Nordteil der Grafschaft Hövel undder sie umgebenden zahlreichen altena-märkischen Freigrafschaften nördlich derLippe, im Bistum Münster, nicht mehrmöglich gewesen. Hier hatten schon dieBischöfe von Münster die dortige Goge-richtsbarkeit an sich gezogen. Somit be-schränkte sich die zukünftige Territorial-herrschaft „Grafschaft Mark“, die GrafAdolf I. von der Mark wohl schon ange-strebt haben mag, von vornherein nur aufdie Goe, die innerhalb des ErzbistumsKöln lagen. Realisiert wurde dieser vonKöln unabhängige Territorialstaat Graf-schaft Mark aber erst durch Adolfs EnkelGraf Everhard II., nach der Schlacht vonWorringen, 1288, durch den Sieg überden Kölner Erzbischof Siegfried vonWesterburg.
Die Machtstellung Graf Adolfs I., als Va-sall der Kölner Kirche, beruhte einzig undallein auf seinem Allodial- und Lehnsbe-sitz, den er durch seine Burgen sicherte.Etwa sieben Jahre lang konnte sich GrafAdolf des ungestörten Besitzes der okku-pierten isenbergischen Güter und Goeerfreuen. Nun aber meldete sich Dietrichvon Isenberg zu Wort, der siebzehnjähri-ge erstgeborene Sohn von Graf Friedrichvon Isenberg, der Ansprüche auf seinväterliches Erbe erhob8). Hierbei konnteer sich auf mächtige Verbündete stützen,seinen Oheim Herzog Heinrich IV. vonLimburg und Graf von Berg, Graf Ottovon Tecklenburg, die Edelherren vonSteinfurt und von der Lippe, die Grafenvon Schwalenberg, den Edelherrn Ger-hard von Wildenberg und andere. Mit imBunde waren sein Bruder Friedrich vonIsenberg und sein Onkel Wilhelm vonAltena, genannt von Isenberg, der Bru-der des hingerichteten Friedrich von Isen-berg. Dietrichs anderer weltlicher Onkel,Adolf von Holte (1220-1261) hatte sichnach dem Totschlag Engelberts von sei-ner Familie distanziert und hielt sich ab-seits.
Als ihren Hauptgegner betrachteten dieIsenberger und ihre Verbündeten jedochden Kölner Erzbischof Heinrich von Mo-lenark, den „Mörder“ des Grafen Fried-rich von Isenberg, dem sie Rache ge-schworen hatten und den sie mit allenMitteln bekämpften. Erzbischof Heinrich,gegen den in Rom ein kanonischer Pro-zess anhängig war, geriet in arge Be-drängnis; so der Tenor eines Briefes von
Papst Gregor IX., vom 17. Juni 1233, anden Bischof von Osnabrück, den KölnerDompropst und den Propst von St. Gere-on zu Köln9). Darin teilt er ihnen mit, dassdie Söhne des überaus verabscheuungs-würdigen Grafen Friedrich von Isenberg,des Mörders des Erzbischofs Engelbert,als Nachahmer seiner Gottlosigkeit, mitdem Bruder ihres Vaters, Wilhelm vonIsenberg, die Kölner Kirche und den Erz-bischof Heinrich aufs heftigste bedräng-ten. Der Papst befahl daher den Adres-saten, die Übeltäter und ihre Anhängermittels kirchlicher Strafen zur Ruhe zubringen, damit der gegen den Erzbischofeingeleitete kanonische Prozess keineVerzögerung erleide. Vom gleichen Tagdatiert ein weiteres Schreiben, das derPapst an die „Fideles“ (Getreuen) undVasallen der Kölner Kirche richtete10).Darin befahl er ihnen, der Kölner Kircheund dem Erzbischof gegen die Söhnedes Grafen Friedrich von Isenberg undWilhelm, den Bruder des Grafen, beizu-stehen. Gegen die Isenberger und ihrenAnhang wurde jedenfalls auch ein Pro-zess in Rom eröffnet, wegen des Ver-dachtes gegen die Verwandten und
Zwei Siegel von Graf Adolf I. als Graf v. Altena und v. d. MarkLinks: Beschädigter Siegelabdruck von 1226 mit dem Namen (ALT)ENA. Rechts: Siegelabdrucknach 1226 mit der Namensänderung in MARCHA. Nach Westfälische Siegel, Tafel X, Nr. 2 und3, aus dem StADortmund.
Links: Reitersiegel von Graf Diedrich von Isenberg von 1246. Umschrift: +S(IGILLUM) *THEODERICI * COMITIS * DE * ISINBERGE. Rechts: Rücksiegel des Reitersiegels. Umschrift.+SIGILLI SECRETUM. Fürstl. Benth.-Tecklenb. Archiv zu Rheda; an Urk. WUB VII, Nr. 629.
Sterlinge des Grafen Adolf I. v. d. Mark, geprägtab 1230/32 in Iserlohn. Abb. vergrößert

14
Schwäger des Mörders von ErzbischofEngelbert, die aus Rache den ErzbischofHeinrich verfolgten und ihn beleidigten11).
Etwa gleichzeitig eskalierte die Lage inWestfalen. Da Graf Adolf von der Markdie Rückgabe der isenbergischen Güterablehnte, fiel Herzog Heinrich von Lim-burg mit Heeresmacht in Adolfs Gebietein. In dieser Situation war Graf Adolf I.nahezu ohne Verbündete. Nur gestütztauf die Treue und die Kampfkraft seinerMinisterialen, gelang es ihm der LageHerr zu werden. Eine zeitliche Einord-nung der Kämpfe, z.B. um Hamm, Bö-nen, Wiedenbrück, Gassmert und Sonn-born ist leider nicht möglich. Für dasGefecht bei Wiedenbrück gibt das „Chro-nicon Veteris“ das Jahr 1232 an. WieLevold von Northof rund hundert Jahrespäter berichtet, erfolgte danach ein Lim-burgischer Vorstoß ins Ruhrtal aufSchwerte12), genauer gesagt auf die „vil-lam de swerte“, die „Arnold, Hermannund Dietrich de Altena“ gehörte, denSöhnen des 1200 urkundlichen „Gisel-her de Swerte“, der sich nach 1225, 1230
Karte der Raffenburg mit ihrer civitas, derBurgstadt, mit Einzeichnung der bis heutefestgestellten Gebäudereste und Hauspodien.Aus dem Atlas der vor- und frühgeschichtlichenBefestigungsanlagen in Westfalen. Diesogenannte Franzosenschanze ist dasBelagerungskastell des Grafen Everhard II. v.d. Mark von 1288.
Torpartie der Raffenburg während der Teil-ausgrabung von 1934. Fotoarchiv des Hohen-limburger Museums.
Rekonstruktionsversuch der Raffenburg v. R.Stirnberg. Ansicht von Norden.
Ansicht der Limburg in der ersten Bauphasevon 1242.
urkundlich, „de Altena“ nannte. Giselherhatte noch zwei weitere Söhne: Everhardund Giselher II. Letzterer erscheint ab1262 wieder als Giselher de Swerte13).
Die villam de swerte, das Dorf (= unbe-festigte Ansiedlung) zu Schwerte, wiebislang die betreffende Textstelle über-setzt wird, ging beim Angriff der Limbur-ger in Flammen auf. Hermann Esser setztden Überfall in das Jahr 1232. Dass essich hierbei um die gesamte AnsiedlungSchwerte gehandelt haben soll, beste-hend aus dem großen, wahrscheinlichschon befestigtem Xantener Hof, der „cur-tis principalis swerte“, unter der Vogteider Grafen von Kleve, mit der Hofes- undnunmehrigen Pfarrkirche St. Victor, denHöfen der Abtei Werden und der ehemalsisenbergischen, nun märkischen „curtisswerte“, als Villicationsoberhof des Ho-fesverbandes Schwerte, nebst umliegen-den Hofstätten, macht keinen Sinn. Daist zum Einen die doppelte Bedeutungdes Begriffes „villam“, der sowohl mit„Dorf“, als auch mit „Landgut“, einemgrößeren Gutskomplex, übersetzt wer-den kann. Wäre die gesamte AnsiedlungSchwerte gemeint gewesen, so hätteLevold von Northof sicherlich den Termi-nus „villam sverte“ benutzt. Er nennt sieaber „villam de sverte“ - villam zu sverte.Also kann mit „villam“ nur ein Teil derSiedlung gemeint sein. Wir müssen da-her villam mit Landgut übersetzen.Daraus folgt, dass den Gebrüdern deAltena nur die ihnen gehörige, oder vonihnen verwaltete märkische curtis swer-te, nebst möglichen umliegenden zuge-hörigen Hofstätten, von den Limburgernabgefackelt wurden. Als Herren der Ge-samtsiedlung Schwerte scheiden die deAltena jedenfalls aus.
Benannt hat sich diese Familie von/zuAltena genannt Ludenschede nach ihremBurglehen zu Altena, wie Diedrich vonSteinen berichtet. Ihr Wappen ist dem derHerren von Bönen, von Northof und vonNeuhoff gleich, und zeigt eine senkrechtstehende geöffnete Handfessel14).
Zur Finanzierung des Krieges beschrittGraf Adolf auch den Weg der Münzprä-
gung, obwohl er gar nicht dazu berechtigtwar. So ließ er ab 1230/33 in Hamm undIserlohn englische Pennys oder Sterlingenachprägen und in Umlauf bringen. Dieenglischen Sterlinge entsprachen nachRauh- und Feingewicht den Kölner Pfen-nigen und erfreuten sich im Rheinlandund in Westfalen, als inoffizielle Kursmün-zen, großer Beliebtheit. Davon gedachteGraf Adolf zu profitieren. Außerdem konn-te er so das königliche Münzregal unter-laufen. Prägeberechtigt waren zu dieserZeit in Westfalen nur der König, der Erzbi-schof von Köln und die Bischöfe von Müns-ter, Osnabrück und Paderborn. Über diemärkischen Münzen berichte ich in einemspäteren Aufsatz.
Als der Angriff der Limburger auf dievillam de swerte erfolgte, lagerte einemärkische Kohorte, unter der Führungvon Arnold de Altena, und seinen Brü-dern Hermann und Dietrich, am Randedes „Lürwaldes“, mit freier Sicht aufSchwerte. Es kann sich hierbei nur umden heutigen Börstinger Berg gehandelthaben. Die zahlenmäßig unterlegenenMärker griffen daraufhin die Limburgeran. In der Talaue, auf dem Werth, „zwi-schen den Ruhren“ vor Villigst, kam es zueiner blutigen Schlacht, die mit einer Nie-derlage der Limburger endete. SechzigLimburger Ritter und Edelknechte wur-den gefangen und nach Altena gebracht.Der genaue Ablauf ist nachzulesen beiLevold von Northof. An diese Schlachterinnert die alte Schwerter Ortssage vom„Kopf in der Ruhr bei Villigst“, die JosefSpiegel zu einem Gedicht in plattdeut-scher Sprache inspiriert hat.
Weitere wechselvolle Kämpfe folgten.Schließlich fiel der Edelherr (Gerhard?)von Wildenberg, der Verbündete des Lim-burgers, von Osten her, mit seinen Trup-pen in die Grafschaft Altena ein. Auf demBerge Gassmert bei Herscheid kam eszur Schlacht. Hierbei bereitete das mär-kische Heer den Wildenbergischen Trup-pen eine schlimme Niederlage. Im Ge-genzug fielen die Märker in die GrafschaftBerg ein, die sie mit Feuer und Schwertverwüsteten. Doch Herzog Heinrich vonLimburg und Graf von Berg holte zum

15
Schloss Hohenlimburg um 1800. Blick vom Schleipenberg ins Lennetal. Links, das KirchdorfElsey. Gemälde von H. Tillmann (1820-1913).
Gegenschlag aus. Beim heutigen Wup-pertal-Sonnborn stellte er die Märker zurSchlacht, die für sie mit einer verheeren-den Niederlage endete. In wilder Fluchtzogen sie sich in die Grafschaft Altenazurück, die Limburger hart auf den Fer-sen. Den Limburgern gelang es so, sichan der unteren Lenne, dem Go Elsey undder „cometia osteric“ dauerhaft festzu-setzen.
Eine ständige Bedrohung muss für siejedoch die starke Kölnische Raffenburggewesen sein, die den Lenneübergangder „Königsstraße“ bei Elsey sicherte,und von Hagen aus nach Iserlohn undweiter ins Hönnetal führte, wo sie diewichtigen Eisenerzgruben und Verhüt-tungsplätze dieses Raumes erschloss.Die Gefahr, die von der Raffenburg fürdie Limburger ausging, war nicht zu un-terschätzen. Daher beschloss HerzogHeinrich ihr gegenüber, in einer Entfer-nung von knapp einem Kilometer Luftli-nie, für seinen Neffen, eine starke Burgals Widerpart auf einer Bergzunge desSchleipenberges zu errichten, die er „nachdem Namen seines eigenen SchlossesLimburg (a. d. Vesdre) gleichfalls Lim-burg nannte. Es heißt, der Herzog habe„so viele Ritter dort gehabt wie Bretteroder Planken, mit denen die Burg befes-tigt wurde...“15) Es handelte sich dem-nach ursprünglich um eine Holz-Erdebe-festigung, die erst später in Steinausgebaut wurde. Zeitgleich, wie dasbisher geborgene Fundmaterial bezeugt,entstand in etwa 400 Metern Entfernung,oberhalb des heutigen Schlosses Ho-henlimburg, auf dem Schleipenberg eineweitere kleine, aber stark befestigte Burg.Sie diente vermutlich dem Flankenschutzder Limburg während des Baues. Wie siegeheißen hat wissen wir nicht. Ihre Restenennt man heute „Die Sieben Gräben aufdem Schleipenberg“. Ein kompliziertes
Wall-Graben-System, die Wälle vermut-lich als Holz-Erde-Befestigung konzipiert,umschloss ein relativ kleines, ovalesKernwerk mit Steinmauer und Steinturm(siehe Karte). Der Befund ist mir aber zurZeit noch unklar, sodass ich noch keinenRekonstruktionsvorschlag anbietenkann.
Während Herzog Heinrich die Limburgerrichtete, nahm sein Neffe Dietrich vonIsenberg auf der Oestricher Burg Quar-tier, dem alten Allodialbesitz seines Va-ters und Großvaters. Hier baute er denalten karolingischen Westring der Festezu einer regelrechten steinernen Funkti-onsburg aus, die einen runden Bergfriederhielt16). Wenn den bisher gemachtenBodenfunden zu trauen ist, so ließ Diet-rich von Isenberg möglicherweise imLaufe der folgenden Jahre nach und nachauch die anderen Befestigungen der 18Hektar großen Gesamtanlage wieder ineinen verteidigungsfähigen Zustand ver-setzen. Nach dem Ausbau des West-rings folgte die Wiederherstellung desMittelwalles, anschließend die des Ost-ringes (1244/50?). Etwa um 1247/50 (?)wurde danach der große Nordwall voll-endet. Ich hege daran aber erheblicheZweifel. Es steht für mich zwar außerFrage, dass Dietrich von Isenberg dieAbsicht gehabt hat die Oestricher Burgzu seinem hiesigen Hauptsitz zu ma-chen und auszubauen. Die Fertigstel-lung einer so ausgedehnten Befesti-gungsanlage macht aber nur dann einenSinn, wenn er nicht auch die Absichtgehabt hätte, innerhalb der Wälle eine„Civitas“, eine Burgstadt, anzulegen, wiees bei der kölnischen Raffenburg heutenachgewiesen ist. Der Grund, warumdieses Vorhaben letztlich aufgegebenwurde, muss mit dem 1243 geschlosse-nen Einigungsvertrag mit Graf Adolf zu-sammenhängen, der ein Befestigungs-
verbot enthielt. So heißt es darin: „Des-gleichen darf Dietrich keine neue Fes-tung aufbauen oder eine alte instand-setzen; noch darf Graf Adolf irgendwasbefestigen außer Kamen und Hamm;noch darf Dietrich die Stadt vor der BurgLimburg über der Lenne befestigen.“17)
Eine zeitliche Einordnung und der ge-naue Ablauf der hier geschilderten Ereig-nisse ist unmöglich festzulegen, dies lässtdie Quellenlage nicht zu. So setzt Her-mann Esser17a) die Schlacht bei Villigst,und in mutmaßlicher Folge den Einfallder Märker in die Grafschaft Berg, diemärkische Niederlage bei Sonnborn undden Baubeginn der Limburg, in das Jahr1232. Ein gewisses Wahrscheinlichkeits-moment spricht dafür, dass sich die Lim-burger und Isenberger erst nach ihremSieg bei Sonnborn im Go Elsey und dercometia osteric festsetzen konnten. Nur,wann diese Schlacht stattfand, ist völligunklar. Nach Esser hatte Ludolf von Bö-nen den Einfall in die Grafschaft Bergangeführt. Diese Aussage hat nur einenNachteil, nach 1226 lässt sich die Exis-tenz Ludolfs urkundlich nicht mehr bele-gen. Auch der Baubeginn der Limburg istvöllig unklar. Zwar sind die bislang ge-borgenen Scherben von Siegburger Früh-
Blick von Norden auf die „Sieben Gräben aufdem Schleipenberg“. Aufnahme von 1935.
Plan der „Sieben Gräben“ aus dem Atlas dervor- und frühgeschichtlichen Befestigungs-anlagen in Westfalen von 1920.

16
Ansicht des Oestricher Burgberges um 1800, mit Einzeichnung der Burg Graf Diedrichs vonIsenberg im karolingischen Westring. Bleistiftzeichnung von R. Stirnberg.
Karte des Oestricher Burgberges aus dem Atlas der vor- und frühgeschichtlichen Befestigungenin Westfalen von 1920.
Blick von Osten auf die Schlupfpforte, das sog.„Sonnenloch“, in der Westringmauer. Aufnahmevon ca. 1937. Foto: Sammlung W. Bleicher.
Der Turmstumpf des Bergfrieds im östlichenWestringbereich. Aufnahme von 1940/45. Foto:Sammlung W. Bleicher.
steinzeug vom Oestricher Burgberg undden sieben Gräben vom Schleipenbergidentisch, beide Burgen haben also zeit-gleich bestanden, doch lassen sich dieScherben mit Sicherheit nur „um die Mittedes 13. Jhdts.“ datieren.18)
Fertiggestellt war die Limburg jedenfalls1242, nach Ausweis der Urkunde vom17. Juli, in der „der Edle (noch nicht Graf)Dietrich von Isenberg“ mit Zustimmungder Brüder seines Vaters, Engelbert Bi-schof von Osnabrück, Philipp Propst von
Soest, Bruno Propst von Osnabrück,Gottfried Propst von St. Martin in Müns-ter, Wilhelm von Isenberg und Adolf vonHolte, der sich wieder zu seiner Familiebekannte, seinem Oheim Herzog Hein-rich von Limburg, in seiner Eigenschaftals Graf von Berg, die Limburg, als ihmgehöriges Allod zu Lehen aufträgt19); fer-ner zwei Höfe zu Elsey und die Höfe zuHufele/Hövel und Wanemale/Wambel.Dietrich empfängt sie als Erblehen zu-rück, sowohl in männlicher wie weib-licher Linie. Kurz gesagt, Dietrich vonIsenberg begab sich dadurch in die Lehns-abhängigkeit der Grafen von Berg. Am24.8.1244 ließen sie sich von den Burg-männern der Limburg die Treue schwö-ren20). Im gleichen Jahr musste sich Diet-rich sogar verpflichten, niemals ohne dieZustimmung der Grafen von Berg überseine Burg zu verfügen21). Diese ständi-ge Bevormundung durch seinen Oheim,und nach 1247 durch seinen Vetter GrafAdolf VI. von Berg und dessen Nachfol-ger, sollte Zeit seines Lebens anhalten,wie wir noch sehen werden.
Die alte Sachsenfeste auf dem Oestri-cher Burgberg ist uralter Kulturboden undwar seit der Mittelsteinzeit bis in dasSpätmittelalter immer wieder perioden-weise besiedelt. Das hier geborgeneFundgut übertrifft an Bedeutung das derberühmten Hohensyburg bei weitem.Doch wird sie in der wissenschaftlichenLiteratur stets stiefmütterlich behandelt.Das mag daran liegen, dass sie bei denkarolingischen Geschichtsschreibernnirgendwo Erwähnung findet. Doch be-weist die Existenz des karolingischenWestrings, dass hier in der zweiten Hälf-te des 9. Jhdts. eine fränkische Burgbe-satzung stationiert war. Die Lage derOestricher Burg auf dem Gipfelplateaudes Burgberges war strategisch günstiggewählt. Von hier aus konnten die uralte,später fränkische Königsstraße und dasLennetal kontrolliert und gesperrt wer-den.
Bis in das 19. Jhdt. hinein war der Burg-berg Teil eines großartigen Naturszena-rios unserer Heimat, das ich als das „Ei-serne Tor des Sauerlandes“ bezeichnenmöchte; den Durchbruch der Lenne durchden mitteldevonischen Massenkalk! Einheute längst dem Steinabbau zum Opfergefallener Ausläufer des „Honseler Rü-ckens“ schob sich einst von Süden bis anden Fuß des unersteigbaren Burgber-ges, mit den Kalkklippen von „Pater undNonne“, wie es meine Zeichnung nacheinem Gemälde des frühen 19. Jhdts.zeigt. Diesen tiefen Einschnitt zwischendem Burgberg und dem Honsel hat imLaufe von Äonen die Lenne geschaffen,die hier aus der Enge der Schlucht in densich öffnenden Talkessel von Letmatheaustrat.

17
Abgabenverzeichnis der „cometia osteric/Grafschaft Oestrich“, um 1250.
Blick auf den Oestricher Burgberg mit Pater und Nonne. Aufnahme um 1960.
Urkunde von der Ersterwähnung der Limburg vom 17.7.1242. StAMünster, Grafschaft Mark, Urk.Nr. 4.
Von diesem Naturschauspiel ist nichtsgeblieben. Wie ein Krebsgeschwür ha-ben sich die Steinbrüche in den Burgbergund den Honsel hineingefressen und dasTal geweitet. So ist von der Burg Diet-richs von Isenberg im Westring nichtsgeblieben. Ihre erhaltenen Mauerreste,mit dem sogenannten „Sonnenloch“, ei-nem Schlupftor, das auf den Punkt desSonnenaufgangs am Tag der Frühjahrs-und Herbst-Tagundnachtgleiche ausge-richtet war, und der Stumpf des Bergfrie-des, sind nach 1945 dem Kalkabbau zumOpfer gefallen. Nur verblassende Foto-grafien erinnern noch daran. Die gesam-te Südseite des Burgberges wurde völligverwüstet. Nur die eindrucksvolle Fels-gruppe von Pater und Nonne hat dieZeiten überdauert. Den letzten Rest derBurg beseitigte dann der Durchstich desBurgberges, zum Bau des Autobahnzu-bringers, in den siebziger Jahren des 20.Jhdts.
Von den sich um den Burgberg ranken-den Sagen ist besonders eine für uns vonInteresse. Danach lebte vor Urzeiten aufdem Burgberg ein riesiger Hüne. DessenBruder hauste auf der Wulfsegge, demStandort der späteren Burg Altena. Alssich nun der Bruder auf der Wulfseggeeines Nachts im Schlaf seine haarigenBeine kratzte, erwachte von dem Lärm,der dabei entstand, der Bruder auf demOestricher Berg und rief kummervoll aus:„Oh Brauer, du bis mir al to nah!“22) Sosoll Altena zu seinem Namen gekommensein. Wer denkt hierbei nicht gleich andas gespannte Verhältnis zwischen denBrüdern Graf Arnold von Altena, als demHerrn der Oestricher Burg, und Graf Fried-rich von Altena, als Herrn der Burg Alte-na? Hat sich so im Volksmund eine Erin-nerung an die beiden Grafenbrüder, überJahrhunderte hinweg, erhalten?
Von der Existenz der ehemaligen „come-tia osteric“ - der „Grafschaft Oestrich“erfahren wir nur aus einem Abgabenver-zeichnis, das Graf Dietrich von Isenberg
etwa um 1250 hat niederschreiben las-sen. Es findet sich am Ende der großenVogteirolle. Es werden darin die zur Graf-schaft gehörigen Güter und ihre Besitzermit der Höhe ihrer Abgaben in Denarenaufgeführt. Die Eintragungen sind zwarteilweise unlesbar geworden. Die Mehr-zahl der Güter lag um den Burgbergherum, so in Oestrich, Stengelinchusen/Stenglingsen, Lasbek, Gindena/Genna,Gruden, Steney, Letmathe und Helme-kinchusen, möglicherweise die den Hon-seler Steinbrüchen zum Opfer gefalleneSiedlung Helmke bei Letmathe. AndereHöfe lagen dagegen offensichtlich au-ßerhalb dieser Zwerggrafschaft; so inNortlon, bei Iserlohn, in Rene/Rheinen,in Coten, vermutlich bei Haus Kotten inMenden-Bösperde, und in Vrylinchusen/Frielinghausen bei Ennepetal. Bei demgenannten, nur halb lesbaren „...endor-pe“, könnte es sich um Höfe zu Tiefen-dorf, oder zu Bahrendorf bei Iserlohnhandeln. Aber auch Altendorf bei Dellwigkäme noch in Betracht.
Wollen wir die cometia osteric räumlichfassen, so lässt sich aus der Lage der umden Burgberg liegenden Höfe auf ein nurwenige Quadratkilometer großes Gebietschließen, welches flächenmäßigungefähr dem des Reichshofes Westho-fen entsprechen würde. Damit ist derReigen der Gemeinsamkeiten aber nochnicht erschöpft. Wie die sächsisch-frän-kische Sigiburg einst Mittelpunkt desReichshof war, so war auch die säch-sisch-fränkische Oestricher Burg einstZentrum ihres Gebietes, der cometiaosteric. Nun ist osteric eindeutig mit „Ost-reich“ zu übersetzen und liegt zu allemÜberfluss auch noch südöstlich desReichshofes Westhofen, auch „das ReichWesthofen“ genannt. Außerdem warendie Sigiburg/Hohensyburg und die Oe-stricher Burg durch den „Syburger Weg“verbunden, der von Hohensyburg kom-mend, bei Elsey auf die Königsstraßestieß, und dessen Name nachweislich,wenigstens abschnittweise, bei Iserlohn,auf die Königsstraße übertragen wurde.

18
Auch Sagen und Spukgeschichten sindmit dieser Straße verbunden; nachzule-sen bei Walter Ewig.23)
Bei all diesen Parallelen drängt sich mirdie Frage auf, ob wir es bei der cometiaosteric nicht mit einem untergegange-nen ehemaligen fränkischen Königshofzu tun haben, der später allodifiziert,oder dem Reich entfremdet und in eineandere Rechtsform überführt wurde. Istdieses „Ostreich“, dieser möglicherweiseehemals „östliche Reichshof“ vielleichtnamensbestimmend für den „westlichenReichshof“ geworden? Doch lassen wirdiese Spekulationen vorerst auf sich be-ruhen und wenden uns wieder den Ereig-nissen der „Isenberger Wirren“ zu.
Die Jahre zwischen 1233 und 1243 wa-ren von unablässigen Fehden zwischenGraf Adolf I. und den Isenberg-Limbur-gern erfüllt. Eine Entscheidung ist nichtgefallen. Es herrschte eine klassischePattsituation zwischen den Kontrahen-ten. Gestützt auf seine zwei Burgen, dieOestricher Burg und die Limburg, konntesich Dietrich von Isenberg mit Limbur-gisch-Bergischer Hilfe im Go Elsey undder cometia osteric behaupten; mehr aberauch nicht. Genausowenig konnte GrafAdolf eine Wende herbeiführen. EineLösung musste über kurz oder lang aufdem Verhandlungsweg gefunden wer-den.
In diesem unseligen Bruderzwist hatteGraf Adolf noch weitere Gebietsverlustehinnehmen müssen. So war die StadtLünen an den Isenberger verlorenge-gangen; desgleichen der Go Hattingen,mitsamt seiner Hauptfeste, der neuge-gründeten Burg Blankenstein. Da dieserKonflikt mit militärischen Mitteln nicht zulösen war, bot sich nur noch eine Ver-handlungslösung an, wie sie anschei-
Seite 3 der beglaubigten Abschrift, des Eini-gungsvertrages vom 1.5.1243, von etwa 1487.Foto: Archiv W. Bleicher.
nend auch von der geistlichen Fraktionder Isenberger, den Oheimen Dietrichs,angestrebt wurde. So kam es dann imFrühjahr 1243 zu Verhandlungen, nach-dem Dietrich von Isenberg von Graf Adolfdie Rückgabe der Kölnischen Lehen sei-nes Vaters gefordert hatte, mit denenAdolf durch Erzbischof Heinrich von Mo-lenark und 1238 durch Konrad von Hoch-staden belehnt worden war. Verhand-lungsführer auf Isenbergischer Seitewaren Bischof Engelbert von Osnabrück,der 1239 wieder in sein Amt eingesetztworden war, sowie Herzog Heinrich vonLimburg, der Graf von Berg. Die Ver-handlungen dürften schwierig gewesensein. Doch am 1. Mai 1243 konnte einVergleich geschlossen werden zwischenDietrich von Isenberg, seinem BruderFriedrich und seinen Schwestern Agnes,Sophia und Elisabeth einerseits und GrafAdolf I. von der Mark und dessen Ver-wandten andererseits, den Bischof En-gelbert beurkundete.24)
Es ist hier nicht der Platz um das gesam-te Vertragswerk in allen Einzelheiten, mitdem Tausch von Lehnsleuten, Ministeri-alen und Gütern, zu besprechen. Ichkann mich hier nur auf die wesentlichenPunkte beschränken. Graf Adolf wurdedarin der Besitz der beiden curtes Brene,möglicherweise Brenen, das heutige(Essen)Bredeney25) und swerte zuge-standen; ferner die Vogtei der Kirche unddas Gericht der „villa Unna“, das Gebietzwischen dem Fluss, der durch Geneggefließt und der „villa Hesne“(Heessen),wofür Dietrich zu entschädigen sei. AuchLünen und Blankenstein (mit dem GoHattingen) sollten wieder an Adolf fallen.Die Freigrafschaft und das Gericht, so-wie die curtis und Kirche zu Bochumsollten geteilt werden, wie auch das Ge-richt zu Halver und Kierspe, „um Erhal-tung ihrer Freundschaft willen“. Alle (Köl-nischen?) Güter, die Graf Friedrich freiund unbelastet besessen hatte und vonGraf Adolf verpfändet oder verlehnt wur-den, solle er binnen Jahr und Tag wiederfreimachen und an Dietrich übergeben.Bei denjenigen Gütern, die Graf Fried-rich besaß, und die bereits verlehnt wa-ren und von Graf Adolf neu verlehnt wur-den, würde Dietrich die Belehnungenanerkennen, nachdem er sie zurücker-halten hätte. Die durch Graf Adolf vollzo-genen Vertauschungen und Verschen-kungen von Ministerialen und Güternbleiben in Kraft. Die Lehnsleute und Mi-nisterialen, welche Graf Friedrich gehabthat, erhält Dietrich. Diejenigen, die aberschon damals Friedrich und Adolf ge-meinsam gehörten, sollen es auch inZukunft bleiben. „Jedoch die Söhne undTöchter des Ritters Engelbert de Altenawerden bei dem Grafen Adolf bleiben.“26)Es folgt das gegenseitige Verbot, desanderen Untertanen, Ministerialen und
Burgmänner gegen den eigenen HerrnSchutz zu geben, noch sie in die Städteaufzunehmen. Am Schluss folgt die schonangesprochene gegenseitige Befesti-gungsbeschränkung.
Der Vertrag ist gekennzeichnet von ge-genseitigem Geben und Nehmen undmacht einen ausgeglichenen Eindruck.Die bislang vertretene Ansicht, Dietrichvon Isenberg habe nur einen kleinen Teilseines väterlichen Erbes zurück erhal-ten, trifft wohl so nicht zu. Wenn sich dieHerrschaft der Isenberg-Limburger spä-ter nur auf die 118 Quadratkilometer klei-ne Grafschaft oder das Vest Limburgbeschränkte, so liegt das daran, dass sieihren Besitzstand auf Dauer nicht habenhalten können.
Das Original der Urkunde ist verlorenge-gangen, doch es existiert eine beglaubig-te Abschrift von etwa 1487. Sie befindetsich heute im Fürstl. Bentheimischen Ar-chiv zu Rheda.
Anmerkungen
1) Vergl. Urkunde vom 1. Mai 1243,gedruckt: Westfälisches Urkunden-buch (WUB) VII, Nr. 546.
2) Nach der Großen Vogteirolle. Darinsind die Namen aller Curien und dieZahl der Mansen in den einzelnenOrtschaften aufgeführt.
3) Nach Urkunde vom 19.2.1227, ge-druckt: WUB VII, Nr. 272.
4) Nach Urkunde vom 18. oder28.11.1226, gedruckt: WUB VII, Nr.279 und Urkunde vom 1.2.1227, ge-druckt: WUB VII, Nr. 291.
5) Nach Abschrift (15. Jhdt.) im Kopiardes Klosters St. Pantaleon. Histori-sches Archiv d. Stadt Köln, Geistl.Abt., Nr. 203a, Bl. 302.
6) Nach H. Flebbe, Levold von Northof,die Chronik der Grafen von der Mark;in: Die Geschichtsschreiber deut-scher Vorzeit, Hrsg. von K. Langosch,Münster/Köln 1955, S. 77. Kurztitel:Levold v. Northof, Edition Flebbe.
7) dito
8) Nach Levold v. Northof, Ed. Flebbe,S. 79-82.
9) Nach Urk. vom 17.9.1233. Vaticani-sches Archiv, gedruckt: OsnabrückerUB, Nr. 309.
10) Siehe Regest bei Knipping, Die Re-gesten der Erzbischöfe von Köln imMittelalter III, 1, Nr. 783.
11) Vaticanisches Archiv. Druck Roden-bergs nach Registerband 17, f. 41v,Nr. 145: Aufzählung schwebenderProzesse.
12) Nach Levold v. Northof, Ed. Flebbe,S. 79-82.

19
13) Nach Levold v. Northof, Ed. Flebbe,S. 79-82. Die Gebrüder de Altena/Swerte erscheinen einzeln oder zumehreren urkundlich zwischen 1251und 1280 in folgenden Urkunden:WUB VII, Nr. 382, 691, 765, 882,931, 1201, 1258, 1273, 1431, 1483,1725 und Reg. S. 1328.
14) Nach Westfälische Siegel, Tafel 213,Nr. 1 u. 2. im StADortmund, sowieDiedrich von Steinen, WestfälischeGeschichte, XII. Stück, S. 699 undTafel XXII, M10, Abgedruckt in AS,Nr. 37/1996.
15) Nach Levold v. Northof, Ed. Flebbe,S. 78.
16) Siehe hierzu: W. Bleicher, Die ver-schollene Geschichte des Letma-ther Burgberges, in: Hohenlimbur-ger Heimatblätter, Nr. 2/99, S. 41-52.
17) Nach WUB VII, Nr. 546.
17a) H. Esser, Hohenlimburg und Elsey,Dortmund 1907.
18) Vergl. dazu: Hohenlimburger Hei-matblätter Nr. 6/1954, S. 81 ff.
19) Urkunde im StaAMünster, GrafschaftMark Urk. Nr. 2, gedruckt: WUB VII,Nr. 529.
20) Urkunde im Fürstl. Bentheim-Teck-lenburgischen Archiv zu Rheda, Urk.Limburg, Nr. 3, gedruckt: WUB VII,Nr. 571.
21) Urkunde im Fürstl. Benth.-Tecklenb.Archiv zu Rheda, Urk. Limburg, Nr.4, gedruckt: WUB VII, Nr. 574.
22) Siehe W. Ewig, Zwischen Lenne undHönne, Letmathe 1956, S. 88. Siehedazu auch die Ausführungen vonH.D. Schulz zur NamensdeutungAltena in AS, Nr. 60, S. 19 und 61/2002, S. 18.
23) W. Ewig, Zwischen Lenne und Hön-ne, S. 96-101. Derselbe, Der Kö-nigsweg, die Schicksalsstraße un-serer Heimat, Iserlohn 1951. ImGegensatz zu Ewig halte ich denKönigsweg, oder Königsstraße, füreinen Abzweig der „via regia“, der„Königsstraße“, des Köln-Paderbor-ner Hellwegs. Von Köln ausgehend,führte er durch die Grafschaft Bergins märkische Schwelm. Hier teilteer sich in die Nordtangente nachDortmund und die Osttangente. Letz-tere, auch „der Kölner“, oder „derKleine Hellweg“ genannt, lief als sog.„Emperstraße“ durch das Ennepetalauf Hagen (Altenhagen) zu. ÜberBoele, Westhofen, an Schwertevorbei, hier „Großer und KleinerHellweg“ und „Römerstraße“ ge-nannt, erreichte er bei Hengsen dieHöhe des Haarstrangs. Als Höhen-weg, der „Haarweg“, begleitete er
nun den Lauf von Ruhr und Möhne,mit Abzweigen nach Unna, Werl undSoest, parallel zum „Großen Hell-weg“ Duisburg-Paderborn,größtenteils in Sichtweite. VomOberlauf der Möhne an, bog er nachNordosten ab und folgte dem Laufder Alme, um sich kurz vor Pader-born mit dem Großen Hellweg zuvereinigen. Dieser Kölner Hellwegist, wie der Große Hellweg, eineuralte Fernverkehrsstraße. Wie imFalle des Großen Hellwegs reihensich auch hier, seine Trasse beglei-tend, zahlreiche römische Münzfun-de, wie die Perlen auf einer Kette.
Der Königsweg zweigte m. E. inAltenhagen von dem Kölner Hell-weg ab, lief auf Hagen zu, um dannüber die Höhen nach Osten, in Rich-tung Lennetal abzubiegen. DenFluss querte die Straße durch dieLennefurt bei Elsey. Hier empfingsie von Norden den Syburger Weg,dessen Name später, wenigstensabschnittsweise, auf den Königs-weg übertragen wurde.
24) Original verschollen. BeglaubigteKopie von ca. 1487 im Fürstl. Benth.-Tecklenb. Archiv zu Rheda, ge-
druckt: WUB VII, Nr. 546.
25) Bredeney erscheint in der Karte desErzbistums Köln des Johan Gigas,von 1620, als Brenen; abgedruckt inAS Nr. 37/1997, S. 15. W. Bleicheridentifiziert die curtis Brene mit demHof Brende in Hagen-Halden. Siehedazu Hohenlimb. Heimatblätter, imJg. 57/1996, S. 209-213.
26) Bei diesen „de Altena“ handelt essich vermutlich um ein anderes Ge-schlecht, welches sich auch nachseinem Burglehen zu Altena benann-te. Nach den Forschungen des +Ge-org v. Sobbe handelt es sich bei demgenannten Engelbert v. Altena umden Großvater von Sobbo de Altena(1293-1322 urk.), den namensgeben-den Stammvater des späterenSchwerter Stadtherrengeschlechtes„Sobbe“. Alle Wappen des Ge-schlechterkreises de Altena/Sobbe/Lappe/Hegenscheid etc. zeigen 3gezahnte Blätter in der Stellung 2 : 1.Siehe dazu: R. Stirnberg, Vom Wer-den der Stadt Schwerte III, AS Nr. 38/1997 und Georg v. Sobbe, Das Rit-tergeschlecht Sobbe zu Villigst, Teil Iund II, in Hohenlimburger Heimat-blätter, Heft 3/1987 und 2/1989.
Durch Gottes unerforschlichen Ratschlussoder wodurch auch immer ist die Fuß-note 11 der Anmerkungen leider verlorengegangen, die ich hiermit nachreiche.
11) Originale der Papsturkunden im StA-Düsseldorf. Gedruckt: WUB V, 1, Nr. 287und 286, vom 1.3.1221 und Nr. 291, vom15.3.1221.
Nachtrag zu: Bevor die Märker kamen Teil VII