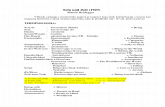BIOLOGIE_ABITUR_ZUSAMMENFASSUNG.pdf
-
Upload
jokergotfame -
Category
Documents
-
view
7.051 -
download
2
Transcript of BIOLOGIE_ABITUR_ZUSAMMENFASSUNG.pdf

NORDRHEIN-WESTFALEN ZENTRALABITUR 2012
Biologie Grundkurs Abitur Zusammenfassung der relevanten Themen
Autor: Christoph Hocks

NORDRHEIN-WESTFALEN ZENTRALABITUR 2012
Biologie Grundkurs Abitur Zusammenfassung der relevanten Themen
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Inhaltsverzeichnis
1. DNA als Erbträger: Struktur und Funktion ...................................................................... 4
a. Experiment von Griffith (1928) und Avery (1944): Ansatz, Ergebnis, Aussage ........ 4
b. Regeln von Chargaff .................................................................................................... 5
c. DNA-Strukturmodell: Molekularer Aufbau (Bausteine, molekulare Anordnung,
Polarität, etc.) .................................................................................................................... 5
d. Entwicklung des Doppelhelixmodells von Watson und Crick ................................... 6
2. Die DNA-Replikation ........................................................................................................ 7
a. Replikationsmodelle: konservativ, semikonservativ, dispers ................................... 7
b. Experimenteller Beweis für den Replikationsmodus: das Meselson-Stahl-
Experiment ......................................................................................................................... 8
c. Ablauf und Enzyme der Replikation ........................................................................... 9
3. DNA-Analyse / DNA-Isolierung ...................................................................................... 11
a. Organisations- und Verpackungsebenen der DNA, Transportform versus
Arbeitsform der DNA ....................................................................................................... 11
b. Erforderliche Maßnahmen zur Isolierung pflanzlicher DNA aus Tomate
einschließlich der Bedeutung der Schritte und Chemikalien ......................................... 13
c. Die Polymerasekettenreaktion (PCR): Ablauf, Voraussetzungen, Anwendungen . 13
d. Sequenzierung von DNA: biochemische Reaktionen, Ablauf, Ergebnis ................. 15
e. Gelelektrophorese .................................................................................................... 16
4. Proteinbiosynthese ....................................................................................................... 16
a. Bau und Funktionen von RNA (mRNA, tRNA, rRNA) ............................................... 16
b. Überblick Proteinbiosynthese .................................................................................. 17
c. Genetischer Code (Eigenschaften, Code-Sonne) ..................................................... 17
d. Transkription (Phasen, Vorgänge, beteiligte Moleküle, Enzyme) ........................... 18
e. Translation (Phasen, Vorgänge, beteilige Moleküle, Enzyme) ................................ 19

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
f. Vergleich Replikation und Proteinbiosynthese (Unterschiede und
Gemeinsamkeiten) .......................................................................................................... 21
g. Vergleich Proteinbiosynthese bei Eukaryoten und Prokaryoten (Ort, zeitlicher
Ablauf, Spleißvorgang: Introns, Exons, alternat. Spleißen) ........................................... 22
5. Mutationen .................................................................................................................... 23
a. Historische Entwicklung des Genbegriffs: Was ist ein Gen? (Begriffe: Genom,
proteinkodierendes Gen, RNA-kodierendes Gen erläutern) ......................................... 23
b. Mutagene (bestimmte Strahlungsformen und Chemikalien) ................................. 24
c. Überblick Mutationstypen (Genommutationen, Chromosomenmutationen,
Genmutationen) .............................................................................................................. 26
d. Verschiedene Formen der Genmutationen und ihre Auswirkungen ...................... 26
e. Mutationen auf DNA-, Aminosäuren- und Proteinebene beschreiben und ihre
Auswirkungen beurteilen können................................................................................... 27
f. Beispiele: Sichelzellanämie, Mukoviszidose ............................................................ 29
6. Genregulation ................................................................................................................ 30
a. Regulation bei Prokaryoten (Operon-Modell, Substratinduktion,
Endproduktrepression) .................................................................................................... 30
7. Klassische Genetik, Cytogenetik, Humangenetik .......................................................... 33
a. Mendelsche Regeln der Vererbung .......................................................................... 33
b. Grundlagen: Phänotyp, Genotyp .............................................................................. 35
c. Chromosomen und Karyogramme ........................................................................... 35
d. Genommutationen/Aneuploidie: autosomale (Trisomie 21), gonosomale (Turner,
Klinefelter, etc.) ............................................................................................................... 36
e. Genetische Beratung, Pränatale Diagnostik: Amniozentese, Chorionzottenbiopsie,
Polkörperchendiagnostik ................................................................................................ 42
f. Meiose, Genkopplung, Crossing-Over, Erb- / Kreuzungsschema ............................ 45
g. Die Vererbung der Blutgruppen ............................................................................... 49

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
h. Analyse von Erbgängen: autosomal-dominant, autosomal-rezessiv, gonosomal-
dominant, gonosomal-rezessiv ....................................................................................... 51
i. Kenntnisse zu den im Unterricht behandelten Erbkrankheiten ............................. 53
Literatur- und Quellenverzeichnis ............................................................................................ 54

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Abb. 1: Versuch von Griffith
1. DNA als Erbträger: Struktur und Funktion
a. Experiment von Griffith (1928) und Avery (1944): Ansatz, Ergebnis,
Aussage
Zu dieser Zeit war bekannt, dass sich die genetischen Informationen im Zellkern auf den
Chromosomen befinden.
Ansatz bei Griffith. Er entdeckte zwei Stämme von Pneumokokken (Bakterien): einen krank-
heitserregenden (virulenten) S-Stamm (S = smooth), der mit einer Polysaccharidkapsel um-
hüllt, und somit vor den Verteidigungsmechanismen des Immunsystems geschützt ist, und
einen R-Stamm (R = rough), der durch Mutation die Fähigkeit zur Bildung der Schutzkapseln
verloren hat und somit nicht virulent ist. Er führte vier verschiedene Teilversuche aus:
1. Er injizierte Mäusen leben-
de R-Zellen
2. Er injizierte Mäusen leben-
de S-Zellen
3. Er injizierte Mäusen hitze-
getötete S-Zellen
4. Er injizierte Mäusen eine
Mischung aus Bakterien des
R-Stammes und hitzegetö-
teten, und damit ebenfalls
nicht virulenten, S-Zellen
Ergebnis bei Griffith. S-Zellen töteten die meisten Mäuse, R-Zellen hingegen waren unge-
fährlich. Auch die abgetöteten S-Zellen waren nicht virulent. Trotzdem beide Stämme in die-
ser Verfassung an sich nicht virulent waren, starben die Mäuse, wenn er ihnen die Mischung
der Stämme injizierte.
Aussage bei Griffith. Die toten S-Zellen waren in der Lage gewesen, die Eigenschaft, Kapseln
zu bilden, auf die lebenden, nicht virulenten R-Zellen zu transformieren und sie damit zu
virulenten S-Zellen umzuformen. Dieser Vorgang wird Transformation genannt.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Ansatz bei Avery. Averys Versuch baute auf den Erkenntnissen auf, die Griffith gewonnen
hatte. Er trennte die abgetöteten S-Pneumokokken in ihre Bestandteile (Polysaccharide, Pro-
teine, DNA) und setzte sie jeweils einzeln Kulturen von R-Pneumokokken zu.
Ergebnis bei Avery. Unter den Nachkommen der R-Pneumokokken erzeugten nur diejenigen
Polysaccharidkapseln, deren Kulturen mit DNA vermischt worden waren. Er wiederholte den
Versuch, behandelte die zugesetzte DNA aber zuvor mit DNA-zerstörenden Enzymen. Die
Kapseln wurden nicht mehr erzeugt.
Aussage bei Avery. Er bewies mit seinem Versuch, dass die Informationen für die Ausbildung
bestimmter Merkmale in der DNA der Bakterien enthalten sind und in dieser Form auf ande-
re Zellen übertragen werden können.
b. Regeln von Chargaff
1. Die Gesamtmenge der Purinbasen (A+G) in einer Probe entspricht der Gesamtmenge
der Pyrimidinbasen (C+T) A+G = C+T
2. Die Menge an Adenin stimmt mit der Menge des Thymins überein. Cytosin ist stets in
derselben Menge vorhanden wie Guanin A = T ∧ C = G
3. Das Verhältnis von (A+T) zu (C+G) ist in den DNA-Proben aus verschiedenen Organis-
men unterschiedlich
Purinbasen sind Adenin und Guanin, Pyrimidinbasen sind Cytosin und Thymin. Dies kann
man sich mithilfe des „y“ in den Pyrimidinbasen merken.
c. DNA-Strukturmodell: Molekularer Aufbau (Bausteine, molekulare
Anordnung, Polarität, etc.)
Bausteine der DNA. Die DNA ist ein kettenförmiges, unverzweigtes Makromolekül. Sie be-
steht aus Desoxyribose, Phosphorsäure und vier verschiedenen organischen Basen, die ne-
ben Kohlenstoff- auch Stickstoffatome enthalten. Die Basen unterteilen sich in Purine und
Pyrimidine und paaren sich über Wasserstoffbrückenbindungen. Sie sind für den Informati-

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
onsgehalt der DNA verantwortlich. Desoxyribose bildet einen Ring aus fünf C-Atomen, Phos-
phorsäure wirkt als Verbindungsstück zwischen den einzelnen Desoxyribose-Molekülen.
Pyrimidine (Cytosin, Thymin) – einfacher Ring aus sechs Atomen
Purine (Adenin, Guanin) – Doppelringsystem
Molekulare Anordnung. Die Kettenglieder
der DNA werden Nukleotide genannt. Sie
bestehen aus je einem Molekül Desoxyri-
bose, einer Phosphatgruppe und einer der
vier Basen. Verbindungen aus Desoxyribose
und einer der vier Basen nennt man Nukle-
oside. Ein DNA-Molekül besteht aus vielen
Millionen Nukleotiden, wobei die Desoxyri-
bosen stets über eine Phosphatgruppe mit-
einander verbunden sind. Dies wird das
Zucker-Phosphat-Rückgrat genannt, woran
die Basen angehängt sind.
Polarität. Die C-Atome der Pentose-Ringe
werden von 1‘ bis 5‘ durchnummeriert.
Demnach steht immer das C-5‘-Atom eines
Desoxyribosemoleküls über eine Phosphatgruppe mit dem C-3‘-Atom des nächsten Zucker-
molekülrests in Verbindung. Die Polarität besteht darin, dass das DNA-Molekül an seinem 5‘-
Ende eine Phosphatgruppe und am 3‘-Ende eine OH-Gruppe trägt.
d. Entwicklung des Doppelhelixmodells von Watson und Crick
Durch die Untersuchung mit Röntgenstrahlen haben Watson und Crick erkannt, dass die
DNA eine schraubenförmige Struktur (Strickleiter) haben muss. Sie nahmen an, dass zwei
DNA-Ketten über die gesamte Länge des Moleküls schraubig umeinander gewunden sind,
also eine Doppelhelix bilden. Als Durchmesser der Doppelhelix berechneten Sie 2nm.
Abb. 2: Aufbau der DNA

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Die weitere Untersuchung der Basenpaarung von Watson und Crick zeigte, dass sich Thymin
mit Adenin und Cytosin mit Guanin zusammenschließen. Zwischen Adenin und Thymin bil-
den sich zwei Wasserstoffbrückenbindungen und zwischen Guanin und Cytosin eine stärkere
Bindung mit drei Wasserstoffbrücken.
Die beiden DNA-Einzelstränge sind zueinander komplementär. Die Stränge sind antiparallel,
weil die 5‘ 3‘-Richtung entgegengesetzt läuft. Heute weiß man, dass die Basen der Nukleo-
tide die Buchstaben des genetischen Alphabets darstellen. Sie kodieren die Erbinformatio-
nen durch ihre Reihenfolge.
2. Die DNA-Replikation
a. Replikationsmodelle: konservativ, semikonservativ, dispers
Es gibt drei verschiedene denkbare Modelle der Replikation, wobei der tatsächliche Replika-
tionsmodus semikonservativ ist.
Konservativ. Das ursprüngliche
DNA-Molekül bleibt vollständig er-
halten und das Tochtermolekül be-
steht aus zwei neu gebildeten Strän-
gen.
Semikonservativ. Es entstehen ge-
nau genommen zwei neue DNA-
Moleküle, die jeweils aus einem
Strang der ursprünglichen DNA und
einem neu synthetisierten Strang
bestehen.
Dispers. Die beiden ursprünglichen DNA-Stränge sind in Bruchstücke zerfallen und werden
nach der Replikation wieder verbunden. Nach der Replikation besteht jeder der beiden DNA-
Moleküle aus einer gestückelten Mischung aus neuer und alter DNA.
Abb. 3: Replikationsmodelle

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
b. Experimenteller Beweis für den Replikationsmodus: das Meselson-
Stahl-Experiment
Fragestellung. Meselson und Stahl wollten herausfinden, welcher Replikationsmodus beim
Erbgut vorliegt, also nach welcher oben genannten Methode die DNA identisch verdoppelt
wird.
Durchführung. Meselson und Stahl ließen Bakterien auf einem Nährboden wachsen, der das
schwere Stickstoffisotop 15N enthielt. Dieses Isotop enthält ein Neutron mehr als üblich,
wodurch es eine größere Masse und eine höhere Dichte aufweist. Die auf diesem Nährboden
gezüchteten Bakterien enthielten so schweren Stickstoff in beiden DNA-Strängen. Durch die
Dichtegradientenzentrifugation, ein physikalisches Trennverfahren, lassen sich verschieden
schwere Moleküle voneinander trennen, dadurch dass die Zentrifugalkraft die schwereren
weiter nach unten in das Röhrchen drückt. Bei der Zentrifugation sedimentierte sich die 15N-
DNA so weiter nach unten. Für die Dauer einer Zellteilung wurden diese Bakterien nun in ein
Medium mit leichtem 14N-Stickstoff überführt. Anschließend ließen sie die DNA ein weiteres
Mal replizieren.
Abb. 4: Meselson-Stahl-Experiment

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Ergebnis. Die auf dem leichten Nährboden replizierte DNA war zunächst mittelschwer, d.h.
die Dichte der Bakterien-DNA lag nun zwischen der schweren 15N-DNA und der leichten 14N-
DNA, die alten DNA-Stränge waren nicht erhalten geblieben. Nach der zweiten Replikation
fanden die Forscher zwei gleich starke Banden: eine auf mittlerer Höhe und eine auf der Hö-
he der 14N-DNA.
Aussage. Da die Bande nach der ersten Replikation in der Mitte lag zwischen schwerer und
leichter DNA, muss die neu replizierte Bakterien-DNA zu gleichen Teilen aus der schweren
und der leichten DNA bestehen. Die DNA-Stränge blieben nicht erhalten, die konservative
Replikation war widerlegt. Eine Bande auf Höhe der 14N-DNA nach der zweiten Replikation
ist nur möglich, wenn die DNA-Stränge bei der Replikation vollständig erhalten bleiben und
als Vorlage zur Synthese neuer Stränge dienen. Somit war die disperse Replikation widerlegt,
und die semikonservative Replikation gleichzeitig belegt.
c. Ablauf und Enzyme der Replikation
Das Grundprinzip der Replikation. Die Vervielfältigung der DNA beruht auf der komplemen-
tären Basenpaarung. Dadurch, dass jede Base nur mit der jeweils komplementären Base ge-
paart werden kann, kann ein einzelner Strang als Matrize zur Synthese des Komplemen-
tärstranges dienen. Ziel ist die genetisch identische Verdopplung des DNA-Doppelstranges.
Komponenten der Replikation.
DNA-Strang als Matrize
Nukleosidtriphosphate (ATP, GTP, CTP, TTP)
Primer, an die die ersten Nukleotide geknüpft werden
Enzyme mit spezifischer Funktion:
Enzym Funktion
Topoisomerase Setzt gezielt Schnitte um Entwindung zu er-leichtern, verknüpft Trennstellen später wieder und verhindert Torsionen (Spannun-gen im Molekül)
DNA-Helicase Trennung der DNA-Stränge und Entwindung des DNA-Moleküls

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Primase Bildung der Primer
DNA-Polymerase III Heftet in 5‘-3‘-Richtung Nukleotide an den Primer
DNA-Polymerase I Entfernt die RNA-Primer und ersetzt sie durch Desoxyribonukleotide
DNA-Ligase Schließt die Lücken zwischen den Okazaki-Fragmenten
Ablauf der Replikation. Zuerst vermindert die Topoisomerase die Verdrillung der DNA. Sie
setzt gezielt Schnitte (spaltet das Zucker-Phosphat-Rückgrat), um die Entwindung der DNA zu
erleichtern. Die Trennstellen verknüpft sie später wieder. Dann entwindet die DNA-Helicase
den Doppelstrang und spaltet unter ATP-Verbrauch die Wasserstoffbrückenbindungen der
DNA-Stränge. SSB-Proteine (single-strand binding proteins) verhindern, dass sich die Stränge
nicht sofort wieder verbinden. So entsteht eine Replikationsgabel, wie beim Öffnen eines
Reißverschlusses. Dies geschieht an mehreren Orten gleichzeitig, wodurch sich sogenannte
Replikationsblasen bilden, die immer größer werden, bis sie verschmelzen.
Nun dienen die Einzelstränge als Vorlage. Die Primase, eine RNA-Polymerase, erstellt ein
kurzes RNA-Stück, das zu der DNA-Vorlage komplementär ist. Dieser Primer dient als Start-
punkt für die eigentliche Replikation. Die DNA-Polymerase III setzt nun an dem Primer an
und verlängert den neuen Strang in 5‘-3‘-Richtung, wobei sie im Zellplasma frei schwimmen-
de Desoxyribonukleotide an die 3‘-OH-Gruppe des Zuckers am Ende eines wachsendes DNA-
Abb. 5: Die Replikation

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Stranges anfügt. Deshalb kann die Polymerase III nur an einem der beiden Stränge der Heli-
case folgen und ihn kontinuierlich verlängern. Diesen Strang nennt man Leitstrang. Am ande-
ren Elternstrang synthetisieren die Polymerasen den Folgestrang von der Replikationsgabel
weg. Somit muss die Polymerase am Folgestrang immer wieder direkt hinter der Helicase
ansetzen und kann nur diskontinuierlich synthetisieren. Es entstehen kurze DNA-Fragmente,
die man Okazaki-Fragmente nennt.
Die DNA-Polymerase I ersetzt die RNA-Primer durch vollwertige Desoxyribonukleotide. Das
Enzym DNA-Ligase verknüpft die Okazaki-Stücke, die nach ihrem Entdecker, einem japani-
schen Biochemiker, benannt sind, sodass ein zusammenhängender Strang entsteht. Wenn
sich nun die Proteine entfernen, bilden sich automatisch wieder Wasserstoffbrücken zwi-
schen den komplementären Basenpaaren und zwei DNA-Doppelstränge, jeweils zur Hälfte
aus alter und neu synthetisierter DNA bestehend, sind entstanden.
3. DNA-Analyse / DNA-Isolierung
a. Organisations- und Verpackungsebenen der DNA, Transportform ver-
sus Arbeitsform der DNA
Notwendige Fachbegriffe.
Fachbegriff Bedeutung
Chromosomen Sind bei Eukaryoten die Träger der Erbin-formationen und bestehen aus zwei identi-schen DNA-Doppelsträngen (Chromatiden) und Proteinen (Histone). Chromosomen können in unterschiedlicher Form vorliegen. Jede menschliche Körperzelle besitzt 23 ho-mologe Chromosomenpaare, wobei je ein Partner der Paare von Vater bzw. von der Mutter geerbt ist.
Chromatin Ist das Material, aus dem die Chromosomen bestehen. Es handelt sich um einen Komplex aus DNA und Proteinen, u.a. Histone.
Nukleosom Organisationseinheit bestehend aus von

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Histonen aufgebauten Proteinkomplexen, um die die DNA gewunden ist.
Histon Stark basische Proteine, die im Zellkern Komplexe mit der DNA ausbilden und damit zur Ausbildung der typischen Chromoso-menstruktur beitragen.
Ebenen der DNA-Verpackung. Die Verpa-
ckung der DNA vollzieht sich in mehreren
Schritten. Zunächst bilden DNA und Histon-
proteine ein Nukleosom. Die perlschnurartig
aufgereihten Nukleosomen lagern sich dann
zu einer Faser von ca. 30 nm Durchmesser
zusammen. Die 30nm-Faser kann sich ihrer-
seits wiederum zu übergeordneten Struktu-
ren auffalten. Die exakte Geometrie des
Chromatins jenseits der 30nm-Faser ist nicht
bekannt und möglicherweise nicht genau
definiert. Die höchste Verpackungsdichte
erreicht das mitotische Chromosom (ganz
unten), das im Verlauf einer jeden Zellteilung
ausgebildet wird.
Transportform versus Arbeitsform der DNA.
Die als Chromosomen verdichtete DNA besitzt
den Zweck der Komprimierung und ist als Transportform bekannt. Die DNA-Fäden des Men-
schen wären dekomprimiert ca. 2 Meter lang, sodass es notwendig ist, die Moleküle stark zu
verdichten, um sie transportieren zu können. Muss jedoch mit der DNA gearbeitet werden,
muss sie also z.B. repliziert werden, so kann die Basenabfolge nur dann abgelesen werden,
wenn die DNA zuvor entspiralisiert, also entpackt wurde.
Abb. 6: Verpackungsebenen der DNA

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
b. Erforderliche Maßnahmen zur Isolierung pflanzlicher DNA aus Toma-
te einschließlich der Bedeutung der Schritte und Chemikalien
Notwendige Schritte und ihre Bedeutung.
1. Wasser, Spülmittel und Kochsalz in einem Becherglas mischen.
2. Tomate verkleinern und ggf. zerdrücken, um die Zellwände der Pflanzenzellen aufzu-
brechen.
3. Die Tomatenstücke zur Mischung hinzugeben. Das Spülmittel bricht die Zellmembra-
nen sowie die Zellkernwand auf, sodass die DNA freigelegt wird. Das Salz erhöht die
Löslichkeit der DNA während der Präparation.
4. Erwärmen des Becherglases und der Mischung auf 60 Grad, um den Prozess zu be-
schleunigen und um DNA abbauende Proteine denaturieren zu lassen (DNAsen).
5. Mischung in Eisbad abkühlen lassen, um eine Schädigung der DNA zu verhindern.
6. Filtrieren der Mischung, um die festen Zellwandbestandteile von der DNA zu trennen.
7. Hochprozentiges kaltes Ethanol hinzugeben, um die DNA zu färben und sie sichtbar
zu machen.
c. Die Polymerasekettenreaktion (PCR): Ablauf, Voraussetzungen, An-
wendungen
Voraussetzungen. Zur Durchführung der PCR benötigt man neben der zu vervielfältigenden
DNA die vier Desoxyribonukleotide, zu der zu vervielfältigenden DNA passende Primer und
die Taq-Polymerase, eine DNA-Polymerase III, die aus heißen Quellen gewonnen wird und so
auch eine Erhitzung über 94°C übersteht.
Ablauf. Die PCR ist im Grunde genommen ein künstliches Verfahren, das die Replikation
nachahmt. Ein PCR-Zyklus besteht aus drei sich wiederholenden Schritten.
1. Denaturierung
2. Hybridisierung
3. Polymerisation

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Zunächst wird die Probe auf 94°C erhitzt, um eine
Denaturierung der DNA zu erreichen, sodass die
Doppelhelix sich trennt und Einzelstränge vorlie-
gen. Eine normale DNA-Polymerase III würde bei
dieser Temperatur auch denaturieren und un-
brauchbar werden. Deshalb verwendet man die
Taq-Polymerase, eine aus heißen Quellen gewon-
nene DNA-Polymerase III, die auch hohe Tempera-
turen unbeschadet übersteht. Die Probe wird auf
65°C abgekühlt um eine erneute Zusammenlage-
rung der Einzelstränge zu verhindern. Anschließend
lagern sich die zuvor synthetisierten DNA-Primer
an die Einzelstränge an, sie hybridisieren. In einem
dritten Schritt erfolgt bei einer Temperatur von
72°C (Temperaturoptimum der Taq-Polymerase)
die DNA-Synthese, indem die Taq-Polymerase an
die Primer bindet und sie in 5‘-3‘-Richtung verlän-
gert. Zu beachten ist, dass die Polymerase nicht
stoppen kann, sodass sie einen Teil der DNA repli-
ziert, der nicht gebraucht wird. So entstehen erst
am Ende des dritten Zyklus doppelsträngige DNA-
Stücke, die nur die Zielsequenz enthalten.
Anwendungen. Das bekannteste Feld der Anwendungen ist die Kriminaltechnik. Die PCR
wird eingesetzt, um eine geringe Menge gefundener DNA zu vervielfältigen und in der Lage
zu sein, ein genetisches Profil des Täters zu erstellen. In der Lebensmittelanalytik kann man
mithilfe der PCR fremde Gene in Lebensmitteln nachweisen und auch in der Evolutionsbiolo-
gie kommt die PCR-Methode zum Einsatz. Mit ihr kann der Verwandtschaftsgrad zwischen
verschiedenen Arten und Gattungen relativ genau bestimmt werden. Auffällig ist also die
Vielfalt der Möglichkeiten, die die PCR-Methode mit sich bringt.
Abb. 7: Die PCR-Methode

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
d. Sequenzierung von DNA: biochemische Reaktionen, Ablauf, Ergebnis
Biochemische Reaktionen. Die Sequenzierung von DNA beruht auf dem Prinzip der DNA-
Replikation, mit dem Unterschied, dass nur ein Einzelstrang benötigt wird, der dann von der
DNA-Polymerase repliziert wird. Die DNA-Polymerase III verlängert den Primer, indem sie die
Desoxyribonukleotide an die 3‘-OH-Gruppe anfügt. Wenn jedoch ein verändertes Nukleotid
(Didesoxyribonukleotid) eingefügt wird, bricht der Vorgang ab, denn durch die fehlende OH-
Gruppe kann die DNA-Polymerase III
keine Nukleotide mehr anfügen.
Ablauf. Zunächst wird die DNA durch
Denaturierung in Einzelstränge gespal-
ten, die man dann mit radioaktiv mar-
kierten Primern hybridisiert. Diese Pri-
mer sind speziell hergestellt worden
und sind komplementär zum 3‘-Ende
des DNA-Stranges. Die Probe wird auf
vier Reagenzgläser verteilt, wobei in
jedem Reagenzglas die vier DNA-
Nukleosidtriphosphate und eine geringe
Menge je eines der modifizierten Nuk-
leosidtriphosphate enthalten. Die DNA-
Polymerasen III verlängern nun die Pri-
mer in 5‘-3‘-Richtung und bauen zufällig
intakte oder modifizierte Nukleosid-
triphosphate ein, sodass die Replikation
entweder durchläuft oder abbricht. So
bilden sich unterschiedlich Lange DNA-Stränge in jeder Probe. Die DNA-Stränge aus den vier
Ansätzen werden dann durch parallele Gelelektrophorese aufgetrennt. Durch die radioaktiv
markierten Primer lassen sich die Banden leicht sichtbar machen und durch den Vergleich
der vier Bandenreihen lässt sich die Basensequenz direkt ablesen, wobei sie komplementär
zur Sequenz der DNA-Matrize ist.
Abb. 8: DNA-Sequenzierung nach F. Sanger

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
e. Gelelektrophorese
Die Gelelektrophorese ist ein biochemisches Trennverfahren. Dabei werden Moleküle auf
einem Trägermaterial in einem elektrischen Feld getrennt. DNA-Abschnitte, die bei der DNA-
Sequenzierung entstanden sind, wandern aufgrund ihrer negativen Ladungen in dem elektri-
schen Feld, das in einem Gel angelegt wird, zum Pluspol zur anderen Seite des Gels. Je nach
Größe der Abschnitte legen sie in einer bestimmten Zeit verschiedene Wegstrecken zurück,
sodass die DNA-Fragmente aufgefächert werden. Um dann die Banden sichtbar zu machen,
die die DNA-Abschnitte im Gel bilden, arbeitet man beispielsweise mit den radioaktiven Pri-
mern, oder mit Färbung durch ein Färbungsbad. Dadurch, dass die Länge der zurückgelegten
Strecke abhängig ist von der Länge der DNA-Abschnitte, kann man die Reihenfolge problem-
los ablesen.
4. Proteinbiosynthese
a. Bau und Funktionen von RNA (mRNA, tRNA, rRNA)
RNA allgemein. Ribonukleinsäure besteht aus Ribose und einer der Basen Adenin, Guanin,
Cytosin oder Uracil.
RNA und ihre Funktion.
Fachbegriff Funktion
mRNA (messenger RNA) Transportiert die genetischen Informationen zu den Ribosomen, den Orten der Protein-synthese
tRNA (transfer RNA) Ein Vermittler. Transportiert die Aminosäu-ren zu den Ribosomen und sorgt dafür, dass sie in der richtigen Reihenfolge miteinander verknüpft werden können
rRNA (ribosomal RNA) Sie stellt neben Proteinen den Hauptbe-standteil der Ribosomen dar.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
b. Überblick Proteinbiosynthese
Bei der Proteinbiosynthese wird die Information, die in der Basensequenz der DNA ver-
schlüsselt ist, in die spezifische Aminosäurensequenz von Proteinen übersetzt. Dies ge-
schieht in zwei Schritten:
1. Transkription: die Basensequenz der DNA, die für die Bildung eines Proteins benötigt
wird, wird in eine mRNA umgeschrieben, was bei Eukaryoten im Kernplasma stattfin-
det.
2. Translation: Die in der mRNA enthaltene Information wird an den Ribosomen im Cy-
toplasma in die entsprechende Aminosäurensequenz umgesetzt.
DNA TRANSKRIPTION mRNA TRANSLATION Protein
c. Genetischer Code (Eigenschaften, Code-Sonne)
Eigenschaften des genetischen Codes.
Die Abfolge von drei Basen (Basentriplett, Codon) stellt die verschlüsselte Einheit
zum Einbau genau einer Aminosäure in den Polypeptidstrang dar.
20 verschiedene Aminosäuren sind durch die Codons kodiert
Der genetische Code ist degeneriert, das heißt, es gibt für viele Aminosäuren mehre-
re verschiedene Codons
Der genetische Code ist kommafrei, das
heißt, die Codons schließen lückenlos anei-
nander
Der genetischer Code ist prinzipiell univer-
sell, das heißt, er gilt für fast alle Lebewe-
sen (Ausnahme: z.B. DNA der Mitochond-
rien)
Die Code-Sonne. Mithilfe der Code-Sonne lässt
sich jedem Basentriplett der mRNA eindeutig eine Abb. 9: Die Code-Sonne

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Aminosäure zuordnen. Die Code-Sonne gibt die Sequenz der mRNA an und wird von innen
nach außen gelesen. Mit dem Startcodon AUG beginnt die Proteinbiosynthese, die Stopp-
Codons UAA, UAG und UGA beenden sie.
d. Transkription (Phasen, Vorgänge, beteiligte Moleküle, Enzyme)
Phasen im Überblick.
Initiation
Elongation
Termination
Grundlagen. Die Gene in unserem Erbgut sind größtenteils Anleitungen für den Bau von Pro-
teinen. Weil die Proteine jedoch in eukaryotischen Zellen im Zellplasma gebildet werden und
die DNA den Zellkern nicht verlassen kann, erstellt die Zelle von den Genen Arbeitskopien.
Die mRNA dient dabei als Bote zwischen Zellkern und Zellplasma. Prokaryoten benutzen das-
selbe Prinzip, obwohl sie keinen Zellkern besitzen.
Ablauf. Bei der Initiation bindet die RNA-Polymerase an eine Basensequenz, die den Start
der Transkription markiert (Promotorsequenz). Auf den Promotor folgt entlang des codoge-
nen (= Proteine kodierenden) Stranges in 3‘-5‘-Richtung der zu transkribierende Bereich. Die
RNA-Polymerase umschließt dabei einen Bereich von etwa 30 Basenpaaren. Der DNA-
Doppelstrang wird dann in einer Länge von ca. 15 Basenpaaren von der RNA-Polymerase
aufgetrennt. Sich frei in der
Zellflüssigkeit bewegende
RNA-Nukleotide binden ge-
mäß ihrer Komplementarität
zufällig an den codogenen
Strang, wonach sie von der
RNA-Polymerase verknüpft
werden.
Es folgt die Elongation (Verlän- Abb. 10: Vorgang der Transkription

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
gerung), bei der der mRNA-Strang in 5‘-3‘-Richtung verlängert wird. Dabei bewegt sich die
RNA-Polymerase an der DNA entlang und bewirkt das weitere Auftrennen der Doppelhelix.
Es lagern sich weitere RNA-Nukleotide an, die verknüpft werden. Der so wachsende mRNA-
Strang löst sich am anderen Ende der Transkriptionsblase vom codogenen Strang, sodass
sich die Doppelhelix dort wieder schließen kann.
Die Termination erfolgt schließlich bei der Transkription der Terminator-Sequenz, die ein
Signal für die RNA-Polymerase darstellt, die Verlängerung der mRNA einzustellen. Das
mRNA-Molekül löst sich schließlich von der DNA und wird von der RNA-Polymerase freige-
geben. Gleichzeitig löst sich die Überdrehung der Doppelhelix, die Stränge lagern sich wieder
zusammen und die RNA-Polymerase löst sich von dem DNA-Doppelstrang.
Ergebnis. Die RNA-Polymerase hat eine Arbeitskopie des Bereiches erstellt, der für die Her-
stellung eines Proteins kodiert.
e. Translation (Phasen, Vorgänge, beteilige Moleküle, Enzyme)
Phasen im Überblick.
Initiation
Elongation
Termination
Faltung des Proteins
Grundlagen. Die Übersetzung des genetischen Codes der mRNA in eine Aminosäurense-
quenz nennt man Translation. Sie erfolgt in den Ribosomen (Zellorganell), die aus ribosoma-
ler RNA (rRNA) und Proteinen bestehen. Die Aminosäuren werden von der Transfer-RNA
transportiert, die in einem zweidimensionalen Schema eine typische Kleeblattstruktur auf-
weist, sich aber tatsächlich zu einem L-förmigen Molekül windet. An dessen langem Arm
liegt das Anticodon: ein Basentriplett, das im Ribosom an ein bestimmtes Codon der mRNA
bindet. Die zu diesem Codon passende Aminosäure hängt am kurzen Arm der tRNA.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Ablauf. Bei der Initiation bindet zunächst die kleine Untereinheit eines Ribosoms an eine
spezifische Bindungsstelle am 5‘-Ende der mRNA. Anschließend bewegt sie sich in 5‘-3‘-
Richtung an der mRNA entlang, bis ein Startcodon (AUG) erreicht wird. Die sich in der Zell-
flüssigkeit frei bewegenden tRNAs lagern sich zufällig an die mRNA an, wobei das Anticodon
komplementär zum Codon der
mRNA sein muss. Sobald die
Start-tRNA (mit der Aminosäu-
re Methionin) an das Startco-
don bindet, tritt die große Un-
tereinheit des Ribosoms hinzu.
Das zusammengesetzte Ribo-
som besitzt zwei Bindungsstel-
len für tRNAs, die direkt über
benachbarten Basentripletts
der mRNA liegen.
Die Start-tRNA besetzt zu Beginn der Elongation den Ausgang P (Peptidyl-Bindungsstelle),
das folgende freie Triplett liegt im Eingang A (Aminoacyl-Bindungsstelle). Hier lagert sich nun
eine der mRNA komplementäre tRNA an, die mit einer entsprechenden Aminosäure beladen
ist. Die beiden Aminosäuren, die an die tRNAs in P und A gebunden sind, werden durch eine
Peptidbindung miteinander verknüpft. Die Bindung zwischen der Aminosäure (Methionin)
und der Start-tRNA wird aufgelöst und die freie tRNA verlässt den Ausgangsbereich. Sie kann
im Zellplasma erneut mit der dazugehörigen Aminosäure beladen werden. Das Ribosom be-
wegt sich anschließend um ein Basentriplett weiter in 5‘-3‘-Richtung, sodass der Eingangsbe-
reich, also die Aminoacyl-Bindungsstelle frei wird und eine weitere dem Codon des Basen-
tripletts im Eingangsbereich tRNA binden kann. So bewegt sich das Ribosom an der mRNA
entlang, wobei kontinuierlich neue Aminosäuren von tRNAs hinzugefügt werden und die
Aminosäurenkette wächst, bis das Ribosom ein Stoppcodon (UAA, UAG, UGA) erreicht.
Die Termination beginnt, denn für die Stoppcodons gibt es keine tRNA mit komplementärem
Anticodon. Befindet sich also ein Stoppcodon im Eingangsbereich A, so besetzt statt der
tRNA ein Enzym, der so genannte RF (release factor) den Eingang A. Er spaltet das fertige
Abb. 11: Der Vorgang der Translation

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Polypeptid von der letzten tRNA. Es trennt sich außerdem das Ribosom von der abgelesenen
mRNA und zerfällt wieder in seine Untereinheiten. Die mRNA wird früher oder später in ihre
Einzelnukleotide zersetzt. Es folgt die Faltung des Proteins. Hierbei nimmt das freigesetzte
Polypeptid seine spezifische Raumstruktur ein.
Ergebnis. Die durch die Basenfolge der mRNA kodierten Informationen wurden übersetzt
und als Bauanleitung eines Proteins genutzt.
f. Vergleich Replikation und Proteinbiosynthese (Unterschiede und
Gemeinsamkeiten)
Gemeinsamkeiten. Beim Vergleich der beiden Vorgänge sind kaum Gemeinsamkeiten zu
finden. Bei beiden Vorgängen wird die Komplementarität der Basenpaarung ausgenutzt und
in beiden Vorgängen synthetisieren Polymerasen, jedoch zu unterschiedlichen Zwecken. Die
Transkription entspricht dem Prinzip der Replikation, d.h. eine DNA-abhängige RNA-
Polymerase verknüpft Ribonukleotide komplementär zur Vorlage der einsträngig vorliegen-
den DNA.
Unterschiede.
1. Es wird nicht die gesamte DNA einer Zelle verdoppelt bzw. kopiert, sondern nur ein
kleiner Teil, nämlich ein Gen oder ein Operon, eine kleine Gruppe von Genen
2. Bei der Replikation werden beide Stränge der Doppelhelix kopiert. Bei der Transkrip-
tion wird nur von einem der beiden Stränge ein Transkript (eine Abschrift) angefertigt
3. Bei der Replikation entsteht neue DNA. Die Abschrift, die bei der Transkription ent-
steht, ist chemisch abgewandelte DNA, so genannte RNA
4. Bei der Replikation verbleibt die Kopie im Zellkern, bei der Transkription dagegen
wandert die neu synthetisierte RNA in das Zellplasma, wo sie sich mit Ribosomen zu-
sammenlagert
5. Durch die Synthese eines RNA-Stranges bei der Transkription wird, anders als bei der
DNA-Synthese bei der Replikation, kein Primer benötigt

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
g. Vergleich Proteinbiosynthese bei Eukaryoten und Prokaryoten (Ort,
zeitlicher Ablauf, Spleißvorgang: Introns, Exons, alternat. Spleißen)
Abb. 12: Vergleich der Proteinbiosynthese bei pro- und eukaryotischen Zellen
Ort. Während die mRNA bei der eukaryotischen Proteinbiosynthese nach der Transkription
aus dem Zellkern heraus in das Zellplasma transportiert werden muss, um zu den Ribosomen
zu gelangen, sind Transkription und Translation bei Prokaryoten nicht räumlich voneinander
getrennt, da prokaryotische Zellen keine Kernmembran besitzen.
Zeitlicher Ablauf. Die Translation kann bei eukaryotischen Zellen erst starten, nachdem die
Transkription abgeschlossen ist. Dies ist durch die räumliche Trennung der Vorgänge be-
dingt. Anders bei Prokaryoten: hier beginnt die Translation bereits, während die mRNA noch
transkribiert wird.
Processing. Im Unterschied zu der DNA der Prokaryoten, besteht die DNA von Eukaryoten
nicht nur aus Sequenzen, die für die Kodierung des Genprodukts erforderlich sind. Bei der
Transkription werden so auch Sequenzen in die mRNA aufgenommen, die nicht erforderlich,
also überflüssig sind. Diese Bruchstücke der mRNA werden Introns genannt, während die
kodierenden Abschnitte Exons genannt werden.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Weil die mRNA der eukaryotischen Zelle noch einen Reifungsprozess durchlaufen muss, wird
sie auch prä-mRNA genannt. Der Reifungsprozess, Processing genannt, beginnt damit, dass
nach der Transkription am 5‘-Ende der prä-mRNA ein besonderes Nukleotid angebaut wird,
die „cap“ (Kappe). Sie erleichtert die spätere Bindung der Ribosomen an die mRNA. Am 3‘-
Ende der prä-mRNA werden 100-200 Adenin-Nukleotide angeheftet, weshalb man von ei-
nem Poly(A)-Schwanz spricht. Er ist notwendig, weil die mRNA im Zellplasma außerhalb des
Zellkerns abgebaut wird. Während der Translation wird somit der Poly(A)-Schwanz abge-
baut, sodass die kodierende Sequenz verschont bleibt. Anschließend beginnt der Spleißvor-
gang, bei dem die Introns aus der prä-mRNA herausgeschnitten werden. Dies übernehmen
spezielle Enzyme, die selbst aus RNA und Proteinen bestehen. Man nennt sie Spleißosomen.
Nach dem Spleißvorgang liegt die reife mRNA vor, die nun durch die Kernporen ins Zellplas-
ma außerhalb des Zellkerns zu den Ribosomen gelangt. Die Translation beginnt.
Alternatives Spleißen. Man geht mittlerweile von weniger als 25 000 Genen beim Menschen
aus. Das ist insofern paradox, als dass der menschliche Organismus mehr als 90 000 ver-
schiedene Proteine herstellt. Durch die Intron-Exon-Struktur der eukaryotischen Gene ist
alternatives Spleißen möglich, was die Variabilität enorm erhöht. Jedes primäre RNA-
Transkript eine Gens enthält mehrere Introns. Beim alternativen Spleißen werden nicht nur
die Introns, sondern Introns zusammen mit einem oder mehreren Exons aus der prä-mRNA
herausgeschnitten. Das Ergebnis: mehrere verschiedene Möglichkeiten einer reifen mRNA
pro Gen.
5. Mutationen
a. Historische Entwicklung des Genbegriffs: Was ist ein Gen? (Begriffe:
Genom, proteinkodierendes Gen, RNA-kodierendes Gen erläutern)
Historische Entwicklung. In der Frühphase der Genforschung hatte man vor allem an Bakte-
rien erkannt, dass jeder Teilschritt innerhalb einer Genwirkkette durch Enzyme katalysiert
wird. Dies führte 1941 zur Formulierung der Ein-Gen-ein-Enzym-Hypothese. Das Gen war
also nicht, wie vor dieser Zeit, als Einheit der Merkmalsausprägung definiert. Später erkann-
te man, dass nicht alle Gene für Enzyme, sondern auch für andere Proteine kodieren. Auch

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
sind häufig komplexere Proteine aus mehreren Polypeptidketten aufgebaut, für die jeweils
ein Gen kodiert. Es folgte daraufhin die Ein-Gen-ein-Polypeptid-Hypothese.
1977 wurde jedoch auch dieses Konzept erschüttert, als revolutionäre Fortschritte in der
Molekularbiologie es möglich machten, auch eukaryotische Gene zu untersuchen. Man fand
auf der DNA Regionen, die nicht in eine Polypeptidsequenz übersetzt wurden, obwohl sie
innerhalb der für das Gen kodierenden Regionen lagen. Dies war die Entdeckung der unter-
brochenen Gene (vgl. Exons und Introns) der Eukaryoten. Man fand außerdem Gene, die die
Synthese gleich mehrerer Polypeptide durch differenzielles Spleißen von einem Genort aus
steuern. So kann man sagen, dass ein Gen als Abschnitt zwischen einer Promotor- und einer
Terminator-sequenz definiert ist, was für viele Gene stimmt. Auch hier gibt es Ausnahmen,
weshalb wir heute auf eine klare Gendefinition verzichten müssen. Man kann das Gen als
Abschnitt der DNA sehen, der ein funktionelles Produkt kodiert.
Das Genom. Als Genom wird die Gesamtheit der Erbanlagen eines Lebewesens bezeichnet.
Es umfasst den Gesamtbestand an Basenpaaren in der DNA eines Individuums, den kodie-
renden (mit den Informationen für die Synthese der einzelnen Eiweiße) wie den nichtkodie-
renden Teil.
Protein- und RNA-kodierende Gene. Wie schon bei der historischen Entwicklung ersichtlich
ist, kodiert nicht jedes Gen für Proteine. Die Protein-kodierenden Gene machen nur ca. 3 %
des menschlichen Genoms aus, während ca. 95 % aller Nukleotide nichtkodierend sind. Es
gibt Gene, die RNA kodieren und so die Informationen für den Bau von z.B. der für den
Translations-Vorgang unerlässlichen tRNA enthalten. Diese Gene nennt man RNA-
kodierende Gene.
b. Mutagene (bestimmte Strahlungsformen und Chemikalien)
Allgemein. Die meisten Mutationen entstehen nicht durch Ablesefehler bei der Replikation
der DNA, sondern sie entstehen durch äußere Einflüsse. Dazu gehören Mutagene. Das sind
Stoffe, die im Erbgut von Organismen Mutationen auslösen können.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Strahlungsformen. Zu den physikalischen Einflüssen, die Veränderungen im Erbgut auslösen
können, gehören energiereiche Strahlen, z. B. UV-Strahlen, radioaktive Strahlung und Rönt-
genstrahlen. Durch kurzwellige UV-Strahlen (z. B. Sonnen- und Höhenstrahlung) werden be-
nachbarte Thyminbasen eines DNA-Strangs verknüpft. Diese können sich dann nicht mit den
komplementären Basen Adenin paaren. Die genetische Information kann an diesen Stellen
nicht mehr genau abgelesen werden.
Radioaktive Strahlung und Röntgenstrahlen wirken nicht unmittelbar auf die DNA ein. Sie
bilden allerdings in den Zellen sehr reaktionsfreudige Radikale, die mit der DNA im Weiteren
chemische Reaktionen eingehen. Dadurch kann es möglicherweise zu Brüchen im Einzel-
oder Doppelstrang der DNA kommen. Die Folge können ein Basenaustausch oder der Ausfall
eines Nukleotids innerhalb der DNA sein.
Chemikalien. Zu den chemischen Stoffen, die Veränderungen im Erbgut auslösen können,
gehören z. B. Teerstoffe, Basenanaloga und salpetrige Säure. Teerstoffe in Tabakwaren wir-
ken krebserregend. Sie besitzen ein Molekül mit Ringsystem und schieben sich zwischen die
Nukleotide. Dabei täuschen sie eine Base zu viel vor. Bei der Replikation der DNA wird an
diese vorgetäuschte Base eine beliebige andere angelagert. Dieser DNA-Strang ist dadurch
um ein Nukleotid länger.
Basenanaloga besitzen in ihrer chemischen Struktur eine gewisse Ähnlichkeit mit den norma-
len Basen der DNA und können diese deshalb vertreten und sogar ein Basenpaar bilden.
Bromuracil z.B. ähnelt in der Struktur den Purin- und Pyrimidinbasen. Bei der Replikation der
DNA wird Thymin durch Bromuracil ersetzt, wodurch es zu einer Mutation kommen kann.
Salpetrige Säure verändert in der ruhenden DNA Cytosin. Cytosin wird dadurch in Uracil um-
gewandelt. Dieses Uracil ist nicht mehr komplementär zu Guanin sondern zu Adenin. Kommt
es zu einer Replikation der DNA, wird dann später im Doppelstrang das Basenpaar C-G durch
das Basenpaar U-A ersetzt. Daraus entstehen Replikationsfehler, wodurch ein Protein wir-
kungslos wird.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
c. Überblick Mutationstypen (Genommutationen, Chromosomenmutati-
onen, Genmutationen)
Genommutationen. Genommutationen sind Veränderungen der Chromosomenzahl (Aneup-
loidie, Polyploidie). Sie können nach Nichttrennung homologer Chromosomen oder Chroma-
tiden während der Meiose oder der Mitose auftreten, oder durch Verlust von Chromoso-
men. Besonders bei Pflanzen liegt oft eine Vervielfachung ganzer Chromosomensätze vor.
Folgen von Genommutationen sind beispielsweise Trisomien, wie die Trisomie 21 (Down-
Syndrom).
Chromosomenmutationen. Chromosomenmutationen sind Strukturveränderungen einzel-
ner Chromosomen. Man beobachtet Verlust von Chromosomenteilen (Deletion), Verdoppe-
lung (Duplikation), Hinzufügung (Insertion), Drehung um 180° (Inversion) und Translokatio-
nen von Chromosomenteilen oder ganzer Chromosomen. Folgen von Chromosomenmutati-
onen sind beispielsweise Syndrome wie das Katzenschrei-Syndrom, dem eine Deletion zu-
grunde liegt.
Genmutationen. Genmutationen sind Veränderungen innerhalb eines Gens, und deshalb
mikroskopisch nicht sichtbar. Auch Genmutationen sind, wie bei den Chromosomenmutati-
onen, unterteilt in Deletion, Duplikation, Insertion, Inversion und Translokation. Häufig sind
Genmutationen ohne Folgen, weil sie an einer funktionell unwichtigen Stelle des Gens auf-
treten. Folgen von Genmutationen sind beispielsweise das Marfan-Syndrom und die Sichel-
zellanämie.
d. Verschiedene Formen der Genmutationen und ihre Auswirkungen
Formen. Man unterscheidet zwei Formen der Genmutationen. Unter einer Punktmutation
versteht man den Ersatz eines Nukleotids und seines komplementären Partners im DNA-
Strang. Diese Basenpaarsubstitution kann sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Die
andere Form, eine Rasterschubmutation, liegt dann vor, wenn durch Deletion oder Insertion
das Leseraster geändert wird. Da bei der Translation immer drei Basen für eine Aminosäure

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
kodieren, erfolgt durch Hinzu- oder Wegnahme von Basen eine Verschiebung des Leseras-
ters.
Auswirkungen. Rasterschubmutationen haben meist extreme Auswirkungen, unabhängig
davon, ob eine Deletion oder eine Insertion vorliegt. Durch eine Verschiebung des Leseras-
ters werden völlig andere Aminosäuren kodiert und angebaut, sodass der sinnvolle Aufbau
von Proteinen kaum möglich ist. Anders ist es bei Punktmutationen. Die Auswirkungen von
Punktmutationen sind vielfältig und unterscheiden sich stark. Man unterscheidet zwischen
verschiedenen Formen der Punktmutation anhand ihrer Auswirkungen. Im folgenden Ab-
schnitt sind die Auswirkungen anhand der verschiedenen Formen exemplarisch anhand ei-
nes Beispiels aufgezeigt.
Formen der Punkt- und Rasterschubmutation.
Beispielsatz Mutationstyp
mRNA Aminos.
AUG CAA GAU AAA CAU UGA Met Gin Asp Lys His *
Ausgangspunkt Keine Mutation
mRNA Aminos.
AUG CAG GAU AAA CAU UGA Met Gin Asp Lys His *
Keine Auswirkungen Stumme Mutation (silent)
mRNA Aminos.
AUG CAC GAU AAA CAU UGA Met His Asp Lys His *
Aminosäure verändert Missense Mutation
mRNA Aminos.
AUG CAA GAU UAA CAU UGA Met Gin Asp *
Stoppcodon eingebaut Nonsense Mutation
mRNA Aminos.
AUG CCA AGA UAA ACA UUG A Met Pro Arg *
Insertion Rasterschubmutation
mRNA Aminos.
AUG_AAG AUA AAC AUU GA Met Lys Lle Asn Lle
Deletion Rasterschubmutation
e. Mutationen auf DNA-, Aminosäuren- und Proteinebene beschreiben
und ihre Auswirkungen beurteilen können
Anhand eines Klausurbeispiels wird die Beschreibung und Beurteilung von Mutationen im
Folgenden deutlich gemacht.
Gegeben ist ein DNA-Doppelstrang:
5’ C A A G T C C G A C A T 3’ [codogener gesunder Strang] 3’ G T T C A G G C T G T A 5’

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
5’ C A A C T C C G A C A T 3’ [codogener mutierter Strang] 3’ G T T G A G G C T G T A 5’
Aufgabe: Geben Sie an, um welche Mutation es sich handelt!
Vorgehen zum Lösen der Aufgabe:
1) Art der Mutation angeben (DNA-Ebene!): G zu C mutiert Punktmutation
2) mRNA des gesunden Stranges bilden (komplementär zum codogenen Strang)
3’ G U U | C A G | G C U | G U A 5’ 4.AS 3.AS 2.AS 1.AS
3) Aminosäurensequenz aus der Codesonne ablesen
M e t – S e r – A s p – L e u AUG UCG GAC UUG
4) mRNA des mutierten Stranges bilden und die Aminosäurensequenz ablesen
3’ G U U | G A G | G C U | G U A 5’ M e t – S e r – G l u – L e u 4.AS 3.AS 2.AS 1.AS AUG UCG GAG UUG
5) Vergleich der beiden mRNA-Stränge und Benennung der Mutation
Was verändert sich? das dritte Basentriplett! (G A G statt G A C)
Mit welchen Auswirkungen? andere Aminosäure kodiert (G l u statt A s p)
Benennung der Mutation: Missense-Mutation,
da das Austauschen der Base die Kodierung einer anderen Aminosäure zur Folge hat.
Wichtig: Da man die mRNA des codogenen Stranges bildet, liegt diese in 3’-5’-Richtung vor!
Also muss die Aminosäurensequenz hier rückwärts bestimmt werden!
Immer in 5’-3’-Richtung

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
f. Beispiele: Sichelzellanämie, Mukoviszidose
Sichelzellanämie. Bei Sichelzellanämie nehmen die
Erythrocyten in sauerstoffarmem Blut eine sichel-
förmige Gestalt an. In dieser Form sind sie weniger
elastisch, weshalb sie die Blutkapillaren verstopfen
und die Organe nicht mehr ausreichend mit Sauer-
stoff versorgt werden. Außerdem platzen sie leich-
ter und werden schneller abgebaut, als neue Zellen
entstehen. Aufgrund des Erythrocytenmangels
kommt es zur Anämie, einer verminderten Trans-
portfähigkeit des Bluts vor allem für Sauerstoff. Die
Krankheit verläuft meist tödlich.
Die Verformung der roten Blutzellen wird durch eine
Variante des Blutfarbstoffs Hämoglobin verursacht. Im Sichelzell-Hämoglobin ist an einer
Stelle die Aminosäure Glutaminsäure gegen Valin vertauscht, somit ist Sichelzellanämie die
Folge einer missensen Punktmutation. Sichelzellanämie wird rezessiv vererbt. Heterozygote
sind durch das Sichelzell-hämoglobin resistent gegen Malaria, denn sobald Malaria-Erreger
in die Erythrocyten eindringen, verformen sich die Zellen und Kaliumionen strömen ver-
mehrt aus den Sichelzellen aus. Malariaerreger brauchen jedoch ein kaliumreiches Milieu.
Sie können sich somit in den Sichelzellen nicht vermehren.
Mukoviszidose. Mukoviszidose ist eine rezessiv vererbte Krankheit, bei der in verschiedenen
Organen erhöhte Mengen sehr zähflüssiger Düsensekrete gebildet werden. Die Betroffenen
leiden schon früh an Atemnot, chronischer Bronchitis und häufigen Lungenentzündungen.
Hinzu kommen Mangelerscheinungen infolge von Verdauungsstörungen.
Ursache hierfür ist der Defekt eines Kanalproteins für Chloridionen. Normalerweise sorgt
dieser Ionenkanal dafür, dass Chloridionen zusammen mit dem Drüsensekret aus der
Epithelzelle transportiert werden. Da Chloridionen osmotisch Wasser anziehen, bleiben die
Sekrete dünnflüssig. So können beispielsweise Schleim, Staub und Bakterien aus der Lunge
Abb. 13: Sichelzellförmige Erythrocyte

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
befördert werden. Unterbleibt der Ionentransport, wird der Schleim dick und zähflüssig und
verstopft die Bronchien.
Der betreffende Ionenkanal wird mit der Abkürzung CFTR (cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator) bezeichnet. Das CFTR-Gen ist auf Chromosom 7 lokalisiert. Es gibt
über 600 Mutationen in diesem Gen,
die zu unterschiedlich schweren Fällen
von Mukoviszidose führen. In etwa 70
% der Fälle fehlen drei Nukleotide im
Exon 10, was zum Ausfall der Amino-
säure Phenylalanin an Position 508 des
Proteins führt. Aufgrund seiner verän-
derten Tertiärstruktur kann das Protein
das ER nicht verlassen und wird abge-
baut. Andere Mutationen erlauben
zwar die Herstellung des Proteins und
seinen Einbau in die Zellmembran, ver-
hindern aber ein korrektes Funktionie-
ren.
6. Genregulation
a. Regulation bei Prokaryoten (Operon-Modell, Substratinduktion, End-
produktrepression)
Allgemein. François Jacob und Jacques Monod haben in den 1960er Jahren das An- und Ab-
schalten von Genen bei Bakterien erforscht. Das Darmbakterium Escherichia coli findet in
seiner Umgebung vor allem den Zucker Glucose und stellt Enzyme zum Abbau her. Überführt
man solche Bakterien in ein Nährmedium mit Lactose statt Glucose, so beginnen die Bakte-
rien nach kurzer Verzögerung, die Lactose als Energiemedium zu nutzen. Jacob und Monod
schlossen daraus, dass es Gene geben muss, die für Enzym zum Abbau des seltenen Sub-
strats kodieren, die aber normalerweise nicht in Funktion sind. Es war offensichtlich möglich,
Abb. 14: CFTR-Kanal

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
bestimmte Gene an- und abzuschalten. Die beiden Forscher entwickelten ein Modell, das
inzwischen durch molekularbiologische Versuche bestätigt wurde.
Das Operonmodell. Zellen benötigen nur bestimmte Proteine (Enzyme) kontinuierlich, ande-
re werden erst bei Bedarf gebildet. Dies entspricht dem Grundsatz der Ökonomie. Die Regu-
lation der Enzymneubildung erfolgt dabei auf Transkriptionsebene. Folgende Elemente sind
Teil des Modells, das Jakob und Monod entwickelten:
Elemente Merkmale
Strukturgene Enthalten die genetischen Informationen zur Bildung der Enzyme
Regulatorgen Enthält die Information zur Bildung des Repressorproteins
Repressor Protein, das die Enzymsynthese unterbinden kann
Operator DNA-Abschnitt, an den das Repressorprotein reversibel binden kann
Promotor DNA-Abschnitt, an den die RNA-Polymerase bindet
Operon Begriff für DNA-Abschnitt aus Promotor, Operator und Strukturgenen
Beim Lac-Operon heißen die Strukturgene, die die genetische Information zur Bildung der
Enzyme enthalten, lacZ, lacY und lacA. Das
lacZ-Gen kodiert für das Enzym β-Galactosidase, welches Lactose in Galactose und
Glucose aufspaltet
lacY-Gen kodiert für das Enzym Permease, welches sich in die Zellmembran des Bak-
teriums setzt und für den Transport der Lactose in die Zelle hinein verantwortlich ist
lacA-Gen kodiert für
das Enzym Transacety-
lase. Die Funktion die-
ses Enzyms ist zurzeit
noch nicht vollständig
bekannt, sicher ist nur,
dass das Enzym eine
Acteylgruppe auf die
Lactose überträgt
Substratinduktion. Wird die
Bildung eines Enzyms erst bei Abb. 15: Vorgang der Substratinduktion

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Anwesenheit eines bestimmten Substrats (Induktor) ausgelöst, spricht man von Substratin-
duktion. Das Repressorprotein sitzt, gemäß dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, an der Operator-
region und verhindert so die Transkription der Strukturgene. Es besitzt ein allosterisches
Zentrum, in das sich kleinere Moleküle hineinsetzten können. Wenn die Lactose-
Konzentration in der Zelle steigt, steigt gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass ein Lactose-
Molekül sich in das allosterische Zentrum des Repressors setzt. Wenn dies geschieht, verän-
dert sich die Proteinstruktur des Repressors, der folglich nicht mehr an die Operatorregion
binden kann. So fungiert Lactose als Induktor, der es möglich macht, die Strukturgene zu
transkribieren. Wenn nun Lactose durch β-Galactosidase abgebaut wurde und keine weite-
ren Lactose-Moleküle mehr in die Zelle dringen, so wird auch die Wahrscheinlichkeit gerin-
ger, dass sich Lactose in das allosterische Zentrum des Repressors setzt. Somit wird bei ab-
nehmender Lactose-Konzentration die Transkription der Strukturgene wieder gehemmt.
Endproduktrepression.
Häufig werden aber auch
aktive Gene „abgeschaltet“.
Die Synthese der Amino-
säure Tryptophan wird bei-
spielsweise so reguliert. Bei
dieser Endproduktrepressi-
on bewirkt das Regulator-
gen die Herstellung eines
inaktiven Repressors. Die
Transkription der Struktur-
gene kann also ungehindert
stattfinden. Das Tryptophan dient als Corepressor, d.h. wenn die Konzentration des Endpro-
duktes Tryptophan ansteigt, so ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass Tryptophan an
das allosterische Zentrum eines Repressorproteins bindet. In diesem Fall wird die Struktur
des Proteins verändert, sodass es gemäß dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an die Operatorregi-
on binden kann, und die Transkription der Strukturgene verhindert wird. Dies ist, wie auch
bei der Substratinduktion, reversibel.
Abb. 16: Vorgang der Endproduktrepression

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
7. Klassische Genetik, Cytogenetik, Humangenetik
a. Mendelsche Regeln der Vererbung
Mendel und die Gartenerbse. Gregor Mendel führte im 19. Jahrhundert Kreuzungsversuche
mit der Gartenerbse durch. Das Versuchsobjekt erwies sich dabei als besonders geeignet.
Die Gartenerbse bietet
Einen kurzen Generationszyklus, d.h. bereits nach kurzer Zeit liegen die Nachkommen
(Samen) einer Kreuzung vor
Hohe Nachkommenzahl, d.h. es liegt ausreichend großes Zahlenmaterial vor, um die
Ergebnisse statistisch abzusichern
Zahlreiche, einfach zu unterscheidende Merkmale, wie z.B. Samenfarbe und –form
Die Möglichkeit der Selbstbestäubung, sodass Reinerbigkeit (Homozygotie) gewähr-
leistet ist
Die Möglichkeit der Fremdbestäubung mit der Folge der Mischerbigkeit (Heterozygo-
tie)
Die Mendelschen Regeln der Vererbung.
1. Uniformitätsregel: Kreuzt man
zwei Individuen einer Art, die sich
in einem Merkmal reinerbig un-
terscheiden, so sind die Nach-
kommen in der Tochtergenerati-
on (1. Filialgeneration) unterei-
nander gleich. Dabei ist es gleich-
gültig, welcher der beiden Rassen
Vater oder Mutter angehören.
2. Spaltungsregel: Kreuzt man die
Individuen der 1. Filialgeneration
untereinander, so spaltet sich die
F2-Generation im Zahlenverhältnis 3:1 auf.
Abb. 17: Monohybrider Erbgang – 1. und 2. Mendelsche Regel

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
3. Unabhängigkeitsregel: Kreuzt man
Individuen einer Art, die sich in meh-
reren Merkmalen unterscheiden, so
werden die Anlagen getrennt und
unabhängig voneinander vererbt. Es
gilt also die Uniformitäts- und die
Spaltungsregel für jedes Merkmal.
Erklärung der Mendelschen Regeln. Die
Entschlüsselung dieser Gesetzmäßigkeiten
der Vererbung gelang Gregor Mendel durch
die Erfassung der zahlenmäßigen Vertei-
lung. Die Aufspaltung der F2-Generation im
Verhältnis 3:1 lässt sich nur unter folgenden
Annahmen erklären:
Die Anlagen für Merkmalsausprägun-
gen müssen in jedem Individuum dop-
pelt vorliegen. Heute wissen wir,
dass es sich um Gene homologer
Chromosomen handelt, die als Allele
bezeichnet werden. Liegen gleiche
Allele eines Gens vor, spricht man
von Homozygotie, verschiedene Al-
lele eines Gens führen zu Heterozy-
gotie.
Ein Allel kann das andere Allel in sei-
ner Wirkung auf den Phänotyp
überdecken, es ist dann dominant.
Das überdeckte Allel nennt man re-
zessiv. Die Gesamtheit der Erbfakto-
ren, hier also die Allelkombinationen, Abb. 19: Intermediärer Erbgang
Abb. 18: Dihybrider Erbgang – 3. Mendelsche Regel

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
bezeichnet man als Genotyp. Dominante Allele werden mit Großbuchstaben verse-
hen, rezessive Allel erhalten denselben Buchstaben, jedoch kleingeschrieben.
Intermediäre Erbgänge. Ist keines der beiden Allele eines Gens dominant, so liegt ein inter-
mediärer Erbgang vor. Die Merkmalsausbildung in der F1-Generation liegt zwischen der bei-
der Eltern. Ein klassisches Beispiel ist die Vererbung der Blütenfarbe der Wunderblume.
Während die F1-Generation uniform ist, spaltet sich die F2-Generation im Geno- und Phäno-
typenverhältnis im Zahlenverhältnis 1:2:1 auf. Typisch ist also, dass Genotyp und Phänotyp
stets übereinstimmen.
b. Grundlagen: Phänotyp, Genotyp
Phänotyp und Genotyp. Unter dem Genotyp versteht man den vollständigen Satz von Ge-
nen, den ein Organismus geerbt hat. Zum Phänotyp eines Lebewesens gehören nicht nur die
äußerlichen Merkmale, sondern auch Lage und Größe der inneren Organe sowie Verhal-
tensmerkmale und physiologische Werte wie Blutzuckerspiegel. In der Praxis bezieht man
die Begriffe "Phänotyp" und "Genotyp" immer auf Teilaspekte des Organismus, und nicht auf
die Gesamtheit.
c. Chromosomen und Karyogramme
Chromosomen. Chromosomen
bestehen aus DNA und speziellen
Proteinen (siehe Organisations-
und Verpackungsebenen der DNA)
und sind im Zellzyklus unter-
schiedlich dicht gepackt. In der
Metaphase der Mitose erreichen
sie mit ihrer größten Dichte auch
eine kennzeichnende Gestalt aus
identischen Chromatiden und Abb. 20: Karyogramm eines normalen Mannes

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
dem Centromer, der Ansatzstelle der Spindelfasern.
Diploide Körperzellen des Menschen enthalten 46 Chromosomen (2n=46). Dabei wird zwi-
schen 2 Typen unterschieden. Einerseits den Autosomen, welche sowohl in weiblichen, als
auch in männlichen Zellen enthalten sind. Jeder Mensch besitzt 44 Autosomen, d.h. je 22
homologe Chromosomen von Vater und Mutter. Andererseits spezifizieren die Geschlechts-
chromosomen (Gonosomen) das Geschlecht des Individuums. Frauen besitzen ein aus 2 gro-
ßen X-Chromosomen bestehendes Chromosomenpaar. Bei den Männern hingegen finden
sich ein X-Gonosom und ein kleineres Y-Gonosom. Somit hat jeder Mensch einen gesamten
Chromosomensatz von 46 Chromosomen, 44 Autosomen und 2 Gonosomen.
Karyogramme. Ein Karyogramm ist die schematische Darstellung der Chromosomenpaare
nach Größe und Gestalt. Dabei werden die Chromosomen (je paarweise) der Größe nach
abfallend angeordnet. Anschließend folgt die Angabe der Gonosomen.
d. Genommutationen/Aneuploidie: autosomale (Trisomie 21), gonoso-
male (Turner, Klinefelter, etc.)
Trisomie 21. Ist die beim Men-
schen häufigste Chromosomen-
störung, der eine Genommutati-
on, nämlich das dreifache Vor-
handensein von Chromosom 21,
zugrunde liegt. Neben geistiger
Retardierung ist das Down-
Syndrom durch ein breites
Spektrum von Auffälligkeiten im
Kopf- und Gesichtsbereich cha-
rakterisiert. Im Vordergrund der
inneren Organfehler stehen an-
geborene Herzfehler. Weiterhin sind Fehlbildungen im Bereich des Magen-Darm-Traktes
charakteristisch, sowie Abnormitäten im Skelett, und viele kleinere Abnormitäten wie Ver-
Abb. 21: Karyogramm bei einer Trisomie 21

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
änderungen der Hand- und Fußlinien.
Leukämie im Kindes- und Säuglingsalter
tritt häufig auf.
Man kennt eine Reihe weiterer autoso-
maler Trisomien, die zur Geburt eines
Kindes führen, aber im Säuglingsalter
letal sind. Beispiele Hierfür sind die
Trisomie der Chromosomen 13 und 18.
Grundsätzlich können alle Autosomen trisom auftreten, Embryonen mit einer Trisomie der
großen Chromosomen abortieren allerdings vor der Implantation in den Uterus, andere wie-
derum führen zu Aborten innerhalb der ersten frei Monate der Schwangerschaft.
Ursache für all diese Trisomien ist ein Nichttrennen (Non-disjunction) homologer Chromo-
somen in der Meiose in den Keimzellen der Eltern, überwiegend in der weiblichen Meiose.
Dies führt dann zu Keimzellen mit einem überzähligen Chromosom, was nach der Befruch-
tung schließlich in einer Trisomie resultiert. Folgende Abbildungen verdeutlichen diese Non-
disjunction, wobei a) die Nichttrennung bei der 1. Reifeteilung, und b) die Nichttrennung bei
der 2. Reifeteilung bei der Frau darstellt, und c) und d) das selbige beim Mann.
Abb. 22: Typische Merkmale bei einer Trisomie 21
Abb. 23: Nichttrennung des 21. Chromosomenpaares bei 1. Reifeteilung der Frau

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Abb. 25: Nichttrennung des 21. Chromosomenpaares bei 2. Reifeteilung der Frau
Abb. 24: Nichttrennung des 21. Chromosomenpaares bei den Reifeteilungen des Mannes

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Turner-Syndrom. Beim Turner-Syndrom weisen die Körperzellen in der Regel statt der übli-
cherweise doppelt vorhandenen Geschlechtschromosomen nur ein Chromosom X auf. Diese
als Monosomie X bezeichnete Anomalie ist nicht erblich. Die Betroffenen sind immer weibli-
chen Geschlechts; ihre Geschlechtsentwicklung ist jedoch durch das fehlende zweite X-
Chromosom gestört. Die Folgen dieser Monosomie sind vielfältig.
Äußerlich auffällig sind Turner-Syndrom-Patienten wegen ihrer geringen Körpergröße, einer
breiten Brust, einem großen Abstand zwischen den Brustwarzen, kurzen Fingern und oft ge-
schwollenen Händen und Füßen. Innerlich sind die Folgen unterentwickelte Eierstücke, ein
Ausbleiben der Menstruation und Unfruchtbarkeit. Außerdem kann es zu folgen Problemen
kommen: Herzprobleme, hoher Blutdruck, Hörprobleme, Kurzsichtigkeit, Lernschwierigkei-
ten, Schilddrüsenprobleme, Nierenprobleme, Diabetes, Osteoporose. Auch hier liegen die
Ursachen bei einer Nichttrennung der Chromosomen während der Meiose. In den folgenden
Abbildungen sind diese Nichttrennungen aufgeführt, wobei sich a) auf die Nichttrennung der
Gonosomen beim Mann bezieht und b) auf die Nichttrennung der Gonosomen bei der Frau.
Beides ist noch einmal unterteilt in 1. Und 2. Reifeteilung.
Abb. 26: Nichttrennung der Gonosomen bei der Keimzellenbildung des Mannes

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Abb. 27: Nichttrennung der Gonosomen bei der Keimzellenbildung der Frau
Klinefelter-Syndrom. Als Klinefelter-Syndrom werden die Auswirkungen einer angeborenen
Chromosomenstörung bei Männern bezeichnet, bei der zusätzlich zum normalen Chromo-
somensatz 46,XY ein weiteres X-Chromosom vorliegt. Dadurch ergibt sich der Chromoso-
mensatz 47,XXY. Mögliche Körperliche Besonderheiten sind schmale Schultern, Brüste, brei-
te Hüften, lange Arme und Beine, dünner oder gar kein Bartwuchs, ein weibliches Muster
der Geschlechtsbehaarung und kleine Hoden. In der Regel sind die betroffenen Männer un-
fruchtbar. Häufig treten außerdem Entwicklungsstörungen der Sprache auf, sowie Verhal-
tensauffälligkeiten und Kontaktarmut. Auch hier liegen die gleichen Ursachen wie bei den
oben aufgeführten Erkrankungen zugrunde.
Man kann das Klinefelter-Syndrom, um es sich zu merken, als Gegensatz des Turner-
Syndroms sehen, denn in beiden Fällen werden körperliche Merkmale ausgeprägt, die einen
andersgeschlechtlichen Phänotyp hervorrufen. Natürlich darf man dabei nicht vergessen,
dass die beiden Krankheiten weitreichendere Folgen haben als äußerlich erkennbar sind. So
sind Betroffene unfruchtbar und haben Probleme mit ihren inneren Organen. Folgende Ab-
bildung verdeutlicht die Ursachen des Klinefelter-Syndroms.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Andere Aneuploidien. Neben diesen gängigen Aneuploidien können noch weitere auftreten,
wie folgende Abbildung verdeutlicht. Auch die Folgen einer solchen Aneuploidie ist in der
Abbildung dargestellt.
Abb. 28: Nichttrennung der Gonosomen beim Mann und bei der Frau
Abb. 29: mögliche Kombinationen der Geschlechtschromosomen und ihre Folgen

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
e. Genetische Beratung, Pränatale Diagnostik: Amniozentese, Chori-
onzottenbiopsie, Polkörperchendiagnostik
Indikationen. Das Risiko einer genetisch bedingten Erkrankung oder Fehlentwicklung ist
nicht bei allen Elternpaaren gleich groß. Deshalb wird genetische Beratung nur bei folgenden
Indikationen durchgeführt:
Einer der Ratsuchenden ist von einer Erbkrankheit betroffen
In der Familie eines Ratsuchenden kommt ein Betroffener einer Erbkrankheit vor
Gesunde Eltern haben ein betroffenes Kind
Die Eltern haben ein erhöhtes Alter
Es liegt eine Verwandtenehe vor
Vor oder während der Schwangerschaft sind schädliche Umwelteinflüsse eingetreten
Genetische Beratung. Die genetische Beratung klärt Familien, die in die oben genannten
Kategorien fallen, darüber auf, wie hoch das Risiko ist, dass die Erbkrankheit auf das Kind
übertragen wird. Sie verfolgt folgende Ziele:
Medizinische Fakten einschließlich der Diagnose, den vermutlichen Ablauf der Er-
krankung und die zur Verfügung stehenden Behandlungsmethoden erfassen
Den erblichen Anteil an der Erkrankung kennen und das Risiko für die einzelnen Fami-
lienmitglieder, Träger des betreffenden Gens zu sein
Mit einem möglichen Risiko umgehen
Eine Entscheidung treffen, die ihrem Risiko, ihren familiären Zielen, ihren ethischen
und religiösen Wertvorstellungen entspricht, und in Übereinstimmung mit dieser
Entscheidung handeln
Diagnostik. Neben den klassischen Verfahren der Stammbaumanalyse spielt die pränatale
Diagnostik eine zentrale Rolle. Man unterscheidet hierbei zwischen nicht-invasiven und inva-
siven Methoden. Zu den nicht-invasiven Eingriffen zählen die Ultraschalluntersuchung und
die Untersuchung des mütterlichen Blutes. Invasive Eingriffe sind die Amniozentese, Chori-
onzottenbiopsie und Nabelschnurpunktion. Des Weiteren unterscheidet man zwischen diag-
nostischen Methoden bei einer bestehenden Schwangerschaft, nämlich die hier bereits auf-

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
geführten, und den Methoden bei Befruchtung im Reagenzglas. Diese Methoden sind die
Polkörperchendiagnostik und die Präimplantationsdiagnostik.
Ultraschalluntersuchungen. Werden im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen dreimal
durchgeführt. Ziel ist es, den Entwicklungsstand zu beurteilen, die Lage des Fetus in der Ge-
bärmutter und dessen Größe, sowie das Geschlecht zu bestimmen. Die Untersuchung birgt
keinerlei Risiken, ist jedoch zu ungenau, um eine sichere Diagnose von Fehlbildungen zu ge-
währleisten.
Serumuntersuchung. Bei der Serumuntersuchung des mütterlichen Blutes in der 15.-19.
Schwangerschaftswoche lässt sich im Blut Alpha-Feto-Protein (AFP) nachweisen. Bei schwe-
ren Fehlbildungen der Wirbelsäule ist die Konzentration dieses Proteins höher. Beim Triple-
Test werden verschiedene Komponenten untersucht, er gibt Aufschluss über das Risiko für
die Trisomien 18 und 21. Das geringe Risiko für Mutter und Kind geht jedoch auch mit einer
schwierigen Interpretation der Testergebnisse einher.
Amniozentese. Hierbei werden in der 15.-20.
Schwangerschaftswoche mit einer 0,7mm
dünnen Nadel, die unter Ultraschallüberwa-
chung durch die Bauchhöhle eingestochen
wird, aus der Gebärmutter etwa 20ml Frucht-
wasser entnommen. Ab diesem Zeitpunkt
enthält die Amnionflüssigkeit ausreichend
abgelöste Zellen des Fetus. Nach 9-14 Tagen
liegen dann so viele Zellen in einer Kultur vor,
dass ein Karyogramm erstellt werden kann,
sodass Chromosomenanomalien sicher diag-
nostiziert werden können. Mit molekularbio-
logischen Methoden lassen sich außerdem
krankheitsverursachende Genmutationen di-
rekt feststellen.
Die biochemische Analyse des Fruchtwassers erlaubt es, sehr sichere Aussagen über rezessiv
vererbte Stoffwechselkrankheiten zu treffen. Allerdings ist die Methode mit einem Fehlge-
Abb. 30: Amniozentese

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
burtsrisiko von 0,5-1 % verbunden. Für einen Schwangerschaftsabbruch ist der Zeitpunkt zu
spät.
Chorionzottenbiopsie. Hierbei werden Zellen aus der sich bildenden Placenta untersucht. Sie
kann bereits zwischen der 10. Und 12. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden. Mithil-
fe eines 1-2mm dünnen Katheters, der i.d.R. durch die Scheide eingeführt wird, entnimmt
man Chorionzottengewebe, an dem die gleichen Untersuchungen wie bei der Amniozentese
sofort durchgeführt werden können. Die Aussagesicherheit gleicht sich, der Eingriff kann
aber bis zu 8 Wochen früher erfolgen. Das Fehlgeburtsrisiko wurde früher mit 4-8 % angege-
ben, liegt jedoch bei erfahrenen Ärzten nicht höher als bei der Amniozentese.
Polkörperchendiagnostik. Bei dieser Methode werden ein oder mehrere Polkörperchen kurz
vor der Befruchtung einem Gencheck unterzogen. Sie gilt als rechtlich unbedenklich, da noch
kein Embryo im Sinne des Embryonenschutzgesetzes vorliegt. So wird eine chromosomale
Analyse, ein Gencheck und eine biochemische Analyse veranlasst.
Abb. 31: Chorionzottenbiopsie

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Präimplantationsdiagnostik. Bei der PID wird einem Embryo im Vier- bis Achtzellenstadium
eine Zelle entnommen und diese den oben genannten Analysen unterzogen. Diese Methode
ist in Deutschland verboten, andere Länder dagegen gestatten sie unter Auflagen.
f. Meiose, Genkopplung, Crossing-Over, Erb- / Kreuzungsschema
Ablauf der Meiose. Die Meiose besteht aus zwei Reifeteilungen, die zum Ziel haben, aus
dem diploiden Chromosomensatz einen haploiden Satz Ein-Chromatid-Chromosomen zu
machen, damit sich der Chromosomensatz nicht von Generation zu Generation verdoppelt.
Der Ablauf ist wie folgt:
1. Prophase I: In der Prophase verkürzen sich die Chromatinfäden und bilden Chromo-
somen (Transportform). Erst jetzt wird die Erbsubstanz auch unter dem Lichtmikro-
skop klar erkennbar. Die homologen (gleichartigen) Chromosomen rücken zusam-
men, sodass ihre Chromosomenabschnitte nebeneinander zu liegen kommen. Die
beiden Chromatiden werden aber immer noch vom Centromer zusammen gehalten.
Die Strahlenkörperchen (Zentriolen) wandern langsam zu den Zellpolen hin.
2. Metaphase I: Die Kernmembran löst sich auf und die homologen Chromosomen ord-
nen sich paarweise im Mittelbereich (Äquatorialebene) der Zelle an. Die Chromatiden
werden immer noch vom Centromer zusammen gehalten. Die Zentriolen erreichen
die Zellpole und Spindelfasern wachsen von den Strahlenkörperchen (Zentriolen) zu
den Centromeren der Chromosomen. Jedes Centromer ist nun fest über den Spin-
delapparat mit einem Zentriol verbunden.
3. Anaphase I: Die Spindelfasern verkürzen sich und pro Chromosomenpaar wird je ein
homologes Chromosom zu den Zellpolen hin gezogen. Welches der beiden homolo-
gen Chromosomen zum Nordpol oder zum Südpol der Zelle gezogen wird, bleibt dem
Zufall überlassen. Die Zellwand verändert ihre Form, sie wird in die Länge gezogen.
Der Spindelapparat wird abgebaut.
4. Telophase I: In der Zwischenzeit hat die Zellwand begonnen, sich langsam in der
Äquatorialebene abzuschnüren. In jeder Polhälfte der Zelle befindet sich jetzt nur
noch ein einziger Chromosomensatz zu je zwei Chromatiden. Die erste Reifeteilung
ist damit abgeschlossen und an sie schliesst unmittelbar die zweite Reifeteilung an.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Die 2. Reifeteilung (Äquationsteilung) folgt dem Schema der 1. Reifeteilung (Reduktionstei-
lung). Die beiden sind beinahe identisch, nur werden bei der Äquationsteilung die beiden
Chromatiden eines jeden Chromosoms getrennt und an die beiden Pole gezogen, sodass am
Ende der Meiose vier Zellen mit je 23 Ein-Chromatid-Chromosomen entstanden sind. Fol-
gende Abbildung soll noch einmal den Unterschied zwischen der Meiose und der Mitose
darstellen:
Es unterscheidet sich die männlichen und die weibliche Gametenbildung in der Teilung des
Zellplasmas. Während beim männlichen Geschlecht in der Spermatogenese aus einer Urzelle
vier Spermien reifen, entstehen bei der Oogenese der Frau durch ungleiche Teilung nur eine
plasmareiche Eizelle und drei fast plasmalose Polkörperchen, die bald zugrunde gehen.
Abb. 32: Die Abläufe von Meiose und Mitose

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Des Weiteren ist zu beachten, dass die meiotischen Teilungen im männlichen Organismus
erst mit der Pubertät beginnen und ständig andauern, während bei der Frau in den ersten
Monaten der Embryonalentwicklung aus den Stammzellen schon alle Oogonien (Ureizellen)
gebildet sind und schon pränatal Oocyten 2. Ordnung vorliegen. Einen ständigen Nachschub
aus Stammzellen, wie dies beim Mann der Fall ist, findet während der weiblichen Gameten-
bildung also nicht statt.
Genkopplung. Aufschluss darüber, wie Gene auf den Chromosomen lokalisiert sind, brach-
ten vor allem Versuche mit der Fruchtfliege Drosophila melanogaster von dem amerikani-
schen Biologen Thomas Hunt Morgan. In zahlreichen dihybriden Kreuzungen stellte er fest,
dass bei manchen Merkmalen nur zwei Phänotypen auftreten statt vier, oder dass diese im
Verhältnis zu den anderen viel häufiger sind, als nach der 3. Mendelschen Regel zu erwarten
wäre. Er schloss daraus, dass bestimmte Merkmale nicht unabhängig voneinander vererbt
werden. Seine Annahme, dass Gene, die immer oder bevorzugt gemeinsam vererbt werden,
auf demselben Chromosom liegen, wurde eindrucksvoll bestätigt. Demnach kann man ein
Chromosom auch als Kopplungsgruppe bestimmter Gene auffassen.
Crossing-Over. Morgan stellte jedoch auch fest,
dass gekoppelte Gene nicht immer gemeinsam
vererbt werden. Führte er eine Rückkreuzung
durch, kreuzte er also Individuen der Parental-
und der 1. Filialgeneration miteinander, so fand
er neben den beiden zu erwartenden Phänoty-
pen noch zwei weitere. Morgan erklärte dieses
Phänomen durch die Hypothese des Crossing-
Overs. In der Prophase I der Meiose liegen die
Chromosomenpaare (jeweils als Zwei-Chromatid-
Chromosomen) so eng aneinander (Tetrade),
dass es zu Überkreuzungen von Nichtschwester-
chromatiden (d.h. von väterlichen und mütterli-
chen Chromatiden) kommt. Dies wird Chiasma
genannt. Bei der späteren Trennung der Paare Abb. 33: Crossing-Over bei der Meiose

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
kommt es zu Crossover, d. h. zum Bruch und Über-Kreuz-Verheilung. Der Prozentsatz, mit
dem Morgan in seinen Versuchen rekombinierte Eigenschaften fand, variierte je nach
Merkmalspaar stark. Daraus schloss er, dass die entsprechenden Gene unterschiedliche Posi-
tionen auf dem Chromosom haben müssen: Je weiter zwei Gene auf einem Chromosom aus-
einanderlagen, desto wahrscheinlicher fand ein Crossing-Over statt und umso häufiger wur-
den diese Gene und die zugehörigen Merkmale entkoppelt.
Erb-/Kreuzungsschema. Man unterscheidet zwischen verschiedenen Arten eines Kreuzungs-
schemas. Dabei kann man eines, oder mehrere Merkmale betrachten. Die nachfolgenden
Abbildungen zeigen den Aufbau eines solchen Schemas.
Abb. 34: Kreuzungsschema nach der 1. Mendelschen Regel
Abb. 35: Kreuzungsschema nach der 2. Mendelschen Regel

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
g. Die Vererbung der Blutgruppen
Allgemein. Das ABO-Blutgruppensystem wurde 1901 von Landsteiner entdeckt. Ausgangsla-
ge: Es herrschte Krieg und viele Leute benötigten Blutkonserven. Man merkte, dass viele
Blutempfänger sofort starben, als man ihnen fremdes Blut gab. Man schloss daraus, dass es
zu Agglutinationsreaktionen kommen kann: Zwischen den Blutkörperchen eines Menschen
und dem Serum eines anderen Menschen kann es zu Verklumpungen kommen. Es gibt 4
verschiedene Blutgruppen: A, B, AB, O. Diese verschiedenen Blutgruppen beschreiben je
Abb. 37: Kreuzungsquadrat nach der 3. Mendelschen Regel
Abb. 36: Kreuzungsschema nach der 3. Mendelschen Regel

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Abb. 39: Spender-Empfänger-System bei Blutspenden
eine Oberflächenbeschaffenheit der Erythrocyten. An ihrer Oberfläche befinden sich ver-
schiedene Antigene, welche die 4 Blutgruppen definieren.
Im Serum des menschlichen Blutes befinden sich Antikörper. Sie kommen natürlich vor. Die
Antikörper greifen fremde Erythrocyten an und deaktivieren sie, wodurch es zu Verklum-
pungen kommt.
Daraus ergibt sich die rechts zu se-
hende Tabelle. Das „+“ kennzeich-
net eine Verklumpung. Es gibt nur
Antikörper für A und B, wodurch
bedingt ist, dass die Blutgruppe AB
keinerlei Antikörper besitzen kann,
denn sonst würden Abwehrreaktio-
nen gegen die eigenen Erythrocy-
ten erfolgen. Deshalb ist AB Universalempfänger. Die Blutgruppe 0 ist Universalspender,
denn im Körper können keine Antikörper gegen sie gebildet werden.
Vererbung. Bezüglich der Vererbung des ABO-Systems können wir eine Ausnahme zu den
Mendelschen Regeln feststellen: die Kodominanz. Bei einem Erbgang spricht man von Ko-
dominanz, wenn zwei oder mehr Allele im Phänotyp gleichzeitig feststellbar sind. Daneben
wird von multipler Allelie gesprochen, wenn mehrere Allele einen Phänotyp bestimmen,
bzw. an einem Genort vorhanden sind. Die Allele A und B werden kodominant vererbt, wäh-
rend das Allel 0 rezessiv ist. Im Modell kann man sich die kodominante Vererbung von A und
B als intermediäre Vererbung nach Gregor Mendel vorstellen, dass also, wenn beide Allele
aufeinandertreffen, keines der beiden dominiert, sondern die Blutgruppe AB entsteht. Die
Allele A und B sind stets dominant gegenüber dem Allel 0, sodass alle Träger der Blutgruppe
0 homozygot sein müssen, nämlich den Genotyp 00 besitzen.
Abb. 38: Antigen-Antikörper-Beziehung

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
h. Analyse von Erbgängen: autosomal-dominant, autosomal-rezessiv,
gonosomal-dominant, gonosomal-rezessiv
Stammbaumanalyse. Ziel der Stammbaumanalyse ist die Genotypenzuordnung bei gegebe-
nen Phänotypen. Damit kann dann beispielsweise im Rahmen einer genetischen Beratung
eine Risikoabschätzung für das Auftreten einer Krankheit vorgenommen werden.
Schreibweise eines Stammbaumes. Die Aufstellung eines Stammbaumes folgt bestimmten
Regeln und einer Symbolik, die international anerkannt ist. folgende Abbildung verdeutlicht
die möglichen Erbgänge, und die spezifische Darstellung von Stammbäumen.
Allgemeine Vorgehensweise.
1. Erster Blick
a. Der erste Blick bei der Stammbaumanalyse sollte den Geschlechtern der Betroffe-
nen gewidmet werden. Sind deutlich mehr Männer als Frauen betroffen, so kann
dies auf eine gonosomal-rezessive Vererbung hinweisen. In diesem Falle sind mehr
Männer betroffen, dass sich ein rezessives Merkmal nur dann im Phänotyp wieder-
findet, wenn Homozygotie herrscht. Bei Männern ist dies automatisch der Fall, denn
sie besitzen nur ein X-Chromosom.
Abb. 40: Erbgänge und ihre Schreibweisen

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
b. Ein zweiter Blick sollte darauf gerichtet werden, ob jede Generation betroffen ist,
denn wenn dies der Fall ist, kann man auf einen dominanten Erbgang schließen, bei
dem sich das Merkmal bereits ausprägt, wenn der Betroffene heterozygot ist.
2. Nach Mustern suchen
a. Ist mindestens ein Kind Merkmals-
träger, die beiden Eltern jedoch
nicht, dann liegt eindeutig eine re-
zessive Vererbung vor. Die beiden
Eltern sind heterozygot.
b. Sind beide Eltern Merkmalsträger,
mindestens ein Kind ist es jedoch
nicht, so liegt eindeutig eine domi-
nante Vererbung vor und die El-
tern sind heterozygot.
3. Vermutung/Hypothese
autosomal gonosomal
Phänotyp rezessiv dominant rezessiv dominant
aa AA/Aa a- xy
A- xy
aa AA/Aa aa xx
AA/Aa xx/xx
AA/Aa aa A- xy
a- xy
AA/Aa aa AA/Aa Xx/xx
aa xx
Im weiteren Verlauf wird nun die aufgestellte Hypothese mithilfe der Tabelle überprüft, wo-
bei man die fehlenden Genotypen im Stammbaum ergänzt.
Abb. 41: rezessive Vererbung
Abb. 42: dominante Vererbung

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
i. Kenntnisse zu den im Unterricht behandelten Erbkrankheiten
Ausführliche Erläuterungen zu Sichelzellanämie und Mukoviszidose sind in Kapitel 5: „Muta-
tionen“ zu finden.
Hämophilie. Ist auch unter dem Namen Bluterkrankheit bekannt. Bei der Hämophilie ist ein
Blutgerinnungsfaktor defekt, sodass Wunden sich nicht mehr verschließen. Bluterkranke
können nach relativ harmlosen Stürzen und Stößen an Wunden oder inneren Blutungen
sterben. Diese Erbkrankheit wird gonosomal-rezessiv vererbt.
Rot-Grün-Blindheit. Auch diese Erbkrankheit wird gonosomal-rezessiv vererbt. Sie ist eine
Störung des Farbsinns mit Schwäche bzw. vollständigem Fehlen der Wahrnehmung der Far-
ben Grün und Rot. Für das Fehlen farbempfindlicher Zellen in der Netzhaut ist ein defektes
Gen auf dem X-Chromosom verantwortlich.
Chorea Huntington. Ist auch unter dem Namen Veitstanz bekannt. Diese tödliche Nerven-
krankheit äußert sich durch Bewegungsstörungen und Gedächtnisschwäche, die in Demenz
und Tod münden. Die Krankheit wird autosomal-dominant vererbt, und kommt somit bei
allen Genträgern unweigerlich zum Ausbruch, allerdings meist erst im Alter von 40-50.
Marfan-Syndrom. Auch diese Erbkrankheit wird autosomal-dominant vererbt. Sie beruht auf
einem Defekt in einem Gen, das für die Bildung eines wichtigen Bestandteils des Bindegewe-
bes verantwortlich ist. Symptome sind unter anderem verlängerte Gliedmaßen, Verformung
des Augapfels und der Linse, überdehnbare Sehnen und Gelenke, sowie ein Herzklappenfeh-
ler.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Literatur- und Quellenverzeichnis
>unbekannt<. (2005). Abgerufen am 28. Januar 2012 von Das Biotechnologie und Life
Sciences Portal Baden-Württemberg: http://www.bio-
pro.de/magazin/thema/00182/index.html?lang=de&artikelid=/artikel/03055/index.h
tml
>unbekannt<. (2007). Abgerufen am 29. Januar 2012 von Kirksville R-III School District:
http://www.kirksville.k12.mo.us/khs/teacher_web/alternative/crossing_over.jpg
>unbekannt<. (2008). Abgerufen am 13. Januar 2012 von Chemgapedia:
http://www.chemgapedia.de/vsengine/popup/vsc/de/glossar/c/ch/chromosomen.gl
os.html
>unbekannt<. (2008). Abgerufen am 13. Januar 2012 von Chemgapedia:
http://www.chemgapedia.de/vsengine/popup/vsc/de/glossar/n/nu/nucleosomen.gl
os.html
>unbekannt<. (2008). Abgerufen am 13. Januar 2012 von Chemgapedia:
http://www.chemgapedia.de/vsengine/popup/vsc/de/glossar/h/hi/histone.glos.html
>unbekannt<. (2008). Abgerufen am 29. Januar 2012 von Chemgapedia:
http://www.chemgapedia.de/vsengine/media/vsc/de/ch/8/bc/zellbio/flash/compare
15_swf_altref.jpg
>unbekannt<. (2009). Abgerufen am 4. November 2011 von 2ClassNotes:
http://www.2classnotes.com/images/12/science/biology/botany/genetic_material/b
acterial_transformation.gif
>unbekannt<. (2009). Abgerufen am 21. Januar 2012 von Duden Schülerlexikon:
http://m.schuelerlexikon.de/mobile_biologie/Mutagene.htm
>unbekannt<. (2010). Abgerufen am 15. Januar 2012 von Abiunity:
http://www.abiunity.de/attachments/12099.jpg

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Bauersachs, G. (kein Datum). Abgerufen am 4. November 2011 von Guido Bauersachs
Homepage: http://www.guidobauersachs.de/oc/dna.gif
Beck, E.-G. (2006). Abgerufen am 30. Januar 2012 von Zentrale für Unterrichtsmedien im
Internet e.V.: http://www.zum.de/Faecher/Materialien/beck/13/bs13-16.htm
Born, A., Brott, A., Dr. Engelhardt, B., Dr. Esders, S., Dr. Gnoyke, A., Gräbe, G., et al. (2009).
Biologie Oberstufe. Berlin: Cornelsen Verlag.
Bossek, J. (2006). Abgerufen am 28. Januar 2012 von Abiturvorbereitung Biologie -
kompaktes Wissen: http://www.biolk-gsg.de/buch/kap2/karyogramme.html
Brüggemeier, M. (2009). Top im Abi - Abiwissen kompakt: Biologie. Braunschweig: Schroedel
Verlag.
Dr. med. Dickerhoff , R., & Prof. Dr. Dr. von Ruecker , A. (2011). Abgerufen am 21. Januar
2012 von Sichelzellstudie Deutschland: http://www.haemoglobin.uni-
bonn.de/sichelzellerkrankung2010_7.html
Dr. rer. nat. Bacchus, C., Bauer, T.-W., Prof. Dr. rer. nat. habil. Buselmaier, W., Prof. Dr. rer.
nat. Keil, M., & Priv.-Doz. Dr. med. Tariverdian, G. (2004). Fischer Abiturwissen
Biologie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
Dr. rer. nat. Groth, J. (2004). Meine Moleküle Deine Moleküle - Von der molekularen
Individualität. Berlin: Rhombos-Verlag.
Fischer, C. (2009). Abgerufen am 11. Januar 2012 von EGBs e-Learning:
http://www.egbeck.de/skripten/bilder/!img023.gif
Helmich, U. (2011). Abgerufen am 19. Januar 2012 von Ulrich Helmichs Homepage:
http://www.u-helmich.de/bio/gen/reihe2/23/karte232.html
Helmich, U. (2011). Abgerufen am 26. Januar 2012 von Ulrich Helmichs Homepage:
http://www.u-helmich.de/bio/gen/reihe2/25/25-1-s.html
Hertie-Institut. (2011). Abgerufen am 13. Januar 2012 von EIPAD - Epigenetic Inheritance in
Parkinson's Disease: http://www.eipad.uni-tuebingen.de/hintergrund2.html

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Kraft, U., Dr. med. Waitz, M., & Bradtmöller, M. (2011). Abgerufen am 28. Januar 2012 von
Techniker Krankenkasse: http://www.tk.de/tk/krankheiten-a-z/krankheiten-
k/klinefelter-syndrom/29088
Ling, W. (kein Datum). Abgerufen am 28. Januar 2012 von Scheffel-Gymnasium:
http://www.scheffel-
gymnasium.de/faecher/science/biologie/genetik/92mutation/mutation.htm
Ling, W. (kein Datum). Abgerufen am 28. Januar 2012 von Scheffel-Gymnasium:
http://www.scheffel.og.bw.schule.de/faecher/science/biologie/genetik/91methoden
/methoden.htm
Ling, W. (kein Datum). Abgerufen am 29. Januar 2012 von Scheffel-Gymnasium:
http://www.scheffel-
gymnasium.de/faecher/science/biologie/genetik/1mendel/mendel6.gif
Ling, W. (kein Datum). Abgerufen am 29. Januar 2012 von Scheffel-Gymnasium:
http://www.scheffel-
gymnasium.de/faecher/science/biologie/genetik/1mendel/mendel8.gif
Ling, W. (kein Datum). Abgerufen am 29. Januar 2012 von Scheffel-Gymnasium:
http://www.scheffel-
gymnasium.de/faecher/science/biologie/genetik/1mendel/mendel10.gif
Ling, W. (kein Datum). Abgerufen am 29. Januar 2012 von Scheffel-Gymnasium:
http://www.scheffel-
gymnasium.de/faecher/science/biologie/genetik/1mendel/mendel7.gif
Madprime. (2008). Abgerufen am 15. Januar 2012 von Wikipedia:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/PCR.svg
Manske, M. (2009). Abgerufen am 27. Januar 2012 von Wikipedia:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Mendelian_inheritance_inter
med.svg

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks
Mihu, M. (kein Datum). Abgerufen am 30. Januar 2012 von Biologie-Online.eu:
http://www.biologie-online.eu/genetik/vererbung-blutgruppen.php#1
Uhlenbrock, K., & Walory, M. (kein Datum). Schülerhilfe Abitur-Box: Biologie. Königswinter:
Tandem Verlag GmbH.

NORDRHEIN-WESTFALEN ZENTRALABITUR 2012
Biologie Grundkurs Abitur Zusammenfassung der relevanten Themen
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Inhaltsverzeichnis
1. Ökofaktoren der unbelebten Umwelt ............................................................................. 3
a. Definitionen: Autökologie, Demökologie, Populationsökologie, Synökologie,
Ökosystem, Biosphäre, Biotop, Biozönose, usw. ............................................................. 3
b. Biotische und abiotische Ökofaktoren im Überblick, Umwelteinflüsse als
Selektionsfaktoren ............................................................................................................. 4
c. Schema einer Optimumkurve (Minimum, Optimum, Maximum), ökologische
Potenz (Toleranzbereich), stenöke und euryöke Arten ................................................... 4
d. Ökofaktor Temperatur: RGT-Regel, Schema einer Optimumkurve ...................... 7
e. Erfassen physikalischer und chemischer Faktoren (Licht, Temperatur, pH-Wert) 7
f. Tiere und Temperatur: wechselwarme Tiere, gleichwarme Tiere,
Thermoregulation .............................................................................................................. 8
g. Wärmehaushalt homoiothermer Tiere, Klimaregeln ................................................ 9
h. Ökofaktor Wasser: Aufbau eines Laubblattes, Überblick Fotosynthese,
Wasserhaushalt der Pflanzen, Angepasstheit an die Verfügbarkeit von Wasser ......... 10
i. Zusammenwirken abiotischer Faktoren: Regulation der Stomataöffnung ............ 12
2. Wechselwirkungen / Beziehungen zwischen Lebewesen ............................................. 13
a. Biotische Faktoren im Überblick, Darstellung der Wechselwirkungen in
Schaubildern, je-desto-Beziehungen, negative Rückkopplung...................................... 13
b. Intra- und interspezifische Konkurrenz, Konkurrenzausschlussprinzip,
physiologisches und ökologisches Optimum, Hohenheimer Grundwasserversuch ..... 15
c. Mechanismen der Konkurrenzabschwächung: Verringerung innerartlicher
Konkurrenz, ökologische Sonderung, Einnischung ......................................................... 16
d. Ökologische Nische: Definition, Teilnischen, Bildung ökologischer Nischen,
ökologische Stellen, Anpassung ...................................................................................... 17
e. Symbiose: Formen (Ekto-/Endosymbiose), Anpassung, Koevolution ................. 18
f. Parasitismus: Formen, Anpassung, Parasitenabwehr, Koevolution ....................... 19

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
g. Fressfeind- bzw. Räuber-Beute-Beziehung .............................................................. 20
3. Populationsökologie ...................................................................................................... 21
a. Nahrungskette, Nahrungsnetz; Trophieebenen: autotroph, heterotroph;
Produzenten, Konsumenten, Destruenten ..................................................................... 21
b. Definition Population, Populationswachstum: exponentielles und logistisches
Wachstum ........................................................................................................................ 23
c. Regulation der Populationsdichte: dichteabhängige und dichteunabhängige
Faktoren ........................................................................................................................... 24
d. Entwicklung von Populationen: innere Dynamik, Wechselwirkungen, Räuber-
Beute-Populationen, Volterra-Regeln ............................................................................ 25
e. Schädlinge und Schädlingsbekämpfung: Definition Schädlinge / Nützlinge;
chemische / biologische / biotechnische Schädlingsbekämpfung ................................ 26
f. Fortpflanzungsstrategien: K- und r-Strategie .......................................................... 27
g. Wachstum der Weltbevölkerung, ökologischer Fußabdruck .................................. 28
4. Ökosysteme Schwerpunktsetzung Terrestrisches System ............................................ 28
a. Struktur des Ökosystems Wald, Stockwerkaufbau (Schichten) .......................... 28
b. Nahrungsnetze im Ökosystem Wald .................................................................... 30
c. Ökologische Pyramiden: Energiepyramide, Energiefluss zwischen den
Trophieebenen ................................................................................................................. 30
d. Biomassepyramide, Brutto- und Nettoprimärproduktion .................................. 31
e. Stoffkreisläufe im Ökosystem Wald: Kohlenstoffkreislauf ................................. 32
f. Stoffkreisläufe im Ökosystem Wald: Stickstoffkreislauf ......................................... 32
g. Untersuchung von Ökosystemen / nachhaltiger Waldbau ..................................... 33
h. Entwicklung von Ökosystemen: Sukzession ......................................................... 35
Literatur- und Quellenverzeichnis ............................................................................................ 37

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
1. Ökofaktoren der unbelebten Umwelt
a. Definitionen: Autökologie, Demökologie, Populationsökologie, Syn-
ökologie, Ökosystem, Biosphäre, Biotop, Biozönose, usw.
Die Ökologie ist die Lehre von den Wechselbeziehungen der Lebewesen untereinander und
zu ihrer Umgebung. Die Umwelt der Lebewesen wird von Faktoren der belebten und unbe-
lebten Umwelt bestimmt. Die abgebildete Abbildung soll die Beziehung der darunter ste-
henden Begriffe noch einmal verbildlichen.
Begriff Bedeutung
Autökologie Das einzelne Individuum steht im Mittelpunkt der Betrachtung, es wer-
den die Wirkungen einzelner Ökofaktoren auf das Individuum betrachtet
Demökologie Es werden die Wechselwirkungen der Populationen mit der Umwelt be-
trachtet (eher quantitativer Fokus)
Synökologie Es werden die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen tierischen und
Abb. 1: Die Forschungsfelder der Ökologie und ihre Fokusse

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
pflanzlichen Lebensgemeinschaften und der Umwelt betrachtet
Biotop Lebensraum, in dem ein Lebewesen lebt ( unbelebt)
Biozönose Alle Lebewesen, die sich ein Biotop teilen ( belebt)
Ökosystem Biotop und Biozönose beeinflussen sich auf vielfache Weise und bilden
so eine Einheit, die man Ökosystem nennt
Biosphäre Die Gesamtheit aller Ökosysteme auf der Erde
b. Biotische und abiotische Ökofaktoren im Überblick, Umwelteinflüsse
als Selektionsfaktoren
Biotische Faktoren. Biotische Ökofaktoren sind durch die belebte Umwelt, also Lebewesen
gekennzeichnet. Beispiele hierfür sind Fressfeinde, Parasiten, Symbionten und Konkurren-
ten. Man kann die biotischen Ökofaktoren in intra- und interspezifische Faktoren untertei-
len, also zwischen- und innerartlich.
Abiotische Faktoren. Abiotische Ökofaktoren sind Einflüsse der unbelebten Umwelt. Sie sind
also physikalisch-chemischer Natur. Wichtige abiotische Ökofaktoren sind Temperatur,
Strahlung, Wasser, Wind, pH-Wert, Luftfeuchtigkeit und viele mehr.
Umwelteinflüsse als Selektionsfaktoren. Das Leben jedes Lebewesens hängt von zahlrei-
chen biotischen und abiotischen Ökofaktoren ab, die das es grundlegend bestimmen. Meist
sind es wechselseitige Beziehungen zwischen Lebewesen, die sich, neben der unbelebten
Umwelt, besonders positiv oder negativ auswirken. So kann man jeden Einfluss der Umwelt
als Selektionsfaktor ansehen, denn Lebewesen mit einer besseren Anpassung an ihre Um-
welt haben mehr Fitness, können sich besser reproduzieren und haben dadurch einen Selek-
tionsvorteil.
c. Schema einer Optimumkurve (Minimum, Optimum, Maximum), öko-
logische Potenz (Toleranzbereich), stenöke und euryöke Arten
Alle Lebewesen sind an bestimmte Lebensbedingungen angepasst, unter denen sie beson-
ders gut leben und sich vermehren können. Aus dieser Abhängigkeit ergibt sich für jeden
Ökofaktor eine Toleranzkurve (auch Optimumkurve genannt), welche die Wachstumsbedin-

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
syn- oder autökologisch?
Die Toleranzkurve wird immer auch
von biotischen Ökofaktoren wie
Konkurrenz beeinflusst. Deshalb
spricht man hierbei von einem syn-
ökologischen Optimum, bzw. einer
synökologischen Potenz.
Wenn hingegen Versuche im Labor,
also unter Ausschluss biotischer
Faktoren, durchgeführt werden,
sind Optimum und Potenz autöko-
logisch (physiologisch)
gungen für einen bestimmten Organismus wiedergibt. Im Folgenden wird der wesentliche
Aufbau einer Toleranzkurve erläutert und anhand einer Abbildung dargestellt.
Toleranzkurve. Die Toleranzkurve ist
die konkrete Intensität der Lebens-
vorgänge/Aktivität des Lebewesens
im Toleranzbereich als Reaktion auf
Veränderungen des Umweltfaktors.
Optimum. Das Optimum ist der güns-
tigste Wert, bei dem in Bezug auf den
dargestellten Ökofaktor ideale Bedin-
gungen herrschen. Das Optimum ist
grafisch dargestellt der Hochpunkt
der Toleranzkurve.
Präferenzbereich. Der Präferenzbereich kennzeichnet eine Umgebung um das Optimum, der
vom Organismus präferiert, also bevorzugt wird. In diesem Bereich halten sich somit die
meisten Individuen auf.
Minimum und Maximum. Das Minimum und das
Maximum bilden die äußersten Grenzen für die
Lebensfähigkeit des Organismus'. Werden diese
Punkte überschritten, tritt der Tod ein. Sie be-
grenzen das Vorkommen einer Art in der Bio-
sphäre.
Toleranzbereich. Als Toleranzbereich eines Le-
bewesens versteht man jenen Bereich, in dem
die bloße Existenz des Lebewesens möglich ist.
Sie ist durch das Minimum und das Maximum
begrenzt.
Pessimum. Nähert sich die Toleranzkurve den
Abb. 2: Schema einer Toleranzkurve

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Maximum bzw. dem Minimum an, so spricht man vom Pessimum. Hier ist zwar kurzzeitig
Existenz, aber keine Fortpflanzung, Entwicklung und ähnliches möglich.
Ökologische Potenz. Die ökologische Potenz beschreibt den Bereich, in dem Fortpflanzung,
Bewegungsaktivitäten und Entwicklung stattfinden kann. Sie umfasst den Toleranzbereich
abzüglich des Pessimums.
Stenöke und euryöke Arten. Bei der Feststellung, ob eine Art stenök oder euryök in Bezug
auf den dargestellten Ökofaktor ist, ist der Toleranzbereich entscheidend. Stenöke Arten
haben einen engen Toleranzbereich, euryöke Arten einen weiten. Daraus kann geschlussfol-
gert werden, dass euryöke Arten extreme Schwankungen der Ökofaktoren viel besser ver-
kraften als stenöke Arten.
Folgende Tabelle stellt die Fachbegriffe für euryöke und stenöke Arten gegenüber. Die Ab-
bildung zeigt grafisch den Unterschied zwischen stenöker und euryöker Art.
stenök Ökofaktor euryök
stenotherm Umgebungstemperatur eurytherm
stenohalin Salzgehalt euryhalin
stenohygr Bodenfeuchte euryhygr
stenohyd Wassergehalt euryhyd
stenoxygen Sauerstoffgehalt euryoxygen
Abb. 4: Toleranzkurve einer euryöken Art Abb. 3: Toleranzkurve einer stenöken Art

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
d. Ökofaktor Temperatur: RGT-Regel, Schema einer Optimumkurve
Die Temperatur ist als Ökofaktor für alle Lebewesen von größter Bedeutung, denn kaum ein
Lebensvorgang bleibt von ihr unbeeinflusst.
Einfluss auf Lebensvorgänge. Die Temperatur entspricht dem Wärme- oder Energiezustand
eines Körpers und damit der ungerichteten Bewegung seiner Moleküle. Von dieser Teilchen-
bewegung hängt wiederum die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen entscheidend ab.
Die nachfolgend genannte Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel gilt grundsätzlich für
alle biochemischen Reaktionen in den Zellen der Lebewesen, allerdings nur in einem ver-
hältnismäßig engen Bereich zwischen 0°C und ca. 40°C. Temperaturen darüber oder darun-
ter würden zur Denaturierung empfindlicher Proteine, bzw. zu einer Beschädigung des Zell-
plasmas führen.
Die RGT-Regel. Eine Erhöhung der Temperatur um 10°C beschleunigt die Geschwindigkeit
chemischer und physiologischer Reaktionen um das Zwei- bis Dreifache. Diese Regel gilt nur
bei poikilothermen Tieren, da ihre Körpertemperatur von der Außentemperatur abhängt.
Untersuchung der Wirkung. Untersucht man die Wirkung unterschiedlicher Temperaturwer-
te auf die Fotosyntheseleistung einer Pflanze, auf die Entwicklungsdauer eines Tieres oder
auf die Stoffwechselintensität von Bakterien, erhält man meist sehr ähnliche Ergebnisse. Die
Ergebnisse lassen sich in einer Optimumkurve darstellen, wie sie im vorigen Kapitel behan-
delt wurde. Sie wird durch die drei Kardinalpunkte Minimum, Optimum und Maximum cha-
rakterisiert. Zu beachten sind in diesem Zusammenhang die beiden oben bereits erklärten
Begriffe stenotherm und eurytherm.
e. Erfassen physikalischer und chemischer Faktoren (Licht, Tempera-
tur, pH-Wert)
Experimente geben über die Auswirkung abiotischer Faktoren auf Lebewesen Auskunft. Um
die Wirkung eines bestimmten abiotischen Ökofaktors zu untersuchen, verändert man des-
sen Intensität während alle anderen Faktoren konstant gehalten werden (Monofaktoren-
Experiment). So lässt sich nur die Wirkung auf einzelne Lebenserscheinungen der untersuch-

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
ten Art, wie Wachstum oder Fortpflanzung, ermitteln. Erst Auswertungen vieler solcher Ex-
perimente am Standort zeigen, wie die Art von ihrer unbelebten Umwelt insgesamt abhängt.
f. Tiere und Temperatur: wechselwarme Tiere, gleichwarme Tiere,
Thermoregulation
Man unterscheidet in der Biologie wechselwarme und gleichwarme Tiere. Auch Pflanzen
sind wechselwarm. Zu den wechselwarmen Tieren gehören Amphibien, Reptilien, Insekten
und Fische. Zu den gleichwarmen Tieren Säugetiere und Vögel.
wechselwarm = poikilotherm(ektotherm) gleichwarm = homoiotherm (endotherm)
Wechselwarme Tiere. Bei wechselwarmen Tieren schwankt die Körpertemperatur mit der
Umgebungstemperatur, weshalb sie auch als ektotherm bezeichnet werden. Bei Umge-
bungstemperaturen in der Nähe ihres Minimums oder Maximums fallen Wechselwarme in
Kälte- bzw. Wärmestarre. Diese sind durch eine reversible Verlangsamung des Stoffwechsels
charakterisiert. Bewohner extrem heißer oder extrem kalter Lebensräume sind durch Hitze-
oder Frostschutzstoffe speziell angepasst. Im Vergleich zwischen wechselwarmen und
gleichwarmen Tieren haben Wechselwarme einen engeren Toleranzbereich, da ihre Körper-
temperatur stark abhängig ist von den Umgebungstemperaturen. Daraus folgt, dass wech-
selwarme Tiere durch die Unregelmäßigkeit ihrer Körpertemperatur ein kleineres Optimum,
Abb. 5: Toleranzkurven von gleich- und wechselwarmen Tieren im Vergleich

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
sowie einen kleineren Präferenzbereich besitzen. Wechselwarme Tiere zeigen thermoregula-
torische Verhaltensweisen, wie z.B. Sonnenbäder der Reptilien, um ihre Temperatur zu regu-
lieren.
Gleichwarme Tiere. Bei gleichwarmen Tieren bleibt die Körpertemperatur relativ konstant,
sodass sie unabhängig von den Außentemperaturen sind. Sie kommen daher auch in sehr
kalten oder sehr warmen Gebieten vor. Für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur
benötigen homoiotherme Tiere Energie in Form von Nahrung. Während der Kälteperiode
ziehen Zugvögel in wärmere Klimazonen, um mehr Nahrung zu finden, während einige Säu-
getiere Winterruhe oder –schlaf halten. Diese Ruhezustände sind durch ein Absinken der
Stoffwechselaktivität auf ein Mindestmaß charakterisiert. Bei der Winterruhe bleibt die Kör-
pertemperatur im Normalbereich, während sie beim Winterschlaf auf +5°C bis 0°C herabge-
setzt wird. Ein Absinken der Temperatur auf Letaltemperaturen bewirkt einen Weckreiz. Im
Gegensatz zu den poikilothermen Tieren haben die homoiothermen Tiere einen weiten Tole-
ranzbereich, ein ausgebreitetes Optimum und einen weiten Präferenzbereich, da die Körper-
temperaturen bei ihnen nicht von Außentemperaturen abhängen.
Die Thermoregulation bei gleichwarmen Tieren ist an eine ganze Reihe von Merkmalen ge-
bunden:
Eine isolierende Körperbedeckung aus Haaren oder Federn
Wärmedämmendes Fettgewebe in der Unterhaut
Ein leistungsfähiger Blutkreislauf zum Wärmetransport
Einrichtungen zur Wärmeabgabe und Kühlung (z.B. schwitzen)
Auch das Zittern bei niedrigen Temperaturen ist ein gezielter Reflex, denn durch die Bewe-
gung und Muskelaktivität wird Wärme erzeugt. Die Körperwärme wird bei Gleichwarmen als
„von innen heraus“ produziert, weshalb sie auch als endotherm bezeichnet werden.
g. Wärmehaushalt homoiothermer Tiere, Klimaregeln
Zu beachten ist, dass es zu den unten angegebenen Regeln zahlreiche Ausnahmen gibt, und
sie auch nur auf gleichwarme Tiere angewendet werden können.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Bergmannsche Regel. Sie lautet: Die durchschnittliche Körpergröße einer Art oder verwand-
ter Arten nimmt in kälteren Lebensräumen zu. Dies lässt sich mit dem für den Wärmehaus-
halt wichtigen Verhältnis von Volumen zu Oberfläche erklären. Für einen größeren Körper ist
dieses Verhältnis günstiger als für einen kleinen. Da die Wärmebildung vor allem vom Kör-
pervolumen, die Wärmeabstrahlung aber von der Körperoberfläche abhängt, sind große Tie-
re bei niedrigen Außentemperaturen im Vorteil. Bei großen Körpern bleibt die Oberfläche im
Verhältnis zum Volumen kleiner als bei kleinen Körpern, weshalb ein großer Körper weniger
schnell auskühlt.
Allensche Regel. Sie lautet: Die Größe der Körperanhänge (Ohren, Schwanz, Extremitäten)
einer Art oder verwandter Arten nimmt in kälteren Lebensräumen ab. Auch diese Regel lässt
sich durch die oben erläuterten Überlegungen erklären. Über große Extremitäten wird viel
Körperwärme abgegeben, weshalb sie bei Tieren in heißen Gebieten durchaus sinnvoll sind,
aber bei Tieren in kalten Gebieten zum Erfrieren führen kann.
h. Ökofaktor Wasser: Aufbau eines Laubblattes, Überblick Fotosynthese,
Wasserhaushalt der Pflanzen, Angepasstheit an die Verfügbarkeit von
Wasser
Aufbau eines Laubblattes. Die folgende Abbildung macht deutlich, wie ein Laubblatt meist
aufgebaut ist.
Abb. 6: Aufbau eines Laubblattes

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Das Laubblatt bestimmt im Querschnitt aus mehreren Schichten:
Oben und unten ist es durch eine Epidermis begrenzt, deren farblose Zellen keine
Chloroplasten enthalten. Sie sind von einer Cuticula überzogen, einer Wachsschicht,
welche das Blatt vor dem Austrocknen schützt.
Unterhalb der oberen Epidermis liegt das Palisadengewebe. Es besteht aus dicht ge-
drängten, chloroplastenreichen Zelle und ist der Hauptort der Fotosynthese.
Das darunter liegende Schwammgewebe besteht aus locker angeordneten Zellen, die
ebenfalls Chloroplasten enthalten. Zwischen den Zellen liegen mit Luft gefüllte Inter-
zellularen, die dem Austausch von Gasen dienen.
Die Interzellularen stehen über Spaltöffnungen (Stomata) mit der Außenluft in Ver-
bindung. Diese werden nach Bedarf geöffnet und geschlossen und regeln so den
Gasaustausch.
Über die Leitbündel werden vor allem Wasser und Mineralstoffe in das Blattgewebe
gebracht und Kohlenhydrate für das weitere Wachstum abtransportiert.
Überblick Fotosynthese. Die Fotosynthese ist der zentrale Stoffwechselvorgang der Erde:
Aus den energiearmen, anorganischen Stoffen Kohlenstoffdioxid und Wasser bauen die
Pflanzen die energiereiche, organische Verbindung Glucose sowie Sauerstoff auf. Die Energie
für diese Reaktion stammt vom Sonnenlicht. Die Gleichung der Fotosynthese lautet:
6CO2 + 12H2O LICHTENERGIE C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
Die Fotosynthese beruht auf Kohlenstoffdioxid, das mit 0,03 % als Spurengas in der Luft ent-
halten ist. Für den Menschen bedeutet dies, dass das CO2, das wir ausatmen, durch Pflanzen
umgewandelt wird. Es dient der Pflanze indirekt als Nahrung, die Pflanze gibt uns wiederum
den Sauerstoff zum Atmen. Die Absorption des Lichts geschieht durch die Blattpigmente, vor
allem durch Chlorophyll. Bei der Fotosynthese spielen die oben aufgeführten Stomata eine
große Rolle, da sie für den Gasaustausch verantwortlich sind. Ihre Öffnungsweite wird durch
das Zusammenwirken von Licht, Wasserversorgung, Luftfeuchtigkeit und Temperatur gere-
gelt.
Wasserhaushalt der Pflanzen. Zellen der Wurzel, vor allem die dünnwandigen Wurzelhaare,
nehmen durch Diffusion und Osmose Wasser aus dem Boden auf. Wasser strömt dabei in

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Richtung seines Konzentrationsgefälles aus dem wasserreichen Boden in die wasserärmeren
Zellen. Die als hydratisierte Ionen im Wasser gelösten Mineralstoffe werden selektiv durch
die Membranen der Wurzelzellen, vor allem durch die Endodermis, transportiert. Dies kann
auch gegen das Konzentrationsgefälle als aktiver Transport geschehen, der ATP verbraucht.
Das Feuchtigkeitsgefälle zwischen den wasserreichen, in den Zellzwischenräumen mit Was-
serdampf gesättigten Blättern und dem trockeneren Luftraum ist die Ursache dafür, dass
eine Pflanze Wasser durch Verdunstung an die Umgebung verliert. Die kontrollierte Abgabe
von Wasserdampf wird Transpiration genannt, sie richtet sich nach Temperatur, Licht, Koh-
lenstoffdioxid und nach dem Zelldruck (Turgor).
Angepasstheit an die Verfügbarkeit von Wasser. Ob eine Pflanze auf Dauer mit dem Was-
serangebot an ihrem Standort auskommt, hängt davon ab, ob ihre Wasserbilanz positiv ist.
Darunter versteht man die Differenz von Wasseraufnahme und Wasserabgabe. Zwar können
Pflanzen durch die Stomata ihre Wasserabgabe bedingt regulieren, doch verlieren sie auch
bei geschlossenen Stomata über die Epidermis und die Cuticula Wasser. Viele Pflanzen sind
in Bau und Gestalt an die unterschiedliche Verfügbarkeit von Wasser an ihren Standorten
angepasst und erreichen so einen konstanten Wassergehalt.
i. Zusammenwirken abiotischer Faktoren: Regulation der Stomataöff-
nung
CO2-Gehalt Luftfeuchtigkeit
Licht Temperatur
hoher Wert
geö
ffn
et
niedriger Wert
gesc
hlo
ssen
Sto
mat
a
Abb. 7: Regulation der Stomataöffnung

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Wie in der obigen Abbildung ersichtlich ist, wird die Stomataöffnung von vielen abiotischen
Ökofaktoren reguliert. Der Ökofaktor Licht bewirkt zunächst eine starke Öffnung der Stoma-
ta. Wird jedoch die Lichtintensität zu hoch, werden die Stomata nicht weiter geöffnet. Bei
der Temperatur ist es vergleichbar, jedoch werden die Stomata bei hohen Temperaturen
sogar wieder geschlossen, um zu viel Transpiration durch die Stomata zu verhindern. Die
Luftfeuchtigkeit ist linear aufgebaut, sodass die Stomata bei steigender Luftfeuchtigkeit wei-
ter geöffnet werden. So kann Wasser aufgenommen werden. Bei steigendem CO2-Gehalt
werden die Öffnungen geschlossen, denn zu viel Kohlenstoffdioxid ist toxisch für die Pflanze.
Außerdem ist der Bedarf an CO2 bei einer bestimmten Konzentration gedeckt, sodass die
Stomata nicht geöffnet sein müssen, um Gasaustausch zu gewährleisten.
Dieses Beispiel zeigt exemplarisch, dass die abiotischen Ökofaktoren nicht unabhängig von-
einander auf Lebewesen einwirken. Vielmehr ist es die Gesamtheit aller abiotischen Ökofak-
toren, die Lebewesen beeinflussen.
2. Wechselwirkungen / Beziehungen zwischen Lebewesen
a. Biotische Faktoren im Überblick, Darstellung der Wechselwirkungen
in Schaubildern, je-desto-Beziehungen, negative Rückkopplung
Biotische Faktoren im Überblick. Biotische Ökofaktoren sind Faktoren der belebten Umwelt,
die also von anderen Lebewesen ausgehen. Zu diesem Faktoren gehören: Symbiose, Karpo-
se, Konkurrenz, Parasitismus, und die Räuber-Beute-Beziehung. Die verschiedenen Faktoren
werden in den folgenden Kapiteln eingehender behandelt. Man kann die biotischen Fakto-
ren in zwei Gruppen einteilen: intra- und interspezifische Faktoren.
Darstellen von Wechselwirkungen in Schaubildern. Wechselwirkungen zwischen Lebewesen
können in Schaubildern dargestellt werden. Um die Wechselwirkungen zu klassifizieren, be-
nutzt man meist ein einfaches Schema aus den Zeichen „+“ und „–“, mit denen eine vorteil-
hafte oder nachteilige Wirkung auf das jeweilige Lebewesen formelartig dargestellt werden
kann.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Je-desto-Beziehungen. Man kann die Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen mit je-
desto-Beziehungen kennzeichnen. Oft werden sie bei Wechselwirkungen zwischen Populati-
onen gebraucht. Es werden Regelkreise aufgestellt. Beispiel: Je dichter die Population einer
Beute ist, desto leichter fällt es ihren Fressfeinden, Nahrung zu erwerben, desto stärker wird
deren Population wachsen.
Negative Rückkopplung. Wenn wir den bei den je-desto-Beziehungen gemachten Gedan-
kengang weiterverfolgen, entdecken wir automatisch das Prinzip der negativen Rückkopp-
lung. Zurück zum Beispiel: Je stärker die Population der Fressfeinde wächst, desto mehr Beu-
tetiere werden gefressen, desto weniger Nahrung ist vorhanden, desto mehr Räuber müssen
hungern, desto weniger Räuber wird es in Zukunft geben. Dieser Vorgang hat eine kreisartige
Struktur, denn diesen Gedanken könnte man immer weiter führen. Wenn es wieder weniger
Räuber gibt, kann sich die Beutepopulation erholen, und das Spiel fängt wieder von vorne
an.
Abb. 8: Darstellung von Wechselwirkungen zwischen Tieren in einem Schaubild

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
b. Intra- und interspezifische Konkurrenz, Konkurrenzausschlussprin-
zip, physiologisches und ökologisches Optimum, Hohenheimer
Grundwasserversuch
Intra- und interspezifische Konkurrenz. Man unterscheidet in der Biologie die innerartliche
von der zwischenartlichen Konkurrenz. Die meisten für einen Organismus überlebenswichti-
gen Ressourcen stehen nur begrenzt zu Verfügung. Ein Beispiel hierfür ist die Nahrung. Le-
bewesen konkurrieren um Ressourcen. Der Schaden, den sich die Konkurrenten dabei ge-
genseitig zufügen, ist selten gleichgewichtig. Bei einer Konkurrenzbeziehung ist derjenige
Konkurrent natürlich im Vorteil, dessen Nahrungsspektrum größer ist. Konkurrenz besteht
aber, wie oben schon erwähnt, nicht nur zwischen Angehörigen verschiedener Arten, son-
dern auch zwischen Artgenossen. Ein Beispiel einer Ressource, um die intraspezifisch kon-
kurriert wird, sind Reviere. Je ähnlicher sich zwei konkurrierende Arten sind, desto stärker ist
der Konkurrenzkampf.
Konkurrenzausschlussprinzip. Das Konkurrenzausschlussprinzip, auch Gause-Volterra’sches
Prinzip genannt, besagt, dass mit zunehmender Ähnlichkeit der Umweltansprüche zweier
konkurrierender Arten die Möglichkeit einer dauerhaften Besiedelung des gleichen Lebens-
raums abnimmt. Eine Art wird sich immer als konkurrenzstärker erweisen und die andere
verdrängen. In einem späteren Kapitel wird der Begriff der ökologischen Nische eingeführt,
welcher hierauf anwendbar ist.
Physiologisches und ökologisches
Optimum. Diese Unterscheidung ist
bereits „c. Schema einer Optimum-
kurve“ aufgeführt (siehe Textfeld).
Hohenheimer Grundwasserversuch.
Der Hohenheimer Grundwasserver-
such wurde erstmals 1952 an der
Universität Hohenheim durchge-
führt. Er besteht darin, dass Mitar-
beiter der TH Hohenheim drei ver-
Abb. 9: Hohenheimer Grundwasserversuch

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
schiedene Grasarten (Glatthafer, Wiesenfuchsschwanz, Aufrechte Trespe) zunächst getrennt
voneinander in Sandbeeten mit kontinuierlich ansteigender Grundwassertiefe von 0 bis 1,5
Metern ausgesät haben, um sie in einem zweiten Schritt gemeinsam – also unter Konkur-
renzbedingungen – erneut auszusäen. Es zeigt sich, dass sich das Optimum der erstellten
Toleranzkurve unter Konkurrenz verschiebt, denn getrennt voneinander zeigen die drei Grä-
ser identische Toleranzkurven.
Durch den Versuch wird nicht nur das Konkurrenzausschlussprinzip deutlich, sondern auch
der Unterschied zwischen dem autökologischen und dem synökologischen Optimum.
c. Mechanismen der Konkurrenzabschwächung: Verringerung innerart-
licher Konkurrenz, ökologische Sonderung, Einnischung
Verringerung innerartlicher Konkurrenz. Artgenossen ermöglichen die geschlechtliche Fort-
pflanzung und bieten als Sozialpartner Schutz, Sicherheit und Chancen zum Lernen, sind aber
gleichzeitig auch Konkurrenten. Innerartliche Konkurrenz ist aufgrund der ähnlichen Um-
weltfaktoren besonders ausgeprägt. Folgende Mechanismen führen zu einer Konkurrenz-
abschwächung:
Abgrenzung von Revieren schafft vor allem für die Fortpflanzung einen konkurrenz-
armen Raum.
Große Unterschiede zwischen Jugend- und Altersform, wie bei Raupe und Schmetter-
ling, erlauben einer Art die Nutzung unterschiedlicher Ressourcen.
Die Verschiedenheit zwischen den Geschlechtern, also der Sexualdimorphismus, kann
ähnlich groß sein, wie die zwischen verschiedenen Arten. So saugen Stechmücken-
männchen Nektar und die Weibchen Blut.
Ökologische Sonderung. Unter den Nachkommen intensiv konkurrierender Arten sind dieje-
nigen Individuen im Vorteil, deren Merkmale eine abweichende Lebensweise erlauben. Dies
kann durch anders geformte Mundwerkzeuge, Enzyme mit veränderter Wirkung, höherer
Säuretoleranz, geringeren Wasserbedarf u.v.m. möglich sein. Im selben Maße, wie sich die

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Umweltansprüche unterscheiden, nimmt die Konkurrenz ab. Man nennt diese Individuen
ökologisch isoliert oder eingenischt.
Einnischung. Verschiedene Arten nutzen die Umwelt in verschiedener Art und Weise. Bilden
Tochterarten einer Stammart unterschiedliche sogenannte ökologische Nischen (vgl. folgen-
des Kapitel), weil sich ihre Lebensansprüche unterscheiden, spricht man von ökologischer
Isolation oder von Einnischung.
d. Ökologische Nische: Definition, Teilnischen, Bildung ökologischer Ni-
schen, ökologische Stellen, Anpassung
Definition. Die Gesamtheit aller Wechselbeziehungen zwischen einer Art und ihrer Umwelt
nennt man ihre ökologische Nische. Dabei stellt diese Nische keineswegs etwas Räumliches
dar, sondern vielmehr eine Stellung, man könnte sie also als „Beruf“ einer Art bezeichnen.
Teilnischen. Selbst für gut bekannte Tier- und Pflanzenarten ist es unmöglich, ihre ökologi-
schen Nischen vollständig zu erfassen. Ein Koordinatensystem mit Umweltansprüchen einer
Art wäre ein nicht vorstellbares multidimen-
sionales Beziehungsgefüge. Deshalb be-
schränkt man sich bei der Betrachtung oft
auf einzelne Dimensionen, zum Beispiel der
„Nahrungsnische“. Diese Dimensionen wer-
den Teilnischen genannt.
Bildung ökologischer Nischen. Die Bildung
ökologischer Nischen vollzieht sich durch
Einnischung von Arten, wie sie oben be-
schrieben wird. Die Artbildung, wie die Bil-
dung ökologischer Nischen können wir nicht
beobachten, denn sie finden im Laufe der
Evolution in einem größeren Zeitraum statt.
Für die heute lebenden Arten hat sich die Abb. 10: Besiedlung unterschiedlicher Körperregionen

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Einnischung in der Vergangenheit abgespielt. Trotzdem lassen sich erfolgte ökologische Son-
derungen rekonstruieren:
Durch Besiedlung unterschiedlicher Lebensräume (z.B. verschiedene Waldtypen)
Durch Besiedlung unterschiedlicher Körperregionen
Durch Entwicklung unterschiedlicher Köpergröße und Sonderung nach Beutegröße
Ökologische Lizenzen. Ökologische Lizen-
zen werden auch ökologische Stellen ge-
nannt. Wo auf der Erde vergleichbare
Lebensbedingungen herrschen, haben
Lebewesen die Möglichkeit, ähnliche öko-
logische Nischen zu bilden. Der Lebens-
raum vergibt dafür gewissermaßen „Li-
zenzen“. Werden diese von verschiede-
nen, meist jedoch nicht verwandten Ar-
ten in ähnlicher Weise genutzt, spricht
man von Stellenäquivalenz. So nehmen
beispielsweise parasitische Kleinkrebse
bei Walen die Stelle der Läuse anderer
Säugetiere ein. Wo Spechte fehlen, neh-
men andere Tiere mit spezialisierten Or-
ganen ihre Stelle als Stocherjäger auf Bäumen ein.
Stellenäquivalenz erkennt man meist daran, dass nicht verwandte Arten übereinstimmende
Anpassungen aufweisen.
e. Symbiose: Formen (Ekto-/Endosymbiose), Anpassung, Koevolution
Symbiose allgemein. Unter Symbiose versteht man das Zusammenleben artverschiedener
Lebewesen zum wechselseitigen Nutzen. Der kleinere Partner wird hierbei als Symbiont, der
größere als Wirt bezeichnet. Symbiose erweitert die ökologischen Möglichkeiten beider
Abb. 11: Stellenäquivalenz

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Partner außerordentlich, so kann es dazu kommen, dass durch Symbiose ein völlig anderer
Lebensraum erschlossen werden kann, wie es bei Flechten der Fall ist.
Formen von Symbiose. Man unterscheidet Ekto- und Endosymbiose. Bleiben die Partner bei
der Symbiose körperlich getrennt, spricht man von Ektosymbiose, wird einer der Partner in
den Körper des anderen aufgenommen, spricht man von Endosymbiose.
Anpassung und Koevolution. Die beiden an der Symbiose beteiligten Individuen, also Sym-
biont und Wirt, durchlaufen eine wechselseitige Anpassung. Die Symbiose von Pflanzen und
Insekten besteht seit etwa 100 Millionen Jahren. Die Pflanze profitiert von der Fremdbe-
stäubung, die Insekten profitieren von dem Nektar, den sie dafür bekommen. Durch Koevo-
lution wurden die beiden aneinander angepasst. Die Pflanzen besitzen Lockmittel wie Duft,
auffällige Farbe oder Nektar, die Insekten spezielle Sammeleinrichtungen bzw. spezifische
Mundwerkzeuge.
f. Parasitismus: Formen, Anpassung, Parasitenabwehr, Koevolution
Parasitismus allgemein. Parasitismus ist dadurch gekennzeichnet, dass der Parasit seinem
Wirt Nahrung entzieht, ohne ihn zu töten, dass er besonders weitgehend an den Wirt ange-
passt ist und von ihm abhängig ist. Auch wenn Parasitenbefall den Wirt nicht lebensbedroh-
lich schädigt, wirkt er sich doch negativ auf Wachstum, Fortpflanzung oder Lebensdauer aus.
Formen von Parasitismus. Man unterscheidet, wie auch bei der Symbiose, zwischen Ekto-
und Endoparasitismus. Lebt der Parasit im Körper des Wirts, spricht man von Endoparasitis-
mus. Falls nicht, spricht man von Ektoparasitismus. Neben den echten Parasiten gibt es auch
Übergangsformen zwischen Räubern und Parasiten. So kann die Bremse, wenn an einem
Säugetier Blut saugt, als Parasit begriffen werden. Saugt sie aber eine Insektenlarve voll-
kommen aus, entspricht sie einem Räuber.
Eine andere Form sind Parasitoide. Diese Parasitenähnlichen schmarotzen als Larven im Kör-
per von anderen Insekten. Dabei verschonen sie zunächst die lebenswichtigen Organe des
Wirts, töten ihn am Ende ihrer Entwicklung aber doch.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Anpassung. Die Umwelt des Parasi-
ten ist ein Lebewesen. Daraus erge-
ben sich spezielle Anpassungen.
Haft- und Klammerorgane,
die verhindern, dass der Pa-
rasit seinen Wirt verliert,
was i.d.R. zum Tod führen
würde
Rückbildungen, die für Para-
siten ohne Nachteil sind.
Flöhen fehlen Flügel, endop-
arasitische Würmer haben
keine Sinnes- und Verdau-
ungsorgane, etc.
Große Eizahlen und komplizierte Entwicklungs- und Übertragungswege sichern die
Fortpflanzung und das Auffinden eines Wirts.
Parasitenabwehr. Von Parasiten befallenes Pflanzengewebe kann absterben und Abwehr-
stoffe freisetzen. In der Umgebung setzt eine schützende Schorfbildung ein, das Gewebe
verkorkt. Tiere bekämpfen Ektoparasiten durch Putzen und Baden. Endoparasiten werden
zum Teil eingekapselt oder durch Abwehrzellen, Antikörper und Enzyme angegriffen.
Koevolution. Das Verhältnis von Parasit und Wirt gilt als Musterbeispiel von Koevolution und
wird manchmal verglichen mit einem Wettrüsten der Partner. Je besser sich die Parasiten an
die Wirtsart anpassen, desto wirksamere Abwehrmechanismen entwickeln die Wirte gegen
die Parasitenart.
g. Fressfeind- bzw. Räuber-Beute-Beziehung
Räuber-Beute-Beziehung allgemein. Räuber ernähren sich von ihrer Beute. In der Natur bil-
det sich zwischen Räuber und Beute häufig ein komplexes ökologisches Zusammenspiel, das
Abb. 12: Beispiel für Parasitismus: Fuchsbandwurm

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
die Koexistenz beider erlaubt. So haben die Beutetiere beispielsweise verschiedene Tarn-
und Warnmechanismen entwickelt, um dem Räuber zu entgehen.
Nahrungstypen. Man unterscheidet in der Natur drei verschiedene Nahrungstypen. Carnivo-
re Tiere sind Fleischfresser, Herbivore sind Pflanzenfresser, und Omnivore sind Allesfresser.
Beutespektrum. Neben den Nahrungstypen unterteilt man auch das Beutespektrum. Dies
geschieht in Anlehnung an die Begriffe eury- und sten-, die wir bereits bei den Toleranzkur-
ven kennen gelernt haben. Allesfresser haben ein breites Beutespektrum, sie werden als
euryphag bezeichnet. Tiere mit einem geringen Beutespektrum bezeichnet man als steno-
phag. Es gibt zudem monophage Tiere, die nur auf eine einzige Nahrung festgelegt sind. Ein
Beispiel hierfür ist der Koalabär, der sich ausschließlich von Eukalyptusblättern ernährt.
Beuteerwerb. Man unterscheidet je nach Technik des Beuteerwerbs verschiedene Katego-
rien.
Filtrierer filtern Nahrung bestimmter Größe aus dem Wasser (Bartenwal)
Strudler erzeugen zum Ausfiltern der Nahrung einen Wasserstrom (Muscheln)
Sammler lesen gezielt einzelne Beuteobjekte auf (Vögel)
Weidegänger beißen Pflanzenteile ab und zerkleinern sie (Huftiere)
Fallensteller stellen den Beutetieren Fallen (Spinnen)
Jäger lauern Beute auf oder erjagen sie im Lauf, Flug oder schwimmend (Gepard,
Anglerfisch, Hai)
3. Populationsökologie
a. Nahrungskette, Nahrungsnetz; Trophieebenen: autotroph, hete-
rotroph; Produzenten, Konsumenten, Destruenten
Produzenten. Dies sind Lebewesen, die organische Substanzen (Biomasse) aus anorgani-
schem Material aufbauen. Zu ihnen zählen neben den autotrophen Bakterien nur die Foto-
synthese betreibenden Pflanzen. Im Wasser handelt es sich bei diesen vor allem um Algen,

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
auto- und heterotroph
autotrophe Organismen sind
selbsternährend, d.h. sie sind in der
Lage organische Substanz aus an-
organischer Materie zu bilden. Or-
ganismen, die dazu nicht in der
Lage sind, und somit pflanzliche
oder tierische Produkte zu sich
nehmen müssen um zu überleben,
nennt man heterotroph.
an Land um höhere grüne Pflanzen. Von der Bio-
masse, die die Produzenten aufbauen, leben alle
anderen Organismen eines Ökosystems.
Konsumenten. Sie ernähren sich von lebender
organischer Substanz. Zu ihnen zählen pflanzen-
und fleischfressende Tiere und pflanzliche sowie
tierische Parasiten. Pflanzenfresser werden als
Primärkonsumenten bezeichnet. Sekundärkonsu-
menten sind entsprechend carnivore Tiere, die
Primärkonsumenten fressen. Diese Nahrungskette
lässt sich fortführen bis zu einem so genannten
Endkonsumenten.
Destruenten. Saprophagen und Mineralisierer werden als Destruenten bezeichnet. Sie bau-
en tote organische Substanzen zu einfachen anorganischen Stoffen ab. Saprophagen leben
von den meist noch hochwertigen Stoffen toter Materie wie Aas, Kot und Abfall. Pilze und
Bakterien zählen zu den Mineralisierern. Sie überführen totes organisches Material in anor-
ganische Stoffe wie unter anderem in Mineralstoffe, was ihnen ihren Namen gibt.
Kreislauf.
Produzenten bauen organische Stoffe aus anorganischen auf
Konsumenten bauen fremde organische Stoffe in körpereigene um
Mineralisierer bauen organische Stoffe vollständig zu anorganischen ab
…
Nahrungskette und Nah-
rungsnetz. Pflanzen sind Pro-
duzenten. Von ihnen ernäh-
ren sich die Primärkonsumen-
ten, welche wiederum von
carnivoren Sekundärkonsu-
menten gefressen werden, Abb. 13: Nahrungskette

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
etc. Das letzte Glied ist der Endkonsument. Dieser Zusammenhang des Fressens und Gefres-
sen-Werdens nennt man Nahrungskette. Pflanzenfresser verzehren in der Regel nicht nur
eine Pflanzenart und Fleischfresser ernähren sich meist von unterschiedlichen Beutetieren.
Damit sind verschiedene Nahrungsketten miteinander zu einem komplexen Nahrungsnetz
verwoben.
Trophieebenen. Fasst man in einem Ökosystem alle Arten mit gleicher Stellung in der Nah-
rungskette zu einer Trophiestufe zusammen, also Produzenten, Primärkonsumenten, Sekun-
därkonsumenten etc. dann ergibt sich eine ökologische Pyramide. Von einer Trophiestufe
zur nächsten nehmen Produktivität, Biomasse und Individuenzahl ab, während die Körper-
größe der Konsumenten im Mittel zunimmt. Diese Gliederung gelingt nicht widerspruchsfrei,
da viele Tiere ihre Nahrung nicht nur aus einer Stufe beziehen.
Die Primärproduktion als Nahrungsbasis begrenzt die Zahl der Trophieebenen. In Land-
Ökosystemen finden sich meist drei bis fünf Stufen, in Gewässer-Ökosystemen bis zu sieben.
b. Definition Population, Populationswachstum: exponentielles und lo-
gistisches Wachstum
Definition Population. Unter „Population“ versteht man eine Gruppe artgleicher Individuen,
die zur gleichen Zeit in einem begrenzten Verbreitungsgebiet leben und sich ohne Einschrän-
kungen untereinander fortpflanzen, also Gene austauschen können.
Populationswachstum. Sieht man von Zu- und Abwanderungen ab, entscheiden Geburtenra-
te (Natalität b) und Sterberate (Mortalität d), ob eine Population abnimmt oder wächst. Ihre
Differenz ergibt die Wachstumsrate (r) der Population: r = b – d
Beispiel: Eine Population umfasst 10 000 Individuen. Sie hat 300 Nachkommen und es ster-
ben im gleichen Zeitraum 100 Individuen, dann ist b = 300 : 10 000 = 0,03, d = 100 : 10 000 =
0,01 und r = 0,03 – 0,01 = 0,02. Mit der Wachstumsrate r lässt sich das Wachstum einer Po-
pulation berechnen.
Exponentielles Wachstum ist unter günstigen Bedingungen, wie sie für Lebewesen in Kultur
geschaffen werden oder wie sie natürliche Populationen vorfinden, typisch. Es ist auch ty-

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
pisch, wenn eine Art verschleppt wird oder unter Schutz gestellt wird. Die Veränderung in
der Individuenzahl (dN) in einem Zeitabschnitt (dt) ist dann das Produkt aus der Wachstums-
rate r und der jeweils vorhandenen Individuenzahl (N):
Da alle Ressourcen begrenzt sind, ist dieses Wachstum auf die Dauer nicht möglich. In der
Regel schwächt sich daher das Wachstum einer Population mit zunehmender Dichte ab und
die Größe nähert sich einem konstanten Wert. Dieser Wert wird Kapazitätsgrenze genannt.
Und wird in der Formel für das logistische Wachstum mit K bezeichnet:
(
)
Der Ausdruck in der Klammer zeigt, dass das Wachstum der Population dichteabhängig ist,
also wie nahe die Individuenzahl N der Kapazitätsgrenze K gekommen ist. Bei kleinem N ist
das Wachstum exponentiell. Ist N=K, wird der Zuwachs 0, die Populationsgröße bleibt kon-
stant.
c. Regulation der Populationsdichte: dichteabhängige und dichteunab-
hängige Faktoren
Die Dichte einer Population, also die Anzahl der Individuen in einer Population bezogen auf
die Größe des zur Verfügung stehenden Lebensraumes, wird von vielen Faktoren beeinflusst.
Man unterscheidet zwischen dichteabhängigen Faktoren, die bei unterschiedlicher Dichte
auch unterschiedlich in Erscheinung treten, und dichteunabhängigen Faktoren, die immer
gleich in Erscheinung treten.
dichteabhängige Faktoren dichteunabhängige Faktoren
Intraspezifische Konkurrenz
Nahrung
Revier
…
Abiotische Umweltfaktoren
Licht
Temperatur
…
Artspezifische Feinde
Räuber
Nichtspezifische Feinde
Menschen

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Parasiten
…
…
Ansteckende Krankheiten
Pest
…
Nichtansteckende Krankheiten
Allergien
…
Naturkatastrophen
Unwetter
Vulkanausbrüche
…
d. Entwicklung von Populationen: innere Dynamik, Wechselwirkungen,
Räuber-Beute-Populationen, Volterra-Regeln
Innere Dynamik von Populationen. Bei zahlreichen Insekten, kleinen Nagetieren, einjährigen
Pflanzen oder Krankheitserregern schwankt die Populationsdichte ohne die Mitwirkung an-
derer Arten stark. Teilweise bilden sich regelmäßige Zyklen von Vermehrung und Zusam-
menbruch.
Wechselwirkungen zwischen Populationen. Alle Ökofaktoren wirken sich auf ganze Popula-
tionen aus. Wenn zum Beispiel Feinde, Parasiten und Konkurrenten die Existenz von Indivi-
duen beeinträchtigen, hat dies natürlich auch Einfluss auf die beteiligten Populationen. Dies
unterliegt dem Prinzip der negativen Rückkopplung (siehe 2. Wechselwirkungen / Beziehun-
gen zwischen Lebewesen).
Räuber-Beute-Populationen.
Die Beziehungen zwischen
Räuber- und Beutepopulatio-
nen haben G. F. GAUSE, A. J.
LOTKA und V. VOLTERRA durch
Laborversuche und Rechenmo-
delle erforscht. Diese führten
1920 und 1930 zu der Erkennt-Abb. 14: 1. Und 2. Volterra-Regel

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
nis, dass die Entwicklung von Beute- und Fressfeindpopulationen durch Regeln miteinander
verknüpft ist.
Volterra-Regeln.
1. Die Populationsdichten
von Beute und Fress-
feind schwanken perio-
disch und zeitlich ge-
geneinander verscho-
ben
2. Die Dichte jeder Popula-
tion schwankt um einen
konstanten Mittelwert
3. Erhöhung der Beute-
dichte bewirkt eine Zu-
nahme der Fressfeinde.
Gleich starke Verminde-
rung beider Arten führt
dazu, dass sich die Population der Beute schneller erholt als die des Fressfeindes.
e. Schädlinge und Schädlingsbekämpfung: Definition Schädlinge / Nütz-
linge; chemische / biologische / biotechnische Schädlingsbekämpfung
Definition. Als Schädlinge bezeichnen die Menschen diejenigen Lebewesen, die ihnen in ir-
gendeiner Weise schaden. Dabei sind mit Schädlingen in erster Linie die tierischen Konkur-
renten des Menschen gemeint, die seine Nahrungspflanzen oder die daraus hergestellten
Produkte fressen. Darunter fallen auch solche Pilze, Bakterien und Viren, die Krankheiten der
Nutzpflanzen und Nutztiere verursachen. Diejenigen Lebewesen, aus denen der Mensch
Nutzen zieht, nennt er Nützlinge. Somit stellen die beiden Begriffe keine Klassifikation im
eigentlichen Sinne dar, die Begriffe sind subjektiv besetzt.
Abb. 15: 3. Volterra-Regel Teil 1
Abb. 16: 3. Volterra-Regel Teil 2

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Schädlingsbekämpfung. Heute sind vor allem drei Methoden der Schädlingsbekämpfung von
Bedeutung.
chemisch: durch Pestizide oder Biozide
biologisch: durch gezielten Einsatz von deren natürlichen Feinden und Parasiten
biotechnisch: durch Verwendung von biologischen Wirkstoffen, vor allem Pheromo-
nen, zum Anlocken und Fang der Schädlinge
Zu beachten ist, dass bei der chemischen Schädlingsbekämpfung die 3. Volterra-Regel ihre
Anwendung findet. Das bedeutet, dass sich bei der Anwendung von Pestiziden (also eines
unspezifisch wirkenden Bekämpfungsmittels) die Schädlingspopulation schneller erholt, so-
dass sie bald erneut bekämpft werden muss.
f. Fortpflanzungsstrategien: K- und r-Strategie
Je nach den Umweltbedingungen werden von der Selektion gegensätzliche Typen der Popu-
lationsentwicklung gefördert:
Arten mit stark schwankender Populationsdichte sind meist klein, kurzlebig und er-
zeugen schnell viele Nachkommen. Dadurch nutzen sie günstige Bedingungen ihrer
sich häufig ändernden Umwelt opportunistisch aus. Ihre Fortpflanzungsweise wird als
r-Strategie bezeichnet. Beispiele: Blattläuse, Wasserflöhe, einjährige Pflanzen.
Arten mit langfristig kontanter Populationsdichte sind oft groß, langlebig, haben we-
nige Nachkommen und sind darauf angelegt, sich trotz starker Konkurrenz in einer
beständigen Umwelt dauerhaft zu behaupten. Da die Selektion die optimale Ausnut-
zung der Umweltkapazität bewirkt, spricht man von der K-Strategie. Beispiele: Bäu-
me, große Säugetiere, Mensch.
Zwischen reiner r- und K-Strategie existieren alle Übergänge. Oft kann man nur im Vergleich
zweier Arten die Fortpflanzungsstrategie bestimmen, sie ist also nicht streng festgelegt.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
g. Wachstum der Weltbevölkerung, ökologischer Fußabdruck
Wachstum der Weltbevölkerung. Das exponentielle Wachstum bewirkt, dass sich die Ein-
wohnerzahl in immer kürzer werdenden Abständen verdoppelt. Das Bevölkerungswachstum
ist in verschiedenen Teilen der Erde sehr unterschiedlich. In den Industrieländern ist eine
deutliche Verlangsamung des Wachstums bis hin zur Stagnation festzustellen. Eine Ausnah-
me bilden die USA mit 2,1 Geburten je Frau und einer starken Zuwanderungsrate.
Ursachen für eine rasante Bevölkerungsexplosion seit dem Dreißigjährigen Krieg sind vor
allem Innovationen im Agrarbereich (bessere Ernährungssituation) und bessere Hygiene
(geminderte Seuchengefahr).
Ökologischer Fußbadruck. Der ökologische Fußabdruck misst den Ressourcenverbrauch ei-
nes Einzelnen, einer Gruppe oder der gesamten Menschheit. Er gibt die Größe an produkti-
ven Land- und Wasserflächen an, die – beim heutigen technischen Stand – notwendig sind,
Ressourcen für den Konsum dieser Menschheit bereitzustellen und deren Abfall aufzuneh-
men.
Der ökologische Fußbadruck eines Deutschen beträgt im Schnitt 6,2 ha. In Deutschland ste-
hen dem aber nur 2,4 ha an biologisch produktiver Fläche gegenüber. Das Defizit wird über
Importe gedeckt. Das bedeutet aber, dass wir durch unseren Lebensstil die Ressourcen an-
derer belasten, vor allem in den Entwicklungsländern.
4. Ökosysteme Schwerpunktsetzung Terrestrisches System
a. Struktur des Ökosystems Wald, Stockwerkaufbau (Schichten)
Wald allgemein. Wälder sind Ökosysteme, deren Charakter durch Bäume geprägt wird. Von
einem Wald sprechen wir, wenn Bäume auf einer Fläche von mindestens einem Hektar ei-
nen geschlossenen Bestand mit Kronendach bilden. Da unsere Wälder seit Langem vom
Menschen vielfältig genutzt werden, gibt es heute in Mitteleuropa keine intakten Naturwäl-
der mehr. Der größte Teil sind Wirtschaftswälder.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Stockwerkaufbau. Der Stockwerkauf-
bau mit seinen verschiedenen Vegetati-
onsschichten ist ein Kennzeichen eines
naturnahen Waldes. Naturwälder sind
durch ungleichen Kronenschluss der
Baumschicht und ein Mosaik aus Di-
ckungen, Lichtungen und Kleinstlebens-
räumen wie Baumstümpfen noch stär-
ker strukturiert.
W u r z e l s c h i c h t – Im Waldboden
sind die Wurzeln der Pflanzen veran-
kert, die aus dem Boden Wasser und
darin gelöste Mineralstoffe aufnehmen. Destruenten zerkleinern hier abgestorbene Pflan-
zenteile wie Blätter und Äste, aber auch Tierkot und tote Tiere und bauen sie ab. Durch die
Abbauprozesse wird mineralstoffreicher Humus gebildet, der den Pflanzenwurzeln die wich-
tigen Mineralstoffe zur Verfügung stellt.
M o o s s c h i c h t – Diese Schicht befindet sich unmittelbar auf dem Erdboden und wird
meist nicht höher als 10-20 cm. Je nach Waldtyp kann sie sehr unterschiedlich ausgeprägt
sein. Moose gehören zu den Pflanzen, die auch an Stellen wachsen können, die nur wenig
Sonnenlicht erhalten. Die Moosschicht dient dem Wald als Wasserspeicher. Außerdem
wachsen dort niedrige Gräser. Man findet in der Moosschicht die Fruchtkörper vieler Pilze
und viele wirbellose Tiere.
K r a u t s c h i c h t – In der Krautschicht wachsen Gräser und andere Blütenpflanzen sowie
Farne. Im Frühjahr kann man dort viele Frühblüher entdecken, im Sommer wachsen hier vor
allem Pflanzen, die mit wenig Licht auskommen. Die Krautschicht reicht bis eine Höhe von
etwa einem Meter. Sie hat eine große Bedeutung für Blüten besuchende Insekten und auch
für Vögel und kleine Säugetiere.
S t r a u c h s c h i c h t – Oberhalb der Krautschicht schließt sich die Strauchschicht an. Die
vorkommenden Sträucher werden meist 2-6 m hoch. Zu diesem Stockwerk gehören außer-
dem Kletterpflanzen aber auch junge Bäume. Ebenfalls befinden sich die Stämme der größe-
Abb. 17: Stockwerkaufbau eines Mischwaldes

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
ren Bäume auch in dieser Schicht, was geeignete Lebensbedingungen für z.B. Spechte und
Fledermäuse bzw. Holz bewohnende Insekten bereitstellt.
B a u m s c h i c h t – Sie nimmt den größten Raum ein. Im unteren Bereich der Baumschicht
befinden sich die jüngeren Bäume, die ihre Kronen in Höhen von 10-15 m ausbreiten. Im
oberen Bereich findet man die Kronen der Laubbäume oder die der Nadelbäume. Die Kro-
nenbereiche der Bäume bieten zahlreichen Insektenarten, Säugetieren und Vögeln einen
Lebensraum.
b. Nahrungsnetze im Ökosystem Wald
Zersetzung im Ökosystem Wald. In Land-Ökosystemen beeinflussen neben Sauerstoff vor
allem Feuchtigkeit und Temperatur die Abbaugeschwindigkeit. Während sich organische
Reste im tropischen Regenwald in wenigen Monaten zersetzen, benötigt Falllaub in unseren
Wäldern drei bis sechs Jahre, in nordischen Wäldern sogar 50 Jahre zur völligen Mineralisie-
rung. Experimente zeigen, dass dazu Fraß- und Ausscheidungsvorgänge von wirbellosen Tie-
ren und Zersetzungsprozesse durch Mikroorganismen ineinandergreifen müssen. Sie vollzie-
hen sich alle am Boden.
Boden und Bodenlebewesen. Der Boden kann als unterste belebte Schicht aufgefasst wer-
den, aber auch als eigenes Ökosystem. In ihm findet eine Masse von Abbauprozessen statt.
Daran sind zahlreiche Bodenlebewesen beteiligt: Mikroorganismen, Kleinst- und Kleintiere.
80 % der Bodenbiomasse stellen die Mineralisierer. Neben Pilzen und Bakterien gehören
dazu auch Actinomyceten. Das sind mycelartig wachsende besondere Bakterien.
c. Ökologische Pyramiden: Energiepyramide, Energiefluss zwischen den
Trophieebenen
Energiepyramide. Summiert man die Energie der Produktion jeder Trophiestufe des gesam-
ten Ökosystems, ergibt sich eine Energiepyramide. In dieser Pyramide verringert sich der
Energiegehalt von Stufe zu Stufe durchschnittlich um den Faktor 10.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Energiefluss zwischen den Trophieebenen. Wie oben schon erklärt, verringert sich der
Energiegehalt von Stufe zu Stufe durchschnittlich um den Faktor 10. Ein großer Teil der
Energie jeder Trophiestufe wird in Wärmeenergie umgewandelt. Außerdem fließt auf jeder
Trophiestufe der Löwenanteil der Produktion – oft mehr als zwei Drittel – in die Detritus-
Nahrungsketten, letztlich also den Destruenten zu.
d. Biomassepyramide, Brutto- und Nettoprimärproduktion
Jedes Jahr entziehen die Pflanzen des Festlands und der Meere der Atmosphäre rund 250
Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid und bilden daraus durch Fotosynthese mehr als eine
halbe Billion Tonnen neue Biomasse. Von dieser Bioproduktion leben praktisch alle Organis-
men der Erde. Sie wird daher auch als Primärproduktion bezeichnet.
Brutto- und Nettoprimärproduktion. Pflanzen verbrauchen 20 bis 75 % ihrer durch Fotosyn-
these erzeugten organischen Stoffe durch Atmung (Respiration R). Man unterscheidet daher
zwischen Brutto- (Pb) und Nettoprimärproduktion (Pn):
Abb. 18: Energiefluss zwischen den Trophieebenen

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Pn = Pb – R
Die Nettoprimärproduktion gibt – meist in kg Trockensubstanz je m² oder Tonnen Kohlen-
stoff je ha Grundfläche – den Produktionsertrag der Pflanzendecke während eines Jahres an.
Unter Biomasse versteht man dagegen das Gewicht der lebenden Organismen einer Flächen-
oder Volumeneinheit.
e. Stoffkreisläufe im Ökosystem Wald: Kohlenstoffkreislauf
Im Zentrum stehen Dissimilati-
on und Assimilation als gegen-
läufige Prozesse. Durch Photo-
synthese wird in der Biosphäre
jährlich rund ein Siebtel des
atmosphärischen CO2 (entspre-
chend etwa 100 Gigatonnen
Kohlenstoff) gebunden und
dieselbe Menge durch Atmung
wieder freigesetzt. Nur wenn
Biomasse unter Luftabschluss
unvollständig mineralisiert
wird, wird Kohlenstoff dem
Kreislauf entzogen.
f. Stoffkreisläufe im Ökosystem Wald: Stickstoffkreislauf
Obwohl die Atmosphäre zu 78 % aus Stickstoff (N2) besteht, begrenzt dieses vor allem zum
Aufbau der Proteine und Nukleinsäuren notwendige Bioelement in vielen Ökosystemen die
biologische Produktion. Stickstoff kann von Pflanzen nur in Form von Ammonium NH4+ oder
Nitrat (NO3-) und von Tieren nur organisch gebunden aufgenommen werden. Anorganische
Stickstoffverbindungen entstehen in der Natur vorwiegend durch die Tätigkeit der Destruen-
Abb. 19: Kohlenstoffkreislauf im Ökosystem Wald

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
ten in Verbindung mit speziali-
sierten Bakterien. Von den Des-
truenten werden stickstoffhalti-
ge organische Verbindungen zu
Ammonium aufgeschlossen. Die-
ses wird anschließend unter
Verbrauch von Sauerstoff durch
nitrifizierende Bakterien über
Nitrit (NO2+) zu Nitrat oxidiert.
Manche im Boden freilebenden
oder symbiontischen Blaualgen
und Bakterien können Luftstick-
stoff binden und in den Stick-
stoffkreislauf einschleusen.
Knöllchenbakterien fixieren etwa
200 kg Stickstoff pro ha – im Vergleich dazu beträgt der jährliche Verbrauch von Stickstoff-
dünger in Deutschland etwa 100 kg pro ha.
g. Untersuchung von Ökosystemen / nachhaltiger Waldbau
Untersuchung von Ökosystemen. In der Regel ist es aufgrund der Komplexität, der Vielzahl
der veränderlichen Faktoren und der langen Zeiträume, in denen sich manche Vorgänge ab-
spielen, nicht möglich, das gesamte Ökosystem zu untersuchen. Auch externe Faktoren wie
die Sonneneinstrahlung beeinflussen das System maßgeblich. Man versucht daher mithilfe
von Stichproben repräsentative Daten zu ermitteln, aus denen man auf das System hoch-
rechnet.
Faktorengewichtung. Nicht jedem Ökofaktor kommt dasselbe Gewicht zu. Je weiter ein Fak-
tor vom Optimum entfernt ist, desto größer ist sein relatives Gewicht. Gerät ein Faktor in
den Bereich von Minimum oder Maximum der ökologischen Potenz und begrenzt damit die
Existenz einer Art im Lebensraum, spricht man vom Minimumfaktor oder besser vom limitie-
Abb. 20: Stickstoffkreislauf im Ökosystem Wald

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
renden Faktor. Obwohl das Vorkommen einer Art im Lebensraum durch ein Faktorengefüge
bedingt wird, lässt sich auf einzelne Faktoren rückschließen, wenn die ökologische Potenz
der Art für diesen Faktor eng begrenz ist. Stenopotente Arten eignen sich daher als Zeigerar-
ten (Bioindikatoren).
Standortfaktoren und Waldgesellschaften. Vergleicht man Buchenwälder an verschiedenen
Standorten, stellt man fest, dass in der Strauch- und Krautschicht bestimmte Pflanzenarten
mit großer Regelmäßigkeit gemeinsam auftreten. Man spricht von Pflanzengesellschaften.
Sie bevorzugen jeweils gleiche Konzentrationen eines bestimmten Umweltfaktors. Einige
Pflanzen sind in ihrer optimalen Verbreitung fast ausschließlich für bestimmte Gesellschaf-
ten charakteristisch, sie werden als Kennarten oder Zeigerarten bezeichnet.
Vieljährige Beobachtungen haben dazu geführt, jeder Pflanzenart eine Kombination ökologi-
scher Kennzahlen zuzuordnen. Dabei sind bestimmte abiotische Faktoren wie Licht, Feuch-
tigkeit, Bodenreaktion, Stickstoffanspruch in einer Skala von 1-9 eingeteilt. Geringe Ansprü-
che werden mit niedrigen Zahlen, große mit hohen Zahlen bewertet. Die Größe „x“ bedeu-
tet, dass sich die Pflanzenart einem Faktor gegenüber indifferent verhält. Hat man aufgrund
einer Vegetationsaufnahme eine Artenliste erstellt und fügt die Mengenangaben und Zei-
gerwerte hinzu, lassen sich Aussagen über die Standortbedingungen ableiten.
Vegetationsaufnahmen sind auch unentbehrlich für die Beschreibung von Waldgesellschaf-
ten. Diese gehen in Waldbiotopkartierungen ein, die von Forstplanungsämtern durchgeführt
werden. Dabei werden die Bestände hinsichtlich ihrer Naturnähe, Vielfalt und Seltenheit
eingestuft.
Untersuchung eines Waldstandortes. Zur Vegetationsaufnahme wählt man im Wald eine
repräsentative Fläche von 10 m x 10 m aus und markiert sie. Man macht dann Angaben zur
Lage und bestimmt mithilfe der Literatur die Pflanzenarten in den jeweiligen Schichten und
schätzt ihren Deckungsgrad ab. Außerdem bestimmt man an festgelegten Stellen den Licht-
wert, die Lufttemperatur in 1 m Höhe sowie die Bodenoberflächentemperatur.
Nachhaltige Bewirtschaftung. Heute wird neben der Holznutzung auch die sonstige wirt-
schaftliche, ökologische und gesellschaftliche Bedeutung des Walds berücksichtigt. Der Be-
griff der Nachhaltigkeit wurde somit erweitert. Die moderne Forstwirtschaft muss daher die

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Notwendigkeit der Ressourcennutzung, die Ziele des Naturschutzes, sowie die Anforderun-
gen durch Erholungsbedarf und Freizeitgestaltung abwägen und gewichten. Voraussetzung
für die Integration aller Ziele ist eine naturnahe Waldbewirtschaftung. Wichtige Aufgaben
der Waldbewirtschaftung sind die Waldverjüngung und die Waldpflege.
Bei der Waldverjüngung geht es darum, standortgerechte Wälder aufzubauen. Ist das nicht
durch eigene Aussaat möglich, bieten Forstgenbanken Hilfe bei der Versorgung mit Hoch-
wertigem Saatgut geeigneter Herkunft. Waldpflege muss dafür sorgen, dass in den Wäldern
viele Baumarten in verschiedenen Altersstufen vertreten sind. Durchforstung fördert die
gesündesten und wuchskräftigsten Bäume durch Entfernen konkurrierender Nachbarbäume.
Bei der Holzernte wird auf Schonung der Umgebung geachtet, etwa durch Einsatz sogenann-
ter Harvester, die Bäume schon während des Fallens bearbeiten. Diese Einzelbaumnutzung,
also der Verzicht auf Kahlschlag, vermehrt auch das Alt- und Totholz, was wiederum zur För-
derung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten beiträgt. Der so erzielte Arten- und Struktur-
reichtum verspricht eine höhere Stabilität gegenüber biotischen und abiotischen Gefahren.
h. Entwicklung von Ökosystemen: Sukzession
Wir können mit bloßem Auge erkennen, dass sich Ökosysteme mit der Zeit von Natur aus
verändern können, wenn beispielsweise ein Teich zusehends verlandet. Dagegen ist uns
kaum bewusst, dass Ökosysteme grundsätzlich eine als Sukzession bezeichnete allmähliche
Entwicklung durchlaufen.
Formen und Ursachen von Sukzession. Von Primärsukzession spricht man, wenn sie ihren
Ausgang von der Erstbesiedlung unbelebter Lebensräume wie Dünen, Lavafeldern oder Glet-
schermoränen nimmt. Sekundärsukzession geht hingegen auf Störungen bestehender Öko-
systeme zurück: Brand, Windwurf, Überschwemmung, Lawinen, Kahlschlag. In beiden For-
men sind die Änderungen der abiotischen Umwelt ausschlaggebend, trotzdem bestimmen
immer auch biotische Einflüsse den Ablauf der Sukzession mit.
Entwicklungstendenzen. Auch wenn jede Sukzession durch ihre Vorgeschichte, die Einflüsse
der angrenzenden Ökosysteme und durch Zufälle ihre eigene Dynamik entwickelt, lassen sich
eine Reihe von Tendenzen verallgemeinern:

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Die Biomasse nimmt zu und erreicht später einen konstanten Wert
Die Bruttoproduktion ist anfangs hoch, erreicht ein Maximum und geht dann auf ei-
nen konstanten Wert zurück
Die Artenvielfalt nimmt zu, durchläuft ein Maximum und geht dann auf einen kon-
stanten Wert zurück
Die Nahrungsketten verzweigen sich zunehmend
Anfangs dominieren sogenannte Pionierarten mir r-Strategie der Fortpflanzung, spä-
ter Arten mit K-Strategie
Experiment Sukzession. Die einfachste Methode, Sukzession zu verfolgen ist genau Be-
obachtung über Jahrzehnte hinweg. Im kleineren Umfang lassen sich Sukzessionen auch ex-
perimentell auslösen. In Form von Mikrokosmosmodellen führen sie relativ schnell zu Ergeb-
nissen. Eine bewährte Methode zur Untersuchung von Sukzessionen sind Probeflächen aus
künstlichen Substraten, deren Besiedlung sich über längere Zeit hinweg qualitativ und quan-
titativ verfolgen lässt.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Literatur- und Quellenverzeichnis
Born, A., Brott, A., Dr. Engelhardt, B., Dr. Esders, S., Dr. Gnoyke, A., Gräbe, G., et al. (2009).
Biologie Oberstufe. Berlin: Cornelsen Verlag.
Brosske, D. (2005). Abgerufen am 29. Februar 2012 von Abiwissen.info:
http://www.abiwissen.info/biologie_populationsoekologie.html
Brüggemeier, M. (2009). Top im Abi - Abiwissen kompakt: Biologie. Braunschweig: Schroedel
Verlag.
Buschmann, A. (2011). Abgerufen am 31. Januar 2012 von Ulrich Helmichs Homepage:
http://www.u-helmich.de/bio/oek/oek01/bilder/bild06.jpg
Dr. rer. nat. Bacchus, C., Bauer, T.-W., Prof. Dr. rer. nat. habil. Buselmaier, W., Prof. Dr. rer.
nat. Keil, M., & Priv.-Doz. Dr. med. Tariverdian, G. (2004). Fischer Abiturwissen
Biologie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
Hauer, P. (2008). Abgerufen am 1. Februar 2012 von Philipp Hauers Homepage:
http://www.philipphauer.de/info/bio/toleranzbereich/
McKenna, H. (2006). Abgerufen am 5. Februar 2012 von Wikipedia:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Laubblatt-
Aufbau.svg/1000px-Laubblatt-Aufbau.svg.png
Miram, W., & Scharf, K.-H. (. (1997). Biologie heute SII. Hannover: Schroedel Verlag.
Theobaldt, C. (2011). Abgerufen am 7. Februar 2012 von Bio Kompakt: http://www.bio-
kompakt.de/images/stories/oekologie/parasiten_koerperregionen.jpg
Theobaldt, C. (2011). Abgerufen am 25. Februar 2012 von Bio Kompakt: http://www.bio-
kompakt.de/images/stories/oekologie/fuchsbandwurm.jpg
Uhlenbrock, K., & Walory, M. (kein Datum). Schülerhilfe Abitur-Box: Biologie. Königswinter:
Tandem Verlag GmbH.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Ökologie, Autor: Christoph Hocks
Walter, H. (1960). Einführung in die Phytologie Bd. 3, 1. Teil: Grundlagen der
Pflanzenverbreitung. Stuttgart: Ulmer Verlag.

NORDRHEIN-WESTFALEN ZENTRALABITUR 2012
Biologie Grundkurs Abitur Zusammenfassung der relevanten Themen
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Inhaltsverzeichnis
1. Evolutionstheorien .......................................................................................................... 4
a. Grundlagen .................................................................................................................. 4
b. Historische Entwicklung des Evolutionsgedankens ................................................... 5
c. Grundgedanken der Evolutionstheorie von Darwin: Schlussfolgerungen /
Aussagen ............................................................................................................................ 6
d. Vergleich Lamarck / Darwin ....................................................................................... 6
e. Synthetische Evolutionstheorie, Evolutionsfaktoren ................................................ 7
2. Evolutionsfaktoren .......................................................................................................... 8
a. Evolutionsfaktoren ...................................................................................................... 8
b. Definition Population .................................................................................................. 8
c. Genetische Grundlagen: Allelfrequenz, Polymorphismus, Variation, Mutation,
Rekombination .................................................................................................................. 9
d. Selektion: stabilisierend, gerichtet, aufspaltend; Beispiele. ................................... 10
e. Balancierter Polymorphismus .................................................................................. 13
f. Artbegriff, Klassifikationsebenen ............................................................................. 14
g. Allopatrische Artbildung: Separation, Isolation / Isolationsmechanismen............ 15
h. Gendrift, Gründerprinzip, Flaschenhalseffekt ......................................................... 18
3. Großereignisse – Triebfedern für die Evolution ............................................................ 19
a. Überblick über die Entwicklung des Lebens / Erdzeitalter, Massensterben .......... 19
b. Biogeographie: Kontinentaldrift (z.B. als Ursache für Separation, Isolation, etc.) 22
c. Adaptive Radiation: ablaufende Teilschritte ........................................................... 23
d. Beispiele: Stammesgeschichtliche Entwicklung der Säugetiere und der Beuteltiere
24
4. Evolutionsbelege und –hinweise ................................................................................... 25

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
a. Belege aus der Paläontologie: Fossilisation, Bedeutung von Fossilien für die
Evolutionsbiologie ........................................................................................................... 25
b. Relative Altersbestimmung von Fossilien: mithilfe von Leitfossilien, Biostratigrafie
27
c. Absolute Altersbestimmung von Fossilien: Radiocarbonmethode (Grundlagen,
Durchführung, Grenzen) .................................................................................................. 28
d. Ergebnisse der Paläontologie; Rekonstruktion von Lebewesen ............................. 28
e. Lebende Fossilien: Bedeutung für die Evolutionstheorie, Beispiel: Quastenflosser
29
f. Mosaikformen: Bedeutung für die Evolutionstheorie und als Zwischenformen bei
der Anwendung der Homologiekriterien; Beispiele ....................................................... 30
g. Stammbaumdarstellung: Unterschied Phylogramm / Kladogramm ...................... 31
h. Stammbaum und Evolution der Wirbeltiere............................................................ 32
i. Belege aus Anatomie / Morphologie: Homologie und Analogie ............................ 35
j. Homologiekriterien: Anwendung auf Beispiele ....................................................... 37
k. Belege aus der Embryonalentwicklung: Biogenetische Regel von Ernst Haeckel .. 37
l. Atavismen und Rudimente: Definition, Unterscheidung, Ursachen ....................... 37
m. Belege aus der Molekularbiologie: Homöobox-Gene – Definition, Bedeutung für
die Stammbaumerstellung und die Evolutionsbiologie ................................................. 39
n. Übereinstimmung in der DNA-Sequenz, DNA-Sequenzierung, DNA-Hybridisierung,
DNA-Homologie ............................................................................................................... 39
o. Analyse mitochondrialer DNA, molekulare Uhr ...................................................... 40
p. Übereinstimmung in der Aminosäuresequenz: Beispiel Cytochrom c ................... 41
q. Belege aus der Parasitologie: Beispiel Malariaerreger, Kamele und ihre Parasiten
42
5. Evolution des Menschen ............................................................................................... 43

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
a. Stammbaum der Primaten: Systematische Stellung des Menschen, Merkmale der
Primaten, Prädispositionen für die Evolution des Menschen ....................................... 43
b. Skelett- und Schädelvergleich: Mensch und Schimpanse ....................................... 45
c. Evolution des aufrechten Gangs: Hypothesen zur Evolution, Voraussetzungen im
Skelettbau ........................................................................................................................ 48
d. Kulturelle Evolution: Sprache, Werkzeuge .............................................................. 50
e. Paläoanthropologie als Wissenschaft ...................................................................... 51
f. Frühe Fossilgeschichte des Menschen: Ursprung der Hominiden, „Lucy“,
Altersbestimmung mithilfe der Kalium-Argon-Methode ............................................... 51
g. Jüngere Fossilgeschichte des Menschen: Neandertaler, Homo sapiens, Homo
florensis ............................................................................................................................ 52
h. Stammbaum der Hominiden .................................................................................... 53
a. Ursprung des Menschen: Out-Of-Africa-Modell, multiregionales Modell ............. 54
Literatur- und Quellenverzeichnis ............................................................................................ 55

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
1. Evolutionstheorien
a. Grundlagen
Grundlagen. Die Artenvielfalt ist durch Evolution zu erklären. Alle Veränderungen, durch die
das Leben auf der Erde zu seiner heutigen Form und Vielfalt gelangt ist, nennt man Evoluti-
on. Moderner: Die Änderung der genetischen Zusammensetzung einer Population im Laufe
der Zeit.
Die Evolutionsforschung versucht die Gesetzmäßigkeiten zu erfassen, die der Evolution zu-
grunde liegen. Sie gibt Antworten darauf, warum die belebte Welt heute so ist, wie sie sich
uns darstellt.
Phänomen Vielfalt. Es gibt unzählige Arten, die zu einem großen Teil kaum oder gar nicht
erforscht worden sind. Biologische Vielfalt umfasst die genetische Verschiedenheit der Or-
ganismen, die Vielfalt der Arten und der Ökosysteme sowie die Wechselwirkungen zwischen
ihnen.
Ökologie ↔ Evolutionsforschung
Entstehung der Vielfalt. Alle Arten sind aus einer einzigen Wurzel in einem mehr als dreiein-
halb Milliarden Jahre andauernden Evolutionsprozess entstanden. Zu den treibenden Kräf-
ten der Artenvielfalt zählen Prozesse wie Mutation und Rekombination sowie die richtende
Selektion der Umwelt.
Bedrohung der Vielfalt. Zahllose Arten sind ausgestorben durch Klimaänderungen und kos-
mische Katastrophen sowie die Zerstörung von Lebensräumen durch die Menschen.
Vielfalt, Verwandtschaft und System. Systematik
Beschreiben, benennen und ordnen der Lebewesen
Begründer: schwedischer Naturforscher CARL VON LINNÉ (1707 – 1778)
Er führte binäre Nomenklatur ein erster Name Gattung, zweiter Name Art
Beispiel: „Culex pipiens“ (gemeine Stechmücke)
Zufriedenstellende Ordnung der Lebewesen erst durch „natürliches System“ gelungen:

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Interpretation der abgestuften Ähnlichkeit zwischen den Arten als Folge abgestufter
Verwandtschaft.
b. Historische Entwicklung des Evolutionsgedankens
Geschichte der klassischen Evolutionstheorie.
CARL VON LINNÉ (1707 – 1778) – Konstanz der Arten, künstliches System der Einordnung
von Lebewesen nach morphologischen Gesichtspunkten und Einführung der binären No-
menklatur (s.o.).
GEORGES DE CUVIER (1769 – 1832) – Konstanz der Arten. Katastrophentheorie: Fossilien
repräsentieren Arten, die durch Naturkatastrophen ausgestorben sind und danach wieder
neu erschaffen wurden. Begründer der zoologischen Paläontologie. Glaubt an Schöpfungs-
akt.
JEAN BAPTISTE LAMARCK (1744 – 1829) – Gebrauch und Nichtgebrauch von Organen ent-
scheiden über Weiterentwicklung oder Verkümmerung von Anlagen. Erworbene Eigenschaf-
ten werden weitervererbt Arten sind veränderlich!
CHARLES DARWIN (1809 – 1882) – Alle Arten sind aus einer Stammart hervorgegangen (Des-
zendenztheorie). Der Tauglichste setzt sich unter den Nachkommen durch und kommt häufi-
ger zur Reproduktion (Selektionstheorie).
Die Evolutionstheorie von Jean Baptiste Lamarck.
1. Naturgesetz: Gebrauch
oder Nichtgebrauch von
Organen fördert Weiter-
oder Rückbildung
2. Naturgesetz: Vererbung
erworbener Eigenschaf-
ten an die Nachkommen
Abb. 1: Evolutionstheorie nach Jean Baptiste Lamarck

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Treibende Kraft der Evolution nach Lamarck ist der starke Drang eines Lebewesens, sich an
veränderte Umweltverhältnisse anzupassen. Dadurch sind das erste und das zweite Naturge-
setz bedingt.
Belege zur Vererbung erworbener Eigenschaften konnte man bis heute nicht finden,
wodurch die Theorie ausschied.
c. Grundgedanken der Evolutionstheorie von Darwin: Schlussfolgerun-
gen / Aussagen
Die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Nach Darwin sind alle Arten aus einer Stammart
hervorgegangen. So entwickelte er aufgrund der Beobachtungen auf den Galapagosinseln
( Darwinfinken) seine Deszendenztheorie. Der Artenreichtum ist durch natürliche Zucht-
wahl entstanden.
Treibende Kraft für die Entstehung der verschiedenen Arten ist nach Darwin die natürliche
Selektion, die auf drei Grundprinzipien beruht (Überproduktion, Mutation, Selektion).
1. Die Organismen haben weit mehr Nachkommen, als für die Arterhaltung erforderlich
wäre (Überproduktion).
2. Die Nachkommen eines Elternpaares gleichen sich nicht in allen Merkmalen, sondern
zeigen individuelle Unterschiede (Mutation).
3. Alle Lebewesen einer Art stehen im ständigen Konkurrenzkampf um Lebensraum,
Nahrung und Fortpflanzung („struggle for life“). Nur derjenige, der an die Umweltbe-
dingungen am besten angepasst ist, überlebt im Daseinskampf („survival of the fit-
test“) und kommt am häufigsten zur Fortpflanzung (Selektion).
d. Vergleich Lamarck / Darwin
Darwinismus
Lamarckismus
Begründer Charles Robert Darwin ( 1809-1882), britischer Bio-loge und Naturforscher
Jean-Baptiste de Lamarck (1744 - 1829), französischer

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Botaniker und Zoologe
Erstveröffentlichung der Theorie
The Origin of Species (1859) Philosophie Zoologique (1809)
Grundannahme Organismen werden passiv durch die Selektion angepasst
Organismen passen sich aktiv den äußeren Umweltbedin-gungen an
Giraffen Beispiel
Unter der Giraffenpopulation gibt es einige Giraffen, die zufallsbedingt längere Hälse haben als ihre Art-genossen. Diese Giraffen haben einen Selektions-vorteil, weil sie an Nahrung gelangen, an die andere Giraffen mit kürzeren Hälsen nicht gelangen würden. Giraffen mit diesem Selektionsvorteil bringen ihre Gene häufiger in den Genpool der nächsten Genera-tion ein, weil sie besser ernährt sind. Auf diese Wei-se werden die Hälse der Giraffen langfristig immer länger.
Giraffen strecken ihren Hals um an Nahrung in den Bäu-men zu gelangen. Durch den häufigen Gebrauch verlängert sich der Hals und die Giraffe vererbt ihren verlängerten Hals an die nächste Generati-on weiter.
Heutige Sicht Theorie dient als Grundlage für die synthetische Theorie der Evolution.
Theorie ist widerlegt, weil sie eine Veränderung des Erb-guts voraussetzt, die nach heutigem Erkenntnisstand aber nicht möglich ist.
Abb. 2: Vergleich Darwinismus mit Lamarckismus
e. Synthetische Evolutionstheorie, Evolutionsfaktoren
Synthetische Evolutionstheorie. Ein System von Aussagen, das Evolution als realhistorischen
Prozess beschreibt und erklärt. Sie ergänzt Darwins Theorie durch weitere wichtige Evoluti-
onsfaktoren. Diese Faktoren wirken immer auf die Gesamtheit aller Gene einer Population
(Fortpflanzungsgemeinschaft), die man als ihren Genpool bezeichnet.
Genommutatio-nen, Genmutati-onen, Chromo-somenmutation
Migration = Gen-fluss
Gendrift = Zufall
Selektion
Isolation
Genpool der Population
Allelfrequenz
Rekombinat.
Genotypen-frequenz
Erblichkeit
Phänotyp-Variabilität
Artentstehung
Abb. 3: Die entscheidenden Faktoren der Evolution

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Die synthetische Theorie sieht vor allem die Population (nicht wie Darwin die Art) und deren
genetische Struktur im Zentrum des Evolutionsgeschehens und erklärt Evolution als Wandel
von Genfrequenzen. Jeder Faktor, der die Genfrequenz im Genpool einer Population ändert,
wird dabei als Evolutionsfaktor verstanden.
2. Evolutionsfaktoren
a. Evolutionsfaktoren
b. Definition Population
Unter „Population“ versteht man eine Gruppe artgleicher Individuen, die zur gleichen Zeit in
einem begrenzten Verbreitungsgebiet leben und sich ohne Einschränkungen untereinander
fortpflanzen, also Gene austauschen können. Populationen sind die Träger für die Verbrei-
tung von Organismen. Sie entscheiden durch den Fluss und die Veränderungen aller in ihnen
enthaltenen Gene über das Schicksal jedes einzelnen Gens.
Die Gesamtheit aller Genotypen, die Genotypenfrequenz, wird auch als genetische Struktur
einer Population bezeichnet. Die Gesamtheit der Gene einer Population stellt ihren Genpool
dar.
Abb. 4: Evolutionsfaktoren der synthetischen Evolutionstheorie

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Abb. 6: Rekombination
Abb. 5: Crossing-Over
c. Genetische Grundlagen: Allelfrequenz, Polymorphismus, Variation,
Mutation, Rekombination
Allelfrequenz. Die Häufigkeit, mit der bestimmte Allele in der Population vertreten sind. Der
Begriff „Allel“ bezeichnet hierbei die Ausprägung eines Gens. Die Allelfrequenz beeinflusst,
wie oft bestimmte Genotypen und damit auch Phänotypen innerhalb der Population vor-
kommen.
Polymorphismus. Das Vorkommen genetisch verschiedener Individuen innerhalb einer Po-
pulation heißt Polymorphismus. Diese genotypische Variabilität innerhalb der Populationen
ist die Grundlage für die evolutive Anpassung einer Art an die besonderen und wechselnden
Bedingungen der Umwelt.
Variation. Bezeichnet die Unterschiedlichkeit von Genotypen innerhalb einer Population und
entsteht durch Mutationen. Variationen basieren einerseits auf den unterschiedlichen Erb-
anlagen der Individuen, andererseits aber auch u.a. auf Boden- und Klimaverhältnissen, dem
Nahrungsangebot und mechanischen Faktoren ( Phänotypische Variation).
Mutation. Neuschaffung genetischer Informatio-
nen und der treibende Mechanismus der Evolution
und somit der Faktor, der Neues entstehen lässt.
Mutationen können alle Merkmale der Form, Größe
oder Struktur eines Organismus ebenso verändern
wie Stoffwechseleigenschaften oder Verhaltenspa-
rameter. Sie verändern die Allelfrequenz eines Gen-
pools einer Population und sorgen so für eine er-
höhte Varianzbreite.
Rekombination. Bezeichnet die Neukombination
von Allelen durch geschlechtliche Fortpflanzung. Durch „Crossing-Over“ bei der Meiose wir
die Zahl der möglichen Kombinationen zusätzlich erhöht, wodurch auch die Zahl der ver-
schiedenen Phänotypen innerhalb der Population steigt. Rekombination trägt viel stärker zur
Variabilität der Individuen in einer Population bei, führt aber allein nicht zur Evolution. Sie

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
bringt immer neue Genotypen und Phänotypen hervor, die der Umwelt mehr oder weniger
gut angepasst sind.
d. Selektion: stabilisierend, gerichtet, aufspaltend; Beispiele.
Selektion allgemein. Entscheidet über das Überleben und die Verbreitung der Mutationen,
wobei sie stets am Phänotyp ansetzt. Sie gibt der Evolution eine Richtung. Zusammen mit
Rekombination und Mutationen verändert die Selektion die Allelhäufigkeit im Genpool.
Diejenigen Individuen, die besser mit den gegebenen Umweltbedingungen zurecht-
kommen, können mehr Nachkommen erzeugen.
Diese Individuen bringen mehr Allele in den Genpools ein, verändern die Allelfre-
quenz also zu ihren Gunsten.
Den Beitrag, den ein Individuum zum Genpool einer
Population leistet, ist seine Fitness oder Tauglichkeit.
Das Maß der Fitness ist der Fortpflanzungserfolg, so-
mit ist die Fitness an der Zahl der Nachkommen zu
messen.
Stabilisierende Selektion. Verhindert Wandel einer
Population. Ist eine Population gut an ihre Umwelt
angepasst, sind neu auftretende, abweichende Mu-
tanten in so gut wie allen Fällen schlechter angepasst.
Die stabilisierende Selektion ist für die relative Konstanz der Lebewesen verantwortlich.
Das Merkmal, das bisher bereits vorherrschend war, gewinnt weiter an Häufigkeit
Selektionsfaktoren
Äußere Selektionsfaktoren
Innere Selektionsfaktoren
biotisch
abiotisch
Stoffwechsel
Abb. 8: Stabilisierende Selektion
Abb. 7: Selektionsfaktoren

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Die Ausnahme wird noch seltener
Gerichtete Selektion. Verändert Populationen. Än-
dern sich die Umweltverhältnisse oder ist eine Po-
pulation noch nicht optimal an ihre jetzige Umwelt
angepasst, können neu auftretende Phänotypen
bevorzugt sein. Die gerichtete Selektion ist für die
allmähliche Artumwandlung verantwortlich.
Das Merkmal, das bisher vorherrschend
war, wird seltener
Die Ausnahme wird häufiger und ist schon
bald vorherrschend
Disruptive (= aufspaltende) Selektion. Trennt Popu-
lationen. In manchen Fällen sind Populationen ei-
nem Selektionsdruck ausgesetzt, durch den die häu-
figen Formen benachteiligt sind und die seltenen
Phänotypen mit extremer Merkmalsausprägung
Vorteile haben. Aufspaltende Selektion ist für die
Trennung von Populationen mitverantwortlich.
Merkmale, die bisher vorherrschend waren,
werden seltener
Die Ausnahmen werden häufiger und sind bald häufiger, als das zuvor vorherrschen-
de Merkmal
Abiotische Selektionsfaktoren. Sind, wie in der Ökologie, Einwirkungen der unbelebten
Umwelt, wie z.B. Kälte, Hitze, Trockenheit, Feuchtigkeit, Salzgehalt, Lichtmangel.
B e i s p i e l : Die Kerguelen sind eine vulkanische Inselgruppe im indischen Ozean, auf denen
starke Stürme herrschen. Dort leben die Kerguelen-Fliegen mit verkümmerten Flügeln. Dies
verhindert, dass sie fliegen und auf den Ozean in den sicheren Tod getrieben werden.
Abb. 9: gerichtete Selektion
Abb. 10: Aufspaltende Selektion

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Exkurs: Präadaptation
Wenn bei einem Individuum ein
Merkmal bereits in seinem Genbe-
stand vorhanden ist, aber erst
durch veränderte Bedingungen
einen Selektionsvorteil bietet,
spricht man von Präadaptation.
Exkurs: Koevolution
Den Prozess der wechselseitigen
Anpassung zweier Arten aneinan-
der bezeichnet man als Koevoluti-
on. Beide Arten üben jeweils einen
Selektionsdruck auf die andere Art
aus.
Biotische Selektionsfaktoren. Einflüsse, die von anderen Lebewesen ausgehen. Man unter-
scheidet zwischenartliche Selektion z.B. durch Fressfeinde oder Parasiten und innerartliche
Selektion durch Konkurrenz um Nahrung, Geschlechtspartner, Brutreviere.
B e i s p i e l e : Das Abendpfauenauge ist ein
Falter, der eine braune Färbung der Vorderflü-
gel aufweist und damit gut getarnt ist. Wird er
dennoch von Fressfeinden beunruhigt, so
klappt er seine Hinterflügel aus, erschreckt
Feinde mit seinen leuchtend blauen Augenfle-
cken und nutzt die Schrecksekunde zur Flucht.
Ein Schmetterling mit dem Namen Hornissen-
schwärmer ahmt die Färbung einer Hornisse
nach, um so durch den Effekt der Mimikry giftig und wehrhaft zu erscheinen, und Fressfein-
de abzuschrecken.
Die Blütenröhren des Fingerhuts sind auffällig gefärbt und der Eingang zur Blütenröhre ist als
Landestelle für Insekten ausgebildet. Hummeln kriechen hinein, lösen die Bestäubung aus
und werden mit Nektar belohnt. Hier liegt eine Symbiose vor, die das Ergebnis wechselseiti-
ger Anpassung ist. Man spricht von Koevoluti-
on.
Sexuelle Selektion. Basiert auf der Variabilität
der sekundären Geschlechtsmerkmale und
führt zu einem abweichenden Erscheinungsbild
von Männchen und Weibchen. Man spricht von
Sexualdimorphismus, der sich oft in einem
deutlichen Größenunterschied der beiden Ge-
schlechter, aber auch in anderen Merkmalen wie Färbung, etc. zeigt. Weibchen wählen
Männchen nach ihren sekundären Geschlechtsmerkmalen aus, sodass bei Männchen oft
extreme Phänotypen vorkommen, während bei den Weibchen eher eine schlichte Schutz-
färbung vorkommt. Durch sexuelle Selektion konnte Darwin erklären, warum trotz seiner

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Theorie vom „survival of the fittest“ Individuen in der Natur vorkommen, die extreme Phä-
notypen aufweisen. Es ist zu beachten, dass die Rolle der sexuellen Selektion schwer einzu-
schätzen ist, da besonders auffällige sexuelle Auslöser die Überlebenschance durch schlech-
tere Anpassung an die Umwelt auch mindern können.
B e i s p i e l e : Birkhähne führen eine Gruppenbalz durch. Hierbei sind die erzeugten Geräu-
sche, die weißen Unterschwanzfedern und die blutroten Hautwülste von großer Bedeutung.
Birkhennen wählen ranghohe Hähne aus, wobei dies nicht bewusst geschieht, sondern viel-
mehr davon abhängt, wie stark das Verhalten und die Färbung der Männchen als Signale
beim Weibchen wirksam sind.
Ursprüngliche Hirsche haben ein wenig entwickeltes Geweih, der Rivalenkampf wurde über
die Eckzähne ausgetragen. Der eiszeitliche Riesenhirsch dagegen hatte ein Geweih von bis zu
vier Metern Spannweite, was vermutlich durch sexuelle Selektion entwickelt wurde. Nur
durch die selektiven Nachteile des großen Geweihs, als die Wälder wieder dichter wurden,
starb der Riesenhirsch aus.
Künstliche Zuchtwahl. Das Verfahren der künstlichen Auslese, das der Mensch seit der Jung-
steinzeit nutzt, um aus Wildformen Haustiere oder Nutzpflanzen zu züchten. Der Züchter
liest hierbei diejenigen Individuen mit den erwünschten Merkmalen aus und nutzt sie zur
Weiterzucht.
B e i s p i e l : Aus der Felsentaube aus dem Mittelmeergebiet wurden im Laufe der Zeit alle
heute vorkommenden Haustaubenrassen, rund 150, gezüchtet. Dies bewies Darwin, indem
er durch Kreuzung verschiedener Taubenrassen eine Form erhielt, die der wild lebenden
Felsentaube sehr ähnlich sah.
e. Balancierter Polymorphismus
Polymorphismus. Besteht aus „polymorph“ ≙ vielgestaltig. Individuen einer Population wei-
sen genetisch bedingt unterschiedliche Merkmalsausprägungen (Allele) auf.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Balancierter Polymorphismus. Durch die Selektion wird die Variabilität einer Population
erhalten.
Aufspaltende Selektion führt zu balanciertem Polymorphismus
Gerichtete Selektion kann zu balanciertem Polymorphismus führen
Stabilisierende Selektion schränkt balancierten Polymorphismus ein.
f. Artbegriff, Klassifikationsebenen
Morphologischer Artbegriff. Arten sind Gruppen von Organismen, die sich anhand von mor-
phologischen Merkmalen oder anhand ihres Verhaltens voneinander unterscheiden lassen.
Beispiele hierfür sind Pferd und Esel, bzw. Löwe und Tiger. Pferd und Esel lassen sich mor-
phologisch klar voneinander abgrenzen. Löwe und Tiger lassen sich sowohl morphologisch,
als auch im Verhalten klar voneinander abgrenzen.
Biologischer Artbegriff. Basiert weniger auf Ähnlichkeit, als vielmehr auf dem Potenzial, sich
fortpflanzen und fertile Nachkommen bekommen zu können. Eine Art ist eine Gruppe von
Populationen, deren Angehörige sich untereinander fortpflanzen können. Ihre Nachkommen
sind lebensfähig und fertil (= fruchtbar). Eine Art ist von anderen Arten durch Isolationsme-
chanismen reproduktiv isoliert.
Klassifikationsebenen. Das natürliche
System zieht nur Merkmale zur Ord-
nung der Organismen heran, die die
stammesgeschichtliche Verwandt-
schaft wiederspiegeln. Eine in dieses
System in einer bestimmten Katego-
rie eingeordnete Gruppe von Orga-
nismen bezeichnet man als Taxon (Pl.
Taxa).
Abb. 11: Klassifikationsschema mit Beispielen

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
g. Allopatrische Artbildung: Separation, Isolation / Isolationsmecha-
nismen
A l l o p a t r i s c h e A r t b i l d u n g – Eine
Population wird räumlich in zwei Teile getrennt
(geographische Isolation). Die Teilpopulationen
entwickeln sich unabhängig voneinander unter-
schiedlich. Sind die Unterschiede so groß, dass
keine fruchtbaren Nachkommen mehr zwischen
den Teilpopulationen möglich sind, so liegt eine
reproduktive Isolation (Fortpflanzungsisolation)
vor. Neue Arten sind entstanden.
S y m p a t r i s c h e A r t b i l d u n g – Einzelne
Individuen einer Population werden durch Mu-
tation schlagartig von der Restpopulation re-
produktiv isoliert. Die Artneubildung findet also
innerhalb eines Verbreitungsgebietes und ohne
geographische Isolation statt.
Ablauf der allopatrischen Artbildung.
1. Separation (geographische Isolation)
Genfluss wird verhindert
2. Wirksamkeit von Evolutionsfaktoren (Gendrift, Mutation, Rekombination, Selektion)
3. Rassen bilden sich aus (Durchmischung theoretisch möglich)
4. Neue Arten entstehen (Durchmischung nicht mehr möglich)
Artbildung
Allopatrisch (allos, gr. anders)
Sympatrisch (sym, gr. zusammen
Mit Separation
patris (gr.): Heim
Ohne Separation
Abb. 13: Allopatrische Artbildung
Abb. 12: Artbildung

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Exkurs: Rassen
Population einer Art, die sich in
wenigstens einem homozygoten
Merkmal von der Restpopulation
unterscheidet. „Rasse“ ist die
kleinste, sich ständig wandelnde
systematische Einheit.
Exkurs: ökologische Nische
Die Summe aller Wechselbeziehun-
gen zwischen einer Art und der
Umwelt wird als ökologische Nische
bezeichnet.
Allopatrischer Artbildung geht stets Separation, eine Form der Isolation, voraus. Im folgen-
den Abschnitt wird der Begriff Isolation erklärt.
Isolation. Die Unterbindung der Paarung, wie sie
für Angehörige verschiedener Arten typisch ist,
aber auch zwischen den Individuen einer Art
oder Population entstehen kann, bezeichnet
man als Isolation.
Isolationsmechanismen allgemein. Alle Fakto-
ren, die zwei Arten davon abhalten, gemeinsame
Nachkommen hervorzubringen, tragen zur gene-
tischen und reproduktiven Isolation bei und werden als Isolationsmechanismen bezeichnet.
Man unterscheidet zwischen präzygotischen und postzygotischen Isolationsmechanismen.
Präzygotisch werden Fortpflanzungsbarrieren genannt, die die Paarung verhindern. Postzy-
gotisch diejenigen, die erst nach Ausbildung einer Zygote einsetzen, es also grundsätzlich
zulassen, dass Hybride entstehen.
Präzygotische Isolationsmechanismen.
g e o g r a p h i s c h e I s o l a t i o n – Wird auch als Separation bezeichnet, bedeutet eine
räumliche Trennung und beruht auf geologischen Ereignissen, klimatischer Grenzziehung
oder der Trennung durch unbesiedelbare Räu-
me.
E t h o l o g i s c h e I s o l a t i o n – Zwischen
den Arten besteht keine sexuelle Anziehung
oder die gegenseitigen Paarungssignale werden
nicht verstanden. Beispiele sind unterschiedli-
che Balzgesänge von Vögeln.
Z e i t l i c h e I s o l a t i o n – Liegt vor, wenn die Paarung und Befruchtung zu unterschiedli-
chen Jahreszeiten erfolgt.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
artverschiedene Individuen
präzygotische Isolation
geographische Isolation
ethologische Isolation
zeitliche Isolation
ökologische Isolation
Isolation durch Polyploidie
STOP
STOP
STOP
STOP
STOP
STOP
STOP
STOP
STOP
Paarung
mechanische Isolation
gametische Isolation
Befruchtung
postzygotische Isolation
Bastardsterblichkeit
Bastardsterilität
Bastardzusammenbruch
Lebensfähige, fruchtbare Nachkommen
STOP
Ö k o l o g i s c h e I s o l a t i o n – Die
Tochterarten einer Stammart besetzen
unterschiedliche ökologische Nischen
durch unterschiedliche Lebensansprüche.
Dies führt nur dann zur Entstehung neuer
Arten, wenn die Reproduktion durch wei-
tere Merkmalsänderungen eingeschränkt
oder unterbunden ist.
I s o l a t i o n d u r c h P o l y p l o i d i e –
Die Vervielfachung des Chromosomensat-
zes verhindert eine erfolgreiche Kreuzung.
Dies ist bei Pflanzen durch eine Genom-
mutation häufig der Fall. Polyploidie führt
also zu einer Isolation gegenüber den an-
deren Mitgliedern der Population.
M e c h a n i s c h e I s o l a t i o n – Der
Erfolg von Paarungsversuchen wird durch
den unterschiedlichen Körperbau, oder
dem Aufbau und der Größe der Ge-
schlechtsorgane verhindert. Oft passen die
Geschlechtsorgane genau nach dem
Schlüssel-Schloss-Prinzip zueinander.
G a m e t i s c h e I s o l a t i o n – Liegt
vor, wenn trotz der Paarung die Entste-
hung einer Zygote verhindert wird. Dies
kann aufgrund fehlender chemischer Sig-
nale erfolgen. Auch bei Pflanzen kann dies
durch ein fehlendes chemisches Wechsel-
spiel zwischen Pollen und Blütenstempel Abb. 14: Isolationsmechanismen

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
erfolgen.
Postzygotische Isolationsmechanismen.
H y b r i d – S t e r b l i c h k e i t – Die Embryonalentwicklung möglicher Hybriden wird dabei
abgebrochen. Sie tritt erhöht auf und verhindert so zusätzlich die Überwindung der Art-
schranke.
H y b r i d – S t e r i l i t ä t – Selbst wenn Angehörige unterschiedlicher Arten im selben Ver-
breitungsgebiet vorkommen, und sie sich Paaren, so bleibt die Artschranke bestehen, da
Hybriden in der Regel steril (unfruchtbar) sind. So werden die Hybriden niemals über die
erste Generation hinaus bestehen können. Dies kann durch eine Polyploidie hervorgerufen
werden.
H y b r i d – Z u s a m m e n b r u c h – Setzt nicht die Hybrid-Sterblichkeit ein, so kann es auch
zum sogenannten Hybrid-Zusammenbruch kommen. Dabei sind die Hybriden der ersten Ge-
neration lebensfähig und pflanzen sich untereinander auch fort, ihre Vitalität nimmt jedoch
zunehmend ab und erlischt mit weiteren Generationen.
h. Gendrift, Gründerprinzip, Flaschenhalseffekt
Gendrift. Bezeichnet eine zufällige Veränderung des Genpools einer Population, die nicht
durch Selektion bewirkt wird. Die Gendrift wirkt auf kleinere Populationen erheblich stärker,
als auf größere. Ursachen können zufällige Ereignisse wie Blitzschlag, Überschwemmung
oder Erdbeben sein. Es gibt zwei Sonderfälle der Gendrift: das Gründerprinzip und den Fla-
schenhalseffekt.
Gründerprinzip. Besiedeln nur wenige Individuen einer großen Population als Gründerindi-
viduen ein neues Gebiet, so bringen sie nur einen geringen Teil der Allele der Stammpopula-
tion mit. Ein Beispiel hierfür sind die Darwinfinken. Die vorübergehend sehr geringe Popula-
tionsgröße erklärt die geringe genetische Variabilität der Population, auch nachdem sich die
Gründerindividuen vermehrt haben. Es kommt zur Gendrift.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Flaschenhalseffekt. Der
Flaschenhalseffekt
dient als Modellvorstel-
lung für das Gründer-
prinzip. Wie in der Ab-
bildung zu sehen ist,
macht der Flaschen-
halseffekt deutlich,
dass aus der großen
Ausgangpopulation nur ein geringer Teil an Individuen ein neues Gebiet besiedelt. Auf Allele
bezogen heißt das, dass die Variabilität der Teilpopulation stark eingeschränkt ist.
Drei Prozesse beeinflussen den Aufstieg und den Niedergang einzelner Organismusgruppen:
Massensterben (Katastrophen)
Kontinentaldrift
Adaptive Radiation: Artaufspaltung als Folge unterschiedlicher Einnischung
Lokal: z.B. Darwinfinken
Global: z.B. Entwicklung der Säugetiere
3. Großereignisse – Triebfedern für die Evolution
a. Überblick über die Entwicklung des Lebens / Erdzeitalter, Massen-
sterben
Entfaltung des Lebens. Die Geschichte des Lebens auf der Erde ist in vier Abschnitte unter-
teilt: Erdfrühzeit (Präkambrium), Erdaltertum (Paläozoikum), Erdmittelalter (Mesozoikum),
Erdneuzeit (Känozoikum). Zahlreiche Fossilfunde machen es möglich zu bestimmen, zu wel-
cher Zeit die einzelnen Gruppen von Pflanzen und Tieren mit Sicherheit schon auf der Erde
gelebt haben.
Abb. 15: Flaschenhalseffekt

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Präkambrium. Erster und längster Teil
der Erdgeschichte. Vor ca. 3,8 Mrd. Jah-
ren entstehen erste Lebewesen in Form
von Bakterien und Cyanobakterien. Vor
ca. 2,1 Mrd. Jahren treten dann erste
Eukaryoten auf, Vorläufer der Geißeltie-
re und Grünalgen. Es gibt einen Mangel
an Fossilien aus dem Präkambrium, der
zum einen mit den zahlreichen tektoni-
schen Veränderungen der Erdkruste zu-
sammenhängt, wodurch Fossilien zer-
stört wurden, und der zum anderen auf-
grund fehlender schwer zersetzbarer
Skelettstrukturen (Knochen, Zähne,
Schalen) in dieser Zeit zustande kommt.
Paläozoikum.
K a m b r i u m – Beginn vor etwa 570
Mio. Jahren. Es kommt zu einer explosi-
onsartigen Entwicklung der ver-
schiedensten Lebensformen. Beinahe
alle sind marine, also im Meer lebende
Formen. Man findet in kambrischen Se-
dimenten Vertreter aller heute bekannten
Tierstämme, mit Ausnahme der Insekten und der Wirbeltiere. Besonders zahlreich sind die
heute nicht mehr lebenden Trilobiten, Vertreter der Gliederfüßer. Grün- und Rotalgen ste-
hen am Anfang der Nahrungskette der meisten Tiere. Räuberische Arten entwickeln sich, ein
Selektionsdruck wird erzeugt, hin zu Schutzeinrichtungen wie z.B. Außenschalen. Koevolutiv
entwickeln sich dadurch bei den Räubern starke Gebisse oder krallenbewehrte Gliedmaßen
(Wettrüsten zwischen Angriffs- und Verteidigungseinrichtungen).
Abb. 16: Überblick über die Erdzeitalter

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
O r d o v i z i u m – Es treten erstmals Wirbeltiere auf. Es handelt sich dabei um kieferlose,
mit Knochenplatten gepanzerte Fischformen, die eine knorpelige Wirbelsäule besitzen. Un-
ter den Protisten (eukaryotische Einzeller) finden sich die verschiedensten Algen.
S i l u r – Die Weltmeere werden zunächst von Korallen, Trilobiten (meeresbewohnende
Gliederfüßer), Kopffüßern, Stachelhäutern und Meeresskorpionen beherrscht. Gegen Ende
des Silurs entstehen kiefertragende Panzerfische. Zur gleichen Zeit entwickeln sich erste
Landlebewesen (Nacktfarne, Moose, Flechten). Dies sind einfache Pflanzen, die weder Blät-
ter, noch echte Wurzeln besitzen. Wenig später entstehen erste Landtiere (Skorpione, Tau-
sendfüßer).
D e v o n – Erste amphibienartige Wirbeltiere verlassen das Wasser und entwickeln sich zu
Landtieren. Nacktfarne erleben ihre Blütezeit, werden dann aber von Gefäßsporenpflanzen
verdrängt. Es treten erste Samenpflanzen auf. Es kommt zu einer Differenzierung der Zellen
wegen höherer erforderlicher Leistungsfähigkeit des Körpers an Land. Neue Fortpflanzungs-
mechanismen und Fortbewegungsweisen entstehen. Kontinente werden durch Besiedelung
umgestaltet, neue ökologische Lizenzen bieten der Evolution neue Möglichkeiten.
K a r b o n – Riesige Farnwälder mit Schachtelhalmen, Schuppen- und Siegelbäumen bede-
cken das Land. Geflügelte Insekten entwickeln sich, erste Reptilien entwickeln sich. Amphi-
bien, Libellen, Schaben und Tausendfüßer bilden Riesenformen aus. Gegen Ende des Kar-
bons erscheinen erste Nadelbäume.
P e r m – Zeit der großen Baumfarne und der Beginn der Dinosaurierentfaltung. Es entstehen
zahlreiche neue Reptiliengruppen. Aus einer werden sich später die Säugetiere, aus einer
anderen die Vögel entwickeln. Es findet ein Massensterben mariner Gruppen statt.
Mesozoikum.
T r i a s – Erste Dinosaurier entstehen. Die Reptilien prägen das Leben auf der Erde und be-
siedeln mit Land, Luft und Wasser alle Lebensbereiche. Erste eierlegende Säugetiere mit ei-
nem spärlichen Haarkleid erscheinen an der Grenze von der Trias zum Jura.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
J u r a – In den jüngsten Schichten des Jura findet man Vögel. Diese Periode ist auch die gro-
ße Zeit der Kopffüßer wie Ammoniten und Belemniten, die jedoch gegen Ende des Erdmit-
telalters aussterben
K r e i d e – Neben den Nacktsamern erlangen die Bedecktsamer erste Bedeutung. Mit der
Entfaltung der Blütenpflanzen entwickeln sich die Insekten zur formreichsten Tiergruppe.
Am Ende der Kreidezeit sterben die meisten Reptilien, sowie die Ammoniten und Belemniten
aus.
Känozoikum.
T e r t i ä r – Die Blütenpflanzen breiten sich über die ganze Erde aus. Vögel und höhere Säu-
getiere entfalten sich in einer adaptiven Radiation. Gegen Ende des Tertiärs erscheinen frühe
Menschenformen.
Q u a r t ä r – Während der Eiszeiten sterben zunächst zahlreiche Pflanzen aus, später dann
auch die großen Eiszeitformen wie Mammut, Wollnashorn und Riesenhirsch. Der Mensch in
seiner heutigen Form wird zur beherrschenden Art und bestimmt die Entwicklung der ande-
ren Arten von da an in entscheidender Weise mit.
b. Biogeographie: Kontinentaldrift (z.B. als Ursache für Separation, Iso-
lation, etc.)
Biogeographie. Untersucht die
räumliche Verteilung der Lebe-
wesen unter Berücksichtigung
stammesgeschichtlicher Ent-
wicklungen. Sie erforscht die
Prozesse der Separation, Isolati-
on, Anpassung und die Bildung
ökologischer Nischen.
Kontinentaldrift. Alfred Wege-Abb. 17: Verbreitungsgebiete von Lebewesen aus Trias und Perm

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
ner, ein deutscher Polarforscher und Geowissenschaftler, entwickelte seine Theorie der Kon-
tinentalverschiebung aufgrund seiner Fossilfunde Südamerikas und Afrikas, die zu großen
Teilen übereinstimmten. Zusammen mit den fast übereinstimmenden Küstenverläufen Süd-
amerikas und Afrikas ließ dies auf die Existenz eines Urkontinents (Pangea) schließen, der
auseinandergebrochen war und dessen Teile auseinanderdriften. Die bis dahin verbreitete
Theorie, dass Landbrücken für die Übereinstimmung der Fossilien verantwortlich waren,
wurde dadurch widerlegt, dass diese sich nicht zwischen allen Kontinenten nachweisen lie-
ßen. Die Kontinentaldrift ist hierbei der Begriff, der die anhaltende Verschiebung der Konti-
nente benennt. Die in der Abbildung gezeigten Verbreitungsgebiete stellen einen Beweis für
die Kontinentaldrift und einen Urkontinent dar.
Plattentektonik. (gr. tektonikos, die Baukunst betreffend). Mit ihr wird heute die Bewegung
der Kontinente erklärt. Feste Erdplatten treiben auf zähflüssigem Magma dahin, angetrieben
von Wärmeströmungen aus dem Erdinneren. Die Platten können aufeinanderprallen und
Gebirge wie den Himalaya auftürmen oder können unter starker Vulkantätigkeit auseinan-
derweichen wie auf dem Meeresboden in der Mitte des Atlantiks. Sie können sich auch un-
tereinander schieben. Reibungen der Platten können wie beim kalifornischen San-Andreas-
Graben starke Erdbeben verursachen. Wichtig ist, dass die Kontinentalplatten keineswegs
identisch mit den Kontinenten sind. Die Platten bestehen jeweils aus kontinentalen und oze-
anischen Anteilen.
Kontinentaldrift als Ursache für Separation. Dadurch, dass der Urkontinent in Teilen ausei-
nandergedriftet ist, wurden teilweise Arten und Populationen voneinander getrennt, was
eine geographische Isolation, also Separation, darstellt. Dadurch konnten sich die Teilpopu-
lationen unabhängig voneinander entwickeln, da der Genfluss unterbrochen war.
c. Adaptive Radiation: ablaufende Teilschritte
Adaptive Radiation. Bezeichnet eine Artaufspaltung in Folge unterschiedlicher Einnischung.
Hierbei gehen aus einer stammesgeschichtlichen Linie zahlreiche Arten hervor. Adaptive
Radiation ist möglich:

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Exkurs: konvergente Evolution
Bei der unabhängigen Evolution
von Beuteltieren und Plazentasäu-
gern kam es zur Ausbildung ähnli-
cher Merkmale bei Vertretern bei-
der Gruppen. Man spricht von kon-
vergenter Evolution, die auf gleich-
artigem Selektionsdruck und der
Bildung ähnlicher ökologischer Ni-
schen beruht.
Nach Massensterben
Bei Besiedelung eines neuen Gebietes (z.B. Gendrift Gründerprinzip)
Bei Erwerb neuer Schlüsselmerkmale
Durch Koevolution (z.B. Blütenpflanzen explosionsartige Evolution der Insekten)
Beispielhafter Ablauf der adaptiven Radiation anhand der Darwin-Finken.
1. Gründung der Stammpopulation – Gründerindividuen gelangten durch Stürme auf
den Archipel. Sie konnten sich dort stark vermehren.
2. Geographische Isolation – Einige Finken gelangten auf Nachbarinseln. Der Genfluss
zur Stammpopulation wurde unterbrochen.
3. Einnischung – Auf den Nachbarinseln herrschten andere ökologische Bedingungen.
Mit zunehmender Individuenzahl entwickelte sich eine starke intraspezifische Kon-
kurrenz. Die Populationen wurden an unterschiedliche Nahrungsquellen angepasst,
um die Konkurrenz zu vermeiden. Die Schnabelformen änderten sich dadurch.
4. Radiation – Kehrten Individuen zur Ausgangspopulation zurück, konnten sie aufgrund
der unterschiedlichen Ansprüche an die Umwelt koexistieren (ökologische Isolation).
Eine neue Art hatte sich gebildet.
d. Beispiele: Stammesgeschichtliche
Entwicklung der Säugetiere und
der Beuteltiere
Adaptive Radiation der Säugetiere. Vor ca. 250
Mio. Jahren entwickelten sich die ersten Säuge-
tiere, die jedoch bis zum Aussterben der Dino-
saurier eine eher unbedeutende Tiergruppe blie-
ben. Erst danach konnten die Säugetiere eben-
falls große Formen hervorbringen, da sie neue
ökologische Möglichkeiten nutzen konnten. Auch
die Entwicklung der Samenpflanzen brachte ei-

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
nen Vorteil, da die Insekten, die sich von ihren Pollen und ihrem Nektar ernährten, eine Nah-
rungsquelle der frühen Säugetiere darstellten. Nachdem die Großnischen besetzt waren,
kam es zur immer vollkommeneren Anpassung der Arten durch Spezialisierung. Vor etwa
120 Mio. Jahren entwickelte sich die heute noch lebende Großgruppe der Säugetiere, die
Kloakentiere (heute leben noch Schnabeltier und Schnabeligel). Sie entstanden in Asien und
verbreiteten sich durch die damalige Verbindung zwischen Antarktis, Australien und Süd-
amerika über die Kontinente. Heute ist das Vorkommen der Beuteltiere weitgehend auf
Australien beschränkt.
Adaptive Radiation der Beuteltiere. Die ursprünglichen Beuteltiere in Australien lebten
vermutlich nachtaktiv und ernährten sich von Insekten. Australien driftete bereits vor der
Entwicklung moderner Säugetiere (Plazentasäuger) von den übrigen Südkontinenten weg,
wodurch kaum interspezifische Konkurrenz herrschte. Die Beuteltiere verbreiteten sich über
ganz Australien. Es entstand innerartliche Konkurrenz, nachdem die Populationsgröße an-
stieg, wodurch Beuteltiere mit leicht verändertem Nahrungsspektrum und veränderten An-
sprüchen an die Umwelt Vorteile hatten und sich erfolgreicher fortpflanzten. Die dadurch
entstandenen Unterarten besetzten so gut wie alle ökologischen Nischen, die die Plazen-
tasäuger auf den übrigen Kontinenten bildeten.
4. Evolutionsbelege und –hinweise
a. Belege aus der Paläontologie: Fossilisation, Bedeutung von Fossilien
für die Evolutionsbiologie
Fossilisation. Fossilien finden sich nur in Sedimentgesteinen. Als Fossilien werden alle Reste
von Organismen bezeichnet, von der Kriechspur eines Wurmes im Sand bis zum vollständig
erhaltenen Körper. Fossilisation bezeichnet die Entstehung von Fossilien. Man unterscheidet
entsprechend der Art des Fossils:
Versteinerungen
Steinkerne
Abdrücke

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Einschlüsse
Mumifikationen
Entscheidend für die Entste-
hung von Fossilien ist die
schnelle Einbettung von
pflanzlichen oder tierischen
Überresten in Sediment,
bevor eine vollständige Zer-
setzung durch Verwesung
oder Fäulnis erfolgt ist. Das
Sediment sollte sich dabei
schnell verfestigen und wei-
testgehend sauerstofffrei sein, um eine Zersetzung zusätzlich zu verhindern. Im Normalfall
bleiben nur Hartteile (Schuppen, Knochen, Zähne, Schalen, Gehäuse) erhalten, da sie dem
Zersetzungsprozess länger widerstehen können.
Versteinerungen sind durch die Einbettung von Hartteilen entstanden, wobei die ursprüngli-
che Substanz der Schalen und Gehäuse eine Umkristallisierung zu Calciumkarbonat, Kiesel-
säure oder Schwefelkies erfahren hat. Wenn nach der Zersetzung von Weichteilen Hohlräu-
me zurückgeblieben sind, die mit Sand und Kalkschlamm ausgefüllt wurden, sind do genann-
te Steinkerne entstanden, die den inneren Abdruck der Hartteile wiedergeben. Abdrücke
von Weichteilen sind durch das Eindringen von Mineralsalzlösungen in Hohlräume entstan-
den, die nach Auflösung der Weichteile zurückgeblieben sind. Auch gibt es Funde von ganzen
Körpern, die entweder durch Einschluss in fossilem Baumharz oder durch Mumifikation im
Eis oder durch in saurem Moorwasser entstanden sind.
Bedeutung von Fossilien. Die Entstehung von Fossilien ist ein seltenes Ereignis und wie das
Auffinden von Fossilien immer von Zufällen abhängig. Dennoch haben sie als Zeugnisse der
Evolution eine besondere Bedeutung. Zum einen sind sie direkte Dokumente vergangener
Lebewesen, zum anderen ermöglichen sie deren zeitliche Einordnung.
Abb. 18: Fossilisation

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
b. Relative Altersbestimmung von Fossilien: mithilfe von Leitfossilien,
Biostratigrafie
Leitfossilien. Um 1800
erkannte man, dass be-
stimmte Fossilien in be-
stimmten Gesteins-
schichten vorkommen
und sich von den Fossi-
lien der darüber und da-
runter liegenden Schich-
ten unterscheiden. Fossi-
lien, die für bestimmte
Gesteinsschichten charakteristisch sind, werden als Leitfossilien bezeichnet. Sie werden zur
historischen Gliederung von geologischen Formationen verwendet und erlauben die Erstel-
lung einer Erdgeschichte. Leitfossilien dienen als Zeitmarken zur relativen Altersbestimmung.
Um als Zeitmarken zu gelten, müssen sich aber die damaligen Organismen oder Organismus-
gruppen morphologisch rasch verändert haben. Die fossilisierte Art sollte also nur kurze Zeit
aufgetreten sein, damit die vertikale Verbreitung gering ist. Zahlenmäßig sollte sie aber häu-
fig in dieser Zeit gelebt haben. Ein weiteres Kriterium ist die weite regionale Verbreitung im
gleichen Lebensraum.
Biostratigrafie. Der englische Ingenieur William Smith leitete aus seinen vielen Kanalbauten
in Mittelengland ab, dass Fossilien in bestimmten Folgen in den Schichten auftreten. Er wur-
de damit zum Begründer der Biostratigrafie. In ungestörten Sedimentgesteinen sind unten
stets die geologisch ältesten Schichten. Sie werden von jüngeren Schichten überlagert. Dabei
treten in regelmäßiger Abfolge pflanzliche und tierische Fossilien auf.
Abb. 19: Leitfossilien

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
c. Absolute Altersbestimmung von Fossilien: Radiocarbonmethode
(Grundlagen, Durchführung, Grenzen)
Genaue Datierungsmethoden beruhen auf der Messung des radioaktiven Zerfalls von Isoto-
pen. Die Radiocarbonmethode benutzt den Zerfall von 14C-haltigen organischen Verbindun-
gen. In den oberen Atmosphärenschichten treffen Neutronen aus der kosmischen Strahlung
auf Stickstoffatome. Dabei entstehen in geringen Mengen die radioaktiven Kohlenstoffisoto-
pe 14C. Somit kommt 14C in der Atmosphäre vor und wird vom lebenden Organismus im Kör-
per aufgenommen.
Nach dem Tode zerfällt das im Gegensatz zu 12C instabile Kohlenstoffisotop mit einer Halb-
wertszeit von ca. 5 760 Jahren zu 14N unter Abgabe von Elektronen (β-Strahlung). Da das
Verhältnis von 14C- zu 12C-Atomen im Körper dem Verhältnis in der Erdatmosphäre entspricht
– nämlich 1 : 1012 – und 12C nach dem Tode nicht zerfällt, kann man die Veränderung des
Verhältnisses im Körper als Maß für das Alter des Fossils verwendet werden. Die Altersbe-
stimmung wird jedoch nach Ablauf der Halbwertszeit immer ungenauer. Deshalb ist die Ra-
diocarbonmethode nur für Funde verlässlich, die nicht älter als 50 000 Jahre sind.
Kalium-Argon-Methode. Eine weitere Methode der absoluten Altersbestimmung ist die Ka-
lium-Argon-Methode, die später bei den Kapiteln über die Evolution des Menschen erläutert
wird.
d. Ergebnisse der Paläontologie; Rekonstruktion von Lebewesen
So gut wie alle Fossilien können mithilfe der Homologiekriterien rezenten Tier- und
Pflanzengruppen zugeordnet werden.
Je älter Fossilien sind, desto mehr weichen sie von den rezenten Formen ab. Nicht al-
le Gruppen waren von Anfang an vertreten.
Viele Formen zeigen eine im Verlauf der Zeit zunehmende Kompliziertheit. Daneben
findet man aber auch Rückbildungen.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Die verschiedenen systematischen Gruppen treten nacheinander auf. So erscheinen
Lurche erst lange nach den Fischen, die Reptilien folgen später und noch später er-
scheinen Säugetiere und Vögel.
Für viele Fossilien lassen sich Entwicklungsreihen abgestufter Ähnlichkeit aufstellen,
bei denen sich eine Entwicklung in kleinsten Schritten nachvollziehen lässt.
Merkmale ausgestorbener Arten treten nicht wieder in gleicher Weise auf. Evoluti-
onsvorgänge sind unumkehrbar.
Die meisten Pflanzen- und Tierarten sind auf eine bestimmte geologische Epoche be-
schränkt und sterben dann aus.
Nur sehr wenige Formen haben lange Perioden unverändert überdauert.
e. Lebende Fossilien: Bedeutung für die Evolutionstheorie, Beispiel:
Quastenflosser
Lebende Fossilien. Lebende Fossilien sind Organis-
men der heutigen Tier- und Pflanzenwelt, die man als
stammesgeschichtliche Dauertypen bezeichnen könn-
te. Bei ihnen traten über Jahrmillionen hinweg keine
Evolutionsfortschritte auf. Sie sind Beispiele für einen
Stillstand in der Phylogenese einer Gruppe von Orga-
nismen. Für solche lebenden Fossilien ist nicht allein
das absolute Alter entscheidend. Dieses kann bei den
einzelnen Arten stark schwanken.
Lebende Fossilien weisen häufig altertümliche Bau-
merkmale auf. Daneben haben sie zusätzlich hoch-
spezialisierte Eigenschaften, die den ursprünglichen
Charakter verdecken können. Sie nehmen in der Sys-
tematik eine isolierte Stellung ein. Ihre Verwandten sind meist schon Millionen von Jahren
ausgestorben. Die räumliche Verbreitung ist heute meist auf ein sehr kleines Areal be-
schränkt. Trotzdem können ihre Vorfahren weit verbreitet gewesen sein.
Abb. 20: Vergleich eines rezenten Quasten-flossers mit zwei Fossilien

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Beispiel Quastenflosser. Quastenflosser, fossil seit dem Devon als artenreiche Fischgruppe
bekannt, hielt man lange für ausgestorben, als 1938 ein lebendiger Quastenflosser der Gat-
tung Latimeria vor Südafrika gefangen wurde. Mit zwei Arten kommen Quastenflosser der
Gattung Latimeria an wenigen Stellen in der Tiefe des Indischen Ozeans vor. Sie weisen viele
altertümliche Merkmale auf und unterscheiden sich darin kaum von 70 Millionen Jahre alten
fossilen Funden.
f. Mosaikformen: Bedeutung für die Evolutionstheorie und als Zwi-
schenformen bei der Anwendung der Homologiekriterien; Beispiele
Mosaikformen. Als Beweis für die Abstammungsleh-
re sind fossile Brückenformen, die den Übergang von
einer Tier- bzw. Pflanzengruppe zur nächsten darstel-
len, von großer Bedeutung. Mosaikformen stellen
Bindeglieder zwischen den Großgruppen der Orga-
nismen dar und beweisen somit den Evolutionsvor-
gang. Sie vermitteln einen Eindruck, wie die wesentli-
chen Merkmale einer Großgruppe in die einer ande-
ren übergehen. Stets weisen Brückenformen ein Mo-
saik aus ursprünglichen und fortschrittlichen Merk-
malen auf, da die evolutive Umbildung verschiedener
biologischer Strukturen mit unterschiedlicher Ge-
schwindigkeit erfolgt.
In einem späteren Kapitel werden die drei Homolo-
giekriterien erläutert. Anhand dieser Kriterien kann
man Rückschlüsse über die Verwandtschaft von zwei
Arten ziehen. Eines dieser Kriterien beruht auf dem Vorhandensein von Mosaikformen, da
diese das Bindeglied darstellen und somit auch die Verwandtschaft belegen.
Abb. 21: Archaeopteryx im Vergleich

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Übergang von wasserlebenden Fischen zu Landwirbeltieren. Mit vielen Fossilien aus dem
Devon ist dieser Übergang von wasserlebenden Fischen zu Landwirbeltieren vor etwa 400
bis 350 Millionen Jahren belegt. Der Fleischflosserfisch Eusthenopteron lebte in flachen,
sauerstoffarmen Süßgewässern. Lungen als zusätzliche Atmungsorgane, muskulöse Stütz-
flossen mit knöchernem Skelett und ein Hautpanzer als Verdunstungsschutz ermöglichten
ihm, bei Eintrocknen eines Gewässers ein neues aufzusuchen. Arcanthostega war schon Vier-
füßer, doch dienten die Beine eher zum Schwimmen als zum Laufen. Beide Fossilien belegen,
dass Luftatmung und Beine als typische Merkmale der Landwirbeltiere bereits im Wasser
entstanden sind. Ichthyastega besaß mit Schwanzflosse und Schuppen ursprüngliche Fisch-
merkmale, mit mehrzehigen Beinen und Lungen- sowie Hautatmung statt der Kiemenat-
mung aber typische Amphibienmerkmale.
Archaeopteryx. Das Mosaik aus Reptilien- und Vogelmerkmalen macht die Besonderheit von
Archaeopteryx aus. Jedes Einzelmerkmal lässt sich dabei eindeutig einer der beiden Gruppen
zuordnen. Die Reptilienmerkmale zeigen besonders große Ähnlichkeit mit den fossilen
Theropoden, kleinen Raubdinosauriern aus der Ordnung der Saurischia (Echsenbeckensau-
rier).
Vogelmerkmale Reptilienmerkmale
Hirnschädel und großes Auge Schädelöffnung und Zähne
Federkleid Rippen ohne Versteifungsansätze
Armskelett (Vogelflügel) freie Finger mit Krallen
Rabenschnabelbeine im Schultergürtel Schien- und Wadenbein nicht verwachsen
Beinskelett (Mittelfußknochen bildet Lauf) lange Schwanzwirbelsäule
1. Zehe nach hinten gerichtet (unsicher) Saurierbecken (Beckenknochen nicht ver-
wachsen
g. Stammbaumdarstellung: Unterschied Phylogramm / Kladogramm
Phylogramme. Phylogramme sind konventionelle Stammbäume. Sie zeigen, zu welchem
relativen – oder auch absoluten – Zeitpunkt sich die verschiedenen Taxa trennten und wie
unterschiedlich diese seitdem geworden sind. Die Breite ihrer Stammlinien kann die Arten-
zahl veranschaulichen.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Kladogramme. Kladogramme stellen nur
die Aufspaltungen der Abstammungsli-
nien dar, wobei jede Abzweigung durch
eines oder mehrere neu erworbene
Merkmale definiert ist. Wie unterschied-
lich die Taxa geworden sind, lässt sich aus
ihnen nicht entnehmen, wohl aber die
Abfolge der Verzweigungen im Verlauf
der Stammesgeschichte. Kladogramme
sind die Stammbäume der phylogeneti-
schen Systematik.
Zum Vergleich sind hier noch einmal ein
Kladogramm und ein Phylogramm abgebil-
det.
Apomorphien. Der Begriff bezeichnet in
der Systematik der Phylogenese solche
Merkmale, die im Vergleich zum Vorfahren
der jeweils betrachteten Stammlinie neu
erworben wurden. So sind Apomorphien für die Abzweigungen des Kladogramms verant-
wortlich (siehe oben).
Plesiomorphien. Der Begriff bezeichnet in der Systematik der Phylogenese ursprüngliche
Merkmale, die bereits vor der jeweils betrachteten Stammlinie entstanden sind. Plesiomor-
phien können also nicht zur Erstellung von Kladogrammen herangezogen werden.
h. Stammbaum und Evolution der Wirbeltiere
Der Stamm Wirbeltiere leitet sich von einfach organisierten, im Wasser lebenden Tieren ab,
bei denen ein im Rücken liegender, knorpeliger Stab – die Chorda dorsalis – als Stütze dient.
Das Lanzettfischchen, ein Meeresbewohner, ist ein heute lebendes Chordatier, das mit vie-
Abb. 23: Schema zweier möglicher Kladogramme
Abb. 22: Phylogramm der Dinosaurier

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
len ursprünglichen Merkmalen den Wirbeltiervorfahren sehr ähnlich ist. Die ältesten Wirbel-
tierfossilien, die wir kennen, stammen von fischartigen, kieferlosen Tieren ab, die im Ordovi-
zium vor 500 Millionen Jahren lebten, und mit den rezenten Kieferlosen eng verwandt sind.
Fische. Im Silur lebten nur wenige Arten urtümlicher Fische, während die anschließende
Epoche des Devons als das „Zeitalter der Fische“ gilt. Die Fischgruppe, aus der sich die Land-
wirbeltiere oder Tetrapoda als monophyletische Gruppe entwickelten, waren die Fleischflos-
ser, zu denen Quastenflosser und Lungenfische zählen. Ihre Merkmale erwiesen sich als Prä-
dispositionen für das Landleben:
Paarige Fischlungen
Innere Nasenöffnungen
Muskulöse, fleischige Brust- und Bauchflossen
Lurche. Der Übergang vom Wasser- zum Landleben erforderte eine Reihe tiefgreifender
Strukturänderungen:
Stabilisierung des Skeletts
Veränderte Bewegung
Austrocknungs- und UV-Schutz
Andere Atmung
Ausscheidung und Fortpflanzung
Trotz dieser neuen Merkmale sind die Amphibien oder Lurche als Nachfahren der ältesten
Landwirbeltiere bis heute an feuchte Lebensräume gebunden: Ihre Haut darf nicht völlig
austrocknen und zur Fortpflanzung müssen die meisten Arten das Wasser aufsuchen.
Reptilien. Das ganze Erdmittelalter über waren die als Reptilien zusammengefassten Grup-
pen die beherrschenden Landwirbeltiere. Die Flugsaurier eroberten auch den Luftraum,
Fischsaurier und manche Schildkröten gingen sekundär wieder zum Wasserleben über. Rep-
tilien sind die ersten an das dauernde Leben an Land angepassten Wirbeltiere. Sie besitzen
Hornschuppen, die ihre fast drüsenfreie Haut vor Austrocknung schützen. Ihre Eier haben
eine feste Eischale, die Atemgase durchlässt, Feuchtigkeit aber zurückhalt. Erst die Evolution
einer inneren Befruchtung ermöglichte die Entwicklung eines beschalten Eies. In dessen In-

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
neren bildet der Embryo während seiner Entwicklung eine Hautfalte, das Amnion. In der
flüssigkeitsgefüllten Fruchtblase durchläuft er wie in einem „Tümpel“ seine Entwicklung bis
zum Schlüpfen.
Säugetiere und Vögel. Aus frühen Reptiliengruppen entwickelten sich unabhängig vonei-
nander die gleichwarmen oder homoiothermen Säugetiere und Vögel. Ihre konstante Kör-
pertemperatur macht sie unabhängiger von den wechselnden Lebensbedingungen der Um-
welt, hat aber einen höheren Energiebedarf zur Folge. Von den Säugetier-Apomorphien
kennt man keine direkten Beweise, sie sind fossil nicht belegt:
Haarkleid
Homoiothermie
Zwerchfell für eine intensive Atmung
Gesichtsmuskeln zum Saugen
Hochdifferenziertes Gehirn
Abb. 24: Stammbaum der Wirbeltiere einschließlich der Apomorphien

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
i. Belege aus Anatomie / Morphologie: Homologie und Analogie
Homologie. Ähnlichkeit biologischer Strukturen bei verschiedenen Lebewesen aufgrund
übereinstimmender Erbinformationen bezeichnet man als Homologie. Man kann Homolo-
gien also als Hinweis gemeinsamer Abstammung werten. Homologie ist die Folge einer di-
vergenten Entwicklung.
Analogie. Ähnlichkeit biologischer Strukturen bei verschiedenen Lebewesen aufgrund von
einer gleichen Funktion und eventuell gleichem Aussehen bezeichnet man als Analogie. Ana-
loge Merkmale sind somit kein Ausdruck von gemeinsamer Abstammung und Folge einer
konvergenten Entwicklung. So können sich analoge Strukturen durch ähnliche Umweltbe-
dingungen der verschiedenen Lebewesen bilden.
Folgende Abbildung verdeutlicht noch einmal zusammengefasst den Unterschied zwischen
Homologie und Analogie:
Bestimmung. Zur Bestimmung, ob ein Merkmal homolog oder analog ist, werden drei Krite-
rien herangezogen. Das Kriterium der Lage besagt, dass Strukturen genau dann homolog
sind, wenn sie in einem vergleichbaren Gefügesystem die gleiche Lage einnehmen. Dieses
Kriterium ist sehr unsicher und reicht alleine nicht zur Bestimmung aus. Das Kriterium der
spezifischen Qualität besagt, dass komplex gebaute Organe dann homolog sind, wenn sie in
Abb. 25: Homologe und analoge Strukturen im Vergleich

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
besonderen Einzelheiten ihres
Aufbaus übereinstimmen. Das
Kriterium der Stetigkeit besagt,
dass auch dann Homologie vor-
liegt, wenn stark abgewandelte
Organe durch eine Reihe von
Zwischenformen so miteinander
verbunden sind, dass sie einen
Übergang von der einen Struk-
tur zur anderen erkennen las-
sen.
Die Abbildung zeigt, wie vielfältig das Kriterium der Lage dabei ist.
Konvergenz und Divergenz. Konvergente bzw. divergente Entwicklung sind die Ursachen von
Homologie und Analogie. Folgende Abbildung macht dabei die Begrifflichkeiten deutlich.
Abb. 26: Homologiekriterien
Abb. 27: Divergente und konvergente Entwicklung

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
j. Homologiekriterien: Anwendung auf Beispiele
Kriterium der Lage. Die Vordergliedmaßen und Knochen aller Wirbeltiere stimmen in ihrer
Lage im Gesamtgefüge und relativ zueinander überein. Die Mundwerkzeuge der Insekten,
deren Bauteile je nach Lebensweise sehr verschieden gestaltet sind, stimmen nach Lage und
Anordnung überein.
Kriterium der spezifischen Qualität. Wirbeltierzähne und Haischuppen lassen sich durch
übereinstimmenden Aufbau aus Pulpa, Dentin und Schmelz homologisieren.
Kriterium der Stetigkeit. Die Gehörknöchelchen der Säugetiere lassen sich mit Schädelkno-
chen der Fische und Reptilien homologisieren. Für das Beinskelett des heutigen Pferds lässt
sich anhand fossiler Zwischenformen belegen, wie durch Reduktion einzelner Glieder aus
einem fünfstrahligen Fuß eine einstrahlige Form entstand.
k. Belege aus der Embryonalentwicklung: Biogenetische Regel von Ernst
Haeckel
Die biogenetische Regel von Ernst Haeckel besagt, dass die Individualentwicklung (Ontoge-
nese) eine unvollständige und schnelle Rekapitulation der Phylogenese, also der stammesge-
schichtlichen Entwicklung, ist, wobei in der Embryonalentwicklung nur Embryonalstadien
von phylogenetisch älteren Arten durchlaufen werden, nicht aber Erwachsenenstadien. So
bilden menschliche Embryonen kurzzeitig Anlagen zu Schwimmhäuten und Kiemen aus.
l. Atavismen und Rudimente: Definition, Unterscheidung, Ursachen
Rudimente. Viele Strukturen verschiedener Lebewesen sind funktionslos. Sie lassen sich als
Rudimente erklären, das heißt als Reste ehemals funktionstüchtiger Organe der Vorfahren,
die im Verlauf der Evolution ihre Funktion verloren haben. Umgekehrt können Rudimente
wichtige Hinweise auf die Abstammung liefern: Im Körperinneren von Walen findet man z.B.
Reste von Beckenknochen sowie rudimentäre Ober- und Unterschenkelknochen als Belege
ihrer Abstammung von Tetrapoden.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Atavismen. In seltenen Fällen treten durch Mutation ursprüngliche Merkmale, die nur von
Vorfahren der Art bekannt sind, bei einzelnen Individuen wieder auf. Beim Menschen kann
ein beispielsweise ein schwanzartig verlängertes Steißbein wieder auftreten. Ein solcher Ata-
vismus lässt sich damit erklären, dass Erbinformationen der Vorfahren noch vorhanden sind
und anomal wieder verwirklicht wird.
Abb. 29: Atavismen bei Pferd und Mensch
Abb. 28: Rudimente des Walfisches

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
m. Belege aus der Molekularbiologie: Homöobox-Gene – Definition, Be-
deutung für die Stammbaumerstellung und die Evolutionsbiologie
Homöobox-Gene kommen in Clustern vor und sind Gene, die für bestimmte Transkriptions-
faktoren kodieren. Diese Transkriptionsfaktoren schalten Gene an und aus. Diese Transkrip-
tionsfaktoren bewirken beispielsweise, dass die Anlagen für Schwimmhäute während der
Embryonalentwicklung des Menschen rückgebildet werden.
Die Bedeutung dieser Gene und der Transkriptionsfaktoren für die Stammbaumerstellung
und die Evolutionsbiologie allgemein liegt darin, dass sie die Entstehung von Atavismen er-
klären. Denn ein Atavismus entsteht, wenn die Kontrollgene defekt sind, die in diesem Bei-
spiel für die Anschaltung des Transkriptionsfaktors zuständig sind. Wenn diese Kontrollgene
nicht funktionieren, würde kein Transkriptionsfaktor gebildet und die Transkription der
Schwimmhautanlagen würde fortgeführt werden, statt eine Rückbildung zu bewirken.
Auch belegen die weitegehend identischen Basensequenzen der Homöobox-Gene, ihre Lage
und das ähnliche Expressionsmuster bei den verschiedenen Tierarten und systematischen
Gruppen , dass sie homolog sind, also einen gemeinsamen phylogenetischen Ursprung ha-
ben.
n. Übereinstimmung in der DNA-Sequenz, DNA-Sequenzierung, DNA-
Hybridisierung, DNA-Homologie
Übereinstimmung in der DNA-Sequenz. Bei dem Vergleich von DNA-Sequenzen handelt es
sich um eine Methode der Molekularbiologie, um Evolution zu belegen. Konkret heißt das,
dass der Vergleich von DNA-Sequenzen über die Verwandtschaft der zu vergleichenden Ar-
ten Aufschluss gibt.
DNA-Sequenzierung. Um die DNA-Sequenzen vergleichen zu können, müssen sie zwangsläu-
fig sequenziert werden. Eine geläufige Methode ist die DNA-Sequenzierung nach F. Sanger,
die in der Zusammenfassung der Genetik-Themen bereits erläutert ist. Es empfiehlt sich, die
Methode an dieser Stelle nun zu wiederholen, bevor Folgendes angesprochen wird.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
DNA-Hybridisierung. Die
DNA-DNA-Hybridisierung ist
eine Methode zum Vergleich
des genetischen Materials
zweier Arten. Der Vorteil ist,
dass man die genaue Abfol-
ge der Basen, wie man sie
durch die Sequenzierung
und Gelelektrophorese er-
mittelt, nicht bekannt sein
muss. Die DNA-DNA-
Hybridisierung erfolgt in vier Schritten. Zunächst wird die DNA zweier zu vergleichender Ar-
ten extrahiert und zerschnitten. Dann werden die beiden DNA-Doppelstränge getrennt von-
einander erhitzt und so denaturiert. Die Wasserstoffbrückenbindungen brechen auf und die
komplementären Stränge werden getrennt. In einem zweiten Schritt bringt man die Einzel-
stränge der verschiedenen Arten zusammen und kühlt sie ab. Die Einzelstränge lagern sich
an allen komplementären Stellen zusammen, sie hybridisieren. Je ähnlicher die DNA der be-
teiligten Arten, desto mehr Wasserstoffbrückenbindungen bilden sich. Danach werden die
Hybrid-Stränge erneut erhitzt. Anhand der Schmelztemperatur, also der Temperatur, zu der
die Stränge erneut aufgetrennt werden, kann man die genetische Ähnlichkeit und damit die
Verwandtschaft bemessen. Je mehr Wasserstoffbrücken sich gebildet haben, also je ähnli-
cher sich die DNA-Stränge sind, desto höher liegt die Schmelztemperatur.
o. Analyse mitochondrialer DNA, molekulare Uhr
Mitochondriale DNA. Die mtDNA ist aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften geeignet, um
Stammbäume zu erstellen und die Abstammungsverhältnisse des Menschen zu rekonstruie-
ren. mtDNA unterliegt keiner Rekombination, sie wird von der Mutter an die Zygote weiter-
gegeben. Bei Fossilien kann eher eine ausreichende Menge mtDNA als normaler DNA gefun-
den werden, da eine Zelle viele Mitochondrien besitzt. Die mtDNA mutiert außerdem mit
einer relativ konstanten Mutationsrate.
Abb. 30: Verfahren der DNA-DNA-Hybridisierung

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Analyse. Aufgrund der Tatsache, dass mtDNA ohne Rekombination weitergegeben wird,
müssen Änderungen der Sequenz aufgrund von Mutationen geschehen sein. Da eine kon-
stante Mutationsrate bekannt ist, die vergleichsweise hoch ist, lässt sich durch ein Zurück-
rechnen ziemlich exakt bestimmen, wann beispielsweise zwei verglichene Gruppen sich ge-
trennt haben.
Molekulare Uhr. Die molekulare Uhr bezeichnet die Mutationsrate, anhand derer sich zu-
rückrechnen lässt, wann die Ausgangssequenz eines DNA-Abschnittes existiert hat. Diese
molekulare Uhr eicht man, indem man Sequenzunterschiede der DNA für Organismen ermit-
telt, deren gemeinsame Vorfahren mit einer anderen Methode datiert wurden.
p. Übereinstimmung in der Aminosäuresequenz: Beispiel Cytochrom c
Übereinstimmung in der Aminosäurensequenz. Proteine sind durch Kettenlänge und Se-
quenz ihrer Aminosäurebausteine eindeutig gekennzeichnet. Sie wurden innerhalb der
Stammesentwicklung ziemlich konservativ erhalten. Da die Aminosäuresequenz durch Gene
codiert ist, darf man Sequenzübereinstimmung von Proteinen verschiedener Arten als un-
mittelbaren Ausdruck gemeinsamer Abstammung ansehen.
Cytochrom c. Cytochrom c ist ein Enzym der mitochondrialen Atmungskette, das wichtig für
alle aeroben Eukaryoten ist. Es besteht aus 104 Aminosäuren. Die Homologie der Sequenz
bezieht sich durchschnittlich auf ein Drittel des Moleküls. Je mehr Unterschiede existieren,
desto kleiner ist der Verwandtschaftsgrad zwischen den verglichenen Arten. Das Cytochrom
c des Menschen unterscheidet sich von denen des Gorillas und des Schimpansen gar nicht,
und unterscheidet sich von dem des Rhesusaffen nur durch die Substitution einer einzigen
Aminosäure.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
q. Belege aus der Parasitologie: Beispiel Malariaerreger, Kamele und ih-
re Parasiten
Kamele und ihre Parasiten. Das afrikanische Dromedar, das asiatische Trampeltier und das
südamerikanische Lama haben einen gemeinsamen Vorfahren. Die enge Verwandtschaft der
Kamele zeigt sich beispielsweise daran, dass sie alle 74 Chromosomen im diploiden Satz be-
sitzen. Bei allen drei Arten leben im Fell parasitische Läuse, die sich außerordentlich ähnlich
sind. Die unterschiedlichen Lebensbedingungen auf den drei Kontinenten führten zwar zum
Merkmalswandel bei den Kamelarten, ihre Parasiten standen aber offenbar zu keiner Zeit
unter einem entsprechenden Selektionsdruck.
Da Parasiten i.d.R. hoch wirtsspezifisch sind, lassen gleiche Parasiten bei verschiedenen Ar-
ten den Schluss auf gemeinsame Vorfahren und damit Verwandtschaft zu.
Malariaerreger. Die einzelligen Erreger der Gattung Plasmodium (Malariaerreger) gehören
wahrscheinlich zu den ältesten Parasiten des Menschen und seiner Vorfahren. Über ihre
Abb. 31: Genom-Vergleich des Cytochrom c

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Evolution ist wenig bekannt: Plasmodien begannen ihre Entwicklung wahrscheinlich vor
mehr als 60 Millionen Jahren im Darmtrakt von Reptilien. Irgendwann gelang diesen Parasi-
ten der Sprung auf Vogel- und Säugetierarten. Mit zunehmender Spezialisierung entstanden
Arten, die sich im Blutstrom des Wirtes von dessen roten Blutkörperchen ernährten. In ei-
nem weiteren Schritt gelang der Sprung auf blutsaugende Stechmücken — das Alter von
frühen Moskitos wurde auf 35 Millionen Jahre datiert —, die als Überträger des Parasiten
von einem Wirt auf den nächsten dienten. Bei der Menschwerdung waren Malariaparasiten
ständige Begleiter unserer Vorfahren. Neben den vielen Plasmodienarten, die Affen befallen
und teilweise in der Lage sind, Menschen zu infizieren, haben sich die vier Erreger, Plasmo-
dium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale und Plasmodium vivax auf die
Menschheit spezialisiert.
5. Evolution des Menschen
a. Stammbaum der Primaten: Systematische Stellung des Menschen,
Merkmale der Primaten, Prädispositionen für die Evolution des Men-
schen
Systematische Stellung des Menschen. Die Gruppe der Primaten umfasst die Halbaffen, so-
wie die Affen. Zu den Halbaffen zählen die Lemuren, Loris, Pottos, die Affen unterteilen sich
in Tieraffen und Menschenaffen. Gibbons, der Orang-Utan, Gorillas, Schimpansen und Men-
schen gehören zu den Menschenaffen.
Fachbegriff Bedeutung
Hominoiden alle Menschenaffen, also die oben aufge-zählten Arten
Hominiden Orang-Utan, Gorilla, Schimpanse, Mensch
Homininae Schimpanse, Mensch
Der Stammbaum der Primaten stellt sich wie folgt auf.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Merkmale der Primaten. Durch ihre recht ursprünglichen Gliedmaßen mit je fünf Fingern
und das wenig differenzierte Gebiss sind die Primaten schwieriger zu kennzeichnen als ande-
re Säugetierordnungen. Typisch ist eine Kombination folgender Merkmale:
Vier zum Greifen fähige Füße, deren erste Zehe sich weit abspreizen und anderen Ze-
hen gegenüberstellen lässt
Flache Nagel statt Krallen
Ein gut ausgebildeter, farbtüchtiger Gesichtssinn mit nach vorn gerichteten Augen,
die räumliches Sehen ermöglichen
Ein Gehirn, das im Verhältnis zum übrigen Körper groß ist
Relativ späte Geschlechtsreife und lange Lebensdauer
Prädispositionen für die Evolution des Menschen. Millionen Jahre später erwiesen sich eine
ganze Reihe dieser Anpassungen an das Baumleben als wichtige Prädispositionen für die
Evolution des Menschen (siehe auch Präadaptation).
Abb. 32: Stammbaum der Primaten

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Greifhände und Plattnägel. Greifhände mit abspreizbarem Daumen und mit Plattnä-
geln als Widerlager erhöhen die Griffsicherheit an Ästen. Für die spätere menschliche
Evolution war die Entwicklung der Hand zu einem hochsensiblen Greiforgan von ent-
scheidender Bedeutung.
Räumliches Sehen und Farbensehen. Verbessert das Abschätzen von Entfernungen
und da die Tiere meist tagaktiv sind, erleichtert das Farbensehen den Nahrungser-
werb.
Gehirn. Mit der anspruchsvollen Sinneswahrnehmung und der notwendigen schnel-
len Bewegungskoordination ging bei den baumbewohnenden Primaten eine Vergrö-
ßerung und Verfeinerung von Klein- und Großhirn einher.
Fortpflanzung. Schwangerschaft der Primaten dauert sehr lange, fast immer kommt
ein relativ unselbstständiges und einzelnes Junges auf die Welt. Durch viel Kontakt
zur Mutter wird Imitationslernen ermöglicht.
Unspezialisiertheit. Primaten sind Generalisten verglichen mit anderen Säugetieren.
Dies erfordert ein offenes Verhaltensprogramm mit hoher Flexibilität, was wiederum
eine besondere Entwicklung der Intelligenz voraussetzt. Nur so war kulturelle Evolu-
tion möglich.
b. Skelett- und Schädelvergleich: Mensch und Schimpanse
Abb. 33: Skelettvergleich zwischen Schimpanse und Mensch

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Das Skelett. Am Skelett des Menschen kann man er-
kennen, was ihn – im Gegensatz zum Schimpansen –
zum aufrechten Gang befähigt. Auch der Körperschwer-
punkt liegt beim Menschen deutlich anders. Die wich-
tigsten Elemente sind hier eindeutig die Wirbelsäule,
das damit zusammenhängende Hinterhauptsloch, das
Hüftgelenk, aber auch die Zehen. Mit einem solchen
Körperschwerpunkt wie dem des Schimpansen ist ein
aufrechter Gang schlichtweg nicht möglich.
Der Schädel. Der Schädel gibt Aufschluss über Ver-
wandtschaft verschiedener Arten und ist gleichzeitig ein
Indikator für kognitive Leistungen, denn durch Schädelabdrücke kann das Hirnvolumen nä-
herungsweisegeschätzt werden. Den Schädel unterteilt man in Gesichtsschädel und Gehirn-
schädel. Folgende Abbildung soll die wesentlichen Unterschiede des Schädels von Mensch
und Schimpanse deutlich machen.
Abb. 34: Vergleich der Körperhaltung des Menschen und des Schimpansen
Abb. 35: Vergleich des Kiefers und des Schädels von Schimpanse und Mensch

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Anatomische Unterschiede.
Die Wirbelsäule des Menschen ist am oberen Beckenrand scharf nach hinten ge-
knickt. Eine zweite und dritte federnde Einbiegung (Doppel-S) im Brust- und Halsbe-
reich ermöglichen erst beim Menschen die vollkommende Aufrichtung des Oberkör-
pers.
Das Becken des Menschen ist stark verbreitet und verkürzt und bildet die Eingewei-
deschüssel. Durch die Lage der Gelenkpfanne können Becken und Oberschenkel und
damit der gesamte Oberkörper eine senkrechte Linie bilden.
Der Schädel des Menschen ruht direkt auf der senkrecht stehenden Wirbelsäule. Das
Hinterhauptsloch, durch welches das Rückenmark in den Schädel gelangt, liegt etwa
in der Mitte der Schädelbasis. Bei den Menschenaffen mit ihrer vorn übergebeugten
Körperhaltung muss der Schädel durch starke Nackenmuskulatur gehalten werden,
das Hinterhauptsloch liegt weiter hinten.
Die Schädelform zeigt beim Menschenaffen die typischen kräftigen Überaugenwüls-
te, die weit vorspringende Schnauze und ein fliehendes Kinn.
Das Volumen und Gewicht des Gehirnschädels des Menschen übertreffen mit 1450 g
das der Menschenaffen bei weitem.
Die Zahnreihen stehen beim Menschenaffen in U-Form und zeigen in jedem Kiefer
eine Lücken (Diastema). Sie bieten beim Schließen des Kiefers Platz für die kräftigen
Eckzähne. Beim Menschen fehlen überragende Eckzähne und Zahnlücke. Die Zahn-
reihe gleicht eher einer Parabel.
Die Beine des Menschen sind stets länger als die Arme. Die Beine des Affen stehen in
O-Stellung und sind kürzer als die vorderen Extremitäten.
Die Füße des Menschen zeigen nicht mehr den Greiffuß der Affen, sondern einen
Standfuß, der das gesamte Körpergewicht trägt.
Die Hände des Affen werden beim Hangeln zum Haken gekrümmt, sodass der kurze
Daumen funktionslos ist. Der verlängerte menschliche Daumen kann jedem der an-
deren Finger gegenübergestellt werden, sodass ein Präzisionsgriff möglich ist.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
c. Evolution des aufrechten Gangs: Hypothesen zur Evolution, Voraus-
setzungen im Skelettbau
Es gibt zahlreiche Hypothesen und Ansätze, den Ursprung des aufrechten Ganges des Men-
schen zu erklären. Einige sind im folgenden Abschnitt benannt und erläutert.
Savannenübersichtshypothese. Diese Theorie besagt, dass ein großer Klimawandel stattge-
funden hat, der die Entstehung von trockeneren Klimabedingungen bewirkte. Diese trocke-
nen Bedingungen reduzierten schwerwiegend die Menge an bewaldeten Lebensräumen vor
ungefähr 2,5 Millionen Jahren. In der Savanne dürfte ein aufrechter Gang von Vorteil gewe-
sen sein, denn Feinde waren früher zu erkennen, die Hände waren frei zum Tragen von Ge-
genständen und zur Verteidigung. Zudem verbraucht das aufrechte Gehen weniger Energie
als die Fortbewegung auf allen Vieren. Die Vormenschen (Australopithecinen) waren relativ
klein. In einer Landschaft mit hohem Gras konnten sie ihre Feinde erst relativ spät sehen. Bei
einer aufrechten, zweibeinigen Fortbewegung hatten sie bessere Chancen, sich rechtzeitig
auf einen Baum zu retten oder sich anders in Sicherheit zu bringen.
Energieeffizienzhypothese. Die frühen Vormenschen waren wahrscheinlich, wie heutige
Menschenaffen, in erster Linie Fruchtfresser mit einem vielfältigen Speiseplan. Früchte tra-
gende Bäume und andere Nahrungsangebote waren aber in der entstehenden Savanne zu-
nehmend großflächiger verstreut. Um beim Sammeln effektiv zu bleiben, müssten die Homi-
niden lange Strecken mit Nahrung oder Werkzeugen zurücklegen, wodurch Vierbeinigkeit
extrem ineffizient würde. Eine verbesserte und energiesparende Fortbewegung war die Fol-
ge. Messungen ergaben, dass Menschen mit dem zweibeinigen Gang bei nicht maximaler
Geschwindigkeit etwas doppelt so lange Strecken zurücklegen können wie vierfüßige Schim-
pansen. Der Mensch wurde zum Ausdauerläufer.
Werkzeughypothese. Andere Erklärungen für den aufrechten Gang gehen davon aus, dass
sich Schimpansen bei Waffengebrauch öfters aufrichten. Zunehmende kriegerische Ausei-
nandersetzungen hätten dann zum aufrechten Gang geführt. Wieder andere Erklärungen
führen zunehmende Jagd als Grund an. Die frei gewordenen Hände können besser Werkzeu-
ge mittragen und herstellen. Allerdings gibt es bis jetzt keine Anzeichen dafür, dass Aust-
ralopithecinen im Vergleich zu Menschenaffen deutlich mehr Werkzeuge hergestellt hätten.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Wasserwathypothese. Eine ganz eigenwillige Hypothese über die Vorteile eines aufrechten
Ganges äußerte am 13.3.2001 im Schwäbischen Tagblatt Tübingen Professor Carsten
Niemitz aus Berlin: Er vermutet, dass die Uferzone von Flüssen die Hauptnahrungsquelle für
tierische Proteine darstellte. "Für einen watenden Affen oder Vormenschen am Ufer sind
lange Beine von großem Vorteil. Sie bieten weniger Fließwiderstand als der breite Körper
und sie lassen mehr vom Körper aus dem Wasser herausschauen. Dadurch wird das Gewicht
auf den Füßen erhöht und das sonst zu 'schwebende' Gehen erleichtert."
Kühlerhypothese. Ein weiteres Problem des Lebensraums Savanne könnte die im Vergleich
zum Wald vermehrte Sonneneinstrahlung gewesen sein. Der Körper, insbesondere das Ge-
hirn, darf nicht überhitzen. Durch eine aufrechte Fortbewegungsweise wird die der Sonne
um die Mittagszeit ausgesetzte Körperfläche deutlich verringert. Der Körper hat mehr Ab-
stand zum ebenfalls Wärme abstrahlenden Boden und kann zusätzlich durch Wind besser
gekühlt werden. In diesem Zusammenhang wurde vielleicht auch das Schwitzen "erfunden",
was ja unsere Menschaffenverwandte nicht beherrschen.
Hohe-Beeren-Hypothese. Meave Leaky vermutet eine andere Ursache für die Zweibeinig-
keit. In der entstehenden Savanne waren Büsche und Bäume und damit die Futterquellen für
"Früchteesser" weiter auseinander stehend. Beeren an höheren Büschen waren für Vierbei-
ner schlechter zu erreichen. Das ist auch der Grund, warum die Gerenuk-Gazelle sich beim
Fressen auf die Hinterbeine stellen kann und damit auch höhere Beeren und Blätter erreicht.
Vielleicht gab es für unsere Vorfahren ähnliche Gründe?
Nahrungstransport-Sozial-Hypothese. Bei zweibeiniger Fortbewegung werden die Vorder-
extremitäten funktionslos und können neue Aufgaben übernehmen. Es ist so z.B. wesentlich
besser möglich, Nahrung zu sammeln, zu tragen und anderen Familienmitgliedern zu brin-
gen. Bei Menschenaffen findet man dieses Verhalten nicht. C. O. Lovejoy stellt einen ganzen
Komplex von angepassten Verhaltensänderungen als Folge der neuen Möglichkeiten des
aufrechten Ganges auf. Familiäre Strukturen entstehen einhergehend mit weitgehender
Monogamie beider Elternteile, die sich gemeinsam um den Nachwuchs kümmern. Der Mann
schafft Nahrung aus einem weiteren Umkreis herbei, sodass die Mutter jeden Säugling bes-
ser nähren und beschützen kann und auch (insbesondere im Vergleich mit den großen Men-

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
schenaffen) mehr Kinder gebären kann. Die Frauen sind wegen der Kinder stärker ortsge-
bunden und sammeln Nahrung in der näheren Umgebung.
Voraussetzungen im Skelettaufbau. Die Voraussetzungen für den aufrechten Gang sind im
Skelettaufbau zu finden. Informationen hierzu sind im vorigen Kapitel verfügbar.
d. Kulturelle Evolution: Sprache, Werkzeuge
Kulturelle Evolution. Ein herausragendes Merkmal des Menschen ist seine Lernfähigkeit.
Bereits frühe Vorfahren des Menschen übernahmen offensichtlich gelerntes Verhalten von
erfahrenen Artgenossen. So entstand Tradition, die Voraussetzung von Kultur. Mit der Fähig-
keit zur Kultur haben die Menschen als einzige Lebewesen eine kulturelle Evolution durch-
laufen, um Informationen zu erwerben, zu vermehren und an die nächste Generation wei-
terzugeben.
Die Kulturelle Evolution ist schnell und anpassungsfähig durch ihren horizontalen Informati-
onsfluss. Durch die Entwicklung der Sprache und später durch die Erfindung der Schrift wur-
de die Wirkung dieser Besonderheiten enorm gesteigert. Mit der Errungenschaft der Kultur
wurde der Mensch immer besser in die Lage versetzt, seine Umwelt zu verändern und den
eigenen Bedürfnissen anzupassen.
Sprache. Voraussetzung für Sprache sind der Luftraum zwischen Kehlkopfdeckel und Gau-
mensegel, die geschlossene Zahnreihe, die bewegliche Zunge und ein spezielles motorisches
Sprachzentrum im Großhirn. So konnte Sprache nur durch eine Komplexitätssteigerung des
Gehirns entstehen. Wann und unter welchem Selektionsdruck sich die Wortsprache der
Menschen entwickelt hat, ist unbekannt.
Werkzeuge. Schon die Australopithecinen benutzten vermutlich Steine oder Stücke als
Werkzeuge, ähnlich wie es heute lebende Menschenaffen tun. Doch die systematische Her-
stellung und Verwendung von Werkzeugen setzt erst mit dem Auftreten der Gattung homo
ein. Damit könnte in Beziehung stehen, dass bei diesen Frühmenschen die zuvor auf Kraft-
wirkung ausgerichtete Greifhand zur vielfältig einsetzbaren Universalhand wird und der Kau-
apparat an Bedeutung für die Zerkleinerung der Nahrung verliert und reduziert wird.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
e. Paläoanthropologie als Wissenschaft
Die Paläoanthropologie befasst sich mit den Ursprüngen des Menschen und den Ursachen
seiner Evolution. Dabei ist sie auf die scharfsinnige Auswertung fossiler Zeugnisse angewie-
sen.
Fossilien
Werkzeugfunde
Fundstättenanalyse
f. Frühe Fossilgeschichte des Menschen: Ursprung der Hominiden,
„Lucy“, Altersbestimmung mithilfe der Kalium-Argon-Methode
Ursprung der Hominiden. 25 bis
9 Millionen Jahre alte Fossilfun-
de aus Europa und Afrika, die
man als Dryopithecinen zusam-
menfasst, gelten als Stamm-
gruppe aller Hominiden. Etwa 7
Millionen Jahre alt ist der Schä-
del von Sahelanthropus tcha-
densis, dessen Einzelteile 2001
von einer Forschergruppe im
Tschad gefunden und zusam-
mengesetzt wurden. Mit relativ
kleinen Eckzähnen und kurzer
Schnauze zeigt er bereits
menschliche Merkmale. Der auf-
rechte Gang wird bei ihm bereits
vermutet. Da er aber ein Einzel-
fund ist, ist eine sichere Einord-Abb. 36: Merkmale menschlicher Vorfahren und des rezenten Menschen

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
nung in die Verwandtschaft des Menschen nicht möglich.
Lucy. Lucy gehört zu den Prähomininen, also den Vormenschen. Als Vormenschen werden
Formen bezeichnet, die noch nicht alle Merkmale der echten Menschen besaßen und keine
Werkzeuge bearbeiteten. Lucy gehört der Verwandtschaftsgruppe Australopithecus afaren-
sis an. Lucy konnte nachweislich aufrecht gehen und sie gilt als Mosaikform, also als eine
Übergangsform.
Altersbestimmung mithilfe der Kalium-Argon-Methode. Mithilfe der Kalium-Argon-
Methode kann man das Alter vulkanischen Gesteins bestimmen. Sie beruht darauf, dass ra-
dioaktives Kalium 40K mit einer Halbwertszeit von 1,3 Milliarden Jahren zu Argon 40Ar zerfällt.
Da bei einem Vulkanausbruch das Argon aus dem geschmolzenen Gestein entweicht, ist
frisch erstarrte Lava frei davon. Durch Zerfall von radioaktivem Kalium im Gestein entsteht
neues Argon, sodass man durch die Berechnung des Argon-Gehaltes in der Lava das Alter
berechnen kann.
g. Jüngere Fossilgeschichte des Menschen: Neandertaler, Homo sapiens,
Homo florensis
Neandertaler. Die Bezeichnung geht auf den ersten Fund im Neandertal bei Düsseldorf zu-
rück. Das Alter von Fossilfunden beträgt zwischen 30 000 und 130 000 Jahren. Der Neander-
taler wurde bis zu 1,60 m groß, wog bis zu 80 kg und hatte mit 1 200 bis 1 750 cm³ ein Hirn-
volumen, das größer sein konnte als das des modernen Menschen. Er hatte einen muskulö-
sen Körperbau, massivere Knochen, eine flache Stirn, Überaugenwülste und ein fliehendes
Kinn. Er war als Jäger an ein eiszeitliches Leben angepasst und bestattete zumindest gele-
gentlich seine Toten. Bis sie vor 30 000 Jahren spurlos verschwanden, lebten sie mit den
modernen Menschen einige Tausend Jahre nebeneinander.
Homo sapiens. Durch Artumbildung entwickelte sich aus afrikanischen Populationen des
Homo erectus der Homo sapiens. Altertümliche Formen mit großem Gehirn und flachem
Gesicht erwarben vor etwa 260 000 Jahren nach und nach immer mehr Eigenschaften, die
für den modernen Menschen typisch sind. Funde aus Äthiopien gelten mit 195 000 Jahren

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
als die ältesten Fossilien von Homo sapiens. Etwa zur gleichen Zeit nahm die Kreativität bei
der Werkzeugherstellung schnell zu. Gegenwärtig vertritt die Mehrzahl der Forscher die An-
sicht, dass alle heutigen Menschen von einer kleinen Gruppe von Afrikanern abstammen, die
sich beginnend vor 100 000 Jahren von Afrika aus über die ganze Welt verbreitete. Gegen
Ende der Eiszeit, vor rund 40 000 Jahren, wanderte eine Teilpopulation auch in Europa ein.
Homo florensis. Homo floresiensis („Mensch von Flores“) ist eine ausgestorbene, sehr
kleinwüchsige Art der Gattung Homo. Die im September 2003 auf der indonesischen Insel
Flores entdeckten und dieser Art zugeordneten Knochenfunde wurden 2004 in der Erstbe-
schreibung auf „mindestens 18.000 Jahre“ datiert. Während die Nachbarinseln schon seit
mehreren tausend Jahren vom modernen Menschen
(Homo sapiens) besiedelt waren, lebte auf Flores
demnach noch eine zweite Homo-Art. Wie eng die
Verwandtschaft von Homo floresiensis mit anderen
Arten der Gattung Homo ist, ist unter Anthropologen
und Paläoanthropologen umstritten. Von seinen Ent-
deckern wurde Homo floresiensis bereits 2004 als so
genannte Inselverzwergung stammesgeschichtlich von
Homo erectus abgeleitet. Andere Forscher vermute-
ten, es könne sich um eine krankhaft veränderte Po-
pulation von Homo sapiens gehandelt haben. Die
jüngsten Befunde – darunter eine neuerliche genaue
Beschreibung aller Knochen des Schädels – „deuten
jedoch darauf hin, dass Homo floresiensis eine klar
unterscheidbare Art“ war.
h. Stammbaum der Hominiden
Die rechte Abbildung zeigt den Stammbaum der Ho-
miniden. Auffällig ist, dass vieles noch ungeklärt ist,
Abb. 37: Stammbaum der Hominiden

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
was durch gestrichelte Linien kenntlich gemacht wurde. So ist ersichtlich, dass die Evolution
des Menschen noch immer rätselhaft ist.
a. Ursprung des Menschen: Out-Of-Africa-Modell, multiregionales Mo-
dell
Out-Of-Africa-Hypothese. Sie be-
sagt, dass der Homo sapiens vor
etwa 160 000 Jahren in Afrika ent-
standen ist. Der Homo sapiens ver-
ließ vor ca. 100 000 Jahren Afrika
und es gab zwei große Wande-
rungswellen. Homo sapiens der
zweiten Welle verdrängte schließlich
Homo erectus-Populationen der 1.
Welle.
Multiregionales Modell. Es geht
davon aus, dass Homo sapiens sich
an verschiedenen Orten der Erde
parallel aus Homo erectus entwickelt hat. In Kontaktzonen kam es dabei regelmäßig zum
Genaustausch.
Abb. 38: Multiregionales Modell und Out-Of-Africa-Hypothese

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Literatur- und Quellenverzeichnis
>unbekannt<. (2008). Abgerufen am 14. Februar 2012 von Evolution Mensch:
http://www.evolution-mensch.de/thema/siedlung/hypothesen.php
>unbekannt<. (2010). Abgerufen am 10. März 2012 von GeoDataZone:
http://www.geodz.com/deu/d/images/1909_taphonomie.png
>unbekannt<. (2010). Abgerufen am 11. März 2012 von GeoDataZone:
http://www.geodz.com/deu/d/images/1994_leitfossil.png
>unbekannt<. (2011). Abgerufen am 13. März 2012 von Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Plesiomorphie
>unbekannt<. (2011). Abgerufen am 13. März 2012 von Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Apomorphie
Beck, E.-G. (2006). Abgerufen am 12. Februar 2012 von Zentrale für Unterrichtsmedien im
Internet e.V.: http://www.zum.de/Faecher/Materialien/beck/bilder/!page39.jpg
Born, A., Brott, A., Dr. Engelhardt, B., Dr. Esders, S., Dr. Gnoyke, A., Gräbe, G., et al. (2009).
Biologie Oberstufe. Berlin: Cornelsen Verlag.
Brown, P. (3. März 2004). A new small-bodied hominin from the Late Pleistocene of Flores,
Indonesia. Nature, S. 1055-1061.
Brüggemeier, M. (2009). Top im Abi - Abiwissen kompakt: Biologie. Braunschweig: Schroedel
Verlag.
Dr. Arlt, S. (2011). Abgerufen am 31. Oktober 2011 von Fronter:
https://nrwir.de/regioit/links/files.phtml/308433955$855016608$/Unterrichtsmateri
alien/13.1+Quartal+1/Synthetische+Evolutionstheorie
Dr. Arlt, S. (2011). Abgerufen am 1. November 2011 von Fronter:
https://nrwir.de/regioit/links/files.phtml/308433955$855016608$/Unterrichtsmateri

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
alien/13.1+Quartal+1/Folien_prcent_3A+Was+ist+eine+Art_prcent_3F+_prcent_28G
k_prcent_29
Dr. Arlt, S. (2011). Abgerufen am 14. März 2012 von Fronter:
https://nrwir.de/regioit/links/files.phtml/308433955$855016608$/Unterrichtsmateri
alien/13.1+Quartal+2/Folien+Homologie+Analogie+Konvergenz+Divergenz
Dr. rer. nat. Bacchus, C., Bauer, T.-W., Prof. Dr. rer. nat. habil. Buselmaier, W., Prof. Dr. rer.
nat. Keil, M., & Priv.-Doz. Dr. med. Tariverdian, G. (2004). Fischer Abiturwissen
Biologie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
Dr. rer. nat. Groth, J. (2004). Meine Moleküle Deine Moleküle - Von der molekularen
Individualität. Berlin: Rhombos-Verlag.
Erdmann, U., Dr. Paul, A., & Polzin, C. (2010). Materialien SII - Biologie: Evolution.
Braunschweig: Schroedel Verlag.
Hall, D. (2006). Abgerufen am 31. Oktober 2011 von Wikipedia:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Chromosomal_Recombinatio
n.svg
Hepp, M. (2001). Abgerufen am 14. Februar 2012 von Michael Hepps Homepage:
http://www.michelhepp.de/umaterial/humanevol/aufrechtergang/aufrechtergang.h
tm
Jakob, J. (kein Datum). Abgerufen am 14. März 2012 von Biologie-Lernprogramme.de:
http://biologie-
lernprogramme.de/daten/programme/js/homologer/daten/img/embryonalentwicklu
ng.png
Kaifu, Y. (5. Oktober 2012). Yousuke Kaifu et al.: Craniofacial morphology of Homo
floresiensis: Description, taxonomic affinities, and evolutionary implication. Journal of
Human Evolution, S. 644.682.

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Kouprianov, A. (2006). Abgerufen am 13. März 2012 von Wikipedia:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Identical_cladograms
.svg/500px-Identical_cladograms.svg.png
Kubb, C. (2010). Abgerufen am 31. Oktober 2011 von Biologie-Schule: http://www.biologie-
schule.de/vergleich-darwin-lamarck.php
Leinfelder, R. (1998). Abgerufen am 11. März 2012 von Naturkundemuseum Berlin:
http://mfnmac053.naturkundemuseum-
berlin.de/mehr/palaeo/edu/lebfoss/ausstellung/poster/latimzeichn.jpg
Ling, W. (kein Datum). Abgerufen am 14. März 2012 von Scheffel-Gymnasium:
http://www.scheffel.og.bw.schule.de/faecher/science/biologie/evolution/2befunde/
atav1.gif
Morwood, M. (3. März 2004). Archaeology and age of a new hominin from Flores in eastern
Indonesia. Nature, S. 1087-1091.
Pätzold, J. (2009). Abgerufen am 3. November 2011 von Marum - Zentrum für marine
Umweltwissenschaften:
http://www.marum.de/Binaries/Binary15353/Erdgeschichte_101025.jpg
Reader, J. (1997). Africa: Biography of a Continent. London: Vintage.
Theobaldt, C. (2011). Abgerufen am 31. Oktober 2011 von Bio Kompakt: http://www.bio-
kompakt.de/images/stories/evolution/lamarck_system.jpg
Theobaldt, C. (2011). Abgerufen am 1. November 2011 von Bio Kompakt: http://www.bio-
kompakt.de/images/stories/evolution/wirken_der_selektion.jpg
Theobaldt, C. (2011). Abgerufen am 2. November 2011 von Bio Kompakt: http://www.bio-
kompakt.de/images/stories/evolution/allopatrische%20artbildung.jpg
Theobaldt, C. (2011). Abgerufen am 2. November 2011 von Bio Kompakt: http://www.bio-
kompakt.de/images/stories/evolution/gendrift.jpg

Biologie Grundkurs Abitur
Thema: Evolution, Autor: Christoph Hocks
Theobaldt, C. (2011). Abgerufen am 11. März 2012 von Bio Kompakt: http://www.bio-
kompakt.de/images/stories/evolution/archaeopteryx.jpg
Uhlenbrock, K., & Walory, M. (kein Datum). Schülerhilfe Abitur-Box: Biologie. Königswinter:
Tandem Verlag GmbH.