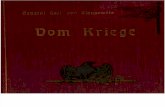Carl von Clausewitz - dtv...Howard und Peter Paret, zeichneten für die Übersetzung...
Transcript of Carl von Clausewitz - dtv...Howard und Peter Paret, zeichneten für die Übersetzung...
-
Carl von Clausewitz (1780–1831), derpreußische General und Militärtheore-tiker, zeigt in seinem Werk ›Vom Kriege‹generelle Prinzipien der Kriegsführungauf, die sich aus dem Studium der Ge-schichte und aus dem logischen Denkenergeben. Dabei bezieht Clausewitz dasimmer vorhandene psychologische Ele-ment und den unvorhersehbaren Ein-fluss des Zufalls mit ein.Sein Buch gilt bis heute als Standard-werk für Strategie und das weit über
den militärischen Bereich hinaus.
Hew Strachan, geboren in Edinburgh, war Dozent an der RoyalMilitary Academy Sandhurst, Direktor des Scottish Centre forWar Studies und Professor für Neuere Geschichte an der Uni-versity of Glasgow. Heute ist er Professor für Militärgeschichtean der University of Oxford.
»Strachan gelingt es, auch komplizierteste Zusammenhängeklar und einfach zu vermitteln.« Süddeutsche Zeitung
-
Hew Strachan über
Carl von ClausewitzVom Kriege
Aus dem Englischen vonKarin Schuler
Deutscher Taschenbuch Verlag
-
Die Reihe »Bücher, die die Welt veränderten«
Karen Armstrong über die Bibel (i.Vorb. für 2008)Simon Blackburn über Platon, Der Staat (dtv 34430)Philip Bobbitt über Machiavelli, Der Fürst (i.Vorb. für 2009)Janet Browne über Charles Darwin, Die Entstehung der Arten (dtv 34433)Christopher Hitchens über Thomas Paine, Die Rechte des Menschen (dtv 34432)Bruce Lawrence über den Koran (dtv 34431)Alberto Manguel über Homer, Ilias und Odyssee (i.Vorb. für 2009)P. J. O’Rourke über Adam Smith, Vom Wohlstand der Nationen (dtv 34459)Hew Strachan über Carl von Clausewitz, Vom Kriege (dtv 34460)Francis Wheen über Karl Marx, Das Kapital (dtv 34458)
Deutsche ErstausgabeJanuar 2008Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, Münchenwww.dtv.de© 2007 Hew StrachanTitel der englischen Originalausgabe:›Carl von Clausewitz’s On War. A Biography‹,erschienen bei Atlantic Books, an imprint of Grove Atlantic Ltd.© der deutschsprachigen Ausgabe:Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenUmschlagkonzept: Balk & BrumshagenUmschlagbild: akg-imagesFrontispiz: ullsteinbildSatz: Greiner & Reichel, KölnGesetzt aus der Concorde 8,75/11,25·
Druck und Bindung: Druckerei C.H. Beck, NördlingenGedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem PapierPrinted in Germany · ISBN 978-3-423-34460-9
-
inhalt
Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Erstes KapitelDie Realität des Krieges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zweites KapitelDie Entstehung von ›Vom Kriege‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Drittes KapitelDas Wesen des Krieges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Viertes KapitelDie Theorie des Krieges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Schluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Danksagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Anmerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Quellen und weiterführende Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Eine Anmerkung zu Ausgaben und Übersetzungen . . . . . . 156
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
-
einführung
Im Jahr 1975, sechs Jahre nach der Rückkehr von seinem letz-ten Kampfeinsatz im Vietnam, nahm der damalige ColonelColin Powell seine Ausbildung am US National War Collegeauf. Ein Jahr später brachte Princeton University Press eineneue englische Edition von Carl von Clausewitz’ ›Vom Kriege‹,oder ›On War‹, heraus, ein Buch, das auf Deutsch erstmals zwi-schen 1832 und 1834 posthum in drei Bänden erschienen war.Zwei der bedeutendsten Historiker ihrer Generation, MichaelHoward und Peter Paret, zeichneten für die Übersetzung ver-antwortlich. Howard hatte mit Auszeichnung im Zweiten Welt-krieg gekämpft – Clausewitz sprach ihn an als ein Soldat, der fürandere Soldaten schrieb. Howards Ziel war eine englische Fas-sung, die von Soldaten gelesen würde, und für den Fall, dass siees doch nicht wurde, beschloss Bernard Brodie, ein weithinstrahlender Stern am Firmament der strategischen Studien imAtomzeitalter, den Band mit einer kurzen Zusammenfassungdes Textes. Die Princeton-Ausgabe von ›Vom Kriege‹ erwiessich als weitaus erfolgreicher als das deutsche Original. Sie gabnicht nur Clausewitz’ gut lesbare und anschauliche Prosa in an-gemessener Form wieder, sondern verlieh dem Text auch eineinnere Geschlossenheit, die ihm viele Leser zuvor abgesprochenhatten. In den letzten dreißig Jahren haben vor allem amerikani-sche Soldaten Howards Hoffnungen erfüllt und Clausewitz’Buch wirklich gelesen.
Einer von ihnen war Colin Powell. Er schrieb: »Sein WerkVom Kriege, 106 Jahre vor meiner Geburt geschrieben, war wieein Lichtstrahl aus der Vergangenheit, der auch militärischeProbleme der Gegenwart erhellte.« Bestürzt über den innerenZerfall seiner geliebten Armee in Vietnam und beunruhigt durchdie Kluft, die sich zwischen ihr und der Gesellschaft, der siediente, aufgetan hatte, fand er in ›Vom Kriege‹ Erklärungen fürdie offenkundigen Fehler der militärischen und politischen Füh-
-
rung. »Clausewitz’ wichtigste Lehre für Militärs war, dass derSoldat, bei allem Patriotismus, Mut und Können, lediglich einElement einer Troika ist. Wenn nicht alle drei Pferde mitziehen,Militär, Regierung und Volk, muss das Unternehmen scheitern.«1
Im Jahr 1983 wurde Powell leitender militärischer Assistentvon Caspar Weinberger, dem Verteidigungsminister im Kabinettvon Ronald Reagan. Weinberger war wie Powell entschlossen,die Armee wieder zu stärken, und auch er fand Anregungendazu in ›Vom Kriege‹. Im November 1984 formulierte er Krite-rien für den Einsatz amerikanischer Soldaten im Ausland: »WieClausewitz schrieb: ›Niemand beginnt einen Krieg – oder viel-mehr niemand sollte vernünftigerweise einen Krieg beginnen –,ohne sich zunächst darüber klar zu werden, was wer mit diesemKrieg erreichen will und wie er ihn führen will.‹«2 Die Tatsache,dass man dies in Vietnam unterlassen hatte, war in Powells Wor-ten »Fehler Nummer eins in Vietnam. Was zu Clausewitz’ RegelNummer zwei führt: Die politische Führung muss ein Kriegszielvorgeben, während die Armee es zu erreichen versucht.«3
Eben weil Clausewitz die Beziehung zwischen Krieg und Poli-tik anscheinend so klar beschrieb, fühlten Powell und Weinber-ger sich von ihm angezogen. Im Jahr 1989 geriet der politischeKontext durch den Zusammenbruch der Sowjetunion allerdingsins Wanken – die klaren politischen Ziele lösten sich in Luft auf.Gerade in dieser Phase, als das Militär der Vereinigten Staatenplötzlich ohne ebenbürtigen Gegner dastand, wurde Powell zumChef des Generalstabs ernannt. 1992, als die bosnischen Serbenim ehemaligen Jugoslawien Muslime abschlachteten, fordertedie amerikanische Öffentlichkeit eine militärische Interventionder Regierung. Powell jedoch berief sich auf die Weinberger-Doktrin, er betonte die Notwendigkeit klarer politischer Ziele,bevor amerikanische Bodentruppen auf den Balkan geschicktwerden konnten. Aber er ging noch weiter: Er lehnte den Ein-satz »begrenzter Gewalt« ab und erklärte, dass »entscheiden-de Mittel und Resultate immer vorzuziehen« seien.4 Auch dieseEinstellung war ihrem Ursprung nach von Clausewitz abzu-leiten.
Als Reaktion auf die Niederlage in Vietnam hatte auch einUmdenken eingesetzt, was die Kriegsführung auf operativer Ebe-
8 einführung
-
ne anging, ein Prozess, bei dem das deutsche Heer als Vorbilddiente. Zwischen 1871 und 1945 hatte der deutsche Generalstabeine sogenannte »Vernichtungsstrategie« propagiert, der zufolgeder Sieg auf dem Schlachtfeld so entscheidend und so schnellfallen sollte, dass er die Politik vor vollendete Tatsachen stellte.Auch diese Idee lässt sich auf Clausewitz zurückführen. In derPowell-Doktrin aus dem Jahr 1992 kamen also zwei Aspekte zu-sammen – zum einen der politische Zweck des Krieges und zumanderen die Kriegführung an sich –, die beide ihre Ursprüngebei Clausewitz hatten. In dem darauffolgenden Jahrzehnt kon-zentrierte sich die US-Armee, die sich ihrer militärischen Über-legenheit immer stärker bewusst wurde, auf den zweiten As-pekt – »entschlossener Mitteleinsatz und Resultate« – und ließden ersten darüber fast völlig außer Acht. Die Planung des Irak-krieges von 2003 offenbarte, dass eine modernisierte Versionder deutschen »Vernichtungsstrategie« Clausewitz’ »Regel Num-mer eins« einschloss, wie ironischerweise gerade Colin Powell,nun selbst Außenminister, feststellen musste. Tommy Franks,Oberbefehlshaber des Zentralkommandos der Vereinigten Staa-ten, strebte fast schon stur nach schnellem operativem Erfolgauf Kosten der langfristigen politischen Ziele. Seiner Ansichtnach »hat der preußische Stratege Carl von Clausewitz in seinenGrundsätzen festgelegt, dass Masse – konzentrierte Formatio-nen von Soldaten und Waffen – der Schlüssel zum Sieg sind. Umden Sieg zu erlangen, so riet Clausewitz, muss eine Militärmachtihre Kräfte am ›Schwerpunkt des Feindes‹ zusammenziehen.«5
Franks und seinesgleichen verstanden sich selbst als Verfeine-rer von Clausewitz, nicht als Gegner seiner Theorie. Andere je-doch – jene, in deren Augen Desert Storm eine im Grunde intel-lektuell überholte, rückwärtsgewandte Aktion war – hielten›Vom Kriege‹ für nicht mehr relevant. Sie entdeckten Verände-rungen nicht nur im Charakter des Krieges, sondern sogar in sei-nem tiefsten Wesen. 1991 veröffentlichte etwa der israelischeMilitärhistoriker Martin van Creveld ein Buch mit dem Titel›Die Zukunft des Krieges‹, nach Meinung seines amerikani-schen Verlags die »radikalste Neuinterpretation des bewaffne-ten Konflikts seit Clausewitz«. Seit dem Ende des Kalten Krie-ges war die Clausewitz’sche Grundannahme, dass Krieg ein
einführung 9
-
Gewaltakt sei, um die Ziele der Politik durchzusetzen, immerstärker in Frage gestellt worden. Clausewitz, so das Argument,setzte den Krieg mit dem Staat gleich, nicht zuletzt deshalb, weiler davon ausging, dass nur Staaten Politik machen. Viele Kon-flikte der Zeit nach 1990 wurden dagegen unter nichtstaatlichenAkteuren ausgetragen. Einige von ihnen kämpfen für politischeZiele, setzen aber nicht jene Art von Heer ein, die Clausewitzbeschrieb: Stattdessen sind ihre Werkzeuge Guerillas und Terro-risten. Andere führen den Krieg nicht aus politischen Beweg-gründen heraus, sondern nutzen den Konflikt, um organisierteKriminalität, Drogenhandel oder Geldwäsche dahinter zu ver-stecken. Ihr Ziel ist nicht der Frieden (wie bei Clausewitz), son-dern eine Ausweitung des Krieges. Gegen Ende des Jahrtau-sends könnte van Creveld mit guten Gründen darauf pochen,dass er Recht gehabt habe. Mary Kaldors ›Neue und alte Kriege‹,1999 im amerikanischen Original und ein Jahr später auf Deutscherschienen, unterschied dann auch zwischen »alten Kriegen«,jenen, die Clausewitz untersucht hatte, und den »neuen Kriegen«der Kriegsherren auf dem Balkan, in deren Interesse eine Fort-setzung des Konflikts lag, nicht sein Ende. Für van Creveld undKaldor war Bosnien das beste Beispiel für das, was aus dem Krieggeworden war, und Powell – der die Vereinigten Staaten ausdiesem Konflikt heraushielt, weil er einen alten Krieg führenwollte – sah sich in ein typologisches Chaos verstrickt, für dasClausewitz verantwortlich zeichnete. Van Creveld nahm Anstoßan dem, was er das »Clausewitzsche Universum« nannte, nichtnur, weil es auf der Annahme beruht, dass Krieg vor allem vonStaaten, oder, um genau zu sein, von Regierungen geführt wird,sondern auch, weil Clausewitz’ Vorstellung des Krieges »trini-tarisch« ist. Wie Powell beschrieb van Creveld Clausewitz’»Dreifaltigkeit« als das Zusammenspiel von Volk, Regierung undArmee. Wie wir sehen werden, entspricht das nicht ganz Clau-sewitz’ Vorstellungen. Es ist vielmehr noch zu fragen, wie zentraldiese Trinität überhaupt für das Gesamtbild des Krieges war, das›Vom Kriege‹ prägt, und auch die Beziehung zwischen Kriegund Politik sowie die Frage, was genau Clausewitz unter Politikverstand, bedarf weiterer Prüfung.
Meinungsstreit ist für Clausewitz nichts Neues, ja, er selbst
10 einführung
-
hatte ihn mit voller Absicht provoziert. In ›Vom Kriege‹ hatte ersich einen leichten und einen schwierigen Kontrahenten dafürausgesucht. Leicht war die Auseinandersetzung mit einem Offi-zier des preußischen Heeres, Dietrich Adam Heinrich von Bü-low, der – nicht immer besonders erfolgreich – versucht hatte,die Auswirkungen der Französischen Revolution von 1789 aufdie Kriegführung zu erklären. Bülow wurde 1806 für geistes-krank erklärt und starb ein Jahr später. Er konnte also seine Po-sition im Jahr 1832 nicht verteidigen. Anders lag der Fall bei An-toine-Henri Jomini, der erst 1869 im Alter von neunzig Jahrendas Zeitliche segnete. Wenn das moderne strategische Denkenseine Wurzeln im 19. Jahrhundert hat, dann kann der SchweizerJomini eigentlich mit größerem Recht Anspruch auf dessen Vater-schaft erheben als Clausewitz. Jomini diente zwischen 1805 und1813 als Stabsoffizier in der napoleonischen Armee, brachtewährenddessen immer wieder seine Gedanken zu Papier undwidmete den Rest seines Berufslebens der Ausarbeitung seinerÜberlegungen zur Kriegführung. Die Militärakademien undStabsschulen, die in seiner Zeit wie die Pilze aus dem Bodenschossen und an sich schon Symptome des wachsenden profes-sionellen Selbstverständnisses der Soldaten waren, erwiesensich als bereitwillige Abnehmer seiner Regeln.
Clausewitz führte in ›Vom Kriege‹ nur einige wenige, flüchti-ge Hiebe gegen Jomini und widerlegte dessen Grundprinzipien.In anderen Werken jedoch konnte er sehr viel deutlicher wer-den. In einem Essay, den er 1817 verfasste, kritisierte ClausewitzBülow wie auch Jomini für ihre »phantastischen und einseitigenSysteme«.6 Zu Clausewitz’ letzten historischen Arbeiten gehör-te eine Darstellung des französischen Feldzugs von 1796 gegendie Österreicher in Italien, bei dem der junge Napoleon zum ers-ten Mal sein militärisches Genie offenbart hatte. Der Feldzugwurde zum Ausgangspunkt für Jominis Analyse der neuen Me-thoden Napoleons, mit denen dieser den Krieg im Vergleich zuseinen Vorgängern im 18. Jahrhundert verändert habe. Clause-witz sagte dazu auf der ersten Seite seiner eigenen Darstellung,dass Jominis »Erzählung dürftig [ist], lückenhaft, dunkel, wider-sprechend, kurz alles, was eine bündige Darstellung der Ereig-nisse in ihrem Zusammenhange nicht sein sollte«.7
einführung 11
-
Aller Wahrscheinlichkeit nach war Clausewitz Jomini nochgar kein Begriff, bevor diese Worte im Jahr 1833, zwei Jahrenach Clausewitz’ Tod, veröffentlicht wurden. Doch Jomini nahmdie Herausforderung an: 1838 erklärte er im Vorwort zu seinem›Précis de l’art de la guerre‹, das aufgrund seiner Lehrbuch-Qua-litäten noch heute als Vorbild für Arbeiten zur Strategie heran-gezogen wird, dass Clausewitz eine »gewandte Feder« führe.»Aber diese«, so fuhr Jomini fort, »zuweilen etwas vagabondi-render Statur, ist vor Allem ein wenig zu anspruchsvoll für eindidaktisches Werk, in welchem Einfachheit und Klarheit daserste Erforderniss sind. Ausserdem zeigt sich der Autor etwas zuskeptisch in Bezug auf die Kriegswissenschaft. Sein erster Bandist nichts als Deklamation gegen jede Kriegstheorie, währenddie beiden folgenden voll theoretischer Grundsätze stecken, dieden Beweis liefern, daß der Verfasser an den Nutzen seiner Leh-ren, wenn auch nicht an den anderer glaubt. Was mich betrifft,so habe ich in diesem gelehrten Labyrinth nur eine kleine Zahlerleuchteter Gedanken und hervorragender Aufsätze findenkönnen, und weit entfernt, die Zweifelsucht des Verfassers zutheilen, würde mich kein Werk mehr als das seinige die Noth-wendigkeit einer guten Theorie haben fühlen lassen.«8
Jominis Kritik an Clausewitz ist es wert, so ausführlich zitiertzu werden, gerade weil sie nie ganz widerlegt wurde. Zwischen1834, als der letzte der drei Bände von ›Vom Kriege‹ heraus-kam, und 1871 wurde Clausewitz außerhalb seiner Heimat Preu-ßen kaum gelesen. Ein Grund bestand darin, dass das Werk aufDeutsch verfasst war und damit in einer Sprache, die den Gebil-deten Europas weniger zugänglich war als das Französische.Der belgische Artillerieoffizier Neuens übersetzte ›Vom Kriege‹schließlich zwischen 1849 und 1851 ins Französische, und LaBarre Duparcq, ein Ausbilder an der französischen Militäraka-demie St. Cyr, verfasste 1853 einen Kommentar zu dem Text. Du-parcqs Ansichten spiegelten die von Jomini wider. Seiner Mei-nung nach enthielt ›Vom Kriege‹ viele Einsichten, verbreiteteaber falsche Urteile, und zudem mangelte es dem Werk an Klar-heit. Clausewitz’ preußischen Landsleuten standen viele andereBücher zur Verfügung, die in der Konzeption allerdings nicht anClausewitz’ Anspruch heranreichten. Als der Verleger von ›Vom
12 einführung
-
Kriege‹ sich 1853 zu dem ambitionierten Entschluss durchrang,eine zweite, verbesserte Auflage herauszubringen, war die ersteAuflage mit 1500 Exemplaren noch nicht verkauft. 1857 verglichder damals sehr bekannte Militärschriftsteller Wilhelm RüstowClausewitz mit Thukydides und sagte, er sei ein »Gut für alleZeiten«, räumte allerdings auch ein: »Clausewitz wird viel ge-nannt, ist aber sehr wenig gelesen«.9
Weder Jominis noch Rüstows Urteil hat je an Wirkung ver-loren. Doch Preußens verblüffende und schnelle Siege überÖsterreich im Jahr 1866 und über Frankreich 1870/71, die in derdeutschen Reichsgründung kulminierten, führten zur erstenwirklichen Entdeckung von Clausewitz. Das deutsche Heerwurde nun zum Modell für Europa, und Clausewitz galt als seinVordenker. ›Vom Kriege‹ wurde 1873 von J. J. Graham ins Eng-lische übersetzt. Vier weitere deutsche Editionen erschienen vordem Ersten Weltkrieg, die insgesamt fünfte kam 1905 sogar miteinem Vorwort des Generalstabschefs Alfred von Schlieffen he-raus. Sechs Ausgaben wurden während des Krieges veröffent-licht, dazu eine Unmenge gekürzter Fassungen und Auszüge inHandbüchern.
Die Gründe dafür sind nicht ganz klar. In hohem Alter zählteder Architekt der preußischen Kriege, Helmuth von Moltke,›Vom Kriege‹ zu der Handvoll Bücher, die ihn beeinflusst hat-ten, zusammen mit den in diesem Kontext üblichen Werken wieder Bibel und den Epen Homers. Es galt deshalb als erwiesen,dass Clausewitz Moltkes »Lehrmeister« gewesen sei, obwohl eskeinen Beleg dafür gibt, dass sich ihre Wege gekreuzt hätten, alsMoltke in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts die Kriegs-schule besuchte; Clausewitz war damals zwar Direktor der Aka-demie, unterrichtete aber nicht selbst. Als Chef des Generalstabsbildete Moltke seine Offiziere später durch praktische Übungenwie Geländeritte und Manöver aus, nicht durch theoretischeWerke. Wenn Moltke überhaupt etwas aus ›Vom Kriege‹ über-nahm, so waren es sicher nicht die Thesen zur Beziehung zwi-schen Krieg und Politik oder zu dessen »dreifaltigem« Wesen,wie Colin Powell oder Martin van Creveld es später verstanden.Bekanntermaßen wies Moltke die Versuche des preußischenMinisterpräsidenten (und ersten deutschen Kanzlers) Otto von
einführung 13
-
Bismarck zurück, den Primat der Politik im Krieg zwischenFrankreich und Preußen durchzusetzen, und zwar mit dem Ar-gument, der Einfluss der Politik sei nur bei der Eröffnung unddem Ende eines Konfliktes entscheidend.
Preußen fügte Napoleon III. bei Sedan am 1. September 1870eine vernichtende Niederlage zu, und doch zog sich der Kriegbis zum 10. Mai 1871 hin, denn nach dem Sturz Napoleons führ-te die Dritte Republik einen Krieg des nationalen Widerstands.Moltke erkannte nach dieser Erfahrung mit dem Volkskrieg nichtetwa das »dreifaltige« Wesen des Krieges an, sondern er leugne-te es umso heftiger – er verkündete, dass die Guerilla-TruppenFrankreichs sich über die Gesetze des Krieges hinwegsetzten,und bekräftigte, dass zumindest in Deutschland das Heer, auchwenn es eine Armee von Wehrpflichtigen war, ein Ethos pflegensollte, das nicht vom Volk, sondern von der Monarchie und ih-rem Offizierscorps ausging.
Gerhard Ritter, der große Historiker des deutschen Militaris-mus, kam zu dem Schluss, dass Moltkes Konzeptionen, »trotzihrer bewußten Anlehnung an gewisse Formulierungen Carl vonClausewitz’, eine deutliche Abkehr von dessen Grundanschau-ungen« enthalten. Während der Belagerung von Paris im Winter1870/71, als sich die Krise zwischen Bismarck und Moltke zu-spitzte, erklärte Moltke, dass »politische Momente nur insoweitBerücksichtigung finden [können], als sie nicht etwas militärischUnzulässiges oder Unmögliches fordern«.10 Diese Meinung warnun wirklich nicht vereinbar mit eben jenen Teilen von ›VomKriege‹, auf die sich Ritter und nachfolgende Kommentatorenkonzentrierten – also das erste und das letzte der acht Bücher,besonders das erste Kapitel des ersten Buches. Hier findet sichdie zwingendste Beschreibung der Beziehung zwischen Kriegund Politik, und dieses Kapitel endet auch mit der Beschreibungder »Dreifaltigkeit«. Moltke und seine Zeitgenossen lasen dieanderen Bücher von ›Vom Kriege‹ ebenso aufmerksam, wennnicht noch gründlicher, gerade weil sie die NapoleonischenKriege beschrieben, deren Paradigma (nicht zuletzt dank Jomi-ni) das militärische Denken bis 1914 bestimmte. Die Kriege derdeutschen Einigung von 1866 und 1870/71 waren kurz, heftigund in ihrem Ergebnis eindeutig. Das war ein Ideal, das Clause-
14 einführung
-
witz und Napoleon teilten. Die Schlacht prägte die Strategie.Moltke und seine unmittelbaren Nachfolger verstanden unterStrategie rein militärische Überlegungen, also eher das, was wirheute als »die operative Ebene des Krieges« bezeichnen. Aufdiesem Feld fanden zwischen 1871 und 1914 die wichtigsten De-batten zur Militärtheorie statt. Strategie war das, was die Gene-rale und ihre Stäbe taten (und sie waren schließlich die vorran-gige Zielgruppe eines dicken Buches über den Krieg); Strategieprägte ihre Manöver und Übungen; und Strategie lenkte die Plä-ne, mit denen sie sich 1914 in die kriegerische Auseinanderset-zung stürzten. 1866 und 1870 hatte Moltke durchschlagendeErfolge errungen, weil seine Heere auf dem Schlachtfeld vonverschiedenen Richtungen heranmarschierten und seine Geg-ner so von der Flanke und vom Rücken her wie auch von vorneangriffen. Napoleon hatte, vor allem bei seinen frühen Feldzü-gen in Italien, das Gleiche getan, und doch war Clausewitz keinFreund der sogenannten Umfassung. Darin waren er und Jomi-ni sich einig, und letzterer – der immerhin den Krieg von 1866noch erlebte, wenn auch nicht mehr den von 1870/71 – kritisier-te Preußens Kriegführung gegen Österreich aus ebendiesemGrund. Moltke zog ›Vom Kriege‹ heran, weil er sich mit klassi-scher Strategie, nicht mit Politik beschäftigte und sie modifizie-ren wollte. Eine der wenigen Passagen, in denen er Clausewitzdirekt zitierte, schloss Moltke 1871 mit den Worten: »Generalvon Clausewitz … sagte: ›Strategie ist der Gebrauch des Ge-fechts zum Zweck des Krieges‹. Tatsächlich bietet die Strategieder Taktik die Mittel zum Kämpfen und die Wahrscheinlichkeitdes Sieges durch die Lenkung der Heere und ihr Zusammentref-fen auf dem Kampfplatz. Andererseits macht sich die Strategieden Erfolg jedes Gefechts zu eigen und baut darauf auf. Die For-derungen der Strategie verstummen im Angesicht eines takti-schen Sieges und passen sich der neu geschaffenen Situationan.«11
In den Augen Moltkes und seiner Nachfolger ging es in ›VomKriege‹ ebenso sehr um die Beziehung zwischen der Taktik, alsodem, was Heere auf dem Schlachtfeld tun, und der Strategie,also der Verwendung der Ergebnisse, die sie auf dem Schlacht-feld erzielen, wie um die Beziehung zwischen Krieg und Politik.
einführung 15
-
Und damit hatten sie gar nicht so unrecht. Vor allem Clausewitz’Beschäftigung mit Themen der Moral und des Mutes, des Wil-lens und der Einsicht schien unter den taktischen Bedingungendes späten 19. Jahrhunderts noch wichtiger als zu Beginn desJahrhunderts. Die Industrialisierung hatte das Schlachtfeld ineine einzige Feuerzone verwandelt, die von Hinterladern, Ge-wehren, Maschinengewehren und Schnellfeuerwaffen mit Ge-schossen überzogen wurde. Und sie hatte die Bevölkerung vomLand in die großen Städte gezogen. Dort brachte die Kombina-tion aus Slums, lasterhaften Freizeitvergnügungen und urbanerDekadenz, so hieß es, Menschen hervor, die den Härten desKrieges weder körperlich noch seelisch gewachsen waren.
Frankreichs kurze Liebesaffäre mit Clausewitz offenbarte die-se Punkte noch deutlicher. Frankreich hatte als Verlierer von1871 mehr Grund, sich mit den Quellen des deutschen Erfolgeszu beschäftigen, als Deutschland selbst. 1885 hielt Lucien Cardoteine Vorlesung über Clausewitz an der École supérieure de guer-re, und 1886/1887 brachte Lieutenant Colonel de Vatry eine neueÜbersetzung von ›Vom Kriege‹ heraus, die bezeichnenderweisenur die Bücher 3 bis 6 umfasste, eben jene, die sich vor allem mitder napoleonischen Kriegführung befassten und in denen VatrysAnsicht nach die strategischen Prinzipien besonders klar hervor-traten. Das waren eben nicht die Bücher, die Colin Powell so be-eindruckten oder die Martin van Crevelds »ClausewitzschesUniversum« stützten. Vatry machte sich auch daran, den Restvon ›Vom Kriege‹ zu übertragen, aber interessanterweise meintegerade der damals bekannteste französische Clausewitz-Kenner,Georges Gilbert, er hätte sich die Mühe nicht machen müssen.Gilbert erklärte, dass Clausewitz’ Theorie sich eigentlich in dreiGesetzen zusammenfassen lasse: Handle gleichzeitig mit allenzusammengezogenen Kräften; handle schnell und meist mit ei-nem direkten Schlag; und handle ohne Unterbrechung.12
Unter Cardots und Gilberts Zuhörern an der École de guerrewar auch der Mann, der 1918 die vereinigten französischen, bri-tischen und amerikanischen Truppen an der Westfront komman-dieren sollte – Ferdinand Foch. In einer Reihe von Vorträgen ander École de guerre sagte Foch im Jahr 1901, die Niederlage von1871 habe bei den Franzosen die Erkenntnis geweckt, dass das
16 einführung
-
Wesen des Krieges durch die Geschichte zu verstehen sei, dassClausewitz diese Methode benutzt habe und dabei »im Buch derGeschichte, sorgfältig untersucht«, »die lebendige Armee« ge-funden habe, »Soldaten in Bewegung und Handeln, mit ihrenmenschlichen Bedürfnissen, Leidenschaften, Schwächen, Entsa-gungen, Fähigkeiten aller Art«. Moralische Stärke und Willens-kraft seien entscheidend für den Sieg. Weil allerdings beide Sei-ten in diesen Punkten die Überlegenheit anstrebten, werde derFeind »sich erst dann geschlagen geben, wenn er nicht mehrkämpfen kann, wenn also sein Heer materiell und moralischvernichtet ist«. »Deshalb«, so konnte Foch schließen, »kann dermoderne Krieg nur jene Auseinandersetzungen zulassen, die zuder Vernichtung jenes Heeres führen: nämlich die Schlacht, dieUnterwerfung durch Gewalt.«13 Clausewitz selbst hatte sichähnlich geäußert, wie Foch durch direkte Zitate belegte.
Dies war der Clausewitz, an dem der britische Militärkom-mentator Basil Liddell Hart nach dem Ersten Weltkrieg so star-ken Anstoß nehmen sollte. Im Krieg setzte Foch das, was er pre-digte, in die Tat um, zumindest aber distanzierte er sich niedavon. Foch, so schrieb Liddell Hart 1931 in einer Biografie desfranzösischen Marschalls, »hatte nur Clausewitz’ schrille Gene-ralisierungen aufgegriffen, nicht dessen leisere Untertöne«. Lid-dell Harts Clausewitz war also durch die Generale des ErstenWeltkriegs vermittelt. In seiner Kritik an Foch deutete er zwar an,dass es auch einen anderen Clausewitz gebe, doch falls er daswirklich glaubte, so äußerte er sich jedenfalls nie explizit dazu. InLiddell Harts Vorstellung lag der Kern des Problems nicht beiFoch, sondern bei Clausewitz selbst: »Clausewitz’ gewichtigeBände sind so massiv, dass sie mentale Verstopfung bei jedemStudenten hervorrufen, der sie ohne einen langen Vorbereitungs-kurs in sich hineinstopft. Nur ein durch jahrelange Studien undReflexionen geschulter Geist kann diesen massiven Klotz in ver-dauliche Teile aufbrechen«.14 In seinen Lees Knowles Lectures*,
einführung 17
* 1912 an der Universität Cambridge etablierte Vorlesungsreihe, die vonangesehenen Experten der Militär- und Seegeschichte abgehalten wird.Als Vortragender ausgewählt zu werden gilt als große Ehre in den Krei-sen der Militärhistoriker. (Anm. d. Red.)
-
1932/33 in Cambridge gehalten, gab Basil Liddell Hart Clau-sewitz die Schuld am Blutbad des Ersten Weltkriegs und be-zeichnete ihn einprägsam, aber unverständlicherweise als »denMahdi des Massenmassakers«. Er erklärte, dass »Clausewitz’Grundsatz von der Gewalt ohne Grenzen und ohne Rücksichtauf die Kosten nur zu einem vor Hass tollwütigen Mob passt undauch nur für ihn geeignet ist. Es ist eine Absage an die Staats-kunst – und an eine intelligente Strategie, die bestrebt ist, denZielen der Politik zu dienen.«15
Wenn Liddell Hart recht gehabt hätte, dann hätte Clausewitznicht von Martin van Creveld und anderen nach dem KaltenKrieg für tot erklärt werden müssen; er wäre schon nach demErsten Weltkrieg von seinem Podest gestoßen worden. Und inFrankreich und England (wo er schon immer einen schwererenStand gehabt hatte) war es auch so. Nicht jedoch in seiner Hei-mat. Die Niederlage von 1918 ließ die Deutschen vielmehr zuClausewitz zurückkehren. Diesmal allerdings lasen sie ihn ganzanders. Clausewitz wurde im zweiten Anlauf nicht von Solda-ten entdeckt wie nach 1871, sondern vor allem von Akademi-kern. Vor dem Ersten Weltkrieg hatte sich Hans Delbrück, selbstVeteran des deutsch-französischen Krieges und Professor inBerlin, fest davon überzeugt gezeigt, dass Clausewitz, wenn ernicht so früh an der Cholera gestorben wäre, sein System zu einerStrategie weiterentwickelt hätte, die dann zwei verschiedeneFormen der Kriegführung gekannt hätte. Die erste wäre eine Ver-nichtungsstrategie gewesen. Die zweite aber wäre eine Erschöp-fungsstrategie gewesen, die den Feind zu Verhandlungen zwin-gen sollte. Delbrück hatte ein bisschen tendenziös argumentiert,dass der preußische König Friedrich der Große im Siebenjäh-rigen Krieg zwischen 1756 und 1763 versucht habe, die zweiteStrategie zu verfolgen, eine Deutung, der die Historiker des Ge-neralstabs energisch widersprachen. In mancher Hinsicht spie-gelten die Positionen beider Seiten die Voreingenommenheitenihres jeweiligen Berufsstands wider. Delbrück betrachtete dieStrategie in einem politischen Kontext: Friedrich suchte seinerAnsicht nach einen Verhandlungsfrieden, weil Preußen sich ei-ner Allianz aus Frankreich, Russland und Österreich gegenüber-sah und nicht stark genug war, um sich mehr zu erhoffen. Der
18 einführung
-
Generalstab sah Strategie in einem militärischen und operati-ven Licht: In ihren Augen suchte Friedrich den Kampf, statt ihmauszuweichen, vor allem dann, wenn er die Gelegenheit erhielt,sich mit einem seiner Feinde isoliert auseinanderzusetzen. Dasdeutsche Heer trat mit der Überzeugung in den Ersten Weltkriegein, dass es nur einen Weg gab, einen Krieg zu führen, und die-ser Weg war die Vernichtungsstrategie, die zu einem vollstän-digen deutschen Sieg führen würde: Das operative Denken wur-de auf die Ebene der Politik gehoben.
Delbrück kommentierte den Verlauf des Krieges ständig underneuerte nach dessen Ende seine Angriffe auf den strategi-schen Ansatz des Generalstabs – und besonders auf Erich Lu-dendorff, der zwischen 1916 und 1918 de facto an der Spitze desdeutschen Heeres gestanden hatte. Delbrücks Auszüge aus›Vom Kriege‹ zeigten die Rolle der Dialektik in Clausewitz’Denken. Die Bücher 3 bis 5 des Werkes, auf die sich viele Mili-tärtheoretiker zwischen 1871 und 1914 konzentriert hatten, be-schrieben eine einheitliche Auffassung des Krieges, die sich vorallem aus den Napoleonischen Kriegen ableitete und sich mitStrategie im operativen Sinne beschäftigte. Die ersten beidenwie auch die letzten drei Bücher von ›Vom Kriege‹ berücksich-tigten dagegen auch Alternativen. Gegen Ende des Ersten Welt-kriegs schloss der junge deutsche Historiker Hans Rothfels gera-de seine Doktorarbeit zu Clausewitz’ frühem Werdegang unddessen Einfluss auf die Formulierung seiner Ideen ab. Die Paral-lelen sprangen ins Auge. 1806 war Preußen von Frankreich ge-schlagen worden. Clausewitz befand sich in derselben Situationwie viele junge Deutsche des Jahres 1918. Sein eigener Lebens-lauf gewann deshalb Bedeutung für die Interpretation seinesWerkes. ›Vom Kriege‹ durfte nicht als Stabsschul-Handbuch ge-lesen werden, in Auszügen, sondern als Ganzes, und es sollte imKontext mit den philosophischen Ideen gesehen werden, die esstützten. Auf operativer Ebene gehörte dazu die Wiederentde-ckung von Buch 6 mit seiner Erklärung, dass die Verteidigungstärker sei als der Angriff, eine Feststellung, die besonders alljene ansprach, die zwischen 1914 und 1918 in den Schützengrä-ben gekämpft hatten und jetzt ganz unerwartete Verdienste ausClausewitz’ Beschreibung der Schlacht als einer Form der Zer-
einführung 19
-
mürbung ableiten konnten. Die wichtigste Folge dieser neuenClausewitz-Welle und besonders von Rothfels’ eigener Arbeitwar eine Neubetrachtung dessen, was Clausewitz zur Beziehungzwischen Krieg und Politik zu sagen hatte.
Das deutsche Heer redete sich ein, dass es nicht selbst denErsten Weltkrieg verloren habe, sondern dass die November-revolution 1918 in der Heimat die Niederlage herbeigeführthabe. Diese sogenannte »Dolchstoß-Legende« führte dazu, dassdas Heer dem dritten Element der »Dreifaltigkeit« bei Clause-witz, dem Volk, vermehrte Aufmerksamkeit zuteilwerden ließ.Ludendorff erkannte, dass zum Krieg jetzt die vollständige Mo-bilisierung aller Ressourcen der Nation gehöre. In einem 1922erschienenen Buch, ›Kriegführung und Politik‹, setzte sich Lu-dendorff respektvoll mit Clausewitz’ Ideen auseinander undstellte (nicht ganz richtig) fest, dass Politik für Clausewitz nurAußenpolitik, nie Innenpolitik gewesen sei, dass aber der ErsteWeltkrieg, bei dem es für Deutschland ums schiere Überlebengegangen sei, gezeigt habe, dass die politischen Grundsätze in›Vom Kriege‹ jetzt auf beide Felder der Politik angewendet wer-den müssten. Ja, mehr noch, wie schon der Titel seines Buchesklar machte, sollte die Kriegführung vor der Politik stehen: Letz-tere sollte der ersteren dienen, nicht andersherum. In ›Der tota-le Krieg‹, erschienen im Jahr 1935, ging Ludendorff noch weiter.Eigentlich ging es ihm hier nicht um einen totalen Krieg, son-dern um einen »totalitären Krieg«. Ludendorff konzentriertesich nicht auf die Kriegführung gegen einen Feind im operativenSinne, sondern darauf, wie man den ganzen Staat für den Kriegmobilisieren könne. »Alle Theorien von Clausewitz sind überden Haufen zu werfen«, schrieb er. »Krieg und Politik dienender Lebenserhaltung des Volkes, der Krieg aber ist die höchsteÄußerung des völkischen Lebenswillens. Darum hat die Politikder Kriegsführung zu dienen16«.
Ironischerweise schloss sich Ludendorff also Liddell Hart anund gab Clausewitz die Schuld an den Fehlern der Kriegführungim Ersten Weltkrieg. In seinen Augen bestand das Problem al-lerdings darin, dass der Erste Weltkrieg so ganz anders gewesenwar als frühere Kriege und dass ›Vom Kriege‹ Deutschland miteiner allzu beschränkten Konzeption vom Wesen des Krieges
20 einführung