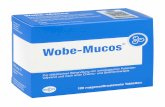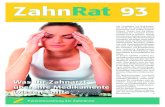Chemo: Nebenwirkungen mindern
Transcript of Chemo: Nebenwirkungen mindern

LeukopenieThrombozytopenie AnämieInfektion
KEYWORDS
Gezielt vorbeugen und intervenieren
Chemo: Nebenwirkungen mindern
Ein Tumor kann mittels Operation und/oder Strahlentherapie effektiv behandelt werden. Zur Bekämpfung von zirkulierenden Tumorzellen
und Fernmetastasen ist allerdings in der Regel eine systemische Chemotherapie notwendig. Patientin-nen erhalten dabei Zytostatika – einzeln oder in Kombination. Diese wirken vorrangig an den Zellen, die sich noch in der Teilungs- oder Reifephase be-finden. Alle Gewebe aber, deren Zellen sich ähnlich dem Tumorgewebe häufig teilen oder einen emp-findlichen Zellstoffwechsel haben, sind häufig und stärker als andere von Nebenwirkungen betroffen.
Auswirkungen auf die BlutbildungBlutkörperchen entstehen in einem komplizierten Verfahren im Knochenmark. Chemotherapeutika gelangen auf dem Blutweg zum Knochenmark, wo sie die Neubildung einzelner Blutzellen, die sich in einer unreifen Entwicklungsstufe befinden, hemmen. So verringert sich die Anzahl der Blutzellen unter-schiedlicher Entwicklungsstufen im Knochenmark.
Nach abgeschlossener Reifung der Zellen erreichen die Zytostatika ihre Wirksamkeit durch Schädigung und Hemmung des Stoffwechsels. Dieser kann so gravierend sein, dass die Zellen zugrunde gehen.
Nicht alle Blutzellen reagieren gleichermaßen emp-findlich auf Zytostatika. Vorrangig sind es Leukozyten und Thrombozyten, die circa zehn Tage nach Thera-pieverabreichung mit einem Zellrückgang reagieren. Bei einem starken Abfall der Granulozyten und Fie-berschüben muss eine Dosisreduktion erfolgen be-ziehungsweise bis zur Erholung des Knochenmarks gewartet werden. Wenn die Dosis nicht reduziert werden soll, ist der Einsatz von Wachstumsfaktoren wie G-CSF indiziert. Durch ihren Einsatz wird die Phase der Hypo- oder Agranulozytose verkürzt und damit die Gefahr einer lebensbedrohlichen Infektion mit hohen Therapiekosten vermindert.
Reduktion der Leukozytenzahlen. Bei Leukozyten-zahlen unter 5.000/µg Blut spricht man von einer
Leukopenie. Diese Nebenwirkung ist sehr häufig. Im Stadium der Leukopenie ist der Körper jeglicher In-fektion gegenüber gefährdet. Dazu zählen besonders Entzündungen der Mundschleimhaut (Soor, Stomati-tis) und der Harnausscheidungssysteme (Nieren- und Blasenentzündung), Genitalinfektionen (z.B. durch Pilzerreger), Infektionen des Atem- und Magen-Darm-traktes.
Um einer Infektion vorzubeugen, müssen Kontakte mit unter ansteckenden Erkrankungen leidenden Per-sonen vermieden werden. Auch der Aufenthalt an Orten mit Menschenansammlungen wie Bussen, Bah-nen, Kaufhäusern stellt eine Gefahr dar. Arbeiten, bei denen man sich leicht verletzen kann, zum Beispiel beim Umgang mit dornigen und stachligen Pflanzen, sollten unterbleiben. Vorsicht ist auch bei der Nagel-pflege geboten. Denn schon geringe Verletzungen können gravierende Schäden hervorrufen. Auch Spei-seeis, ungeschältes Obst, ungekochtes Gemüse und nicht vollständig durchgegartes Fleisch können mit Krankheitserregern besiedelt sein, so dass auf deren Genuss verzichtet werden soll.
Zur Krankheitsvorbeugung gehört auch die Körper-pflege. Hier spielt die Mundhygiene eine große Rolle. Ausreichend Schlaf sowie eine vitamin- und mineral-stoffangepasste Ernährung sind für die Infektabwehr erforderlich.
Reduktion der Thrombozyten. Ein Absinken der Thrombozytenzahlen unter 50.000/µl Blut wird als Thrombozytopenie bezeichnet. Obgleich diese Ne-benwirkung nicht mit der gleichen Häufigkeit auftritt wie die Leukopenie, handelt es sich um eine ernstzu-nehmende Erscheinung. Blutungen, beispielsweise im Gehirn, oder andere nicht zu stillende Blutungen können sogar tödlich enden. Als Blutungsquellen kommen in Frage:
▶ Haut und Schleimhaut (punktförmige Hautblutungen)
▶ Blutungen in der Muskulatur (Hämatome) ▶ Harnausscheidungssystem (Hämaturie) ▶ Weibliches Genital (vaginale Blutungen) ▶ Zahnfleisch ▶ Nasenschleimhaut ▶ Magen (Hämatemisis) ▶ Darmschleimhaut (Teerstuhl) ▶ Hirnversorgende Blutgefäße ▶ Wunden
Eine Blutung entsteht immer aufgrund einer Schädi-gung der Blutgefäßwand, bei Veränderung des Blut- ©
Mat
hias
Ern
ert,
Nat
iona
les
Cent
rum
für T
umor
erkr
anku
ngen
DO
I: 10
.100
7/s0
0058
-013
-075
3-5
Im Gegensatz zu den Anfängen der Brustkrebs-Therapie, als jede Behandlung ein gewagtes Experiment war, sind die unerwünschten Wirkungen an gesunden Zellen mittlerweile bekannt. Trotzdem sind auf Grund der Individualität jeder Frau nicht alle Nebenwirkungen vorhersehbar.
20
PflegeKolleg Mammakarzinom
Heilberufe / Das P�egemagazin 2013; 65 (7-8)

strömungverhaltens, durch degenerative Gefäßwand-veränderungen oder bei Tumorinfilteration. Gegen viele dieser zur Blutung führenden Vorbedingungen können keine vorbeugenden Maßnahmen eingesetzt werden, aber die Patientinnen sollten bei bereits vor-handenem Zahnfleischbluten zeitweise auf das Zäh-neputzen verzichten und auf Mundspülungen zu-rückgreifen. Beim vorsichtigen Umgang mit spitzen Gegenständen sollten Schutzhandschuhe angezogen werden. Sinnvoll sind auch vorbeugende Maßnahmen gegen Verstopfung.
Reduktion der Erythrozyten. Beim Abfall der roten Blutkörperchen beziehungsweise bei Abnahme des Hämoglobinspiegels spricht man von einer Anämie. Da die Zellen nicht ausreichend Sauerstoff bekom-men, kann es zu Kopfschmerzen, Schwindel, Müdig-keit und erhöhtem Schlafbedürfnis, Sehstörungen, Blässe und Herzrasen kommen. Präventiv kann man dem Abfall der roten Blutkörperchen nur partiell durch das Verhindern einer Blutung begegnen.
Um die anämiebedingten Symptome zu lindern, sollten betroffene Patientinnen nach einer längeren Liegepause langsam aufstehen, um den Kreislauf an-zuregen. Hilfreich ist die Gabe von Bluttransfusionen, eventuell Eisenpräparaten und von Erypoetin.
Auswirkungen auf den Magen-Darm-TraktNausea und Emesis. Im Allgemeinen wird der Brechreiz zentral, also durch das sich im verlängerten Mark befindende Brechzentrum ausgelöst. Bei einer Chemotherapie durchschreiten die Medikamente zwar nicht die Blut-Liquor-Schranke, aber bestimmte Impulse aktivieren das Brechzentrum und führen dazu, dass die Magenmuskulatur erschlafft und der darunter liegende Zwölffingerdarm sich zusammen-zieht. So wird der Mageninhalt mundwärts befördert.
Übelkeit während einer vorangegangenen Behand-lung, Angst, Unsicherheit und der übersensible Ge-ruchssinn führen bei vielen Patientinnen dazu, dass sich ein so genanntes Erwartungserbrechen (antizi-
Kein Patient reagiert wie der andere und jede Therapie kann andere Nebenwir-kungen hervorrufen.
patorisches Erbrechen) einstellt. Eine angenehme und vertrauensvolle Atmosphäre ist für den Patienten von eminenter Wichtigkeit, denn allein schon das Gefühl der Unsicherheit und des Alleingelassenwerdens kann über unterschiedliche psychische Mechanismen Übel-keit und Erbrechen auslösen. Empfohlen wird ein leichtes Frühstück am Morgen der Therapie. Die Medikamenteneinnahme sollte (falls keine besonde-ren Anweisungen vorliegen), kurz nach den Mahl-zeiten mit genügend Flüssigkeit erfolgen.
Auf größere Mengen Kaffee, scharfe Gewürze, Ni-kotin und Alkohol sollte während der Behandlung verzichtet werden, da diese Stoffe die Schleimhäute reizen. Fünf bis sieben kleine Mahlzeiten über den ganzen Tag verteilt, sind weniger belastet für den Magen-Darm-Trakt. Entspannungsübungen (z.B. autogenes Training) können die Übelkeit abbauen. Wichtig ist, dass die Angst vor der Therapie durch gute Information und durch Beantwortung aller Fra-gen weitgehend abgebaut wird. Die positive Einstel-lung zu dieser Behandlung ist nicht nur zur Reduzie-rung der Übelkeit, sondern auch für den Erfolg der Therapie notwendig.
Diarrhoe. Durchfall tritt häufig gleichzeitig mit krampfartigen Bauchschmerzen, Übelkeit und Kreis-laufbeschwerden auf. Die gründliche Beobachtung der Patientinnen auf die Veränderung der Darmaus-scheidung sowie das Einleiten spezieller therapeu-tischer und prophylaktischer Maßnahmen ist unbe-dingt erforderlich. Vorbeugend sollten die Patien-tinnen ausreichend trinken (zwei bis drei Liter/Tag).
Zum Auffüllen der Kaliumspeicher eigenen sich Bananen, Haferflocken oder Tomaten. Feuchte Wär-me hilft gegen die häufig auftretenden Bauchschmer-zen. Fencheltee, Aufgüsse aus Koriander oder Anis besitzen eine krampflösende Wirkung.
Um die Gefahr der fortschreitenden Tumorkache-xie zu reduzieren und einen Glukosemangel zu ver-meiden, kann Getränken oder halbflüssigen Nah-rungsmitteln Maltodextrin zugesetzt werden.
21Heilberufe / Das P�egemagazin 2013; 65 (7-8)

Obstipation. Eine Obstipation äußert sich durch harten Stuhlgang in Abständen von mehr als drei Tagen. Nicht selten kommt es gleichzeitig zu Übelkeit, Schweißausbrüchen, Bauchschmerzen und Appetit-losigkeit. Einige Zytostatika und Schmerzmittel läh-men die Darmperistaltik oder beeinträchtigen das vegetative Nervensystem. Weitaus häufiger sind aber mangelnde Bewegung, falsche Ernährung und vor allem eine zu geringe Trinkmenge. Auch bei Verstop-fung müssen die Patientinnen ausreichend viel trin-ken, mindesten zwei Liter am Tag. Ballastreiche Nah-rung wie Leinsamen, Kleie, Vollkornprodukte, fri-sches Obst und Gemüse regen die Darmperistaltik an. Auch Bewegung – Spaziergänge, Schwimmen oder Gymnastik – wirkt positiv.
Die Geschmackswahrnehmung verändert sichAuf der Zunge befinden sich verschiedene Empfin-dungskörperchen, die im wesentlichen vier Ge-schmacksrichtungen wahrnehmen können: süß, sauer, salzig, bitter. Die einzelnen Geschmacksrich-tungen können unter Chemotherapie, aber auch un-ter Strahlentherapie, verändert sein. Solange aber der Energie- und Nährstoffbedarf auf die Bedürfnisse der jeweiligen Patientin abgestimmt ist, dürfen die Wün-sche der Patientinnen richtungweisend sein.
Reaktionen der HautVeränderungen der Haut sind nur in wenigen Fällen direkt durch Zytostatika ausgelöst. Mögliche Reakti-onen können sein: Ausschlag, zum Beispiel Bläschen als Ausdruck einer allergischen Reaktion, Verdickung, Braunfärbung, streifenförmige Pigmentverände-rungen, Schuppenbildung und Petechien.Hautverän-derungen können entweder lokal oder generalisiert am ganzen Körper auftreten.
Allerdings gibt es bei einigen neuen Therapieopti-onen (Targeted-Therapies) heftigste Nebenwirkungen im Bereich der Haut wie akneiforme Hautverände-rungen oder das Hand-Fuß-Syndrom.
Die Toxizität vieler Zytostatika wirkt sich auch auf die Haarbälge der Haare aus, denn diese unterliegen einer häufigen Teilung. So kann es bereits etwa zehn
Tage nach Chemotherapiebeginn zum Ausfall der ersten Haare kommen – auch aller übrigen Körper-haare wie Wimpern, Augenbrauen, Schambehaarung, Haare an Armen, Beinen und am Oberkörper. Kommt es zu einem stärkeren Haarverlust, spricht man von einer Alopezie. Der Haarausfall ist zum einen sehr lästig, da die ausgefallenen Haare kitzeln, zum ande-ren wirkt sich eine Alopezie zum Teil belastend auf die ohnehin angegriffene Psyche aus. Nun kann sogar jeder Außenstehende erkennen, dass eine Tumort-herapie durchgeführt wird. Bereits vor dem Ausfallen der Haare sollte mit der Patientin ein Gespräch über die Anfertigung einer Perücke geführt werden. Au-ßerdem ist die Bescheinigung der medizinischen Notwendigkeit für eine solche Maßnahme erforder-lich. Eine Ersatzfrisur sollte die Patientin möglichst vor dem Ausfallen der Haare auswählen. In den mei-sten Fällen erholen sich die Haarzellen nach Absetzen der Behandlung und die neuen Haare beginnen, vielfach kräftiger, zu sprießen.
Die Mundschleimhaut reagiertVor allem in den leukopenischen Phasen zeigen sich charakteristische Erscheinungen an der Mund-schleimhaut. Die meisten werden durch spezielle Krankheitserreger ausgelöst, die während der ge-schwächten Immunabwehrlage der Patientinnen und bei eingeschränkter Regenerationsfähigkeit der Mundschleimhautzellen in ihrer Vermehrung kaum eingeschränkt werden. Bevorzugt zeigen sich Soor-infektionen – weißliche Belege und Borken auf Zun-ge und Mundschleimhaut, kombiniert mit schlechtem Geschmack im Mund und Schmerzen. Bereitet sich der Pilz weiter aus, kommt es zu Schluck- und Magen- Darmbeschwerden. Auch Herpesinfektion verursa-chen Schmerzen.
Unter Stomatitis werden eine ganze Reihe von ver-schiedenen, undifferenzierten Entzündungsreakti-onen im Bereich der Mundschleimhaut zusammen-gefasst. Mundwinkelrhagaden, kleine Schleimhaut-bläschen, die vorwiegend auf der Zunge und an den Wangentaschen auftreten, sind als Zeichen eines schlechten Ernährungszustandes (Vitamin- und Eiweißmangel) und einer reduzierten Abwehrlage zu sehen.
Diese Beschwerden äußern sich nicht nur in Schmerzen und Einschränkungen der Lebensqualität. Vielmehr besteht die Gefahr, dass die Patientin die Nahrungsaufnahme reduziert oder einstellt. Ge-wichtsverluste und eine Verschlechterung des Allge-meinzustandes können die Folge sein. Zur Linderung der Mundschleimhautveränderungen sollten die Zähne und Zahnfleischtaschen saniert und der Mund nach jeder Mahlzeit mit klarem, lauwarmen Wasser gespült werden. Der Einsatz einer weichen Zahnbür-ste und einer Munddusche, mit der auch die Zahn-fleischtaschen gründlich, aber gleichzeitig schonend
Die gründliche Krankenbeobachtung
der Patientinnen sowie das Einleiten
spezieller therapeutischer und prophylaktischer
Maßnahmen ist unbedingt erforderlich.
▶ Auf Grund der Individualität jeder Brustkrebspatientin sind nicht alle Ne-benwirkungen vorhersehbar und Beschwerden lassen sich nicht immer vollkommen verhindern.
▶ Medikamente der Chemotherapie beeinflussen die Blutbildung, eine Leu-kopenie entsteht sehr häufig. Der Körper ist dann jeglicher Infektion ge-genüber stark gefährdet.
▶ Die Angst der Patientinnen vor der Therapie sollte durch Information und durch Beantwortung aller Fragen weitgehend abgebaut werden. Die posi-tive Einstellung zur Behandlung ist für den ihren Erfolg notwendig.
FA Z IT FÜ R D I E PFLEG E
22
PflegeKolleg Mammakarzinom
Heilberufe / Das P�egemagazin 2013; 65 (7-8)

Anzeige
gespült werden können, hat sich bewährt. Leidet die Patientin unter Schmerzen, kann eine Lokalanästhe-sie vor der Mundpflege und auch vor dem Essen die Schmerzempfindlichkeit reduzieren.
Scheideninfektionen vermeidenAuf der feuchtwarmen Vaginalschleimhaut können sich, wenn die körpereigene Abwehr gestört ist, Krankheitserreger rasch ausbreiten. Besonders bei älteren Patientinnen kann die normale Bakterienflo-ra verändert sein. In Folge kann es zum Brennen, Jucken oder auch zu Schmerzen kommen. Möglich sind auch ein vermehrter, weißlich schaumiger, gelb-lich oder krümeliger Ausfluss, eventuell unange-nehmer Geruch oder angeschwollene, gerötete La-bien. Beim Auftreten dieser Symptome wird ein Vaginalabstrich entnommen, um nach genauer Dia-gnose gezielt Medikamente einzusetzen.
Ziel aller vorbeugenden Maßnahmen ist es, eine gesunde Scheidenflora mit einer genügend großen Zahl von Milchsäure Bakterien zu erhalten. Diese sorgen für ein saures Scheidenmilieu, in dem sich Krankheitserreger nicht vermehren. Patientinnen sollten neutrale oder im sauren pH-Bereich liegende
Kerstin ParadiesSprecherin des Vorstandes der Konferenz der Onkologischen Kranken- und Kinder-krankenpflege (KOK) Deutsche Krebsgesellschaft e.V. Im alten Dorfe 24, 22359 Hamburg [email protected]
Jede Therapie kann andere Komplikationen hervorrufen.
Seifen oder Waschlotionen verwenden. Mit Folie unterlegte Slipeinlagen oder Binden sind kontrain-diziert. Baumwollslips sind solchen aus Synthetik vorzuziehen. Sie sind kochfest, so dass Erreger bei jeder Wäsche abgetötet werden.
Ob und wie stark die beschriebenen Nebenwir-kungen auftreten, ist neben der unterschiedlichen Reaktionsweise und Stoffwechselfunktion des menschlichen Körpers abhängig vom Wirkungsme-chanismus der Medikamente, von der zeitlichen Ver-teilung (Einmalgabe oder Verabreichung in Thera-pieintervallen) und von der Kombination der Medi-kamente. Jede Therapie kann andere Komplikationen hervorrufen.
Heilberufe / Das P�egemagazin 2013; 65 (7-8)
Lohmann & Rauscher 1/2 quer
23