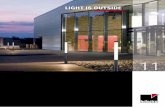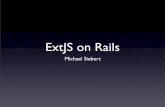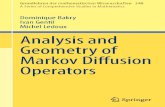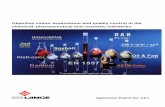Christian Wagner (ext.) Globalisierung und ... · India in the Nineties, in: The National Interest,...
Transcript of Christian Wagner (ext.) Globalisierung und ... · India in the Nineties, in: The National Interest,...

SWP-StudieStiftung Wissenschaft und PolitikDeutsches Institut für InternationalePolitik und Sicherheit
Christian Wagner (ext.)
Globalisierung undaußenpolitischer Wandelin der Indischen Union
S 36Oktober 2001Berlin

Nachweis in öffentlichzugänglichen Datenbankennicht gestattet.Abdruck oder vergleichbareVerwendung von Arbeitender Stiftung Wissenschaftund Politik ist auch in Aus-zügen nur mit vorherigerschriftlicher Genehmigunggestattet.
© Stiftung Wissenschaft undPolitik, 2001
SWPStiftung Wissenschaft undPolitikDeutsches Institut fürInternationale Politik undSicherheit
Ludwigkirchplatz 3−410719 BerlinTelefon +49 30 880 07-0Fax +49 30 880 [email protected]
GestaltungskonzeptGorbach Büro fürGestaltung und RealisierungBuchendorf

Inhalt
Problemstellung und Empfehlungen 5
Globalisierung und Außenpolitik in Indiennach dem Ende des Kalten Krieges 7
Die politische Dimension der Globalisierung 9Nationale Ebene 9Außenpolitisches Selbstverständnis,Entscheidungsprozeß, Akteure 9Der Wandel des Parteiensystems 12Regionale Ebene: Von �Südasien� zum �südlichen Asien� 13Internationale Ebene: AußenpolitischesRealignment zwischen Interdependenz undGroßmachtanspruch 15USA � China � Sowjetunion 15Deutschland � Europäische Union 17Zusammenfassung 18
Die wirtschaftliche Dimensionder Globalisierung 20Die nationale Ebene: Von der mixed economy zur Liberalisierung 20Die regionale Ebene: SAARC, SAPTA, SAFTA 23Die internationale Ebene: Von self-reliance zur Weltmarktintegration 24Zusammenfassung 25
Die gesellschaftliche Dimensionder Globalisierung 26Nationale Ebene: Soziale Bewegungenund Nichtregierungsorganisationen 26Die regionale Ebene: Arbeitsmigrationund Terrorismus 27Die internationale Ebene:Die Non-Resident Indians 28Zusammenfassung 29
Ausblick: Globalisierung und Außenpolitikin Indien 30
Abkürzungsverzeichnis 31

Dr. Christian Wagner ist Mitarbeiter desZentrums für Entwicklungsforschung,Universität Bonn

SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
5
Problemstellung und Empfehlungen
Globalisierung und außenpolitischer Wandelin der Indischen Union
Ausgangspunkt dieser Studie ist die Frage, welcheFolgen die Liberalisierung nach 1991 und die damitverbundenen Globalisierungsprozesse für die indischeAußenpolitik haben. Hierzu wurden die politischen,wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderun-gen auf nationaler, regionaler und internationalerEbene erörtert. Selbst wenn viele der Entwicklungenbereits in den 80er Jahren zu beobachten waren, kann1991 dennoch als Zäsur in der indischen Politikgelten. Die Liberalisierung markiert einen Politik-wechsel, der aufgrund der breiten Zustimmung unterden größten Parteien unumkehrbar sein dürfte. ZehnJahre nach Beginn der Liberalisierung lassen die wach-senden internationalen Verflechtungen, hier alsGlobalisierung umschrieben, folgende Thesen inbezug auf die Außenpolitik Indiens zu:
1. Die indische Außenpolitik weist einen breiten,parteiübergreifenden Konsens in Grundsatzfragen auf.Einigkeit herrscht über den Anspruch, als Großmachtim internationalen System anerkannt zu werden,unter anderem durch eine international akzeptierteGleichrangigkeit mit der VR China und einen ständi-gen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen(VN). Trotz des Konsenses ist seit 1991 zu beobachten,daß die praktische Umsetzung der Außenpolitikstärker von den jeweiligen Regierungskonstellationenund den unterschiedlichen parteipolitischen Inter-essen und Prioritäten abhängig geworden ist. Dieskommt unter anderem in den verschiedenen sicher-heitspolitischen Konzeptionen sowie in den Nuklear-tests vom Mai 1998 zum Ausdruck.
2. Die indische Tradition der Eigenständigkeit (self-reliance) wird in Fragen der Wirtschafts- und Sicher-heitspolitik zunehmend an ihre Grenze gelangen. Dasindische Großmachtverständnis betont im sicherheits-politischen Bereich weiterhin Normen wie Eigenstän-digkeit und Unabhängigkeit, die ihren Ausdruck etwaim Nuklear- und Weltraumprogramm finden. Dage-gen bricht die Politik der Liberalisierung und Welt-integration faktisch mit der Tradition der self-reliance.Aufgrund der wirtschaftlichen Probleme und Abhän-gigkeiten ist zu erwarten, daß die wachsende inter-nationale Verflechtung die Handlungsspielräumeindischer Außenpolitik im Vergleich zu früherenJahren einschränken wird. Die damit verbundene

Problemstellung und Empfehlungen
SWP-BerlinIndische UnionOktober 2001
6
Gratwanderung zwischen wirtschaftspolitischem Mul-tilateralismus und sicherheitspolitischem Bi- bzw. Uni-lateralismus dürfte sich künftig in außenpolitischenStrategien niederschlagen, deren Akzente je nachNeigung der Regierungsparteien auf dem einen oderanderen Pol liegen werden.
3. Der multipolare Charakter des internationalenSystems kommt den indischen Großmachtambitionenim sicherheitspolitischen Bereich eher entgegen alsdie ideologischen Frontstellungen des bipolarenSystems in der Zeit des Kalten Krieges. Vom angestreb-ten wirtschaftlichen Großmachtstatus ist Indien abernoch weit entfernt, wie der geringe Anteil des Landesam Welthandel oder die geringe Höhe ausländischerDirektinvestitionen belegen.
Empfehlungen! Die internationale Einbindung Indiens in sicher-
heitspolitische Institutionen sollte weiter gefördertwerden. Deutschland und Europa sollten auf dieEinbeziehung Indiens in den ASEM-Prozeß drängenund den Dialog mit diesem wichtigen Entwick-lungsland im Rahmen der G-8-Gipfeltreffen weiterausbauen.
! Sicherheitspolitische Ansatzpunkte zu einer inten-siveren Zusammenarbeit zwischen Deutschland/Europa und der Indischen Union ergeben sich bei-spielsweise in Zentralasien. Indien ist hier fastNachbar der OSZE, und beide Seiten haben eingemeinsames Interesse an der Bekämpfung desinternationalen Terrorismus. Im Nahen Osten undin der Golfregion bieten sich ebenfalls Koopera-tionsmöglichkeiten, da Indien über traditionellsehr gute Beziehungen zur arabischen Welt undseit neuestem auch zu Israel verfügt.
! Das indische Großmachtverständnis ist in Sicher-heitsfragen in erster Linie bilateral geprägt undbetont klassische Machtattribute wie Nuklear-waffen. Dies widerspricht deutschen und europäi-schen Vorstellungen von multilateralen Sicher-heitsstrukturen und Konzepten wie Zivilmacht undHandelsstaat. Zugleich setzt der indische Bilatera-lismus Partner voraus, deren sicherheitspolitischeInteressen klar definiert sind. Dies kann in Einzel-fragen Probleme aufwerfen, da die GemeinsameAußen- und Sicherheitspolitik der EU eben nochnicht voll entwickelt ist.
! Aufgrund seiner Tradition der self-reliance hat Indiengroße Schwierigkeiten mit äußeren Einwirkungen.Diese werden aber mit der Globalisierung zuneh-men und das Konfliktpotential im Land verstärken.
Programme zur sozialen Abfederung der Folgen derGlobalisierung oder zur Reform des Föderalismuskönnen gerade von deutscher und europäischerSeite eingebracht werden.
! Die außenpolitische Elite Indiens ist in erster Linieauf die USA ausgerichtet. Damit wird es langfristigfür Deutschland und Europa immer schwieriger,eine entsprechende Lobby unter politischen Ent-scheidungsträgern in Indien zu finden. BestehendeDialogforen müssen deshalb erweitert und vertieftwerden.
! Noch bestehende Sanktionen, die nach den Atom-tests 1998 im Bereich der entwicklungspolitischenZusammenarbeit verhängt wurden, sollten auf-gehoben werden. Abgesehen vom hohen Symbol-wert, den diese Maßnahme in Indien hätte, könntedie Bundesregierung damit zugleich auch ihreAbsicht signalisieren, die guten bilateralen Bezie-hungen mit Indien weiter auszubauen.

Globalisierung und Außenpolitik in Indien nach dem Ende des Kalten Krieges
SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
7
Globalisierung und Außenpolitik in Indiennach dem Ende des Kalten Krieges
Anfang der 90er Jahre galt Indien noch als einer derVerlierer nach dem Ende des Ost-West-Konflikts.1 Mitdem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte dieIndische Union einen ihrer wichtigsten Handelspart-ner und internationalen Verbündeten verloren. DieZahlungsbilanzkrise im Frühsommer 1991 hatte dasScheitern der bisherigen Wirtschaftspolitik offenbart.Und die Minderheitsregierungen zwischen 1989 und1991 sowie die Ermordung Rajiv Gandhis im Mai 1991schienen die einst vielbeschworene politische Stabili-tät der indischen Demokratie ins Wanken zu bringen.Das Asienkonzept der Bundesregierung von 1993 kon-zentrierte sich denn auch auf die wirtschaftlich dyna-mischen Regionen Ost- und Südostasiens, Indien unddie Staaten Südasiens fanden kaum Erwähnung.2
Mit den Atomtests vom Mai 1998 brachte die Indi-sche Union dann aber ihre Ambitionen auf eine inter-nationale Großmachtrolle im 21. Jahrhundert unmiß-verständlich zur Geltung. Trotz internationaler Kritikund trotz Sanktionen der Industriestaaten scheinendie Nuklearversuche die internationale BedeutungIndiens mittelfristig eher gestärkt als geschwächt zuhaben. Bereits im November 1998 mußten die USAaufgrund der bedrohlichen Situation in Pakistan Teileder Sanktionen wieder aussetzen. Zudem konnteIndien in bilateralen Gesprächsrunden nicht dazubewegt werden, dem Nichtweiterverbreitungsvertrag(NVV) oder dem allgemeinen Teststoppabkommen(Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT) beizutreten.Trotz dieser Differenzen leitete die US-Regierung mitdem Besuch von Präsident Clinton im März 2000 eineneue Phase der indisch-amerikanischen Zusammen-arbeit ein. Die neue internationale Bedeutung Indiensist auch daran abzulesen, daß das Ziel der erstenAsienreise von Außenminister Fischer im Mai 2000Indien und nicht China oder Japan war.
Mit den 1991 begonnenen Wirtschaftsreformen hatIndien eine grundlegende Abkehr von der Binnen-marktorientierung hin zur Integration in den Welt-markt vollzogen und damit zugleich die Tür zu Globa-
1 Vgl. R. H. Munro, The Loser. India in the Nineties, in: TheNational Interest, (Sommer 1993), S. 62�69.2 Vgl. ohne Verfasser, Asien-Konzept der Bundesregierung, in:Asien, (Januar 1994) 50, S. 142�157.
lisierungsprozessen aufgestoßen, mit denen staatlicheAußenpolitik in vielen Ländern in immer stärkeremMaße konfrontiert ist. Wenngleich Uneinigkeit überden Begriff �Globalisierung� besteht, ergibt sich einedefinitorische Annäherung durch die neuen Heraus-forderungen in verschiedenen staatlichen Politik-feldern.3 Am eindeutigsten scheint der Begriff �Globa-lisierung� im Bereich der Wirtschaft definiert zu sein,wo er die immer stärkere Liberalisierung der Waren-und Kapitalströme bezeichnet, die durch Fortschrittein der Informations- und Kommunikationstechnologiemöglich geworden sind. Dies ist aber kein �naturwüch-siger� Prozeß, sondern Folge politischer Entscheidun-gen in den Industriestaaten, die sich in den vergan-enen Jahren für eine globale Liberalisierung derFinanz-, Handels- und Warenströme eingesetzt haben.
Im politischen Bereich steht �Globalisierung� füreine Reihe grenzüberschreitender Probleme undRisiken � von der Bedrohung durch Massenvernich-tungswaffen über die Umweltbelastung und Arbeits-migration bis hin zum internationalen Terrorismus �,die von den Nationalstaaten allein nicht mehr zubewältigen sind. Eine Folge hiervon ist die Zunahmeinternationaler Regime, mit denen Staaten versuchen,Lösungen für gemeinsame Probleme zu finden.
Der Begriff �Globalisierung� umfaßt zudem einegesellschaftliche Ebene. Außenpolitische Entschei-dungsprozesse werden nicht mehr nur von staat-lichen, sondern zunehmend auch von gesellschaft-lichen Akteuren bestimmt. Beispiele hierfür sindmultinationale Unternehmen, die von der Liberalisie-rung der Waren- und Finanzströme profitieren, sozialeBewegungen, die durch ihre transnationale Vernet-zung erfolgreich gegen Menschenrechtsverletzungenin anderen Staaten agieren, oder militante Gruppen,welche die neuen Informations- und Kommunikations-möglichkeiten für ihre Zwecke nutzen.4
3 Zur theoretischen Debatte vgl. u.a. David Held/AnthonyMcGrew/David Goldblatt/Jonathan Perraton, Global Trans-formations. Politics, Economics and Culture, Stanford 1999.4 Zürn spricht deshalb von Prozessen der Denationalisie-rung, da die hier genannten Entwicklungen nicht unbedingtglobal, aber auf jeden Fall de-national verlaufen; vgl. MichaelZürn, Regieren jenseits des Nationalstaates. Globalisierungund Denationalisierung als Chance, Frankfurt a.M. 1998.

Globalisierung und Außenpolitik in Indien nach dem Ende des Kalten Krieges
SWP-BerlinIndische UnionOktober 2001
8
Den wirtschaftlichen, politischen und gesellschaft-lichen Globalisierungsprozessen ist gemein, daß sieeinerseits die Interdependenzen zwischen den Staatenverstärken, damit andererseits aber auch die Hand-lungsspielräume staatlicher Außenpolitik einschrän-ken. Unter den Bedingungen der innenpolitischenLiberalisierung und einer immer stärkeren Verflech-tung mit dem internationalen System (hier mit demBegriff Globalisierung umschrieben) muß die Analysestaatlicher Außenpolitik deshalb mehr als je zuvor dieWechselwirkungen zwischen nationaler, regionalerund internationaler Ebene berücksichtigen. Diese dreiEbenen ergeben zusammen mit den politischen, wirt-schaftlichen und gesellschaftlichen Dimensionen derGlobalisierung eine Matrix, die im folgenden alsGliederungsschema für die Kontinuitäten, Verände-rungen und neuen Herausforderungen der indischenAußenpolitik seit 1991 dienen soll. Es bleibt indes einmethodisch schwieriges Unterfangen, die Folgen vonLiberalisierung und Globalisierung wissenschaftlichexakt mit der Außenpolitik zu korrelieren. Viele derhier genannten Entwicklungen waren bereits inAnsätzen in den 80er Jahren zu beobachten. Mit gutenGründen läßt sich jedoch argumentieren, daß sieohne die Veränderungen von 1991 ihre aktuelleBedeutung kaum erlangt hätten.

Nationale Ebene
SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
9
Die politische Dimension der Globalisierung
Nationale Ebene
Im politischen Bereich hat sich die Liberalisierung ineinem veränderten außenpolitischen Selbstverständ-nis sowie in der Einbeziehung neuer Akteure in denaußenpolitischen Entscheidungsprozeß niedergeschla-gen. Aber auch die Veränderungen in der indischenParteienlandschaft können auf die Folgen wirtschaft-licher Reformprozesse zurückgeführt werden.
Außenpolitisches Selbstverständnis,Entscheidungsprozeß, Akteure
Das Selbstverständnis der indischen Außenpolitik unddie ihr zugrundeliegenden Normen wurden maßgeb-lich von Jawaharlal Nehru bestimmt, dem ersten indi-schen Premierminister nach der Unabhängigkeit1947. Ausgehend von der Erfahrung der antikolonia-len Befreiungsbewegung strebte er eine Außen- undWirtschaftspolitik an, die auf Eigenständigkeit (self-reliance) und Unabhängigkeit beruhte. Davon abgelei-tet wurden Begriffe wie Anti-Rassismus, Dekolonisie-rung, Abrüstung und Blockfreiheit zu den zentralenVorgaben für die indische Außenpolitik. Nehru setztesich für eine stärkere Kooperation zwischen Entwick-lungsländern ein und bemühte sich um eine engeZusammenarbeit mit der Volksrepublik (VR) China.
Durch seine Reden und Schriften prägte Nehru einkulturelles Großmachtverständnis der IndischenUnion. Neben der Größe des Landes und seiner Ein-wohnerzahl waren es vor allem die historisch-kultu-rellen Errungenschaften der indischen Zivilisation, alsderen Erbin Nehru die Indische Union ansah. Sieschienen dem Land einen �natürlichen� Großmacht-status im internationalen System nach dem Ende desZweiten Weltkriegs zu verleihen. Neben den Super-mächten USA und UdSSR waren für Nehru nur nochIndien und China international von Bedeutung.5
Zwei Ereignisse erschütterten Nehrus außenpoli-tische Konzeptionen. Der Konflikt mit Pakistan um dieZugehörigkeit des vormals unabhängigen Fürsten-
5 Vgl. u.a. seine verschiedenen Ausführungen in: JawaharlalNehru, The Discovery of India, Calcutta 1946, S. 535ff.
staates Kaschmir führte � unmittelbar nach der Unab-hängigkeit und Teilung Britisch-Indiens in die neuenStaaten Indien und Pakistan 1947/48 � zum ersten vondrei Kriegen zwischen beiden Staaten. Nehru brachteden Konflikt vor die Vereinten Nationen (VN), um dorteine internationale Beilegung des Konflikts unteranderem mit einem von ihm vorgeschlagenen Refe-rendum zu erzielen. Die verschiedenen Resolutionender VN verurteilten aber nicht, wie von Indiengewünscht, die pakistanische �Aggression�, sondernstellten den am 26. Oktober 1947 vollzogenen BeitrittKaschmirs zur Indischen Union in Frage. Der Konfliktwurde nicht im Sinne Indiens beigelegt, der StatusKaschmirs war wieder offen, was den indischen Vor-stellungen von der Zuständigkeit der VN zuwiderlief.6
Während der Kaschmirkonflikt Nehrus Vertrauenin die Konfliktbeilegungskapazität multilateralerInstitutionen erschütterte, zerplatzten mit der militä-rischen Niederlage Indiens im Grenzkrieg mit China1962 seine Hoffnungen auf eine stärkere Zusammen-arbeit zwischen beiden Staaten. Seit den 50er Jahrenhatte sich Nehru darum bemüht, China in die inter-nationale Staatengemeinschaft zu integrieren, indemer sich unter anderem für seine Aufnahme in die VNeinsetzte. Im Vertrag über Tibet vom 29. April 1954verständigten sich beide Staaten auf die »Fünf Prin-zipien friedlicher Koexistenz« (Panch Sheel) als Grund-lage ihrer Beziehungen. Die Besuche Nehrus in Chinaund Zhou Enlais in Indien Mitte der 50er Jahreschienen Konflikte etwa um die ungeklärte Grenz-ziehung und die damit verbundenen territorialenAnsprüche zu überdecken. Doch mit der Niederschla-gung des tibetischen Aufstands 1959 durch China undder Flucht des Dalai Lama nach Indien rückten dieindisch-chinesischen Spannungen stärker in den Vor-dergrund. Trotz zahlreicher bewaffneter Grenz-zwischenfälle wurde die indische Armee von demchinesischen Angriff im Oktober 1962 überrascht.
6 Zu Nehrus Kaschmirpolitik und zu Indiens Vorgehen inden VN vgl. u.a. Subrata K. Mitra, Nehru�s Policy towards Kash-mir: Bringing Politics back again, in: Justus Richter/ChristianWagner (Hg.), Regional Security and Problems of Governancein South Asia, Neu-Delhi 1998, S. 30�72; K. P. Wagner, Indiaand the United Nations, in: Nancy Jetly (Hg.), India�s ForeignPolicy. Challenges and Prospects, Neu-Delhi 1999, S. 288�305.

Die politische Dimension der Globalisierung
SWP-BerlinIndische UnionOktober 2001
10
Angesichts der drohenden Niederlage wandte sichNehru an die Westmächte und erhielt militärischeUnterstützung auch von den USA. Im November 1962endete die chinesische Strafexpedition genauso über-raschend, wie sie begonnen hatte: die chinesischenTruppen zogen sich zurück. Mit dem Trauma derNiederlage schlug der indische Wunsch nach einerengeren Zusammenarbeit mit China in Rivalität um,die seitdem prägend für das Selbstverständnis derindischen Außenpolitik ist.
Mit der Liberalisierung 1991 gab die Indische Uniondie Politik der Eigenständigkeit im wirtschaftlichenBereich auf. Hatte die �kulturelle� Großmacht Indienmit dem ersten Atomtest 1974 ihre militärischenGroßmachtkapazitäten demonstriert, strebt sie seit1991 auch danach, als wirtschaftliche Großmachtanerkannt zu werden. Nicht mehr Importsubstitution,sondern Integration in den Weltmarkt und die Förde-rung ausländischer Direktinvestitionen sind seitdemzu zentralen außenpolitischen Anliegen geworden.Die Reden führender Politiker bekunden diesen Priori-tätenwandel ebenso wie immer neue Initiativen zurExportförderung oder die Neuausrichtung der diplo-matischen Ausbildung, in der Wirtschaftsfragen seitAnfang der 90er Jahre größeren Raum einnehmen.
Repräsentiert die neue Bedeutung der Wirtschaftden grundlegenden Wandel im außenpolitischenSelbstverständnis Indiens, dann steht die Sicherheits-politik für die Kontinuität der indischen Vorstellungvon Eigenständigkeit und für die damit verbundenenGroßmachtambitionen. Nehrus Prägung des außen-politischen Denkens sowie die innenpolitische Domi-nanz der Kongreßpartei, von der sich viele Politikerim Laufe der Jahre mit neuen Parteien abspalteten,dürften erklären, warum sich, trotz aller parteipoliti-schen Unterschiede, ein Konsens über den Großmacht-anspruch und außenpolitische Grundsatzfragen ent-wickelt hat. Die außenpolitischen Eliten habenNehrus Vorstellung einer �kulturellen� Großmachtmittlerweile durch die klassischen Symbole einerGroßmacht weitgehend ersetzt. Hierzu zählen unteranderem die Forderung nach einem ständigen Sitz imSicherheitsrat der VN, die Anerkennung der Gleich-rangigkeit mit China sowie die Vorstellungen vonwirtschaftlicher und militärischer Stärke, wie sieunter anderem im Nuklear- und Weltraumprogrammzum Ausdruck kommen. Aus diesem Grund weigernsich indische Regierungen auch, dem NVV beizutre-ten, obwohl Nehru in den 50er Jahren zu den vehe-mentesten Verfechtern nuklearer Abrüstung zählte.Die im NVV vorgenommene Zweiteilung der Welt in
Nuklear- und Nicht-Nuklearstaaten stellt eine inindischer Sicht bis heute nicht zu rechtfertigende Dis-kriminierung der internationalen Staatengemein-schaft im allgemeinen und Indiens im besonderendar. Es ist für das indische Großmachtverständnisnicht hinnehmbar, daß die VR China als offiziellerNuklearstaat anerkannt ist, während Indien dem NVVgegenwärtig nur als Nicht-Nuklearstaat beitretenkönnte. Daraus erklärt sich, daß viele Politiker undWissenschaftler ihr Land seit den Nukleartests vomMai 1998 als �Atommacht� bezeichnen, ungeachtet dervertraglichen Festlegungen des NVV.
Das indische Großmachtverständnis steht somiteinerseits in der Kontinuität von Nehrus Vorstellun-gen, wie der Verweis auf die kulturelle Größe Indiensin den Reden und Schriften vieler Politikern nahelegt,und spiegelt andererseits die historischen Erfahrun-gen und den Lernprozeß der außenpolitischen Ent-scheidungsträger wider. Im Hintergrund scheint dabeiimmer das Vorbild China zu stehen. Dessen Aufstiegzur international anerkannten Großmacht erfolgtedurch seine Mitgliedschaft im NVV seit 1968, die Auf-nahme als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat 1971sowie die allmähliche Öffnung der Wirtschaft nach1978. Es spricht vieles dafür, daß die indische Außen-politik diesem Vorbild nacheifert.
Die Wahrnehmung des internationalen Systemsscheint sich in der vergleichsweise kleinen strategiccommunity aber weiterhin eher an der Tradition der self-reliance und den Denkmustern des Kalten Krieges alsan den Herausforderungen der Globalisierung zuorientieren.7 Begriffe wie �Anarchie� als Struktur-merkmal des internationalen Systems oder Symbolewie Nuklearwaffen als klassische Machtattributedieser Epoche8 stehen auf den ersten Blick im Gegen-satz zu immer wieder genannten Strukturmerkmalendes Zeitalters der Globalisierung wie �komplexe Inter-dependenz�, �internationale Regime� und �wirtschaft-liche Integration�.9 Darin spiegelt sich das Spannungs-verhältnis zwischen den wirtschafts- und sicherheits-politischen Aspekten des indischen Großmacht-
7 Vgl. hierzu u.a. K. Subrahmanyam, Self-Reliant Defence andIndian Industry, http://www.idsa-india.org/an-oct-00-2.html.8 Zur Bedeutung von Nuklearwaffen als Symbol für dasindische Großmachtverständnis vgl. George Tanham, IndianStrategic Culture, in: The Washington Quarterly, 15 (Winter1992) 1, S. 129�142.9 Zur Perzeption der außenpolitischen Entscheidungsträgervgl. auch die Ausführungen von Amitabh Mattoo, India�sStrategic Perceptions, auf der Indo-Europe Conference,5./6.3.2001, in Neu-Delhi.

Nationale Ebene
SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
11
verständnisses wider. Während die wirtschaftlicheVerflechtung bereits früher vorhanden, aber eher eineabhängige denn unabhängige Variable der Politik war,spricht vieles dafür, daß sich diese Rangordnung nach1991 verändert hat. Der Anspruch, wirtschaftlicheGroßmacht zu sein, kann aber auf lange Sicht nurdurch internationale Verflechtungen und damitimmer neue Abhängigkeiten erfüllt werden, die auchsicherheitspolitische Fragen berühren können, bei-spielsweise bei den Verteidigungsausgaben oder imNuklearbereich. Die Globalisierung hat den Bereich�Wirtschaft� gegenüber dem Bereich �Sicherheit�zweifellos aufgewertet. Der Streit über die jeweiligePrioritätensetzung dürfte deshalb in den kommendenJahren den außenpolitischen Entscheidungsprozeßbegleiten und sich in unterschiedlichen außen-politischen Strategien der jeweiligen Regierungs-koalitionen niederschlagen.
Deutlich wurde dies unter anderem in der Nuklear-frage. Nach dem ersten Test im Mai 1974 hatte Indieneine Politik der nuklearen Zweideutigkeit (nuclearambiguity) verfolgt: Der erreichte Stand des militäri-schen Teils im indischen Nuklearprogramm blieb fürdie internationale Umwelt lange Zeit unklar. Doch ab1995 gab es Berichte, daß die Kongreßregierung Atom-tests vorbereiten würde, die dann jedoch zum Teil aufinternationalen Druck hin unterblieben. Demgegen-über führte die im April 1998 an die Regierunggelangte Bharatiya Janata Party (BJP) einen Monatnach Amtsantritt Nuklearversuche durch und unter-mauerte damit die indischen Großmachtambitionen.
Solange das politische System Indiens von der Kon-greßpartei dominiert wurde, blieb diese auch in 42Jahren Unabhängigkeit (1947�1989) von der Nehru-Gandhi-Dynastie geprägt. 37 Jahre lang bestimmte siedie Geschicke von Partei und Regierung in entschei-dender Weise. Die Dominanz einer Partei unter derFührung einer Familie sowie Nehrus und IndiraGandhis herausgehobene Stellung in internationalenFragen � beide hatten lange Zeit selbst das Amt desAußenministers inne � machten außenpolitische Ent-scheidungen zur �Chefsache�. Zentrale Entscheidun-gen wie der Einmarsch in Goa 1961 oder der indo-sowjetische Freundschaftsvertrag 1971 wurden vonden jeweiligen Premierministern in Abstimmung mitihren engsten Beratern gefällt. Außenministeriumoder Kabinett hatten nur geringe Mitsprache.
Mit der wirtschaftlichen Liberalisierung und derZunahme von Koalitions- und Minderheitsregierungennach 1991 hat sich auch die Zahl der an außenpoliti-schen Entscheidungen beteiligten Akteure erhöht,
selbst wenn nicht alle Regionalparteien ein gleicher-maßen großes Interesse an internationalen Fragenhaben. Durch den für Delhi bestehenden Zwang zurBildung von Koalitionsregierungen haben zum Bei-spiel die Ministerpräsidenten der Bundesstaaten neuewirtschaftspolitische Spielräume erhalten. Auf ihrenAuslandsreisen werben sie für Direktinvestitionen inihren Bundesstaaten oder erhalten, wie AndhraPradesh im März 2001, direkt Kredite von multilatera-len Organisationen wie der Weltbank. Je nach Rolle,die die Ministerpräsidenten in den Koalitionsregierun-gen auf Bundesebene spielen, sind sie damit zu einemneuen wichtigen außenpolitischen Akteur geworden.
Die Öffnung 1991 machte auch eine Professionali-sierung der Außenpolitik notwendig. War das Amt desAußenministers bis dahin oft in Personalunion vomPremierminister ausgeübt worden, ließen die wach-senden internationale Verpflichtungen Indiens dieseÄmterhäufung zunehmend als Anachronismuserscheinen. Langfristig könnte damit die Eigenstän-digkeit des Außenministeriums gestärkt werden,besonders wenn dieses Amt, wie in Deutschland, ausGründen der Koalitionsarithmetik an Politikerkleinerer Parteien vergeben werden sollte.
Aber nicht nur auf der Ebene der Exekutive hat sichder außenpolitische Entscheidungsprozeß verändert.Im Rahmen der mixed economy waren, mit Rücksichtauf die einheimische Industrie, hohe Zollmauernerrichtet worden, während die Arbeitnehmer im orga-nisierten Sektor durch umfangreiche Arbeitsschutz-gesetze gesichert waren. Der sukzessive Abbau derZollmauern nach 1991 und die anhaltende Debatteüber die Privatisierung von Staats- und Landesbetrie-ben machen es mehr als je zuvor notwendig, daß auchUnternehmer und Gewerkschaften ihre Anliegen imaußenwirtschaftlichen Prozeß zur Geltung bringen.Die Unternehmerseite zerfällt dabei in diejenigenFirmen, die von einer weiteren Liberalisierung profi-tieren, und solche, die eine weitere Öffnung desindischen Marktes fürchten. Die Gewerkschaftenwiederum müssen ihre Interessen in den außenwirt-schaftlichen Entscheidungsprozeß einbringen, umden drohenden Abbau von Arbeitsrechten im Rahmender Wirtschaftsreformen abzuwehren. Wenngleich esinnenpolitisch durchaus eine Reihe von Gruppen gibt,die sich kritisch mit den Folgen der Globalisierung fürIndien auseinandersetzen, darunter Gewerkschaften,Intellektuelle, kleinere Parteien, so haben diese bis-lang kaum eine parteipolitische Basis im Parlament.10
10 Zu den kritischen Stimmen im Globalisierungsdiskurs

Die politische Dimension der Globalisierung
SWP-BerlinIndische UnionOktober 2001
12
Der Wandel des Parteiensystems
Erste zaghafte Ansätze, die indische Wirtschaft fürden Weltmarkt zu öffnen, gab es bereits Ende der 70erJahre unter der Janata-Regierung. Indira Gandhi hattein ihrer zweiten Amtszeit nach 1980 die Export-produktion weiter gefördert, ihr Sohn Rajiv setztediese Politik nach 1984 fort. Trotz deutlicher politi-scher Mehrheiten im Parlament blieben diese Refor-men aber nur begrenzt. Große Teile der Kongreßparteisetzten einer solchen Wirtschaftspolitik Widerstandentgegen. Von dieser ersten Phase der Liberalisierungprofitierten vor allem die städtischen Mittelschichten,die sich verstärkt der hindu-nationalistischen BJPzuwandten. Die BJP propagierte die Herrschaft derHindus (Hindutva) als ideologische Grundlage desStaates und lehnte Nehrus Konzept des Säkularismusab. Demzufolge kritisierte die BJP Korruption undMißwirtschaft der Kongreßpartei sowie die verfas-sungsrechtlichen Privilegien von Minderheiten wieChristen, Muslimen und Sikhs im Familien- und Erb-recht sowie im Bildungsbereich.
Die politischen Kontroversen um den Fall ShahBano, einer Muslimin, die Unterhaltszahlungen vonihrem geschiedenen Mann einklagte und damit einebreite öffentliche Debatte über das Verhältnis vonsäkularem Zivilrecht und religiösem Familienrechtauslöste, sowie die gewaltsamen Auseinandersetzun-gen zwischen Hindus und Muslimen um den Tempel-bzw. Moscheenkomplex in Ayodhya boten der BJP seitMitte der 80er Jahre zahlreiche Möglichkeiten, ihreWähler zu mobilisieren. Damit erwuchs der Kongreß-partei, die zwischen 1948 und 1989 mit Ausnahme derZeit von 1977 bis 1980 stets die Regierung gestellthatte, erstmals eine ernste Konkurrenz auf nationalerEbene. Der rasante Aufstieg der BJP, die bei denWahlen 1984 nur zwei Sitze im Parlament errungenhatte, zeigt sich in der nebenstehenden Tabelle.
Eine Reihe von Studien zur Parteien- und Wähler-struktur der BJP hat auf den engen Zusammenhangzwischen den neuen Mittelschichten und der BJP-Wählerschaft hingewiesen. Die BJP-Wähler entstam-men zumeist den oberen Kasten, sind hauptsächlichjunge Städter und verfügen über eine höhere Ausbil-dung als die Wähler anderer Parteien.11
vgl. B. Vivekanandan, Globalisation and India, in: PurusottamBhattacharya/Ajitava Ray Chaudhuri (Hg.), Globalisation andIndia. A Multi-Dimensional Perspective, Neu-Delhi 2000,S. 13�25.11 Zum sozialen Hintergrund der BJP-Wähler vgl. YogendraK. Malik/V. B. Singh, Bharatiya Janata Party. An Alternative to
Tabelle:
Zahl der Abgeordneten und Stimmenanteile der
Kongreßpartei und der BJS / BJP, 1952�1999
Kongreßpartei BJS/BJP
Wahl-
jahr
Sitze Stimmen-
anteil (%)
Sitze Stimmen-
anteil (%)
1952 364 45,0 3 3,1
1957 371 47,8 4 5,9
1962 361 44,7 14 6,4
1967 283 40,8 35 9,4
1971 352 43,7 22 7,4
1977 154 34,5 * *
1980 353 42,7 * *
1984 415 48,1 2 7,4
1989 197 39,5 86 11,5
1991 227 36,4 120 20,1
1996 140 28,1 161 20,3
1998 141 25,8 182 25,7
1999 114 28,4 182 23,7
* getrennte Angaben für 1977 und 1980 fehlen, da die BJS Teilder Janata-Partei war.Quellen: David Butler/Ashok Lahiri/Prannoy Roy, India Decides:Elections 1952�1995, New Delhi 1995; Election Commission ofIndia (http://www.eci.gov.in).
Der Aufstieg der BJP und der Niedergang der Kon-greßpartei spiegeln den sozialen Wandel der indi-schen Gesellschaft im Parteiensystem wider, das langeZeit ein von der Kongreßpartei geprägtes one partydominant system war. Seit Ende der 80er Jahre hat essich in ein Mehrparteiensystem gewandelt, mit zweigroßen Parteien, der Kongreßpartei und der BJP, diejedoch auf kleinere Parteien angewiesen sind, wennsie eine Regierung bilden wollen. Vor allem Regional-parteien, die oftmals aus Abspaltungen der Kongreß-partei entstanden sind, erfuhren damit eine deutlichepolitische Aufwertung. Dies wiederum war unteranderem die Folge des wirtschaftlichen Aufstiegs dersogenannten Other Backward Castes (OBC) in den Bun-desstaaten, die von der Ausweitung der bundesstaat-lichen Quoten- und Reservierungspolitik profitierthatten. Fünf nationale Wahlen zwischen 1989 und1999 sowie die Zunahme von Minderheits- und Koali-tionsregierungen haben zwar auf den ersten Blick die
the Congress (I), in: Asian Survey, 32 (1992) 4, S. 318�336;Ralph B. Meyer/David S. Malcolm, Voting in India. Effects ofEconomic Change and New Party Formation, in: AsianSurvey, 33 (1993) 5, S. 507�519; Pradeep Chhibber, Who Votedfor the Bharatiya Janata Party, in: British Journal of PoliticalScience, 27 (1997) 4, S. 631�639.

Regionale Ebene: Von �Südasien� zum �südlichen Asien�
SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
13
Regierungsstabilität, jedoch nicht das Vertrauen derBürger in die demokratischen Institutionen desLandes beeinträchtigt.12 Obgleich eine genaue Zuord-nung schwierig ist, scheinen die, wenn auch zunächstnur bescheidenen, wirtschaftlichen Reformen seitAnfang der 80er Jahre doch die Veränderungen in derParteienlandschaft beschleunigt zu haben.
Regionale Ebene:Von �Südasien� zum �südlichen Asien�
Die Beziehungen Indiens zu seinen Nachbarn warenvon Beginn an durch ungeklärte Grenzverläufe,strittige territoriale Ansprüche und unterschiedlicheVorstellungen von nationaler Sicherheit belastet. DieIndische Union verstand sich als legitime Nachfolge-rin Britisch-Indiens und interpretierte ihre Sicher-heitsinteressen eher im regionalen als im nationalenRahmen. Am problematischsten erwiesen sich dieBeziehungen zu Pakistan. Bereits die Gründung eineseigenen Staates für die Muslime Südasiens war in derindischen Unabhängigkeitsbewegung auf erbitterteAblehnung gestoßen und hatte in der Endphase derbritischen Herrschaft zu blutigen Unruhen zwischenbeiden Religionsgemeinschaften geführt. Der anschlie-ßende Streit um die Zugehörigkeit des zunächst unab-hängigen Königreichs Kaschmir hatte zwei Kriege(1947/48 und 1965) zur Folge. Der dritte indisch-paki-stanische Krieg 1971 entwickelte sich aus dem Bürger-krieg zwischen West- und Ostpakistan. Die militäri-sche Intervention Indiens führte zur Niederlage Paki-stans und zur Unabhängigkeit Bangladeschs. Trotz desFriedensvertrags von Simla 1972 kam es auch danachimmer wieder zu militärischen Drohgebärden, zumBeispiel durch Truppenaufmärsche und Manöver(1984, 1986, 1990). Die regelmäßigen Kämpfe in denSommermonaten am Siachen-Gletscher sowie diebewaffneten Zusammenstöße an der Waffenstill-standslinie machen deutlich, daß sich beide Staaten ineinem permanenten Kleinkrieg befinden.
Seit den Nuklearversuchen Indiens und Pakistansim Mai 1998 ist deren Rivalität um eine nukleareDimension erweitert worden. Die Hoffnung, daß ana-log zum Ost-West-Konflikt die nukleare Aufrüstungeine Annäherung beider Seiten mit sich bringenwürde, schien sich mit dem Besuch des indischen
12 Vgl. A. Subrata Mitra, Das Wahlverhalten und die Legitimi-tät der indischen Demokratie, in: Indo�Asia, 39 (1997) 2,S. 34�41.
Premierministers Vajpayee in Pakistan im Februar1999 zu erfüllen. Die gemeinsame Lahore-Erklärunggalt als Beginn eines neuen Kapitels der bilateralenZusammenarbeit. Doch die Kargil-Krise im Frühsom-mer 1999 machte offenkundig, daß die nukleareStreitmacht nicht der Abschreckung diente, sondern �zumindest aus pakistanischer Sicht � das Eindringenkaschmirischer Freischärler in das indische Jammuund Kaschmir ermöglichte. Damit standen sich erst-mals zwei Atommächte in direkter militärischerKonfrontation gegenüber.13
Nehru, im internationalen Kontext in vielen Krisender 50er Jahre als Vermittler anerkannt und respek-tiert, setzte in der Region die SicherheitsinteressenIndiens ohne jede Vermittlung durch. In Fortsetzungder britischen Politik sicherte sich Indien 1949/50durch Verträge mit den Himalaya-KönigreichenBhutan, Nepal und Sikkim eine Kontrolle über derenaußenpolitische Ausrichtung vor allem im Hinblickauf die VR China. Der Einsatz militärischer Mittelblieb für Nehru, abgesehen von der Annexion Goas imDezember 1961, die Ausnahme.
Indira Gandhi entwickelte eine eigene Sicherheits-doktrin, die die Vormachtstellung der IndischenUnion gegenüber ihren Nachbarn untermauern sollte.Die nach ihr benannte Indira-Doktrin beinhaltete unteranderem die Ablehnung von Militärbasen imIndischen Ozean, was sich vor allem gegen die ameri-kanische Truppenpräsenz auf Diego Garcia richtete,sowie das Beharren auf bilateralen Verhandlungen imKonfliktfall, um Allianzen zwischen den Nachbarnund externen Großmächten oder internationalenOrganisationen zu verhindern.14 Die Indira-Doktrinbildete den Ansatzpunkt für eine Reihe politischerund militärischer Interventionen Indiens in die Nach-barstaaten, von denen die Stationierung indischerTruppen auf Sri Lanka zwischen 1987 und 1990 dieam weitesten reichende Maßnahme war. Die indischeAuffassung von nationaler Sicherheit ließ ein Dilem-ma entstehen, da die Nachbarn nicht bereit waren,ihre Sicherheitsinteressen denen der Indischen Union
13 Das Eindringen der Freischärler, die z.T. als Angehörigepakistanischer Truppenverbände identifiziert werdenkonnten, wäre ohne die militärische und logistische Unter-stützung durch pakistanische Stellen nicht möglich gewesen.14 Manchmal wird die Indira-Doktrin auch Südasien- oderindische Monroe-Doktrin genannt. Zu ihren Kernaussagenvgl. Devin T. Hagerty, India�s Regional Security Doctrine, in:Asian Survey, 31 (April 1991) 4, S. 351f; Chris Smith, India�s AdHoc Arsenal. Direction or Drift in Defence Policy?, Oxford1994, S. 110.

Die politische Dimension der Globalisierung
SWP-BerlinIndische UnionOktober 2001
14
unterzuordnen. Die Vernetzung innenpolitischer Aus-einandersetzungen mit bilateralen Konflikten undden internationalen Konstellationen des Ost-West-Kon-flikts machten Südasien in den 80er Jahren zu einerRegion �chronischer Instabilität�.15
Die Veränderungen von 1991 schlugen sich auchim Verhältnis Indiens zu seinen Nachbarn nieder.Dabei schien Indien angesichts des militärischen undpolitischen Debakels in Sri Lanka von der Indira-Doktrin allmählich abzurücken. WirtschaftlicheAspekte begannen die Beziehungen zu dominieren,und unter dem Schlagwort der �Nicht-Reziprozität�machten indische Regierungen deutlich, daß sie nunbereit waren, mehr zu geben, als sie von den kleinenNachbarn im Gegenzug erhalten konnten. Bereitsunter der Kongreßregierung von Narasimha Raowurden langanhaltende Streitigkeiten beispielsweisemit Nepal beigelegt und die wirtschaftlichen Bezie-hungen zu Sri Lanka ausgebaut. Die nachfolgende»United Front«-Regierung legte den jahrzehntelangenStreit mit Bangladesch über die Verteilung des Ganges-wassers durch einen neuen Vertrag bei. Der Außen-und spätere Premierminister der »United Front«-Regie-rung I. K. Gujral formulierte die neuen Prinzipien derindischen Außenpolitik gegenüber den Nachbarn inSüdasien:16
1. Die Beziehungen zu den Nachbarstaaten Bhutan,Bangladesch, den Malediven, Nepal und Sri Lankasollten nicht mehr auf der Grundlage der Reziprozi-tät gestaltet werden. Indien sei angesichts seinerStärke und Überlegenheit in vielen Bereichenbereit, mehr zu geben, als es von den Nachbarnerhalte.
2. Kein Staat Südasiens sollte sein Gebiet für Aktionengegen einen anderen Staat zur Verfügung stellen.
3. Es sollte keine Einmischung in die inneren Angele-genheiten der anderen Staaten geben.
4. Alle Staaten Südasiens sollten die territoriale Inte-grität und Souveränität der Nachbarn anerkennen.
5. Streitfälle sollten durch friedliche bilaterale Ver-handlungen beigelegt werden.Gujral plädierte damit für eine »Politik der guten
Nachbarschaft«,17 die die Indira-Doktrin mit ihrerPolitik der Stärke und inneren Einmischung ablösen
15 Vgl. Sandy Gordon, Resources and Instability in South Asia,in: Survival, 35 (1993) 2, S. 66�87.16 Vgl. I. K. Gujral, A Foreign Policy for India, ohne Ort 1998,S. 37f. Vgl. auch ohne Autor, �Our Neighbours and Our World�,Interview von I. K. Gujral in: Frontline, 4.�17.4.1997, S. 12.17 Vgl. Hans-Georg Wieck, Indiens Politik der guten Nachbar-schaft, in: Aussenpolitik, (1997) 3, S. 291�300.
sollte. Politische Kriterien wie nationale Sicherheit,die noch zu Zeiten Indira Gandhis die Beziehungen zuden Nachbarstaaten geprägt hatten, sollten jetzt diebilateralen Beziehungen weniger bestimmen als wirt-schaftliche Fragen. Auch die regionale Zusammen-arbeit erhielt eine deutlich größere Bedeutung in derAußenpolitik. Da aber die Erfolge der Zusammen-arbeit von der Stärke der Beteiligten abhängig sind,kann angesichts der Dominanz Indiens davon aus-gegangen werden, daß das Land mit dieser neuenaußenpolitischen Strategie keinen allzu großenMachtverlust gegenüber seinen kleineren Nachbarnerleiden wird. Der Wandel war dennoch bedeutsam,weil Gujral der Zusammenarbeit und den vertrauens-bildenden Maßnahmen ein merklich größeresGewicht in der Außenpolitik einräumte.
Selbst wenn üblicherweise nur die Staaten Süd-asiens zu den Nachbarn Indiens gezählt werden,erlaubt es der von indischen Politikern immer wiederbenutzte Begriff der �erweiterten Nachbarschaft�(extended neighbourhood), auch die Beziehungen zu Süd-ostasien einzubeziehen, zumal Indien mit Myanmareine Land- und mit Indonesien eine Seegrenze besitzt.Nach seinem Amtsantritt 1991 verfolgte Premiermini-ster Rao eine Look East Policy, mit der vor allem die wirt-schaftlichen Beziehungen zu den ost- und südostasiati-schen �Tigerstaaten� verbessert werden sollten. Nebenden wirtschaftlichen Verbindungen haben sich in denletzten Jahren auch die politischen Kontakte mit Süd-ostasien intensiviert. Seit 1992 war Indien sektoraler,ab 1996 vollständiger Dialogpartner der ASEAN, seit1993 ist es im neugegründeten ASEAN Regional Forum(ARF) vertreten, in dem sicherheitspolitische Fragenmit bedeutenden internationalen Akteuren wie denUSA, der EU und China erörtert werden.
Durch neue Regionalorganisationen wie die 1997gegründete Indian Ocean Rim Association for RegionalCooperation (IORARC) oder die Bangladesh, India,Myanmar, Sri Lanka and Thailand Economic Coopera-tion (BIMSTEC) konnte die institutionelle Zusammen-arbeit mit den beteiligten Staaten Südostasiens eben-falls verstärkt werden. Während Indien für die ASEANwirtschaftlich ohne größere Bedeutung ist, habeneinzelne Staaten wie Singapur ein Interesse, Indienstärker sicherheitspolitisch in die Region einzubinden.Damit wollen sie chinesischen Hegemonieansprüchenim südchinesischen Meer begegnen. Während dieIndustrienationen die indischen Nuklearversucheverurteilten, hielten sich die Staaten Südostasiens mitKritik zurück. Die indische Regierung folgerte daraus,

Internationale Ebene: Außenpolitisches Realignment zwischen Interdependenz und Großmachtanspruch
SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
15
daß die ASEAN Indien als »balancing power«18 gegen-über China anerkannt hatte.
Nach der Regierungsübernahme durch die BJP 1998erfolgte eine erweiterte Festlegung indischer Sicher-heitssphären und Einflußzonen. Wurde zu Zeiten vonNehru, Indira und Rajiv Gandhi noch �Südasien� (SouthAsia) als nationale Sicherheitsregion reklamiert,dehnte die BJP-Regierung nun die außenpolitischenSicherheitsinteressen Indiens deutlich aus. Außen-minister Singh gab in verschiedenen Reden zu ver-stehen, daß sich Indiens nationale Interessen nichtmehr auf Südasien (South Asia), sondern auf das �süd-liche Asien� (Southern Asia) konzentrieren. Indien erhobAnspruch auf eine internationale Ordnungsfunktion,die Südostasien, Zentralasien, den arabischen Raummit Israel sowie den Indischen Ozean umfaßt. »India isbut just about 90 odd nautical miles from thenorthern-most Province of Indonesia-Aceh. Devel-opments, therefore, in the entire South-East Asianregion are a matter of direct consequence to us. Inanother direction, from the northern most point ofIndia, which is now part of Pakistan-occupied Kash-mir, Tajikistan is a mere 35 kms away; thus theCentral Asian lands define that part of our region.«19
Abzuwarten ist allerdings, ob diese VorstellungenBestandteil des außenpolitischen Konsenses indischerParteien werden oder ob sie eine von der jeweiligenRegierungskonstellation abhängige Variable bleiben.
Internationale Ebene: AußenpolitischesRealignment zwischen Interdependenz undGroßmachtanspruch
Die indische Außenpolitik hat von Anfang an ihreEigenständigkeit gegenüber den Blöcken des KaltenKrieges betont und eine eigene Großmachtrolle iminternationalen System angestrebt. Diese Politikwurde von den USA, der UdSSR und China zunächstgleichermaßen kritisch verfolgt. Die Beziehungen zudiesen drei Staaten wurden in der Folge zum Dreh-und Angelpunkt für das Verständnis indischer Außen-politik, da sie in der Ära des Kalten Krieges über Machtund Status im internationalen System entschieden.
18 Government of India, Ministry of External Affairs, AnnualReport 1998�99, Neu-Delhi 1999, S. 77.19 Jaswant Singh, India�s Perspective on International andRegional Security Issues, Vortrag am 17.1.2001, Berlin, verteil-tes Manuskript, S. 12f. Ein Abdruck der Rede findet sich auchauf der Homepage der indischen Botschaft in Deutschlandunter http://www.indianembassy.de/dgap.htm.
USA � China � Sowjetunion
Nehru hatte durch seine Bemühungen um regionaleKrisenbeilegung in den 50er Jahren hohes internatio-nales Ansehen erworben, doch die militärische Nieder-lage gegen China 1962 wurde zum Trauma für seineaußenpolitischen Vorstellungen. Die konventionelleBedrohung wurde nach dem ersten chinesischenAtomtest 1964 um eine nukleare Komponente erwei-tert. Während China 1968 als anerkannte Nuklear-macht Mitglied des NVV wurde, lehnte Indien einenBeitritt als Nicht-Nuklearwaffenstaat ab. Seine Groß-machtambitionen bekundete Indien mit dem erstenNuklearversuch 1974, dem eine Reihe von Sanktionenfolgten, obwohl Indien nicht Mitglied des NVV war.
Das Verhältnis zwischen Indien und den USA ver-schlechterte sich in der zweiten Hälfte der 60er Jahre.Die USA, die Weltbank und der InternationaleWährungsfonds drängten Indira Gandhi zu innenpoli-tischen Reformen und nutzten die AbhängigkeitIndiens als Druckmittel aus, was mit den indischenVorstellungen von Eigenständigkeit nicht zu verein-baren war.20 Mit der Annäherung Chinas an die USAund der Aufnahme als ständiges Mitglied in denSicherheitsrat der VN 1971 stieg die Volksrepublikendgültig zur international anerkannten Großmachtauf. Parallel zur Verbesserung der chinesisch-amerika-nischen Beziehungen im Sommer 1971 eskalierte derBürgerkrieg zwischen der Unabhängigkeitsbewegungin Ostpakistan, die von Indien unterstützt wurde, unddem Militärregime in Westpakistan, das Unterstüt-zung von den USA erhielt. Die Annäherung an Chinaund die Unterstützung Pakistans durch die USA veran-laßten Indien im August 1971, einen Freundschafts-vertrag mit der Sowjetunion zu unterzeichnen. Wäh-rend sich die indisch-amerikanischen Beziehungen inder Folge weiter verschlechterten, wurde Indien zueinem der größten Empfänger sowjetischer Wirt-schaftshilfe und Rüstungsgüter. Damit verbanden sichaber weder innen- noch außenpolitische Auflagen, sodaß Indien seiner Politik der Eigenständigkeit treubleiben konnte.
Mit der Abschwächung des Ost-West-Konflikts abMitte der 80er Jahre begann eine Phase der Wieder-annäherung Indiens sowohl an die USA als auch anChina. Während der Regierungszeit Rajiv Gandhis(1984�1989) erfolgten zahlreiche hochrangige Staats-
20 Vgl. Vijay Sen Budhraj, Indian Foreign Policy: The IndiraGandhi Era, 1966�1976, in: Surendra Chopra (Hg.), Studies inIndia�s Foreign Policy, Amritsar 1983, S. 27.

Die politische Dimension der Globalisierung
SWP-BerlinIndische UnionOktober 2001
16
besuche, die die Beziehungen zu beiden Staaten aufeine neue Grundlage stellten. Mit der Öffnung derindischen Wirtschaft erhielten die indisch-amerikani-schen Beziehungen einen weiteren Schub. Angesichtsder neuen internationalen Konstellationen entdecktenbeide Seiten neue gemeinsame Interessen, zum Bei-spiel im Kampf gegen den militanten islamischenFundamentalismus, gegen den internationalen Terro-rismus oder gegen den Drogenhandel, und betontenstärker als in der Vergangenheit ihre gemeinsamendemokratischen Werte.21
Die Differenzen über das indische Atomprogrammblieben jedoch bestehen, so daß die USA und eineReihe weiterer Industriestaaten Sanktionen gegenIndien und Pakistan nach deren Nukleartests im Mai1998 verhängten, obwohl keiner der beiden StaatenMitglied des NVV war und insofern auch nicht gegenbestehende Verträge verstoßen hatte. Indien verkün-dete im Herbst 1998 ein Testmoratorium und stellteden Beitritt zum CTBT in Aussicht, wenngleich diedamit verknüpfte Bedingung eines innenpolitischenKonsenses kaum zu erreichen sein dürfte. In den bila-teralen Gesprächen mit den USA rückte Indien nichtvon seiner Politik ab, eine minimum nuclear deterrenceaufzubauen. Dennoch zeichnete sich ein Kompromißab, als hochrangige indische Politiker zu verstehengaben, daß Indien den Normen und Prinzipien inter-nationaler Rüstungskontrollverträge durchaus folgenkönnte, ohne diesen jedoch beizutreten.22
Der Besuch von US-Präsident Bill Clinton im März2000 in Indien leitete eine neue Phase der bilateralenBeziehungen ein. Galten Indien und die USA langeZeit als »estranged democracies«,23 bezeichnete Pre-mierminister Vajpayee sie nun als »natural allies«.Indien zeigt großes Interesse an der Zusammenarbeitmit den USA, etwa in Fragen der Hochtechnologie,und hofft auf deren Unterstützung für seine Bewer-bung um einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat derVN. Auf der anderen Seite haben die USA ein großesInteresse an einer engeren sicherheitspolitischenZusammenarbeit mit Indien in der Golfregion, wie derneue US-Außenminister Powell deutlich machte.
21 Vgl. hierzu u.a. Selig S. Harrison/Geoffrey Kemp, India &America. After the Cold War, Washington: Carnegie Endow-ment for International Peace, 1993.22 Vgl. Jaswant Singh, Against Nuclear Apartheid, in: ForeignAffairs, 77 (September/Oktober 1998) 5, S. 41�51.23 So der Titel des Buchs von Dennis Kux, Estranged Democ-racies. India and the United States 1941�1991, London/Neu-Delhi 1994.
Die Indische Union reagierte, zur allgemeinenÜberraschung, auch positiv auf die Vorschläge derneuen US-Administration von Präsident Bush, eineNational Missile Defence (NMD) zu errichten. Die ame-rikanische NMD-Initiative kommt den außenpoliti-schen Interessen Indiens in verschiedenen Punktenentgegen. Im Kern sehen die amerikanischen Vor-schläge erstens ein Abrücken von dem Prinzip dergegenseitigen Abschreckung vor, zweitens eine deut-liche Reduzierung der noch bestehenden nuklearenPotentiale sowie drittens eine neue Haltung zu Fragender nuklearen Proliferation. Indien gilt seit jeher alsBefürworter einer weltweiten nuklearen Abrüstungund lehnte das Prinzip der gegenseitigen Abschrek-kung ab, so daß sich hier eine Übereinstimmung derInteressen ergibt. Von größtem strategischem Inter-esse dürften aber für die indische Regierung die verän-derten internationalen Sicherheitsstrukturen sein, diedurch NMD entstehen könnten. Diese neuen Struk-turen könnten, so die Überlegungen indischer Politi-ker und Sicherheitsexperten, die Bedeutung des NVVlangfristig verringern.24 Dies würde einerseits dieindische Kritik an dem Vertrag bekräftigen, anderer-seits dürfte damit eine zentrale Hürde überwundensein, die bislang einer internationalen AufwertungIndiens zur Großmacht im Wege stand. Die positiveReaktion Indiens auf die NMD-Vorschläge kann des-halb als Absichtserklärung der BJP-Regierung verstan-den werden, die indisch-amerikanischen Beziehungenauszubauen, um eine weitere Annäherung bei Fragender internationalen Sicherheit zu erreichen. BeideSeiten haben zudem ihre Absicht bekräftigt, imIndischen Ozean enger zu kooperieren.
Die Beziehungen zur VR China haben sich seit Endeder 80er Jahre ebenfalls deutlich verbessert. Zur Dis-kussion über die Regelung von Dauerkonflikten wiedem ungeklärten Grenzverlauf zwischen beidenStaaten wurde 1989 eine joint working group (JWG) ein-gerichtet. Abkommen über den Status quo an derGrenze (1993) sowie über vertrauensbildende Maß-nahmen (1996) brachten eine weitere Entspannung imbilateralen Verhältnis. Trotz der chinesischen Kritikan den indischen Nukleartests und der indischen Vor-behalte gegenüber der militärischen Zusammenarbeitzwischen China und Pakistan im Bereich der Nuklear-und Raketentechnologie entdeckten beide Staaten
24 Vgl. Raja C. Mohan, The Armitage Mission, in: The Hindu,10.5.2001. Zu den negativen Folgen von NMD für Indien, z.B.durch die mögliche nukleare Aufrüstung und Modernisie-rung der chinesischen Arsenale, vgl. u.a. Achin Vanaik, India�sResponse to the NMD, in: The Hindu, 25.5.2001.

Internationale Ebene: Außenpolitisches Realignment zwischen Interdependenz und Großmachtanspruch
SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
17
gemeinsame Sicherheitsinteressen. Der militante isla-mische Fundamentalismus stellt eine Bedrohung dar,mit der Indien in Kaschmir und China in seinen west-lichen Landesteilen konfrontiert ist. Beide Staatenhaben auch gemeinsame Vorstellungen von einerpolyzentrischen bzw. multipolaren Struktur des inter-nationalen Systems. Sie wenden sich damit gegeneinen westlichen Unilateralismus bzw. das Hegemo-niestreben einer Supermacht wie den USA. Trotz allerbilateralen Probleme führten die gemeinsamen Inter-essen zu neuen Formen der Zusammenarbeit. Soverurteilte Indien die Bombardierung der chinesi-schen Botschaft in Belgrad durch die NATO währenddes Kosovo-Krieges 1999 und stimmte unter anderemim April 2001 in der VN-Menschenrechtskonferenz inGenf gegen einen Vorschlag der USA, die Menschen-rechtspolitik Chinas zu verurteilen.25
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nor-malisierten sich zunächst die Beziehungen zwischenIndien und Rußland. Der neue, 1993 geschlosseneFreundschaftsvertrag enthielt im Gegensatz zu 1971keine Klauseln mehr über eine mögliche Beistands-verpflichtung im Krisenfall. Durch die enge militä-rische und technologische Zusammenarbeit, zum Bei-spiel im Bereich der Nuklear- und Raketentechnologie,hat Rußland für Indien weiterhin einen hohen Stellen-wert. Dies kam sowohl während des Staatsbesuchsvon Premierminister Putin im Oktober 2000 als auchin den umfangreichen Rüstungsvereinbarungen imFebruar 2001 zum Ausdruck.
Deutschland � Europäische Union
Für die Bundesrepublik Deutschland stand Indien bisMitte der 90er Jahre im Schatten der aufstrebendenVolkswirtschaften Südostasiens. Dies zeigte sich indem eingangs erwähnten Asien-Konzept der Bundes-regierung 1993/94, das hauptsächlich auf wirtschaft-liche Fragen ausgerichtet war. Deutschland ist einerder wichtigsten bilateralen Handelspartner derIndischen Union, die wiederum seit Jahren zu dengrößten Empfängern bundesdeutscher Entwicklungs-hilfe zählt. Die wichtigsten deutschen Exportgüterkommen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektro-technik sowie aus dem Chemie- und Pharmasektor.Die indische Industrie liefert bislang vor allem Tex-tilien und Lederwaren nach Deutschland, bemüht sich
25 Vgl. Raja C. Mohan, India Backs China on Human Rights,in: The Hindu, 19.4.2001.
aber um eine Diversifizierung ihrer Exporte etwa impharmazeutischen Bereich. Die Einführung einer greencard in Deutschland hat das indische Potential imBereich Informationstechnologie und Softwareent-wicklung erkennen lassen. Indische Experten bildetendie größte nationale Gruppe, die im ersten Jahr nachder Einführung der green card nach Deutschland kam.
Neben den wirtschaftlichen Interessen nähertensich auch die sicherheitspolitischen Vorstellungen an.Nach dem Ende des Kalten Krieges zeigte sich immerdeutlicher, daß Indien zentrale Wertvorstellungen wieDemokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, dasBekenntnis zu marktwirtschaftlichen Strukturen, aberauch die Sicherheitsinteressen im Kampf gegen deninternationalen Terrorismus und den Drogenhandelmit der westlichen Staatengemeinschaft teilte.
Die Bundesrepublik verhängte nach den indischenAtomtests im Mai 1998 Sanktionen und gab keineNeuzusagen mehr im Bereich der finanziellen Zusam-menarbeit. Die Zunahme hochrangiger Besuche nachdem Regierungswechsel in Bonn 1998 unterstreichtjedoch, daß Deutschland, trotz vorhandener Unter-schiede hinsichtlich der Nuklearpolitik, mittlerweiledie politischen Gemeinsamkeiten mit der IndischenUnion höher bewertet und in dem Land einen wichti-gen Partner im internationalen System des 21. Jahr-hunderts sieht. Erfolge im Kampf gegen internatio-nalen Terrorismus, Drogenhandel, grenzüberschrei-tende Kriminalität und nukleare Weiterverbreitungals zentrale Herausforderungen für die internationaleStaatengemeinschaft werden ohne eine aktive Ein-beziehung Indiens nicht zu bewerkstelligen sein. Süd-asien kann als �gefährlichster Ort der Welt� im21. Jahrhundert gelten, da sich hier die genanntenProbleme wie in sonst keiner anderen Region bün-deln.26 Trotz seiner innenpolitischen Probleme bleibtIndien der zentrale Stabilitätsanker in der Region.
Die Beziehungen Indiens zur EU haben sich bislangvor allem auf wirtschaftliche Fragen konzentriert.Indien war das erste nicht zur Europäischen Gemein-schaft gehörende Land, das bereits 1962 eine eigeneVertretung in Brüssel eröffnete.27 Die ersten Verträgemit der EG wurden 1973 geschlossen, der jüngste
26 Vgl. Christian Wagner, Der �gefährlichste Platz der Welt?�Südasien am Beginn des 21. Jahrhunderts, in: HessischeStiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK), Bulletin,(Frühjahr 2000) 8, 6 S. (http://www.hsfk.de/fg1/proj/abm/bulletin/pdfs/wagner1.pdf).27 Vgl. Dietmar Rothermund, Europe and India: The Needfor Greater Mutual Awareness, in: Asien, (Juli 2001) 80,S. 116�125.

Die politische Dimension der Globalisierung
SWP-BerlinIndische UnionOktober 2001
18
Vertrag über �Partnerschaft und Entwicklung� wurde1994 unterzeichnet. Zudem wurden eine gemeinsameKommission sowie drei Unterkommissionen zu denBereichen Handel, wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklungszusammenarbeit eingerichtet.28
Trotz Liberalisierung und Exportförderung inIndien haben sich die wirtschaftlichen Beziehungenmit der EU in den 90er Jahre asymmetrisch entwik-kelt.29 Während der Handel mit der EU für Indienimmer wichtiger wird, spielt Indien wirtschaftlich fürdie EU so gut wie keine Rolle. Die EU, mittlerweile dergrößte Handelspartner Indiens, nimmt ca. 25 bis 30%der indischen Ausfuhren auf. Demgegenüber liegt derAnteil Indiens am Gesamthandel der EU bei lediglichca. 1,3%.30 Die indische Industrie beklagt regelmäßigdie Handelsrestriktionen etwa durch Mengen-beschränkungen, Industrienormen und Sozial-standards, während die EU die weiterhin hohen Zöllesowie die schleppende Bürokratie und Probleme derInfrastruktur bemängelt.
Da Indien 1996 nicht Mitglied der ASEM wurde,blieben die Beziehungen zur EU auf bilaterale Kon-takte beschränkt. Die Vereinbarung über erweiterteZusammenarbeit zwischen Indien und der EU von1996 betonte die gemeinsamen sicherheitspolitischenInteressen und gab unter anderem die Intensivierungdes politischen Dialogs sowie die Verbesserung vonHandel und Investitionen als Ziele vor.31 Der Wider-streit zwischen nationalen und europäischen Inter-essen in außen-, sicherheits- und wirtschaftspoliti-schen Fragen schafft immer wieder Irritationen inIndien. Während die EU die Atomtests 1998 kritisierteund einige Staaten Sanktionen verhängten, hatteFrankreich als langjähriger sicherheitspolitischerPartner Indiens größeres Verständnis für dessennukleare Ambitionen. Das komplizierte System der EUmacht es zudem für Staaten wie Indien schwierig,handelspolitische Erleichterungen zu erlangen.32
Das erste gemeinsame Gipfeltreffen zwischenIndien und der EU im Juni 2000 in Lissabon bedeutete
28 Eine Übersicht über verschiedene Dokumente der Zusam-menarbeit zwischen Indien und der EU bietet http://europa.eu.int/comm/external_relations/india/intro/index.htm.29 Vgl. J. D. Pedersen, India and the EC in a New World Order,in: Contemporary South Asia, 2 (1993) 3, S. 265�284.30 Zu den Zahlenangaben vgl. Batuk Gathani, EU SeekingGreater Trade, in: The Hindu, 2.3.2000; K. K. Katyal, E.U., aMajor Factor for India, in: The Hindu, 26.6.2000.31 Vgl. Commission of the European Communities, EU�IndiaEnhanced Partnership, Brüssel 1996, S. 12f.32 Vgl. Saran Rohit, Si! No! May Be.., in: India Today,20.7.2000.
für Indien eine weitere internationale Aufwertung, daes als drittes asiatisches Land nach Japan und Chinavon der EU zu einem solchen Gipfeltreffen eingeladenwurde. In ihrer gemeinsamen Erklärung betontenbeide Seiten ihren Wunsch nach einer verstärktenZusammenarbeit, unter anderem im Kampf gegen denTerrorismus und Drogenhandel. Die EU hob das frei-willige Testmoratorium Indiens und seine Bereitschafthervor, dem allgemeinen Teststoppabkommen beizu-treten. Zugleich konnten Handelsprobleme beigelegtwerden, da Indien unter anderem Zugeständnisse fürTextileinfuhren in die EU erhielt. Beide Seiten verstän-digten sich darauf, ihren Dialog auf der Track II-Ebenedurch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen ThinkTanks in Europa und Indien auszubauen.
Aufgrund der ähnlich gelagerten politischen undwirtschaftlichen Vorstellungen über regionale undinternationale Sicherheit ergeben sich eine Reihepotentieller Kooperationsfelder zwischen Indien, derEU und Deutschland. Von deutscher und europäischerSeite sollte weiterhin darauf gedrängt werden, daßIndien in die ASEM aufgenommen wird, zumal dieserWunsch sowohl von Indien selbst als auch von ver-schiedenen Staaten Europas und Asiens geäußertwird. Gemeinsame Sicherheitsinteressen haben Euro-pa, Deutschland und Indien in Zentralasien, vor allemdas Interesse, der Ausbreitung des militanten isla-mischen Fundamentalismus zu begegnen. Hier sindDeutschland und Europa über ihre Mitgliedschaft inder OSZE fast Nachbarn der Indischen Union, die ihreBeziehungen zu den zentralasiatischen Republikenseit Anfang der 90er Jahre ebenfalls ausgebaut hat.
Ein zweiter Bereich, der sich für eine intensivereZusammenarbeit anbietet, ist der Nahe Osten. Sowohldie EU als auch Indien haben ihr Interesse an einemstärkeren Engagement in der Region bekräftigt. Durchseine prominente Rolle in der Bewegung der Block-freien Staaten pflegt Indien seit Jahren gute Beziehun-gen zur arabischen Welt und hat erst seit wenigen Jah-ren vor allem seine militärischen Kontakte zu Israelintensiviert. Durch seine Abhängigkeit von Erdöl-einfuhren und von den Arbeitsmöglichkeiten für indi-sche Gastarbeiter haben der Nahe und Mittlere Osteneinen hohen wirtschaftlichen Stellenwert für Indien.
Zusammenfassung
Die Liberalisierung hatte weitreichende Folgen impolitischen Bereich. Während die indischen Groß-machtambitionen eine gewisse Kontinuität aufweisen,

Zusammenfassung
SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
19
haben die veränderten parteipolitischen Konstellatio-nen neue Akteure in den außenpolitischen Entschei-dungsprozeß gebracht. Die Verlagerung auf wirt-schaftliche Fragen hat die Beziehungen zu denmeisten Nachbarn entspannt, wobei Pakistan auf-grund des Kaschmirkonflikts ein Sonderfall bleibt. Iminternationalen Kontext hat Indien eine deutliche Auf-wertung erfahren. Allein die internationale Aufmerk-samkeit, die Indien seit Anfang der 90er Jahre zuteilwurde, läßt die These zu, daß Indien eher ein Gewin-ner denn ein Verlierer der internationalen Verände-rungen seit dem Ende des Kalten Krieges ist.

Die wirtschaftliche Dimension der Globalisierung
SWP-BerlinIndische UnionOktober 2001
20
Die wirtschaftliche Dimension der Globalisierung
Die nationale Ebene:Von der mixed economy zur Liberalisierung
Die Politik der Eigenständigkeit schlug sich nicht nurin der Außen-, sondern auch in der Innenpolitiknieder. Indien versuchte mit seinem Staats- und Ent-wicklungsmodell wie kaum ein anderes Land in derPhase des Kalten Krieges, einen dritten Weg zwischenwestlichem Kapitalismus und sozialistischer Planwirt-schaft einzuschlagen. Während sich das politischeSystem an den Traditionen und Institutionen derbritischen Westminster-Demokratie orientierte, nahmdie indische Wirtschaftspolitik stärkere Anleihen beisozialistischen Vorbildern wie der Sowjetunion.Ausgehend von den zahllosen Entwicklungsproble-men in allen Bereichen sollte eine staatliche Planungdie Modernisierung des Landes vorantreiben undzugleich die Probleme kapitalistischer Marktordnungumgehen.33 Bei der Umsetzung dieser �gemischten�Wirtschaftspolitik (mixed economy) sollte der Staat alszentraler Motor der Entwicklung fungieren. Er kon-trollierte nicht nur die wichtigsten Wirtschaftszweige,sondern übte durch ein weitverzweigtes Netz vonLizenzen, Quoten und Genehmigungen bürokratischeKontrolle über die Privatwirtschaft aus. Dieses Systemwurde in Analogie zur britischen Kolonialzeit (BritishRaj) als permit-licence-quota-raj bezeichnet.
Während kleinere Staaten in Südostasien Export-produktion und Weltmarktintegration als Entwick-lungsstrategien verfolgten, setzte die Indische Unionauf eine Politik der Importsubstitution, das heißt aufeine Entwicklung des Binnenmarkts, der durch hoheZollmauern vom Weltmarkt abgeschirmt war.34 Dem-zufolge sank Indiens Anteil am Weltmarkt von über2% in den 50er Jahren auf weniger als 1% in den 80erJahren. Obwohl die Landwirtschaft der wichtigsteWirtschaftssektor war � im Hinblick auf ihren Anteilam BIP und die Zahl der dort Beschäftigten �, erhieltsie nur eine vergleichsweise geringe Förderung. Stattdessen wurden Ende der 50er Jahre die Prioritäten auf
33 Für seine kritische Sicht des westlichen und sowjetischenEntwicklungsmodells vgl. Nehru, The Discovery of India,S. 548.34 Vgl. Economist Intelligence Unit, India. Towards Globaliza-tion, London 1995, S. 3.
die (Schwer-) Industrie verlagert. Von den insgesamt163 Mrd. Rupien der drei ersten Fünfjahrespläne ent-fielen nur 19 Mrd. auf die Landwirtschaft, die weit-gehend in privater Hand lag. Die Mißernten Mitte der60er Jahre führten der indischen Regierung allerdingsdie weiterhin bestehende hohe Abhängigkeit der öko-nomischen Entwicklung von der Landwirtschaft vorAugen. Die �Grüne Revolution� brachte deutlicheSteigerungen der Erträge, doch blieb sie auf wenigeGetreidesorten wie Weizen und auf einzelne Gebietewie den Punjab beschränkt.35
Mittlerweile hat Indien die Selbstversorgung mitNahrungsmitteln erreicht, doch besteht bis heute einehohe Abhängigkeit von der Landwirtschaft. DerenAnteil am BIP ist zwar 1998/99 auf ca. 29% gesunken,sie nimmt aber noch immer mehr als 60% der Arbeits-kräfte im Lande auf.36 Die indische Wirtschaft kannmit einer Reihe von Erfolgen aufwarten, etwa demAufbau der Schwerindustrie oder der Entwicklungeines eigenen Weltraum- und Nuklearprogramms. DieImportsubstitution hat eine ausgedehnte Konsum-güterindustrie entstehen lassen, deren Erzeugnissejedoch kaum mit ausländischen Waren konkurrierenkönnen. Die durchschnittliche jährliche Wachstums-rate, die sogenannte Hindu rate of growth, lag bis zumBeginn der Liberalisierung bei ca. 3,5% � angesichtseines Bevölkerungswachstums von ca. 2% zu wenig fürdauerhafte Entwicklungserfolge und eine nachhaltigeVerringerung der Armut. Die unzureichende Lebens-qualität zeigt sich auch darin, daß Indien unter 174Staaten nur Rang 128 auf dem Human DevelopmentIndex 2000 belegte. Zudem verwandelte sich diepolitische Ökonomie, im Sinne staatlicher Planungund eines großen Staatssektors, in eine �politisierte�Ökonomie, in der das enge Zusammenspiel von Partei-politik und staatlich kontrollierter Wirtschaft der Aus-breitung von Patronage und Korruption vielfältig Vor-schub leistete.
Trotz aller Entwicklungsanstrengungen blieb dieindische Wirtschaft auf internationale Entwicklungs-
35 Vgl. Dietmar Rothermund, Indiens wirtschaftliche Entwick-lung, Paderborn 1985.36 Vgl. Tata Services, Statistical Outline of India 2000�2001,Mumbai 2000, S. XVI.

Die nationale Ebene: Von der mixed economy zur Liberalisierung
SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
21
hilfe angewiesen, wobei die USA und die UdSSR diewichtigsten Geberländer waren. Während die USAihre Hilfslieferungen mit einer Reihe wirtschaftlicherReformen verbanden, etwa der Abwertung der Rupiein den 60er Jahren, verständigten sich Indien und dieSowjetunion auf die Verrechnung von Rubel gegenRupien. Die Sowjetunion wurde einer der wichtigstenLieferanten von Rüstungsgütern und von Rohöl, dievon Indien nicht in harten Devisen bezahlt werdenmußten. Im Gegenzug belieferte Indien die Märkte desOstblocks mit Konsumgütern, deren Qualität aller-dings mangels Wettbewerb deutlich hinter internatio-nalen Standards zurückblieb.
Vor allem im Vergleich zur Entwicklung in Ost- undSüdostasien zeigen sich die wirtschaftlichen undsozialen Defizite der indischen Entwicklungsstrategie.Galt Indien in den 50er Jahren noch als alternativesEntwicklungsmodell zu China, genießt das chinesi-sche Modell mittlerweile international eine deutlichhöhere Reputation als das indische.37 Ausgehend voneiner mit Indien vergleichbaren Basis in den 50erJahren haben Staaten wie Südkorea inzwischen denSprung in die OECD geschafft oder zählen wie Taiwanzur Gruppe der NIC. Vergleichende Studien unter-schiedlicher Entwicklungswege haben herausgearbei-tet, daß weniger kulturelle Faktoren wie Hinduismusund Kastensystem, sondern vor allem institutionelleFaktoren wie ein wenig durchsetzungsfähiger Staat(soft state), fehlende Landreformen sowie eine unzurei-chende Alphabetisierung und Gesundheitsfürsorge fürdie wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Indi-schen Union verantwortlich sind.38
Nach den ersten zaghaften Reformen Ende der 70erJahre unter der Janata-Regierung lockerten Indira undspäter Rajiv Gandhi die Importbeschränkungen undförderten in den 80er Jahren die Exportproduktion.Damit wuchs auch die Verschuldung des Landes von18% 1984/85 auf 27% 1989/90.39 Die Golfkrise 1990/91
37 Vgl. dazu Beate Kruse, Indien und die VR China in derWeltwirtschaft � Ein Vergleich, in: Werner Draguhn (Hg.),Indien. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Hamburg: Institutfür Asienkunde, 1999, S. 289�300.38 Für den Vergleich der Entwicklungswege vgl. DieterSenghaas/Ulrich Menzel, Europas Entwicklung und die DritteWelt. Eine Bestandsaufnahme, Frankfurt a.M. 1986, S. 136f;Robert Wade, East Asia�s Economic Success: Conflicting Per-spectives, Partial Insights, Shaky Evidence, in: World Politics,44 (Januar 1992), S. 270�285; Jean Drèze/Amartya Sen, India.Economic Development and Social Opportunity, Delhi 1996,S. 38�42.39 Michael von Hauff, Die steigende Verschuldung Indiensund ihre wirtschaftlichen Konsequenzen, in: Internationales
und die mit ihr einhergehende Verteuerung derÖlpreise sowie der Zusammenbruch der Sowjetunionund des Ostblocks, durch den Indien seine wichtigstenAbsatzmärkte verlor, führten im Sommer 1991 zueiner schweren Zahlungsbilanzkrise, so daß Einfuhrennur noch für zwei Wochen finanziert werdenkonnten.40 Erst diese verschiedenen externen Schocksbewirkten einen grundlegenden Wandel des indischenWirtschaftsmodells. Während Indira und Rajiv Gandhimit ihren großen politischen Mehrheiten im Parla-ment nur schrittweise Reformen gegen den Wider-stand der Interessengruppen und Fraktionen durch-setzen konnten, mußte der im Sommer neugewähltePremierminister Narasimha Rao das Reform-programm des Internationalen Währungsfonds miteiner der schwächsten Mehrheiten aller Kongreß-regierungen umsetzen.
Die Liberalisierung zielte auf einen Rückzug desStaates, zum Beispiel durch Privatisierung der Bundes-und Landesbetriebe, auf eine Stärkung des Privat-sektors sowie auf Reformen in der Handelspolitik,etwa den Abbau von Zollmauern oder die Förderungausländischer Direktinvestitionen.41 Im Vergleich zurmixed economy stellte diese neue Wirtschaftspolitikunzweifelhaft eine Revolution dar.42 Trotz der bereitserwähnten Widerstände einzelner Gruppen in denParteien oder der Gewerkschaften entwickelte sich beiden großen Parteien einschließlich der CommunistParty of India/Marxist (CPI/M) ein breiter Konsens überdas neue �Mantra� der Liberalisierung. Bei den ver-schiedenen Regierungswechseln im Verlauf der 90erJahre kam es deshalb auch nicht zu einer grundsätz-lichen Abkehr von der Reformpolitik. Yashwant Sinha,Finanzminister der BJP-Regierung nach 1998, brachteden erreichten parteiübergreifenden Konsens auf diekurze Formel: »The clock won�t be turned back.«43
Obwohl zwischen den größten Parteien ein Konsensüber die Notwendigkeit der weiteren Liberalisierungund der Weltmarktintegration herrscht, sollte nichtübersehen werden, daß es innerhalb der Parteien bzw.
Asienforum, 23 (1992) 3�4, S. 213�226.40 Zur Entwicklung der wirtschaftlichen Situation in den80er Jahren und den Ursachen der Krise 1991 vgl. V. Joshi/I. M. D. Little, India: Macroeconomics and Political Economy1964�1991, Washington 1994, S. 180�200.41 Einen Überblick über die Reformen bieten Vijay Joshi/I. M. D. Little, India�s Economic Reforms 1991�2001, Neu-Delhi1996.42 Economist Intelligence Unit, India, S. 1.43 Sridhar Krishnaswami, The Clock Won�t Be Turned back:Sinha, in: The Hindu, 18.4.1998.

Die wirtschaftliche Dimension der Globalisierung
SWP-BerlinIndische UnionOktober 2001
22
in parteinahen Organisationen zum Teil beträchtlicheWiderstände gegen diesen Kurs gibt. So trat die BJP beider Wahl 1998 mit dem swadeshi-Konzept an, um Teileder einheimischen Industrie vor der ausländischenKonkurrenz zu schützen. Wenngleich die BJP diesesKonzept nach ihrem Regierungsantritt wieder fallenließ, wenden sich einflußreiche Gruppen wie dieradikal hindu-nationalistische Rashtriya SwayamsevakSangh (RSS) weiterhin gegen eine allzu umfassendeLiberalisierung.44 Der Streit zwischen dem Gewerk-schaftsflügel der BJP und Finanzminister Singh imFrühjahr 2001 um den Fortgang der Liberalisierungzeigt die Aktualität dieser Auseinandersetzung.45
Nach zehn Jahren fällt die Bilanz der bisherigenReformanstrengungen ambivalent aus. Zu den Erfol-gen zählt unzweifelhaft, daß sich das Wachstum derindischen Wirtschaft deutlich erhöht hat. Zwischen1992/93 und 2000/01 wuchs die indische Wirtschaftum durchschnittlich 6,5% pro Jahr. Mittlerweile weistIndien ähnlich konstant hohe Wachstumsraten aufwie die Staaten Südostasiens. Selbst wenn das hoch-gesteckte Ziel von mindestens 7% Wirtschaftswachs-tum bislang nur in Ausnahmefällen erreicht wurde,hat sich die Hindu rate of growth dennoch fast verdop-pelt. Zugleich sank das Bevölkerungswachstum, daszwischen 1981 und 1991 noch bei ca. 2,3% pro Jahrlag, auf einen Wert unter 1,7% für die Jahre nach1997.46 Auch die positiven Rahmenbedingungen fürausländische Investoren werden von offizieller Seiteimmer wieder betont, wie zum Beispiel das westlicheRechts- und Bildungssystems, die Verbreitung derenglischen Sprache sowie das Potential an wissen-schaftlich-technischem Personal, das sich an den inter-nationalen Erfolgen indischer Softwareingenieureersehen läßt.
Die ebenfalls positiv zu bewertende Stabilität derdemokratischen Institutionen verweist zugleich aufdie Herausforderungen, mit denen die Regierungenim Falle einer Fortsetzung der Liberalisierung kon-frontiert sind. Die Reformen sind mittlerweile aneinem Punkt angelangt, an dem ihre Fortsetzung tiefeEinschnitte in lang gehegte Pfründe von Parteien undInteressengruppen bedeutet. Das Haushaltsdefizitbeträgt mittlerweile fast 10% des BSP,47 doch können
44 Vgl. Neena Vyas, RSS to Attack Economic Policy, in: TheHindu, 23.6.2000.45 Vgl. Alok Mukherjee, Not Quitting: Sinha, in: The Hindu,10.5.2001.46 Vgl. Tata Services, Statistical Outline of India 2000�2001,Mumbai 2000, S. 28f.47 Aufgrund abweichender Berechnungsmethoden gab die
der Abbau von Subventionen, die Privatisierungmaroder Unternehmen, die Reform der Arbeitsgesetz-gebung und der Abbau der Bürokratie aufgrund derlabilen politischen Mehrheiten der jeweiligen Regie-rungen nicht energisch genug vorangetrieben werden.Unrentable staatliche Betriebe wurden bislang nichtgeschlossen, weil die Behörden entsprechende Geneh-migungen aus sozialpolitischen Gründen verweiger-ten. Als Folge des stärkeren Wettbewerbs ist die Zahlder maroden Betriebe seit 1991 noch weiter ange-wachsen. Die Staatsbetriebe auf Landes- und Bundes-ebene gelten als Erbhöfe der Patronage. Eine Priva-tisierung scheitert folglich an vielfältigen politischenWiderständen, an der Furcht vor wachsender Arbeits-losigkeit und vor möglichen Belastungen für die staat-lichen Banken als Hauptgläubigern der Betriebe. DieVerbreiterung der Steuerbasis ist ebenfalls proble-matisch. Aufgrund der niedrigen Einkommen sind diestaatlichen Einkünfte aus der direkten Besteuerunggering, und an eine Besteuerung der Landwirtschaft,einem der wichtigsten Wirtschaftszweige, wagt sichangesichts der zu erwartenden politischen Widerstän-de keine Regierung.48
Neben den Defiziten in fast allen Bereichen derInfrastruktur � vom Straßennetz über die Hafenanla-gen bis hin zur Eisenbahn und der Energieversorgung,die sich nachteilig auf die Industrieproduktion aus-wirken � vertiefen sich durch die Liberalisierung auchdie Unterschiede zwischen den Bundesstaaten.49 Dieausländischen Direktinvestitionen konzentrieren sichin der Regel auf nur wenige, besser entwickelte Bun-desstaaten: So entfielen zwischen 1991 und 1994 über50% der Investitionen auf Delhi, Gujarat, Maharashtraund West-Bengalen.50 Die Liberalisierung hat denWettbewerb zwischen den Bundesstaaten erhöht undzugleich den langjährigen Konflikt zwischen ihnen
Regierung das Defizit für 1998 mit 6,1% an, wohingegen derInternationale Währungsfonds unter Berücksichtigung derBundesstaaten und der Staatsindustrie die Höhe des Defizitsauf einen Wert zwischen 9 und 10% bezifferte; vgl. SridharKrishnaswami, The Clock Won�t Be Turned back: Sinha, in: TheHindu, 18.4.1998.48 Zu den Problemen der Liberalisierung vgl. Hans ChristophRieger, Stockt der wirtschaftliche Reformprozeß?, in: WernerDraguhn (Hg.), Indien 1998. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft,Hamburg: Institut für Asienkunde, 1998, S. 217.49 Vgl. Dietmar Rothermund, Regionale Disparitäten inIndien, in: Werner Draguhn (Hg.), Indien 1999. Politik, Wirt-schaft, Gesellschaft, Hamburg: Institut für Asienkunde, 1999,S. 273�287.50 Vgl. Ajai Chopra et al., India: Economic Reform andGrowth, Washington 1995, S. 21.

Die regionale Ebene: SAARC, SAPTA, SAFTA
SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
23
und der Zentralregierung in den Hintergrund gerückt.Dieser neue Wettbewerb dürfte ebenfalls dazu bei-tragen, daß die Politik der Liberalisierung fortgesetztwird. Seit 1991 waren die Ministerpräsidenten derBundesstaaten ungeachtet ihrer parteipolitischenZugehörigkeit immer wieder bereit, Liberalisierungs-maßnahmen der Zentralregierung zu unterstützen,sofern sie sich von ihnen Vorteile für den eigenenBundesstaat versprachen.51
Die Asienkrise vom Sommer 1997 traf die IndischeUnion in weit geringerem Ausmaß als die Staaten Süd-ostasiens. Ursache hierfür war die bis dahin vergleichs-weise schwache Integration Indiens in die internatio-nalen Finanzstrukturen, die die negativen sozialenKonsequenzen der Krise im Vergleich zu Südostasiendeutlich abmilderte.52 So sank zwar die indischeExportproduktion 1997/98 als Folge der Krise um fast30%, doch fiel das gesamtwirtschaftliche Wachstumim selben Jahr nicht unter 5%,53 während die StaatenSüdostasiens zum Teil eine Kontraktion ihrer Volks-wirtschaften und einen dramatischen Verfall ihrerWährungen mit entsprechenden sozialen Verwer-fungen erleben mußten.
Die regionale Ebene: SAARC, SAPTA, SAFTA
Wirtschaftliche Fragen haben auf regionaler Ebene vor1991 für Indien so gut wie keine Rolle gespielt. Diebilateralen Beziehungen hatten keinen nennenswer-ten Handel mit den Nachbarn zu Folge. Ausnahmenwaren Nepal und Bhutan, die aufgrund ihrer geogra-phischen Lage und ihrer politischen Abhängigkeit vonIndien ihre Handelsbeziehungen hauptsächlich überdie Indische Union abwickeln mußten. Die indischeEntwicklungshilfe, die sich auf diese beiden Nachbar-länder konzentrierte, war aber nicht dazu bestimmt,den regionalen Handel in Südasien zu fördern.54 Dieanfängliche Abhängigkeit Bangladeschs nach derindischen Intervention und der Unabhängigkeit 1971
51 Vgl. hierzu Rob Jenkins, Democratic Politics and EconomicReform in India, Cambridge 1999, S. 128�136.52 Vgl. Christian Wagner, Indien: Von der Krise unberührt,zum Wandel verdammt?, in: Werner Draguhn (Hg.), Asien-krise: Politik und Wirtschaft unter Reformdruck, Hamburg1999, S. 33�49; Kruse, Indien und die VR China in der Welt-wirtschaft, S. 295.53 Vgl. Tata Services, Statistical Outline of India 2000�2001,Mumbai 2000, S. 7.54 Zur indischen Entwicklungshilfe vgl. Citha D. Maaß,Indien�Nepal�Sri Lanka. Süd�Süd-Beziehungen zwischenSymmetrie und Dependenz, Wiesbaden 1982, S. 257�263.
hielt nur bis zum ersten Putsch der Militärs 1975 an,die sich in der Folge von Indien abwandten und demWesten öffneten. Obwohl Nehru und alle Premier-minister nach ihm immer wieder die Zusammenarbeitzwischen Entwicklungsländern propagierten und mitdem Colombo-Plan und der Blockfreien-Bewegungmaßgeblich an der Gründung regionaler und inter-nationaler Organisationen beteiligt waren, kam dervielbeschworene Süd-Süd-Handel weder auf internatio-naler noch auf regionaler Ebene richtig in Gang.
Vor diesem Hintergrund entwickelte sich die wirt-schaftliche Zusammenarbeit in der 1985 gegründetenSouth Asian Association for Regional Cooperation(SAARC) nur schleppend.55 Erst 1991 wurde auf Initia-tive Indiens und Sri Lankas eine Arbeitsgruppe ein-gerichtet, die Pläne für eine Handelsliberalisierungzwischen den SAARC-Staaten ausarbeitete. 1993 legtesie ihren Bericht vor, der Ausgangspunkt für ersteGespräche wurde. Im Dezember 1995 verabschiedetendie SAARC-Staaten das SAARC Preferential TradingArrangement (SAPTA), das zunächst Einfuhrerleichte-rungen für nur 226 Produkte vorsah, deren Zahljedoch in weiteren Verhandlungen heraufgesetztwurde. Der wirtschaftliche Nutzen von SAPTA für denregionalen Handelsaustausch wird, nach den Erfah-rungen vergleichbarer Regionalorganisationen, geringbleiben. Der Erfolg des Abkommens liegt denn auchweniger im ökonomischen als im politischen Bereich.Zum ersten Mal hatten sich die SAARC-Staaten auf eingemeinsames Wirtschaftsabkommen verständigt,wobei vor allem in Pakistan beträchtliche innenpoli-tische Widerstände zu überwinden waren. Neben denbekannten politischen Vorbehalten bezüglich Kasch-mirs gab es zahlreiche Bedenken, daß indische Firmendie Wirtschaft des Landes dominieren könnten.
SAPTA ist ein Signal an die internationale Gemein-schaft, daß die Staaten der SAARC den Prozeß derWeltmarktintegration fortsetzen werden. BesondersIndien ist mittlerweile zur treibenden Kraft bei derFortsetzung und dem Ausbau der wirtschaftlichenZusammenarbeit geworden. Auf dem SAARC-Gipfel inMalé 1997 war es dem Drängen des indischen Premier-ministers Gujral zu verdanken, daß sich die Teil-nehmer auf die Gründung einer SAARC Free TradeArea (SAFTA) bis zum Jahr 2001 verständigten. Selbstwenn diese Ziele im vorgegebenen Zeitrahmen
55 Zur Entstehung, Entwicklung der SAARC und zum Ver-gleich mit der ASEAN vgl. Jörn Dosch/Christian Wagner, ASEANund SAARC: Entwicklung und Perspektiven regionaler Zusam-menarbeit in Asien, Hamburg 1999.

Die wirtschaftliche Dimension der Globalisierung
SWP-BerlinIndische UnionOktober 2001
24
verfehlt und entsprechend korrigiert wurden, zeigtensie dennoch die vermehrte Aufmerksamkeit vor allemindischer Regierungen für Fragen der wirtschaftlichenZusammenarbeit. Ebenfalls in diese Richtung wiesenbilaterale Wirtschaftsabkommen, beispielsweise dasim Dezember 1998 zwischen Indien und Sri Lanka un-terzeichnete Freihandelsabkommen, das deren wirt-schaftliche Zusammenarbeit weiter vertiefen soll.56
Die internationale Ebene:Von self-reliance zur Weltmarktintegration
Wenngleich Indien keine mit den ost- und südostasia-tischen Tigerstaaten vergleichbare Exportstrategie ver-folgte, hatte es sich seit Nehru doch immer als Für-sprecher auch der wirtschaftlichen Interessen derStaaten der Dritten Welt verstanden. Vor allem imRahmen der VN war Indien maßgeblich an derBildung der G 77 beteiligt, die ein Gegengewicht zuden Industrienationen bilden sollte. Darüber hinausprägte Indira Gandhi in den 70er und 80er Jahren dieentwicklungspolitischen Debatten über die Bildungeiner neuen Weltwirtschafts- und Weltinformations-ordnung, in der die Interessen der Entwicklungs-länder stärker Berücksichtigung finden sollten, ent-scheidend mit. Konkrete Schritte und Signale, wie dasanfängliche Interesse Indiens an einer Mitwirkung inder 1967 gegründeten ASEAN, brachten jedoch keinegreifbaren Ergebnisse, da die Staaten Südostasiensunter anderem wegen des Kaschmirkonflikts nichtbereit waren, Indien aufzunehmen.57
Erst mit der Liberalisierung setzte die Regierungauf die Integration in den Weltmarkt sowie einestärkere Exportförderung und warb um ausländischeDirektinvestitionen. Das neue SelbstverständnisIndiens als wirtschaftlich aufstrebende Macht kamunter anderem in den Auftritten von PremierministerRao auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zum Aus-druck. Der Wandel ließ sich aber auch an der Zusam-mensetzung der Delegationen ablesen, die den Pre-mierminister auf seinen Auslandsreisen begleiteten:Im Vergleich zur Zeit vor 1991 waren in ihnen mehrWirtschaftsvertreter und Unternehmer zu finden.58
56 Vgl. ohne Autor, India, Sri Lanka Sign Free Trade Pact, in:The Hindu, 3.2.2000.57 Vgl. Kripa Sridharan, The ASEAN Region in India�s ForeignPolicy, Dartmouth 1996, S. 50.58 Baladas Ghoshal, Linkage between Domestic Politics andForeign Policy: The Case of India, in: ders. (Hg.), Diplomacyand Domestic Politics in South Asia, Neu-Delhi 1996, S. 44f.
Trotz aller Anstrengungen und immer neuer Pro-gramme zur Ankurbelung der Exporte59 konnte Indienseinen Anteil am Welthandel bislang kaum erhöhen.Er stieg in der Zeit zwischen 1990 und 1997 lediglichvon 0,5% auf 0,6%.60 Wie stark Indien im internatio-nalen Kontext noch um Vertrauen ringen muß, zeigendie ausländischen Direktinvestitionen. Zwischen 1993und 1998 entfielen nur 1,4% aller Direktinvestitionenauf Indien, das damit Rang 17 belegte, gleichauf mitLändern wie Vietnam und Peru. Im selben Zeitraumgingen 25,7% aller Direktinvestitionen nach China,und selbst südostasiatische Staaten wie Malaysia undIndonesien konnten immerhin 3,7 bzw. 2,2% der welt-weit getätigten Direktinvestitionen ins Land holen.61
Nachdem die Bewegung der Blockfreien Staatennach dem Ende des Kalten Krieges merklich an inter-nationaler Bedeutung eingebüßt hat, war Indien maß-gebend an der 1989 neugeschaffenen G 15 beteiligt.Mit der G 15 streben die wichtigsten Entwicklungslän-der eine gemeinsame Interessenvertretung gegenüberden Industrienationen an, um Probleme wie Verschul-dung oder die Folgen der Globalisierung zu erörtern.In der 1999 in Berlin gegründeten G 20, in der dieFinanzminister und Notenbankchefs der G 8, die EUund wichtige Entwicklungsländer vertreten sind, istIndien ebenfalls Mitglied, was sein Interesse an einemstabilen internationalen Finanz- und Währungssystemunterstreicht. Die Einladung Indiens und anderer Ent-wicklungsländer zu Gesprächen anläßlich des Gipfel-treffens der G 8 in Genua läßt ebenfalls die gewach-sene internationale Rolle des Landes erkennen.
Seit 1995 ist Indien Mitglied der WTO und alssolches deren Prinzipien, Verfahren und Sanktionenunterworfen.62 Wie bereits im Rahmen des GATTfordert Indien auch in der WTO den Abbau von Ein-fuhrbeschränkungen und Agrarsubventionen in denIndustriestaaten, um einen besseren Marktzugangbzw. eine höhere Konkurrenzfähigkeit für seineProdukte zu erreichen. Auf der WTO-Ministertagung
59 Zu den verschiedenen Initiativen der Regierung vgl. ohneAutor, Industry Seeks Radical Steps to Boost Exports, in: TheHindu, 15.4.1998; ohne Autor, More Measures to Boost Exports,in: The Hindu, 17.9.1998; ohne Autor, Sinha Announces MoreSteps to Boost Growth, in: The Hindu, 26.10.1998.60 Vgl. Tata Services, Statistical Outline of India 2000�2001,Mumbai 2000, S. 84.61 Alle Zahlen stammen aus United Nations Conference on Tradeand Development, World Investment Report 2000. Cross BorderMergers and Acquisitions and Development, New York/Genf2000, S. 23.62 Zur indischen Position in diesen Fragen vgl. http://www.indianembassy.org/policy/WTO/overview.html.

Zusammenfassung
SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
25
in Seattle sprach sich der indische HandelsministerMaran noch einmal explizit gegen die Einbeziehungder Themen Umwelt und Arbeit in die WTO-Agendaaus.63 Indien fürchtet davon einen neuen Protektionis-mus der Industriestaaten und weitere Wettbewerbs-nachteile.
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Integrationin den Weltmarkt war die Aufhebung des Systemsmengenmäßiger Beschränkungen der Einfuhrbestimmter Produkte nach Indien im April 2001.64
Vorangegangen war ein seit 1997 schwelender Streitzwischen Indien und den USA, die eine stärkereÖffnung des indischen Marktes für Produkte unteranderem aus dem Textil-, Agrar- und Konsumgüter-bereich gefordert hatten. Die Auseinandersetzung wardurch ein Schlichtungsverfahren der WTO beigelegtworden, deren Entscheidung Indien damit umsetzte.Wenngleich es versuchte, neue Vorschriften zur Ein-fuhrbeschränkung zu erlassen, wird der Wegfall derquantitativen Beschränkungen den Druck auf Teileder indischen Industrie und auf die Landwirtschafterhöhen, was nicht ohne innenpolitische Folgenbleiben dürfte.
Seit Anfang der 90er Jahre hat Indien seine wirt-schaftlichen Beziehungen zu den Staaten Ost- undSüdostasiens deutlich ausgebaut, ohne aber bislangMitglied in der APEC oder ASEM zu sein. IndiensUnverständnis, im Gegensatz etwa zu Rußland in derAPEC nicht berücksichtigt zu werden, kam in demStatement des damaligen Finanzministers Chidamba-ram zum Ausdruck: »APEC without India is likeHamlet without the Prince of Denmark«.65 Ebenfallserfolglos blieben die indischen Bemühungen um eineTeilnahme an den seit 1996 abgehaltenen ASEM-Treffen. Angesichts seiner wirtschaftlichen Reformenund Erfolge sieht sich Indien als �dynamische regio-nale Wirtschaft, ohne deren Teilnahme ASEM unvoll-ständig wäre�.66 Asiatische Staaten wie Korea und
63 Vgl. Rammanohar C. Reddy, Remove WTO Imbalances:India, in: The Hindu, 2.12.1999.64 Vgl. George Iype, Indian Industry Braces for WTO Regimewith the Lifting of QRs�, in: http://www.rediff.com/money/2001/mar/29wto.htm.65 Zitiert in: Marika Vicziany, Inquiry into Nuclear Tests byIndia and Pakistan, Submission to the References CommitteeAustralian Senate Foreign Affairs, Defence and Trade Refe-rences Committee, The Australian Parliament, ParliamentHouse Canberra Act 2600 (http://www.fas.org/news/india/1998/09/980900-inq.htm).66 Vgl. hierzu die Ausführungen der indischen Botschaft inWashington in: http://www.indianembassy.org/policy/Foreign_Policy/IER.htm.
Singapur, aber auch die Europäer, darunter dieBundesrepublik Deutschland, haben sich für einenBeitritt Indiens zur ASEM ausgesprochen.67 Beimersten Gipfeltreffen zwischen der EU und Indien imJuni 2000 warb Premierminister Vajpayee bei der EUauch um eine Aufnahme Indiens in die ASEM.68 Indienfehlt als wichtiger Teil Asiens bislang in beiden Insti-tutionen, und zugleich fehlen Indien diese multilate-ralen Foren für die Umsetzung seiner außen- und wirt-schaftspolitischen Interessen.
Zusammenfassung
Die Liberalisierung hat mittlerweile das Wirtschafts-wachstum deutlich erhöht. Erfolge etwa bei derArmutsbekämpfung und der Verbesserung der Infra-struktur stehen aber noch aus. Im regionalen Rahmenkonnte mit SAPTA erstmals eine Vereinbarung erzieltwerden, die langfristig das Interesse aller Staaten derSAARC an einer engeren wirtschaftlichen Zusammen-arbeit, die seit 1991 auch im ureigensten InteresseIndiens liegt, aufrechterhalten sollte. Im internatio-nalen Kontext sind die Folgen der alten Wirtschafts-politik noch am ehesten zu spüren, wie die vergleichs-weise geringen Direktinvestitionen oder die bislangnur unbefriedigende Einbindung Indiens in multilate-rale Foren zeigen. Zwei Aspekte sprechen für eine Fort-setzung der �vorsichtigen� Liberalisierung: Erstensfehlen die politischen Mehrheiten für tiefgreifendeReformen, zweitens blieben die Folgen der Asienkrisefür Indien aufgrund seiner nur schwachen Weltmarkt-integration gering.
67 Vgl. die Gespräche des ehemaligen Außenministers Kinkelwährend seiner Indienreise im Januar 1997, in: http://www.germanembassy-india.org/news/march97/kinkel.htm.68 Vgl. ohne Autor, PM to Attend Indo�EU Meet, in: TheTribune, 23.6.2000.

Die gesellschaftliche Dimension der Globalisierung
SWP-BerlinIndische UnionOktober 2001
26
Die gesellschaftliche Dimension der Globalisierung
Nationale Ebene: Soziale Bewegungen undNichtregierungsorganisationen
Globalisierung bedeutet auch das »Handeln und (Zusam-men-)Leben über Entfernungen (scheinbar getrennte Weltenvon Nationalstaaten, Religionen, Regionen, Kontinenten)hinweg.«69 Die Folgen der technologischen Errungen-schaften des Informationszeitalters sind auch inIndien wahrzunehmen. Parteien und Politiker, reli-giöse und fundamentalistische Organisationen sowieGurus aller Art nutzen mittlerweile moderne Kommu-nikationsmedien und sind im virtuellen Raumpräsent. Allerdings zeigt die alltägliche Erfahrung,daß trotz aller Erfolge im Hard- und Softwarebereichunzureichende Bildungseinrichtungen, fehlendeGesundheitsfürsorge und eine hoffnungslos überalter-te Infrastruktur für die Mehrheit der indischen Bevöl-kerung noch immer bestimmend sind.
Den Verfechtern des indischen Entwicklungs-modells ist es nicht gelungen, im Verlauf von fünfzigJahren staatliche Grundfunktionen wie Recht undOrdnung oder eine soziale Grundsicherung für dieBürger bereitzustellen. Dies hat soziale Bewegungenund Nichtregierungsorganisationen (NRO) auf denPlan gerufen: Soziale Bewegungen treten für eineumfassende soziale Besserstellung einer Gruppe, etwader Unberührbaren (Dalits), ein, während NRO stärkerauf die Beseitigung bestimmter Mißstände orientiertsind und sich zum Beispiel im Kampf gegen Kinder-arbeit oder bei der Verbesserung des Umweltschutzesengagieren. Beide Gruppen agieren zunächst außer-halb der etablierten Parteien, was aber eine Partei-gründung oder Formen der Zusammenarbeit mitbestehenden Parteien nicht ausschließen muß.
Vor allem im entwicklungspolitischen Bereichhaben soziale Bewegungen und NRO zunehmend anBedeutung gewonnen, nicht zuletzt dank modernerInformationstechnologie. Eines der bekanntesten Bei-spiele ist die Narmada Bachao Andolan (NBA), einZusammenschluß lokaler NRO, die seit 1983 gegen dieUmsiedlungen und Vertreibungen im Zuge des Sardar-Sarovar-Damm-Projekts am Narmada-Fluß im indi-
69 Ulrich Beck, Was ist Globalisierung?, Frankfurt a.M. 1997,S. 45 (Hervorhebung im Original).
schen Bundesstaat Gujarat protestierten. Seit 1984engagierte sich Oxfam/Großbritannien in einer zu-nächst lokalen Kampagne. Die Initiative entwickeltesich zur International Narmada Campaign, an der sichinternationale NRO wie Friends of the Earth betei-ligten. Damit eröffneten sich Vertretern der NBA neueMöglichkeiten, ihre kritischen Ansichten über das Pro-jekt etwa vor dem US-Kongreß oder in der Weltbankzu äußern. Sie konnten dadurch eine Teilrevision desursprünglichen Vorhabens erreichen, da Mitgliederder internationalen Gebergemeinschaft ihre Mittel-vergabe entsprechend abänderten.
Eine Übersicht über die sozialen Bewegungen undNRO erscheint angesichts ihrer Vielfalt und der Größedes Landes kaum möglich. Dabei sind internationalbekannte NRO wie die Self-Employed Women�sAssociation (SEWA) längst Zielgruppen westlicher Ent-wicklungshilfeorganisationen. Auch die einschlägigenDatenbanken über indische NRO im Internet dürftennur Segmente der Themenpalette vermitteln, die vonaccounting/auditing/legal service bis hin zu women/genderissues and rights reicht.70 Die positiven Seiten dieserzivilgesellschaftlichen Strukturen in Indien, die zumBeispiel in der stärkeren Beteiligung von Frauen in derKommunalpolitik, der Pressefreiheit oder der Ver-urteilung hochrangiger Politiker wegen Korruptionzum Ausdruck kommen, sind im Human Develop-ment Report 2000 gewürdigt worden.
Der mit der Globalisierung beschleunigte sozialeWandel hat auch die Unterschiede zwischen Stadt undLand vertieft. Indien zählt bislang zu den wenigen Ent-wicklungsländern mit einer vergleichsweise geringenUrbanisierungsrate von unter 30%. Die neue Mittel-klasse ist ein überwiegend städtisches Phänomen, wiesich auch anhand der Verteilung von Konsumgüternablesen läßt. Während 252 (von 1000) städtische Haus-halte mittlerweile einen Kühlschrank besitzen, sind esin den ländlichen Gebieten lediglich 20 (von 1000).71
70 Vgl. die Übersicht: http://www.cafonline.org/cafindia/i_search.cfm. Weitere Datenbanken und Informationen zuNRO in Indien finden sich u.a. http://www.braintrustindia.com/directory_databases/NGO_India sowie im Indian Devel-opment Information Network: http://www.indev.org.71 Vgl. Pamela Shurmer-Smith, India. Globalization andChange, London 2000, S. 28.

Die regionale Ebene: Arbeitsmigration und Terrorismus
SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
27
Unterschiedliche Abgrenzungskriterien erklären dieoft widersprüchlichen Angaben über den Umfang undAnteil der Mittelklasse, die zwischen 10 bis 40% derindischen Gesellschaft schwanken.
Die Veränderungen in der Parteienlandschaft durchdiese neue Mittelklasse wurden bereits erörtert. Wenn-gleich hindu-nationalistische Strömungen seit jehereinen Platz im indischen Parteiengefüge hatten, sindsie doch erst in den 90er Jahren mit der BJP regie-rungsfähig geworden und haben über radikale Grup-pierungen wie den Hindu-Weltrat (Vishwa HinduParishad, VHP) und die RSS eine breitere gesellschaft-liche Basis bekommen. Richtete sich die Agitationgegen die Moschee in Ayodhya seit Mitte der 80erJahre noch gegen die muslimische Minderheit, mani-festierte sich in den Protesten unter anderem gegendie amerikanische Imbißkette Kentucky Fried Chickenin Neu-Delhi 1996, den Demonstrationen gegen dieMiss-World-Wahl 1997 in Bangalore sowie den zahl-reichen Angriffen auf Christen seit 1998 der Wider-stand solcher Gruppen gegen Symbole und Vertretereines �westlichen Kulturimperialismus�. Daß solcheGruppierungen durch moderne Medien auch inter-national vertreten sind und unter anderem in denUSA gezielt um Mitglieder werben, zeigt ihren trans-nationalen Vernetzungsgrad und damit ihre neuenMöglichkeiten, außenpolitisches Handeln in Indienoder in anderen Staaten zu beeinflussen.
Die regionale Ebene:Arbeitsmigration und Terrorismus
Es gehört zu den Besonderheiten des Globalisierungs-prozesses, daß Unterscheidungen wie die zwischender nationalen und der internationalen Ebene zuneh-mend an Bedeutung verlieren. Die damit verbundenenaußenpolitischen Herausforderungen lassen sichanhand der grenzüberschreitenden Migration und desTerrorismus veranschaulichen.
Neben einer ausgeprägten innerindischen Arbeits-migration gibt es auch eine grenzüberschreitendeZuwanderung vor allem aus Nepal und Bangladesch.Das Ausmaß dieser Migration ist weitgehend unklar,da beide Zuwanderergruppen Aufnahme in die nepali-bzw. bengalisprachigen communities in Indien finden.Die an Bangladesch angrenzenden Bundesstaatdistrik-te verzeichnen seit Jahren ein deutlich höheres Wachs-tum der muslimischen Bevölkerung, das weniger aufdie höhere Geburtenrate als vielmehr auf die Zuwan-derung muslimischer Bangladeschis zurückzuführen
ist. Diese unkontrollierte Zuwanderung führte bereitsin den 80er Jahren im Bundesstaat Assam zu schwere-ren Unruhen und Pogromen gegen die Einwandereraus Bangladesch. Die offene Grenze zwischen Indienund Nepal hat in den 90er Jahren auf nepalesischerSeite Befürchtungen vor einer Überfremdung der anIndien angrenzenden Terai-Region aufkommen lassen.Die Versuche der Regierung in Kathmandu, spezielleArbeitsgenehmigungen für indische Staatsbürger ein-zuführen, hat wiederum die bilateralen Beziehungenzwischen Indien und dem Himalaya-Königreichbelastet.
Ein wesentlich gravierenderes Problem im regio-nalen Rahmen stellt der grenzüberschreitende Terro-rismus dar. Die Unterstützung bewaffneter Gruppendurch staatliche Einrichtungen in den Nachbar-ländern hat in Südasien eine lange Tradition, an derenEntstehung auch Indien nicht unbeteiligt war. Anfangder 70er Jahre unterstützte Indira Gandhi die ostpaki-stanischen Mukti Bahini (Freiheitskämpfer) in ihremKampf gegen die westpakistanische Regierung. ZuBeginn der 80er Jahre bildete der indische Geheim-dienst Research and Analysis Wing (RAW) tamilischeGuerillagruppen, die zum Teil auch politischen Rück-halt bei den Landesregierungen im südindischenBundesstaat Tamil Nadu fanden, für ihren Kampfgegen die Regierung in Colombo aus. Bewaffnete Auf-standsbewegungen in den Chittagong Hill Tracts inBangladesch verfügten ebenfalls über Nachschub- undAusbildungslager in den benachbarten indischenBundesstaaten.
Indien ist besonders in Kaschmir und in seinennordöstlichen Bundesstaaten mit bewaffneten Auf-standsbewegungen konfrontiert. KaschmirischeGuerillagruppen operieren vom pakistanisch besetz-ten Teil Kaschmirs aus in Indien und werden dabeivon pakistanischer Seite, beispielsweise Teilen derArmee und der Geheimdienste, militärisch, finanziellund logistisch unterstützt. Allerdings nutzen dieseGruppen auch zunehmend Nachbarländer wie Nepalund Bangladesch für ihre Aktionen, was zuletzt beider Entführung eines indischen Verkehrsflugzeugszur Jahreswende 1999/2000 deutlich wurde, das sichauf dem Weg von Kathmandu nach Neu-Delhi befand.
In den nordöstlichen Bundesstaaten operieren ver-schiedene Guerillagruppen, deren Rückzugsgebietesich in Myanmar und Bangladesch befinden. Fragendes Terrorismus erhalten in den bilateralen Beziehun-gen zunehmend an Gewicht. Der Kampf gegen separa-tistische Gruppen im Nordosten Indiens war eines derMotive für die Annäherung an Myanmar seit Mitte der

Die gesellschaftliche Dimension der Globalisierung
SWP-BerlinIndische UnionOktober 2001
28
90er Jahre. Die im März 2001 eröffnete India�Myan-mar Friendship Road verbindet den nordöstlichenBundesstaat Manipur mit Mandalay, der zweitgrößtenStadt Myanmars. Die Straße, bereits 1993 geplant,wurde vollständig vom indischen Außenministeriumfinanziert und von indischen Arbeitern fertiggestellt.72
Neben Wirtschaftsaustausch sollen damit auch Trup-penbewegungen für den Einsatz gegen die in Assamoperierende United Liberation Front of Asom (UFLA)erleichtert werden, die enge Verbindungen zu Gueril-lagruppen in Myanmar wie der Karen National Union(KNU) und der Arakan Liberation Party unterhält.73
Unabhängig von staatlicher Unterstützung habenmilitante Gruppen ihre eigenen Netzwerke aufgebaut,die sich unter anderem über den Drogen- und Waffen-handel finanzieren. Medienberichte weisen auf immerneue Querverbindungen zwischen den verschiedenenGruppen hin, etwa den tamilischen Liberation Tigersof Tamil Eelam (LTTE) und der UFLA. Die maoistischeAufstandsbewegung in den westlichen Landesteilenvon Nepal soll wiederum über enge Verbindungen zubewaffneten maoistischen Gruppen in Indien wie derPeople�s War Group (PWG) verfügen. Neben den militä-rischen Auseinandersetzungen nutzen diese Gruppenzum Teil auch ihre internationalen Verbindungen, umin den Hauptstädten der westlichen Welt politisch fürihre Anliegen einzutreten.
Da der Terrorismus für alle Staaten eine Bedrohungdarstellt, wurde bereits 1987 auf dem SAARC-Gipfel inKathmandu die SAARC Regional Convention on Sup-pression of Terrorism verabschiedet. Die Konventiontrat 1988 in Kraft, ein SAARC Terrorist Offences Moni-toring Desk (STOMD) in Colombo wurde eingerichtet.Nicht zuletzt weil militante Gruppen politisch instru-mentalisiert werden, gibt es insgesamt jedoch kaumeine staatenübergreifende Zusammenarbeit im Kampfgegen den Terror.
Die internationale Ebene:Die Non-Resident Indians
Die Ausführungen zum Narmada-Projekt habengezeigt, daß viele nationale NRO ihre Ziele kaum nochohne die Mitwirkung internationaler bzw. transnatio-naler Akteure erreichen können. Mit den sogenannten
72 Vgl. Amit Baruah, The Roads to Myanmar, in: Frontline,3.�16.3.2001.73 Vgl. ohne Autor, India for �Pragmatic� Ties with Myanmar,in: The Hindu, 3.3.1999.
Non Resident Indians (NRI) soll nun eine Gruppebetrachtet werden, die in den letzten Jahren außen-politisch besonders im Verhältnis zu den USA anBedeutung gewonnen hat. In Reaktion auf die wach-senden transnationalen Verflechtungen hat Neu-Delhimittlerweile die indischen Minderheiten im Auslandals Instrument eigener Interessen entdeckt: »The sixmillion Indian Citizens and an estimated 14 millionPeople of Indian Origin (PIO) resident abroad havebeen playing an increasingly important role for thefurtherance of India�s foreign policy.«74
Als Folge der gezielten Einwanderungspolitik derUSA fanden gut ausgebildete indische Einwandererseit den 80er Jahren Zugang zu den renommiertenund aufstrebenden Wirtschaftssektoren in den USAund profitierten überdurchschnittlich vom nachfol-genden Technologie- und Computerboom. Im Jahr2000 zählten zu den NRI ca. 1,6 Millionen Menschen,die sich vor allem in den großen Städten und Wirt-schaftszentren niedergelassen haben.75 Daß »die Hälftevon Silicon Valley den Indern gehöre«, ist dasumgangssprachliche Resümee der amerikanischenPolitik, das sich statistisch im ökonomischen Erfolgder indischen community niedergeschlagen hat. Anfangder 90er Jahre war sie die wohlhabendste aller nicht-weißen Minderheiten in den USA.
Der wirtschaftliche Erfolg begann sich auch zu-nehmend in politischen Einfluß umzusetzen. DurchOrganisationen wie das Network of South AsianProfessionals (NETSAP), das India Abroad Centre forPolitical Awareness (IACPA) oder die Indo-AmericanPolitical Foundation versuchen die indo-amerikani-schen Einwanderer, ihren Einfluß auf die amerikani-schen Parteien und Abgeordneten geltend zu machen.Die Einrichtung eines eigenen Indian caucus im US-Kon-greß 1993 hatte sowohl die Anliegen der NRI als auchdie Verbesserung der indisch-amerikanischen Bezie-hungen zum Ziel. Der caucus hat mittlerweile mehr alseinhundert Mitglieder, mehrheitlich Demokraten.76
Wie die meisten eingewanderten Minderheiten
74 Government of India, Ministry of External Affairs, AnnualReport 2000�2001, Neu-Delhi 2001, S. 132.75 Zu den Zahlenangaben und der Verteilung der NRI in denUSA vgl. http://www.nrilinks.com/usa/indians/default.asp(31.7.2001).76 Zur Entwicklung des Congressional Caucus on India andIndian Americans vgl. Neil Parekh, Community Must Ask Moreof Caucus, in: News India-Times, 25.2.2000 (http://www.indiatogether.org/us/caucus/parekh-caucus.html); K. DiwanjiAmberish, The India Caucus Still Has a Long Distance to Go, in:Rediff, 18.9.2000 (http://www.indiatogether.org/us/caucus/rediff-caucus.html).

Zusammenfassung
SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
29
standen auch die NRI politisch der DemokratischenPartei nahe. Sie unterstützten neben anderen Al Goreim Präsidentschaftswahlkampf 2000 mit drei Mio.US-Dollar und Hillary Clinton bei ihrem erfolgreichenKampf um das Senatorenamt im Staat New York imselben Jahr mit einer Mio. US-Dollar.77 In den letztenJahren haben aber Teile der NRI auch verstärkt Kandi-daten der Republikaner durch Spenden unterstützt.Die Lobbyarbeit der NRI umfaßt unter anderem dasgezielte Anschreiben einzelner Abgeordneten beiindien-spezifischen Themen sowie die Beobachtungdes Abstimmungsverhaltens von US-Kongreßabgeord-neten zu indienrelevanten Fragen in den verschie-denen Ausschüssen.78 Das Wirken der NRI und desIndian caucus hat maßgeblich zur Verbesserung derindisch-amerikanischen Beziehungen Ende der 90erJahre beigetragen.
Der Einfluß der indischen Gemeinschaft schlägtsich auch in der Universitäts- und Forschungsland-schaft nieder. Die Kinder der Einwanderergenerationdrängen mittlerweile an die Universitäten, belegenrenommierte Fächer wie Medizin, Recht, Informatik,nutzen aber auch die geistes- und sozialwissenschaft-lichen Lehrangebote der South Asia Departments. Diezusätzliche Nachfrage erlaubt es wiederum den Süd-asien-Abteilungen, ihre Lehr- und Forschungsaktivitä-ten auszuweiten. Die Stiftung von Lehrstühlen durchSpenden lokaler indischer communities, zum Beispiel inBerkeley, zeugt für den ökonomischen Wohlstand,aber auch den wachsenden (bildungs-) politischen Ein-fluß der indischen Einwanderer. Schließlich habenauch die indischen Nukleartests eine intensivere wis-senschaftliche Beschäftigung mit Indien und Südasienin den einschlägigen amerikanischen Think Tanks zurFolge gehabt.79
Zusammenfassung
Im Vergleich zu Politik und Wirtschaft sind die Folgender Liberalisierung im gesellschaftlichen Bereichweniger ausgeprägt, da sich Indien von Anfang an als�offene� Gesellschaft verstanden hat. Allerdings
77 Vgl. Nina Kohli-Laven, The Gore Gamble, in: Outlook,27.11.2000, S. 37f.78 Das namentliche Abstimmungsverhalten der Mitgliederdes Auswärtigen Ausschusses zur Kargil-Krise 1999 ist z.B.unter http://www.indiatogether.org/us/record/kargil.htmnachzulesen.79 Interviews des Verfassers in Washington und Baltimoreim September 1999.
formieren sich mittlerweile auch, wie in anderenStaaten, wachsende Widerstände und Proteste gegeneine Zunahme der �Verwestlichung�. Sie nehmen bei-spielsweise mit Übergriffen auf Christen Formen an,die es zuvor nicht gab. Die wachsenden transnationa-len Verflechtungen stellen eine neue Herausforderungfür die Außenpolitik dar, da viele gesellschaftlicheAnliegen nicht mehr nur im lokalen oder nationalen,sondern jetzt auch im internationalen Kontextverhandelt werden. Die weitaus größte Heraus-forderung geht vom grenzüberschreitenden Terroris-mus aus. Gerade hier ist eine stärkere Zusammen-arbeit gefordert, da nationale Auseinandersetzungen,wie die Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, oftregionale und internationale Krisen zur Folge hatten.

Ausblick: Globalisierung und Außenpolitik in Indien
SWP-BerlinIndische UnionOktober 2001
30
Ausblick: Globalisierung und Außenpolitik in Indien
Viele der hier genannten Entwicklungen waren bereitsin den 80er Jahren zu beobachten. Dennoch kann1991 als Zäsur in der indischen Politik verstandenwerden. Die Liberalisierung markiert einen Politik-wechsel, der aufgrund der breiten Zustimmung unterden größten Parteien unumkehrbar sein dürfte.
Über die indischen Großmachtambitionen, denWunsch nach Gleichberechtigung mit China, dieForderung nach einem ständigen Sitz im VN-Sicher-heitsrat und die Ablehnung des NVV besteht einparteiübergreifender Grundkonsens. Während sicher-heitspolitische Entscheidungen beispielsweise überAtomtests wie bisher nur im kleinen Kreis gefälltwerden, ist durch die Liberalisierung und Weltmarkt-integration die internationale Verflechtung größerund der außenpolitische Entscheidungsprozeß kom-plexer geworden. Neben den Interessen der Koalitions-partner müssen jetzt auch die Belange der Bundes-staaten sowie die Anliegen gesellschaftlicher Gruppenwie Unternehmer und Gewerkschaften stärker berück-sichtigt werden als zuvor.
Im regionalen Kontext hat Indien seine lange Zeitkonfliktbeladenen Beziehungen zu den Nachbarndeutlich verbessert. Im Dauerkonflikt mit Pakistanzeigten indische Offerten wie die Feuerpause in Kasch-mir Ende 2000 oder das Gipfeltreffen in Agra im Juli2001, daß Indien Interesse an einem stabilen Pakistanhat. Eine Destabilisierung Pakistans hätte unabseh-bare politische Folgen für Indien und würde zugleichdie Attraktivität Indiens und Südasiens für ausländi-sche Direktinvestitionen verringern. Den außenpoliti-schen Entscheidungsträgern in Neu-Delhi ist einesdeutlich geworden: Ihre Großmachtambitionenwerden nicht ohne gute Beziehungen zu den Nach-barn zu verwirklichen sein. Der Weg zum ständigenSitz im Sicherheitsrat in New York wird über Colom-bo, Dhaka, Kathmandu und Islamabad führen.
Im internationalen Kontext fällt vor allem dieAnnäherung an die USA und an China auf. Indien teiltinzwischen mit beiden Staaten eine Reihe wichtigersicherheitspolitischer Gemeinsamkeiten. So wendensich Indien und China gegen einen westlichen Uni-lateralismus und propagieren statt dessen eine multi-polare bzw. polyzentrische Struktur des internationa-len Systems. Indien und die USA wiederum gründen
ihre Kooperation auf ihre demokratischen Ideale undstreben eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit imIndischen Ozean und in der Golfregion an. Die deut-lich verbesserten Beziehungen zu den USA und Chinazeigen trotz aller bestehenden Probleme, wie sehrIndien in den letzten zehn Jahren international anBedeutung gewonnen hat.
Wenngleich Indien seit 1991 beansprucht, einewirtschaftliche Großmacht zu sein, sind seine Defiziteauf diesem Gebiet am auffälligsten. Zwar hat sich diewirtschaftliche Entwicklung verbessert, doch der ent-scheidende Durchbruch im Kampf gegen die Armutläßt weiter auf sich warten. Auch wenn die Liberalisie-rung unumkehrbar erscheint, fehlt ihr, bedingt durchdie schwachen bzw. wechselnden parlamentarischenMehrheiten, doch die Kraft für einschneidende Refor-men, zum Beispiel bei der Privatisierung der Staats-betriebe. Im südasiatischen Rahmen zählt Indienmittlerweile zu den vehementesten Befürworterneiner weiteren Liberalisierung. In den Nachbarstaatenbestehen jedoch vereinzelt Vorbehalte, da sie eineDominanz indischer Firmen in der einheimischenWirtschaft fürchten. Indien ist für ausländischeDirektinvestitionen weniger attraktiv als beispiels-weise China. Zudem hat es bislang keinen Zugang zuden wichtigen multilateralen Gremien in Asien wieAPEC oder ASEM, die im Zeitalter der Globalisierungeine immer wichtigere Rolle in der internationalenKoordination staatlicher Politik spielen.
Im nationalen Rahmen nutzen soziale Bewegungenund NRO ihre transnationalen Verbindungen zuneh-mend, um Indiens staatliche Politik zu ihren Gunstenzu beeinflussen. Im südasiatischen Kontext bleibt ins-sondere die Bekämpfung des grenzüberschreitendenTerrorismus die zentrale Herausforderung für dieAußenpolitik. Sie ist um so ernster, als separatistischeGruppen mit ihren Forderungen die staatliche Einheitbedrohen. Zugleich versucht die indische Außenpoli-tik aber auch, die sich aus der Globalisierung ergeben-den neuen Chancen für sich zu nutzen, indem sie zumBeispiel zielgerichtet die NRI umwirbt, um sie für dieVertretung indischer Interessen im Ausland ein-zuspannen.
Die praktische Umsetzung der indischen Außen-politik nach 1991 ist trotz Kontinuität in Grundsatz-

Abkürzungsverzeichnis
SWP-BerlinIndische Union
Oktober 2001
31
fragen, zum Beispiel ihrem Großmachtanspruch,unter den Bedingungen der Globalisierung wechsel-hafter geworden. Selbst wenn außenpolitische Fragenin Wahlkämpfen weiterhin nur eine geringe Rollespielen, werden die jeweiligen Regierungskonstellatio-nen, in denen unterschiedliche parteipolitische Inter-essen und Prioritäten auszugleichen sind, das außen-politische Verhalten weitaus stärker prägen als zuvor.
Abkürzungsverzeichnis
APEC Asia-Pacific Economic CooperationARF ASEAN Regional ForumASEAN Association for Southeast Asian NationsASEM Asia�Europe MeetingBIMSTEC Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka and Thailand
Economic CooperationBIP BruttoinlandsproduktBJP Bharatiya Janata Party (»Indische Volkspartei«)BJS Bharatiya Jana SanghCPI/M Communist Party of India/MarxistCTBT Comprehensive Test Ban TreatyEG Europäische GemeinschaftEU Europäische UnionG 8 Gruppe der acht führenden IndustriestaatenG 20 Gruppe der 20 (Finanzminister und Notenbank-
gouverneure unter anderem der G 8, EU, IWF undgroße Entwicklungsländer wie Indien und VR China)
G 77 Gruppe von anfänglich 77 Staaten aus der DrittenWelt in den VN
GATT General Agreements on Tariffs and TradeIACPA India Abroad Centre for Political AwarenessIORARC Indian Ocean Rim Association for Regional
CooperationJWG Joint Working GroupKNU Karen National UnionLTTE Liberation Tigers of Tamil EelamNBA Narmada Bachao Andolan (»Bewegung zur Rettung
des Narmada-Flusses«)NETSAP Network of South Asian ProfessionalsNIC Newly Industrialized CountriesNMD National Missile DefenceNRI Non-Resident IndiansNRO NichtregierungsorganisationNVV NichtweiterverbreitungsvertragOBC Other Backward CastesOECD Organization for Economic Cooperation and
DevelopmentOSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in EuropaPWG People�s War GroupRAW Research and Analysis WingRSS Rashtriya Swayamsevak Sangh (»Nationales
Freiwilligenkorps«)SAARC South Asian Association for Regional CooperationSAFTA SAARC Free Trade AreaSAPTA SAARC Preferential Trading Arrangement
SEWA Self-Employed Women�s AssociationSTOMD SAARC Terrorist Offences Monitoring DeskUFLA Liberation Front of AsomVHP Vishwa Hindu Parishad (»Weltrat der Hindus«)VN Vereinte NationenVR VolksrepublikWTO World Trade Organisation