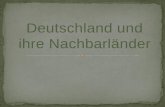Deutschland und ihre Nachbarländer. Deutschland Sprache: Deutsch Hauptstadt: Berlin Währung: Euro.
DER SPIEGEL Jahrgang 1999 Heft 18 -...
Transcript of DER SPIEGEL Jahrgang 1999 Heft 18 -...


Werbeseite
Werbeseite

DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN
REU
TER
S
Hausmitteilung3. Mai 1999 Betr.: Titelbild, Balkankrieg, Chatrooms
Einen Selbstversuch ganz eigener Art unternahm SPIEGEL-Redakteur ThomasTuma, 34. Er setzte sich vier Wochen lang an die virtuellen Stammtische (Chats)
der elektronischen Welt des World Wide Web. Mal als „Fruchtzwerg“, mal als „Nie-mand“, mal als Mann, mal als Frau nahm er Kontakt zu Fremden auf. Inhalten sindin den Chatrooms keine Grenzen gesetzt: „Es wird geplappert und gelogen, gelacht,geweint, geliebt und gehaßt.“ Am Ende spürte Tuma erste Suchtsymptome. „Chatssind die Kommunikation der Zukunft“, glaubt er, „schön und gefährlich.“ Nir-gendwo sonst könne man einem Menschen so schnell auf den Grund seiner Seeleblicken: „Die Anonymität schützt einen – nur nicht vor sich selbst“ (Seite 102).
Bundeskanzler Gerhard Schröder in Siegerpose, aber mit ernstem Gesicht.Dahinter das auffallend spitznasige Gespenst der traditionellen SPD, das den
Regierungschef in Schach hält: „Der Kanzler und die Sozial-Mafia“. So war die Ideefür den SPIEGEL-Titel. Nancy Stahl, 49, eine der internationalen Top-Illustratoren,
die für den SPIEGEL tätig sind, sollte dieses bildnerischumsetzen. Spezialität der New Yorkerin: Sie arbeitetfast ausschließlich am Computer. Einen ersten grobenEntwurf zeichnet Stahl zwar noch per Hand, legt ihnauf den Scanner und schickt ihn nach Hamburg. Allesweitere findet dann aber mit virtuellen Stiften und Pinseln am Bildschirm statt. „Der große Vorteil dabeiist, daß ich Versionen, die mir persönlich gefallen, spei-chern und trotzdem auf Änderungswünsche eingehenkann“, sagt die Künstlerin.Vergangenen Freitag lag das
Ergebnis ihrer aktuellen Arbeit vor – zunächst als digitalisierte E-Mail, wenig später ausgedruckt und jetzt für alle sichtbar auf dem Titel des SPIEGEL.
Stahl
Nach fünf Wochen Bombardement und Raketenbeschuß durch die Nato ist Jugoslawien ein zerstörtes Land. SPIEGEL-Redakteurin Renate Flottau, 54,
hatte Ende vergangener Woche den Eindruck, ganz Belgrad sollte in Schutt und Aschegelegt werden, so heftig waren die Angriffe. „Zunehmend werden auch zivile Zielegetroffen“, berichtet sie aus der Hauptstadt. „Die Nato hat unserem Land in 35 Ta-gen mehr Unglück gebracht als Hitlers Armee während vierjähriger Okkupation“,versteigt sich der inzwischen geschaßte jugoslawische Vizepremier Vuk Dra∆koviƒ,52, im Interview mit Flottau (Seite 157).Die Nachbarländer tragen inzwischendie Last von Hunderttausenden Vertrie-benen. Jetzt kommt ein weiteres Pro-blem hinzu, wie SPIEGEL-ReporterAlexander Smoltczyk, 40, in Albanienbeobachten konnte: Ungezählte huma-nitäre Organisationen haben ihre Leuteauf den Balkan geschickt. Oft ist die Hil-fe nur mangelhaft koordiniert, im Über-eifer behindern sich die Helfer gegen-seitig: „Viele Verbände sind frustriert,weil sie ihre Lieferungen nicht los-werden“, sagt Thomas Reuter vom Malteser-Auslandsdienst (Seite 166). Hotels und Gaststätten profitieren von dem Rummel – auch eine Gruppe Roma, die um einen Teich im Zoo von Tirana sitzt.„Die Männer angeln dort Frösche und verkaufen sie an zwei Feinschmecker-Restaurants“, erzählt Smoltczyk, „internationale Helfer kehren dort gern ein.“
Smoltczyk, Reuter
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9 3Im Internet: www.spiegel.de

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

G.
RÜ
SC
HEN
DO
RF /
RAPH
O /
AG
EN
TU
R F
OC
US
In diesem Heft
Titel
Verpaßt Schröder seine zweite Chance? ......... 26Lafontaines Rückkehr in die Öffentlichkeit..... 32SPIEGEL-Gespräch mit ArbeitsministerWalter Riester über den Widerstandgegen die Sozialgesetze .................................. 42
Kommentar
Rudolf Augstein: Arroganz der Macht............. 24
Deutschland
Panorama: Schröders Personal für Europa /Ostländer lassen Fördermittel liegen ............... 17Regierung: Bricht die Zustimmungfür den Krieg weg?.......................................... 22Politik-Werbung: Neues Outfitfür Rot-Grün................................................... 50Atomkraft: Abschied vom Ausstieg ................ 54Terrorismus: Unerwünschte Gnadengesuchefür die letzten RAF-Häftlinge ......................... 56Strafjustiz: Gisela Friedrichsenim Prozeß über denHungertod eines Pflegekindes......................... 62Kosovo-Krieg: Die Irrfahrt deutscherFriedensfreunde nach Belgrad ........................ 70Flüchtlinge: Deutschland soll noch mehrKosovo-Albaner aufnehmen ........................... 75Justiz: In Frankfurt befehden sichErmittler und Richter...................................... 78
Wirtschaft
Trends: Lufthansa-Aufsichtsräte genehmigen sich mehr Geld / Telekom-Tochter D1 wechselt nach Italien...... 81Geld: Steuerbegünstigte Altersvorsorge /Perlen im Internet........................................... 83Weltwirtschaft: Ist die Asienkrise vorbei? .... 84Manager: Die Seifenoper um denHypoVereinsbank-Chef Albrecht Schmidt ...... 88Energie: Billiger Strom durch Broker............. 90Welthandel: Transatlantischer Streit über Fleisch und Flugzeuge ............................ 93Luxusindustrie: Die Schlacht um Guccierregt die Italiener .......................................... 94
Medien
Trends: Posse um Journalistenpreis /Hollywoodmesse in Köln ................................ 99Fernsehen: Schweige-Talkshowim WDR / Neues Image für geouteteTV-Kommissarin Ulrike Folkerts ................... 100Vorschau........................................................ 101Internet: Die virtuelle Weltder Chatrooms .............................................. 102Spenden: Das Fernsehen sponsert nurdie großen Hilfsorganisationen...................... 108Fernsehserien: Interview mit TV-ProduzentAaron Spelling über seine neueDrei-Schwestern-Soap „Charmed“ ............... 109
Gesellschaft
Szene: Kriegs-Comics von Joe Sacco /Homosexuelle telefonieren häufiger.............. 113Psychologie: Wie Geld-CoachBodo Schäfer Mut zum Mammon macht ....... 114Kriminalität: Zuhälterkrieg umdie Expo 2000................................................ 120
Sport
Fußball: Oliver Kahns Kampfgegen sein Rauhbein-Image ........................... 122American Football: Läßt sich das deutschePublikum missionieren? ................................ 126
6
Machtprobe in Bonn Seiten 22, 26, 42Der Wirbel um die neuen Regeln für 630-Mark-Jobs und Selbständige gerät zumGrundsatzstreit: Bislang kann sich Kanz-ler Schröder, der für weniger Sozialab-gaben plädiert, nicht durchsetzen gegen Arbeitsminister Riester und eine Sozial-Mafia, die mit immer neuen Beitragszah-lern das alte System staatlicher Wohlfahrt retten will. Riester bleibt im SPIEGEL-Gespräch stur: „Für grundlegende Ände-rungen sehe ich keinen Anlaß.“ Inzwi-schen muß Schröder auch um die Zustim-mung für sein Kriegskabinett fürchten.Schröder, Hombach Riester
M.-
S.
UN
GER
REU
TER
S
Hungertod eines Kindes Seite 62Als der fünfjährige Alex an Unterernährung starb, wog er gerade noch 7,2 Kilo. Jetztstehen die Pflegeeltern unter Mordanklage vor Gericht. Eine psychiatrische Sach-verständige provoziert Widerspruch durch ihren Einsatz für die Mutter.
Comeback der Tigerstaaten Seite 84Hochstimmung an den Börsenin Fernost: Überall in Südost-asien ziehen die Kurse kräftigan. Westliche Fondsmanagerpumpen Milliarden in die Re-gion, aus der sie vor knapp zweiJahren in Panik geflüchtet sind– die Asienkrise scheint über-wunden. Doch der Über-schwang der Investoren täuscht:Noch immer kämpfen die Tigerstaaten mit fundamentalenProblemen: faulen Krediten,Schulden,Vetternwirtschaft. DieArbeitslosigkeit steigt, die so-zialen Spannungen wachsen. Börsenhändler in Hongkong
Am virtuellen Stammtisch Seite 102Hunderttausende treffen sich allein in Deutschland jeden Tagan den virtuellen Stammtischenvon Chat-Räumen. Manche Fo-ren wuchsen zu Cyber-Metro-polen, die bereits mehr „Ein-wohner“ haben als viele Groß-städte. Motto: Reden ist Silber,Schreiben Gold. Im Schutz derAnonymität läßt sich vieles aus-leben. „Es ist ein Spiel mit demFeuer“, sagt eine Chatterin.Auch die Suchtgefahr wächst.Internet-Café
M.
MATZEL /
DAS
FO
TO
AR
CH
IV
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9

M
Rauchschwaden über BelgradDPA
Ächzen unter der Kriegslast Seiten 152, 174, 224Gespannt wartet der Westen auf Erfolge von Moskaus Pendeldiplomatie. Nato-Generalsekretär Solana verbreitet Optimismus: „Wir sind im Begriff, unsere Ziele zu erreichen.“ Doch gebombt wird vorerst weiter. Mit der Dauer des Krieges steigendie ökonomischen und ökologischen Schäden in der Region. Experten schätzen schonjetzt die Kosten von Umweltkatastrophen und die Mittel für den Wiederaufbau auf mehrere hundert Milliarden Mark. Europa wird dafür noch viele Jahre zahlen.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Spiegel des 20. JahrhundertsDas Jahrhundert der Elektronikund der Kommunikation: Karl Otto Hondrich überden vernetzten Menschen .......................... 131Porträt: William Shockley,das gescheiterte Genie............................... 140
AuslandPanorama: Erfolg der Anti-Minen-Kampagne /Zerfall der Gaullisten..................................... 149Balkan: Frieden – wann?............................... 152Serbische Tiefflieger trotzen der Nato........... 154Interview mit Vuk Dra∆koviƒ übereinen Kosovo-Kompromiß............................. 157Serbien: Das Belgrader Tagebuch derSPIEGEL-Korrespondentin Renate Flottau .... 160Albanien: Ansturm der Helfer ...................... 166Kriegsverbrechen: Grundsatzurteil gegenVölkermörder ................................................ 172Nato: Interview mit GeneralsekretärJavier Solana über den Bombenkrieg ............ 174Nato-Strategie: Das neue Konzeptwird teuer ...................................................... 178USA: Schadensersatzklagen gegenWaffenindustrie............................................. 182Israel: SPIEGEL-Gespräch mit demHistoriker Amos Elon über die Wahlen und das Verhältnis zu den Palästinensern............. 183China: Eine Sekte schreckt die Staatsmacht ... 187
KulturSzene: Kunst-Weltmacht Amerika in Frankfurt /Lyrikerin Ulla Hahn überdas Auswendig-Sagen von Gedichten .............. 191Kulturpolitik: SPIEGEL-Gespräch mitMichael Naumann über das Holocaust-Mahnmal und die Kosovo-Debatte ................ 194Musik: Spektakuläre Premiere einervergessenen Kurt-Weill-Oper in Chemnitz .... 198Schauspieler: Suzanne von Borsodyrettet den TV-Film „Dunkle Tage“ ................ 202Schriftsteller: „Single & Single“,der neue Thriller von John le Carré .............. 210Bestseller ..................................................... 211Kunst: Spektakuläre Ausstellung in Weimar.... 212Scharmützel: Deich-Gegnerin Inge Meyselverärgert Nachbarn ....................................... 219
Wissenschaft + TechnikPrisma: Mikrochirurgie gegen Hirntumoren /Regenwalddüngung durch die Luft................ 221Prisma Computer: „Rote Listen“ aufCD-Rom / Plüschtiere als Peilgerät ............... 222Umwelt: Schäden im Kosovo-Krieg .............. 224Psychologie: Familien-Tabus belastendas Zusammenleben...................................... 228Klima: Interview mit demAtmosphärenforscher Thomas Peter überdas schwindende Ozonloch am Nordpol ........ 232Kommunikation: Futuristisches Datennetzzwischen Bonn und Berlin ............................ 236Seuchen: Rätselhaftes Virus in Malaysia ...... 239Automobile: Florierendes Geschäftmit Panzerlimousinen.................................... 242Astronomie: Neue Weltraumteleskopeerforschen den Röntgenhimmel .................... 244
Briefe ............................................................... 8Impressum .............................................. 14, 248Leserservice ................................................ 248Chronik......................................................... 249Register ....................................................... 250Personalien .................................................. 252Hohlspiegel/Rückspiegel ........................... 254
Blick in den Röntgenhimmel Seite 244Mit neuen Röntgensatelliten wollen Astronomen jene Orte im Universum erforschen,die dem Blick von der Erde bislang verborgen waren.Als erstes startete jetzt das deut-sche Weltraumteleskop „Abrixas“. Der erdumkreisende Himmelsspäher soll nach sterbenden Sternen und Schwarzen Löchern fahnden.
NS- und DDR-Kunst in Weimar Seite 212Weimar, Stadt der deutschen Klassik, warauch ein – umkämpfter – Hort der Avant-garde-Kunst. Eine dreiteilige Ausstellungzum Kulturstadt-Jahr zeichnet jetzt an Ortund Stelle „Aufstieg und Fall der Moder-ne“ nach: vom Impressionismus des Jahr-hundert-Endes über Abstraktionen, die der
Maler Johannes Molzahnnach dem Ersten Weltkriegals „Zeit-Taster“ (siehe Ab-bildung) ausgab, bis zumBauhaus mit seiner Utopie,Kunst und Industrie zu ver-einigen. Solchen wütend an-gefeindeten Experimentenstellt die Schau zwei Blöckestaatsnaher „Antimoderne“gegenüber: die bislang größ-ten Rückblick-Kollektionenvon Nazi- und DDR-Kunst.olzahn-Werk Nazi-„Venus und Adonis“ (von A. Kampf)
7

Briefe
Industrieanlage bei Belgrad llbare physische und wirtschaftliche Folgen
AP
SPIEGEL-Titel 16/1999
Titel: Lenz (Lorenz) Dietrich, Direktor der Autofirma VeritasDiese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de
Verdrehte MännerhirneNr. 16/1999, Titel: Nato gegen Milo∆eviƒ –
Krieg ohne Sieg
Ziel der Nato war es, die Kosovo-Albanervor Vertreibung und Schlimmerem zu be-wahren. Das Gegenteil ist erreicht worden.Es sieht so aus, als sei die Nato in eine Fal-le von Milo∆eviƒ getappt. Welche Konse-quenzen werden daraus gezogen? Es wirdverstärkt weitergebombt mit vielen Totenund gigantischen Milliardenschäden, alsgelte es, ein Jahr-2000-Problem der Waffenloszuwerden. Dieser Krieg hat bereits eineEigengesetzlichkeit entwickelt; es wirdhöchste Zeit, daß wieder politische Ver-nunft an ihre Stelle tritt.Zwingenberg (Hessen) Dr. Fred-Jürgen Breit
Phraseologisch haben wir schon gewon-nen: Nach „hinterfragen“ und „andisku-tieren“ folgt „ausbombardieren“.Quern (Schlesw.-Holst.) A. Zänkert
Bei der polemischen Paragraphenreitereium die Uno-Charta übersieht man einenwesentlichen Grundsatz des Völkerrechts:Jeder souveräne Staat hat das Recht, die In-tegrität seiner politischen Grenzen zu schüt-zen. Kein Staat hat aber das Recht, Men-schen zu massakrieren, zu vertreiben undethnische Säuberungen vorzunehmen. DieWeltgemeinschaft konnte nicht mehr un-tätig zuschauen, was im Kosovo geschieht.Deshalb begrüße ich die Entscheidung zumEinsatz von deutschen Kampfflugzeugen imRahmen des Nato-Einsatzes.Heidelberg Memet KiliçStellv. Vorsitz. des Bundesausländerbeirats
Dieser grobe Fehler der Nato, den Krieg inJugoslawien auszuweiten, ist die Folge meh-rerer Fehlentscheidungen. Als die Allianzsich auf ihren Hauptzweck als Verteidi-gungsgemeinschaft beschränkte, war dasNato-Konzept erfolgreich. Aber nach derWiedervereinigung Deutschlands und derAuflösung des Warschauer Pakts war dieExistenzberechtigung der Nato dahin. Dannhätte sie sich folgerichtig auflösen müssen,aber die gefährliche Wahnvorstellung, daß
8
die militärische Macht noch gebraucht wer-den könnte, verleitete sie zur Bereitschaft,auch eine offensive Rolle außerhalb des Ver-teidigungsgebiets anzunehmen. Nun hat siesich in eine Situation eingemischt, die diegrößtmögliche Eindämmung erfordert hät-te und ausschließlich der Uno vorbehaltenwerden sollte. Seltsam, wie be-denkenlos ein paar Nato-Mit-glieder auf den militärischenEingriff gedrängt haben, wobeiganz Europa unter den unvor-stellbaren physischen und wirt-schaftlichen Folgen leiden wird!Palos Hts. (USA) Steve Livesey
Man mochte nicht glauben, daßnach Slowenien, Kroatien undBosnien auch das Kosovo denMachthunger von Milo∆eviƒ stil-len sollte. Wer ihn nur zu gutkannte, wurde eines Besserenbelehrt. Heute verblutet das Ko-sovo, und man streitet immernoch, ob die Nato-Luftschlägegerechtfertigt seien. Die diplomatischenMöglichkeiten waren noch nicht ausge-schöpft, behaupten die extremen Linkenunter Herrn Gysi. Die letzten zehn Jahrewurde versucht, mit Milo∆eviƒ zu verhan-deln, der Verträge und Versprechen nachLust und Laune brach. Betrachtet man dieVorgehensweise und Ziele der beiden Sei-ten, so sollte es auch Herrn Ströbele wieHerrn Gysi etwas klarer in dieser Angele-genheit werden. Die serbische Kriegsma-schinerie geht skrupellos gegen die Zivil-bevölkerung vor, um ein von Albanern eth-nisch reines Kosovo zu schaffen. Sollte man
ZerstörteUnvorste
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
hierbei einfach zusehen? Zum Glück dieNato nicht. Die Allianz ist entschlossen,nicht mehr auf die billigen Angebote desTaktikers Milo∆eviƒ reinzufallen.Gütersloh Fahmi Daka
Ich mache mir große Sorgen, wenn ich sehe,wie schnell schon wieder Andersdenkendein Deutschland diffamiert werden, die nichtgleich hurra schreien, wenn wir wieder mitbomben dürfen, wenn die AkzeptanzDeutschlands ausgerechnet über das ge-meinsame Kriegführen stattfindet.Birkenfeld (Bad.-Württ.) Manfred Paffrath
Als Überlebender eines durch sowjetischeTiefflieger angegriffenen deutschen Flücht-lingstrecks, auf der Flucht aus meiner schle-sischen Heimat nach Bayern, dort in Mün-chen den Bombenangriffen der amerikani-schen „Befreier“ ausgesetzt, kann ich alldiesen so mutigen wie entschlossenen Be-fürwortern des Nato-Angriffs auf Jugosla-wien empfehlen: Ziehen Sie die Hauspan-
toffeln aus und festes Schuhwerk an, undmelden Sie sich für den persönlichen Ein-satz vor Ort als ,,Friedenskrieger“ oder bes-ser als Sanitäter, damit Sie zum ThemaKrieg eine fundierte Meinung bekommen.München Karl-Heinz Wittmann
Ein Mann sucht des Nachts seinen Haus-schlüssel. Er sucht ihn unter der Straßenla-terne. Dort hat er ihn zwar nicht verloren –aber er sucht dort, weil es hell ist. Übrigensist der Schlüssel schon vor Jahren verloren-gegangen. An diese Geschichte erinnertmich das Vorgehen der Nato gegen Serbien:
„Kein Zweifel, die Natowird siegen, aber es wirdein Pyrrhussieg. DasKosovo wird von Serbenund Nato zerstört.“Wolfgang Walper aus Schwabach in Bayern zum Titel „Nato gegenMilo∆eviƒ – Krieg ohne Sieg“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 7. Mai 1949
Schriftsteller Rudolf Leonhard fällt beim SED-Regime in Ungnade Stief-sohn Wolfgang, Dozent für Funktionärsnachwuchs, setzte sich nach Ju-goslawien ab. Katholischer Pfarrer berät: „Naturgemäße Geburtenrege-lung“ Für Knaus-Ogino. Kleinwalsertal, Österreichs Enklave Staatsrecht-liche Komplikationen in Harmonie gelöst. Differenzen in der WestunionBeiderseitige Abneigung zwischen Feldmarschall Montgomery und Gene-ral de Tassigny. Die internationale Stadt Tanger „Schanghai des Westens“.280000 geprellte Volkswagensparer Plan der enterbten Automobilisten.

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Briefe
ozahlen: Unterschiedliche Beliebtheitsskalen
AC
TIO
N P
RES
S
Sowenig der verloreneSchlüssel unter der Later-ne liegt – sowenig „paßt“die vermeintliche „Ret-tungsaktion“ zum beste-henden Problem.Stegen (Bad.-Württ.)
Dr. Stephan Marks
Sie diskutieren die Erwä-gung, ob es nicht klügerwäre, den BetonkopfMilo∆eviƒ heimlich undleise zu liquidieren, aber„mann“ kam zum Schluß,dies sei „unter der Würdedemokratischer Staaten“… Also, ich verstehe dieWelt nicht mehr, verstehe nicht, was in sol-chen verdrehten Männerhirnen vor sichgeht. Einen Massenmörder zu töten ist un-ter ihrer Würde, aber massenweise unschul-dige Menschen in unsägliches Leid zu stür-zen und immense Sachschäden anzurichtennicht? Das verstehe, wer will, ich nicht.Pirmasens Ingeborg Schunk
Ziehung der Lott
Dagobert, nicht DonaldNr. 16/1999, Lotto: Kleine Quote für verrückte Zahlen
„Wie Donald Ducks Goldtalerhügel“ häu-fe sich der Lotto-Jackpot an, solange keinereinen richtigen Sechser tippe, schreiben Sie.Die Ikone des Verlierertyps, Donald, hatihren Lebtag noch nie einen Goldtalerhü-gel besessen. Es kann sich ja wohl nur umseinen Onkel Dagobert Duck, den „reich-sten Mann der Welt“, handeln. Leider wer-den Donald und Dagobert oft verwechselt,obwohl es sich bei ihnen um zwei Entenhandelt, die, was den sozialen Rang angeht,unterschiedlicher nicht sein könnten.Berlin Ulli Kulke
Die Zahlen des „Gaga-Lottos“ müssen je-dem Tipper, der wenigstens beim Haupt-schulabschluß im Fach Mathematik nichtdurchgefallen ist, gezeigt haben, wie un-wahrscheinlich es ist, beim Lotto Millionärzu werden.Was aber die wenigsten wissen:Beim Lotto und den anderen im Toto- undLottoblock verwalteten Glücksspielen wer-den die Tipper nach allen Regeln der Kunstausgenommen: Nur maximal die Hälfte derSpieleinsätze wird wieder ausgeschüttet.Die Finanzminister der Länder freuen sichjährlich über mehr als zwei Milliarden MarkLotteriesteuer. Die Überschüsse (knapp fünf Milliarden Mark jährlich) nannte schonCasanova eine „Steuer der excellenten Gattung“. Statt die Zweckerträge für ge-meinnützige Zwecke zu verwenden, wie esden Tippern allerorten versprochen wirdund auch gesetzlich vorgeschrieben ist, ver-schwinden sie in Bayern, Hamburg, Sachsenund Mecklenburg-Vorpommern als allge-meine Deckungsmittel im Landeshaushalt.Und da, wo diese „Lottomittel“ für Sport,
d e r s p i e g e12
Soziales oder Kultur verwendet werden sol-len, verteilen die Herren der Lottotöpfe dieeine oder andere Million an den eigenenClub oder den Verein des Parteifreunds.Berlin Peter Köpf
Autor des Buches „Die Lotto-Mafia“
Für Baden-Württemberg ist die Beliebt-heitsskala sicher richtig, bundesweit abernicht übertragbar. Denn es gibt in den Bun-desländern unterschiedlich aufgebaute Wett-scheine, die zu unterschiedlichen Stickmu-stern/Tippbildern führen. So liegt an ersterStelle der Beliebtheitsskala in Baden- Würt-temberg die Diagonale = 7-13-19-25-31-37,doch nur aufgrund der Wettscheingestaltung„7 Zeilen à 7 Zahlen“! In Nordrhein-West-falen läßt sich weder diese noch eine ande-re Diagonale auf dem Wettschein ,,Zahlen 1bis 49 in einer waagerechten Reihe“ bilden!Wittingen (Nieders.) Stephan M. Rother
Künstliche NiedrigpreiseNr. 16/1999, Schiffbau:
Was wird aus den Werftarbeitern in Rostock?
Europäische Schiffbauer können ihre Sub-ventionen im Gegensatz nicht nur zu an-deren Ländern, sondern auch zu anderenBranchen, wie zum Beispiel der Automo-bilindustrie mit ihren Jahreswagen, nichtverbergen. Die Warnow-Werft ist ein Bei-spiel für den Aufbau Ost und nicht für aus-ufernde Schiffbauförderung. So beträgt die– aus meiner Sicht derzeit noch notwen-dige – Subvention pro Arbeitsplatz bei-spielsweise bei Sket oder Leuna ein Viel-faches von der bei der Warnow-Werft.Nicht Arbeitsintensität, sondern Kapital-intensität und Know-how prägen dendurchaus wettbewerbsfähigen deutschenSchiffbau. Bekanntlich saugt das Schwel-lenland Südkorea durch künstliche Nied-rigpreise mit Hilfe des IWF Aufträge vominternationalen Markt, um sich zur Über-windung seiner Wirtschaftskrise schnell Liquidität zu beschaffen. Allein das ist dieeigentliche Ursache der Probleme.Bonn Reinhold Robbe
MdB/SPD
l 1 8 / 1 9 9 9

Geriatrisches SexsymbolNr. 16/1999, Mode:
Wolfgang Joop über den neuen Alters-Chic
„Sexsymbole“, welch unerträglicher Ter-minus, sind weiß Gott nicht der Orientie-rungsrahmen der meisten Leute, schon garnicht derer über 35, die haben zuallermeistihre vergnüglichen Partner, Erlebnisse,Ab-wechslungen. Da hat Groß-Wolfgang auf-grund selbst (un)verschuldeter Young-Life-Krisen wohl erheblichen Nachholbedarf.Er bewältige seine eigenen Fragen und ver-schone uns mit diesem unerotischen Aus-fall („Outing“, zu deutsch)!Berlin Dr. Peter Müller-Rockstroh
Na endlich! Haben es die Modemacher be-griffen, daß kultivierte Magersucht undModels, die aussehen wie Wasserleichen,Leute genausowenig animieren wie dieVorstellung, nabelfrei und plateaubesohltin einen Kundentermin zu gehen. Mich (38)amüsiert die Ignoranz der Modemacherund Industrie schon lange, so komplett einekaufträchtige Kundengruppe außer acht zu
lassen. Denn im Ge-gensatz zu konsumter-rorisierten Teenies ste-hen wir schon langenicht mehr unter demZwang, jeden Trendmitzumachen – es seidenn, er gefällt.Zorneding (Bayern)
Christina Seuchter
Das ist ja prächtig! DasAlter beginnt ab 36,man trägt „Alters-Chic“ in Grau, siehtreichlich vergrämt aus,nimmt Viagra, läßt sichalles mögliche implan-tieren und zeigt trotz-dem – weil man ja altist – „zarte Linien umAugen und Mund“.
Mit 52 wird man erwähnenswert, wennman sich nicht liften läßt. Und dann? Dannwird es wohl Zeit, sich Gedanken um dieFarbe seines Leichenhemdes zu machen.Hamburg Dr. Hiltgunt Grabler (71)
Das war ja eine durchaus passable Ab-handlung über die Mode als Seele, HerrJoop! Ernstgemeinte Beweise Ihrer Ansichtüber das Altern könnten Spenden sein.Alte Menschen, Mister Ausrufezeichen,könnten Ihre finanzielle und menschlicheHilfe in jedweder Hinsicht gebrauchen.Bonn Kinza Abdel-Wahhab
Dank Alters-Chic werde ich dieses Jahr denSpaß der späten Jahre entdecken und michim Fitneßstudio stählen, um auch noch mit36 geriatrisches Sexsymbol sein zu können.Düsseldorf D. Steinfeld
Älteres Model
N.
McIN
ER
NEY
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9

Briefe
Cranach-Darstellung „Der Jungbrunnen“: Fausti
Autor RushdieBALBO
NTIN
/ G
RA
ZIA
NER
I / S
YG
MA
Schlag ins Gesicht Nr. 16/1999, Spiegel des 20. Jahrhunderts:
Standpunkte – Ulrich Horstmann über die Sucht nachdem ewigen Leben
Trotz aller medizinischen Künste und derEinrichtungen für sanftes Sterben trifft dasBild des brutalen Sensenmannes immernoch zu, der uns eines Tages hinwegrafft.Die einen machen in ihrer Angst einen wei-ten Bogen um alle Friedhöfe, andere ge-nießen jeden Rausch, den das vergnügte,kurze Leben zuläßt. Für wieder andere istwichtig, ihr begrenztes Dasein durch Er-lebnisse und Begegnungen zu vertiefen.Wiesbaden Theo Wollweber
Bravo, es ist schön, daß ein so klarer Geistim SPIEGEL abgedruckt wurde. Diese Me-taebene hat mir bei den Lehrenden in mei-nem Medizinstudium gefehlt.Hannover Michael Momma
Der Medizin die Abschaffung und die Ignoranz des Todes vorzuwerfen halte ichfür unangemessen. Ziel jeder medizini-schen Forschung und Versorgung war undist stets die Verbesserung/Erhaltung derLebensqualität gewesen und nicht die Welt-verbesserung (?) oder gar die Aufhebungder letzten natürlichen Grenze unsererExistenz, oft herbeigesehnt von Patienten
14
VERANTWORTLICHER REDAKTEUR dieser Ausgabe für Panorama, Terrorismus, Kosovo-Krieg, Flüchtlinge, Justiz, Spenden,Kriminalität: Ulrich Schwarz; für Regierung, Titelgeschichte (S. 32),Politik-Werbung, Atomkraft, Kriegsverbrechen, Nato-Strategie: Michael Schmidt-Klingenberg; für Titelgeschichte (S. 26, 42), Trends,Geld,Weltwirtschaft, Manager, Energie,Welthandel, Luxusindustrie,Internet: Armin Mahler; für Fernsehen, Fernsehserien, Szene,Psychologie, Kulturpolitik, Musik, Schauspieler, Schriftsteller,Bestseller, Kunst, Scharmützel: Dr. Mathias Schreiber; für Fußball,American Football: Alfred Weinziel; für Spiegel des 20.Jahrhunderts:Dr. Dieter Wild; für Panorama Ausland, Balkan, Serbien, Nato,USA, Israel, China: Dr. Romain Leick; für Prisma, Umwelt, Psycho-logie, Klima, Kommunikation, Seuchen, Automobile, Astronomie,Chronik: Jürgen Petermann; für die übrigen Beiträge: die Verfasser;für Briefe, Register, Personalien, Hohlspiegel, Rückspiegel: Dr.Manfred Weber; für Titelbild: Stefan Kiefer; für Layout: Rainer Sennewald; für Hausmitteilung: Hans-Ulrich Stoldt; Chef vom Dienst:Karl-Heinz Körner (sämtlich Brandstwiete 19, 20457 Hamburg)TITELILLUSTRATION: Nancy Stahl für den SPIEGEL
wie medizinischem Perso-nal. Hier von einer Ver-wässerung des Lebens zusprechen ist ein Schlag insGesicht aller Senioren.München Armin Beierlein
Seltsamerweise gilt es un-ter den wahren Menschenimmer noch als chic, aufden seelenlosen Schulme-diziner einzuschlagen. Erscheint uns seine fausti-schen Dienste aufzuzwin-gen – natürlich nur desRuhmes und Geldes we-gen und um seine neue-sten Geräte auszuprobie-ren; er scheint uns den
schnellen, würdevollen, ja vergnügten Todmit fünfzig zu rauben und uns zum Siech-tum bis achtzig zu verdammen.Tatsächlichaber sind es doch die Kranken, die, wennes ernst wird, dem Arzt die Tür einrennenund ihn auf Knien bitten, bloß nichts ausseinem Apparatepark auszulassen, undzwar 99 von 100 Menschen, einschließlichHerrn Horstmann, der das widerwärtiger-weise gleich anfangs eingesteht.Frankfurt am Main Wolfgang Bohnhardt
sche Dienste?
AKG
Geistvolles Spiel mit antiken Mythen?
Beiderseitige IgnoranzNr. 16/1999, Literatur: Benjamin von Stuckrad-Barre
über Salman Rushdies Rock’n’Roll-Roman „Der Boden unter ihren Füßen“
Daß Rushdie und sein neues Buch ausge-rechnet dem Pubertäts-Poeten Benjaminvon Stuckrad-Barre zum Fraß vorgeworfen
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
werden, ist traurig genug. Wenn Rushdiesgeistvolles Spiel mit antiken Mythen jedochals ,,Bildungsdünkel-Kalauer“ gebarrt wird,entpuppt sich der vorgebliche Rezensentendgültig als Blender, der ein Buch zwar bis zum Ende durchblättern, dessen Inhalteaber nicht verstehen kann. Dem Zeitgeistzum Trotz: Bis aus diesem schreibenden An-alphabeten so was wie ein Autor wird, mußer noch häufig in die Disco traben.Hamburg Daniel Killy
Der Autor demonstriert seine eigene mu-sikalische Ignoranz, genau die Ignoranz,die er Rushdie vorwirft, wenn er auf dieseunnachahmlich selbstgewisse Art derjeni-gen, die mit einem besonders begrenztenHorizont gesegnet sind, die Auffassungzum besten gibt, Indien und Rock hättennichts miteinander gemein. Gewiß wurdeder Rock nicht in Indien geboren. Dochhören die Menschen in dieser Gegend, wieim übrigen überall sonst auf der Welt auch,Rock und gründen Bands, die Rock spielen.Uetersen Palvasha von Hassell
Hätte der Kindler-Verlag auf das Tonträger-Design des Buchdeckels verzichtet – viel-leicht wäre dem Rezensenten aufgefallen,daß sich Rushdies Roman nur deshalb län-ger als 74 Minuten nicht bewegt, weil es Li-teratur ist und vollgesogen mit den Tech-niken von Proust und Joyce – und daß erdie Schnellebigkeit und den Erlebnishun-ger des Pop mit der Zeitrafferattacke einesVerdauungsvorgangs aufnimmt, zersetzt,umwandelt, transformiert: 734 Seiten langund keine Seite weniger. Daß Stuckrad-Barre dies nicht paßt, erklärt seine eigene
Schreibe. Daß er es nicht versteht und daßer sich, statt zu rezensieren, verbarrika-dieren muß hinter einer Halde von Vorur-teilen, zeigt das beständige Ausweichen aufNebenkriegsschauplätze qua Gagsprung.Von Rushdie erfahren wir dagegen nichts.Bergisch Gladbach Thomas Krüger
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mitvollständiger Anschrift und Telefonnummer – gekürzt zuveröffentlichen.
Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Ausgabe ist eine Post-karte des SPIEGEL-Verlages/Abo, Hamburg, beigeklebt.Einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Ausgabe liegen Beila-gen des Dreiviertel Verlags, Hamburg, bei.
Alte und neue KlischeesNr. 16/1999, Talkshows:
Im Visier der Medienkontrolleure
Die wesentliche Gefährlichkeit der,,Schmuddel-Talkshows“ besteht nicht imbefürchteten Sprach- und Sittenverderb derlieben kleinen Zuschauer, sondern geht ausvon jenen Shows, deren geforderte Gäste(und Teile des Publikums) mitnichten einBild der Gesellschaft bieten, sondern einekotzbunte Auswahl von sozial und psy-chisch derangierten Personen, die un-bekümmert (?) alle alten und neuen Kli-schees bestätigen, welche man vom unter-privilegierten Mitbürger hat. Tatsächlichsind ,,diese Leute“ so, aber nicht alle, unddie wenigsten drängen auf die Schandbüh-ne. Bürgerliche Kids, denen die Niederun-gen der Gesellschaft und die Abgründe derSeele noch fremd sind, werden via Birte,Bärbel & Co. schnellstens und dauerhaftdarüber ins schallende Bild gesetzt. Kinderwerden kaum noch soziale Erfahrungensammeln wollen angesichts solcher Le-bensbilder des realen Sozialdemokratismus.Frankfurt am Main Uve Schmidt

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Panorama Deutschland
Verheugen, Schröder
E U R O PA P O L I T I K
Spiel auf ZeitBundeskanzler Gerhard Schröder hat
einen Trick gefunden, die Personal-querelen in der Koalition wegen der Be-setzung der beiden deutschen EU-Kom-missarsposten aufzulösen. Er setzt aufZeitgewinn und hat sich daran erinnert,daß nicht nur zwei, sondern mit etwasGlück und Geschick sogar drei prestige-trächtige Europaposten zu vergeben sind.Hinter den Kulissen bemühen sich dieBonner heftig, die Zustimmung der übri-gen 14 Staats- und Regierungschefs für dieBesetzung des neuen Amtes eines „HohenBeauftragten für die Gemeinsame Außen-und Sicherheitspolitik“ der EU mit einemDeutschen zu erringen.Kandidat ist der versierte AußenpolitikerGünter Verheugen, jetzt Staatsminister imAuswärtigen Amt. Sein wichtigster Kon-kurrent, Nato-Generalsekretär Javier Solana, muß wegen desKosovo-Kriegs wahrscheinlich ein Jahr länger auf seinem Po-sten ausharren. Gelingt es Schröder, den SozialdemokratenVerheugen durchzusetzen, hätte er Zeit und Handlungsspiel-raum gewonnen. Er könnte sowohl die Grünen bedenken, dieauf Erfüllung einer entsprechenden Zusage im Koalitionsver-trag pochen, als auch die Christenunion, die der designierte EU-Präsident Romano Prodi gern beteiligt sähe.Ob die Grünen zum Zuge kommen, will Schröder vom Ausgangder Europawahl abhängig machen: Schneiden sie dort schlechtab, will er sie zum Verzicht bewegen, legen sie aber zu, ist ih-nen der Posten sicher. Die Grünen favorisieren dafür nach wie
U.
BAU
MG
ARTEN
/ V
AR
IO-P
RES
S
d e r s p i e g e
Funke-Haus in Dangas
vor Antje Vollmer. Als Kandidatder Union wird – neben Ex-Mini-ster Matthias Wissmann und demEuropa-Abgeordneten Elmar Brok– der frühere GesundheitsministerHorst Seehofer (CSU) genannt. Er
könnte, so das Kalkül, ein Gegengewicht zum Anti-Europa-Populisten Edmund Stoiber bilden. Der besondere Charmedieser Planspiele: Die Entscheidungen fallen erst Anfang Junibeim EU-Gipfel in Köln oder später – nach der Bundespräsi-dentenwahl, bei der die SPD auf die Grünen angewiesen ist.
Vollmer
DPA
t
A F F Ä R E N
Fehlende RechnungUnter zunehmen-
den Druck gerätder Bonner Landwirt-schaftsminister Karl-Heinz Funke in derAffäre um angeblichschwarz erledigteDachdeckerarbeitenan seinem künftigenWohnhaus. Der SPD-Politiker will nicht ge-wußt haben, daß der
damals schon arbeitslos gemeldete Indu-striearbeiter Jürgen Hobbiebrunken dasDach des Funke-Hauses im friesischenDangast 1997 in Schwarzarbeit reparier-te – zum vereinbarten Stundenlohn von25 Mark laut Hobbiebrunken.Für Thomas Schmitz, Sprecher des Zen-tralverbands des Deutschen Dachdecker-handwerks, steht fest: „Diesen Stunden-verrechnungssatz kann kein Dackdecker-
Funke
U.
BAU
MG
ARTEN
/ V
AR
IO-P
RES
S
betrieb in Deutschland, egal wo, anbie-ten. Das ist entweder Schwarzarbeit oderNachbarschaftshilfe.“ Nach den ver-bandseigenen „Musterkalkulationen fürKleinbetriebe“ lag der Stundenverrech-nungssatz für Vorarbeiter 1997 bei 89,84Mark, für Gesellen bei 81,52 Mark.Funke, der inzwischen formlose hand-schriftliche Quittungen über insgesamt
l 1 8 / 1 9 9 9
7175 Mark vorgelegt hat, davon angeb-lich 6391 Mark für Lohnzahlungen, kon-tert per Anwalt mit folgender Rech-nung: Bei der fraglichen Ziegeldach-fläche von 270 Quadratmetern ergebesich ein Quadratmeterpreis von 23,67 Mark. Ein Dachdecker könne proStunde durchaus zwei oder mehr Quadratmeter schaffen – bringe er es
auf zwei, steige derStundenlohn bereits auf47,34 Mark.Eine eindeutig entla-stende Schlußrechnung,die etwa die Mehrwert-steuer ausweisen wür-de, konnte der Ministernicht präsentieren. Ver-gangenen Freitag ließFunke durch seinen Anwalt mitteilen: „EineRechnung ist dann nicht mehr gekommen –warum, das muß Herr Hobbiebrunkenklären.“
J. S
AR
BAC
H
17

Panorama
18
Mit Bundesmitteln gefördertes Bauprojekt in Magdeburg (1994)
DPA
A U F B A U O S T
UndurchsichtigerDschungel
Die neuen Länder sind nicht in derLage, alle vom Bund für den Auf-
bau Ost bereitgestellten Mittel auszu-geben. In einem vertraulichen Papierdes Bundesfinanzministeriums heißt es,auf Verwahrkonten der BundeskasseBerlin lägen noch immer Fördergelderin Höhe von über einer Milliarde Mark,die von den Ostländern eigentlich inden vergangenen Jahren eingesetzt werden sollten. Der Bund zahlt im Rah-men des „Investitionsförderungsgeset-zes Aufbau Ost“ jährlich 6,6 MilliardenMark zur Wirtschaftsförderung im
ann
Osten. Doch bereits im Jahr 1995 blie-ben diese Hilfen des Bundes zum Teilliegen: Allein Sachsen rief damals über380 Millionen nicht ab.Derzeit befinden sich etwa 1,2 Milliar-den Mark auf den Verwahrkonten, über500 Millionen für Sachsen, je rund 200Millionen für Brandenburg und Sach-sen-Anhalt, 110 Millionen für Thürin-gen und 80 Millionen für Mecklenburg-Vorpommern. Im Unterschied zu ande-ren Haushaltsmitteln können die neuenBundesländer auf die Restbeständenoch später zurückgreifen. Die nichtverbrauchten Gelder stehen in den Fol-gejahren zusätzlich zur Verfügung.Als Grund für die Probleme beim Geld-ausgeben gilt der bis heute undurch-sichtige Dschungel der Fördergesetze.Den soll der für den Aufbau Ost zu-ständige Staatsminister Rolf Schwanitz(SPD) nun lichten.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
U M W E L T M I N I S T E R I U M
Neue BeraterMit einem fein austarierten Perso-
naltableau will der grüne Bundes-umweltminister Jürgen Trittin seine imMärz neuformierten Beratungsgremienbesetzen. Vorsitzender der Reaktorsi-cherheitskommission soll der Kernkraft-kritiker Lothar Hahn werden, Koordi-nator des Fachbereichs Reaktorsicher-heit des Darmstädter Öko-Instituts. Zuseinem Stellvertreter soll Edmund Ker-sting ernannt werden, Kernkraftbefür-worter und Abteilungsleiter bei der Ge-sellschaft für Anlagen- und Reaktorsi-cherheit. Für den Vorsitz der Strahlen-schutzkommission wünscht sich Trittindie Epidemiologin Maria Blettner; die Atomkraftbefürworterin arbeitetderzeit am Internationalen Krebsfor-schungszentrum in Lyon. StellvertreterBlettners soll der Münsteraner Strahlen-biologe Wolfgang Köhnlein werden, einKritiker des etablierten Strahlenschut-zes. Bisher war Köhnlein Präsident der„Gesellschaft für Strahlenschutz“, diesich als Konkurrenz der alten Strahlen-schutzkommission verstand. Diese Woche werden die neuen Vorsitzendengekürt.
A T O M M Ü L L
Klage zurückgezogenDie niedersächsische Landesregie-
rung hat eine Klage gegen denBund vor dem Karlsruher Verfassungs-gericht zurückgenommen. Die Staats-kanzlei in Hannover hatte Bonn mit der1997 eingereichten Klage verpflichtenwollen, sich an den Kosten für die Si-cherung von Atommülltransporten insZwischenlager Gorleben zu beteiligen.Nach einem Signal der Verfassungsrich-ter, daß der juristische Vorstoß kaumAussicht auf Erfolg haben werde, be-schloß die Landesregierung jetzt dieRücknahme.
Castor-Transport
AC
TIO
N P
RES
S
J U S T I ZPDS fördert SED-GegnerEinen Personalcoup plant die PDS:
Sie will Florian Havemann, Sohndes prominenten DDR-RegimekritikersRobert Havemann, zum Verfassungs-richter in Brandenburg machen.Havemann, 47, bestätigte aufAnfrage, er stehe „als loyalerStaatsbürger“ dem Angebot po-sitiv gegenüber. Die PDS warEnde vergangenen Jahres amWiderstand der SPD mit demVersuch gescheitert, die Schrift-stellerin Daniela Dahn zur Ver-fassungsrichterin zu ernennen.Havemann, den die SED-Nach- Havem
folgepartei nun nominieren will, istElektriker und Autor. Juristische Erfah-rungen, erklärt er, habe er bereits inder DDR gesammelt. Nach Protestengegen den Einmarsch der Sowjets inPrag 1968 war er wegen „staatsfeindli-cher Hetze“ verurteilt worden und saßvier Monate in Haft. Auch bei der Ver-
teidigung von PDS-VormannGregor Gysi habe er sich ju-ristisch betätigt. Der Have-mann-Sohn hatte den PDS-Politiker gegen den Vorwurf in Schutz genommen, er habeals Anwalt den DissidentenHavemann verraten. Das Aus-maß seines Verhältnisses zurPDS sei ansonsten „gleichNull“.
J. B
ER
GER
/ T
IP

Deutschland
C H I N A - R E I S E
„Clinton als Vorbild“Gerd Poppe, 58,einst ein führenderKopf der DDR-Bür-gerrechtsbewegung,wurde nach demRegierungswechsel„Beauftragter fürMenschenrechteund HumanitäreHilfe“ im Außen-ministerium.
SPIEGEL: Zehn Jahre nach der blutigenNiederschlagung der Studentenprotestereist Bundeskanzler Gerhard Schröderim Mai nach China. Werden Sie alsMenschenrechtsbeauftragter mitreisen? Poppe: Ein solches Angebot liegt derzeitnoch nicht vor.SPIEGEL: Wer könnte das Thema Men-schenrechte in der deutschen Delega-tion vertreten?Poppe: Das ist mir noch nicht bekannt.Ich hätte es begrüßt, wenn ich als Men-schenrechtsbeauftragter in die Planungder Reise einbezogen worden wäre. Ichplädiere dafür, daß Wirtschaftsvertreterin der Gruppe nicht überrepräsentiertsind.
M.
UR
BAN
d e r s p i e g e l
Häftlinge des Gefängnisses von Schanghai auf
SPIEGEL: Was erwarten Sie von der Reise?Poppe: Ich erwarte ein deutliches, einöffentliches Signal an die Demokratie-bewegung Chinas. Der Kanzler solltesich Bill Clintons China-Reise als Vor-bild nehmen und auf einem öffentlichenAuftritt zu diesem Thema bestehen. Esist klar, daß sich chinesische Politikerdagegen sträuben. Aber gegen diese Widerstände muß man sich eben be-harrlich durchsetzen.SPIEGEL: Sind Sie generell gegen Ge-schäfte mit einem Land, das Menschen-rechte mißachtet?Poppe: Nein. Aber die Politiker dürfennicht nur davon reden, daß Handelauch Wandel bringen kann. Man mußden Gesprächspartnern deutlich ma-chen, daß Demokratie eine Gesellschaftstabilisiert, nicht destabilisiert. Außer-dem sollten Firmen, die in einem Landwie China investieren, dazu gedrängtwerden, dort den Belegschaften ähnli-che Rechte einzuräumen wie hierzulan-de. Es gibt Firmenleitungen, die dafüroffen sind. China hat die Uno-Men-schenrechtspakte unterzeichnet, Verbes-serungen sind aber nicht eingetreten.Die deutsche Delegation darf zu denlaufenden Prozessen, zu den Verhaftun-gen von Regimekritikern und zu denMenschenrechtsverletzungen in Tibetnicht schweigen.
dem Weg zur Zwangsarbeit
GAM
MA /
STU
DIO
X
F A H N D E R
Kontrolle für SpitzelDas Bundeskriminalamt (BKA) will
seine V-Leute genauer kontrollie-ren. Zur strafferen Führung der Spitzelund Informanten haben die Wiesba-dener Fahnder nach langwierigen inter-nen Auseinandersetzungen eine „Pro-jektgruppe V-Leute“ eingerichtet, beider die inoffiziellen Mitarbeiter zentralangebunden sind. Bislang wurden diezumeist aus dem kriminellen Milieustammenden Polizeihelfer direkt voneinzelnen Ermittlern geführt – einige
Zuträger gelten als Spitzenleute, sie sol-len tief in verbrecherische Organisatio-nen eingedrungen sein. Kritiker derNeuregelung fürchten, daß die V-Leutesich weigern könnten, mit anderen alsden ihnen vertrauten Kriminalbeamtenzusammenzuarbeiten. Hintergrund derZentralisierung ist der Fall des V-MannsHelmut Gröbe („VP 572“), der seinemBKA-Führungsmann aus dem Ruder ge-laufen war und dadurch peinliche inter-ne Recherchen in Gang gesetzt hatte(SPIEGEL 26/1998). Im März wurdeGröbe in München wegen Meineids zueiner Haftstrafe von 18 Monaten aufBewährung verurteilt.
1 8 / 1 9 9 9

Panorama Deutschland
20
PDS-Vize Dehm
AR
IS
Total digital
Am Rande
P D S
Ärger mit dem WessiDie Realos um Fraktionschef Gregor
Gysi werden zunehmend von Die-ther Dehm, 48, seit Herbst letzten Jah-res erst Mitglied und schon stellvertre-tender Vorsitzender der PDS, verärgert.Die Genossen werfen dem Westimportvor, die Suche nach einer PDS-Kandida-tin für das Amt des Bundespräsidentenan anderen Spitzenfunktionären vorbeibetrieben zu haben. „Irgendein HerrDehm“, erklärte sie, habe bei ihr „vor-gefühlt, ob ich bereit wäre“. AnderePDSler sahen sich dadurch gezwungen,den Vorschlag mitzutragen – ohne mitder Theologin überhaupt gesprochen zuhaben. „Wir konnten nur noch ab-nicken“, beklagt sich ein Spitzengenos-se der Bundestagsfraktion. Selbst Partei-Guru Gysi, der noch vor kurzemzum Verzicht auf einen Kandidaten ge-raten hatte, wehrte sich angesichts dergeschaffenen Fakten vergeblich gegendie Nominierung der Theologin. Gysiwollte erst ein Gespräch von führendenPDS-Politikern mit dem SPD-Kandida-ten Johannes Rau abwarten, das dieseWoche stattfinden soll.Dehm wird von den Realos noch einweiterer Alleingang angelastet: Derwendige Hesse, der selbst jahrelang Mit-glied der SPD war, hatte SPD-Verteidi-gungsminister Rudolf Scharping als„Übererfüllungsgehilfen des Militaris-mus“ beschimpft und die Sozialdemo-kraten auf Kundgebungen wegen derKriegsbeteiligung Deutschlands scharf
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
angegriffen. Gysi, Bisky und VordenkerAndré Brie fürchten, solche derbenAttacken könnten die SPD vor weitererZusammenarbeit mit der PDS in denneuen Ländern zurückschrecken lassen.Auf einer Klausurtagung am vorvergan-genen Sonntag warnte Parteichef Biskynun „führende Vertreter“ der Partei,sich nicht mehr zu „Verbalradikalis-men“ hinreißen zu lassen. Bisky wört-lich: „Noch vertrete ich die Partei nachaußen.“
Gerade hat BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel aufsschäbigste die Rohr-post-Anlage desBundeskanzleramtsals Zeichen techni-scher Rückständig-keit geschmäht, da
schlägt die Regierung mit einer Hy-per-High-Tech-Kommunikations-Sen-sation zurück: „InformationsverbundBerlin-Bonn“ (IVBB) heißt das glas-fasergewirkte Wunderwerk für denBehörden-Telefonverkehr (siehe Sei-te 236). Es ist erstens dazu ersonnen,alle Ministerien total digital mit-einander zu verbinden. Und zweitensgeeignet, Henkel so zu beschämen,daß er sich dorthin trollt, wo man an Drahtkabeln von Anno Dunne-mals telefoniert: in die BDI-Zentralein Köln.Wo aber der Fortschritt so ungestümvoranstürmt, sind natürlich auch Op-fer zu beklagen, wie etwa derMensch. Mit dem neuen Telefonnetzder Ministerien in Bonn und Berlinwird nämlich auch eine neue Zen-tralnummer für alle Ressorts Einzughalten, die 01888. Zur Erinnerung:Vor nicht langer Zeit kam schon dieneue Nummer der Telekom-Aus-kunft (11833), die so ähnlich lautetwie die Nummer der neuen Konkur-renz Telegate (11880), die so ähnlichlautet wie jetzt die neue IVBB-Num-mer – wie soll das ein durchschnitt-lich begabter Ministerialer behalten?Dank einer Werbekampagne! Aufwelche Art man so etwas macht, dashat die Volksschauspielerin VeronaFeldbusch für die Telegate-Auskunft(11880) gezeigt: „Wie ich mir dieNummer merke? 11 Tage im Urlaub,88 Filme verschossen, und, uhps, 0drauf.“ Gottlob fehlt es auch der Re-gierung nicht an sympathischenVolksschauspielern für die neue01888. Bei der SPD natürlich derKanzler, er könnte werben: „Wir ha-ben 0 Ahnung und machen in 1emJahr 888 Gesetzesentwürfe.“ Und beiden Grünen könnte dann Jürgen Trit-tin bekennen: „Alle halten mich füreine 0, aber darin bin ich 1malig, unddafür zollt mir jeder dreifach 8ung.“Wetten, das bleibt hängen, denn wasalle merken, das können sich auchalle ganz leicht merken.
Unionswähler für Rau
Angaben in Prozent; an 100 fehlende Prozent:keine Angabe; Emnid-Umfrage für den SPIEGELvom 27. und 28. April; rund 1000 Befragte
Nachgefragt
Welchen Kandidaten würden Siezum Bundespräsidenten wählen,wenn es eineDirektwahlgäbe?
54
Johannes Rau
Dagmar Schipanski
Uta Ranke-Heinemann
West Ost
42
CDU/CSUAnhänger
40
18 16
32
6 10 6

Werbeseite
Werbeseite

Deutschland
22
Russischer
R E G I E R U N G
„Da bröckelt was“Rot-Grün fürchtet, daß die Stimmung im Volk für die Nato-Bombardements
bald kippen könnte. Selbst in der SPD wagen sich die Kriegsskeptiker lauter hervor. Die deutschen Friedensmissionen sollen auch die Koalition retten.
Während er auf dem Weg zumnächsten Termin durchs Kanzler-amt stürmte, schnappte sich Ger-
hard Schröder vergangene Woche die neu-esten Umfragedaten. Seit Wochen lag derBundeskanzler stabil im Meinungshoch.Was sollte sich im Trott der täglichenKriegsroutine daran groß ändern?
Doch ein Blick auf die Zahlen genügte,um den Kanzler zu alarmieren. Bei einemder drei Institute waren seine Popula-ritätswerte erstmals seit Kriegsbeginn deut-lich gesunken.
Lagen die Forscher falsch? War das Gezerre um 630-Mark-Jobs und Schein-selbständigkeit schuld? Oder haben dieDeutschen den Krieg womöglich lang-sam satt?
Auch wenn die Demoskopen kein ein-heitliches Stimmungsbild ermitteln kön-
Jugoslawien-Beauftragter Tscher
nen, wächst in der rot-grünen Bundesre-gierung die Furcht, daß sich des Volkes Zu-stimmung mit jeder weiteren 100 Millio-nen Dollar teuren Bombennacht langsamins Gegenteil verkehrt.
52 Prozent der Befragten, meldete For-sa vergangene Woche, votierten inzwischenfür einen einseitigen Waffenstillstand derNato. Die ständige Formel der Generäle –„die Nato erhöht den Druck“ – scheintsich zu verschleißen. „Da bröckelt was“,glaubt Ernst-Otto Czempiel, Professor fürinternationale Politik, „die Konsenserzeu-gungsmaschine gerät ins Stottern.“
Für die Bündnispartner hat ein dramati-scher Wettlauf begonnen. Über Belgradwerden mehr und mehr Bomben abgela-den, ohne daß Slobodan Milo∆eviƒ sichtbarangeschlagen wirkt. Zugleich wächst da-heim langsam das Gefühl: Jetzt reicht’s. Im
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
nomyrdin, Kanzler Schröder, Kriegsschäden
Auswärtigen Amt fürchten die Diploma-ten: „Der Zeitdruck wächst.“
Doch der Kanzler sieht noch kein Endeder Bombardements. Nach seinem Treffenmit Uno-Generalsekretär Kofi Annan ver-gangene Woche in Berlin meinte Schröder:„Wir sind nicht am Ende, sondern am An-fang eines Prozesses.“
Schnelle Erfolge an der Friedensfronthat die rot-grüne Regierung jedoch drin-gend nötig. Wenn erst mal die Stimmung in der Bevölkerung zuungunsten des Nato-Kriegs kippt, kann sich auch Schrö-der nicht länger als bündnistreuer Dritterneben dem amerikanischen PräsidentenBill Clinton und Englands PremierministerTony Blair präsentieren. Auch in der SPDwürde der Widerstand gegen die Bom-ben auf Belgrad wachsen und Schröder –zusätzlich zum Ärger in der Steuer-
DPA
in Sudurlica nach einem Nato-Angriff: Der

ing*: Demonstration der Hochmoral
Zeit
und Sozialpolitik – das Regieren schwer-machen.
Unmittelbare Gefahr droht aber von denGrünen. Frönen sie auf dem Sonderpartei-tag am 13. Mai, dem Himmelfahrtstag, nacheiner weiteren Woche ergebnisloser Bom-berei, ihrer latenten Lust an der Apoka-lypse und verweigern der Führungsspitzedie Gefolgschaft auf dem Kriegskurs, dannwäre ein historischer Rekord erreicht: diemit Abstand kürzeste Amtszeit einer deut-schen Nachkriegsregierung.
Die Nato sorgte vergangene Wocheselbst dafür, die Zweifel am Krieg zu ver-stärken. Denn dem mächtigsten Militär-bündnis der Weltgeschichte, dessen Mit-gliedsländer zur Zeit jährlich 450 MilliardenDollar für Verteidigung ausgeben, unterliefeine ganze Serie dramatischer Pannen.
Da war die „Harm“-Rakete, die statt ineiner serbischen Flugabwehrstellung 50 Ki-lometer jenseits der Grenze in einemWohnhaus am Rande der bulgarischenHauptstadt Sofia einschlug.
Zwei weitere Irrläufer landeten in Wohn-gebieten auf serbischem Terrain und töte-ten nach Belgrader Angaben mindestens20 Menschen, während Nato-Sprecher Ja-mie Shea gewunden zugeben mußte, daßdie Allianz entgegen allen Beteuerungeninzwischen auch die besonders tückischenSplitterbomben einsetzt.
Gleichzeitig verlieren die Militärs ihreMacht über die Fernsehbilder. Im fortge-
druck wächst
setzten Hunger nach neu-en Elendsbildern bringendie Sender weniger Be-richte von darbendenFlüchtlingen, dafür aberzunehmend Beiträge vomLeid der serbischen Zivil-bevölkerung.
„Die Legitimation desKriegs wird immer frag-würdiger, je mehr unschul-dige Opfer es gibt“, glaubtPolitikprofessor ThomasMeyer, politischer Leiterder SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Die zyni-sche Kalkulation des Dik-tators, irgendwann in dieOpferrolle zu gelangen, wenn er sein Volknur lange genug beschießen läßt, scheintlangsam aufzugehen.
Für Meyer ist „nicht unwahrscheinlich“,daß die Weltöffentlichkeit mit zunehmen-der Dauer veränderte Rollen wahrnimmt.Anfangs kämpfte die Nato für das Gutegegen einen faschistischen Diktator, in-zwischen leidet ein tapferes kleines Volkunter blindwütigem Furor.
Vorerst jedoch scheint sich Gleichgül-tigkeit breitzumachen. „Bild“, des Kanz-lers wichtigster Indikator für die Kon-junktur von Themen, hat den Krieg zu-nehmend seltener auf der Titelseite. DieEinschaltquoten für Sondersendungen
Minister Scharp
AP
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
REU
TER
S
erreichen längst nicht mehr die anfängli-chen Spitzen.
Der Bamberger Politikprofessor HansRattinger hat „Halbwertzeiten“ für die öf-fentliche Neugier ausgemacht: „Das Inter-esse halbiert sich nach etwa drei Wochenund nach weiteren drei Wochen wie-der.“ Die „wachsende Indifferenz“ der Zu-schauer, die den Krieg zunehmend als nor-malen Bestandteil der täglichen News- undEntertainment-Offensive wahrnehmen, seiaber noch kein Indiz für schwindende Zu-stimmung. „Ein paar Wochen“, so Rattin-ger, „hat die Regierung noch.“
Vorausgesetzt, Parteien und Fraktionenhalten still.Vor allem in der KanzlerparteiSPD wächst der Druck. „Bei uns sieht esdoch genauso aus wie bei den Grünen“,sagt ein erfahrener Vorarbeiter der Bun-destagsfraktion: „Die Abgeordneten hal-ten nur noch die Klappe, weil sonst die Re-gierung am Ende ist.“
Fraktionschef Peter Struck wollte sichbereits pädagogischen Rat im Umgang mitparteiinternen Dissidenten bei seinem grü-nen Kollegen Rezzo Schlauch einholen. DerSchwabe zuckte nur mit den Schultern.
Unerfreulich wird die Lage für Schröderauch im Osten Deutschlands. Je länger derKrieg dauert, desto mehr erinnern dieSchlagzeilen des einstigen SED-Zentral-organs „Neues Deutschland“ an alte Zei-ten. Vom „Jugoslawien-Überfall“ ist dieRede, von „Nato-Führern“, an deren„Händen Blut klebt“.
Der Ton trifft die Befindlichkeit.Herrscht im Westen nach wie vor eher Zu-stimmung zum Bombardement, dominiertin den neuen Ländern klar die Ablehnung.In der Kriegsfrage ist das Land tiefer ge-spalten als bei jedem anderen Thema. Mö-gen die Ostdeutschen im gemeinsamenDeutschland angekommen sein – sie fühlensich in der Nato nicht zu Hause.
Profiteur der ostdeutschen Skepsis istdie PDS, die als einzige Partei das ver-breitete Unbehagen artikuliert. Verein-zelt schließen sich sozialdemokratische
* Am vergangenen Dienstag in Bonn mit einem Foto vonLeichen in Rugovo.
23

Kommentar
24
Arroganz der MachtRUDOLF AUGSTEIN
Macht korrumpiert, und absolute Macht korrumpiert absolut.
Lord Acton 1887
Man sollte meinen, der wider-wärtige Luftkrieg gegen Rest-Jugoslawien hätte einige be-
zahlte westliche Schläfer in den Ämternwachgerüttelt. Für die Führungsmachtder Nato, die Vereinigten Staaten vonAmerika, gilt das offenbar nicht, ob-wohl Clinton von den republikanischenAbgeordneten zurückgepfiffen wurde.
Viele denken, aber keiner der Offi-ziellen sagt es laut, daß der Krieg inund um das Kosovo jetzt schon eineschreckenerregende Fehlbilanz auf-weist, die mit militärischen Mittelnnicht mehr ausgeglichen werden kann.Ein von Washington verfehlter Kriegalso – man darf diesen Ausdruck jaschon wieder benutzen –, der ange-sichts der Fernsehbilder als humanitä-re Aktion natürlich populär war, mitt-lerweile aber jede Faszination sogar fürdeutsche Militärherzen verloren hat.
Man hat alles unterschätzt, was nurzu unterschätzen war: den widersetz-lichen serbischen Volkscharakter, diealbanischen Kleinkriege untereinander,die ungeheuerliche Flüchtlingstragödie,die man angeblich verhindern wollte,nun aber enorm angefacht hat. Manwußte nicht, daß die Mehrheit der Ma-zedonier in den Albanern ihren Haupt-feind sieht. Und vor allem: Man mach-te sich nicht klar, daß der schlaue undhinterhältige Slobodan Milo∆eviƒ fürjede Doppelrolle bereitstand.
Zudem hatte man kein definierba-res Kriegsziel wie 1991 im Golfkrieg,als man sich – dies aber auch erstwährend der kriegerischen Entwick-lungen – entschied, den schurkischenSaddam Hussein nicht durch Wegnah-me Bagdads zu enthaupten, sonderntrotz ständigen Kriegszustands an derMacht zu belassen.
Diesmal war Clinton von der Mehr-heit der Generalität gewarnt worden,daß sich der serbische Diktator binnenangemessener Zeit durch einen Luft-krieg allein nicht zur Aufgabe zwingenlassen würde. Diese Voraussage hat sichbereits erfüllt. Erreicht, wenn auchnicht gewollt, wurde nun die offen-sichtliche und totale Spaltung von Ser-ben und Kosovo-Albanern, die sogar
in einem autonomen Gebiet nie mehrwerden miteinander leben können.Ver-fehlt wurde weiter das Kriegsziel, Rest-Jugoslawien samt Kosovo und Monte-negro zusammenzuhalten. Der politi-sche Sprengstoff, der hier lagert, ist bis-her nur von Wissenschaftlern analysiertund offen angesprochen worden.
Milo∆eviƒ mag sicher grausam sein,aber als Dummkopf hat er sich bishernicht gezeigt. Weder ein Uno-Protek-torat und schon gar nicht ein Nato-Pro-tektorat würde den Serben den Zugangzum Meer sichern und den Albanern irgendwelchen Schutz vor serbischerGuerrilla geben können.
Durch die Ausbreitung der keines-wegs nur friedlich gesinnten Albanerist, wie man ebenfalls vorausgesagt hat-te, der Balkan stärker zerrüttet wor-den, als man sich vorher eingestehenwollte. Er wird auf lange Zeit eine Kri-senregion bleiben.Wer sollte die gleich-falls kriegswütigen Albaner hindern,auf ein Groß-Albanien hinzusteuern?Albanien ist das einzige europäischeLand, in dem ein Ministerpräsidentwährend einer Sitzung erschossen wur-de, so geschehen im Jahre 1981.
Es mag sicher schwer sein, die Wir-ren des Balkans zu durchschauen.Aberdiese Unkenntnis kann man nichtdurch Tornados und Tarnkappenbom-ber zudecken. Die Alliierten wußtennicht weiter, und man darf sich nichtsvormachen: Die USA hatten in Ram-bouillet militärische Bedingungen ge-stellt, die kein Serbe mit Schulbildunghätte unterschreiben können.
So drängt sich denn die Vermutungauf, daß die USA beabsichtigt haben,den Europäern den Einstieg in ihre weitausgreifende neue Strategie schmack-haft zu machen. Seit längerem versu-chen die USA die Europäer, oder rich-tiger die Nato, davon zu überzeugen,daß die Allianz in allen Teilen dieserErde tätig werden müsse, wo die Inter-essen der Nato gefährdet seien.
Daß die Interessen der Nato nur all-zuoft mit den laut verkündeten Inter-essen der USA identisch sind, nichtaber unbedingt mit denen der Nato-Mitglieder, hat man auch in Bonn/Ber-lin begriffen. So sagte denn Joschka Fischer: „Wer die Nato zerstören will,muß sie überfordern. Sie ist nicht diemilitärische Megamaschine, sie ist ein
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
politisches Bündnis. Gefolgschaft aufPfiff geht nicht.“
Auch Kanzler Schröder verwahrtesich glaubhaft gegen einen erweitertenAktionsradius der Atlantischen Allianz.Dennoch ist eine allmähliche Auswei-tung der „Out of area“-Einsätze auchfür europäische Nato-Truppen zu be-obachten, nachdem das amtliche Ame-rika 1993 allein durch den Verlust von 18Elite-Soldaten in Somalia traumatisiertwurde. Die Weltmacht, deren technischeÜberlegenheit niemand in Zweifel zieht,braucht also europäische Hilfstruppen.
Orientierte Menschen werden sichden Kalten Krieg sicher nicht zurück-wünschen. Aber die Amerikaner brau-chen nun einmal ein Feindbild, und seies noch so vage. Sicher würden sie gernallein den Weltsheriff spielen. Dochdazu reicht es nicht. Die USA wollendie Nato als Hilfssheriff. Man muß so-gar fürchten – wie Charles de Gaulledas ja immer getan hat –, daß sich ihnendie Engländer zu jeder Gewaltaktiongeradezu anbiedern. So muß man nichtals allzu zynisch gelten, wenn man fest-stellt, daß von den Vereinigten Staatender Kosovo-Konflikt außer aus ver-ständlichen humanitären Motiven auchals ein Stück ihrer Weltstrategie benutztund begonnen worden ist.
Auf absehbare Zeit wird der Balkandas einzige wirkliche Krisengebiet Eu-ropas bleiben. Uns Deutsche nach In-donesien zu locken, wo ohne Zweifelein Zehnfaches der Greueltaten derMilo∆eviƒ-Schergen verübt wird, dürf-te schwer sein. Aber man muß immerdie schon seit August Bebel umgehen-de Furcht der SPD, als illoyal zu gelten,in Rechnung stellen, und die der Grü-nen erst recht. Die rot-grüne Regierungin Bonn/Berlin mußte für dieses eineMal nachgeben, weil sie sonst schlichtaufgeflogen wäre. Das kann aber nichtso bleiben.
Zweifelsfrei ist auch, daß dieCDU/CSU im Ernstfall die besserenKarten hätte, um dem amerikanischenVerlangen nach einem Hilfspolizistenzu widerstehen. Erfahrungsgemäß wür-de sie ihre Position, bevor sie nachgibt,zunächst sehr deutlich machen. Es giltnun aber mehr als früher, sich innerlichgegen Zumutungen, die außerhalb desVerteidigungsbereichs der Nato liegen,zu wappnen.

Deutschland
Kriegsgegner schon Friedensappellen derPDS an.
Mit propagandistischem Weitblick hattePDS-Wahlkampfmanager André Brie lan-ge vor Kriegsbeginn den Spruch „Europaschaffen ohne Waffen“ zum Motto für dieEU-Parlamentswahlen am 13. Juni auser-koren. Früher als geplant ließ die Parteinun den Slogan plakatieren – sehr zumUnbehagen der SPD.
Mit seinem Instinkt für die ostdeutscheStimmungslage artikulierte BrandenburgsMinisterpräsident Manfred Stolpe als ersterführender Ostgenosse die Skepsis. DerBrandenburger, der den russischen Unter-händler Wiktor Tschernomyrdin gut kennt,
SPD-Ministerpräsidenten Stolpe, Höppner: Friedensthema nicht der PDS überlassen
DPA
erträgt wie sein Kollege Reinhard Höppneraus Sachsen-Anhalt den Kurs seines Kanz-lers nur murrend.
Auf einem Treffen des deutsch-russi-schen Kulturforums Mitte vergangener Wo-che in Potsdam wurde Stolpe so deutlich,wie ein Sozialdemokrat derzeit werdendarf: Die Nato wisse nur „mit altherge-brachten, dafür wenig geeigneten Mittelnzu reagieren“; die Flüchtlingsströme wür-den durch die Luftschläge „eher intensi-viert“. Die Nato begehe einen „dramati-schen strategischen Irrtum“.
Neben der Eskalation des Kriegs fürch-tet Stolpe vor allem die Landtagswahlen imSeptember. Weil der Regierungschef dieabsolute Mehrheit zu verteidigen hat undzudem noch in Thüringen, Sachsen undBerlin gewählt wird, könne man, so hieß esauf einem Treffen führender Ost-Sozis, dasFriedensthema nicht der PDS überlassen.
Das kann diese Woche schwierig wer-den, wenn US-Präsident Clinton bei sei-nem überraschenden Deutschland-BesuchFernsehbilder produziert, die ihn mal ander Seite seiner Kosovo-Piloten auf den
US-Stützpunkten Ramstein und Spang-dahlem zeigen und mal an der Seite desfriedensbemühten Kanzlers.
Beide Bundesgenossen hoffen freilich,daß die Pendelmissionen in Sachen Frie-den, mit denen sich auch die deutschen Po-litiker vergangene Woche um die Russenbemühten, Erfolg bringen. Denn der Prä-sident ist wie Schröder „zwischen Viet-nam-Syndrom und München-Syndrom ge-fangen“, klagt ein Minister. Ein Weiter-bomben mit unübersehbaren Folgen endetwomöglich ebenso im Desaster wie vor-sichtiges Einlenken. Dann zöge sich dieNato – wie 1938 der britische Premier Neville Chamberlain durch sein Münchner
Abkommen mit Hitler – den Vorwurf zu,vor dem Diktator eingeknickt zu sein.
In der kommenden Woche hofft Fischer,im Kreis der G-8-Außenminister ein Uno-Mandat für das Kosovo auf den Weg zubringen. Die alles entscheidende Voraus-setzung: Rußland stimmt einer Resolutionzu oder verzichtet zumindest darauf, siemit einem Veto zu blockieren.
Dem Moskauer Jugoslawien-Beauftrag-ten Tschernomyrdin rang Fischer immerhindas Bekenntnis ab, gemeinsam müsse man„zusehen, daß uns diese Verrückten nichtauf der Nase herumtanzen“.
Langsam entzieht Rußland dem slawi-schen Brudervolk die Unterstützung. Selbstbei einer Eskalation des Konflikts, ver-sprach der Russe, werde Präsident BorisJelzin keine Waffen nach Belgrad liefern.
Zwischen Friedensplänen und Bom-bennächten muß die rot-grüne Regierungdas Volk mit einem Spannungsbogen, deräußerste Glaubwürdigkeit verlangt, bei der„gerechten Sache“ halten.
Vor allem Rudolf Scharping, der anfangseine gute Figur machte, bekommt mit
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
zunehmender Kriegsdauer ein Problem.Der Verteidigungsminister, der sich auf dieRolle des moralischen Legitimators spe-zialisiert hat, müht sich täglich, fehlendeoptische Belege für Greuel im Kosovodurch übersteigerte Empörung zu kom-pensieren.
Kaum war ein wenig in Vergessenheitgeraten, daß Scharping mit seinen Analo-gien zum Hitler-Regime und seinen unbe-wiesenen KZ-Vorwürfen den Gipfel derrhetorischen Eskalation sehr früh erreichthatte, leistete der Verteidigungsministersich den nächsten Fauxpas.
Empört hielt Scharping vergangenenDienstag eine Fotoserie vom Januar mitgrausam zugerichteten Leichen in die Kameras. Sie sollte dokumentieren, daßMilo∆eviƒs ethnische Säuberungen bereitsweit vor Beginn des Nato-Bombardementsstattgefunden haben. Das ist allerdings hin-länglich bekannt, ein Bild vom Tatort hat-te der SPIEGEL bereits im Februar ge-druckt (5/1999).
Nach den der Regierung vorliegendenBerichten und Befragungen der OSZE-Be-obachter war der Hergang jedoch nichtzweifelsfrei zu klären. Angeblich hattenKämpfer der kosovarischen Befreiungs-armee UÇK in Rugovo einen serbischenPolizisten erschossen. In Scharmützeln, diesich über mehrere Tage hinzogen, starbenUÇK-Soldaten und Zivilisten. Ein grausa-mer, wenngleich im damaligen Bürgerkriegwohl nicht ungewöhnlicher Vorgang.
Scharpings fortgesetzte Demonstrationvon Hochmoral, verbunden mit mangeln-der faktischer Sorgfalt, bringt Schröder undFischer in eine doppelte Zwangslage. Zumeinen werden Ernsthaftigkeit und Glaub-würdigkeit von Regierung und Bündnis be-schädigt. Zum anderen bereitet ScharpingsDiktion eine fatale Konsequenz vor: densofortigen Einsatz von Bodentruppen.
Demgegenüber müht sich Kollege Fi-scher aus Furcht um die fragile Stim-mungslage in seiner Partei schon seit Wo-chen, die Entsendung von 150 Fernmel-dern, Pionieren und 16 Hubschraubernnach Albanien zu verzögern, die Schar-ping für Ende April als Beitrag zur Flücht-lingshilfe angekündigt hatte.
Womöglich entscheidet der Bundestag indieser Woche über diesen Einsatz und dieEntsendung eines Kriegsschiffs, das bei derSeeblockade gegen Milo∆eviƒ helfen soll.
Vor allem die Helikopter könnten je-derzeit im Grenzgebiet unter Beschuß ge-raten. Im ungünstigsten Fall genügt die Sal-ve eines Maschinengewehrs, um einen Ab-sturz zu verursachen.
Käme aber in den nächsten Wochen,womöglich noch vor dem grünen Kriegs-konvent, der erste deutsche Soldat imschlichten schwarzen Plastiksack nachHause zurück, weiß Politologe Rattinger,„dann haben wir das Body-bag-Phänomen:Die Stimmung kippt sofort“. Stefan Berg,
Rainer Pörtner, Hajo Schumacher
25

Titel
26
„Dann geh doch!“Kanzler ohne Kurs: Die Regierung Schröder ist dabei, ihre zweite Chance zu verstolpern.
Die versprochene Reformpolitik kommt nicht voran. Im Schatten des Krieges erringt die Traditions-SPD bizarre Siege: viele 630-Mark-Jobs vernichtet, Steuerreform zerredet.
AP
Irgend etwas kommt immer dazwischen.Erst war es Oskar Lafontaine, der dieReformer um Kanzler Gerhard Schrö-
der untätig erstarren ließ. Dann kam derKrieg im Kosovo, der die ganze Kraft desRegierungschefs forderte.
Was wird den Kanzler als nächstes da-von abhalten, das zu tun, wofür er gewähltwurde: das Land und seine Wirtschaft, dieüberbordenden Sozialsysteme und sein lei-stungsfeindliches Steuersystem grundle-gend zu reformieren – kurz: Deutschlandzukunftsfähig zu machen?
Mit der wohlklingenden Formel von der„neuen Mitte“, die nach Aufbruch, Mo-dernisierung und Innovation klingen soll,hatte Gerhard Schröder im Wahlkampf für die SPD eine neue Klientel gewonnen.Die Formel war ein Versprechen: Die Pro-bleme des Landes sollten ohne ideologi-sche Scheuklappen angegangen werden.Es blieb beim Versprechen – was sich hin-ter der flotten Formel verbirgt, ist heuteunklarer denn je. Auch 31 Wochen nachdem Wahlsieg und 8 Wochen nach dem Ab-tritt seines Widersachers Oskar Lafontaine
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
ist Schröder ein Kanzler ohne klares Kursziel.
Im Grabenkrieg der beiden SPD-Gran-den faszinierte vor allem die Frage: Wergewinnt? Nun, ohne den Rivalen, konzen-triert sich alles auf den Regierungs- undParteichef Schröder. Doch die Fragen sindeher lauter geworden: Wieviel Kraft hat er,der SPD einen Reformkurs aufzuzwingen?Und will er das wirklich?
Was getan werden muß, ist unter nahe-zu allen Ökonomen unumstritten: Der So-zialstaat muß umgebaut werden – weil er
Die verhinderten ReformerGerhard Schröder, Bundeskanzler,Bodo Hombach, Kanzleramtsminister
Bislang konnten sich der Kanzler und sein Chef-stratege nicht gegen die große Koalition der Sozial-politiker durchsetzen. Schröder versuchte, das Ge-setz zur Scheinselbständigkeit zu korrigieren – undscheiterte in der Fraktion. Hombach plädiert für einegroße Steuerentlastung von Firmen und Beschäftig-ten – und findet bisher kaum Mitstreiter.

MELDE PRESS
FOTOS: DPA
immer weniger zu finanzieren ist und da-bei sein eigentliches Ziel auch noch ver-fehlt: den wirklich Bedürftigen zu helfen.Das Steuersystem muß entrümpelt, dieSteuersätze müssen gesenkt werden – siehemmen das Wachstum, ersticken die Ei-geninitiative und fördern die Schwarz-arbeit.
Wie will Schröder diese versprocheneModernisierung angehen? Ein paar Vorga-ben („Wir müssen ein Reformkabinettsein“), ein Wirtschaftsminister aus derWirtschaft (erst Stollmann, dann Müller) –mehr zu leisten, war er bisher kaum bereit.Schröder setzte auf den Zeitgeist, hoffteauf die Konjunktur, den richtigen Ruck solldie Diskussion am Runden Tisch der Bünd-nisgespräche bringen.
Doch nichts ruckt, im Gegenteil: Die alteSPD muckt auf – und zeigt immer deutli-cher, daß sie von ihrem Kanzler und seinenVorstellungen nichts hält.
Mit Hingabe debattierten die Genossenüber neue Steuererhöhungen, nach derÖkosteuer ist nun die Mehrwertsteuer dran– statt zunächst zu fragen, wo gespart wer-den kann.
Im Schatten des Kosovo-Krieges errin-gen vor allem die Sozialpolitiker erstaunli-che Siege: Sie vernichten viele 630-Mark-Jobs, weil sie diese abgabenpflichtig – unddamit unattraktiv – machen. Sie gängelnSelbständige durch höhere Abgaben undmehr Bürokratie, weil sie die angeblicheGefahr der Scheinselbständigkeit bekämp-fen wollen. Und sie demütigen den Kanzler.
Auf der letzten Fraktionssitzung, in derSchröder für eine Änderung der aktuellenSozialgesetze warb, protestierten sie. Undals Schröder noch immer für Korrekturenvotierte, fiel jener schmerzhafte Satz, dender Kanzler zunächst kaum fassen konnte:„Dann geh doch.“
Der Kanzler mag im Wahlkampf erfolg-reich Wähler der neuen Mitte geworbenhaben, eine Partei der neuen Mitte führt ernicht: In der Fraktion hat die alte SPD dasSagen, die Partei der Lehrer, der Gewerk-schaften und der Sozialpolitiker – eine Ko-alition der Besitzstandswahrer, die jedeÄnderung des Status quo bekämpft.
Noch verdeckt der Krieg die Misere.Wochenlang konnte der Kanzler, der mitt-lerweile zum Kriegsherrn mutierte, dentrüben Start in Bonn verdrängen. Im Ko-sovo-Konflikt zeigte er plötzlich ungeahn-te Führungsstärke, ver-gessen waren die Bildervom Kaschmir-Kanzler,von Cohiba, Chablis und„Wetten, daß…?“
Auch die Mitgliederdes rot-grünen Kriegs-kabinetts demonstrier-ten erstaunliche Ge-schlossenheit. Alles an-dere ging derweil im me-dialen Grundrauschenunter. Die Abendnach-
Die TradiDie SPD-Bundestnoch nicht auf dumgestellt: Die am liebsten MehOppositionszeiteSteuersenkung Mehrheit. Die Inschaft finden in Gehör.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Die BremserKlaus Zwickel, Vorsitzender derIG MetallRudolf Dreßler, SozialpolitischerSprecher der SPD-Bundestags-fraktion
Der mächtige Gewerkschafts-boß und der SPD-Sozialexper-te kämpfen seit Jahren Seitean Seite: für mehr Kindergeld,für Schlechtwettergeld, fürArbeitszeitverkürzung undeine großangelegte staatli-che Arbeitsmarktpolitik. Einenschlankeren Staat und Steu-ererleichterungen für Unter-nehmen lehnen beide ab.Dreßler ist einer der hart-näckigsten Widersacher derModernisierer.
tionalistenagsfraktion hat sichie RegierungsarbeitAbgeordneten fordernrausgaben – wie zun. Für eine deutliche
gibt es derzeit keineteressen der Wirt-der Fraktion kaum
27

Titel
28
SPD-Vorsitzender Lafontaine, Genossen*: Das Gedankengut wirkt noch heute nach
K.-
B.
KAR
WAS
Z
Die Wähler wollten Entscheidungen –und bekamen neue Gremien
richten wurden bestimmt von Marschflug-körpern und Flüchtlingsströmen – nichtvon Atomausstieg oder Steuerwirrwarr.
Wenn der Krieg abklingt, wird spürbarwerden, daß die Regierung in der Innen-politik lediglich Luftlöcher produzierte –große Turbulenzen um nichts. Wirbel-kanzler Schröder kann bei seinem wich-tigsten Vorhaben, dem Abbau der Arbeits-losigkeit, kaum etwas vorweisen.
Der Umbau des Sozialstaats – kommt spä-ter. Der Niedriglohnsektor – wird noch dis-kutiert. Die große Rentenreform – derzeitkein Thema. Das Bündnis für Arbeit – einDebattenzirkel mit ungewissem Ausgang.
An keiner Stelle ist seiner Regierungs-mannschaft bisher der Durchbruch gelun-gen. Schlimmer noch: Nicht mal eineDruckstelle ist erkennbar, an der sich einkünftiger Durchbruch abzeichnet.
Erstmals ist sogar eine gewisse Verzagt-heit im Reformerlager spürbar. Die großeErneuerung des Rentensystems, von allenExperten aufgrund der Altersstruktur derGesellschaft als zwingend angesehen, wirdes mit Schröder womöglich gar nicht geben.
„Laß mir die Rentner in Ruhe“, befahler seinem Arbeitsminister. Die Begründungfür die neue Vorsicht liefern die Schröder-Getreuen nach: „Wenn der Riester dasThema anpackt, treibt es uns schon heuteden Angstschweiß auf die Stirn.“
* Auf dem SPD-Bundesparteitag am 2. Dezember 1997in Hannover.
Die Zustimmung zur Regierungskoali-tion ist bereits gesunken – minus siebenProzentpunkte seit Jahresende, sagt Infra-test. Fänden morgen Neuwahlen statt, wäredie Mehrheit womöglich dahin.
Die neue Mitte ist offenbar enttäuscht:Dienstleister Schröder hat ihr derzeit keineüberzeugende Performance zu bieten.
Die Wähler wollten Entscheidungen –und bekamen neue Gremien. Ihnen wurdeökonomische Modernisierung versprochen,und sie erleben die Renaissance einer so-zialen Verteilungsdebatte, die schon in derÄra Helmut Schmidt die Partei (nicht denKanzler) dominierte. Sie gaben der Regie-rung in den Umfragen eine zweite Chance
und müssen nun mit ansehen, wie die Bon-ner Truppe mit geradezu grimmiger Ent-schlossenheit dabei ist, sie zu verspielen.
Allmählich erkennt der AufsteigerSchröder, bisher gesegnet mit Glück undeinem unausrottbaren Situationscharme,daß der Aufstieg zum Reformkanzler sonicht glücken kann. Selbst der Abgang vonLafontaine, im Kanzleramt als Geschenkdes Himmels empfunden, brachte nichtden erhofften Klimawechsel.
Wie auch? Lafontaine ist überall: In derPartei, die sich auf Willy Brandt und AugustBebel beruft, haben die Traditionalisten
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
das Sagen.Auch in der Bundestagsfraktion,repräsentiert, aber nicht geführt von PeterStruck, stellen sie die Mehrheit.
Die meisten sind keine Überzeugungs-täter, nur eben Apparatschiks, die den Par-teitagsbeschluß mehr lieben als die Macht,die ihre Arbeitsgruppe in der Fraktion alszweite Heimat empfinden, die sich ernst-hafte Sorgen vor allem dann machen, wenndaheim im Wahlkreis sich was zusam-menbraut.
Der echte Traditionssozi ist an zweischlichten Glaubenssätzen zu erkennen:1. Wir haben kein Ausgaben-, sondern einEinnahmenproblem in der Sozialversiche-rung; 2.Wir müssen wieder Recht und Ord-
nung auf dem Arbeitsmarktherstellen.
Die SPD-Bundestagsfrak-tion ist gleichsam der ver-längerte Arm der Sozial-
staatsmafia. Unternehmer gibt es hiernicht, dafür aber Gewerkschafter, die jedenFirmengründer gern reflexartig zum Feinderklären.
Wer die Eigenverantwortung stärken,den Leistungswillen fördern, die Steuer-schraube zurückdrehen will, hat in derSPD seinen Stallgeruch schnell verloren.
Das Netzwerk der Status-quo-Freundeist engmaschig gestrickt. Die Wohlfahrts-verbände, die Landesanstalten der Ren-tenversicherung, die Sozialbehörden inLändern und Kommunen, die kirchlicheSozialarbeit, Krankenkassen und Gewerk-

Kabinettskollegen Eichel, Müller: Der Staat sol
schaften bilden ein Geflecht, das zusam-men Hunderttausende Menschen beschäf-tigt, die vom wuchernden Sozialstaatprächtig leben.
Vom örtlichen Arbeitsamt bis zur Lan-desversicherungsanstalt sind die Posten un-ter den großen Parteien verteilt. Und paßtder Proporz nicht, wird eben noch ein Po-sten geschaffen.
Zur teuer bezahlten Wählerschaft derSPD gehören 350000 Mitarbeiter der So-zialversicherungen. Viele von ihnen lebenim wesentlichen davon, daß die Rehabi-litation chronisch Kranker von der Ren-tenkasse verwaltet wird.
Die Sozialstaatsmafia konnte bishernoch jede größere Reform verhindern, sieist in beiden großen Parteien und in denGewerkschaften zu Hause. Unter Bundes-kanzler Helmut Kohl hatte sie mit Ar-beitsminister Norbert Blüm einen beson-ders streitbaren Vertreter.
Besonders inzestuös aber ist die Bezie-hung zwischen Genossen und Gewerk-schaften. Von 298 SPD-Abgeordneten imBundestag haben 244 einen Gewerk-schaftspaß. Verkehrsminister Franz Mün-tefering ist bei der IG Metall, Bildungs-ministerin Edelgard Bulmahn in der GEW,Justizministerin Herta Däubler-Gmelin inder ÖTV. Dort hat auch der Kanzler seineLektionen gelernt.
Acht Millionen Mark an Mitglieds-beiträgen pumpten die Arbeitnehmerver-treter in den Wahlkampf Schröders. Dafürverlangen sie jetzt ein Vielfaches an Ge-genleistung.Artig holte Schröder, kaum ge-wählt, Reformen bei Rente und Lohnfort-zahlung zurück.
Der Trugschluß des Kanzlers: Im Ge-genzug würden die Funktionäre Zuge-
Problem Staatsschulden
FAMILIENURTEILUmsetzung des Kindergeldspruchs in zwei Stufen –2000 und 2002. Kosten:etwa 8 Milliarden Mark.
REFORM DERUNTERNEHMENSTEUERVergangene Woche gabeine ExpertenkommissionEmpfehlungen ab. Die Höhe der Nettoentlastung istaber noch umstritten.
Art. 115 des Grund-gesetzes verlangt:Die Nettoneuverschuldungdarf die Investitionsaus-gaben grundsätzlich nichtüberschreiten.
Nettoneuverschuldung in Milliarden Mark
52,0
61,5
66,2InvestiveAusgaben
ZUSÄTZLICHEHAUSHALTSRISIKEN
1991 1992 1993 1994 199
ständnisse beim Bündnis für Arbeit ma-chen, etwa Zurückhaltung bei den Tarif-verhandlungen üben. Von wegen. IG-Me-tall-Vize Jürgen Peters kündigte weiterenKrawall an.
Und für seine Ideen zur Schaffung vonTariffonds erntete Minister Riester die hef-tigste Kritik von der Heiligen Johanna derSozialkassen, DGB-Vize Ursula Engelen-Kefer.
Das Sagen haben, in der Fraktion und inden Gewerkschaftszentralen, die Traditio-nalisten, die die Welt in Gut und Böse, inArbeitnehmer und Unternehmer einteilen.Ihr Weltbild ist fest gefügt, wer es anzwei-felt, ein Neoliberaler.
Doch gerade die Arbeitswelt hat sich inden vergangenen Jahren dramatisch ge-wandelt. Die Betriebe müssen weit flexiblerauf Veränderungen reagieren, sie gliedernimmer mehr Arbeiten und ganze Abteilun-
MilliardenMark
-
-
KONJUNKTURDELLEDie Regierung reduzierte ihre Wachs-tumsprognose von 2,0 auf 1,6 Pro-zent. Ein halbes Prozent wenigerWachstum ergibt zwischen 5 und10 Milliarden Mark Steuerausfall.
ARBEITSLOSIGKEITImmer noch bei rund vier Millionen.Hunderttausend Arbeitslose mehr –das kostet die Bundesanstalt für Arbeit1,6 Milliarden Mark zusätzlich im Jahr.
KOSOVO-KRIEGBisher wurden im Haushalt zusätzlich441 Millionen Mark veranschlagt.Dauert der Krieg länger, sind womög-lich Milliardenbeträge fällig.
40
50
60
70
20
30
58,2
53,5
78,3
geplant10
5 1996 1997 1998 1999
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
gen aus. Großkonzerne prägten das Indu-striezeitalter, das Informationszeitalter ori-entiert sich am Leitbild des – mehr oderweniger – selbständigen Menschen.
Die Sozialsysteme sind auf diesen Wan-del nicht vorbereitet und die Gewerk-schaften schon gar nicht – sie fürchten umMacht und Einfluß, um ihre Existenz. Undso verteidigen sie, unterstützt von ihrenBundesgenossen in den Parteien, den Sta-tus quo, wo sie nur können.
Zunächst galt es, all das zu beseitigen,was die alte Koalition an zaghaften Refor-men auf den Weg gebracht hatte: die Ein-schränkung der Lohnfortzahlung imKrankheitsfall, die Lockerung des Kündi-gungsschutzes, die demographische Kom-ponente im Rentensystem. Und die SPD-Fraktion machte willig mit.
Dann sollte die schöne alte Arbeitsweltwieder restauriert werden. Da störten die
wachsende Zahl von 630-Mark-Jobs und die vielenMehr-oder-weniger-Selb-ständigen, die sich den So-zialabgaben entziehen.
Daß mit solchen Geset-zen der Spielraum des ein-zelnen eingeschränkt wird,nehmen die Traditionalistenin Kauf. Sie dominieren dieSPD-Fraktion, und die wie-derum ist der größte Macht-faktor im Regierungslager,durch schlichte Behäbigkeitbestimmt sie das Tempo:vorwärts im Kriechgang.
Das Gedankengut desWeltökonomen Lafontainewirkt hier noch nach.Schließlich klangen dieWorte, mit denen der be-
gnadete Redner die Genossen in seinenBann zog, allzu verlockend: Von schmerz-haften Strukturreformen war da nichts zuhören, viel dagegen von den Fehlern derGeldpolitik.
Bei den Sozialexperten regiert noch im-mer die alte Garde – so war Ottmar Schrei-ner, 53, lange Jahre der Jüngste im Ar-beitskreis Soziales der Fraktion. Die Hüterder Programmbeschlüsse sind auch des-wegen so mächtig, weil die Materie kom-pliziert ist, das Vokabular abschreckend,die Experten-Szenerie grau und ernst.Werweiß schon, was „Eckrentner“, „Auffüll-beträge“ oder „Festbeträge“ wirklich sind?
So gibt das einflußreiche Experten-Kar-tell aus Oppositionszeiten noch heute denTon an. SPD-Sozialexperte Rudolf Dreßlererntet im Präsidium auch deshalb sowenigWiderspruch, so ein Mitglied des Gremi-ums, weil kaum jemand fachlich gegenhal-ten könne.
Wie weit sich die rot-grünen Machthabermit solchem Denken von der Wirklichkeitentfernt haben, erleben sie jetzt: Überall imLand erhebt sich der Protest gegen diebürokratischen Gesetze. Tenor: Rot-Grün,
l sparen
J. H
. D
AR
CH
ING
ER
29

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Titel
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 932
Sozialdemokrat Lafontaine*„Dummbeutel in Bonn“
AC
TIO
N P
RES
S
beseelt vom Willen zu mehr sozialer Ge-rechtigkeit, hat es zwar gut gemeint, aberschlecht gemacht. Die Bevölkerung scheintzu spüren, was viele in Bonn nicht spürenwollen: Der Sozialstaat alter Prägung hatsich selbst übersteuert, er muß reformiertwerden – weniger Geld, weniger Regeln,mehr Effizienz.
Das Debakel der neuen Sozialgesetzeregt die Deutschen derzeit auf wie kaumein zweites Thema: Die Regeln für die 630-Mark-Jobs haben eine Kündigungswelle beiKellnern, Zeitungsausträgern und Taxifah-rern ausgelöst. Über fünf Millionen Men-schen üben einen solchen Job aus, wer da-neben noch ein weiteres Einkommen hat,muß die 630 Mark künftig besteuern. Dableibt am Ende manchmal nur noch einStundenlohn von acht Mark.
Wächter der WerteDie Rückkehr von Oskar Lafontaine in die Öffentlichkeit
empfinden selbst Freunde als Belastung.
Festen Schrittes zieht er ein, hin-ter sich den vertrauten Schweifvon Kameraleuten und Mikrofon-
trägern. Wenn Oskar Lafontaine sichöffentlich zeigt, ob beim Landespar-teitag der Saar-SPD oder am 1. Mai – Aufmerksamkeit ist ihm sicher.
Bislang hatte der Zar von der Saarnur im kleinsten Freundeskreis überdie „Dummbeutel in Bonn“ gelästertund sich über den Kosovo-Krieg er-regt. Mit seinem Auftritt als Mai-Redner wollte er klarstellen, daß auch künftig mit ihm zu rechnen ist. Ein Leben als Privatmann, wie beim Rücktritt angekündigt, hält ernicht aus.
19,5
Problem Renten
14,0
20
14
15
16
17
18
19
Prozent
Arbeitgeber- und Arbeit-nehmeranteil an dergesetzlichen Renten-versicherung in Prozentdes Bruttoeinkommens
20,3
18,0
19,2
ab April1999
Warum er am 11. März so abrupt indie innere Emigration floh, hat er bis-lang nicht erklärt. „Immer stand er ander Spitze“, vermutet eine Parteifreun-din, „einmal stand er nicht dort – undprompt ist es schiefgegangen.“ Aber dasist nur ein Teil der Wahrheit. Zum an-deren gehört, daß Lafontaine sich undseine politischen Botschaften in Bonnje länger, desto weniger geschätzt sah.
Der Rückblick auf die vergangenenvier Jahre, den Lafontaine demnächstzu Papier bringen will, füllt den ehr-geizigen Sensibilisten nicht aus.Wie einProfi testet er derzeit in Verhandlungenmit Buchverlagen seinen Marktwert –der wohl bei einer halben Million Markliegt. Mit viel Klatsch und Tratsch will
* Am 14. April bei der Jubiläumsfeier „1000 JahreSaarbrücken“.
der Autor beispielsweise seinen erfolg-reichen Parteitags-Putsch gegen RudolfScharping schildern. Nur gegen Endesollen die Memoiren mit Rücksicht aufdie SPD und ihren Kanzler etwas dis-kreter ausfallen.
Daß Lafontaine, der sich mehr dennje als Wächter sozialdemokratischerWerte fühlt, die politische Bühne aus-gerechnet im Saarland wieder betrat,geschah nicht ohne Bedacht. Selbst zuHause waren sie gram über den tristenAbgang. Das Saarland ist ihm Heimat,aber die Botschaften, die er dort ver-kündet hat, waren immer für die ganzeRepublik bestimmt – das „Reich“, wieman im Saarland sagt.
Der Landesparteitag am vorver-gangenen Wochenende war der Probe-lauf: Wie ein Schaubudenbesitzer, derSpektakuläres verheißt, keilte er dasPublikum für seine Kritik an Nato-Einsatz und Wirtschaftspolitik: „Werinteressiert ist, ist am 1. Mai herzlicheingeladen.“
Unverblümt teilte der Rückkehreranschließend mit, wo er seine Rollewirklich sieht. „Das politische Tages-geschäft wird in erster Linie der Mini-sterpräsident bestimmen“, ließ er wis-sen und damit auch, wer für die großenLinien und entscheidenden Entwürfeim Saarland weiterhin zuständig seinwill – er selbst.
„Da hab’ ich fast in die Kaffeetas-se gebissen“, gestand ein SPD-Vorständler hernach. „Unmöglich“,raunte ein anderer zu Ministerpräsi-dent Reinhard Klimmt herüber.
Der hat inzwischen erkannt, daß ihmLafontaine, mit dem ihn eine enge per-sönliche und politische Freundschaftverbindet, zur Gefahr werden könnte.Wo immer Lafontaine sich vor denLandtagswahlen am 5. Septemberzeigt: Klimmt wird – wie neulich beimLandesparteitag – zur Nebensache.Schon heißt es in der Führungsspitzeder Landespartei: „Oskar ist eine Be-lastung für den Wahlkampf.“
Hastig bemühen sich inzwischen die Berater des Spitzenmannes, dasSteuer herumzureißen. Auf Wahl-plakaten, die den Ministerpräsiden-ten mit dem Ex-Vorsitzenden zeigensollten, wurde Lafontaines Kopf ge-gen den von Gerhard Schröder aus-getauscht. Horand Knaup
1960 70 80 90 99

„Es rollt eine nie dagewesene Kündigungswelle“
„Eine noch nie dage-wesene Kündigungswel-le“ erwartet deshalb Pe-ter Imberg, Hauptver-triebsleiter der WAZ-Gruppe. Künftig bekom-men viele seiner 6700Austräger nur noch knapp 400 Mark aus-bezahlt. „Für viele lohnt sich die Arbeitnicht mehr“, sagt er. „Wir wissen nicht,wie wir unsere Zeitungen zugestellt be-kommen.“ Ein Drittel der Austräger hatbereits mit Kündigung gedroht.
Das Ziel der Bundesregierung, die Zer-schlagung fester Arbeitsverhältnisse in 630-Mark-Jobs zu stoppen, geht nach ImbergsMeinung bei den Zeitungsverlagen ins Lee-re: „Zusteller kann ich nicht im Vollzeitjobbeschäftigen. Niemand will nachmittags umvier die Zeitung im Kasten haben.“ DieWAZ müßte 1000 Mark ausgeben, um denBetroffenen nach der neuen gesetzlichenRegelung die 630 Mark zu bezahlen, diesie vorher bekommen haben.
So ist es in vielen Branchen, die auf Aus-hilfen angewiesen sind – etwa in der Ga-stronomie oder im Taxigewerbe. „Dut-
Landhotels „Nain Lohmar bei Ktigt 40 AushilfMark-Basis, dieeinspringen. „Ikeinen verzich
zendweise“ haben bei Hansa-Taxi in Ham-burg die Aushilfen gekündigt, sagt VorstandManfred Gieselmann. Einige seiner Kolle-gen hätten bereits Taxen stillgelegt, „weil ih-nen die Leute fehlen“. Der Hamburger Ta-xenchef fürchtet jetzt, daß an Wochenendeneinfach weniger Taxen unterwegs sein wer-den, „weil wir keine Fahrer kriegen“.
Vielen Einzelhandelsbetrieben geht esgenauso, auch die Reinigungsbranche ar-beitet in großem Maße mit 630-Mark-Kräf-ten. Diese Dienstleistungen werden nunteurer – oder sie werden schwarz angebo-ten. Dann hat der Staat weniger als zuvor.
d e r s p i e g e
Ebenso gut gemeintund ebensowenig durch-dacht ist das Gesetz gegendie Scheinselbständigkeit.Es will verhindern, daßUnternehmen Arbeitenauf unechte, also Schein-selbständige verlagern,um Sozialabgaben zu spa-ren. Die Regierung über-sieht dabei, daß nichtmehr die Festanstellung,sondern die Selbständig-keit für viele das Ziel ist.Die müssen künftig um-ständlich und bürokra-tisch beweisen, daß siezum Beispiel nicht nurvon einem Auftraggeberabhängig und somit wirk-lich selbständig sind.
Eine Korrektur derChaos-Gesetze ist demKanzler bisher nicht ge-lungen. Riester stellte sichstur, eine aufgebrachteSPD-Fraktion versagte inder vorvergangenen Wo-che ihrem Kanzler die Ge-folgschaft. Schröder regi-
strierte bei den Sozialpolitikern sogar einGefühl des Triumphs. Ein Riester-Mitarbei-ter nach der Sitzung: „Jetzt haben wir’seuch mal gezeigt.“
Seine engsten Berater nahmen diese Nie-derlage verärgert zur Kenntnis: „Das Ge-setz“, so Kanzleramtsminister Bodo Hom-bach, „wirkt ähnlich wie ein viel zu starkesPestizid. Das vernichtet nicht nur Schädli-ches, sondern Nützliches. Wir wollten dieScheinselbständigkeit bekämpfen und nichtdie Selbständigkeit.“ Mit dem Schein-selbständigen-Entschluß habe sich die Ko-alition einen „richtigen Tort“ angetan.
Auf Umwegen soll wenigstens eineKorrektur des 630-Mark-Gesetzes er-reicht werden: Eine neue Expertenkom-mission, mit dem Präsidenten des Ar-beitsgerichtshofs an der Spitze, wurdevon Schröder zur Beobachtung des Ge-
setzes eingesetzt.Die SPD-Landeschefs hat
Schröder auf seiner Seite.Am vergangenen Donners-tag abend beschlossen die
SPD-Ministerpräsidenten, ebenfalls Geg-ner des Gesetzes, bei einem Treffen imKanzleramt ein trickreiches Vorgehen.
Die Länder Bayern und Baden-Würt-temberg hatten einen Antrag eingebracht,der das Gesetz außer Kraft setzen wollte.Mit Rücksicht auf Riester konnten die SPD-Politiker dem Antrag zwar nicht zustimmen,aber sie lehnten ihn auch nicht ab – sie ver-wiesen das strittige Werk in die Ausschüssedes Bundesrats, und dort soll es in einigenWochen gekippt werden. Politik paradox.
Die Genese des Gesetzes zur Schein-selbständigkeit zeigt, wie raffiniert die So-
mieaber desfs-Häuschen“ln, beschäf- auf 630-ei Bedarf kann aufn“, sagt er.
J. M
EYER
/ D
AS
FO
TO
AR
CH
IV
GastronoHelmut Otto, Inh
aö
en bchte
l 1 8 / 1 9 9 9 33

zialpolitiker alten Schlagesagieren – und wie sie dabei denKanzler vorführen.
In dem Papier aus dem Hau-se Riester stehe nichts Brisan-tes drin, hieß es von dort. DieLektüre könne man sich spa-ren. Es sei ein alter Blüm-Ent-wurf, es ginge lediglich um dieUmsetzung von Richterrecht inGesetzesform, nicht der Redewert.
In einer Umlaufmappe wur-de der Gesetzestext von Mini-sterium zu Ministerium ge-reicht, überall zeichneten nurdie Staatssekretäre gegen.Außer Riester hatte kein hoch-rangiges Kabinettsmitglied dasGesetz gelesen.
Es rangierte folgerichtig aufder Tagesordnung des Kabi-netts unter der Überschrift„Gesetze ohne Aussprache“.„Das ganze Thema“, erinnertsich ein Minister, „hat keineSau interessiert.“
Auch bei der 630-Mark-De-batte haben sich die Regieren-den schlicht verkalkuliert.Vie-le in der SPD hätten die ehe-mals abgabenfreien Mini-Jobsam liebsten abgeschafft. Nochin den Koalitionsverhandlun-gen wurde eine rigide Lösungverabredet: Sozialabgaben-pflicht plus Steuerlast für alle.
Den Grünen war diese Lö-sung schon damals nicht geheu-er. Deren Sozialpolitiker ver-stehen sich als Anwälte der Job-hopper, der Teilzeitkräfte oderder neuen Selbständigen, diemal fest, mal freiberuflich ihrGeld verdienen. Der Wandelder Erwerbsbiographien warstets ihr Thema, das alte SPD-Leitbild vom Facharbeiter mitVollzeit-Job auf Lebenszeit giltihnen als antiquiert.
Doch die vom Wahlsiegüberraschten Grünen hieltenstill – die Einnahmen sollten teilweise ihrerGesundheitsministerin Andrea Fischer zu-kommen. Sie waren zur Absenkung derZuzahlungen für Medikamente gedachtund damit fest verplant. Das Geld für uns,den Ärger für die anderen, so dachten dieGrünen.
Schon damals hätte Schröder bremsenmüssen – schließlich hatte er sich im Wahl-kampf persönlich festgelegt. Im Gegensatzzu seiner Partei versprach er, die Mini-Job-ber würden künftig nicht schlechtergestellt.
Schröder schaute weg. So konnte Ar-beitsminister Riester mit der Fraktion eineLösung aushandeln, die anderes im Sinnehatte: mehr Geld sollte in die Sozialkassenfließen – dauerhaft. Das Schicksal der Be-
Zeitu6700 Auslich die ZGruppe. „die ArbeitHauptverberg. AbeZeitungen
Großb„Das Bonan der Wischimpft der KölneKraus. Die60 Aushiles wenig
Taxig„Ein TaxeAushilfenManfred Gstand vonburg. Docder neuen„dutzendw
34
troffenen spielte offenbar keine entschei-dende Rolle, es ging schließlich um Großes– die Rettung der Sozialsysteme.
Erst jetzt horchte Schröder auf. Ein wo-chenlanges Gezerre um die 630-Mark-Be-schäftigten begann. Mal sollten die Betrof-fenen zwar Beiträge zahlen, dafür aber kei-ne Leistungen erhalten – ein absurder Ge-danke. Mal sollte der Betriebsrat über dieEinstellung von neuen 630-Mark-Kräftenmitreden können – nicht minder bizarr.
Schließlich blieb für einen Teil der Be-troffenen alles beim alten. Wer nur einen630-Mark-Job bestreitet, steht nichtschlechter da als früher. Steuern muß ernicht zahlen, die fälligen Sozialabgabenträgt der Arbeitgeber.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Doch wer es wagt, mehreredieser Mini-Jobs zu besitzenoder gar einem Hauptberufnachzugehen, der wird rasiert.Er muß die Zusatzverdienstevoll versteuern – mit seinempersönlichen Spitzensteuer-satz.
Auch früher, verteidigt sichRiester (siehe SPIEGEL-Ge-spräch Seite 42), seien mehre-re dieser kleinen Beschäfti-gungsverhältnisse abgabe-pflichtig gewesen. Nur konnte(und wollte) das zuvor nie-mand kontrollieren. Der Ar-beitgeber zahlte die Steuer, derArbeitnehmer war nirgendworegistriert. Die 630-Mark-Jobswurden zur Steueroase derkleinen Leute – die Politikschaute absichtsvoll weg.
Weil alle Nachbesserungenbisher kaum Linderung brach-ten, geht das politische Gefeil-sche nun von vorne los. Ein rie-siges Mediengetöse begleitetdie Fingerübungen der Regie-rung.
Gleich zweimal bestritt dierheinische Boulevardgazette„Express“ vergangene Wocheihre Titelseite mit dem Thema.„Ich arbeite schwarz“, ließ dasBlatt bislang geringfügig Be-schäftigte, das Gesicht scham-haft mit den Händen verdeckt,bekennen. „Bild“ sieht eine„Wutwelle“ durch Deutsch-land rollen.
Die Lage für Schröder istmehr als nur kompliziert: Dennohne grundlegende Reform desgesamten Sozial- und Steuer-systems wird jede Einzelkor-rektur fast automatisch zumFiasko. Einerseits: System-widrige Ausnahmen verbietendie Gerichte, der hehre Gleich-heitsgrundsatz ist dann in Ge-fahr.Andererseits fehlt für eineAusweitung von Sozialleistun-
gen schlicht das Geld. Anders als in densiebziger Jahren hat der Staat nichts mehrzu verteilen.
Im Staatshaushalt klafft ein Milliarden-loch, der Spielraum, den der Maastricht-Vertrag für neue Schulden läßt, ist ausge-schöpft. Die höchsten Gerichte bombar-dieren die Regierung regelrecht mit Ent-scheidungen, die zur Umkehr zwingen. DasSignal von Verfassungsgericht und Bun-desfinanzhof ist eindeutig: Das bisherigeSteuerrecht, das mit seinem System desGebens und Nehmens zur zentralen Um-verteilungsmaschine des Sozialstaats wur-de, ist renovierungsreif.
Vor drei Monaten hatte Karlsruhe dieRegierung erst dazu verdonnert, Familien
Y. A
RS
LAN
/ D
AS
FO
TO
AR
CH
IVH
. G
UTM
AN
N /
LAIF
U.
KIM
MIG
ewerbenbetrieb ist ohne unmöglich“, erklärtieselmann, Vor- Hansa-Taxi in Ham-h die haben wegen 630-Mark-Regelungeise gekündigt“.
äckereiner Gesetz geht vollrklichkeit vorbei“,Hermann Post vonr Großbäckerei Firma beschäftigt
fen – täglich werdener.
ngsvertriebträger verteilen täg-eitungen der WAZ-Für viele lohnt sich nicht mehr“, sagttriebsleiter Peter Im-r wer stellt dann die zu?

Werbeseite
Werbeseite

Prozent
11
12
13
14
12,0
12,9
13,5
Titel
Fis
Arztpraxis (in München)Jede Einnahme fest verplant
10,5
mit Kindern wesentlich besserzu stellen. Die Umsetzung die-ses Urteils wird die Regierungmindestens 8 Milliarden Markkosten, möglicherweise sogar20 Milliarden Mark.
Jetzt präsentierte der Bun-desfinanzhof aus München, dashöchste deutsche Steuerge-richt, ein Urteil, das die rot-grünen Steuerreformer erneutmächtig in die Bredouillebringt.Anders als ursprünglichgeplant, müssen sie nun wohlauch den privaten Spitzensteuersatz sen-ken, nicht nur die Unternehmensteuern.Oder sie lassen, entgegen ihren Verspre-chen, alles beim alten.
Der Bundesfinanzhof hält es jedenfallsfür ungerecht, wie der Fiskus gewerblicheEinkünfte gegenüber anderen Einkunfts-arten, etwa von Beschäftigten, bevorzugt.Die alte Regierung hatte die Ungleichheitmit der besonderen Verpflichtung der Fir-men für die Schaffung von Arbeitsplätzenbegründet. Derzeit liegt der Spitzensteu-ersatz für diese Firmengewinne bei 47 Pro-zent, der für Privatleute bei 53 Prozent.
Schröder & Co. wollen in ihrem Kon-zept für die Unternehmensteuerreform die„Spreizung“, wie die Steuerexperten dasnennen, sogar noch vergrößern.
Ein deutlich reduzierter Spitzensatz füralle Steuerzahler war bislang in der SPDweitestgehend tabu. Lafontaine stellte sichstets quer, wenn Ministerpräsidenten wieWolfgang Clement oder Heide Simonis andiesem Thema rührten. Im gerade verab-schiedeten Steuerreformgesetz wagten dieSozialdemokraten es gerade einmal, denHöchstsatz binnen drei Jahren von 53 Pro-zent auf 48,5 Prozent zu senken.
Zu einer radikalen Steuerreform – miteinfachen Regeln und niedrigen Sätzen –kann sich die Regierung auch jetzt nichtdurchringen. Reformer wie Hombach plä-dieren für eine Nettoentlastung von Bür-gern und Firmen: „Intelligente Steuersen-kungen führen zu mehr Einnahmen für denStaat“, sagte er am vergangenen Mittwochin der London School of Economics. Undverwies auf das Beispiel USA: Dort de-battiert der Kongreß seit Monaten, wie derHaushaltsüberschuß von 70 MilliardenDollar auszugeben sei.
Die Sozialpolitiker können sichüber Hombachs For-derung leiden-schaftlich
Ministerin
alte Bund1990 jew
1960 65 70 75 8
Prob
8,4 8,2
Arbeitgeder gesProzent
36
empören, sie sehen sich undihre Fördertöpfe in Gefahr. Ihrwichtigstes Wort heißt daher„Gegenfinanzierung“.Was derStaat auf der einen Seite gibt,etwa durch Senkung der Ein-kommensteuer, soll er auf deranderen sofort wieder kassie-ren, zum Beispiel durch Er-höhung der Mehrwertsteuer.
Schröder schweigt, sein Fi-nanzminister rechnet noch. Einschlüssiges Konzept besitzt inBonn derzeit niemand. Der Re-
formdruck, so scheint es, hat die Handeln-den kalt erwischt.
Das Ausmaß an Ratlosigkeit überrascht:Keine deutsche Regierung konnte auf so-viel Expertise zurückgreifen wie die Schrö-der-Truppe.Alle Probleme, die es heute zulösen gilt, von der Steuerreform über denSubventionsabbau bis zur Schlankheitskurfür den Staatsapparat, wurden tausendfachdiskutiert und durchgerechnet. Im Aus-land sind alle nur denkbaren Varianten ei-ner Reformpolitik im Praxistest zu besich-tigen.
cher
AP
esländer; bis 1989 Jahresdurchschnitte und abeils durchschnittlicher Beitragssatz am 1. Januar
0 85 90 95 99
9
10
8
lem Krankenversicherung
ber- und Arbeitnehmeranteil anetzlichen Krankenversicherung in des Bruttoeinkommens
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Die Vereinigten Staaten machten vor,wie eine radikale Steuersenkung das Wirt-schaftsleben aktiviert und zu einem Job-wunder ohne Beispiel führen kann. DieNiederländer zeigten, daß auch eine Kon-sensrunde von Gewerkschaften, Arbeitge-bern und Staat zum gleichen Ergebnisführen kann.
Soviel Vorbild war nie. Konrad Adenau-er, der erste Nachkriegskanzler, mußte al-lein sehen, wie er das zerstörte Nach-kriegsdeutschland aufforstete. Ludwig Er-hard, sein Nachfolger, besaß vor allem denfesten Glauben an die Kräfte der Markt-wirtschaft.
Auch für die Ostpolitik von Willy Brandtlag kein Blue Print vor, tastend mußte derSPD-Kanzler seine Politik der Annäherunggegenüber den Kommunisten entwickeln.Helmut Kohl hatte die deutsche Einheitnicht mal als Plangröße im Visier, das Groß-ereignis kam einfach über ihn.
Schröder kennt die Probleme, die er zulösen hat, seit einem Jahrzehnt. Und den-noch – oder deshalb? – zögert er. Er hateine sozialdemokratische Partei im Rücken(wie Tony Blair), nur ohne die staatlichen
Vorarbeiten einer MaggieThatcher.
Im Ausland wird dasdeutsche Zaudern mit Er-staunen registriert. Sogeißelte der InternationaleWährungsfonds (IWF)jüngst das „bemerkens-werte Versagen“ der Deut-schen und anderer eu-ropäischer Volkswirtschaf-ten beim Kampf gegen dieMassenarbeitslosigkeit.
Als am vergangenenDienstag darüber in Wa-shington debattiert wurde,mußte sich Hans Eichel garvon Chinas Zentralbank-
Gouverneur Dai Xianglong belehren las-sen, „vom letzten Kommunisten“, wie Ei-chel süffisant anmerkte: Dai forderte Eichelebenso wie seine europäischen Kollegenauf, endlich ihre Arbeitsmärkte zu dere-gulieren. Der Neuling aus Hessen war baff:„Das muß ich unbedingt der SPD-Fraktionerzählen.“
Kritisch beäugen auch die Ökonomenim eigenen Land das Treiben der Regie-rung. Die Bewältigung der Jobkrise, schrie-ben Deutschlands Wirtschaftsforschungs-institute vergangene Woche in ihrem tra-ditionellen Frühjahrsgutachten, erfordereeinfach „große Anstrengungen“. „Vertei-lungspolitische Maßnahmen“ allein, so wiebisher, brächten nun mal „keine nennens-werten Impulse für Wachstum und Be-schäftigung“.
Wie es anders geht, hat Kanzleramtsmi-nister Hombach, ein Ex-Preussag-Manager,in einem Buch über „Linke Angebotspoli-tik“ aufgeschrieben, das direkt nach derWahl für Aufsehen sorgte. Bislang ist es ihm
W.
M.
WEBER

Werbeseite
Werbeseite

26
28
30
32
3434,4
29,0
AP
Politiker Schröder, Fischer, Lafontaine*: An Expertisen herrscht kein Mangel
33,4
nicht gelungen, seinen schriftstellerischenForderungen auch Taten folgen zu lassen.
Arbeitsminister Riester, von Schrödergegen die Alt-SPD durchgesetzt, hat denRegierungschef bisher bitter enttäuscht. ImWahlkampf noch als Mann mit unkonven-tionellen Ideen gefeiert, haftet dem ehe-maligen Vize-Chef der IG Metall plötzlichdas Image des Bremsers an.
Seine Bonner Mitstreiter taten RiestersBetulichkeit zunächst als Anfängersündenab. Doch seit der Minister sich vor der rie-sigen SPD-Bundestagsfraktion gegen sei-nen Kanzler stellte, schütteln selbst Wohl-meinende nur den Kopf.
Noch erträgt Riester die Kritik an seinerPerson mit erstaunlicher Ruhe.Während inBonn schon Kandidaten wie Verkehrs-minister Franz Müntefering oder SPD-Bundesgeschäftsführer Ottmar Schreinerals Nachfolger gehandelt werden, verteidigt er eisern die umstrittenen Gesetze, alssei nichts geschehen. „Ei-gentlich denkt der Riester gar nicht so“, wundert sichselbst ArbeitgeberpräsidentDieter Hundt, ein langjäh-riger Vertrauter des Mini-sters.
* Am 20. 10. 1998 nach den er-folgreich beendeten Koali-tionsgesprächen.
*alle Ausgaben des Staates und der Versicherungs-träger für die soziale Sicherung
Proble
1960 65 70 75
21,7
Sozialbuddes Brutto
38
34,9Prozent
Reformer berichten immer wieder,Riester habe beim persönlichen Gesprächneuen Ideen freudig zugestimmt und sei später zurückgerudert – mit der Be-gründung, seine Fachleute im Ministeriumhätten ihm abgeraten.
So entstand das Image des allzu sanftenRessortchefs, der sein Haus nicht steuert,sondern selbst gesteuert wird – von einemBeamtenapparat, der den Status quo ver-teidigt. „Die haben den eingenordet“, sagtein Kabinettskollege.
Am kraftvollsten geht bisher noch Wirt-schaftsminister Werner Müller ans Werk.So drängt der Quereinsteiger aus derEnergiebranche auf einen radikalen Sub-ventionsabbau oder fordert mehr Mut beider Steuerreform. Einer Mehr-wertsteuererhöhung, erklärter wacker, werde er nicht zu-
m Sozialstaat
22
24
80 85 90 95 97
get* in Prozentinlandsprodukts
bis 1990 alte Bundesländer
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
stimmen. Müllers Manko: Er ist parteilos,verfügt also in der stärksten Regierungs-partei über keine Hausmacht. Seine Ideentaugen oft nur für die Schlagzeilen der Tageszeitung – und danach ab ins Alt-papier.
Für Schröder avancierte der neue Chefim Finanzministerium zum Hoffnungs-träger. Eichel, der Wahlverlierer aus Hes-sen, gilt zwar nicht als radikaler Reformer,als Systemveränderer, der das Steuersy-stem völlig umstürzen will; selbst derKanzler urteilt öffentlich: „Der tanzt nichtwie Fred Astaire und singt nicht wie Caruso.“
Doch der Bundeskanzler traut dem korrekten Verwaltungsfachmann wenig-stens zu, den maroden Haushalt zu sanie-ren und – anders als Lafontaine – die Aus-gabengelüste der Fraktion stärker zurück-zudrängen. Eichel, kaum drei Wochen im Amt, läßt keinen Zweifel daran, daß er dies als seine wichtigste Aufgabe an-sieht.
Eine „rigide Haushaltspolitik“, erzähltder Neuling, sei schließlich inzwischen „eintypischer Wesenszug der modernen Sozi-aldemokratie in ganz Europa“. Wolle diedeutsche SPD etwas anderes, stünde siekünftig allein; selbst Frankreich fahre einenstrikten Sparkurs. Eichel: „Am eisernenSparen führt kein Weg vorbei.“ Aber reichtdas? Und ist womöglich schon dieser Kraft-akt nicht zu schaffen?
Schröders Machtprobe mit den Sozial-politikern steht noch aus.Auf offener Büh-ne wird er sich mit ihnen anlegen müssen,streiten um die Grundlinie seiner Kanzler-schaft und auch um Details. Im risikofrei-en Selbstlauf, soviel ist mittlerweile klar,wird ein neues „Modell Deutschland“nicht entstehen. Elisabeth Niejahr,
Ulrich Schäfer, Barbara Schmid,Hajo Schumacher, Gabor Steingart

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

42
Titel
Selbständig
S P I E G E L - G E S P R Ä C H
„Ich bin ein Richtigdenker“Arbeitsminister Walter Riester über echte und falsche Selbständige, 630-Mark-Jobs
und den wütenden Protest gegen seine neuen Sozialgesetze
r: „Grauzonen definieren“
SPIEGEL: Herr Riester, kein anderer Mini-ster regt die Deutschen derzeit so auf wieder Arbeitsminister: Sie wollen den 630-Mark-Jobbern ans Portemonnaie und hal-sen vielen Selbständigen mit Ihrem Gesetzzur Scheinselbständigkeit eine neue Büro-kratie auf.Viele fragen sich: Ist der Riesterverrückt geworden?Riester: Ich verstehe die Aufregung nicht:Für die meisten 630-Mark-Beschäftigten hatsich die soziale Lage verbessert, und beiden Scheinselbständigen vollzieht der Ge-setzgeber nur die bisherige Rechtsprechungnach.Wir sorgen dafür, daß die Grauzonendefiniert werden und arbeitnehmerähnlicheSelbständige im Falle des Scheiterns nichtSozialleistungen bekommen, für die die All-gemeinheit aufkommen muß.SPIEGEL: Ihre Unterscheidungen in echteund unechte Selbständige ist doch ein Will-kürakt. Beispiel: Ein Unternehmensberaterkonzentriert sich auf einen großen Auf-traggeber. Der Laden läuft gut, der Mannhat mit Immobilien fürs Alter vorgesorgt.Warum muß der in die staatliche Zwangs-versicherung einzahlen?Riester: Immobilien sind nicht pfändungs-sicher. Wenn der Mann in Konkurs gehtund seinen Besitz verpfänden muß, ist auchdie Alterssicherung weg. Da muß gesichertsein, daß nicht die Allgemeinheit für seineSicherung einspringen muß. Deshalb willich ihn an unserer gesetzlichen Sozialver-sicherung beteiligen.SPIEGEL: Erstens: Auch Selbständige zahlenSteuern und sind beispielsweise damit ander Finanzierung von Sozialhilfe beteiligt.Zweitens: Nach Ihrer Logik müßten Sie alleUnternehmer, die sich heute selbst um ihreAbsicherung kümmern, sofort in die So-zialversicherung zwingen. Das Risiko, inKonkurs zu gehen, hat jeder Selbständige.Riester: Ich könnte diesem Ansatz auchdurchaus etwas abgewinnen, halte ihn in
e Gates, Grass: Neue Regeln für ne
Deutschland allerdings fürunrealistisch. In fast allenLändern Europas gibt eseine generelle Verpflich-tung zur Vorsorge im Alter.Wir kennen die meistenAusnahmen.SPIEGEL: Immerhin sagenSie jetzt offen, worum esIhnen eigentlich geht: Siewollen, genau wie Ihr Vor-gänger Norbert Blüm, dieleeren Sozialkassen füllen.Die Gesetze sind gemachtfür die Versicherungen,nicht für die Versicherten.Riester: Nein, die Rechnungginge nicht auf. Es ging mir darum, die Regeln der komplizierten neuenRealität anzupassen. Des-wegen unterscheiden wirsehr genau zwischenSelbständigen, Schein-selbständigen und arbeit-nehmerähnlichen Selbstän-digen.SPIEGEL: In welche Katego-rie gehört denn Ihrer Mei-nung nach der SchriftstellerGünter Grass, der logi-scherweise für einen einzi-gen Verlag ein Buchschreibt und keine Ange-stellten beschäftigt?Riester: Nach dem Abgren-zungskatalog der Künstler-Sozialkasse wäre er sicherein Selbständiger. Und sie wäre für ihn zu-ständig, wenn er 30 Jahre jünger wäre.SPIEGEL: Die Berufsgruppe der Rechtsan-wälte oder der Werber fällt in den erstenBerufsjahren fast komplett unter die Über-schrift „Scheinselbständige“, weil der jun-
Minister Rieste
J. H
. D
AR
CH
ING
ER
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
M.
ZU
CH
T /
DER
SPIE
GEL
REU
TER
S
ue Realitäten?
ge Anwalt oder junge Kreative ohne An-gestellte beginnt und am Anfang womög-lich auch nur einen Kunden hat.Riester: Widerspruch: Der junge Rechts-anwalt oder der Agenturgründer ist nichtgrundsätzlich Scheinselbständiger. Nachdem neuen Gesetz können beide selbstän-dig sein, sie könnten auch scheinselbstän-dig sein oder auch als arbeitnehmerähn-liche Selbständige gelten. Die Sozialkas-sen prüfen. Das Ergebnis ist offen.SPIEGEL: Kaum einer weiß, wodurch sichein arbeitnehmerähnlicher Selbständigervom Scheinselbständigen unterscheidet.Können Sie uns helfen?Riester: Ein arbeitnehmerähnlicher Selb-ständiger ist der, der nur für einen Auf-traggeber arbeitet und außer Familien-angehörigen keinen Beschäftigten hat.Von

ihm wird nicht mehr erwartet, als daß er fürErwerbsunfähigkeit und für das Alter Vor-sorge trifft. Deshalb will ich, daß dieserMann oder diese Frau in die Sozialsystemeeinzahlt. Der Scheinselbständige ist darüberhinaus weisungsabhängig, es handelt sichpraktisch um einen Arbeitnehmer, der, umSozialkosten zu sparen, rechtlich nicht derFirma angehört, in die er eingegliedert ist.SPIEGEL: Fängt nicht so auch die richtigeSelbständigkeit an – raus aus der alten Fir-ma, der erste Auftrag kommt noch von dort,weitere Mitarbeiter gibt es vorerst keine?Riester: Daß alle Selbständigen weisungs-abhängig sind, kann man nicht unterstel-len. Da sind die Konstruktionen ganz un-terschiedlich. Wir haben deshalb im Ge-setz gesagt: Es müssen alle Umständeberücksichtigt werden, und die könnenbesser als die Sozialkassen oder der Ge-setzgeber der Beschäftigte selbst und mög-licherweise sein Auftraggeber darstellen.Wenn also die Vermutung naheliegt, daß essich hier um ein ganz normales Arbeit-nehmerverhältnis handelt, dann legt dasnicht allein die Kasse fest, sondern der Be-schäftigte kann gegenüber den Behördenseine unternehmerische Tätigkeit alsSelbständiger belegen.SPIEGEL: Da ist doch die Frage erlaubt, obdem Staat diese Unterscheidung jemals ge-lingen kann. Außerdem bürden Sie den Betroffenen eine enorme Bürokratie auf;der WDR muß für mehr als 20000 freieMitarbeiter beweisen, daß sie mehr als ei-nen Auftraggeber haben, also nicht schein-selbständig sind. Das ist doch absurd.Riester: Die Regeln für freie Mitarbeiterhaben sich nicht geändert.Wir wollten überdieses Gesetz keinen Automatismus auslö-sen. Da ist eine Klärung notwendig, diewird in den nächsten Wochen erfolgen. Sohaben wir es im Gespräch im Bundes-kanzleramt verabredet.SPIEGEL: Ihr Gesetz ist neben allen anderenMängeln auch noch ungerecht: Der richti-ge Selbständige muß in der Regel keineSozialabgaben zahlen, darf sich selbst umseine Absicherung für den Armutsfall unddie Rente kümmern. Der sogenannteScheinselbständige, also oft genug ein ech-ter Unternehmensgründer, muß ins teurestaatliche System. Warum diese Ungleich-behandlung?Riester: Scheinselbständige waren schonimmer Arbeitnehmer. Wenn arbeitneh-merähnliche Selbständige scheitern, trägtdie Gemeinschaft das Risiko. Ich will, daßsie zu dieser Risikoabsicherung beitragen.Und das neue Gesetz kommt ihnen weitentgegen, sie müssen in den ersten dreiJahren nur die Hälfte des Beitrages ein-zahlen, schneiden also günstiger ab als dernormale Arbeitnehmer.SPIEGEL: Aber dieser Selbständige konkur-riert nicht mit dem Arbeitnehmer, sondernmit dem Rechtsanwalt oder dem Designervon nebenan, der schon zwei Angestellteund drei Kunden hat. Warum soll ein
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9

3,5
4,0
4,5
4,3
4,8Januar1998
März1999
4,7Februar1997
4,3
Februar1996
Millionen
4,5
Februar1999
Titel
Arbeitsamtspräsident Jagoda: Sinkende Quote
4,0
Februar1994
Start-up-Unternehmer schlechter gestelltsein? Riester: Ich bitte Sie: In vielen Fällen mußder arbeitnehmerähnliche Selbständige nur123 Mark zahlen und kann sogar stundenlassen.Wenn er die nicht hat, wird er auchSchwierigkeiten haben, sich in seinerSelbständigenpraxis durchzusetzen.SPIEGEL: Nach Ihren Regeln von Schein-selbständigkeit wäre das Silicon Valleynicht entstanden, Bill Gates hätte sich inder Anfangsphase mit seinem Kunden IBMvor der Krankenkasse rechtfertigen müs-sen. Warum ist aus dem Querdenker Rie-ster so schnell ein Traditionalist geworden?Riester: Unsinn, ich war weniger Querden-ker als Richtigdenker und bin das auchheute.SPIEGEL: Wird es Nachbesserungen geben?Riester: Für grundlegende Änderungensehe ich keinen Anlaß.SPIEGEL: Viele, auch der Kanzler, hattenvon Ihnen ein anderes Vorgehen erwartet.Früher sorgten Sie mit Sätzen wie „DieRealität frißt sich durch die Sozialsyste-me“ und „Wir müssen die Strukturen desSozialstaates ändern“ für Schlagzeilen.Heute führen Sie genau die alte Diskus-sion: Wie kann ich das alte System retten?Wie presse ich neue Leute als Beitrags-zahler hinein?Riester: Stopp. Jeden meiner Sätze unter-streiche ich, die Realität frißt sich natürlichdurch. Genau darum geht es doch heute:Für eine Million neue Selbständige undfünf bis sechs Millionen Geringverdienermußten neue Lösungen gefunden werden.Niemand wird einfach ins alte System ge-preßt.SPIEGEL: Was Sie bisher vorgelegt ha-ben, ist jedenfalls nicht der Umbau odergar Rückbau des Sozialstaates, den viele sich von dieser Regierung erhofft ha-ben.Riester: Zunächst einmal:Rückbau des Sozialstaa-tes ist nicht Zielsetzungder Regierung, sonderndie Zielsetzung ist, daßwir ihn reformieren.SPIEGEL: Schröder sagt zu-mindest, er möchte dieStaatsquote senken.Das heißt Rückbauund bedeutet, daßder Staat seine
1991 1992 1993 1994 199
2,6
Januar1991
Problem
44
Finger ein Stück weit aus dem Portemonnaieder Bürger nimmt. Haben Sie dasselbe Ziel?Riester: Natürlich: Wir senken die Staats-quote, und wir senken die Lohnneben-kosten, das ist Bestandteil der Koalitions-vereinbarung. Wir haben das nicht nur vereinbart, sondern wir haben die ersteSenkung mit 0,8 Prozent bereits durchge-setzt. Und wir haben dafür gesorgt, daßder Bund Leistungen für Kindererziehungund die Einheit in Höhe von 25 MilliardenMark übernimmt. Das betrachte ich als Erfolg, auch für mich persönlich.SPIEGEL: Für viele 630-Mark-Beschäftigtehaben Sie die Abgabenlast gerade massiv er-
5 1996 1997 1998 1999
2,5
3,0
Arbeitslose
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
höht. Für viele Kellner, Taxifahrer, Volks-hochschullehrer, Grafiker und Software-In-genieure lohnt die Arbeit nicht mehr. Ist dasnicht ein Debakel für den Arbeitsminister?Riester: Für mindestens 4,2 Millionen der5,6 Millionen 630-Mark-Beschäftigten wirktsich das Gesetz positiv aus. Sie haben näm-lich nur einen 630-Mark-Job und müssenkünftig keinerlei Steuern dafür zahlen, derArbeitgeber überweist die Sozialversiche-rungsbeiträge, zehn Prozent Beitrag zurKrankenversicherung, zwölf Prozent zurRentenversicherung, das war’s. Der Be-schäftigte hat sogar die Möglichkeit, wenner will, zusätzlich 7,5 Prozent Rentenbei-
trag zu zahlen, und hatdann die gesamten An-sprüche. Das ist doch gut.SPIEGEL: Ihre Zahlen basie-ren auf einer Umfrage,gesichertes Datenmaterialexistiert nicht. Fest steht allerdings: Das Haupt-problem tritt bei jenen Beschäftigten auf, die meh-rere dieser kleinen Jobs haben oder zugleich einemHauptberuf nachgehen.Die müssen nun mit anse-hen, wie der 630-Mark-Ver-dienst mit ihrem höchstenpersönlichen Steuersatz ra-siert wird. Für viele bleibtdann nur ein Stundenlohnvon acht oder neun Markübrig. Das macht die Leuteso wütend.
Riester: Wollen Sie mit mir über drei an-erkannte Untersuchungen oder über Steu-ern diskutieren? Aber gut: Schon bishermußten Nebeneinkünfte versteuert wer-den. Wie kommen Sie darauf, daß das nie-mand gemacht hat?SPIEGEL: Sie kennen die Antwort genauso-gut wie wir: Für den 630-Mark-Job alterPrägung hat der Arbeitgeber die Steuernpauschal bezahlt, damit war der Fall für diemeisten erledigt, nirgendwo waren die Namen der Mini-Jobber registriert. Jetzt,wo statt der Pauschalsteuer in gleicherHöhe Sozialbeiträge fällig werden, ist derName des 630-Mark-Beschäftigten denBehörden bekannt.Wer diesen Zusatzver-dienst nicht bei der Steuer angibt, fliegtsehr schnell auf.Riester: Wenn das bisher so war, wie Sie esschildern, dann hat das gegen altes Rechtverstoßen. Dann war die Praxis eine Hin-terziehung von Sozialversicherungsbeiträ-gen. Denn nur ein 630-Mark-Job war fürden Arbeitnehmer sozialversicherungsfrei,alle weiteren hätte er angeben müssen.SPIEGEL: Die fehlende Kontrollierbarkeitder alten Regel führte zu einem regelrech-ten Boom bei diesen Beschäftigungsver-hältnissen. Diesen Prozeß wollen Sie jetztrückgängig machen?Riester: Stopp. Ich will keine Prozesse rück-gängig machen, sondern zuerst einmal
n?
REU
TER
S

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Gewerkschaftsmitglied Riester*: „Wenn wir größere Reformen angehen, wird es auch Proteste geben“
A.
VAR
NH
OR
N
Titel
„Alle, die ständig steigende Beiträgebeklagen, können sich freuen“
Transparenz herstellen. Darüber könnensich alle nur freuen, die ständig steigendeSozialbeiträge beklagen.SPIEGEL: Statt dessen Empörung überall:Taxifahrer streiken, den Restaurants laufendie Kellner davon, etliche Volkshochschu-len sind von Schließung bedroht. Bislanggalten die 630-Mark-Jobs als die Steuer-oase der kleinen Leute.Riester: Ihren Ratschlag, daß wir Steuer-hinterziehung oder die Hinterziehung vonSozialversicherungsbeiträgen für gutheißen sollen, teile ich nicht. Das ist ein-deutig nicht meine Auffassung. Das halte
Riester, SPIEGEL-Redakteure*Keine Sekunde an Rücktritt gedacht
J. H
. D
AR
CH
ING
ER
ich weder für modern noch für refor-merisch. Es stellt sich doch allen anderenBeschäftigten, die Mehrarbeit in ihrer Firma leisten, dieselbe Frage: Lohnt sichdas noch, wenn ich die Steuerprogressioneinkalkuliere? Es gibt welche, die sagen:Nein, das lohnt nicht mehr.Warum soll icheine Sorte von Beschäftigten bevorzugen?SPIEGEL: Deutschland braucht diese Mini-Jobs, anders können typische Dienstlei-stungsbranchen wie die Gastronomie, dasTaxifahrergewerbe oder die Zeitungszu-stelldienste nur schwer leben.Riester: Die Wissenschaftler und auch dieMedien fordern immer große Strukturre-formen von uns, und dann wundern sichalle, daß das Reibungen und Unruhe mitsich bringt. Ich bin überzeugt, daß Dienst-
leistungen, die wir brauchen, auch organi-siert werden.SPIEGEL: Die Aufregung der Betroffenenläßt Sie also kalt?Riester: Mir klagte gestern eine Parlamen-tarierin ihr Leid: Sie frage sich, ob die Zei-tung künftig noch ins Haus komme, wasaus ihrem Frühstücksbrötchen werde undob die Fenster bald nicht mehr geputztwürden? Sie gab die Antwort selbst: Es wirdalles erledigt, der Dienstleistungsbereichwird sich auf das neue Gesetz einstellen.SPIEGEL: Herr Riester, die Regierung ist an-getreten, die Arbeitslosigkeit zu bekämp-
fen. Man hat den Eindruck,Sie bekämpfen statt dessendie Arbeitenden.Riester: Die Regierung hatein Sofortprogramm gegen
Jugendarbeitslosigkeit gestartet, das sehrerfolgreich läuft. Und auch die neuen Ar-beitslosenzahlen sprechen für uns: Ich wür-de mich freuen, wenn die Medien berich-ten würden, daß im Januar, Februar undMärz zwischen 335 000 und 368 000 Ar-beitslose weniger registriert wurden als vor einem Jahr.SPIEGEL: Mit Verlaub, aber der Erfolg Ihrer Arbeit sind diese Zahlen nicht.Riester: Wir können darüber streiten, werdafür zuständig ist. Zum Teil ist immer die Regierung für steigende, aber auch fal-lende Zahlen zuständig gemacht worden.
* Oben: auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall am 30. November 1998 in Mannheim; unten: GaborSteingart und Elisabeth Niejahr vor dem Bundes-arbeitsministerium.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Fakt ist: Die Arbeitslosenzahlen gehenzurück.SPIEGEL: Wie oft haben Sie in den vergan-genen Wochen an Rücktritt gedacht?Riester: Keine Sekunde. Ich habe mit Wi-derstand gerechnet, ich nehme das alles gelassen. Wenn wir die größeren Reformen angehen – etwa bei der Rente –,wird es auch Proteste geben. Das ge-hört zum Geschäft derer, die verändernwollen.SPIEGEL: Sie sollen intern sogar mit Rück-tritt gedroht haben.Riester: Ich habe damit nicht gedroht undwürde das auch nicht tun. Ich würde esdann einfach machen.SPIEGEL: Herr Riester, wir danken Ihnenfür dieses Gespräch.
47

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

50
Deutschland
An
OD
EO
N 2
P O L I T I K - W E R B U N G
Emotionalverdichten
Gerhard Schröder sucht ein neues Outfit für die Regierung.
Seine Stammagentur aus Hannover hat beste Aussichten
auf den Millionenauftrag.
zeigen-Entwurf der Agentur Odeon Zwo: Dachmarke für die Deutschland AG
ro
Sozialdemokrat Schröder, Wahlplakat*Design von den Friends of Gerd
W.
SC
HM
IDT /
NO
VU
M
Bisher war das Markenzeichen derrot-grünen Regierung das Chaos.Am 19. Mai wird das anders.
Vor dem Kabinett präsentieren dann dashannoversche Reklamehaus Odeon Zwo,Gerhard Schröders langjährige Stamm-agentur, und das PR-Unternehmen Ahrens& Behrent aus Frankfurt am Main ihreKonzepte für ein einheitliches Erschei-nungsbild von Regierung und Ressorts. DasUnternehmen Schröder und Co. bekommteine „Corporate identity“.
Die Minister dürfen mitentscheiden, wel-che der beiden Firmen, die sich in der Vorauswahl gegen drei weitere Bewerberdurchgesetzt hatten, die Marke Rot-Grün künftig durchstylen darf.Womöglichteilen sich beide auch den Millionen-etat, den das Bundespresseamt (BPA) bis zur Bundestagswahl im Jahr 2002 vergibt.
Was in der Industrie seit Jahren üblichist, von den Regierungen in London undParis in Auftrag gegeben wurde, wird jetztauch Schröders Deutschland AG verpaßt:ein einheitliches Design. Vom Plakat überdie Broschüre bis zum Briefpapier sollenDachmarke (Bundesregierung) und Mar-
kenartikel (Ministerien) einen gemeinsa-men Stil erhalten.
Wie schwer es selbst hauptberuflichenKreativen fällt, den richtigen Ton für denungewöhnlichen Auftraggeber zu treffen,demonstrierten die in der ersten Runde ein-geladenen fünf Agenturen Anfang März.
Weit daneben lag beispielsweise dieAgentur Westag. Die Kölner, die sonst auchfür Eierlikör werben, texteten kirchen-tagskompatibel: „Wir erneuern Deutsch-land – gemeinsam“ und empfahlen als Stra-tegie: „Gerhard Schröder verkauft Hoff-nung“. Flankierend müsse man den „Nut-
zen der Regierungspolitik emo-tional verdichten“.
Unterhaltsam geriet der Vor-schlag von Ogilvy & Mather ausDüsseldorf, mit dem man auchAutos,Viagra oder den DeutschenBeamtenbund hätte bewerben können: „Esbewegt sich was in Deutschland“. Unterbo-ten wurde der Slogan nur von den Plakat-sprüchen: „Lebendig. Nicht tot“ sei dieseRegierung, verströme „Glanz. Nicht Gloria“und sei überhaupt „Motor. Nicht Bremse“.
„Weg. Nicht weiter“, lautete folgerichtigdas Urteil der Jury aus 50 Öffentlichkeits-arbeitern von BPA und Ministerien.
Neben den beiden Finalisten überstandnur KNSK, BBDO die erste Runde. Dochdie Hamburger, die Schröders Bundes-tagswahlkampf gestaltet hatten, scheitertenEnde März im zweiten Durchgang. Über-eifrig hatte das Team einen „Masterplan(Steuerungsvorschlag auf einer Zeit- undEreignisschiene)“ für die Kampagne aus-getüftelt und obendrein Entwürfe für jedesMinisterium geliefert, was die auf Autono-
* Im Februar in Celle während des niedersächsischenLandtagswahlkampfs.
Werber K
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
mie bedachten Ressorts nicht goutierten.So wurde auch KNSK ausgemustert.
Rätselhaft bleibt, wie die biedere FirmaAhrens & Behrent ins Finale gelangenkonnte. Die Frankfurter hatten ein lahmesLogo in Form eines schwarz-rot-goldenenUfos gemalt, um damit T-Shirts und Luft-ballons zu bedrucken. Flankierend soll eineZeitschrift mit dem Titel „21.de“ die Steu-erzahler mit packenden Themen wie „DieLandwirtschaft auf dem Weg zu neuen Lö-sungen“ fesseln. Für 100 000 Exemplare(„Papier: ansprechend, nicht teuer“) alle 14Tage sind 2,5 Millionen Mark veranschlagt.
Obgleich die Frankfurter bis zum Finalezur Nachbesserung angehalten sind, dürf-te der Sieger schon feststehen: Odeon Zwo.Bereits nach der ersten Runde zur Über-arbeitung gebeten, präsentierten SchrödersLieblingswerber unter anderem luftige An-zeigen mit schwarzem, rotem und schmud-delig gelbem Quadrat, wie beim späten
Mondrian, und als Text etlicheGrundgesetzartikel.
Mal mit Belustigung, mal mitBefremden hatte die Brancheschon Anfang Dezember regi-striert, daß die bislang eher in der Regionalreklame tätigeFirma aus Hannover in großen Anzeigen für ihre neue De-pendance in Berlin Kräfte suchte.
Odeon-Werber Michael Kronachergehört zum innersten Kreis der „Frogs“,der Friends of Gerd. Er entwarf auch dieKampagne für die Niedersachsen-Wahl1998, als Schröder fast 48 Prozent und da-mit die SPD-Kanzlerkandidatur gewann.
Nun winkt der größte Etat in der Fir-mengeschichte. Zuvor wird BPA-ChefUwe-Karsten Heye den Ressorts allerdingsnoch erklären müssen, ob Odeon Zwo nuraus dem Budget seines Amtes oder auchaus den Etats der Ministerien gespeist wird.
Schon wächst in den Ministerien die Sor-ge, daß künftig die Einzeletats der Ressorts,jährlich bis zu 25 Millionen Mark, aus Heyes BPA zentral ferngesteuert werden.
Einen solchen Versuch hatte 1970 WillyBrandts BPA-Chef Conrad Ahlers schoneinmal unternommen. Nach heftigen Pro-testen der Opposition gegen die Propagan-da-Maschinerie wurden die Pläne jedochumgehend eingestellt. Hajo Schumacher
nacher
K.
HO
FFM
AN
N

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

5
Deutschland
K
A T O M K R A F T
Stiller AbschiedGerhard Schröder ist dabei, den
Ausstieg aus der Kernkraft in unendliche Ferne zu verschieben.
Jürgen Trittin bereitet dagegen ein letztes Abwehrmanöver vor.
M.
UR
BAN
T. R
AU
PAC
H
ernkraftwerk Brokdorf, Verhandlungspartner Schröder, Henkel: Die Grünen schweigen verzweifelt
Manfred Remmel, Chef der EssenerRWE Energie, sieht seinen Kon-zern längst fürs nächste Jahrtau-
send gerüstet. Schon bald, so die ehrgeizi-gen Pläne des Managers, wird der einstigeStrommonopolist aus dem Ruhrpott dieEnergiemärkte in ganz Europa aufmischen– mit hochmotiviertem Personal und zukonkurrenzlos günstigen Preisen.
Es gibt nur ein kleines Problem: DerAtomstromproduzent RWE müßte baldseine Kraftwerke abschalten, wenn die rot-grüne Bundesregierung bei ihren Aus-stiegsplänen bleibt. Doch seit voriger Wo-che kann Remmel wieder hoffen. Der Ab-schied vom Atomstrom, so verriet er, seikeineswegs „endgültig entschieden“.
Die Vorfreude des Managers ist ver-ständlich. Unter dem Druck von Industrieund Gewerkschaften hat Gerhard SchröderAbschied vom Atomausstieg genommen.Schritt für Schritt wich der Bundeskanzlerzurück, und nun droht das rot-grüne Pre-stigeprojekt endgültig zu sterben.
Kein einziger Meiler werde in dieser Le-gislaturperiode abgeschaltet, versprachSchröder unlängst Kernkraftbetriebsrätenund Gewerkschaftern beim vertraulichenTreffen in der Bonner Regierungszentrale.„Ich bin doch nicht verrückt“, versicherteder Kanzler seinen Gästen.
Auch die Atomfuhren quer durchDeutschland, die Ex-UmweltministerinAngela Merkel vergangenen Mai stoppte,sollen auf jeden Fall pünktlich starten –obwohl die Konzerne keine Garantie über-nehmen, daß künftig nicht wieder ver-strahlte Behälter auftauchen. „Wenn Trans-porte notwendig werden“, blaffte der
4
Kanzler den widerspenstigen grünen Um-weltstaatssekretär Rainer Baake an, „sollendiese auch durchgeführt werden – undzwar ohne juristisches Geplänkel.“
Vergangene Woche machten Schröderund Kanzleramtschef Bodo Hombach neue Zusagen. Einer Industriedelegation,angeführt von BDI-Chef Hans-Olaf Henkel, versprachen die beiden, daß eskeine Novelle des Energierechts gebenwerde.
Für viele Genossen und Grüne ist daseine herbe Niederlage – die Verschärfungdes Paragraphenwerks war für sie die Peit-sche, mit der sie den Konzernen drohenkonnten: Stellten sich die Bosse beim Aus-stieg quer, so die rot-grüne Logik, würde dasParlament zur Strafe per Gesetz für höhe-ren Wettbewerbsdruck auf dem Strommarktsorgen.
Die grüne Führung ist in SchrödersSzenario durchaus schon eingeweiht: Inder rot-grünen Koalitionsrunde enthüllteder Kanzler vor knapp zwei Wochen seineneuesten Atompläne: „Den Ausstieg kannman in 25 bis 30 Jahren hinkriegen.“
Bleibt es dabei, wird der jüngste deut-sche Meiler, Neckarwestheim 2, erst 2029abgeschaltet – nach 40 Jahren Laufzeit.
Die Grünen, von den Debatten über denKosovokrieg zermürbt, schweigen verzwei-felt. Jürgen Trittin, beim Atom zuletzt auffäl-lig wortkarg, rüstet jedoch in aller Stille zurAbwehr der Anti-Ausstiegs-Front. SeinDruckmittel sind die Atommülltransporte.Ausgerechnet der grüne Umweltminister sollnämlich nach dem Wunsch der Industrieschnellstens neue Castorfahrten genehmigen.
Dieses Jahr noch soll der Rücktransportvon Atomabfällen aus Frankreich starten.Trittin stehe beim französischen Industrie-staatssekretär Christian Pierret im Wort,hielten Beamte des Bonner Außenministe-riums in einem vertraulichen Vermerk fest.Bei einer Paris-Visite im Januar hätten sichder Deutsche und der Franzose geeinigt,„daß die Rücktransporte noch in diesemJahr beginnen, und zwar in dem verein-barten Rhythmus von mindestens zweiTransporten im Jahr“.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Doch die heiklen Überführungen zu denWiederaufarbeitungsanlagen in Frankreichund Großbritannien möchte Trittin so lan-ge wie möglich hinauszögern. Ein Gutach-ten dazu soll frühstens Ende Juni vorliegen.
Schon geraten die Konzernchefs wiederin Rage. Denn die Fuhren zu den Atom-recyclern im Ausland, die früher nur seltenvon Demonstranten behindert wurden, lie-gen den Stromern besonders am Herzen:Sie brauchen Platz in ihren prallvollen Ab-
klingbecken, um abgebrannte Brennstäbeeinzulagern. Sonst droht die Zwangsab-schaltung.
Erleichterung könnte den Kraftwerksbe-treibern zwar auch die Brennelemente-Ab-fuhr aus deutschen Meilern in die Zwi-schenlager Gorleben und Ahaus bringen –ein Gemeinschaftsgutachten, das der Um-weltminister beim Öko-Institut und bei derGesellschaft für Anlagen- und Reaktorsi-cherheit bestellte, signalisiert freie Fahrt:„Innerdeutsche Transporte“, urteilen dieExperten, ließen sich künftig so durch-führen, daß „Kontaminationsprobleme ver-mieden werden können“. Praktisch sinddie innerdeutschen Transporte aber kaumeine Alternative, weil sogleich wieder Groß-demonstrationen drohen und die Polizeischon mangelnde Einsatzbereitschaft zeigt.
Die Transporte nach Frankreich, die mitanderen Behältern als denen der Castor-Bauart auf die Schienen gehen, bergen aberweiterhin das Risiko von Kontaminationen.Sogar den Spezialisten der Stromkonzernesind die französischen Transportcontainerunheimlich. Zwischen zigtausend Stacheln,die die Behälteroberfläche vergrößern undfür schnelle Wärmeabfuhr sorgen sollen, ver-bergen sich allzuleicht strahlende Partikel.
Listig hat Trittin seine Blockade bereitseingefädelt: Bestätigen die Experten, daßdie Auslandsfuhren Risiken bergen, wäreder Umweltminister aus dem Schneider.Dann müßte der Kanzler persönlich dieTransporte verantworten.
RWE-Energiechef Remmel ist allerdingssicher: „Um fünf vor zwölf werden Schrö-der und Hombach ein Machtwort sprechenmüssen.“ Hendrik Munsberg

Werbeseite
Werbeseite

HiInh
Deutschland
Tat
56
T E R R O R I S M U S
Recht und GnadeDie Schleyer-Entführerin Sieglinde Hofmann kommt
in dieser Woche frei. Ihren noch inhaftierten RAF-Genossenmacht ein ungewöhnliches Gnadengesuch zu schaffen.
ort Schleyer-Entführung (1977): Keine Gefahr mehr für den Staat
Selbst die Schließer der Justizvoll-zugsanstalt im pfälzischen Franken-thal fragen sich inzwischen, warum
der „alte Mann“ immer noch sitzt. DerStrafgefangene mit dem Ajatollahbart,glaubt sein Anwalt Thomas Scherzberg,gelte der Justiz „nur noch aus Gewohn-heit als topgefährlich“.
Erst vor wenigen Wochen verzeichneteder Jurist im Bemühen um einen norma-
Eva Sybille Haule, 44
2. August 1986
15 Jahre (1988), Lebenslang (1994)
Anschlagsversuch auf Nato-Schule in Oberam-mergau, Anschlag auf US-Airbase Frankfurt (zwei To-te) und vorherige Ermor-dung eines US-Soldaten
Ungewiß
Rolf Heißler, 50
9. Juni 1979
Lebenslang (1982)
Zweifacher Mord an nie-derländischen Zollbeam-ten in Kerkrade
2000 oder 2001
nter Gitternaftierte RAF-Terroristen
Verhaf-tung
UrteilStraf-taten
Entlas-sung
len Strafvollzug einen kleinen Etappen-sieg: Erstmals in fast 20 Jahren durfte erseinen Mandanten sprechen, ohne daßeine zentimeterdicke Panzerglasscheibesie trennte.
Der alte Mann ist in Wirklichkeit gera-de 50 Jahre alt, hat aber die Hälfte seinesLebens hinter Gittern verbracht. Derfrühere RAF-Terrorist Rolf Heißler istlängst Teil bundesdeutscher Geschichte.
Sieglinde Hofmann, 54
5. Mai 1980
15 Jahre (1982), Lebenslang (1995)
Ponto-Anschlag, Schleyer-Entführung und -Ermordung, Haig-Anschlag
5. Mai 1999
Christian Klar, 46
16. November 1982
Lebenslang (1985 und 1992)
Anschläge auf Schleyer, Ponto, Buback und US-General Kroesen, Raub mit Todesfolge, versuchter Anschlag auf Bundesanwaltschaft
frühestens 2008
Birgit Hogefeld, 42
27. Juni 1993
Lebenslang (1996)
Anschlag auf US-Airbase Frank-furt (zwei Tote) und vorherige Ermordung eines US-Soldaten
Ungewiß
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Nachdem er im Frühjahr 1971 gemein-sam mit drei Kumpanen „eine Bank ent-eignet“ hatte, wurde Heißler gefaßt undzu acht Jahren Gefängnis verurteilt. ImMärz 1975 mit vier weiteren Genossen imAustausch gegen den verschleppten Berli-ner CDU-Chef Peter Lorenz freigepreßt,verlor sich die Spur des Politkriminellen ineinem nahöstlichen Ausbildungslager. Spä-ter kehrte er als einer der Wortführer derRAF unerkannt in die Bundesrepublikzurück, wurde hier im Juni 1979 erneutfestgenommen. Bei der Polizeiaktion trafihn ein Schuß in den Kopf; Heißler über-lebte nur knapp. 1982 verurteilte ihn dasOberlandesgericht Düsseldorf zu lebens-langer Haft wegen Mordes an den nieder-ländischen Zollbeamten Dionysius de Jongund Johannes Goemans.
Rolf Heißler ist einer von sieben Le-benslänglichen der RAF, die ein Jahr nachder Selbstauflösung der Untergrundgruppe(„Heute beenden wir dieses Projekt“) nochin bundesdeutschen Gefängnissen einsit-zen (siehe Grafik).
Für sie liegt seit Januar ein ungewöhnli-ches Gnadengesuch auf dem Schreibtischdes Bundespräsidenten. Zum einen ent-schieden sich nicht die Gefangenen selbstfür den Gnadenweg, sondern Dritte – dieRAF-Häftlinge erfuhren davon erst aufUmwegen. Zum anderen bitten die Initia-toren Roman Herzog, alle inhaftiertenRAFler „kollektiv und zugleich jede Per-son individuell zu begnadigen“ – das wäreein Verstoß gegen das individuelle Gna-denrecht und käme einer Amnestie be-denklich nahe.
Nicht nur die merkwürdigen Umstände,auch der Zeitpunkt des Gesuchs habenRAF-Gefangene und Anwälte irritiert undverärgert. Manche glauben sogar, es ver-schlechtere ihre Position. Denn die Selbst-
Brigitte Mohnhaupt, 49
11. November 1982
Lebenslang (1985)
Anschläge auf Schleyer, Ponto,Buback und US-General Kroe-sen, versuchter Anschlag auf Bundesanwaltschaft
Ungewiß
Rolf Clemens Wagner, 54
19. November 1979
Lebenslang (1980, 1987 und 1993)
Bankraub, Mord, Schleyer-Entführung, Haig-Anschlag
Ungewiß
Adelheid Schulz, 44
11. November 1982
Lebenslang (1985 und 1994)
Entführung und Ermordung vonSchleyer und Ponto, Morde an niederländischen Zollbeamten
Haftunterbrechung seit Oktober 1998

Werbeseite
Werbeseite

Deutschland
ag auf U. S. Airbase in Frankfurt (1985): „Grauenhaft
auflösung des RAF-Restes hat für einigeder Verurteilten die Chance auf ein Lebennach dem Knast erheblich verbessert, ohnedaß sie auf den letztlich unsicheren Gna-denweg hoffen müssen.
Was zehn Hungerstreiks, Entführungenund Mordanschläge nicht schafften, wurdeund wird nun ganz unspektakulär Realität:Im Mai vergangenen Jahres hatte Herzogmit Helmut Pohl den langjährigen strate-gischen Kopf der Gefangenengruppe be-gnadigt. Im Oktober verfügte Generalbun-desanwalt Kay Nehm eine Haftunterbre-chung für die gesundheitlich angeschlageneAdelheid Schulz, 44. Daß sie die ausste-hende Reststrafe von etwa einem Jahr nochabsitzen muß, gilt als unwahrscheinlich.
Vor zwei Monaten wurde mit StefanWisniewski, 46, nach 21 Jahren Haft einerder Schleyer-Entführer entlassen, am Mitt-woch dieser Woche öffnen sich für seineKomplizin Sieglinde Hofmann, 54, die Ge-fängnistore.Auch sie hat dann 19 Jahre hin-ter Gittern gebüßt. Paragraph 57a desStrafgesetzbuchs („Aussetzung des Strafre-stes“) erlaubt grundsätzlich eine Entlas-sung Lebenslänglicher schon nach 15 Jah-ren. Da aber die Gerichte bei RAF-Täternregelmäßig eine „besondere Schwere derSchuld“ feststellten, müssen die Ex-Guerri-lleros meist etwa zwei Dekaden absitzen.
Auch für Heißler läuft bereits das Aus-setzungsverfahren, für eine Entscheidung
fehlt noch ein neurologisches Gut-achten über seinen Gesundheits-zustand. Anwalt Scherzberg rech-net mit der Freilassung im näch-sten Jahr. Auf diesen Termin kannauch Rolf Clemens Wagner hoffen,seit 1979 in Haft.
Entsprechend konsterniert rea-gieren die Gefangenen und ihrUmfeld auf das kollektive Gna-dengesuch. Übereinstimmend be-richten Anwälte, ihre Mandantenund deren Angehörige hätten vonder Initiative nur zufällig erfahren.Bis vor wenigen Tagen kannten diemeisten von ihnen nicht einmalden Wortlaut der Eingabe.
Das Gnadengesuch haben derSprecher des linksliberalen Komi-tees für Grundrechte und Demo-kratie, Wolf-Dieter Narr, und derLimburger Pfarrer Hubertus Jans-sen gestellt. Geschrieben haben siees nicht auf dem Briefpapier desKomitees, sondern auf dem der Freien Uni-versität Berlin, wo Narr Politikwissenschaftlehrt. Süffisant fragte ein Beamter, seitwann denn „die FU Berlin auch Gefange-nenseelsorger beschäftigt“. Das Bundes-präsidialamt bestätigt den Eingang desSchreibens – und schweigt.
Gravierender als der Formfehler desfalschen Briefkopfes ist die fehlende Ab-
Anschl
stimmung zwischen Bittstellern und Ge-fangenen. Narr und Janssen räumen „Irri-tationen“ und „Mißverständnisse“ ein, be-haupten aber, die seien überwunden.
Zumindest Franz Schwinghammer, An-walt von Christian Klar und Brigitte Mohn-haupt, sieht das ganz anders. Das Gna-dengesuch sei von den Betroffenen „inkeiner Weise autorisiert und auch nicht

und zutiefst unmenschlich“
hilfreich“. Eine solche Bitte müsse manzum richtigen Zeitpunkt stellen und dannauch nicht ohne vorherige Sondierungen.Für seine Mandanten jedenfalls sei, ob-gleich auch sie dem Terror abschworen,„die äußere Situation, das wagen zu kön-nen, noch nicht da“.
Klar und Mohnhaupt sitzen seit 1982 ein,erst im vergangenen Jahr legte das Ober-
landesgericht Stuttgart für Klareine Mindesthaftzeit von 26 Jah-ren fest. Beide galten lange als be-sonders unbeugsame Symbolfigu-ren der RAF. Auch für Eva Haule,1986 festgenommen, aber erst vorfünf Jahren zu lebenslanger Haftverurteilt, dürfte die unzureichendvorbereitete Gnadeninitiative nochzu früh kommen.
Eine Sonderrolle wird der 1993in Bad Kleinen verhafteten BirgitHogefeld zugebilligt. Ein Jahr vorihrer Festnahme hatte sie nachEinschätzung der Strafverfolger ander „Deeskalationserklärung“ mit-gearbeitet, die erst das Ende derblutigen Anschläge einleitete unddann auch das der RAF. Vor Ge-richt distanzierte sie sich vom„grauenhaften und zutiefst un-menschlichen“ Mord am GI Ed-ward Pimental, der 1985 Stundenvor dem Anschlag auf die U. S.Air-
base in Frankfurt erschossen und seinesAusweises beraubt wurde: „Wir waren de-nen, die wir bekämpfen wollten, sehr ähn-lich und sind ihnen wohl immer ähnlichergeworden.“ Aus der Zelle rief sie zur Auf-lösung der Linksguerrilla auf.
Ein Gnadenverfahren für die reuige Ge-fangene gilt den einstigen Jägern der Ter-roristen als „Selbstläufer“. Der zuständige
AP
Abteilungsleiter der BundesanwaltschaftVolkhard Wache glaubt nicht, daß von denehemaligen Staatsfeinden noch eine Ge-fahr ausgeht. Bei keinem der schon entlas-senen RAF-Häftlinge gebe es „bisher einenAnlaß, über einen Widerruf der Ausset-zung der Strafe überhaupt nachzudenken“.
Solch wohlwollende Reaktionen, klagtdie Hogefeld-Anwältin Ursula Seifert,nützten ihrer Mandantin wenig. Denn imgleichen Atemzug würde sie mit dem be-dauernden Hinweis vertröstet, für ein Gna-dengesuch oder auch nur Hafterleichte-rungen sei die Knastzeit noch zu kurz.
Die rot-grüne Regierung möchte offen-sichtlich eines der schlimmsten Kapitel derbundesdeutschen Geschichte allein durchdie Justiz abwickeln lassen. Kanzler Ger-hard Schröder, der einst RAF-GründerHorst Mahler verteidigte, und Innenmini-ster Otto Schily, der in Stammheim die er-ste Generation der Politdesperados ver-trat, schweigen beharrlich.
Dagegen plädiert einer, der schon An-fang der Neunziger, als die Terroristen nochbombten, eine Versöhnung zwischen RAFund Staat anregte, für „Großzügigkeit“ imUmgang mit den RAF-Gefangenen. „Siehaben gebüßt“, sagt FDP-Mann Klaus Kin-kel, damals Justizminister, angesichts derlangen Haftdauer und der geübten Reue,„nun sollten sie auch behandelt werdenwie alle anderen.“ Gerd Rosenkranz

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

62
Deutschland
Pfleg
S T R A F J U S T I Z
„Das ewige Weinen und Jammern“In Stuttgart stehen Eltern unter Mordanklage vor Gericht. Ihre eigenen Kinder
versorgten sie gut. Eines ihrer Pflegekinder starb an Unterernährung. Sie wollen seinen hochgefährdeten Zustand nicht bemerkt haben. Von Gisela Friedrichsen
ößler, Pflegekinder: Eine Musterfamilie?
Tatort in Weinstadt-BeutelsbachAbends Wasser und Brot
R.
KW
IOTEK
/ Z
EIT
EN
SPIE
GEL
ekind Alexander: Der Fünfjährige wog zuletzt 7,2 Kilo
FO
TO
S:
RTL E
XPLO
SIV
Ein Kind ist verhungert.Nicht in Somalia oder aufder Flucht im Kosovo. Es
ist zugrunde gegangen in einemOrt in der Nähe von Stuttgart.
Als er am 27. November 1997starb, war der fünf Jahre alteAlexander ein welkes, extremvergreistes Knochenbündel mittief eingesunkenen Augen, ge-rade noch 7,2 Kilo schwer. Daswiegen gesunde Kinder im Alter von etwa einem halbenJahr.
Dem sechsjährigen BruderAlois ging es, als Alexanderstarb, nur wenig besser. Auch erwar abgemagert auf gotterbärm-liche 10 Kilogramm, was dem Durch-schnittsgewicht eines gesunden Einjähri-gen entspricht. Ein dritter Junge, An-dreas, neun Jahre alt und nur 104 Zen-timeter groß, wog 11,8 Kilo. Alexander,Alois und Andreas lebten als Pflegekinderder Familie Rößler in Weinstadt-Beutels-bach.
Man möchte nicht wahrhaben, daß Men-schen so umgehen können mit Kindern.Man bringt diesen Gedanken nicht übers
Ehepaar R
Herz. Man ringt mit sich um eine Er-klärung, die zugänglich macht, wie so et-was geschehen kann. Man hofft zu erfah-ren, die Pflegeeltern seien nicht bei Sinnenoder hoffnungslos überfordert gewesen,oder das Kind habe an einer Krankheit ge-litten, die nicht rechtzeitig erkannt wer-den konnte. Nichts davon. Der Fall treibtdie Menschen um.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ehe-paar Klaus und Ulrike Rößler Mord durch
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Unterlassen aus Habgier und MißhandlungSchutzbefohlener vor. Sie hätten die Kin-der nicht ausreichend mit Nahrung undFlüssigkeit versorgt und sie nicht einemArzt vorgestellt. Denn dann wären ihnendie Kinder weggenommen worden, und siehätten nicht mehr die Zuwendungen desStaates (insgesamt 3265 Mark im Monat)für sich und ihre drei eigenen Kinder ver-wenden können.
Das Entsetzen überwältigt. Daß Kinderleiden, wenn die Erwachsenen mit dem Le-ben nicht fertig werden – es ist traurig, abernicht unbegreiflich. Doch hier haben ein 39Jahre alter Mann und eine 33 Jahre alteFrau genau unterschieden zwischen ihreneigenen Kindern, die gepflegt und versorgt
wurden, und den drei Pflegekindern, diesie verkommen ließen.
Bei den Jugendämtern schätzte man dieRößlers als Musterfamilie. Die Frau vomFach, ausgebildet als Kinderpflegerin; derMann, Heizungsbauer mit Abitur, dannZeitsoldat, studierte Waldorfpädagogikund begann schließlich mit Sozialpädago-gik. Warum nur sind sie mit Alexander,Andreas und Alois so umgegangen?
Die zwei älteren leiblichen Kinder desPaares, heute 13 und 12 Jahre alt, hattenZimmer mit Teppichboden, Computer undMusikanlagen, ein Pferd, ein Pony, Hundund Katze. Sie bekamen Pizza, Nutella,Obst und alles, was Kinder mögen undbrauchen. Der Jüngste, ein Baby aus eineraußerehelichen Beziehung der Pflegemut-

Werbeseite
Werbeseite

Deutschland
ter, war wohlgenährt und ständig unterärztlicher Kontrolle.
Die Pflegekinder aber mußten in einemspärlich möblierten Raum hausen, in demdas Licht nicht funktionierte und der Rol-laden meist herabgelassen war. Für sieblieb die Küche abgeschlossen wie im bö-sen Märchen. Am Abend, als Alexanderstarb, so berichtete einer der Jungen, habees Wasser und trockenes Brot gegeben.Vor-sorge-Untersuchungen unterblieben, seitdie Jungen bei Rößlers lebten.
In dieser Strafsache zu verteidigen isteine Last. Der Verteidiger der angeklagtenFrau, Manfred Künzel, rennt gegen diese
Last an. Er spricht von einem „Fall gren-zenloser Rechtsauslegung“: „Ich kennekeine Frau, die selbstloser und verantwor-tungsbewußter ist als meine Mandantin.“
Künzel hat in Stuttgart einen Ruf. Sei-netwegen, er war Pflichtverteidiger GudrunEnsslins, wurde 1977 im Baader-Meinhof-Prozeß der Senatsvorsitzende TheodorPrinzing erfolgreich wegen Besorgnis derBefangenheit abgelehnt. Die „Vertrauens-anwälte“ Schily, von Plottnitz und wie siealle hießen, hatten dies nicht geschafft.
Der Prozeß gegen die PflegeelternRößler begann fast am ersten Jahrestagvon Alexanders Tod, am 25. November
64
1998, und war für elf Tage angesetzt. Daßnoch immer verhandelt wird, ist auf Kün-zels Aktivität zurückzuführen. Ist sein En-gagement von Vorteil für die Mandantin?
Der kleine Alexander, sagt Frau Rößler,habe abends blaß ausgesehen und sich eis-kalt angefühlt.Tagsüber sei es hektisch ge-wesen, der eigene Sohn habe eine Prüfunggehabt und der Hund Durchfall. Sie habegegen 19 Uhr ihren Mann angerufen, weilAlex ihr „komisch“ vorgekommen sei. IhrEhemann habe sich mit dem Jungen aufdessen Wunsch ins Elternbett gelegt, dasKind habe um ein Leberwurstbrot gebetenund um Milch aus der Babyflasche. Sie
habe sich Sorgen gemacht, ob dies nicht et-was zu viel und durcheinander sei.
Nach 23 Uhr bringt Frau Rößler Alexzweimal zur Toilette. Der Bauch sei ge-bläht gewesen. Auf der Toilette habe sichAlex plötzlich nach hinten überstreckt, dieAugen verdreht, den Kiefer verkrampftund die Zähne aufeinander gebissen. IhrMann habe ihn dann beatmet. Erst um 0.44Uhr wurde der Notarzt verständigt.
Es sei keine Böswilligkeit gewesen, daßsie den Zustand des Kindes nicht richtig er-kannt habe, sagt Ulrike Rößler. Gegenüberdem Psychiater Dietrich Netzold von derTübinger Uniklinik weist sie den Vorwurf,
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
sie habe dabei zugeschaut, wie Alex ver-hungerte, als „absurd und schwachsinnig“von sich. Sie hätte doch nicht „ihre Geld-quelle verhungern lassen“.
Alexander konnte kaum noch sprechen,sich kaum noch rühren. Das will die Kin-derpflegerin und dreifache Mutter nicht„richtig erkannt“ haben? In der Nacht, alsalle Bemühungen der Notärzte nicht mehrhalfen und Alexander starb, kam die Poli-zei. Die Pflegeeltern wurden verhaftet.
Die Ermittlungen ergaben, daß das Ehe-paar Rößler zeitweise bis zu acht Kinder imHaus hatte, denn es wurden auch noch Tagespflegekinder aufgenommen. Ulrike
Rößler, die von einer Schar fröhlicher Kin-der zur Aufhellung ihrer Stimmung träum-te, wuchsen die Probleme über den Kopf.Der Ehemann brach das Waldorfstudiumab; die Ehe funktionierte nicht mehr. Erhielt sich aus dem Alltagschaos heraus.Sie erwartete ein Kind von einem an-deren.
Haben die Rößlers ihre Pflegekindernicht mehr bemerkt? Andreas lief einmalnachts von zu Hause weg, er wollte in ei-ner Gaststätte etwas zu Essen haben.Manchmal durchwühlte er Mülleimer.Selbst faulige Äpfel sammelte er vom Bo-den und stopfte sie in sich hinein.

Was hat die monatelange Hauptver-handlung gebracht? Klaus Rößler wird in-zwischen kaum noch wahrgenommen. SeinVerteidiger läßt ihn durch Stillhalten na-hezu von der Bühne verschwinden. Im Mit-telpunkt steht die Mutter, die Goldblonde,die ihr langes Haar schwungvoll nach hin-ten wirft und verbindlich lächelt. Sie istunbegreiflich und unfaßbar wie zu Beginn.
Verteidiger Künzel aber kennt keineFrau, die selbstloser und verantwortungs-bewußter sei als seine Mandantin. Und sorebelliert er auch gegen die Gutachten, dieder Sachverständige Netzold über die An-geklagten vorlegt. Netzold hält beide für
voll verantwortlich. Er übersieht in seinenGutachten die Belastungen des Ehepaaresnicht. Er spricht von einer „latenten Über-forderungs- und Überlastungssituation“der Mutter und findet Züge einer „kind-lich-retardierten Persönlichkeit“ bei ihr.Beiden Angeklagten wird auch zugute ge-halten, daß die Pflegekinder, als sie in dieFamilie kamen, verhaltensgestört waren.
Künzel diskutiert nicht mit diesem Sach-verständigen. Dabei wären durchaus Ein-wände, Anregungen und Fragen zu Net-zolds Gutachten vorzubringen. „Bewußtund in gewolltem Zusammenwirken“ sol-len die Rößlers gehandelt haben. Bewußt?
Diskutieren ist Künzels Sache nicht. Erbringt als präsentes Beweismittel HannaZiegert, 46. Sie ist laut Briefkopf Fachärz-tin für Neurologie und Psychiatrie,Fachärztin für psychotherapeutische Me-dizin, Supervisorin und Lehranalytikerin.Zur Kritik an ihrer indirekten Mitwirkungam Prozeß gegen den Mörder der kleinenNatalie in Augsburg (SPIEGEL 51/1997)schrieb sie in einem Brief: „Ich bin derMeinung, daß allein die sorgfältige und um-fangreiche Aufklärung, die nur verbundensein kann mit einem einfühlsamen Einge-hen auf die Straftäter, letztendlich zurPrävention von Straftaten und zu einem
wirksamen Opferschutz führen kann.“ Dasleuchtet ein.
Aber dann muß erklärt werden, warumein „einfühlsames Eingehen“ nötig ist undwarum man dafür wirbt.Als zwei Deutscheim US-Staat Arizona hingerichtet wurden,diskutierten die deutschen Medien wiedereinmal kritisch die Todesstrafe. Die Reak-tion vieler Leser, Hörer und Zuschauer:Da werde wieder einmal deutlich, daß esbei uns viel zu viel um die Täter und zu we-nig um die Opfer gehe.
Einem Sachverständigen darf vor Ge-richt die kriminalpolitische Großwetterla-ge nicht gleichgültig sein. Das Bemühen
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
um den Täter bedarf heute mehr denn jeder Begründung, schon aus Rücksicht aufdie Gefühle der Opfer. Frau Ziegert aberhält es für selbstverständlich, daß mit demTäter einfühlsam umzugehen ist. Ihr Gut-achten über Ulrike Rößler ist in einer Zei-tung „befremdend“ genannt worden. ImPublikum löste es Empörung, unter denmeisten Verfahrensbeteiligten Zorn aus.
Über zehn Jahre, so Frau Ziegert, habeUlrike Rößler als Kind unter Blasenkrank-heiten gelitten. Heute habe sie keine Erin-nerung mehr an den Schmerz, der ihr inder Behandlung zugefügt wurde – sie habealso ihre Gefühle weggeschoben: „Das ist
der entscheidende Aspekt für die Tat.“Denn: „Ein dreijähriges Kind ist hilflos ge-genüber den Manipulationen der Ärzte.Auch Untersuchungen sind Mißhandlun-gen, sie werden von einem Kind so ver-standen.“
Der Vorsitzende Richter, Martin Krau-se, 60, schaltet sich ein: „In den Arzt-berichten steht doch eindeutig, daß einkörperlicher Defekt bestand. Ich sehe daeine normale Heilbehandlung.“ DerStaatsanwalt rügt, Frau Ziegerts Aus-führungen beruhten auf zuviel Vermu-tungen und Phantasien. Ziegert unbeirrt:Subjektiv fühle sich Frau Rößler mißhan-
65

Deutschland
Sachverständige ZiegertWiderstand zuhauf provoziert
AR
GU
M
delt, ihre Reaktion darauf sei eben Rea-litätsverlust.
Hanna Ziegert wird gefragt, um welchePersönlichkeitsstörung es sich bei FrauRößler handeln soll. „Sie wollen die Scha-blone!“ Frau Ziegert richtet sich auf. „Also:eine depressive Störung. Das geht in Rich-tung Borderline. Aber das sind Fachdis-kussionen, die hier nicht helfen.“
Der Vorsitzende versucht, wieder zuklären: „Hat sie wahrgenommen, daß dieKinder unterernährt waren?“ Ziegert:„Natürlich. Dieses ewige Weinen und Jam-mern. Bei dem Zustand der Kinder.“ DerVorsitzende: „Da Sie ja juristisch konfir-miert sind“ – Herr Ziegert ist Strafvertei-diger in München –, „wissen Sie, daß wiruns an dem Begriff ,unbewußt‘ stören.Wenn eine Mutter ein Kind vors Autostößt, tut sie das doch nicht unbewußt.“Frau Ziegert: „Eine Mutter hat Liebe undHaß zugleich in sich.Wir können ohne wei-teres ein Kind lieben und es vors Autostoßen.Wir können den Ehepartner liebenund ihn trotzdem ärgern.“ Der Vorsitzen-de: „Das ist aber doch was anderes!“
Für Frau Ziegert ist die Angeklagte we-gen fehlender Einsichtsfähigkeit schuld-unfähig oder zumindest wegen einge-schränkter Steuerungsfähigkeit vermindertschuldfähig. Es läßt sich nicht fixieren, wasdas begründen soll. Ziegerts Ausführungengleichen einer Flutwelle, die wegspült, wasan Fragen vorgebracht oder schließlich garnicht mehr vorgebracht wird.
Frau Ziegert ist nicht zuletzt Psycho-analytikerin. Wilfried Rasch, der emeri-tierte Nestor der Gerichtspsychiatrie, be-schrieb einmal die Chancen und die Gren-zen der Psychoanalyse vor Gericht: „Woeinzelne Psychoanalytiker sich als Gut-achter in die Gerichtssäle wagten, war ihrScheitern vorprogrammiert, weil sie dieSpielregeln des Systems nicht kannten odermeinten, das Strafrechtssystem vom Ein-zelfall her revolutionieren zu können …Bis heute wirkt in die Auseinandersetzungüber die Schuldfähigkeit im Gericht diemagische Bedeutung hinein, die dem Un-bewußten“ – von ihnen – „zugemessenwird. Der theoretische Frontalangriff derPsychoanalyse auf die sonstige Begutach-tungspraxis und die mit ihm verbundeneExkulpation war sozusagen zwangsläufiggeeignet, Widerstände zu erzeugen.“
Frau Ziegert hat Widerstand zuhauf pro-voziert. Nur angedeutet kann werden, inwelcher Manier sie die Juristen und die Öf-fentlichkeit überfordert. Nicht bewußt sollder Pflegemutter gewesen sein, wie es umdie Gesundheit der Kinder stand, konsta-tiert sie. Wozu aber hat Frau Rößler dannLegenden erfunden, die Kinder seien durchalkoholkranke Mütter erblich geschädigt,hätten epileptische Anfälle, Eßstörungenund so fort? Von Sommer 1997 an wurdendie Kinder nicht mehr draußen gesehen.Kam jemand zu Besuch, lagen sie in ihrenBetten, die Decke bis zum Haaransatz
d e r s p i e g e66
hochgezogen, die Gesichter zur Wand ge-dreht. Den Eheleuten muß bewußt gewe-sen sein, was der Anblick der Kinder aus-lösen mußte – blankes Entsetzen.
Das Jugendamt habe Frau Rößler im Stichgelassen, brachte Ziegert vor. Doch die Angeklagte hat nach außen brillant das Ge-fühl vermittelt, allem gewachsen und die be-ste aller Pflegemütter zu sein. Die Jugend-ämter werden nach diesem Menetekel zuprüfen haben, ob die Begleitung von Pfle-geeltern nicht intensiviert werden muß.
Vergangenen Mittwoch wurde noch ein-mal der Sachverständige gehört, der die Kin-
der untersucht hat. Verteidiger Künzelbemühte sich erfolglos, ihn wegen Besorgnisder Befangenheit abzulehnen. Er fügte einWort in eigener Sache hinzu – nun entdecktman, worin sein Überengagement auch wur-zelt: Das Ehepaar Künzel hat ein Adop-tivkind. Es bereitete seinen Eltern offenbareinige Sorgen. Stundenlang habe seine Frauam Eßtisch gesessen und gewartet, daß dasKind etwas zu sich nehme, erzählt der Ver-teidiger dem Gericht. Am nächsten Tag seiman gleich zum Kinderarzt gegangen.
Da rutscht der NebenklagevertreterinHeidi Riediger der einzige angebrachteSatz heraus: „Darum sitzen Sie hier ja alsVerteidiger und nicht als Angeklagter!“ Indieser Woche soll plädiert werden. ™
l 1 8 / 1 9 9 9

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Deutschland
70
Deutscher Protest in
K O S O V O - K R I E G
„Ich bin im falschen Film“Ein Trupp deutscher Kriegsgegner protestierte in
Belgrad gegen das Bombardement durch die Nato. Doch die Friedensfreunde waren untereinander heftig zerstritten.
Sichtlich irritiert blickt das Begrü-ßungskomitee vor der Zentrale desRoten Kreuzes in der Belgrader
Straße Ulica Francuska auf die Ankömm-linge aus dem fernen Feindesland. Die Män-ner und Frauen, die zum Teil ein wenig steifaus zwei klapprigen Ikarus-Bussen steigen,entsprechen nicht ganz den Erwartungen,die sich die serbischen Funktionäre von ei-ner Delegation deutscher Friedenskämpfergemacht haben.
Grauhaarige Damen beginnen sofort mitden neugierig stehenbleibenden Passanten
FO
TO
S:
C.
GIE
SE /
TR
AN
SIT
Zerstörte Zentrale der sozialistischen
Belgrad: „Gehört der überhaupt zur Gruppe?“
zu radebrechen. „Wir Deutsche – aber wirgegen den Krieg.“ Zwei Punks aus Berlin,mit bunten Frisuren und Springerstiefeln,entrollen ein Transparent mit der Forde-rung „Peace now“. Ein hochgeschossenerMann mit Baskenmütze zerrt ein riesigesGesteck roter Nelken – eine Gabe der DKPSachsen – aus der Gepäcklade und fragt ei-nen Dolmetscher: „Wissen Sie, wo das Par-tisanendenkmal ist?“
Mit leicht singender Stimme und sanfterRoutine beantwortet Ilona Rothe, 49,Initiatorin der Erfurter Gruppe „Müttergegen den Krieg“, die Fragen der jugosla-wischen Reporter: „Wir haben unsere Söh-ne nicht geboren, damit sie später im Krieg
umkommen. Da sind wir deutschen Mütteruns mit den serbischen einig.“
Im Amtszimmer von Bratislava Morina,der Vorsitzenden des staatlichen Frauen-verbandes, ist Präsident Slobodan Milo∆eviƒgleich dreimal anwesend – milde lächelndauf dem obligatorischen Wandbild, verson-nen auf einem goldgerahmten Schreib-tischfoto, grimmig auf einem Poster an derTür. Morina, eine Blondine mit hochtou-piertem Haar und üppigem Goldschmuck,heißt die deutschen Kriegsgegner willkom-men. Sobald ein paar Artigkeiten über die
Notwendigkeit des Frie-dens ausgetauscht sind,kommt sie zur Sache:„Wir lieben unseren Prä-sidenten Milo∆eviƒ. Esgibt keine Meinungsver-schiedenheiten in diesemLand, das wir bis zumletzten Blutstropfen ver-teidigen werden.“
Einige der deutschenFriedensfahrer klatschenbegeistert, andere schau-en beklommen zu Bo-den. „Uns bedrücktauch, was Ihre Soldaten
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
im Kosovo tun“, wirft Ilona Rothe ein.Michael Fiebig, 22jähriger Student der Ge-schichte und Sozialkunde aus Jena, faßtsich ein Herz: „Meiner Meinung nach istdie Flucht von einer Million Albaner ausdem Kosovo die Folge der serbischen Ver-treibungspolitik.“
Ein Aufschrei der Empörung. „Wer istdas? Gehört der überhaupt zu unsererGruppe?“ Der blasse junge Mann verläßtden Raum. Unten im Bus, in den er sichzurückgezogen hat, kontrollieren drei ser-bische Polizisten seinen Paß.
Auf dem Hof des schwarzgrauen Hau-ses, dessen Fenster wie überall in Belgradmit dicken Papierstreifen gegen die Druck-wellen der Bomben verklebt sind, stehtAnne Arnold aus Radebeul. Sie trägt denalten DDR-Aufkleber „Schwerter zu Pflug-scharen“ am Anorak. „Ich hab’ gedacht,ich bin im falschen Film“, sagt sie fas-sungslos, „diese Einseitigkeit in der Grup-pe habe ich nicht erwartet.“
In der Belgrader Rotkreuzzentrale brichtder seit der Abfahrt aus Deutschlandschwelende Meinungskrieg im „Konvoi fürden Frieden“ offen aus. Was die 133 Teil-nehmer der von den Erfurter Müttern undzwei Friedensinitiativen aus Chemnitz undDresden organisierten Antikriegsaktioneinte, war der gemeinsame Wunsch, „demKrieg von oben Druck von unten“ entge-
genzusetzen – und zwarvor Ort, in JugoslawiensHauptstadt Belgrad.
Doch schon beimStart der Friedens-Odys-see auf einem Parkplatzhinter dem DresdnerHauptbahnhof ist davonkeine Rede mehr. Manwolle, verkündet LotharHäupl von der DresdnerGruppe „RevolutionärerFreundschaftsbund“, lie-ber in Italien gegen dieNato demonstrieren.Der Grund: Trotz wo-chenlanger Bemühungenhaben die Jugoslawenden Friedensfreundenaus der Bundesrepublikkeine Visa ausgestellt.
„Wir wollen nichtnach Mailand“, rebellie-ren die meisten Prote-Partei

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Deutschland
äupl, Rothe: Lieber nach Mailand
stanten, „wir wollen nach Belgrad. Das Vi-sum werden wir erzwingen.“ Drei mit Frie-denstauben und Transparenten beklebteBusse setzen sich schließlich in Bewegung– Richtung Osten, via Prag und Budapestgen Belgrad.
An der Grenze zu Tschechien müssendie Antikriegsaktivisten auf die erste Mit-streiterin verzichten: Eine Friedensfreun-din aus der ehemaligen DDR hat nur ihren alten Hammer-und-Zirkel-Paß dabei.„Wieso“, wundert sich die Frau, „der giltdoch noch bis 2006?“
In den Bussen entlädt sich die Nervositätin lautem Gelächter.Am meisten amüsierensich die Ostdeutschen, die mehr als dreiViertel der Teilnehmer stellen,unter ihnen PDS-Rentner,ehemalige DDR-Kader, Haus-frauen, aber auch eine Gruppewandernder Handwerker, diemit ihrer „Aktion Kelle“ zer-bombte Häuser reparierenwollen, und der schwerstbe-hinderte sächsische PDS-Land-tagsabgeordnete Uwe Adam-czyk, der sich nur im Rollstuhlfortbewegen kann.
Sigrid Blanke aus Weimar,Mutter zweier erwachsenerTöchter, ist politisch über-haupt nicht organisiert. Siefühlt sich „als gebranntes Initiatoren H
„Konvoi“-Teilnehmer in Budapest: „Bei Gefahr
74
Kind“ der DDR. „Man hat uns so oft be-logen. Ich glaube nur noch, was ich mitmeinen eigenen Augen sehe. Deshalb habeich mich zum Konvoi angemeldet.“
Kersten Machnik, 41, arbeitsloser Tier-pfleger aus Finsterwalde, will auf dem Tripseine Angst überwinden, aber auch „demJoschka zeigen, daß nicht alle Grünen denKriegskurs mittragen“.
Ein zierlicher Mann mit Schiebermützeist mit 81 Jahren der Nestor der Friedens-bewegten. „Ich kenne den Krieg aus eige-ner Erfahrung, Scharping und Fischer nuraus Erzählungen. Ich habe die Bomben aufDresden noch nicht vergessen“, sagt ergrimmig. Seinen Namen möchte der Frie-
d e r s p
einhaken“
denskämpfer allerdingsnicht nennen: „Ich bin einAltstalinist und stolz dar-auf, ich stehe zu meinerBiographie.“
Zur Minderheit derWestdeutschen gehörtHarald Pflüger aus Neu-münster, der seine 13jäh-rige Tochter Laura dabeihat. Pflüger beobachtet die gruppendynamischenProzesse im Bus, wo „dieNerven blank liegen“, mitGelassenheit: „Hier laufendie Rituale von vor 20 Jah-ren ab.“
Die Alt-Achtundsech-ziger und Veteranen derwestdeutschen Friedens-bewegung haben den Ossisgewisse Erfahrungen vor-aus. Pablo Rondi, Kauf-mann aus Hamburg underprobter Streiter gegendas Atomkraftwerk Brok-dorf, versorgt die Konvoi-Teilnehmer per Bus-Mi-krofon mit wertvollen Rat-schlägen: „Bezugsgruppenbilden, Namen auswendiglernen, Frauen sollten keinMake-up tragen, bei Ge-fahr einhaken.“ Bravschreiben sich die Konvoi-
i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Teilnehmer die Handy-Nummer einesHamburger Anwalts auf den Unterarm. Ei-nen Zettel kann man schließlich verlieren.
Nach achtstündigem Warten vor der ju-goslawischen Botschaft in Budapest erhal-ten die Friedenstouristen das heißersehn-te Visum. Das ist die gute Nachricht. Dieschlechte: Die Chemnitzer Busfahrer wei-gern sich wegen der Versicherung, insKriegsland Jugoslawien zu fahren.
Erneut bricht Streit aus. Kann ein Pazi-fist in einen serbischen Bus steigen? Wer-den wir nicht „die fünfte Kolonne Bel-grads“? Der Konvoi spaltet sich: Eine klei-ne Gruppe bleibt mit Pablo Rondi („Ichlasse mich nicht instrumentalisieren“) aufungarischem Territorium zurück, währenddie große Mehrheit mit Transparenten,Schlafmatten und Rucksäcken bei strö-mendem Regen um Mitternacht die Gren-ze zu Fuß überquert und drüben in bereit-stehende einheimische Busse steigt.
Im Hotel Patria in Subotica (175000 Ein-wohner) werden die Deutschen um 6.15Uhr morgens vom Bombenalarm aus demSchlaf gerissen. Ganz still und in sich ge-kehrt versammeln sie sich im Foyer. Es istdie Stunde der Alten, die den Jungen vonden Bombennächten des Zweiten Welt-kriegs erzählen können.
Auch in Belgrad hören sie, während einer hastigen Sightseeing-Tour zu den zerbombten Gebäuden, die Sirenen heulenund wundern sich darüber, wie die Men-schen „einfach so weiterleben“. Auf einerKundgebung am total zerstörten Fernseh-sender mitten im Zentrum neben der ehr-würdigen Sveti-Marko-Kirche können diedeutschen Demonstranten dann end-lich mit den „ganz normalen Bürgern“ reden. Auch eine Frau der verfemten ju-goslawischen Friedensgruppe „Mütter inSchwarz“ begrüßt Konvoi-Teilnehmerin-nen. Es gibt Tränen, Umarmungen und so-gar Maiglöckchensträuße für die Deut-schen. „Es macht uns Mut, daß es auch sol-che Deutsche gibt“, sagt die Lehrerin DesaDa‡iƒ gerührt.
Nachmittags um fünf ist die Friedens-mission abrupt zu Ende. „Die Armee hatdie Visa für ungültig erklärt“, verkündetLothar Häupl, „die Regierung kann für un-sere Sicherheit nicht mehr garantieren.“Die murrenden Kriegsgegner, die eigentlicham Abend gemeinsam mit den Belgradernauf der großen Donaubrücke demonstrie-ren wollten, werden in die Busse kompli-mentiert. Eine Polizei-Eskorte begleitet siezurück zur Grenze.
Im Durcheinander des Aufbruchs findendie Genossen von der DKP doch noch einPlätzchen für ihre roten Nelken. Zwarnicht am Monument für die im Kampf gegen den Hitler-Faschismus gefallenenPartisanen, aber dafür vor dem Reiter-standbild des Fürsten Mihailo am Platz der Republik. Der hatte im vorigen Jahr-hundert wenigstens gegen die Türkengekämpft. Almut Hielscher

Geflüchtete Kosovo-Albanerin Merovci, Sohn Albion: Hoffen auf die Hilfe des Bruders in Ham
F L Ü C H T L I N G E
„Ich liebe Deutschland“Obwohl die Deutschen ihr Aufnahmekontingent erfüllt
haben, wächst der Druck, weitere Kosovaren ins Land zu lassen.Bund und Länder streiten über Kosten und Kompetenzen.
Wochenlang hatten die Brüder Be-kim, Naser und Ramadan Oraninichts von ihren Verwandten im
Kosovo gehört, dann klingelte Anfang Aprildas Telefon bei Bekim, 23. „Als unser Va-ter anrief“, sagt der Malergeselle aus Hei-delberg, „war das wie eine Wiedergeburt.“
Seit dem Telefonat versuchen die Brü-der, ihre Eltern, die vor den Serben ausihrem Dorf Grjilane über die mazedoni-sche Grenze flüchteten, nach Deutschlandzu holen. Doch die Ausländerbehörden inHeidelberg und im Rhein-Neckar-Kreisverweigerten ihre Zustimmung zu einemBesuchervisum, obgleich die Oranis einesogenannte Verpflichtungserklärung abge-ben wollten, daß sie für Unterkunft undVerpflegung der Eltern aufkämen.
Was vor dem Kosovo-Krieg unproble-matisch war, ist nun fast unmöglich.„Flüchtlinge sind kein Fall für ein Besu-chervisum“, sagt der baden-württember-gische Innenminister Thomas Schäuble,„das sind schließlich Gäste ohne Rück-kehrmöglichkeit“.
Bei Kriegsausbruch war dies gemeinsameLinie von Bund und Ländern. Konsequenthatten die Innenminister ihre Ausländer-behörden angewiesen, die nach dem Aus-ländergesetz notwendigen Verpflichtungs-erklärungen nicht anzunehmen, ja nichteinmal mehr die dafür notwendigen For-
mulare auszugeben. Noch am 6. April ver-pflichtete Bundesinnenminister Otto Schi-ly die Länder-Innenminister auf die ge-meinsam in einer Schaltkonferenz erarbei-tete restriktive Linie. Das Auswärtige Amt(AA) wurde aufgefordert, auch die Visa-Er-teilung an Serben aus Gründen der politi-schen Opportunität sofort zu beenden.
Doch jetzt, über 40 Kriegstage undknapp 5000 Nato-Angriffsflüge später, zer-bröselt die starre Haltung unter dem Druckder Basis von SPD und Grünen. Die Frage,wie – wenn denn schon weitergebombtwerden müsse – der humanitären Kata-strophe im Krisengebiet zu begegnen ist,treibt einer typisch deutschen Antwort zu:Es wird kleinkariert um die Kosten ge-stritten, um Schuldzuweisungen an dieNato-Partner, die, anders als die Deut-schen, ihre Hilfsangebote noch längst nichteingelöst haben, und letztlich immer dar-um, wie viele neue Flüchtlinge die Bun-desrepublik denn verkraften will und kann.
Was die Diskussion, bei der die Argu-mente ganz nach politischem Standort hin-und hergeschoben werden, nicht über-sichtlicher macht: Jeder hat auch einbißchen recht – und ein bißchen unrecht.
Bei Ausbruch des Kosovo-Kriegs fürch-teten Bund und Länder Folgen wie im Bosnienkrieg, der 1992 begann: Damalswollte die Bundesrepublik rund 10 000
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Flüchtlinge aufnehmen, dankgroßzügiger Nachzugs- undVisa-Regelungen fandenschließlich 350 000 BosnierZuflucht in Deutschland.
Unter den 54000 Bosniernin Baden-Württemberg, be-richtet Schäuble, sei ein „re-lativ hoher Anteil an Be-suchern“ gewesen, da in den Industriestandorten vieleGastarbeiter lebten. Sie ludenihre Verwandten ein, viele erklärten aber nach einerWeile, die Kosten nicht mehrtragen zu können. Daraufhinhabe das Land auf Einhaltungder Kostenübernahme ge-klagt, sei aber gescheitert.Schäuble: „Die Gerichte be-scheinigten den Gastgebern,nach einigen Monaten sei esunzumutbar, weiter für ihreBesucher aufzukommen.“
Also, folgert der Hardliner(„Ich stehe weiter aufrecht“),
seien die Verpflichtungserklärungen ledig-lich „Vereinbarungen von relativem Wert“– und deshalb erst gar nicht zu akzeptieren.
Sein thüringischer Kollege Richard Dewes (SPD) hält dagegen „die Linie, diewir bisher gefahren sind, für falsch“. DieWeigerung Frankreichs und Großbritan-niens, Kosovo-Flüchtlinge aufzunehmen,sei zwar „eine Affenschande“. Doch dieFlüchtlinge „gegenüber anderen Ländernzu instrumentalisieren“ habe „mit sozial-demokratischer Ethik nichts zu tun, unddie ändert sich auch nicht, nur weil wirjetzt die Bundesregierung stellen“.
Dewes kann sich inzwischen vorstellen,„bis zu 200000 Kosovaren“ in die Bundes-republik zu holen – mit Hilfe ihrer hier lebenden Einladenden, aber auch mit Unterstützung von Bundesbürgern. Eben-so wie der saarländische InnenministerFriedel Läpple (SPD) plädiert er in sol-chen Fällen für eine Teilung der Kostenzwischen den Angehörigen und dem Sozialamt, zudem sei eine Risikoüber-nahme durch den Staat für Krankheitsfäl-le denkbar.
Damit prescht Populist Dewes, der imHerbst Wahlen zu bestehen hat, weiter vorals die Bundesregierung selbst. SchilysStaatssekretär Claus Henning Schapperplädierte in zwei Schaltkonferenzen ledig-lich für eine bedingte Aufgabe der altenPosition. Die Länder sollten nur in huma-nitären Fällen – die über das allgemeineVertreibungsschicksal hinausgehen – einBesuchervisum ausstellen.
Zwei Bonner Konditionen mochten dieLänder nicht akzeptieren: Der Bund, derbei den Kontingentflüchtlingen 500 Markder monatlichen Kosten trägt, verweigertdarüber hinaus jedes finanzielle Engage-ment. Und auch bei der Auswahl der Ein-zuladenden wollte er sich heraushalten. Die
burg
M.
MATZEL /
DAS
FO
TO
AR
CH
IV
75

fnahmeländer für Kosovo-Flüchtlinge
USA 20 000 0
Türkei 20 000 5665
eutschland 10 000 9974
ßbritannien einige Tausend 330
Spanien einige Tausend 208
Norwegen 6000 1888
Rumänien 6000 0
riechenland 5000 0
Kanada 5000 0
Österreich 5000 976
Schweden 5000 444
Australien 4000 0
Kroatien 3000 188
Schweiz 2500 33
Niederlande 2000 1011
Portugal 2000 0
Slowenien 1600 0
Dänemark 1500 0
Belgien 1200 848
Finnland 1000 481
Irland 1000 0
Polen 1000 635
Tschechien einige Hundert 115
Frankreich keine Quote 1922
Israel offen 106
Bulgarien offen 0
Lettland offen 0
sonstige ca. 2000 23
GESAMT ca. 115 000 24 847
bisherigeAUFNAHME
AUFNAHME-ANGEBOTLAND
lle: UNHCR, Stand: 29. April 1999
Deutschland
ager in Mazedonien
DPA
Au
D
Gro
G
Que
Ausländerbehörden in Deutschland solltenbeurteilen, welchem Kosovaren in denFlüchtlingslagern es besonders schlechtgeht– ohne ihn je gesehen zu haben.
Die widerspenstigen Länder („Das istNötigung“) verwiesen darauf, daß eine sol-che Regelung Humanität zur Ware mache,da zumeist nur Flüchtlinge mit wohlha-benden Angehörigen eine Chance hätten.Zudem sei ein Zuzug außerhalb der Kon-tingente nicht mehr zu steuern. Die Flücht-linge mit Besuchervisa könnten ja nichtnach dem gültigen Schlüssel auf die Länderverteilt werden wie die Kontingent-flüchtlinge, sondern kämen dahin,wo schon jetzt die meisten der rund350000 in Deutschland lebenden Ko-sovo-Albaner eine Heimat gefundenhätten.Auch sei gar nicht abzusehen,wie viele Kosovo-Albaner so nachDeutschland kommen könnten. (DieSchätzungen schwanken zwischen10 000 und 50 000 Einladungen.)Lockere man die Regeln, fürchtetSchäuble, dann suche sich der Flücht-lingsstrom „wie das Wasser seinenWeg“.
Während die Deutschen unterein-ander und mit ihren Nato-Partnernüber Kontingente streiten, droht inMazedonien eine Katastrophe. Dasgrößte Flüchtlingslager „Stankovac1“ ist mit 26 800 Menschen völligüberbelegt: „Jedem einzelnen“, sagtKatharina Lumpp, 33, von der Uno-Flüchtlingsorganisation UNHCR,„stehen nur noch neun Quadratme-ter Platz zur Verfügung, Seuchendrohen – es ist der absolute Irrsinn.“
Die Juristin registriert im Lagerdie Namen derjenigen, die auf eineFamilienzusammenführung hoffen;etliche von ihnen warteten darauf,daß die Bundesrepublik noch mehrFlüchtlinge akzeptiert: „Hier sitzenviele, die nach Dänemark, Schwedenoder in die Tschechei ausgeflogenwerden könnten, lieber noch eineWoche länger im Lagerelend unddenken: ,Vielleicht komme ich janach Deutschland.‘“
Darunter ist auch die Familie vonRasim Bikliqi, 25, der seit sechs Jah-ren in Bad Oldesloe lebt. Er ist wo-chenlang durch die Lager geirrt, eheer am vergangenen Mittwoch seinehochschwangere Schwester, ihrenMann und deren Tochter im Zelt E 13in Stankovac fand. Im Nachbarzeltwartet Zyhra Biqiri, 18, im T-Shirtmit der Aufschrift „Seebad Wyk aufFöhr“, sie möchte zu ihrem Brudernach Dresden.
Das Zelt D 166 teilt sich FaneteMerovci, 24, mit ihrem Sohn Albion,3, und fünf Fremden. „Ich liebeDeutschland“, sagt sie, ihr Bruderwohnt in Hamburg. Weil sie über-stürzt flüchten mußte, hat sie nicht
L
76
einmal dessen Telefonnummer mitnehmenkönnen. Jetzt weiß sie nicht, wie sie denKontakt herstellen kann: „Deutschland istso nah, aber vielleicht werde ich es niewiedersehen.“
Auch Ramadan Orani, der im nordbadi-schen Dossenheim einen Hausmeister-Ser-vice betreibt und seit einem Jahr einendeutschen Paß besitzt, ist nach Maze-donien gefahren. Er versucht nun von dortaus, was aus Deutschland nicht gelang: die Eltern in seine neue Heimat holen,egal wie.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Es müsse etwas passieren, sagt UNHCR-Helferin Lumpp, „Deutschland muß sichauf mehr Flüchtlinge einstellen“. Ange-sichts des „unvorstellbaren Leids und derunendlichen Grausamkeiten“ plädiert auchdie grüne Ausländerbeauftragte der Bun-desregierung, Marieluise Beck, dafür,„Menschen, die ihre engsten Verwandtenaus Notsituationen retten wollen, keinerechtlichen Hürden in den Weg zu legen“.Deshalb dürfe die Flüchtlingsaufnahmenicht mehr allein Sache der Innenministersein. Beck: „Es geht um das AnsehenDeutschlands, nicht der Bundesländer.“
Ähnliche Bedenken haben – neben derRücksicht auf die Basis – auch das Aus-wärtige Amt und das Bonner Innenmini-sterium zum Kurswechsel bewogen. DasAA hat sogar die Botschaften in Mazedo-nien und Albanien angewiesen, Besucher-visa großzügig auszustellen, weigerte sichaber, die Auswahl der Härtefälle zu treffen.Fischer, argwöhnten die Länderminister,wolle nur eine gute Presse zum Nulltarif.
Es gehört zu den Absurditäten diesesKriegs, daß sich die deutschen Regie-rungsparteien erst untereinander und danngemeinsam mit den Nato-Partnern pro-blemlos auf einen milliardenteuren High-Tech-Waffengang verständigen konnten,aber offensichtlich nicht in der Lage sind,die vereinbarte Unterbringung von insge-samt 100000 Flüchtlingen einvernehmlichzu regeln.
In der Schaltkonferenz der Innenmini-ster am 23. April regte Schleswig-Holsteinan, als Ausweg aus der Misere vielleichtdoch über eine Erhöhung des deutschenKontingents nachzudenken. Da aber moch-ten die Bonner nicht mitspielen. Zum einenmüßte sich dann der Bund an den Kostenbeteiligen, zum anderen, so fürchteten dieRegierungsvertreter, könnten die Nato-Partner dies als Signal mißverstehen, ihreeigenen Zusagen nicht einlösen zu müssen– bisher sind nicht einmal 15000 Flüchtlin-ge außerhalb Deutschlands aufgenommenworden (siehe Grafik).
Auch eine Kontingenterhöhung sei mitihm nicht zu machen, betont Baden-Würt-tembergs Schäuble, „erst sollen die ande-ren Staaten ihre Verpflichtungen erfüllen“.Sage man „zu allem ja und amen“, ergehees den Deutschen womöglich ähnlich wiebei den Bosnien-Flüchtlingen: „Die ande-ren Staaten lehnen sich entspannt zurück,geben uns aber kluge moralische Ratschlä-ge, sobald wir mit der Rückführung begin-nen.“
Zumindest in einem Punkt wurden sichBundesregierung und Länder am vergan-genen Freitag einig: Nicht die deutschenAusländerbehörden, sondern die Bot-schaften sollen jetzt entscheiden, welchebesonders gepeinigten Kosovaren einrei-sen dürfen.Weiter gilt die restriktive Linie:Mehr als ein paar tausend sollen es nichtwerden. Jürgen Dahlkamp, Felix Kurz,
Georg Mascolo, Thilo Thielke

Werbeseite
Werbeseite

7
DeutschlandFO
TO
S:
A.
VAR
NH
OR
N
Kontrahenten Schreitter-Schwarzenfeld, Seibert: „Vergiftete Prozeßatmosphäre“
J U S T I Z
Zoff um MüllIn Frankfurt liefern sich Ermittler
eine beispiellose Fehde mit dem Landgericht. Ein Beamterzeigte Richter wegen Rechts-
beugung und Strafvereitelung an.
Die Stimmung war oft gereizt, wennvor der 26. Strafkammer des Frank-furter Landgerichts die Giftmüll-
schiebereien der Beschuldigten verhandeltwurden. Doch anders als üblich, bekriegtensich nicht Ankläger und Angeklagte, son-dern Richter und Staatsanwälte.
Immer wieder mußte sich Andrea vonSchreitter-Schwarzenfeld herbe Kritik an-hören. Thomas-Michael Seibert, Vorsit-zender Richter der Kammer, hielt derStaatsanwältin etwa vor, der Beweiswertihrer Zeugen laufe „gegen Null“. Sie re-vanchierte sich mit dem Vorwurf, das Ge-richt vernachlässige seine Aufklärungs-pflicht und wolle offenbar gar keine Be-weisaufnahme.
Kriminalhauptkommissar René Bock,der die Ermittlungen gegen die Müllschie-ber geleitet hatte, setzte noch eins drauf:Der Beamte erstattete gegen die KammerAnzeige wegen des Verdachts der Rechts-beugung und Strafvereitelung im Amt –ein wohl einmaliger Eklat in der bundes-deutschen Justizgeschichte.
Die Fehde zwischen Ermittlern und der26. Strafkammer wirkt sich bis ins Privateaus. „Da sind langjährige Freundschaftenzerbrochen“, sagt ein Fahnder. In der Ge-richtskantine schneiden Ankläger RichterSeibert. Sie machen ihn für die „vergifte-te Prozeßatmosphäre“ verantwortlich.
Dabei hatte für die Ermittler alles soschön angefangen. Bei der bis dahin größ-ten Umweltrazzia wurden im Oktober 1996
8
acht Verdächtige festgenommen, drei ver-brachten mehr als ein Jahr in Untersu-chungshaft.
Hauptbeschuldigter des Verfahrens istder Frankfurter Unternehmer Ansgar Jun-gehülsing. Er war ursprünglich gemeinsammit sechs Komplizen angeklagt, mehrereAbfallfirmen ausschließlich zum Zweck desBetrugs gegründet oder übernommen zuhaben. Doch das Verfahren gegen Jun-gehülsing und zwei Mitangeklagte wurdeim August 1998 abgetrennt und ausgesetzt,weil es den Strafverfolgern nach AnsichtSeiberts in den ersten Prozeßmonatennicht gelungen war, ihre Vorwürfe ausrei-chend zu konkretisieren.
Zehntausende Tonnen fester und flüssi-ger Giftstoffe soll die Jungehülsing-Truppezu Altöl umdeklariert und gewinnbringendin eine Entsorgungsanlage in Brandenburgoder auf Deponien in Ostdeutschland ein-geschleust haben. Dafür wurden mehr als600000 Mark Bestechungsgelder gezahlt –getarnt als „Ladehilfen“ .
Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war dieBeweislage „ungewöhnlich gut“ – bundes-weit erstmalig klagte sie die mutmaßlichenÖko-Täter als kriminelle Vereinigung an.Das Gericht sah es zunächst auch so undließ die Anklage in vollem Umfang zu. Erstnach Prozeßbeginn kamen den RichternZweifel, ob es sich tatsächlich um eine kri-minelle Vereinigung handle. Der Kammerfehlten „Gründungsurkunden“ oder „Pro-tokolle von Vereinbarungen der Rädels-führer“. Sie stufte die Taten der Ange-klagten zu einer „Übung der Falschdekla-ration“ herunter.
Staatsanwaltschaft und Kripo sind nochimmer überzeugt, schlüssige Belege fürihren Vorwurf geliefert zu haben. Haupt-kommissar Bock wirft Richter Seibert inseiner Strafanzeige vor, teilweise „bewußtfalsch“ mit Beweisen umgegangen zu sein.Die 26. Strafkammer habe „fieberhaft nachGründen für eine Besserstellung der An-geklagten gesucht“.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Seibert habe „permanent“ vorliegendeTatsachenbeweise „nicht gewürdigt“ odersogar „falsch dargestellt“.Außerdem habeder Richter, Honorarprofessor an der Universität Frankfurt, „bewußte Falsch-darstellungen“ in Umlauf gebracht, umStaatsanwaltschaft und Polizei schlecht-zumachen. So habe Seibert an der Staats-anwaltschaft vorbei „mit diffamierenderIntention“ einen Vermerk an das Ober-landesgericht geschickt, in dem ohne Belegbehauptet werde, die Anklagebehörde un-terdrücke Akten.
Staatsanwältin Schreitter-Schwarzenfeldwirft dem Gericht außerdem vor, ein rund500000 Mark teures Ergänzungsgutachtendes TÜV über die Schadenshöhe, das Sei-bert selbst in Auftrag gegeben hatte, nichtvollständig berücksichtigt zu haben.
Bei der Urteilsverkündung am Dienstagvergangener Woche behauptete der Rich-ter, es sei zu aufwendig gewesen, den an-geklagten Tatzeitraum – etwa vier Jahre –gutachterlich überprüfen zu lassen. Diessei auch eine „Frage der Prozeßökonomie“in einem Großverfahren. Deshalb habe ersich auf 13 exemplarisch ausgewählte Wo-chen beschränkt.
Dabei hatte der TÜV den komplettenTatzeitraum längst analysiert und einenSchaden von 4,1 Millionen Mark errechnet.Dies erwähnte der Richter nicht. Er sprachnur von „mehr als drei Millionen“.
Die Angeklagten können zufrieden sein.Wegen vorsätzlicher umweltgefährdenderAbfallbeseitigung und Betrugs kassierteein Ex-Geschäftsführer Jungehülsings eineFreiheitsstrafe von drei Jahren und sechsMonaten. Die Anklägerin hatte sieben Jah-re und drei Monate gefordert. Zwei Be-triebsleiter wurden zu Haftstrafen von 33Monaten und 24 Monaten auf Bewährungverurteilt.
Die nächste Runde der Justizfehde istschon eingeläutet. Noch im Gerichts-saal kündigte die Staatsanwältin Revisionan. Wilfried Voigt

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Trends Wirtschaft
Buchhandlung (in Köln)
F. Z
AN
ETTIN
I / L
AIF
B U C H P R E I S E
Van Miert bleibt hartWettbewerbskommissar Karel Van Miert hat auch den letz-
ten Versuch der Verleger und Buchhändler verworfen, dieflächendeckende Preisbindung der Branche zu retten. In einemSchreiben vom 8. April an den Börsenverein des DeutschenBuchhandels und an Kultur-Staatsminister Michael Naumannschreibt Van Miert, die neuesten Vorschläge reichten nicht aus,„meine grundsätzliche Position zu ändern“. Die Buchhändlerund Verleger hatten Van Miert angeboten, bestimmte Druck-erzeugnisse dem freien Wettbewerb auszusetzen und damit die Preisbindung im Grundsatz zu erhalten. Pornographischeoder gewaltverherrlichende Druckwerke würden nach den Vor-stellungen der Deutschen dann ebenso aus der Preisbindungfallen wie Kalender, Publikationen von Behörden, Briefmar-kenalben, Kunstblätter und Postkarten, Landkarten und Globen,
Schulwandbilder, Kunstblätter, Comics undAdreßbücher. Insgesamt würden nach demAngebot der Verleger 25 Prozent des „Pro-duktionsvolumens außerhalb der Preisbin-dung verkauft“. Für den Rest sollte das heu-tige System weiter gelten, weil nur überfeste Verkaufspreise die teure, langfristigeVorratshaltung wertvollen Kulturguts gesi-chert werden könnte, so die Verleger undBuchhändler in ihrem Schreiben.Van Miertszuständiger Experte wischte das Verleger-angebot in einem Brief vom Tisch. Der PlanVan Miert
DAR
CH
ING
ER
d e r s p i e g e
Eisenbahner-Wohnunge
H.
SC
HW
AR
ZBAC
H /
AR
GU
S
habe juristisch keine Chance, wenn nicht deutlich mehr als dieHälfte der jetzt preisgebundenen Ware frei verkauft werde.Ver-leger und Buchhändler lehnen das ab. Die „kulturellen Vortei-le“, die sie reklamieren, könnten dann nicht bewahrt werden.Van Miert ist nun fest entschlossen, die jahrhundertealte Buch-preisbindung noch vor der bald beginnenden Sommerpause zukippen. Noch ist allerdings offen, ob er sich in der Kommissiondurchsetzen kann. Präsident Jacques Santer und der ebenfallsmit dem Problem befaßte Kulturkommissar Manuel Orejawollen sich und den Kollegen, die nach dem kollektiven Rück-tritt lustlos die Geschäfte führen, den politischen Ärger kurz vorihrem Abgang ersparen.
n (in Hamburg)
L U F T H A N S A
Lukratives ModellDie Kapitalvertreter im Aufsichtsrat
der Deutschen Lufthansa wollenihre eigenen Bezüge kräftig anheben –gegen den erbitterten Widerstand derArbeitnehmervertreter. Auf der Sitzungdes Kontrollgremiums am Mittwochvergangener Woche schlug Aufsichts-ratschef Klaus Schlede vor, die Bezügerückwirkend für 1998 auf 30000 Markzu erhöhen. In diesem Jahr sollen dieGesamtbezüge sogar auf 50000 Marksteigen. Zusätzlich zu einem Grundbe-trag von knapp 20000 Mark kassierendie Aufsichtsräte dann erfolgsabhängigeTantiemen, die sich an der Lufthansa-Dividende orientieren. „Wir könnendoch nicht bei den Mitarbeitern sparenund uns selbst die Taschen vollschau-feln“, protestierte ein Gewerkschafts-vertreter. Daraufhin drohte Schlede,seine Zweitstimme einzusetzen, ein ab-solutes Novum in der traditionellenkonsensverpflichteten Lufthansa. DerAntrag kam dennoch durch, weil derleitende Angestellte zustimmte und sichzwei Vertreter des fliegenden Personalsenthielten.
D E U T S C H E B A H N
Ärger um ImmobilienVerkehrsminister Franz Müntefering
droht ein politisches und finanziel-les Desaster bei der Deutschen Bahn.An diesem Mittwoch will der Hauptper-sonalrat der Eisenbahner den Verkaufvon rund 114000 Eisenbahner-Wohnun-gen ablehnen. 4,6 Milliarden Mark desVerkaufserlöses hat Müntefering bereitsin seinen Haushalt eingestellt. Die Ge-werkschaft der Eisenbahner ist fest ent-schlossen, den Verkauf der billigen
l 1 8 / 1 9 9 9
Mietwohnungen an eine Bieter-gruppe von Immobilienhändlernund Landesentwicklungsgesell-schaften für insgesamt 7,1 Milliar-den zum Spottpreis von 1000Mark pro Quadratmeter zu ver-hindern. Die Chancen stehen gut.Nach dem Eisenbahnneuord-nungsgesetz von 1993 gelten dieWohnungen als betriebliche So-zialeinrichtung. Dienstherr Mün-tefering darf laut Gesetz nichtsunternehmen, was ihm den un-mittelbaren Einfluß auf die So-zialeinrichtung nehmen würde.Ein Verkauf ist somit ausgeschlos-
sen. Falls Müntefering die Verkaufsver-träge doch unterschreiben will, werdenihn die sozialdemokratischen Freundevon der Gewerkschaft sofort mit einereinstweiligen Verfügung bremsen. Auchden dann immer noch möglichen Gangvor eine Einigungsstelle fürchten dieMüntefering-Genossen nicht. Dort ent-scheidet der Präsident des Oberverwal-tungsgerichts Lüneburg wohl kaum ge-gen das Gesetz. Als letzte Instanz bleibtden Eisenbahnern eine Klage vor denVerwaltungsgerichten. Die dauert dreiJahre. Ein Gewerkschafter: „Bis dahinsieht Müntefering keinen Pfennig.“
81

Trends
BISCHOFF
Deutsche BankBörsennotierte GesMarktkapitalisierunin Milliarden Euro
Deutsche Bank
HypoVereinsbank
Dresdner Bank
Commerzbank
Consors
BHF-Bank
82
Jürgens
G E M A
Musiker sind sauer
M.
DAR
CH
ING
ER
Unter den deutschen Rock- und Jazz-musikern wächst der Ärger über
die Münchner Gema, die sämtliche Ur-heberrechte von Komponisten und Au-toren verwaltet. Statt vier- bis fünfstel-liger Beträge, wie in den vergangenenJahren, erhalten viele Komponisten undTextdichter dieses Jahr nur noch einpaar hundert Mark aus dem Milliar-den-Topf der Inkasso-Gesellschaft. DieGema, klagt Ole Seelenmeyer, der Spre-cher des Deutschen Rock- und Popmu-sikerverbands, „betreibt Existenzver-nichtung“, denn die „meisten Musikerbekommen deutlich weniger Tantiemen,als die Gema bei den Veranstaltern ih-rer Konzerte an Gebühren eintreibt“.
enellschaften nachg
29,8
24,5
22,4
15,7
3,4
3,2
Grund für die „Lachnummer“, so derJazzer Peter Herbolzheimer, ist ein neu-es Abrechnungsverfahren, das die Gema1998 eingeführt hat, um eine „verbes-serte Erfassung der Aufführungen“ zuerreichen. Gewinner der Umvertei-lungsaktion sind die – ohnehin gutbe-tuchten – Stars wie Udo Jürgens sowiedie Autoren von Schnulzen und Ever-greens, die von Tanzkapellen bei Hoch-zeiten oder Schützenfesten nachgespieltwerden. Gema-Aufsichtsrat ChristianBruhn, der als Komponist von Partyhitswie „Mamor, Stein und Eisen bricht“kräftig profitiert, verteidigt das neueAbrechnungsverfahren: „Wir sorgen nurfür eine gerechtere Bewertung.“
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
T E L E K O M M U N I K A T I O N
Mobilfunk nach RomTelekom-Chef Ron Sommer will den
zentralen Sitz seiner Mobilfunktoch-ter D1 nach einer erfolgreichen Fusionmit der Telecom Italia nach Rom verle-gen. Außerdem soll das Unternehmenmit seinen rund sechs Millionen Kundenund 6000 Mitarbeitern unter italienischeLeitung gestellt werden. Mit dem spek-takulären Plan will der Telekom-Chefdie aufgeheizte Stimmung in Italien be-ruhigen und die gefährdete Fusion derbeiden Ex-Monopolisten zum zweit-größten Telefonkonzern der Welt dochnoch retten. Die Zeit drängt: Im Milliar-den-Poker um die Telecom Italia hattensich in der vergangenen Woche immermehr italienische Politiker auf die Seitevon Olivetti geschlagen. Eine feindlicheÜbernahme durch den wesentlich klei-neren Konkurrenten, so ihr Tenor, seiallemal besser, als das ehemalige Staats-unternehmen in die Hände der Deut-schen zu spielen. Für Sommer wäre einErfolg Olivettis ein Fiasko. Mit seinenInternationalisierungsplänen müßte derTelekom-Chef dann bei Null anfangen.Denn auch ein Zurück in die bisherigePartnerschaft mit der France Télécomscheint ausgeschlossen.
Sommer
F I N A N Z I N D U S T R I E
Neue GroßbankIn nur gut vier Jahren hat eine Klein-
bank aus Franken den Sprung unterdie Top fünf der deutschen Großbankengeschafft: Consors Discount-Broker ausNürnberg. Erst 1994 gründete Karl Mat-thäus Schmidt, 30, die Online-Bank. Mitdem Börsengang an den Neuen Marktam vergangenen Montag rangiert Con-sors im Börsenwert (3,4 Milliarden Euro)auf Anhieb direkt hinter den vier Groß-banken (siehe Tabelle). Die Consors-Pa-piere stiegen in nur einer Woche um 18 Prozent – und das, obwohl das Insti-tut für 1998 nur 13,8 Millionen Mark Ge-
winn ausweist. „Die Aktie ist, ähnlichwie die Discount-Broker in den USA,hoch bewertet“, sagt Commerzbank-Analyst Dieter Hein, „die Anleger trau-en diesen Unternehmen noch sehr vielzu.“ Consors-Gründer Schmidt erkanntebereits 1994 die enormen Chancen einesWertpapier-Handelshauses, das Ordersvorwiegend über Telefon und Internetabwickelt. Der Verzicht auf Kundenbera-tung ermöglichte es ihm, die damals vonder Konkurrenz verlangten Provisionenum rund 75 Prozent zu unterbieten. DieGroßbanken sind inzwischen mit ihrenDirekt-Bank-Töchtern ebenfalls in die-sem Markt. Bislang macht jedoch außerConsors nur die zur Commerzbankgehörende Comdirect Gewinn.

Rentner-Paar
CAM
ER
IQU
E /
FO
TEX
Geld
R E N T E N
Neue Form der VorsorgeEinige unscheinbare Veränderungen im Betriebsrentengesetz
ermöglichen eine für Deutschland völlig neue Form dersteuerbegünstigten Altersvorsorge, die bisher in der Öffent-lichkeit kaum wahrgenommen wurde. Arbeitgeber können fürihre Arbeitnehmer bis zu 30 Prozent des Bruttogehalts ohneAbzug von Steuern und Sozialabgaben in eine Unterstüt-zungskasse einzahlen, die als Instrument der betrieblichenAltersversorgung von der Steuer befreit ist. Diese legt dieBeiträge in einer Kapitallebens- oder Rentenversicherung an.Der Arbeitnehmer muß diesen Anteil am Gehalt erst im Mo-ment des Zuflusses der Gelder versteuern und spart zusätzlichdie Sozialversicherungsbeiträge. Als Rentner dürfte seine steu-erliche Belastung aber erheblich niedriger liegen. Für denArbeitgeber liegt der Vorteil darin, daß er für diesen Gehalts-bestandteil keine Sozialversicherungsbeiträge abführen muß.Wenn der Arbeitnehmer aus dem Unternehmen ausscheidet,nimmt er seine Rentenansprüche mit. Durch die Steuervorteilekann die Rente nach diesem neuartigen Modell, so rechnet der Versicherungsmakler Reinhard Eschenlohr von der FirmaArchimedes vor, für einen verheirateten Arbeitnehmer mit
Quelle: Datastream
Jan. Feb. März April Jan. Feb. März April Jan. Feb. März April Jan
130
120
110
100
90
80
70
Volkswagen DaimlerChryslerBMW Po
Deutsche Autoaktien 1.1.1999=100
Vor
d e r s p i e g e l
60000 Mark Jahreseinkommen um 70 Prozent höher ausfallenals bei einer herkömmlichen privaten Rentenversicherung. Beigrößeren Einkommen liegt der Renditevorteil noch höher. Ver-sicherer wie die Allianz Leben oder die Nürnberger gründenzur Zeit sogenannte Unterstützungskassen, um den erwartetenGeldregen in ihre Kassen zu lenken.
STUTTGART
. Feb. März April
130
120
110
100
90
80
70
rschezugsaktie
0
1000
2000
3000
4000
ril
A U T O M O B I L A K T I E N
BMW und VWausgebremst
Die Anleger reagieren enttäuscht aufdie Krise bei BMW und den ge-
ringen Anstieg des Gewinns nach Steu-ern bei Volkswagen im ersten Quartal.Die Aktien der beiden Konzerne schnit-ten in den ersten drei Monaten des Jah-res deutlich schlechter ab als die derKonkurrenten Porsche und Daimler-Chrysler. Christian Breitsprecher, Auto-Analyst der Deutschen Bank Research,ist überzeugt davon, daß sich die Sanie-rung der BMW-Tochter Rover noch lan-ge hinziehen und das gesamte Unter-nehmen weiter belasten wird. Zudem
sei „noch keine Produktstrategie für dieNachfolgeautos der Rover-Modelle 200und 400 erkennbar“. Bei VW ist Breit-sprecher nicht so skeptisch. Wolfsburgberechnet das erste Quartal traditionellsehr vorsichtig. Die Deutsche Bank Re-search empfiehlt deshalb, die VW-Aktieweiter überzugewichten. Auf Erfolgs-kurs bleibt Porsche. Der Kurs der Sport-wagenfirma stieg seit Jahresbeginn umgut 20 Prozent. Das Unternehmen pro-fitiert besonders stark von der gutenKonjunktur auf dem wichtigen Absatz-markt USA und dem hohen Dollarkurs.Bei DaimlerChrysler überzeugt die An-leger nach Ansicht von Breitsprecher,daß „die Fusion bislang offenbar glattläuft“. Zudem ist der Absatz der Ober-klasse-Modelle der Stuttgarter nicht soanfällig für Konjunkturschwankungen.
1 8 / 1 9 9 9
I N T E R N E T- B Ö R S E
Wahre PerlenEinen regelrechten Boom erleben Ak-
tien, die nicht an der Börse notiertsind, sondern im Internet gehandeltwerden. So steigerte allein die AHAGAG, Marktführer im Handel mit diesensogenannten Nebenwerten, ihren Um-satz 1998 von 24,5 Millionen auf 190Millionen Mark. Bei solchen Papierenhandelt es sich meist um Unternehmen,die Kapital brauchen, aber für eine No-tierung am Neuen Markt noch nicht reifsind. Darauf spe-zialisierte Han-delshäuser wickelnOrders über Inter-net oder Telefonab. Unter den Wer-ten finden sichwahre Perlen: Soist die SenatorFilm AG, bevor siean den NeuenMarkt wechselte,zehn Jahre langaußerbörslich gehandelt worden – undhat in dieser Zeit über 5000 Prozent Zu-wachs erzielt. Die bei WebStock gehan-delte Internet 2000 legte seit ihrer Emis-sion im September 1997 um über 1100Prozent zu. Derzeit werden mehr als300 Aktien gehandelt. Doch die Schutz-gemeinschaft der Kleinaktionäre warnt:„Diese Unternehmen unterliegen beiweitem nicht der Kontrolle von börsen-notierten Firmen.“
Aktienkurs vonInternet 2000in Mark
1997 1998 1999
Sept. Ap
Quelle: WebStock
83

Wirtschaft
8
W E L T W I R T S C H A F T
Tiger auf dem SprungDie Börsenkurse steigen kräftig, die Talsohle nach der Asienkrise scheint durchschritten:
Die Staaten Südostasiens fassen wieder Mut. Doch die Zeichen für ein Comeback sind trügerisch.Noch sind die strukturellen Defizite nicht behoben, die sozialen Konflikte verschärfen sich.
Quelle:Datastream,IWF
Frischer Wind im OstenDie wirtschaftliche Entwicklungder Tigerstaaten
BruttoinlandsproduktVeränderung zumVorjahr in Prozent
14000
10000
6000
Malaysia
Südkorea
Thailand
Indonesien
Japan
Hongkong
China
JA PA N H O N G KO N G ( C H I N A )
Nikkei-Index Hang-Seng-Index
1997 1998 1999 1997 1998 1999
20000
17000
14000
–5,1
–1,3
3,15,3
1997 1998 1999* 2000*
*Prognose
1997 1998 1999* 2000*
1,4
–2,8
0,3
–1,4
Es ist nicht lange her, da glich derFlughafen Kimpo in Seoul einemLuftfahrtmuseum: Wenige Passagiere
verloren sich vor Jahresfrist in den dreiTerminals. Einige ausländische Airlineshatten die südkoreanische Hauptstadt ganzaus ihrem Flugplan gestrichen. Die Duty-free-Läden waren wie ausgestorben.
Mit der Ruhe ist es vorbei. Fast wie zuZeiten vor der Asienkrise kehrt hektischeGeschäftigkeit zurück – viel früher, als esselbst Optimisten erwartet haben.
Allein von Januar bis März nahm derLuftverkehr in Südkorea um fast ein Vier-tel zu. Vier neue Flugzeuge wird die Flug-gesellschaft Korean Air in diesem Jahr inBetrieb nehmen, für das kommende Jahrsind gleich 18 weitere bestellt.
Ein Land im Steigflug: An den Schalterndes Flughafens drängen sich die Menschen,Plakate werben für die Fußball-WM imJahr 2002 – Südkorea gewinnt an Zuver-sicht. Nicht nur hier keimt Hoffnung, dietiefe Krise gemeistert zu haben.
In vielen Staaten Südostasiens mehrensich Anzeichen, daß sie noch mal davon-gekommen sind. Die lange gemiedeneWachstumsregion zieht wieder Kapital an,anderswo sind lukrative Anlagemöglich-keiten zur Zeit rar: An der Wall Streetstrebt der Dow Jones Index schon der11000-Marke entgegen, in Europa verunsi-chert der Krieg im Kosovo die Anleger.
„Das Investment-Geld beginnt aus Eu-ropa nach Asien zu fließen“, verkündetBarton Biggs, der einflußreiche Strategeder US-Investmentbank Morgan Stanley.Die Branche horcht auf: Vor der Asienkri-se gehörte Biggs zu jenen, die als erste dasSignal zur Flucht des Kapitals gaben.
Krise? Welche Krise? An den Börsenherrscht Hochstimmung – als hätte es nieein Finanzdesaster gegeben. Seit Jahres-beginn stiegen die Kurse in Südkorea umfast 30 Prozent, Hongkong legte um etwa25 Prozent zu. Selbst Indonesien, das vonUnruhen erschüttert wird, verzeichnet einPlus von rund 20 Prozent. „Das Geld über-schwemmt den Markt“, schwärmt der süd-koreanische Broker Choo Hee Up.
Eilig pumpen die Fondsmanager etlicheMilliarden Dollar in eine Region, aus dersie vor fast zwei Jahren in Panik geflüchtetwaren. Damals, am 2. Juli 1997, brach diethailändische Währung, der Baht, unter
4
spekulativen Attacken von internationalenHändlern ein. Erst Thailand, dann Malay-sia, Indonesien, Südkorea – ein Land nachdem anderen kippte weg. Ein Domino-effekt kam in Gang, dessen Ausläufer bisnach Europa reichten.
Heute sind die Währungen der Tigerlän-der wieder in stabiler Verfassung. Die Zin-sen sinken, die Konjunktur springt an. Süd-korea,Thailand und Malaysia erwarten fürdieses Jahr, daß ihre Wirtschaft wächst,wenn auch nur in geringem Maße.
Ausländische Unternehmen investierenwieder in den Standort Fernost, auch deut-sche Firmen setzen auf die Region. Bayerwill bis 2010 insgesamt 7,9 Milliarden Markdort ausgeben; BMW hat begonnen, inThailand eine Montagefabrik aufzubauen.
Laut einer Umfrage unter asiatischenUnternehmern von Grassroots Research,einer Tochter der Dresdner-Bank-Gruppe,glauben 60 Prozent, das Schlimmste über-standen zu haben. Und Michel Camdes-sus, Chef des Internationalen Währungs-fonds (IWF), antwortete vergangene Wochelapidar auf die Frage, ob die Finanzkrisevorüber sei: „Es scheint so.“
Große US-Finanzgesellschaften wieTempleton legen neue Fonds auf, über diesich Investoren an strauchelnden asiati-schen Firmen beteiligen können, die von
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
den heimischen Banken keinen Kredit be-kommen. „Als Anleger habe ich heute vielmehr Geld in Asien als irgendwann imvergangenen Jahrzehnt“, sagt KennethCourtis, Chefökonom der Deutschen Bankin Tokio. Nun kehrt die Gier zurück,schwappt „hot money“ aus den reichenNationen wieder gen Asien.
Allerorten verschulden sich die Regie-rungen bei ausländischen Banken und risi-kofreudigen Anlegern. Eine gigantischeUmschichtung ist in Gang gekommen –raus aus US-Aktien, rein in Risikofonds,mit fast 75 Millionen Dollar pro Woche.
Das reicht, um die Börsen in Bangkokoder Jakarta rasch aufzublasen. Schonmahnt James Wolfensohn, Präsident derWeltbank, daß der spekulative Über-schwang einen gefährlichen Nebeneffekterzeugt: „Es besteht die Gefahr, daß sichder Reformdruck abschwächt.“ Die beein-druckende Entwicklung der Börsen kannkaum verbergen, daß die strukturellen De-fizite längst nicht überall behoben sind.
Noch lasten auf zahlreichen Banken Un-summen an faulen Krediten. Die Bilanzenselbst der Kapitalgesellschaften sind so un-durchsichtig wie ihre Besitzverhältnisse.Die Regierungen ächzen unter Schulden.Sie stützen nach wie vor notleidende Wirt-schaftssektoren, die eigentlich pleite sind.

d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
500
300
700 1200
800
400
800
500
200
M A L AYS I AS Ü D KO R E A T H A I L A N D
Kospi-IndexKuala LumpurComposite-IndexSET-Index
1997 1998 1999 1997 1998 11997 1998 1999
–5,5
2,04,65,5
1997 1998 1999* 2000*
–0,4
–8,0
1,03,0
1997 1998 1999* 2000*
–6,8
0,92,
7,7
1997 1998 1999* 20
Börse in Hongkong: „Das Geld überschwemmt den Markt“
G.
RU
ES
CH
EN
DO
RF /
RAPH
O /
AG
EN
TU
R F
OC
US
Fragt sich, ob unter solchen Bedingun-gen das Comeback der Tigerstaaten gelin-gen kann – und ob es von Dauer ist. Odermachen am Ende die Fondsmanager den-selben Fehler wie vor der Asienkrise:blindlings Geld in Staaten zu treiben, ohnesich um fundamentale Daten zu kümmern?
Mag sein, daß sich manches geänderthat, seit die Volkswirtschaften Südostasienszusammengebrochen sind. Thailands Poli-tiker willigten in schärfere Konkursgeset-ze ein. Und Indonesiens StaatspräsidentBacharuddin Jusuf Habibie hat im März38 insolvente Banken geschlossen, darun-ter drei Institute, die Kindern des früherenMachthabers Suharto gehörten.
Vor allem Südkorea zeigt deutliche Fort-schritte. Die Regierung beginnt bereits da-mit, die 58 Milliarden Dollar aus dem Ret-tungspaket zurückzuzahlen, das der IWFim Dezember 1997 zusammen mit anderenKreditgebern geschnürt hat. Dafür mußtesie ausländischen Investoren den Zugangzur Industrie des Landes erleichtern.
Fast neun Milliarden Dollar flossen 1998ins Land, fast zwei Milliarden davon stam-men aus Deutschland. BASF übernahm dieFuttermittel-Tochter des ChemiekonzernsDaesang; Bosch kaufte Mando, den größ-ten Autozulieferer des Landes.
Selbst die Chaebols, die großen Indu-striekonglomerate wie Daewoo oder Hyun-dai, bleiben vom Reformdruck nicht ver-schont. Südkoreas Präsident Kim Dae Jungdrängt darauf, daß sie Teile ihrer Firmen-imperien abstoßen. Wegen ihrer hem-mungslosen Expansionspolitik, die sie aufPump finanzierten, gelten sie als Haupt-schuldige der Krise. Heute meint Chung JuYung, der 83jährige Gründer von Hyundai,die Krise habe Südkorea eher noch ge-stärkt: „Unser Land kann durchaus einzweites Wirtschaftswunder schaffen.“
Doch Südkorea ist nicht Südostasien.Wie ernst es die Tigerländer mit ihrem Re-
85
500
300
700
I N D O N E S I E N
JakartaComposite-Index
1997 1998 1999999
0
00*
–4,0
2,5
4,6
–13,71997 1998 1999* 2000*

Autoproduktion bei Hyundai (im südkoreanischen Ulsan): „Ein zweites Wirtschaftswunder“
M.
SAS
SE /
DAS
FO
TO
AR
CH
IV
Wirtschaft
formwillen meinen, müssen die meistennoch beweisen. Viele sträuben sich, ihreWirtschaft grundlegend umzubauen.
Die Banken Malaysias etwa werden vonihrer Schuldenlast fast erstickt. Die Kon-zerne sind eng mit der Regierung von Pre-mierminister Mahathir Mohamad verban-delt. Kein Wunder, daß noch kein einzigerGroßbetrieb Konkurs anmelden mußte.
Trotzdem erwartet Mahathir, daß dieWirtschaft schon im kommenden Jahr wie-der um fünf Prozent wächst.Verbissen hälter an seiner Vision, dem Plan 2020, fest,und der sieht 30 Jahre lang ein Wachstumvon im Schnitt sieben Prozent vor. „KeineKrise wird Malaysias Fortschritt jemals auf-halten“, verkündet Mahathir vollmundig.
In Wahrheit dürfte kaum ein Land derRegion bald wieder die Vorkrisen-Ratenvon jährlich sechs bis acht Prozent Wachs-tum erreichen. Ob es den Tigerstaatenüberhaupt gelingt, dauerhaft positive Zah-len zu schreiben, hängt nicht allein von ih-nen ab. Entscheidend ist, was mit Japanund China geschieht, den größten Wirt-schaftsmächten Asiens.
In Japan deutet nur wenig darauf hin,daß sich die ökonomische Lage ähnlichschnell erholt wie die Aktienkurse. Die Re-zession geht ins fünfte Quartal, teure staat-liche Konjunkturprogramme verpuffenwirkungslos. Die forschen Ankündigungenvon Konzernen wie Sony, massiv Stellen zustreichen, treiben zwar die Aktienkurse,gleichzeitig verunsichern sie aber die Bür-ger – und dämpfen so den Konsum.
Noch unberechenbarer ist, welchen WegChinas Wirtschaft nimmt. Bisher hat es Pe-king verhindern können, seine Währung,den Renminbi, abzuwerten – zu einem ho-hen Preis: Der Export ist eingebrochen,die Arbeitslosigkeit steigt erheblich. Falls
d e r s p i e g e86
das Land doch noch abwertet, wäre ein Fi-nanzbeben in Asien kaum zu vermeiden.
Noch ist alles ruhig. China verfügt über143 Milliarden Dollar an Währungsreser-ven. Premierminister Zhu Rongji versi-chert, er taste die Währung nicht an.
Vielleicht ist die Finanzkrise in Asientatsächlich vorerst ausgestanden. Doch diesoziale Krise fängt gerade erst an.
So glänzend die Börsenzahlen sind, siekönnen nicht darüber hinwegtäuschen, daßfür die Asiaten das harmlose Wort „Re-strukturierung“ nichts anderes bedeutetals Arbeitsplatzverlust und Verelendung.
Jedes zehnte Unternehmen ist in denKrisenländern verschwunden. Wer nochArbeit hat, der muß Lohneinbußen hin-nehmen. In Indonesien sind die Reallöhneum fast ein Drittel gefallen. In Südkorea istder Jahresverdienst pro Kopf im Schnittvon 10000 auf 7000 Dollar gesunken.
„Werden die sozialen Probleme nichtbekämpft“, warnt der US-Ökonom JeffreySachs, „bilden sie in den kommenden Jah-ren ein starkes Wachstumshemmnis.“
So ist das Bild, das die Tigerstaaten der-zeit bieten, widersprüchlich: Während dieRegierung in Seoul stolz verkündet, dieIndustrieproduktion sei im März um 18,4Prozent gestiegen, demonstrieren wütendeDaewoo-Arbeiter gegen die Umbauplänedes Konzerns, weil sie um ihren Job ban-gen – der Strukturwandel ist brutal.
Und demütigend obendrein. Es nagt amSelbstbewußtsein, wenn japanische Ban-ken ihr Tafelsilber veräußern müssen, umfinanziell wieder etwas Luft zu bekommen.Kürzlich erzielte die Fukuoka City Bank 60 Millionen Dollar aus dem Verkauf ihrerKunstsammlung. Alexander Jung,
Mathias Müller von Blumencron,Wieland Wagner
l 1 8 / 1 9 9 9

Werbeseite
Werbeseite

11
10
9
8
6
88
Wirtschaft
M A N A G E R
„Ich wollte nur das Beste“Ein eher überkorrekter Banker sieht sich im Mittelpunkt
einer beispiellosen Seifenoper – und weiß nicht recht, warum:Albrecht Schmidt, Vorstandschef der HypoVereinsbank.
HypoVereinsbank-Chef Schmidt„Wut im Bauch“
C.
LEH
STEN
/ A
RG
UM
Hans Fey, ehemaliger Vorstand derbayerischen Hypo-Bank, wird aufjeden Fall dasein. Er hat sich, qua-
si als Eintrittskarte, eigens zehn Aktien derneuen HypoVereinsbank gekauft, und erhat ein umfangreiches Schriftstück aus-gearbeitet. Es ist seine Abrechnung mitAlbrecht Schmidt, dem Chef der Bank.
Am Donnerstag dieser Woche, auf derHauptversammlung des Kreditinstituts, willFey Schmidt hart attackieren. „SchmidtsAusfall vom Oktober kommt einer Hin-richtung des gesamten früheren Hypo-Vorstands und der alten Hypo-Bankgleich“, empört er sich, „das lasse ich nichtauf mir sitzen.“
Seit Schmidt im vergangenen Oktoberein 3,5-Milliarden-Loch in der Bilanz derfusionierten Bank aufdeckte und dafür dieehemaligen Vorstände seines neuen Part-ners Hypo-Bank verantwortlich machte,ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Feyund dessen ehemaligen Kollegen. Und seit-
Schwächer als die KonkurrenzBörsenkurs der HypoVereinsbank
und der Dax 100 Banken-Index
Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April
0
0
0
0
70
0
Dax 100Banken-Index
1.9.1998(Fusion)=100
her herrscht Aufruhr in der Bank und imKreis ihrer Aktionäre.
Die Hauptversammlung könnte zum Tri-bunal über Schmidt werden. In zahlreichenGegenanträgen fordern Aktionärsvertreterund Kleinanleger, Vorstand und Aufsichts-rat die Entlastung zu verweigern.
Die geplante Schlammschlacht am 6. Maibildet womöglich den Höhepunkt einerAffäre, die Schmidt selbst als „soap-opera“empfindet. Warum ausgerechnet ihm in der Trivialserie eine eher zweifelhafte Rol-le zugewiesen ist, kann und will er nichtverstehen.
Was, bitte schön, hätte er denn tun sol-len? Das Milliarden-Loch verschweigen?Unmöglich für einen, der als überkorrektgilt. Fünfe gerade sein zu lassen, wie esder bajuwarischen Lebensart des ehemali-gen Hypo-Chefs Eberhard Martini ent-spricht, ist seine Sache nicht. Im Gegenteil:Schmidt tat, was er aus seiner Sicht tunmußte – er konnte nicht anders.
Aber mußte der Mann, der sonst so un-terkühlt daherkommt, so emotional rea-gieren? Von seiner „Wut im Bauch“ sprachSchmidt, als er das Milliarden-Loch publikmachte, und von Versagen. Und er forder-te Konsequenzen. Martini sah sich an denPranger gestellt. Die Staatsanwälte wur-den hellhörig.
Schmidt verletzte gleich mehrfach denComment der Branche: Er deckte Fehl-verhalten auf, nicht zu. Und er legte sichmit einem Großaktionär an, der über-mächtigen Allianz.
Seither kämpft der Banker, dessen Kar-riere bisher so geradlinig verlief wie seinScheitel, auch ums eigene Überleben. Warseine Empörung, wie die Gegenseite kol-portiert, nur gespielt, um von eigenemFehlverhalten abzulenken? Waren die Ver-luste aus den Immobiliengeschäften der al-ten Hypo-Bank in Wahrheit, so eine ande-re Version, längst bekannt und in der Bi-lanz bereits berücksichtigt?
So undurchsichtig ist die Gemengelage,daß nun die Experten der Wirtschaftsprü-ferfirma BDO die Vorgänge durchleuchtensollen. Erst dann wird sich zeigen, obSchmidt sein Lebenswerk, die Verschmel-zung der beiden Banken, vollenden kann.
Dabei hatte alles so wunderbar begon-nen. „Bislang ist uns kein Fehler unterlau-fen“, frohlockte Schmidt noch im vergan-genen Sommer über die geglückte Fusion.Der Einserjurist, von der Zeitschrift „Ca-
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
pital“ zu „Deutschlands aggressivstemBanker“ gekürt, wurde als Shooting-Starder deutschen Bankenszene gefeiert.
Getrieben vom Ehrgeiz, die DeutscheBank zu überrunden, brachte der gebürti-ge Leipziger die fusionierte Bayernbankinnerhalb kürzester Zeit auf Kurs. Und denbestimmte nur einer: Albrecht Schmidt.
In harten Tests mußten die Führungs-kräfte ihre Eignung für einen Spitzenjobunter Beweis stellen. Den hausinternenTÜV schafften, wie zu erwarten, nur we-nige Manager der ehemaligen Hypo-Bank.
Auch den „Gleichheitsfanatikern der68er-Generation“ sagte Schmidt den Kampfan. Wer in dem neuen Vorzeigebetrieb ar-beitet und nicht spurt, muß neuerdingshohe Gehaltseinbußen hinnehmen.
Die Börse honorierte Schmidts Crash-Progamm mit einem Kursfeuerwerk. Ge-messen am Börsenwert der neuen Bayern-bank sah die Deutsche Bank im vergange-nen Jahr häufig ganz schön alt aus.
Doch die schönen Zeiten sind längst vor-bei. Seit Schmidts Philippika im Spätherbstvergangenen Jahres verlor die zweitgröß-te deutsche Bank zeitweise rund ein Drit-tel ihres Wertes. Den alten Höchststandhat sie noch immer nicht wieder erreicht.
Die feine Bankerszene betrachtet dasStraucheln des selbstherrlichen Außensei-ters mit einem gewissen Vergnügen. VieleFreunde hat sich Schmidt während seinersteilen Karriere nicht gemacht. Das Gefühlder eigenen Überlegenheit entfernte denAufsteiger immer weiter von seinen Kolle-gen – ohne daß er es selbst merkte.
„Die Menschen müssen mich nicht mö-gen, es reicht, wenn ich sie überzeuge“,sagt er – eine fatale Fehleinschätzung, wiesich im Zuge der HypoVereinsbank-Affä-

HypoVereinsbank-Zentrale in München Aufruhr vor der Schlammschlacht
re zeigte. Ein Großteil der Öffentlichkeit,zumal in München, war eher geneigt, dembarocken Ex-Hypo-Chef Martini Glaubenzu schenken als dem knochentrockenenPrädikatsjuristen Schmidt.
Nachdem Schmidt 1990 zumVorstandschef der Vereinsbankgekürt worden war, hatte erseine Rolle als Außenseiter derdeutschen Bankenszene gera-dezu kultiviert – bis hin zurKleidung. Während seine Kol-legen gedecktes Grau oderDunkelblau bevorzugen, zeigtSchmidt sich gern in grünen,hellgrauen oder gestreiftenAnzügen, die Manschettenzieren viel zu große Mono-gramme. Auch von seinemgrünen Lodenmantel will dergebürtige Sachse nicht lassen.Er verkehrt nicht in den rich-tigen, weil wichtigen Zirkeln,er spielt nicht Golf – er macht,was er will.
Solange Schmidt gute Zah-len ablieferte, sahen seineKollegen aus der bayerischenHochfinanz großzügig übersolche Formfehler hinweg. Dasänderte sich erst, als Schmidtdas Milliarden-Loch der über-nommenen Hypo-Bank an-
prangerte – und sich mit dem bayerischenFinanz-Establishment anlegte. Die feine Al-lianz muß seither mit dem Vorwurf leben,sie hätte ihr 22,5-Prozent-Paket an der an-geschlagenen Hypo-Bank viel zu günstig
V. L
ISTL /
AR
GU
M
losgeschlagen. Die Großaktionäre Viag undMünchener Rück mußten den Wert ihrerHVB-Pakete in der eigenen Bilanz kräftignach unten schreiben.
Ohne es zu wollen, düpierte Schmidtauch den bayerischen MinisterpräsidentenEdmund Stoiber. Der CSU-Politiker hattedie Mega-Fusion mit angeschoben, um denEinstieg der Deutschen Bank in Bayern zu verhindern. Nun muß der Regierungs-chef tatenlos zusehen, wie seine Super-bank zum Gespött in Frankfurter Finanz-kreisen wird.
Schmidt dämmert inzwischen, daß erbei seinem Auftritt am 28. Oktober über-zogen hat. „Ich wollte doch nur das Bestefür die Bank“, rechtfertigte er sich am Mitt-woch vergangener Woche in einem Vor-trag an der Münchner TU, „aber das habenwir leider nicht erreicht.“
Ob das Schuldeingeständnis ausreicht,die Großaktionäre zu besänftigen, bleibtabzuwarten.Am Montag dieser Woche, dreiTage vor der Hauptversammlung, tagt derAufsichtsrat der HypoVereinsbank. Dannwollen die Kontrolleure von Schmidt wis-sen, ob er in den ersten vier Monaten desJahres seine Planzahlen eingehalten hat.
Erreicht der Musterbanker sein Klas-senziel nicht, wollen sich die Eigentümererneut zusammensetzen. „Dann“, pro-phezeit einer von ihnen, „hat Schmidt einneues Problem.“ Dinah Deckstein

90
Wirtschaft
E N E R G I E
Angriff derStromrebellen100 Berliner Unternehmer wechseln den Versorger.
Den Deal vermittelte der ersteStrombroker Deutschlands.
eteu
en
W
Energiebroker Arndt, Claus RottenbacherDie Idee kam aus den USA
N.
MIC
HALK
E
Der ehemalige Monopolist regte sicherst, als es schon zu spät war. Plötz-lich bot der Berliner Stromversor-
ger Bewag dem CD-Hüllen-Hersteller Jür-gen Freidank Konditionen, wie sie sonstnur Großkunden erhalten – einen Preis-nachlaß von 20 Prozent ab sofort und rück-wirkend eine Erstattung von 8 Prozent.
Freidank lehnte ab. 29 Jahre lang hatteer der Bewag nach seinem Empfinden vielzuviel bezahlt, zuletzt knapp 700000 Markim Jahr. Um wettbewerbsfähig zu bleiben,hatte er einen Teil der Produktion nachSchottland verlagert, wo er nur die Hälftedes Bewag-Preises zahlt.
Künftig kauft der Mittelständler denStrom für seine Firma Magnamedia bei derDortmunder VEW, gemeinsam mit 100 an-deren Berliner Unternehmen, und spartdadurch 180000 Mark netto.
Vermittelt hat den Deal die Ampere AG,die erste unabhängige Strom-Broking-Fir-ma in Deutschland. Ampere betreibt einvöllig neues Geschäft, das seit der Öffnungdes deutschen Strommarktes am 29. Aprilvergangenen Jahres möglich wurde: JederBürger kann sich, zumindest theoretisch,Strom kaufen, wo er will, die alten Ge-bietsmonopole gibt es nicht mehr.
Der Broker Ampere hat Stromkundenaus dem Berliner Mittelstand zu einemNachfrage-Pool gebündelt und für dengeballten Bedarf von 122 Millionen Kilo-wattstunden – das entspricht etwa demVerbrauch von 55 000 Haushalten – dengünstigsten Anbieter im Land gesucht.
Damit verschafft Ampere auch kleine-ren Unternehmen die Chance, ihren Strombillig einzukaufen. Bislang kam die Libe-ralisierung des Energiemarktes nur Groß-konzernen zugute. Energieversorger ge-währen ihnen einen so großen Rabatt,daß der Wechsel trotz der zusätzlich zuzahlenden Durchleitungsgebühren für re-gionale und kommunale Netzbetreiberlohnt. Für Privat- und kleine Firmenkun-den dagegen war der Wechsel dadurchmeist unattraktiv. Anders als im Telefon-markt gibt es keine Regulierungsbehörde,die darauf achtet, daß die alten Mono-polisten den neuen Wettbewerbern faireKonditionen gewähren.
Der Broker Ampere überspringt dieWettbewerbsschranke jedoch, indem erden Strom für viele Kleinkunden gemein-
bis 28. April 1998
Ehemalige Gebimonopole der dStromversorger
RWE
HEW
PreussElektra(Veba)VEW
Energie-Baden-Württemberg
RWE
R
RWE
sam einkauft. Die Aus-schreibung, an der sichGroßkonzerne von derHEW bis zu den Bay-ernwerken beteiligten,hat die VEW EnergieAG gewonnen – der Ex-Monopolist von Westfa-len. Ersparnis: 27 Pro-zent im Schnitt. Dasschaffen sonst nur Kun-den wie DaimlerChrys-ler oder auch Kettenwie McDonald’s, diebundesweit denselbenLieferanten wollen.
Die Idee für das Am-pere-Geschäft brachtendie Brüder Claus undArndt Rottenbacher, 33und 35, aus den USAmit. Geld verdienten die ehemaligen Un-ternehmensberater bislang damit nochnicht. Doch das wird sich bald ändern.
Für die Verhandlungen mit den Strom-riesen und die bundesweite Suche nachdem besten Preis verlangen die Strombro-ker im Gegensatz zu Energieberatern keinHonorar. Erst wenn ein Kunde wenigerzahlt, wird Provision fällig: ein Viertel deseingesparten Betrags zum Quartalsende.
Die alten Monopolisten reagieren emp-findlich auf die Broker: „Wir brauchen kei-
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
s-tschen
-
Veag
Bewag
Bayernwerk(Viag)
E
ne Makler und lassen uns von denen auchnicht unter Druck setzen, wir wollen un-sere Angebote direkt an den Kunden wei-tergeben – ohne Provisionen“, sagt einSprecher der Bewag. Aber gute Angebotekommen offenbar nur, wenn die Kundenmit der Abwanderung zu den Stromrebel-len drohen.
Empört gab sich die Bewag nach einemanderen Coup von Ampere: Die Maklerhatten das Berliner Abgeordnetenhaus an die Energie Baden-Württemberg ver-mittelt. Der Berliner Stromversorger warfdem Parlament vor, für einen kurzfristi-gen Vorteil Arbeitsplätze in der Haupt-stadt zu gefährden. Trotzig nahm dieBewag noch nicht einmal an der offiziel-len Ausschreibung des ersten Berlin-Poolsteil. „Betriebswirtschaftlich gesehen völligunverständlich“, sagt Claus Rottenbacher.So verliert die Bewag jetzt Millionen andie VEW.
Im Territorium der RWE hat Ampereeinen weiteren Pool zusammengestellt –knapp 60 Betriebe mit einer Stromnach-frage von etwa 15 Millionen Mark. InNachverhandlungen hat sich die RWE Energie AG zu erheblichen Preisnachlässenfür die Pool-Mitglieder bereit erklärt. Sokann sie – mit neuen Verträgen – ihreKunden behalten.
In Süddeutschland will Ampere, in Ko-operation mit dem baden-württember-gischen Handwerkstag, 118 000 kleineHandwerksbetriebe in einem Riesen-Pool
zusammenschließen unddie Gesamtversorgungbundesweit ausschrei-ben. Eine Hotline für dieKunden läuft bereits.
Ein Problem im Ener-giemarkt bleibt aller-dings die Durchleitungdes Stroms durch dieNetze der ehemaligenMonopolisten: Die ei-nen schrauben die Prei-se hoch, die anderenverweigern sich ganz. Soverweist die BerlinerBewag auf technischeEngpässe wegen derfrüheren Insellage West-Berlins und will Fremd-strom erst durchleiten,wenn die Kapazitätenerweitert sind. Das aber
kann Jahre dauern. Kunden und Kon-kurrenten haben deswegen Beschwerdebeim Bundeskartellamt eingereicht. DieEntscheidung wird in den nächsten Wochen erwartet.
Auf Dauer aber werden sich die Strom-konzerne dem neuen Wettbewerb nichtverschließen können. Die Börse jedenfallsreagierte eindeutig, als der StrombrokerAmpere den Wechsel der 100 Firmen be-kanntgab: Der Kurs der Bewag-Aktie fielum 4,28 Prozent. Polly Schmincke

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Wirtschaft
W E L T H A N D E L
Weder Kriegnoch FriedenAmerikaner und Europäerkämpfen um Vorteile beim
Handel mit Fleisch, Flugzeugenund Bananen – nicht
immer mit fairen Mitteln.
Rinder in Montana: Rückstände von Hormonen
Europa-Parlament in Brüssel: Labyrinthische F
Sir Leon Brittan stimmte die EU-Außenminister in Luxemburg aufWaffenstillstand, wenn nicht gar aufFrieden ein – zumindest im Handelskriegzwischen den USA und der EU. Nach derNiederlage der Europäer im Bananenstreitvor dem Schiedsgericht der Welthandels-organisation WTO müsse man nun schnellWashington und Chiquita zu Willen sein.
Obstruktion aus Brüssel, versprach SirLeon, werde es nicht mehr geben. Dochschon zwei Tage später, am Mittwoch, bra-chen dann wieder Feindseligkeiten aus. DieKommission drohte, vom 15. Juni an keinKilo US-Rindfleisch mehr auf den altenKontinent zu lassen, wenn bis dahin nichtzweifelsfrei sichergestellt werde, daß dieUS-Rinder in ihrem kurzen Leben niemalsmit künstlichen Wachstumshormonen ge-mästet worden seien.
Nur 24 Stunden später beschlossen dieEU-Industrieminister in Luxemburg zudemeine Richtlinie gegen Flugzeuglärm, dieWashington überhaupt nicht paßt. Um dengroßen atlantischen Bruder nicht allzusehrzu verärgern, versprachen die Ministerfeierlich, das Paragraphenwerk nach In-krafttreten für ein Jahr auf Eis zu legen.
Fleisch und Fluglärm sind verzwickteBeispiele für die komplizierten Handels-beziehungen zwischen Europa und denUSA. Schon vor zehn Jahren hatte die EUden Import von Rindern gebannt, die mitWachstumshormonen gefüttert waren, weilderen Fleisch hierzulande als gesundheits-schädlich gilt.
Im Januar 1998 entschied das Schieds-gericht der WTO auf Betreiben Kanadasund der USA, die EU-Beweise reichtennicht. Die Behörde gab Brüssel bis zum 13.Mai dieses Jahres Zeit, um nachzubessern.Vor wenigen Wochen mußte die Kommis-sion indes eingestehen, daß die in Auftraggegebenen 17 Studien nicht rechtzeitig fer-tig werden.
Washington klagt, seinen Farmern ent-gehe jährlich ein Milliarden-Dollar-Ge-schäft mit der Union. Die USA verlangendie Freigabe, andernfalls drohen sie mitEinfuhrzöllen auf EU-Waren in gleicherHöhe – nach den WTO-Regeln zu Recht.
Noch verzwickter wird die Gemengela-ge, weil parallel zwischen Washington undBrüssel ein zweiter Rinderstreit ausge-
fochten wird. Um Washington zu besänfti-gen, hatte die EU zugestanden, unabhängigvom Hormonstreit jährlich wenigstens 7000Tonnen hormonfreies US-Beef auf den eu-ropäischen Markt zu lassen.
Dieses Fleisch stammt von Farmern, dieeidesstattlich versichert haben, ohne Hor-mongaben zu mästen. EU-Kontrolleurefanden jedoch in den Importen Rückstän-de von Präparaten, die zum Teil selbst nachUS-Recht verboten sind. Das wiederum
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
führte zu der Ankündigung,auch diese Lieferungen vom15. Juni an zurückzuweisen.Das Verdikt gegen US-Beefwäre perfekt.
Ein Ausweg bleibt allerdingsnoch. In den nächsten sechsWochen prüfen die EU-Vete-rinäre jede Ladung US-Fleisch. Schafft es Washingtonbis zum 15. Juni, einwandfreieWare wie vereinbart anzulan-den, kann wenigstens dieserHandel weiterlaufen. Solltenaber die am Jahresende zupräsentierenden Belege für dieGesundheitsschädlichkeit derHormonspritzen der WTOnicht reichen, muß die EUihren Markt für die US-Far-mer weit öffnen.
Ähnlich labyrinthisch ver-laufen die Fronten im Flug-lärmstreit. Die von den Indu-strieministern verabschiedeteRichtlinie soll ein höheresLärmschutzniveau bei Startsund Landungen sichern als dieinternational vereinbartenGrenzwerte. Begründung: Eu-ropa sei dichter besiedelt alsdie Staaten.
Die von der EU festgeleg-ten Richtlinien empfinden dieAmerikaner als Schlag gegenBoeing und als Schutzzaun fürdessen europäischen Konkur-renten Airbus. Denn es gibtkeinen Airbus, der davon be-troffen würde, aber sehr vieleältere Boeings.
Einen nachträglich montier-ten Schallschutz, die „hushkits“, lassen die Europäernicht gelten. NachgebesserteBoeings machten zwar nichtviel mehr Lärm als die Air-busse, sie seien aber kleiner.Also sei der Lärm pro Fracht-tonne oder Passagier größer.
Eine strikte Anwendungdieser Regeln würde vor allemden US-Fluggesellschaften ei-nen Milliardenschaden berei-ten. Wenn sie ihre Flugflottenmodernisieren, verkaufen siedie Oldies an weniger potenteCarrier in der Dritten Welt.
Dazu müssen die Jets umgemeldet wer-den, eine neue Europa-Zulassung wird fäl-lig. Diese aber wäre ab 2002 nicht mehrmöglich – der Markt für gebrauchteBoeings bräche zusammen.
Noch versuchen die Europäer, den Kon-flikt zu entschärfen. Im verbleibenden Jahr,in dem die verabschiedete Richtlinie nochnicht gilt, soll mit den Amerikanern ge-meinsam ein Meßsystem für Fluglärm ent-wickelt werden. Winfried Didzoleit
B.
FO
X /
AG
EN
TU
R F
OC
US
ronten
W.
v. C
APPELLEN
/ R
EPO
RTER
S
93

94
Wirtschaft
Die Gucci-FreierGeschäftsjahr 1998
in Milliarden Euro
LVMHMOET HENNESSY-
PPRPINAULT PRINTEMPS-REDOUTE
UMSATZ16,5016,50 6,936,93
L U X U S I N D U S T R I E
„Kategorisch nein“Die Übernahmeschlacht um die Florentiner
Edelschneiderei Gucci empört die Italiener. Sie fürchten den Ausverkauf ihrer Modeindustrie.
Gucci-ModenschauAufgebrachte Gefühle
0,520,51 0,520,513300071000
GEWINN
BESCHÄFTIGTE 3300071000
LOUIS VUITTON
In dichten Trauben drängten sich dieMenschen vor den Gucci-Boutiquen inRom und Mailand. Drinnen ging es zu
wie beim Schlußverkauf. Die Kunden nah-men mit, was nur auf dem Bügel hing. Umjeden Preis: ein Pullover für 750, ein Kleidfür 8000, eine Hose für 2400 Mark.
Der Grund für den ungewöhnlichenAndrang bei den Luxusläden: Ein Franzo-se will Gucci, den erfolgreichen Edel-schneider, schlucken. Diese Nachricht triebRömer, Mailänder und andere gutbetuch-te Italiener zur Jagd nach den, wie siefürchteten, letzten Originalen aus demGucci-Sortiment.
Das war im Januar. Bernard Arnault,Chef des weltweit größten Konzerns fürLuxusartikel, griff – mit Milliarden in derHand – nach der Edelmar-ke aus Florenz. Heute istzwar ein Franzose Gucci-Mehrheitsaktionär, aber esist nicht Arnault.
Der kämpft noch immerum seine Beute, mit nochmehr Geld und inzwischenauch vor Gericht. Arnaultgegen alle: gegen die auf-gebrachten Gefühle der Ita-liener, die um ein Stück na-tionaler Identität bangen;gegen Politiker und Öko-nomen, die fürchten, mitGucci könne die gesamte„Alta Moda“-Branche insRutschen kommen und insAusland abwandern.
Arnault, 50, von derenglischen Wirtschaftszei-tung „Financial Times“ als„Wolf im Kaschmir“ ge-adelt, kauft seit 20 Jahren,was ihm gefällt: Die Mode-schöpfer Dior, Kenzo undLacroix, den ParfümierGuerlain, den Cognacbren-ner Hennessy, den Leder-Guru Louis Vuitton, dieChampagner-Könige Krugund Moët.
All diese Nobelmarkengehören nun zu seinemMischkonzern mit der sper-rigen Buchstaben-Kombi-nation LVMH, einem Un-ternehmen mit 33000 Mit-arbeitern. „Mit nichts ist so L
AZZAR
I / M
ON
DAD
OR
I / P
ICTU
RE P
RES
S
viel Geld zu verdienen wie mit Luxus“,lautet der Wahlspruch des Franzosen.Ver-gangenes Jahr setzte er knapp 14 Milliar-den Mark damit um.
Vor allem in Asien gehen die Geschäftejetzt aber eher schlecht. Moët-Champa-gner und Hennessy-Cognac bleiben in denKellern liegen, seit die reichen Asiaten zubilligeren Alternativen greifen. Stylist Chri-stian Lacroix bringt statt Millionen eherMiese in die Kasse. Selbst der Givenchy-Künstler Alexander McQueen und der wil-de Dior-Designer John Galliano erweisensich finanziell eher als Flop. Die ausge-flippten Briten verzaubern zwar profes-sionelle Kritiker, vergraulen aber die Kun-den – zu wenige Damen wagen sich an de-ren Transparent-Blusen und Extrem-Minis.
Kein Wunder, daß Ar-nault auf Gucci scharf ist.Denn die Zahlen des ita-lienischen Konkurrentenhaben mehr Glamour. DieFlorentiner Firma setzte1998 rund eine MilliardeDollar um, binnen fünf Jah-ren ist der Umsatz der Ita-liener um knapp 400 Pro-zent explodiert.
Klammheimlich kaufteArnault Anfang Januar 34Prozent der Gucci-Aktienund war plötzlich der größ-te Aktionär. Sofort forderteer Mitspracherechte im Un-ternehmen und Vertrauens-leute im Verwaltungsrat.
Gucci-Präsident Dome-nico De Sole, 55, mag sol-che Einmischungen nichthinnehmen. Er fürchtet umdie Jobs – vor allem umseinen eigenen. Denn alsArnault mit dem Textilkon-zern Boussac 1984 auch denModemacher Dior über-nahm, verloren bald darauf6000 Beschäftigte ihrenJob, darunter Dior-ChefPaul Audrain.
Der Gucci-Chef sagte al-so „kategorisch nein“ zumArnault-Antrag und holtezum Gegenschlag aus. Wie
d e r s p i e g e
gerufen kam ihm dabei ein anderer In-teressent.
De Sole gab einfach neue Gucci-Aktienaus, erhöhte damit das Firmenkapital unddrückte so den Anteil des von Arnault ge-kauften Pakets am Aktienbestand auf 21Prozent. Die neuen Papiere kaufte für 2,9Milliarden Dollar ein Franzose namensFrançois Pinault, 62. Über Nacht war ermit 40 Prozent der größte Gucci-Aktionär.
Der Landsmann von Arnault, genausoreich und ebenso ehrgeizig, ist schon seitJahren dessen größter Konkurrent. Derehemalige Holzhändler hat mit amerika-nischen Schrottanleihen, den sogenanntenJunk-Bonds, Milliarden gemacht. Heutezählt Pinault zu den zehn reichsten Män-nern in Frankreich.
Zu seinem Konzern Pinault-Printemps-Redoute gehören das Aktionshaus Chri-stie’s und der Sanofi-Schönheitskonzernmit Marken wie Yves Saint Laurent, Fendiund Oscar de la Renta.
In Amsterdam, wo Gucci aus steuerli-chen Gründen seinen offiziellen Firmensitzhat, klagt Arnault nun gegen die willkürli-che Kapitalerhöhung, die ihn vorüberge-hend aus dem Rennen warf. Zugleichmachte er den Aktionären des FlorentinerModehauses ein neues, aufgebessertes An-gebot: 14 Milliarden Mark.
Das verbissene Schachern der Herrenum das schillernde Modeatelier ist in Ita-lien längst ein Thema von nationalem Ranggeworden.Was sind, bitte schön, Milliarden– selbst in harten Dollars – gegen den Ver-kauf eines Herzstücks der italienischenWirtschaft? „Italien ist zu dem meistbe-neideten Land der Welt geworden“, jubeltSanto Versace, Präsident der nationalenKammer italienischer Mode, „vor allemdank der Mode.“
l 1 8 / 1 9 9 9

Chef Arnault: Allein gegen alle
Eine Industrialisierung à la Arnault,fürchten Alta-Moda-Designer, wäre dasEnde jeder kreativ-erfolgreichen HauteCouture. Das Ergebnis sehe man ja beiArnaults Vasallen Givenchy und Dior, esfehle die authentische Handschrift. „Unterden Kleidern ist einfach nichts …“, sagtLaura Bernabei, Ehefrau und Chef-Assistentin des Designers EmanuelUngaro.
So wie bisher, da sind sich dieExperten einig, kann es in Italienjedoch nicht weitergehen. Nur wenndie Nadel-und-Faden-Künstler ausihrem Dolce-vita-Traum erwachten,meinen sie, hätten ihre FirmenÜberlebenschancen auf dem Welt-markt: ein bißchen mehr Manage-ment, ein bißchen weniger Highlifeund Familienzoff.
Seit Gucci so spektakulär in Ge-fahr geriet, ist auch Italiens Regie-rung um die tapferen Schneiderleinbemüht. Denn ein Ausverkauf ins Auslandkäme das Land womöglich teuer zu stehen:Mit 27 Milliarden Mark Exportumsatzbringt die Modebranche mehr als die Hälf-te aller italienischen Auslandseinnahmen.Ohne die Dollar, Mark und Yen für Schu-he und Schals, Röcke und Roben wäre Ita-lien so gut wie pleite.
Drum sollen nun, pronto, pronto, Styli-sten und Industrielle an einem „Runden
LVMH-
Tisch“ zusammenkommen. Mit „globalerPromotion für den italienischen Stil“glaubt Italiens Außenhandelsminister Pie-ro Fassino neue Kunden in aller Welt fin-den zu können. Gleichzeitig sollen net-tere Gesetze für die Branche das Nähendaheim kuscheliger machen.
Die Stars des eitlen Gewerbes, die ihreKollektionen und Geldbeutel stets vor ei-fersüchtigen Kollegen versteckten, denkenplötzlich sogar laut über einen gemeinsa-men Finanz-Pool nach, um feindliche In-vasoren aus dem Ausland besser abwehrenzu können.
Soviel Patriotismus zwingt selbst Desi-gner, die schon mit dem Feind flirteten,zurück zur Fahnentreue. Etwa Giorgio Ar-
mani. Bei der Mailänder Modewoche imJanuar hatte LVMH-Chef Arnault dem Ita-liener seine Aufwartung gemacht. Langeund demonstrativ-sichtbar plauderte Ar-nault mit dem erfolgreichen Nadel-Künst-ler. Anschließend empfand der Mode-schöpfer „große Bewunderung“ für den
Franzosen und gestand vielsagend:„Ich denke mehr und mehr übermeine Zukunft nach.“
Basta. Der französische Traum istaus. Jetzt heißt es für Armani, sichwieder als guter Italiener zu prä-sentieren oder den Vorwurf vonLandes-Moden-Verrat zu riskieren.„Nie werde ich mich an die GruppeArnault übergeben“ schwört ernun. Er werde für sein Unterneh-men, Jahresumsatz 1,5 MilliardenMark, einen Landsmann suchen,der um die 6 Milliarden Mark be-zahlt und „Giorgio Armani als Chefmitschleppt“.
Zumindest ein Modemacher kann dasmonatelange Geschacher um Gucci schonjetzt als vollen Erfolg für sich verbuchen.Der drohende Untergang der italienischenErfolgsbranche inspirierte das römischeModehaus Gattinoni zu einer neuenKreation mit aktuellem Bezug: Auf einemausladenden, lappigen T-Shirt steht inGroßbuchstaben „Made in Italy – zu ver-kaufen“. Elna Utermöhle
BAR
ET /
RAPH
O /
AG
EN
TU
R F
OC
US

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Trends Medien
Bremer
BO
NG
ARTS
J O U R N A L I S T E N
Streit um DopingEin neuer Ost-West-Konflikt beschäftigt Deutschlands
Sportjournalisten. Zur alljährlichen Verleihung der Fair-play-Trophäe hatte ihr Verband VDS ursprünglich die Schwim-mer Chris-Carol Bremer und Mark Warnecke vorgesehen. Siehatten öffentlich das grassierende Dopingproblem in ihrerSportart angeprangert. VDS-Präsident Karl-Heinz Cammanngab bereits eine Laudatio in Arbeit und kündigte telefonischbei den Schwimmern an, daß der VDS ihnen „für ihren Ein-satz auf die Schultern klopfen“ wolle. Doch vor der Abstim-mung vollführte das VDS-Präsidium eine überraschende Volte.
d e r s p i e g e l
W.
M.
WEBER
Der Erfurter dpa-Journalist Uwe Jentzsch, einziger Vertreteraus den neuen Bundesländern im siebenköpfigen Gremium,drohte Cammann mit einer Austrittswelle der 250 ostdeut-schen VDS-Mitglieder. Seine verblüffende Begründung: DieDopinganklage von Bremer (Hannover) und Warnecke (Essen)richte sich gegen ostdeutsche Schwimmer, eine Ehrung derbeiden empfänden er und seine Kollegen als „Affront“.Statt der Schwimmer kürte der VDS nun den russischenSkisportler Wiktor Majgurow. Der hatte dem havariertenSchlußläufer der deutschen Biathlon-Staffel, dem ThüringerFrank Luck, bei einem Weltcup-Rennen einen Ski zur Ver-fügung gestellt und den Deutschen so zum Sieg verholfen.In Aufzeichnungen des ehemaligen DDR-Arztes Hans-JoachimKämpfe, die kürzlich aufgetaucht sind, ist Frank Luck alsDopingkonsument aufgelistet.
F I L M H A N D E L
Hollywoodmesse in KölnNordrhein-Westfalens Ministerpräsi-
dent Wolfgang Clement (SPD) willin Köln eine internationale Messe fürden Handel mit TV-Programmen star-ten. Sie soll im nächsten Jahr erstmalsstattfinden und orientiert sich an ähnli-chen Branchenereignissen wie etwa derMIP-TV in Cannes. Für die Organisa-
tion ist Clements neuer Medienberater,Ex-RTL-Chef Helmut Thoma, zuständig.Er soll die großen Hollywoodstudios, zudenen er intensiven Kontakt hält, nachKöln locken. Die NRW-Medienpolitikersehen auf dem Fernsehmarkt Deutsch-land einen großen Bedarf für den Han-del mit TV-Programmen. Bisher gibt esin Deutschland nur die Mini-Verkaufs-show „German Screenings“ von ARDund ZDF.
1 8 / 1 9 9 9
M A G A Z I N E
Die Star-BetreuerIm Kampf um die US-Topstars sind
die Grenzen der journalistischenGlaubwürdigkeit erreicht: Deren PR-Agenten, die „publicists“, entscheidenheute fast allein, welches Blatt, welcherFernsehsender Zugriffauf den berühmtenKunden hat. Das ver-traglich zugesicherteTitelblatt ist nahezuNormalität, dazu dieZusicherung, keine kri-tischen Fragen zumletzten Film zu stellen,schon gar nicht überdas Privatleben. DieFotos, die den Text be-gleiten, wählt oft nichtder Chefredakteur,sondern die PR-Truppein Hollywood aus. Widerstand in derBranche ist kaum zu spüren. Society-Magazine wie „Vanity Fair“, „People“oder „InStyle“ haben sogenannteWranglers angestellt, Redakteure, dienicht schreiben, sondern die Stars ein-fangen sollen – für Exklusivstorys mitExklusivbildern. Der Preis für diesejournalistische Unterwerfung, notierteder „New York Observer“, „ist Maga-zin-Journalismus, der in der Bedeu-tungslosigkeit stirbt“.
„Vanity Fair“
P U B L I C R E L A T I O N S
Ferenczy sucht weiterDer Münchner Medienmanager Josef
von Ferenczy, 80, muß weiter nacheinem Partner suchen, um die Zukunftseines PR-Unternehmens zu sichern.Mitte vergangener Woche scheitertendie seit längerem andauernden Ge-spräche mit einer Investorengruppe umden Münchner Chipunternehmer undBuchautor Erich Lejeune und einerBeteiligungsgesellschaft der HypoVer-einsbank, die bei Ferenczy einsteigenwollten. „Die Interessen über das wei-tere unternehmerische Entwicklungs-konzept waren nicht in Übereinstim-mung zu bringen“, heißt es in einerkurzen Mitteilung. Doch das ist wohlnur die halbe Wahrheit. Lejeune wollteFerenczy schon bald aufs Altenteil
schicken. Auch tauchtebei den Verhandlungenerneut ein alter Be-kannter auf: DietrichWalther, Chef desFinanzdienstleistersGold-Zack. DessenUnternehmen hat sich
darauf spezialisiert, junge Firmen an dieBörse zu bringen, und zog schon beiden geplatzten Verhandlungen mit derFrankfurter PR-Firma Hunzinger imvergangenen Jahr die Fäden. Walthersitzt sowohl bei Hunzinger wie beiLejeune im Aufsichtsrat und hält anbeiden Unternehmen zehn Prozent.In Branchenkreisen wird vermutet, dieGespräche seien abgebrochen worden,weil der Banker über die neuen Ei-gentümer erneut Druck machen wollte,die Firma möglichst schnell an die Bör-se zu bringen.
Ferenczy
99

Marktanteile desNachrichtensenders n-tv vorund seit Beginn des Kosovo-
Kriegs am 24. März1,8
1,3
2,2
1,0
24. 1. 22. 27.AprilMärz
0,6
durchschnitt-licher Monats-wert im Januarund Februar
8. 15.
Angaben in Prozent;Zuschauer ab
14 Jahre
durchschnitt-licher Monats-wert im Januarund Februar
Medien
100
Q U O T E N
Boom vorbeiZumindest kleine TV-Anbieter kön-
nen bei der Berichterstattung überKrieg nicht mit einem anhaltendenZuschauerboom rechnen. Diese Erfah-rung macht derzeit der Nachrichten-sender n-tv. Mehr als einen Monatnach Ausbruch des Konflikts im Koso-vo hat sich der n-tv-Marktanteil hal-biert und beträgt nur noch rund einProzent. Bald dürfte der Sender aufsein Normalmaß geschrumpft sein: 0,6Prozent. Die Sondersendungen vonARD und ZDF hingegen können sichnoch recht gut behaupten. Auf Kostender Privaten. Allein bei Pro Sieben sollder Verlust durch die Kosovo-Bericht-erstattung der Öffentlich-Rechtlichenzwischen 0,2 und o,3 Prozent liegen.
SYG
MA
L E U T E
Talk der TrappistenNacht muß es sein, wenn Deutsch-
lands Talker schweigen.Von 2.00bis 2.30 Uhr in West III an diesemFreitag sitzen die Tollitäten der Quas-selbranche – Domian, Willemsen, diLorenzo, Bio, Jauch, Schäfer, Kies-bauer – vor der Kamera beieinanderund sagen kein einziges Wort.Ein Azubi der Medien-Hochschu-le Köln, Uli Wilkes, 28, hat sich
„No Talk“ ausgedacht – es ist seine Diplomarbeit. „In-dem sie schweigen, klagen
sie an“, wußteschon Cicero,und der Aus-druck „beredtesSchweigen“ sagtalles.Tatsächlich of-fenbaren sich inder Runde der
Zwangstrappisten die Attitüden derModeratoren schneller, als es tausendWorte täten.Günther Jauch guckt mit finster entschlossenem Dackelblick, zu kei-ner Änderung bereit. Botschaft: EinSportler hält durch, auch wenn derWahnsinn tobt.Roger Willemsen und Giovanni diLorenzo, Galionsfiguren der gebilde-ten Stände, dagegen verfallen wäh-rend des Experiments immer wiederin überlegenes Lächeln. Es ist, alsschauten sie selbstzufrieden auf deninneren Schatz ihrer medialen Weis-heit. Ganz Eingeweihte in die Tor-heiten des TV-Betriebs, nehmen siedoch gern als Toren an ihm teil.Indem sie schweigen, verraten sie:Egal wo wir sind, wir durchschau-en den Wahnsinn. Hauptsache, wirsind dabei.Die blonde Bärbel dagegen umgibtsich mit der Aura des Trotzes: Ich sit-ze hier, ihr könnt mich verachten,aber ich sitze hier.Als geborene Plappermäuler verra-ten sich Alfred Biolek und ArabellaKiesbauer. Bio räuspert sich oft,schaut auf die Uhr und verbeißt sichmit der Energie eines Nußknackersaufsteigende Rederitis-Anfälle. Ara-bella – hyperaktives Spielkind – kannnur mühsam das Prusten unter-drücken, ihr wirkliches Talkshow-Le-ben will heraus. Und Domian? Erblickt auch hier wie ein gestreßterNachtfalke. „No Talk“ – wie gut, daßman mal ausführlich drüber ge-schwiegen hat.
Outing ohne Folgen?Bild“-Schlagzeile: „Tatort-Kommissarin
Ulrike Folkerts: Ja, ich liebe Frauen“.Was das Boulevardblatt vergangene Woche
als Sensation verkündete, war in der Bran-che längst bekannt. Dennoch häuften sich Zu-
schaueranfragen bei Folkerts’ Haupt-Arbeitge-ber, dem Südwestrundfunk (SWR): Ob das„Bild“-Outing Folgen für ihre Rolle als „Tat-ort“-Kommissarin Odenthal habe. Hat es
nicht – das versichert Dietrich Mack, Leiterder Abteilung Fernsehspiel: „Frau Folkerts’
Privatleben geht uns nichts an.“ Im übrigen habe er die Erfahrung gemacht, daß Zu-schauer ihr Wissen über das private Leben einer Schauspielerin von der Fernsehper-son trennen würden. Wenn Lena Odenthal also in einer der nächsten „Tatort“-Folgenmal wieder einen Mann küssen müsse, werde keiner an der Glaubwürdigkeit derSzene zweifeln. Sorgen, daß Folkerts endgültig auf den Typus einer herben Frau fest-gelegt sei, hat Mack auch nicht. Sie wolle auch andere Seiten zeigen. Mack: „Wir er-arbeiten gerade eine neue Figur – jenseits vom ,Tatort‘. Worum es geht, kann ichnoch nicht verraten, aber ich versichere: Die Zuschauer werden überrascht sein.“
„Tatort“-Star Folkerts
AC
TIO
N P
RES
S
Europäischer Satellit
P R O J E K T E
Thrill im AllSat 1 hebt ab: Im Januar nächsten Jahres will der
Fred-Kogel-Sender den dreiteiligen Weltraum-Thriller „Trillennium“ ausstrahlen. Um den Höhen-flug glaubhaft zu machen, läßt sich Sat 1 derzeit mit Originalaufnahmen von Satelliten aus dem Orbitbeliefern, die in die Spielszenen eingeschnitten wer-den. Für männliche Schönheit ist ebenfalls gesorgt:Als Astronauten fungieren Charles Huber und Bern-hard Bettermann. Huber war einst dunkelhäutiger Ad-latus des „Alten“, Bettermann wirkte als männlichesModel und tritt demnächst im Sat-1-Melodram „Call-boys“ auf.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9

Fernsehen
Vo r s c h a u
Bergmann, Simon in „Das verflixte Babyjahr – Nie wieder Sex?!“
Einschalten
360˚ – Geo-Reportage: SchönheitMontag, 20.15 Uhr, Arte
Bis zum Donnerstag dieser Woche wid-met sich diese Reportage-Reihe demThema Schönheit. Im ersten Berichtgeht es um eine äthiopische Model-Agentur, die versucht, die Beauties desLandes ins Modegeschäft der westli-chen Welt zu bringen. Dort schätztman exotische Erscheinungen. Ein we-nig zu unkritisch läßt der Kommentardie Behauptungen der modernenMädchenhändler stehen, bei der Aus-wahl eines Models käme es auf dessenPersönlichkeit an. Am Dienstag geht esnach Kuba, wo die Bewerberinnen fürdie Devisenbringer-Show „Tropicana“Schlange stehen. Trotz der Härte deskubanischen Alltags blickt der Zu-schauer meist in fröhliche Gesichterund lernt eine Lektion historische Figu-renkunde: Die Revolution bevorzugteden kurvigen Typ „mit Wespentailleund sonst viel dran“, heute regiert, ödewie überall, der Schlankheitswahn.
Das verflixte Babyjahr – Nie wieder Sex?!Mittwoch, 20.15 Uhr, RTL
Alete braucht das Baby, aber brauchenEltern immer Sex, sogar außereheli-chen? Diese TV-Komödie (Buch: BeateLangmaack, Regie: Markus Bräutigam)geht der Frage ausführlich nach. ZweiPaare in spiegelverkehrter Konstella-
Ausschalte
tion: Bei Lisa (Susanna Simon) undCarsten (Andreas Herder) ist abge-macht, daß sie, Chefin einer Fabrik fürFeuerwerkskörper, im Babyjahr zuHause bleibt. Sophia (Ina Weisse) undPeter (Tim Bergmann) halten’s umge-kehrt. Das Dumme: Die Babyhüter ver-lieben sich. Das Schöne: Am Ende wirdalles gut. Mit Slapstick und schnellenSchnitten überwindet das Stück diewindelige Einfalt der Vorlage.
Bangkok – Ein Mädchen verschwindet Freitag, 20.15 Uhr, Pro Sieben
Heroin schmuggelnde Ganoven, dick-bäuchige Sextouristen und ein versoffe-ner Ex-BKAler (Axel Milberg) – im
n
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Grünwal
Chaos der asiatischen Großstadt suchtein kleinbürgerliches Ehepaar (BettinaKupfer, Ulrich Noethen) aus Frankfurtnach der entführten Tochter. ThorstenNäter, Regisseur des vor Ort produzier-ten Pro-Sieben-Thrillers „Bangkok“,hat vor allem eins von seinen Hol-lywood-Vorbildern gelernt: Erwartun-gen dürfen nicht enttäuscht werden.Die Handlung schnurrt, die Spannungsteigt, und am Ende muß die FrauMann und Tochter mit Revolver undRaffinesse befreien. Und weil Bangkokirgendwie nach Hongkong klingt, darfauch das knackig choreographierteKampfsport-Finale nicht fehlen, in demsich sogar Bundesfilmpreisträger Noe-then als Kung-Fu-Anfänger versucht.
d, Mähl in „Hallo Schröder“
Deutschland heute morgenMontag bis Freitag, 5.30 Uhr, Sat 1
Gerade in den Zeiten des Kosovo-Krie-ges nervt das Sat-1-Frühstücksfernse-hen gewaltig. Sicher braucht der Bild-schirm wegen der Grausamkeiten aufdem Balkan nicht in Trauer und Ernstzu erstarren, aber die Daueraufge-räumtheit der Moderatoren wirkt de-plaziert. Ohnehin schon vollgepacktmit Werbeblöcken übt sich die Sendungin permanentem Schnickschnack mitHobby-Sängern, einem Telespiel, einemfetten Hund im Studio und der Mode-ratorin Andrea („Kiwi“) Kiewel, dieunaufhörlich gickert und gackert.Höhepunkt des morgendlichen Allo-tria: Am Montag vergangener Wochesaßen Dessous-Models im Studio, derZuschauer, der noch nicht auf die Uhrgeschaut hatte, mochte meinen, es wäre
noch Nacht und er sei in irgend-einem billigen Sexprogramm gelandet.
Hallo SchröderDienstag, 21.05 Uhr, ARD
Die ARD und Satire – bis aufwenige Ausnahmen ist das keinebesonders glückliche Ehe. DieSketchshow vom BayerischenRundfunk mit Günter Grünwaldund Eva Mähl bestätigt diese Er-kenntnis. Da klabautert die Kla-motte. Wo Figuren B. Scheuerleheißen und die Witze von B. Al-lermann aus Mallorca zu stam-men scheinen, da ersehnt sichder Zuschauer, hallo ARD-Pro-grammdirektor Günter Struwe,den Aufsichtsbeamten des Er-sten, W. Egdamit.
101

Medien
10
„A
I N T E R N E T
Am Anfang ist das Wort :-)
Chats im World Wide Web sind die Kommunikation der Zukunft. In virtueller Anonymität wird geliebt, gehaßt – und
gestorben. Allein in Deutschland treffen sich Hunderttau-sende täglich online. Ein Erfahrungsbericht von Thomas Tuma
Internet-Café in Mannheim (1997): Schon nach
Als ich „Annies“ graugrüne Augenzum erstenmal funkeln sehe, binich längst blind.Als ich anfange, die
Stimme von „GET MORE“ zu hören, binich bereits taub. Und als ich irgendwann dieHolzbohlen dieses Seitenstraßen-Puffs un-ter den Absätzen ächzen spüre, habe ich je-des Gefühl für die Realität abgeschüttelt,wie die meisten meiner vielen Rollen.
Vier Wochen lang war ich mal Mann,mal Frau. Ich nannte mich „Fruchtzwerg“oder „TOM“, „Fantasy“ oder „ES“, „Nie-mand“ oder „Gentleman“. 100 Gesichter,1000 Geschichten. Ich war Spekulant undWitzbold, Forscher und Erforschter, Beicht-vater und Nutte. Ich kittete Beziehungenund brach Herzen.
Operation: mißlungen, Patient: bebt. DasExperiment ist außer Kontrolle geraten. Eswird Zeit aufzuräumen. Aber was?
Meine Endstation ist die typische vir-tuelle Gosse namens „Erotic-Chat“. Es istein Raum, dessen einzige Wirklichkeit sei-ne Internet-Adresse zu sein scheint. Unterplayground.de hat die Online-Redaktionder Hamburger Verlagsgruppe Milchstraßeim World Wide Web zwölf Chat-Räumeeingerichtet. Hier treffen sich bis zu 600Neugierige gleichzeitig via PC. Klicken
2
mica“-Flirtline, 3-D-Chat, virtuelle Milka-Alm,
Sie’s ruhig mal an. Der Erotic-Chat ist derschlimmste von allen. Wirklich.
Hier kommt jeder rein – ohne Passwordoder gar E-Mail-Identifikation: Schuljungsund Spinner, Abenteurerinnen und Maul-helden. Die Herren tragen charmante Na-men wie „Eisenpimmel“ oder „Morgen-latte“. Die Damen, wenn es überhaupt wel-che sind, nennen sich „Strapsmaus“ oder„Vanessa-bi“.
Chatten heißt plappern. Und genau daswird dort rund um die Uhr getan. Zu Be-ginn der neunziger Jahre eröffneten die er-sten deutschen Gesprächsrunden.Anfangswaren es kleine, friedvolle Inseln in derBrandung der ersten Internet-Euphorie.
Surfen langweilt schnell, weil auf jederWelle der Absturz droht. Weil man immerein Zusatzprogramm braucht, das nie funk-tioniert. Und weil man keine eigenen Spu-ren hinterläßt in der Datenflut.Also bleibtman irgendwann an einem Chat-„Strand“liegen. Der von langnese.de heißt sogar so.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Cyber-Stadt Funcity: Politik oder Religion, Sex
Der deutsche Chat-Suchdienst Web-chat.de zählt rund 600 unabhängige Kanäle,in denen über alles geredet wird, selten je-doch über mehr als drei Zeilen. Es gibt Re-ligions-Runden und Politik-Chats, Pausen-höfe für Schulkinder, Flirtlines und Juri-sten-Stammtische. Das Geraune am elek-tronischen Schwarzen Brett des Direkt-Bro-kers consors.de („Achtet mal auf Mobil-com!“) soll Kurslawinen auslösen können.
Allein AOL, der weltweit größte Online-Dienst, bietet seinen 17 Millionen Mit-gliedern rund 19000 Chat-Räume an, etwa
, Schul- und Eheprobleme – in der Anonymität

wenigen Stunden im Netz ist Reden nur noch Silber, Schreiben wird GoldB. BOSTELMANN / ARGUM
des
tausend davon in deutscher Sprache.„E-Mail ist das eine“, sagt AOL-MannAlexander Adler, „aber Echtzeit-Kommu-nikation im Chat ist weitaus spannender“– und rätselhafter.
Alles, was ich brauchte, war eine An-laufstelle wie gamehouse.de, wo ich sofortgefragt wurde, mit welchem Spitznamen(Nick) ich eintreten wolle. Der Nick verrätschon ein bißchen was über den Träger.„Eve“ oder „Molly“ sind typische Se-kretärinnen-Namen. Anders als „Fickstu-te“ zumindest, der man selbst im Nebeldes Cyberspace sofort ansieht, daß sie ei-gentlich Ingo heißt, ein einsamer Compu-ter-Freak ist und vor lauter Geilheit kaumdie Hände auf der Tastatur halten kann.Aber das wußte ich noch nicht, als das nieversiegende Gebrabbel wie CB-Funk für
virtuellen Raums wird über alles geredet, nur
Legastheniker über den Bildschirm zu ra-sen begann.
Wer ist wer? Wer antwortet gerade wem?Und was? Regel Nr. 1: Frag erst gar nicht.Alle sind gleich. Gleich anonym. Gleichbeim „Du“. Am Anfang ist das Wort. Unddas Wort ist bei dir, und du schreibst:TOM: Hallo, ich bin völlig neu im Chat.Könnt ihr mir mal was erklären?
Jetzt bist du drin. Irgend jemand hat meistMitleid und antwortet: „Hi TOM, was? *g*“TOM: Zum Beispiel, was *g* bedeutet.
So lernt der Novize, daß da gerade einer grinste, gelächelt wird mit „:-)“, dasmit viel Phantasie wie ein nach links ge-kipptes, freundliches Gesicht aussieht. *lol* (laughing out loud) ist die Abkürzung ei-nes lauten Lachers. Gefühlsregungen oderAktionen lassen sich in Sternchen aus-
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
selten jedoch über mehr als drei Zeilen
drücken: *freu*, *knuddel*, *wink*, CUsteht für „see you“. Und „Mobitel“ heißt:„Moment bitte, Telefon.“
Tagsüber bedeutet das meist, daß da ge-rade jemand seinen Chef und das deutscheBruttosozialprodukt schädigt. Denn ge-plappert wird nicht nur zu Hause, an derUni oder im Internet-Café, sondern vor al-lem im Büro. An jedem vierten PC-Ar-beitsplatz, glauben Web-Profis, werde ge-chattet. Längst gibt es Unternehmen, dieihren Angestellten das Chat-Netz zer-schneiden, weil unter der Quatsch-Suchtnicht nur die Telefonrechnung leidet.JACCO: Was machst du so, TOM?TOM: Chatte beruflich *g*.
Plötzlich allerdings wurde uns das Fotoeiner jungen Frau auf den Schirm gedrängt,die sich Lilien in diverse Körperöffnungen
103

„Das Netz“: „Beinahe mitleiderregend“
gesteckt hatte. Regel Nr. 2:Chats sind Anarchie, einegesetzlose Spielwiese fürGelangweilte und Einsame,aber auch Schweine undpsychopathische Hacker, dieeinen bis auf die eigeneFestplatte zurückverfolgen,wenn sie wollen.
Manche Chats haben ei-nen Webmaster, eine ArtCyber-Polizei, die jedenausknipsen kann, der zuekelhaft wird. Besondersschlimme Randalierer kön-nen angezeigt werden. Kön-nen. Viele Chats haben nurungeschriebene Benimm-regeln, die Chatiquette.Und alle haben eine verschworene Stamm-gemeinde. Es gibt Räume, die wie düstereBurgen mit hochgeschraubter Zugbrückevor dem Neuling stehen, der sich die Fingerwundschreibt und doch ignoriert wird.
So cybert man weiter und erkundet mitjedem Klick Neuland. In einem Chat saßenaußer mir – als „Fruchtzwerg“ – nur nochdrei prollige Nachtschicht-Administrato-ren von Computerfirmen mit einer Fraunamens „Maerzipan“. Sie baggerten soblöde an ihr herum, daß ich sie irgend-wann „anflüsterte“. Auch das geht.
Klick ihren Namen an, und prompt kannnur sie dich lesen. Regel Nr. 3: Der öffent-liche Chat ist wie das Grundrauschen einesRadios. Erst das Flüstern justiert einen Sen-der – zum glücklichen Empfänger.
„Maerzipan“ ließ sich entführen, undwir flogen gemeinsam zum verwaisten Gamehouse-Salon. Kurz nach ein Uhr morgens waren wir dort völlig allein undbegannen zu reden: übers Schreiben, überPsychopathen und das Paralleluniversumder virtuellen Bundesrepublik.
Bullock im Film
104
Metropolis-Chef HafemannVirtuelle Stadt im Keller
T. B
ARTH
/ Z
EIT
EN
SPIE
GEL
Fruchtzwerg: Morgen stehe ich den glei-chen Leuten wieder im Bus gegenüber, diehier im Schutz der Anonymität die Hosenvor mir runterlassen *in Abgrund guck*.Maerzipan: Insofern ist das hier doch lehr-reicher als die Realität *g*.Fruchtzwerg: Ja, aber macht nicht das erstden Menschen aus, sein gut geschnittenerMantel aus Erziehung, Regeln und Kultur?Maerzipan: Nirgends sind Menschen derartehrlich wie in der Verlogenheit des Chats.
So ähnlich verplauderten wir fast dasMorgengrauen. Wir tranken virtuellenChampagner. Am Ende half ich „Maerzi-pan“ in einen Mantel, den es nicht gab,hielt ihr eine Tür auf, die nie existierte, undverabredete mit ihr, bis drei zu zählen, umgleichzeitig im Nichts zu verschwinden.Fruchtzwerg: Eins.Maerzipan: Zwei.Fruchtzwerg: Drei.
Nach einer Weile fragte ich: „Bist dunoch da?“ und starrte auf den Schirm.„Ja“, flimmerte die Antwort. Irgendwie ha-ben wir es dann doch geschafft, in die Rea-lität zurückzukehren. Ich sah sie nie wie-der. Aber das war einer jener mythischenMomente.
Man ist nur noch Sprache. Sprache zau-bert Gedanken, die zu flüchtiger Schönheitgefrieren. Man schwebt übers Eis und drehtverbale Pirouetten, obwohl man gar nichtrichtig Schlittschuhlaufen kann *g*. Manerschafft Kosmen und läßt sie sich kaputt-machen. „Wo meine Sprache endet, endetmeine Welt“, raunte ein unbekannter „Na-poleon“ durch einen anderen Chat.Als ichdas las, hatte ich es schon verstanden.
Kurz darauf wurde der Gamehouse-Sa-lon geschlossen, weil er zur Pornobude ver-kommen war. Seither quillt das Gästebuchüber: wann endlich wieder *süchtel*, war-um so lange und wo man wen treffen kann?Einige fanden bei nordchat.de Unterschlupfund eröffneten gleich ein eigenes, ruhigesGamehouse-Asyl. Auch der Aufbau neuerRäume ist im Internet möglich. Anderestromerten wie ich heimatlos weiter.
Bei milka.de kroch ich über die virtuel-le Oberzartinger Alm. Bei prosieben.de
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
lernte ich die Vorzüge ei-nes schnellen Servers ken-nen. Bei west.de hatte ichviel zu lachen, weil einZufallsgenerator an meineSatzfetzen noch eine An-rede nähte wie „meineZuckerstange“ oder „klei-nes Scheißerchen“.
Auf einer irrealen Park-bank redete ich mit einerHausfrau, deren Gatte we-nige Tage davor ihre sexu-ellen Chat-Phantasien aufder heimischen Festplatteentdeckt hatte. Den Abtei-lungsleiter eines Kaufhau-ses beriet ich bei Ehepro-blemen, die er sich bis da-
hin nicht einmal selbst eingestanden hatte.Ein Wiener jammerte mir vor, daß seineChat-Gier ihn mittlerweile 1500 Mark mo-natlich koste. Reden war Silber geworden,Schreiben Gold.
Und wenn es mal langweilig wurde, ver-wandelte ich mich in ein „Prinzeßchen“,huschte in eine anerkannt unterirdischeSickergrube wie praline.de, rief „Wer hatLust?“ in die Herrenrunde und sondiertedie Angebote, die schon rein orthogra-phisch außerordentlich schwankten. Von„He, fikken?“ bis zu „Bist du wirklich Prin-zessin oder die Erbse darunter :-)“ war al-les dabei.
Man muß den Sex nicht suchen, um ihnzu finden. Dem einen reicht der Rauscheiner gemeinsam verfaßten Kurzgeschich-te, die mit dem obligatorischen „Uuuh, ichkomme“ ihr schriftlich-schnödes Finale fin-det. Die anderen mailen einem ungefragtihre Handynummer – „stehe auf Tel.sex“.
Jede Nacht treffen sich Cyber-Bekannt-schaften zu echten Blind Dates. Jeden Tagversammeln sich Chatter-Cliquen zu realenAusflügen, wie etwa zwei Dutzend Leutevom Playground-modelchat, der sich gera-de in Wien traf.
„In der Steinzeit war die Keule das In-strument, eine Frau kennenzulernen. ImMittelalter die Kupplerin. Nun ist es derChat“, glaubt Wolfgang Bätz. Der gebürti-ge Baden-Badener loggte sich als Comicfi-gur „Marsupilami“ bei freixenet.de ein.„Kim“ begrüßte ihn: „So heißt die Rattemeiner Tochter.“ Monatelang chatteten sie,tauschten Telefonnummern, trafen sich,liebten sich. Wolfgang ist zu seiner „Kim“gezogen, einer Schweizer Lehrerin, undmachte ihr vor wenigen Wochen einen An-trag – im Chat. Demnächst heiraten sie.
Als „Gentleman“ war ich da vorsichtiger,ging gern mal in einen Lesben-Chat, umden Damen zuzuhören. Nach einer halbenStunde fragte die erste, ob „der Typ“ nochda sei. „Gentleman“ bejahte, bestand aberdarauf, sich als Gast zurückzuhalten. Kurzdanach wurde er angeflüstert und disku-tierte mit sehr netten Lesben über Musicals,das Outing der „Tatort“-Kommissarin
PW
E-V
ER
LAG

Werbeseite
Werbeseite

Medien
tz: Heiratsantrag im Netz
Ulrike Folkerts und die Wirkungsweise vonVibratoren, die er nur vom Hörenschweigenkannte.
Als „Fantasy“ war ich jung, weiblich undmit einer üppigen Phantasie ausgestattet.„Fantasy“ liebte Flirts, bis sie irgendwannsich selbst begegnete, sozusagen. Die an-dere „Fantasy“ war tatsächlich jung, weib-lich und mit einer weit üppigeren Phanta-sie ausgestattet. Der Ehrgeiz der zweiten:„daß sich die Putzfrauen in manchem deut-schen Büro am nächsten Morgen über dieFlecken unter dem einen oder anderenSchreibtisch wundern *g*“.
„Fantasy“ war dann längst weg, hattesich den nächsten einsamen Kerl ge-schnappt, ihn eingewoben inihrem Sprachdschungel. „Esist ein Spiel mit dem Feuer“,flüsterte die Münchner Stu-dentin irgendwann. „Du sam-melst Erfahrungen, ohneAngst haben zu müssen.“
Und so, wie die Phantasieimmer weiterwuchert, wu-chern die Paläste und Ka-thedralen ihrer Verehrung zu nie gesehenen Metro-polen heran. Sie heißen funcity.de oder geocities.com. Die US-Internet-StadtFortuneCity begrüßte An-fang des Jahres ihren mil-lionsten Bürger. „Dieser Mei-lenstein“, posaunt Firmen-chef Peter Macnee, „ist einBeleg für unser einzigartiges Gesell-schaftsmodell.“
Die Bewohner seines Molochs könnensich ihre Homepage einrichten wie ein Rei-henhäuschen, bekommen ihre eigeneAdresse samt Postfach und Einkaufsmög-lichkeiten in virtuellen Kaufhäusern. Seitwenigen Monaten steht auch der deutscheAbleger fortunecity.de mit Bank und Ein-kaufszeile. Greifbar ist lediglich die Aktiedes Unternehmens, die seit ihrer Plazie-rung am Neuen Markt der Frankfurter Bör-se um bis zu 70 Prozent nach oben schoß.
Bisher verdienen am Bauboom vor al-lem ein paar Aktionäre und die Provider.Chats gelten als teures Marketing-Werk-zeug. Rund 40000 Mark verschlinge alleindie Pflege der elf Playground-Foren mo-natlich, schätzt Online-Chef Eric Hegmannvon der Verlagsgruppe Milchstraße undschwärmt vom längst gemachten nächstenSchritt: In dreidimensionalen Chats wiecycosmos.de erschafft man sich zur Be-grüßung sogar selbst neu.
Vielleicht werden wir uns irgendwannauflösen in schreibende Wesen, die nurnoch über den Pizzadienst mit der Außen-welt Kontakt halten und sich im Internetbeerdigen lassen. Tote gibt es schon.
In metropolis.de, der mit mehr als350 000 registrierten „Bürgern“ größtenund kreativsten unabhängigen Chat-Stadtin Deutschland, wurde vor einiger Zeit der
Chat-Paar Bä
M.
LATZEL
d e r s p i e g e106
erste vereinsamte Bewohner zu Grabegetragen. An einem der Chatboards dis-kutierten die Überlebenden den realenSelbstmord. „Wir hatten auch schon Hoch-zeiten – und Scheidungen“, sagt AlexanderHafemann, Geschäftsführer der Media-design-Agentur 21 TORR in Reutlingen.Dort stehen im Keller die Server-Kistenvon Metropolis, in denen Tag und Nachtgeliebt und gelitten wird.
Neulich wurde entdeckt, daß einer derBewohner seit 1996 8700 Stunden onlinewar. Ein Jahr lang.Wann ist der Chat nochFlucht, wann wird er Falle?
Manchmal sei es „richtig unheimlich“,sagt Eva-Maria Bauch, Leiterin der Online-
Redaktion des Frauenmagazins „Allegra“,„wie sich manche Leute jede Nacht bei uns sehen lassen, als hätten sie nichts an-deres mehr“. Allegra.de startete 1996 mit3 Chats. Nun sind es 13, und auch die sindoft übervölkert.
„Ich habe mich selber nicht mehr ver-standen“, sagt Gabriele Farke, Kauffrauaus Berlin, die früher bis zu zehn Stundentäglich im Netz zappelte. Heute therapiertsie ihre Abhängigkeit damit, Bücher zuschreiben, Vorträge zu halten und sich imeigenen Chat (hexenkuss.de) um den Zugder Verzweifelten zu kümmern*.
Die Amerikaner haben zum Phänomenbereits den Begriff parat: „Internet Ad-diction Disorder“ (IAD). ProminentestesOpfer: die Schauspielerin Sandra Bullock,die sich irgendwann selbst als „Internet-Junkie“ begriff. Sie sei „so abhängig“ ge-wesen, „das war beinahe schon mitleid-erregend“.
Eine Chatter-Umfrage der UniversitätInnsbruck ergab, daß 12,7 Prozent der Me-tropolis-Probanden „ein suchtartiges Ver-halten aufweisen“. Der Münchner Medizi-ner Oliver Seemann glaubt, daß IAD „infünf bis zehn Jahren ein Problem sein wirdwie Alkohol“ und eröffnete gerade die
* Gabriele Farke: „Hexenkuss.de – Liebe, Lüge, Lust und Frust im Internet“. Deller-Verlag, Langenfeld/Rhld.;272 Seiten; 34,80 Mark.
l 1 8 / 1 9 9 9

erste deutsche Online-Beratung (med.uni-muenchen.de/psywifo/Interaddict.htm).Das klingt zwar, als verabrede er sich mit Trinkern zur Schnapstherapie. „Aberden Menschen vorm Computer kann ichnur so abholen.“ Welchen Menschen?
Am Ende stromere ich unter dem ge-schlechtslosen Namen „ES“ durch dieschummrige Cyber-Bar des Erotic-Chats.Das hier ist Rick’s Café an der Reeperbahndes Datenhighway. Ich beschreibe mich als„asexuellen Humor“, wenn jemand näher-kommt und mich fragt, wer ich eigentlichbin. Ja, wer bin ich?
Einmal kam ich nur als „ES *30min*“,erklärte, nun 30 Minuten meines Lebenszu verschenken, während ich laut denCountdown einläutete „…27 min…“ Nachzehn Minuten rief der erste, ich solle dasZählen lassen, er werde mich erinnern.Nach 15 fragte einer, was am Ende passie-re. Fünf Minuten vor Schluß verfolgtenmich acht von hundert Chattern. Sie gingenschriftlich in Deckung, versuchten meineUhr zu stoppen, lachten und flüsterten mich an.
ES war bedeutungslos, l’art pour l’art.ES war eine flüchtige Pretiose *angeberischgrins*, die fürs Publikum der intelligentenStammchatter funkeln wollte. ES beganngefährlich zu werden. Ich wußte, wenn Ty-pen wie „GET MORE“ kamen, hatte ichwas zu lachen.Wenn „Saphira“ da war, be-kam ich den besten Caipirinha („Hi ES*freu* wie immer?“). Und wenn „Annie“einflog, zitterten nicht nur die Flammen inden Kronleuchtern.
Am Mittwoch vergangener Woche tratich als „ES-moll“ das letzte Mal auf, gingnoch mal an die Bar, ließ mich anflüstern,ob ich wirklich gehen wolle und wohin? ESantwortete nicht mehr. ES war zu/am Ende,weil seine Sehnsucht nach der virtuellenWärme anfing zu schmerzen.
Wenige Stunden später nagelte eineChatterin namens „Sayuri“ ihre Lebensge-schichte ans Schwarze Brett der benach-barten Flirtline II: Seit Oktober war sie imChat, verlor allmählich Freunde, Familie,Mann und sich selbst. Seit einer Woche istsie in psychiatrischer Behandlung. Sie willihren Mann zurückgewinnen, verkaufte denHeim-PC und ließ den Netz-Zugang imBüro sperren.
„Warum ich euch das alles schreibe?“fragte sie schließlich. „Weil es mir scheißegeht, ich nicht mehr weiter kann und totalverzweifelt und ein Nervenwrack bin.“Tagelang füllte sich das Schwarze Brettdanach mit der Sprachlosigkeit ihrer altenFreunde.
Ich kann sie tuscheln hören in dem of-fenen Web-Fenster hinter diesem Text *g*.Aber ich werde nicht mehr zurückkehren.Hi bye „Luky Luke“. Chatte nicht soviel,„frau“! Glaub nie, was du glaubst, „Glas-gow“. Au revoir, „Annie“ :-) CU @ll ineiner anderen Welt vielleicht. Es gibt jagenug *lol und logout*. ™
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9

1
Medien
Cap-Anamur-Chef Neudeck im ZDF-„Morgenmagazin“*: „Da haben wir nicht nein gesagt“
ZD
F
S P E N D E N
Millionen für die Großen
Im Fernsehen und untereinanderkämpfen Hilfsorganisationen
erbittert um die Spendengelderder Bundesbürger für
die Flüchtlinge aus dem Kosovo.
Medica-Chefin HauserKeine Chance für die Kleinen
S.
EN
DER
S /
BIL
DER
BER
G
Der RTL-Moderator war voll Be-wunderung für die Arbeit der Köl-ner Ärztin Monika Hauser, die sich
um Flüchtlingsfrauen aus Bosnien und demKosovo kümmert. Doch statt die Spenden-nummer ihrer Hilfsorganisation Medicamondiale zu zeigen, blendete der Senderdie Bankverbindung von Unicef ein.
Im ZDF durfte Suzana Lipovac vom Ver-ein Kinderberg über ihre Arbeit mit Flücht-lingskindern an der mazedonischen Gren-ze berichten.Anschließend rief der Mode-rator zu Spenden für das Deutsche RoteKreuz (DRK) und Cap Anamur auf.
Über 160 Millionen Mark, so viel wienie zuvor, spendeten die Deutschen bisherfür Kosovo-Flüchtlinge. Um das Geschäftmit dem Mitleid tobt ein harter Konkur-renzkampf: Fernsehsender und Zeitungengehen feste Partnerschaften mit „ihren“Hilfsorganisationen ein. Die kleinen Or-ganisationen fühlen sich ausgebootet.Während die etablierten Helfer von derSpendenflut überrannt werden, könnenkleinere Hilfswerke ihre Leute vor Ortkaum noch bezahlen.
Die ARD wirbt für Caritas und Diako-nisches Werk, Unicef ist der offizielle Part-ner von RTL. Das ZDF setzt auf DRK undCap Anamur, die Hilfsorganisation desJournalisten Rupert Neudeck.
08
„Dabei zählt der Bekanntheitsgrad, diegute Pressearbeit und nicht unbedingt dieQualität der geleisteten Arbeit“, kritisiertTilmann Zülch von der Gesellschaft für be-drohte Völker. Er hält es für sehr bedenk-lich, wenn „Medienmonopole neuerdingsauch Monopol-Hilfswerke kreieren“.
Beim ZDF hat man sich, nach den Wor-ten von Kommunikationschef PhillippBaum, „in nur drei Stunden auf dieHilfsaktion mit DRK und Cap Anamur ge-einigt“. 108 Millionen kamen bis Freitagauf dem ZDF-Spendenkonto an.
Klaus Brodbeck, der die ZDF-Sonder-sendungen zum Kosovo leitet, hält es fürausgesprochen sinnvoll, nur die beidenPartner einzublenden: „Wir müssen dieSpenden kanalisieren. Kleinere Organisa-tionen sind schnell überfordert.“
Besser kommt bei Johannes Bausch, Ge-schäftsführer der Deutschen Stiftung für
* Mit Moderator Cherno Jobatey.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Uno-Flüchtlingshilfe, die ARD weg. Immerwenn die Konten ihrer Partner Caritas undDiakonie eingeblendet werden, erscheinezumindest „prompt“ der Hinweis auf denVideotext mit anderen Helfern.
Doch den lesen die wenigsten Zuschau-er. Für die Kleinen ist das eingeblendeteKonto die einzige reelle Chance. Zehnmalhat Medica mondiale in den letzten Wo-chen Fernsehinterviews gegeben. Zehnmalhat Monika Hauser um die Nennung ihrerKontonummer gebeten – und immer eineAbfuhr erhalten: „Die Sender verwiesenauf ihre Partner.“
In Zeiten des Bosnienkriegs war das an-ders. Ein einziger Auftritt in den Tagesthe-men brachte Hausers Verein 750000 Markein. „Die humanitäre Hilfe ist ein großesGeschäft“, klagt die Medica-Chefin: „Michärgert, daß ich gar keine Chance mehr be-komme. Ohne Spenden kann ich meineArbeit nicht mehr leisten.“
Die Sender ihrerseits fühlen sich vonden Spendeneintreibern immer stärker unter Druck gesetzt. Denn „das MediumFernsehen ist für Hilfsorganisationen derbeste Weg, um an Spenden zu kommen“,sagt Richard Mahkorn, Kommunikations-chef von RTL. „Es gibt Organisationen, diebieten uns die Finanzierung einer kom-pletten Sendung an, wenn sie im Gegenzugdafür um Spenden werben dürfen.“
Bei RTL kamen für Unicef bislang 6,3Millionen Mark zusammen. Ein Klacks imVergleich zu den 45,8 Millionen, die bisherbei Cap Anamur gelandet sind. Das ZDF,sagt Neudeck-Ehefrau Christel, sei selbstmit der Bitte um Partnerschaft auf sie zu-gekommen, „da haben wir natürlich nichtnein gesagt“.
Christian Schwarz-Schilling (CDU),Vize-Vorsitzender im Bundestagsauschußfür Menschenrechte, hält die Praxis derFernsehanstalten für falsch: Die Sendersollten wie früher die Spendennummernihrer jeweiligen Gesprächspartner zeigen.Uno-Mann Bausch schlägt eine gemeinsa-me Spendennummer aller Hilfswerke vor:„Das wird einfacher für die Spender.“
Monika Kleck vom Verein Amica, der inMazedonien gerade ein Projekt zur Flücht-lingsbetreuung startet, macht noch ein an-deres Problem für den Spenden-Hickhackverantwortlich: die Rivalität der Hilfswer-ke untereinander. Kleck: „Fast jeder machtjedem Konkurrenz.“
Cap Anamur will schon mal von sich ausmit den Kleinen teilen und als erstes dasProjekt von Monika Hauser in Tirana un-terstützen. Sechs Mitarbeiterinnen bauendort gerade Medica Kosova auf. Ziel ist diegynäkologische und psychosoziale Erst-versorgung von Flüchtlingsfrauen, die häu-fig auch vergewaltigt worden sind.
„Ich weiß noch gut, wie es uns früherging“, erinnert sich Christel Neudeck. „Dahaben auch immer nur die Großen kas-siert, und wir fielen hinten runter.“
Barbara Schmid, Andrea Stuppe

F E R N S E H S E R I E N
„Her mit den starken Frauen“Der amerikanische Erfolgsproduzent
Aaron Spelling über seine Serie „Charmed“,die nun in Deutschland anläuft
„Charmed“-Darstellerinnen*: Club der guten H
nv
Spelling, 70, Sohn russischer und polni-scher Einwanderer, begann seine Karrierein den Fünfzigern als Schauspieler undTheaterregisseur und gilt heute als einerder Mächtigsten des amerikanischen Fern-sehgeschäfts. Er gab seiner Tochter Tori,25, eine der Hauptrollen in der von ihmselbst produzierten Serie „Beverly Hills90210“ und machte sie so zum TV-Star.Spellings Vermögen wird auf mehrere hun-dert Millionen Dollar geschätzt; er lebt ineinem 123-Zimmer-Palast in Los Angeles.
SPIEGEL: Mr. Spelling, Sie zählen seit langemzu Amerikas erfolgreichsten TV-Produzen-ten – von „Drei Engel für Charlie“, „Den-ver Clan“ mit Joan Collins bis zu „MelrosePlace“ und „Beverly Hills 90210“ warenviele Ihrer Serien Quotenrenner.Was ist dasBesondere an Ihrem jüngsten Serienhit, deram Sonntag auf Pro Sieben startet?Spelling: Zunächst mal hatte „Charmed“den besten Start aller Serien, die ich jemalsproduziert habe. Es war unglaublich.Außerdem ist es für mich immer wiederaufregend, wenn nach all den Erfolgen undden Niederlagen, nach denen die Pressemich totgesagt hat, noch eine Steigerungmöglich ist. Es ist einfach ein tolles Ge-fühl, daß es immer neue Gipfel zu erklim-men gibt.SPIEGEL: „Charmed“ erzählt von drei mo-dernen Teenager-Schwestern, die in der er-sten Folge entdecken, daß sie über Hexen-kräfte verfügen. Ein amerikanischer Kriti-ker beschrieb die Serie als „Drei Engel fürCharlie“ mit einem Zauberbuch.Spelling: Das klingt lustig,das habe ich noch nichtgehört. Ein bißchenstimmt es auch. Der Un-terschied ist, die drei sindjünger und arbeiten nurfür sich selbst anstelle ei-nes imaginären „Charlie“.SPIEGEL: Reagieren Sie sodarauf, daß sich die Rolleder Frau im Fernsehenverändert hat?Spelling: Sicher. Früherhieß es, „Frauen alsHauptfiguren in Fern-sehserien funktionierennicht“.Wir haben Pilotfil-me gedreht, Drehbüchergeschrieben – keiner woll-te das haben. Dann kam Spelling mit „De
„Drei Engel für Charlie“, das war der ersteErfolg. Und doch haben wir mehr als an-derthalb Jahre gebraucht, um die Serie zuverkaufen. Gott sei Dank werden heutzu-tage Frauen auf dem TV-Schirm so wahrge-nommen, wie sie es verdient haben.SPIEGEL: Sie halten „Charmed“ also fürrealistisch?Spelling: Ja. Zum einen stehen Beziehun-gen zwischen drei Schwestern im Vorder-
grund, und jeder weiß,wie die sich in die Haaregeraten können – undsich in der nächsten Mi-nute wieder in den Ar-men liegen. Das machtden Witz der Serie aus.Dazu kommt, daß alledrei völlig unterschiedli-che Charaktere habenund sich mit typischenTeenager-Problemen her-umschlagen. Zum ande-ren gibt es die magische,mystische Seite der Serie,und aus der entstehenSpannung und Action.
* Alyssa Milano, Shannen Doher-ty und Holly Marie Combs.er“--Star Collins
GLO
BE P
HO
TO
S
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
SPIEGEL: Sind die Magie-Girls Vorbilder fürsjunge weibliche Publikum?Spelling: Das könnte sein. Sie wohnen imeigenen Haus, haben Jobs und benutzenihre von der Mutter geerbten Kräfte nichtnur, um das Böse zu bekämpfen, sondernauch, um anderen zu helfen. Dennoch, essind selbstbewußte junge Mädchen, die fürihre eigenen Interessen kämpfen.SPIEGEL: Ganz so, wie es dem Ideal derneunziger Jahre vom kämpferischen
wilden Mädchen ent-spricht.Spelling: Ja, und ich binfroh darüber. Mein Gott,wie viele Cop-Serien mitharten Kerlen habe ich inmeinem Leben produziert!Ich hatte das so satt. Es warwirklich an der Zeit, starkeFrauen zu zeigen. Das istviel spannender.SPIEGEL: Die SchauspielerinShannen Doherty hattenSie einst bei „Beverly Hills90210“ hinausgeworfen –wegen Streitsucht undGrößenwahn. Nun wurdesie für „Charmed“ wiederfür eine Hauptrolle ver-pflichtet. Woher der Sin-neswandel?Spelling: Jeder verdienteine zweite Chance. Da-mals ging alles viel zuschnell für sie, über Nachtwurde sie zum Star, das hatschon viele aus der Bahngeworfen. Es ist merkwür-
dig in den USA, männliche Schauspielerkönnen jede Menge Probleme haben –Drogensucht, Gefängnis, Therapie – undtrotzdem weiter arbeiten, ohne daß es je-manden stört. Aber laß eine Frau eineneinzigen Fehler machen, und sie ist ver-dammt in diesem Land. Shannen und ichbrauchten beide einfach etwas Zeit zumNachdenken. Außerdem, wenn sie sich anden Streit bei „Beverly Hills“ erinnern –Shannen hat schon immer eine prima Hexeabgegeben.Aber in „Charmed“ ist sie einegute Hexe, das ist der Unterschied.SPIEGEL: Serien, in denen von den Gefah-ren und Geheimnissen des Übersinnlichenerzählt wird, sind derzeit sehr beliebt.Hängt das Ihrer Meinung nach mit demEnde des Jahrtausends zusammen?Spelling: Die Begeisterung für das Über-sinnliche hat mit „Akte X“ angefangen.Wirerzählen allerdings aus der Perspektive vonTeenagern, was die Sache sehr spannendmacht – charmant und sexy. Und natürlichhat der Erfolg beider Serien damit zu tun,daß in den USA eine riesige Furcht vordem Millennium herrscht.Vielleicht solltenwir in der letzten „Charmed“-Episode die-ses Jahrtausends genau das behandeln –die Jahrtausendwende als Inbegriff des Bösen. Interview: Jörg Böckem
exen
PR
O 7
109

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Szene Gesellschaft
omic „Palestine“
C O M I C
Kriegsberichte mit der Zeichenfeder
Der Mehrzahl der amerikanischen Bürger sei daseuropäische Kriegsgeschehen schlicht „zu kom-
pliziert“, um sich dafür zu interessieren, glaubt der Comic-Zeichner Joe Sacco, 39. Er beschloß deshalb, dieNöte und Schicksale fremder Kriegsopfer mit der Zei-chenfeder zu vermitteln. Seit acht Jahren sucht Saccodort seine Themen, wo andere um ihr Leben kämpfen.Zwei Comics, die in Krisengebieten spielen, hat er inzwischen gezeichnet, einen über den Gaza-Strei-
fen und einen überBosnien. Vorteildes Zeichnens sei,daß man Menschenin ihrem Zuhausedarstellen könne,auch während eines Kriegs,erklärt der für sein Werk„Palestine“ preisgekrönteSacco. Als er in Bosnien Fa-milien besuchte, hat er nurgute Erfahrungen gemacht:„Die Leute waren der vie-len Journalisten und Filme-Sacco
K.
HAM
BY
Sacco-C
d e r s p i e g e
rei überdrüssig, mich ließen sie gern herein.“ Saccos nächstesProjekt ist das Kosovo, seine Zielgruppe bleiben weiterhin dieamerikanischen Bürger.Vorgeworfen wurde ihm, daß er in sei-nen Comics zu vehement Stellung für die Palästinenser oder dieBosnier beziehe. Davon will Sacco gar nichts hören: „Ich binnun mal kein neutral erzählender Journalist“, erklärt er. EinenNachteil hat das Zeichnen allerdings für ihn: „So ein Buchdauert leider Jahre.“
K O M M U N I K A T I O N
TelefonsüchtigeHomosexuelle
Michael Adamczak, 39, Gründer derschwul-lesbischen Telefongesellschaft„Pride Telecom“ in Köln, über seineKunden
SPIEGEL: Herr Adamczak, telefonierenHomosexuelle anders?Adamczak: Meiner Erfahrung nach tele-fonieren sie weitaus mehr als Hetero-sexuelle. Darüber hinaus ha-ben sie überdurchschnittlichviele Freunde in den USA.SPIEGEL: Prima für Sie. Dakommt doch sicher einigesan Gebühren zusammen.Adamczak: Einen Teil desGewinns spenden wir derDeutschen Aids-Hilfe. Seitunserer Gründung 1996sind es über 400000 Mark.Wir bieten auch einen Gay-Guide an mit Ausgehtipsoder empfehlen Hotels, indenen Schwule nicht über-rascht angeguckt werden. Adamczak
SPIEGEL: Sie haben ein Unternehmengegründet, das die wirtschaftlicheKraft der Homosexuellen zeigen will.Weswegen? Adamczak: Schwule Haushalte habenim Schnitt ein weit höheres Einkom-men als heterosexuelle, und sie gebendas Geld auch aus, nicht bloß für Telefongespräche, auch für Lifestyle-Produkte oder für Reisen. Diese Wirtschaftskraft demonstrativ zu stützen dient dem Abbau von Vorur-teilen.SPIEGEL: Wie sollte die IndustrieHomosexuelle ansprechen?
Adamczak: Produktekönnten gezielt verän-dert werden. Für einenKüchengeräte-Herstellerhaben wir gerade heraus-gefunden, wie so einKühlschrank aussehenmuß.SPIEGEL: Nämlich?Adamczak: Schwuleernähren sich gesund-heitsbewußt, also mußdas Gemüsefach größersein. Außerdem brauchensie mehr Ablagen fürSekt und Weißwein.
M.
GR
AN
DE
l 1 8 / 1 9 9 9
M O D E
Cash mit ChaosDie richtigen Turnschuhe zu tragen ist
für modebewußte junge Leute eineHerausforderung von existentieller Trag-weite. Derzeit ganz oben auf der Hitlistesind Sport-Treter mit furchteinflößendenStacheln, Anarchie-Logo und (keineswegsgeschlechtsneutralen) Ted-dybären unter der Sohle.Erfunden hat die alp-traumhafte Fußbeklei-dung der Brite Phil DeMesquita. Seine Mar-ke „Acupuncture“wird von Meinungs-machern getragen:Die Popstars Rob-bie Williams, KylieMinogue, Schau-spieler Keanu Reeves und ModemacherJean-Paul Gaultier muten sich das provo-kante Schuhwerk zu, auch Ex-Sex-PistolJohnny Rotten schwört auf die heftigeMarke. Erfinder De Mesquita sieht seineWurzeln in der Punk-Bewegung. DieTreue zahlt sich aus: Seine Firma machtinzwischen sieben Millionen Pfund Um-satz im Jahr.
„Acupuncture“-Schuh
113

114
FO
TO
S:
J. B
IND
RIM
Geldtrainer und Rolls-Royce-Besitzer Schäfer, Seminarteilnehmer in Bad Neuenahr: „Ich bin unerträglich, ein leidenschaftlicher Visionär, ein
P S Y C H O L O G I E
Visionäre Kraft und viel ObstMillionär kann jeder werden, Armut ist ein Denkfehler, wer nichts auf der hohen
Kante hat, ist selbst schuld: Mit solchen Weisheiten tourt der „Money Coach“ Bodo Schäfer durch Europa und lehrt willige Menschen die Kunst der wunderbaren Geldvermehrung.
Schade, daß der schon verheiratet ist“,seufzt eine junge Frau im weißen Ko-stüm. Also ne, sagt ihre Freundin,
„der ist doch zu lackaffig“. Der Lackaffeträgt einen grauen Anzug mit Weste, hatein Mikrofon um und bewegt sich durchden großen Saal des Münchner MarriottHotels wie ein Tigerdompteur. Er heißtBodo Schäfer, 38, und hat einen neuen Be-ruf erfunden. „Europas führender MoneyCoach“ nennt er sich, hetzt in Deutsch-land, den Niederlanden, England und derSchweiz umher und will nichts Geringe-res, als Menschen den Weg zur finanziellenFreiheit weisen, sie lehren, wie sie in siebenJahren die erste Million machen. GuterVorsatz, deshalb ist das Eintagesseminarfür 690 Mark auch gut besucht. Rund 280Leute haben sich eingefunden, lernbereitund wißbegierig, aber auch skeptisch.
„Wenn er Schwachheiten erzählt, willich mein Geld zurück“, sagt Heinrich, 67,leise. Andere Zuhörer nicken. „Sie arbei-ten hart für Ihr Geld, sorgen Sie dafür, daßIhr Geld auch hart für Sie arbeitet“, erklärtSchäfer energisch. Genau das ist es, was dieLeute wollen. Daß das Geld für sie arbei-tet, nachdem sie sich so lange dafür krumm-
gelegt haben. Denn alle fühlen sich ir-gendwie zu kurz gekommen, vom Lebenvernachlässigt, und das ist ungerecht.
Ist es? Bodo Schäfer sieht das anders, erhat, kein Zweifel, für Jammerlappen nichtsübrig. „Egal, wo Sie stehen, Sie könnensich verbessern“, donnert er. Er ist von ein-schüchternder Strenge, der Money Coach,er würde sich sicher nie hängenlassen.
Der Meister des Geldes sieht tipptoppaus, frisch gefönt und gebräunt, von ag-gressiver Energie, dabei humorvoll, alsoeine Mischung aus Michael Douglas, demBörsenhai aus dem Film „Wall Street“, undeinem schlitzohrigen Gebrauchtwagen-händler. „Ich mag Geld“, sagt er. Ehr-fürchtiges Schweigen. Dagobert Duck ausEntenhausen, der im Geld schwimmt, magGeld ebenfalls. Was haben reiche Men-schen gemeinsam? Sie sind geizig, zumin-dest sich selbst gegenüber. Aber sie liebendas Geld, und das Geld liebt sie.
Und was steckt in den Köpfen der Men-schen, die wenig Geld haben? FalscheGlaubenssätze – vermittelt von wohlmei-nenden Eltern, Kindergärten, Schulen:Geld ist schmutzig, verdirbt den Charakter,bringt einen vielleicht weiter, aber sicher
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
nicht näher zu Gott. Bodo Schäfer findet,daß diese Sätze idiotisch sind und eine Artinnere Sabotage bilden – die Menschenwollen reich sein, aber sie sind es nicht,weil sie es sich innerlich nicht erlauben.Dazu kommt, daß sie dämlich sind, sichnicht um wirksame Techniken der Geld-vermehrung kümmern, faul im Sessel sit-zen, ihr Leben halt so runterleben.
Bodo Schäfer hat, damit seine Botschaftmöglichst viele arme Schlucker erreicht,ein Buch geschrieben zum Thema, das ineinigen Wirtschaftszeitungen wohlwollen-de Kritiken erhielt und sich bislang knapp200000mal verkaufte*.
„Nehmen Sie sich ein Ziel vor, und fan-gen Sie innerhalb von 72 Stunden an, esumzusetzen.“ Ein Ziel? Den Zuhörernwird klar, was sie trotz des stattlichen Se-minarpreises nicht bekommen: perfekteAnlagetips. Statt dessen heißt es: erst malan der Persönlichkeit arbeiten, dannklappt’s auch an der Börse. „Und wenn esmal nicht klappt?“ fragen einige zaghaft,
* Bodo Schäfer: „Der Weg zur finanziellen Freiheit. Insieben Jahren die erste Million“. Campus Verlag, Frank-furt am Main; 312 Seiten; 39,80 Mark.

se: „Entscheidungsmuskel trainieren“
Gesellschaft
militanter Gesundheitsapostel“
nämlich die, die sich an den Kursabsturzvom letzten Jahr erinnern. Macht nix.„Verluste an der Börse sind nicht tragisch“,sagt Schäfer. „Verlust ist relativ. Das Geldist nicht weg, es hat jetzt nur ein anderer.“
Er erntet viel Gelächter, wie er da mitseiner Erfolgsschnauze dynamisch im Saalherumwuselt und seinen Schülern strengins Auge blickt, er lacht selbst viel und ver-fällt gelegentlich in schönsten Dialekt –denn eigentlich ist der Mann Rheinländer.Aber aufgewachsen ist er in den USA, woer zur Schule ging, studierte, das Studiumhinschmiß und mit 26 Jahren pleite war.
Er lebte über seine Verhältnisse, ermachte Schulden, er wußte nicht mehr ausnoch ein. Er war am Ende. „Sie sind einWeichei“, sagte sein Coach. Sein Coach?Ja, erzählt er, er habe sich in Amerika ei-nen Coach besorgt, einen Menschen, derihn in die Geheimnisse des Reichtums ein-weihte. Der ihn lehrte, Probleme als Her-ausforderung zu sehen, ihn so lange triez-te, bis er sich aus seiner seelischen Kom-fortzone heraustraute.
Dieser Mann heißt Dan Peña, ist Mil-liardär, hat sein Geld mit Öl gemacht undist in mehrfacher Hinsicht Schäfers Vorbild.Peñas Bücher kosten 300 Dollar, seine Se-minare, in denen er offenbar Ähnlicheslehrt wie Schäfer, rund 1500 Mark. Bei sei-nem Schützling Schäfer war Peña anschei-nend erfolgreich: Inzwischen ist Schäfer anverschiedenen Firmen beteiligt, wie er sagt,fährt einen Rolls-Royce, lehrt andere denWeg zu mehr Geld und verdient dabei miteiner durchschnittlichen Tagesgage von15000 Mark nicht schlecht.
„Ach, das ist schon okay, daß er ordent-lich Geld nimmt für seine Seminare“, sagtein älterer Herr. „Wenn ich so gut quat-schen könnte, würde ich das auch ma-
chen.“ Gut quatschen kann Schäfer tat-sächlich, und irgendwann landet er unver-meidlich beim finsteren Kapitel Frauen undGeld. Obwohl erwiesen sei, sagt Schäfer,daß Frauen bei Geldanlagen ein besseresHändchen hätten als Männer, wagten sieoft nicht, die eigene Arbeit adäquat inRechnung zu stellen. Und sie verlassen sichin Gelddingen meistens auf Männer. „WasDümmeres können sie nicht tun“, konsta-tiert Schäfer trocken.
Die Damen im Raumnicken verlegen. Der Mannhat ja recht. Aber, so derErmutigungsslogan, jederund jede kann es schaffen.Denn selbst Bodo warnicht immer eine solcheRakete. Er war früher ganzschön dick, las kein Buch,dümpelte ziellos durch dieGegend, war also eigent-lich ein ziemlich tumberTropf. Inzwischen ist seineEnergie geradezu schwin-delerregend: Er liest min-destens zwei Sachbücherpro Woche, schläft keineNacht mehr als vier Stun-den, joggt, ißt abends nurObst.Außerdem verordneter sich Selbstvertrauen,denn Selbstvertrauen istder Anfang von allem.„Wir haben ein zu schlechtes Bild von unsselbst“, sagt er. Beifälliges Nicken. „Siewerden nach dem bezahlt, was Sie den-ken, was Sie wert sind. Führen Sie ab so-fort ein Erfolgsjournal.“ Im Erfolgsjournalsolle man fünf Dinge pro Tag notieren,die einem gelungen sind. Dazu gehört leider nicht: „Heute habe ich den Chef
New Yorker Bör
U.
BAU
MG
ARTEN
/ V
AR
IO-P
RES
S
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
geärgert“, sondern eher ein aufbauenderLeistungsnachweis, für den man von an-deren gelobt wird. Wer drei Monate langgewissenhaft sein Erfolgsjournal führe, pro-phezeit Schäfer, steigere seinen Verdienstum 23 Prozent
Ohne Disziplin und Selbstbewußtseingeht nichts, fügt er hinzu, das hätten bereitsLeonardo da Vinci, Galileo Galilei, Franzvon Assisi und andere Berühmtheiten be-wiesen. Offenbar findet er, es könne nichtschaden, sich in deren Nähe zu rücken.Meiden hingegen muß man Menschen, dienicht an sich wachsen wollen, statt dessenBier trinken, die Sportschau gucken, zumFußballspiel gehen, Currywurst mampfen.Das mögen nette Zeitgenossen sein, fürSchäfer sind sie Abtörner. Er arbeitet un-entwegt an sich. „Ich bin unerträglich“,sagt er, „ein leidenschaftlicher Visionär, einmilitanter Gesundheitsapostel.“
Allerdings reicht es auch nicht, sich voreinen Spiegel zu stellen und sich man-tramäßig vorzubeten: „Ich bin ein Sieger.“Schäfer: „Positives Denken allein istSchwachsinn.“
Selbstbewußtsein entwickelt sich, indemman sich entwickelt – so ähnlich hat Hein-rich das verstanden, der eigentlich nichtunter mangelndem Selbstbewußtsein lei-det und außerdem bereits Millionär ist.„Also, ich weiß nicht“, sagt er in der Pau-se, „wenn der Schäfer schon für eine läp-pische Million sieben Jahre braucht, alsoich weiß nicht.“ Die anderen wissen es erstrecht nicht, sind aber neidisch auf die Mil-lion. Doch Neid bringt niemanden voran,also weiter zuhören.
„Sind Sie Visionär?“ fragt Bodo Schäfer.„Was würden Sie tun, wenn Ihnen Ger-hard Schröder den Job des Finanzministersanbietet?“ Nun ja, gut, dieser Job ist imMoment nicht so rasend attraktiv, aber dar-um geht es auch nicht. Sondern, ob man inseinem Lebenspuzzle eine Vision hat. Kei-ne Vision? Schlecht. Schäfer selbst verfolgt
115

Gesellschaft
Comicfigur Dagobert Duck„Ich mag Geld“
Filmszene aus „Wall Street“*: „Sie können sich
JAU
CH
& S
CH
EIK
OW
SK
I
ehrgeizige Ziele: Er möchte das Bildungs-system reformieren – Kinder sollen schonin der Schule den richtigen Umgang mitReichtum lernen. Dafür braucht er Popu-larität und Geld, ganz einfach.
Armut ist ein Denkfehler, und das eige-ne verkorkste Verhältnis zum Geld zeigtsich in den kleinen Dingen des Lebens.Schäfer fragt: Wer hat mehr als 200 Markdabei? Das sind viele. Wer 500? Das sindauch noch einige. Wer einen Tausend-markschein? Ein paar Auserwählte hebendie Hand. Triumphierend zieht Schäfer ei-nen Tausendmarkschein aus der Tasche.„Man fühlt sich reich, wenn man den da-bei hat“, ruft er. „Und Sie lernen, sich mitGeld wohlzufühlen.“ Kreditkarten, so be-hauptet er, „beschleunigen den Puls nicht.“Aber ein Tausender tut es.
Für den disziplinierten Bodo gibt es im-mer was zu verbessern: Joggen, Obst essen,jeden Morgen an seine wichtigsten Zieledenken, ein Traumalbum anlegen, in dasman die Bilder dessen, was man will, klebt,damit es sich verwirklicht. Sich als Millionärfühlen, solange man noch keiner ist. SeinenEntscheidungsmuskel trainieren, indem manim Restaurant innerhalb von 30 Sekundenbestellt. Zack, zack. Sein eigener Marketing-Meister werden. Sich einen Finanzcoach su-chen. So ein Finanzcoach schmückt sichersehr, nur, wo soll man ihn hernehmen?
Einige Zuhörer seufzen. Das klingt dochnach ziemlich viel Arbeit. Nun ja, jedesGlück hat einen kleinen Stich. Heinrichwill seine Persönlichkeit eigentlich nichtso gern verändern, er hängt irgendwie anihr. Er geht gern Golf spielen mit Freundenund trinkt auch gern mal ein Bier, wie erfreimütig gesteht. Zwei junge Frauen es-sen pflichtschuldig Obst und bekennen, sieseien von Schäfers Humor entzückt. „Wieder das rüberbringt, das ist wirklich ein-malig.“ Ohne Humor wären die vielenMerksätze aber auch nur schwer zu ertra-
116
gen. „Also“, sagt Bodo Schäfer streng:„Das Leben ist zu kurz, um unbedeutendzu sein“, und „Wenn Sie tun, was alle tun,werden Sie haben, was alle haben“, und„Ein Mensch ist die Summe aller Bücher,die er gelesen hat“.
Tja, die Dinge sind zweifellos kompli-ziert. Unsere äußere Welt, schwadroniertSchäfer, sei nur eine Reflexion unserer in-neren Welt. Beifälliges Raunen. Ja, das habeer immer wieder erfahren in seinem Le-ben, wispert ein hübscher junger Italiener.
„Selig sind die, die nichts erwarten, denn sie sollen nicht enttäuscht werden“, zitiert
Schäfer den Schriftsteller Jonathan Swift.Inzwischen hat auch der letzte Depp ver-standen, was die Basis für Reichtum aus-macht: Selbstbewußtsein, visionäre Kraft,Erfolgsjournale, Joggen und viel Obst.
Ganz ohne Sparsamkeit allerdings gehtes auch nicht – damit kommt der Geld-Guru zum pragmatischen Teil des Semi-nars, was viele doch sehr erleichtert. Un-besonnen einkaufen? Nein. „Fragen Siesich immer ,Ist das wirklich notwendig?‘,und sparen Sie.“ Aber natürlich nicht ir-gendwie und irgendwo. Die Interessen derBank können nicht die Interessen desBankkunden sein, deshalb ist „der dümm-ste Ort, wo Sie Ihr Geld aufheben können,ein Sparbuch“, doziert Schäfer.
Das hören nun einige nicht gern, unteranderem ein Banker, der zaghaft prote-stiert. Tatsächlich haben viele Deutsche ihrGeld auf dem Sparbuch und nur knappzehn Prozent an der Börse. Aber ohne dieBörse wird das nichts mit den Millionen.Die verschiedenen Finanzpläne, die Schäfernun vorführt, basieren auf dem schlichtenVorschlag, das Kapital in zwei gleich großeTeile zu teilen, eine Hälfte in sicheren An-
* Mit Michael Douglas, Charlie Sheen.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
lagen unterzubringen, den anderen Teil inAktien zu investieren und immer optimalden Cost-Average-Effekt auszunutzen.
„Welchen Effekt?“ fragt eine Frau ent-nervt, denn sie hat es nicht verstanden.Wassie hingegen versteht, ist, daß es gut ist,zehn Prozent seines Einkommens monatlichzu sparen, besser mehr, beim Anlegen dasRisiko zu streuen und zwölf Prozent Ren-dite zu machen, besser mehr.Wo kriegt manzwölf Prozent? Am Aktienmarkt, wenn manclever ist. Und wenn man nicht so clever ist,muß man eben clever werden. Ausredengelten nicht, andere können’s doch auch.
Es folgen einige verwe-gene Rechenbeispiele, undschließlich wird das Ge-heimnis gelüftet: Wer 7500Mark jeden Monat zu 15Prozent anlege, sei in sie-ben Jahren Millionär, rech-net Schäfer vor. Wer ganzsicher gehen will, solltesein Dreitageseminar bu-chen für 2760 Mark, umweitere Geheimnisse zuerfahren.
„Ich habe keine 7500Mark im Monat“, sagt eineFrau kopfschüttelnd. „Werhat schon so viel Geldübrig?“ Trotzdem fand sieden Tag gewinnbringend,die Sache mit der in-neren Reichtumseinstel-lung gibt ihr doch sehr zu denken, und immerhin hat sie begriffen, daß Aktien nichts Unanstän-diges sind.
Die meisten Zuhörer finden Schäfer of-fensichtlich sympathisch. Es mag nicht neusein, was er sagt; er predigt, wie schon an-dere vor ihm, sich selbst neu zu erfinden.Schäfers Seminarbotschaft unterscheidetsich zudem kaum von den Ausführungen inseinem Buch: Das ärgert etliche Teilneh-mer – vielleicht ist er doch nur ein windi-ger Geldschneider.
Zu derlei Zweifeln gibt es durchaus Anlaß. So ist er offenbar derart mit Geld-verdienen beschäftigt, daß er das verein-barte Telefoninterview mit der wißbe-gierigen Journalistin vergißt und auch niemanden aus seiner angeblich elf Mit-arbeiter starken Firma anrufen läßt. Auchhat man dort Mühe, genau zu sagen, wieviele Seminare er nun eigentlich durch-führt innerhalb von drei Monaten; und keiner seiner Mitarbeiter kann erklären,wieso manche Leute für das Tagesseminar690, manche nur 590 Mark bezahlt haben:irritierende Kleinigkeiten bei jemandem,der seinerseits immerzu von klaren Struk-turen faselt.
„Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht“,sagt der nette Heinrich wieder. Er will dasalles jetzt bei einem kleinen Golfurlaub inPortugal überdenken. Angela Gatterburg
verbessern“
GAM
MA /
STU
DIO
X

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Gesellschaft
BrSp
K R I M I N A L I T Ä T
Tote auf dem Pflaster
Bei der Expo 2000 in Hanno-ver erwartet auch die Unterwelt
ein schönes Geschäft. Der Kampf um Huren und Bordelle
hat schon begonnen.
iefbombenopfer Sabrinarengsatz in der Schmuckschatulle
Straßenstrich in Hannover: Deutlicher Besucherzuwachs?
M.
TH
OM
AS
RTC
Eigentlich ist der Mann mit dem Spitz-namen „Mofa“ schuld. Der Braun-schweiger Zuhälter wollte Steuern
sparen. Dafür mußte er das Finanzamt, dasihn pauschal besteuert, von der Unan-gemessenheit der Forderungen überzeu-gen.Also trieb „Mofa“ eines seiner Häuseran der Bruchstraße, dem BraunschweigerStrich, in die Zwangsversteigerung. Dabeiwar Insidern klar, daß ein echter Kauf-interessent den Zorn des Luden auf sichziehen würde, und so blieb das Haus in„Mofas“ Hand.
Weil die Armutsmasche so gut klappte,verweigerte er kurz darauf auch die Zu-stimmung zur fälligen Mieterhöhung fürsein Hurenhaus „Maison d’Amour“. Dochzu „Mofas“ Überraschung nahm derBraunschweiger Rotlicht-Kollege CarstenS., Spitzname „Bananen-S.“, Verhandlun-gen mit der Vermieterin auf und zahlte den
von ihr verlangten Preis. Geizkragen„Mofa“ war draußen – und seither gibteine Gang aus Hamburg den Ton imMaison d’Amour an.
Denn Carsten S. war in Wahrheit – nichtganz freiwillig – Strohmann hanseatischerZuhälter. Die Kollegen aus der Großstadthatten ihm eine Tracht Prügel verabreicht,einen Pistolenlauf in den Mund geschobenund ihre Wünsche mitgeteilt. „Bananen-S.“ kuschte, heißt seither in der Szene„Fruchtzwerg“, und in Braunschweig be-gann ein Zuhälterkrieg, an dessen Endeder örtliche Lude Elefterios („Elef“) Var-
lamis, 32, auf der Strecke blieb. Vier Ham-burger, die „Elef“ am 22. Juli vergangenenJahres während der Fahrt auf der A 395 inHöhe der Anschlußstelle Stöckheim er-schossen haben sollen, stehen derzeit vordem Braunschweiger Landgericht – dieAnklage: Mord.
Hintergrund der Meinungsverschieden-heiten im Milieu rund um die niedersäch-sische Hauptstadt Hannover ist die Welt-ausstellung Expo 2000, die von Juni bis Ok-tober nächsten Jahres ihre Pforten öffnet.
40 Millionen Besucher werden erwartet,eine Region im Umkreis von 250 Kilome-tern um Hannover hofft auf das große Ge-schäft.Auch das Rotlichtmilieu rechnet imsonst eher schleppend laufenden Sexmetiermit Riesengewinnen. „Wenn die Vertei-lungskämpfe beginnen“, befürchtet Han-novers Polizeipräsident Hans-Dieter Klosa,„könnten bald wieder Tote auf dem Pfla-ster liegen.“
Der Aufmarsch der Hamburger Zuhälterin der vormals beschaulichen Braun-schweiger Puffszene war nach Ansicht vonInsidern nur ein Vorgeschmack. „Bis dahin
waren wir eine Insel der Beschaulichkeit“,sagt mit einem Anflug von Wehmut derBraunschweiger Erste Kriminalhauptkom-missar Klaus Buhlmann.
Die Frauen der Hamburger Herren sitzennun schon mal, ungewöhnlich für Braun-schweig, ohne Slip im Fenster und arbeitenmit Beischlaf-Tricks, wie sie rund um dieReeperbahn üblich sind, um Freier auszu-nehmen. „Es ist nicht auszuschließen“, be-fürchtet Polizist Buhlmann, „daß auch an-dere Betriebe übernommen werden.“

Mit zunehmender Sorge beobachtet diePolizei im benachbarten Hannover, wiedas Klima dort ebenfalls rauher wird, dieZahl der Huren und Bordelle langsam an-schwillt. Zu den bestehenden 40 Etablis-sements dürften nach einer Analyse derPolizei schon bald „acht bis zehn neueHäuser“ hinzukommen. Unter den hoff-nungsfrohen Neu-Betreibern sind Deut-sche, Türken, Jugoslawen,Albaner, ein Ita-liener und auch ein Russe.
Die Zahl der Prostituierten, die in soge-nannten Modellwohnungen anschaffen,stieg innerhalb eines Jahres von 300 aufjetzt 350, und, so Polizeipräsident Klosa:„Wir beobachten Tendenzen, daß Wohn-container im Umfeld der Expo-Baustellenzur Prostitution benutzt werden.“ Nir-gendwo reagiert der Markt schneller alsim kriminellen Milieu.
Hannovers Polizei rechnet damit, daßsich zur Expo-Zeit die Zahl der jetzt 1800 Huren verdoppeln wird. Weil ange-sichts des erwarteten Besucherstroms oh-nehin erhöhter Bedarf besteht, will dieLandeshauptstadt zur Messezeit auch dieZahl ihrer jetzt 2400 Polizisten mindestensaufs Doppelte erhöhen. Im ganzen Bun-desgebiet hängen die Stellenausschrei-bungen in Polizeidienststellen, Beamte mitMilieu-Erfahrung sind besonders gesucht.Die Resonanz ist nach Auskunft Klosas„erfreulich“.
Von Hamburg bis Kassel, von Bremenbis Magdeburg dürften zur Expo-Zeitsämtliche Hotels ausgebucht sein, Taxifah-rer reiben sich ebenso die Hände wie Ta-schendiebe, und die Nachfrage nach jederArt Amüsement wird wohl für wenigeMonate rapide ansteigen. In der Braun-schweiger Bruchstraße wie am Steintor inHannover werden heruntergekommeneSteigen aufgepäppelt und auf den erwar-teten Run vorbereitet.
Selbst Herbert Wachtel, seit kurzemBetreiber der gewerblichen Zimmerver-mietung „Pascha“ an der Hamburger Ree-perbahn, wo schon bald 180 frisch reno-vierte Zimmer im ehemaligen Eros-Centerden Damen und wenigen Herren des Ge-werbes zur Verfügung stehen, blickt freu-dig in die Zukunft. „Die Expo war zwarkein Grund, das ‚Pascha‘ in Hamburg zueröffnen, aber wir erwarten in dieser Zeiteinen deutlichen Besucherzuwachs.“
Ganz ohne Protest werden sich nieder-sächsische Luden wohl kaum einengrößeren Teil des Geschäfts von Hambur-gern abknöpfen lassen. Am 7. April de-tonierte in einem Haus an St. Paulis Puff-Meile Herbertstraße eine Briefbombe,adressiert an eine Hure mit dem Arbeits-namen Sabrina. Der Sprengsatz, verstecktin einer Schmuckschatulle, verletzte Sa-brina und eine Kollegin. Die beidengehören zum Personal jener Zuhälter, dielaut Staatsanwaltschaft den Braunschwei-ger „Elef“ Varlamis liquidiert habensollen. Andreas Ulrich
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9 121

122
Bayern-Torwart Kahn gegen Borussia Dortmund, gegen Dynamo Kiew: „Manchmal ist es ein verdammter Job“
L.
BAAD
ER
F U S S B A L L
„Das bin ja nicht ich“Seit Wochen steht Nationaltorwart Oliver Kahn im Zentrum einer merkwürdigen
Debatte. Der Münchner macht seinen Strafraum gelegentlich zum Jagdrevier. Er fühlt sich nicht als einer von elf, sondern als einer neben zehn anderen.
Der junge Mann, über den eine Zei-tung schrieb, er sei „ein beißwüti-ger Dumpfschädel“, grüßt von der
weißen Wohnzimmerkommode. Da stehter, freundlich und rosig und pico geschei-telt, in einem Bilderrahmen.
Kann man wirklich vorzeigen, den Oliver.Den geschlagenen Abend hat seine Muttervon ihm geredet und davon, was man alleslesen muß über ihren Sohn, da fällt ihr ein:Sie hat da ja noch was. Monika Kahn schafftdie Fotoalben von früher ans Licht.
Da, bitte schön: Olli am Strand, mit Va-ter und Bruder, oder, auch sehr hübsch,Olli vor dem Weihnachtsbaum, mit derBlockflöte zwischen den Zähnen. „Kön-nen Sie mitnehmen“, sagt Frau Kahn, wär’vielleicht ganz hilfreich, wenn so was auchmal in die Zeitung käme, dann verstündendie Leut’ womöglich, daß er kein brüllen-des Ungeheuer ist, ihr Bub. Das glaubtennämlich inzwischen tatsächlich einige, hat
der Vater rausgefunden. Besserwisser vonden Stammtischen und Klugscheißer vonden Medien; meistens solche jedenfalls,„die nie Fußball gespielt haben“.
Es ist schon weit nach 23 Uhr, als RolfKahn die öffentliche Moral zerrupft – dadurchzuckt es ihn. Draußen auf der Straßedreht gerade jemand durch. Irgendeiner, derwahrscheinlich zuviel gesoffen hat, brüllt indie Karlsruher Nacht, als sei ihm Satan aufder Ferse. Rolf Kahn sieht zum Fenster undsagt: „Der Oliver is des aber net, gell?“
Das sollte natürlich ein Scherz sein, dasProblem ist bloß, daß die Wirklichkeit da-von gar nicht so weit entfernt ist. OliverKahn, 29, ranghöchster Torhüter im Land,die Nummer eins bei Bayern München undder deutschen Nationalelf, macht gele-gentlich den Eindruck, als gehöre er vor al-lem anderen zunächst mal auf die Couch.
Unstrittig ist, daß der gebürtige Badenerzu den besten Kräften gehört, die in der
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Welt auf dieser Position arbeiten. Wahr istaber auch, daß er von Zeit zu Zeit seinenArbeitsplatz zu einem Jagdrevier macht.
Wann immer es mal wieder passiert ist,stehen die Ferndiagnostiker der Nation zurSprechstunde beisammen. Die „Frankfur-ter Allgemeine“ meldete zarte Zweifel an,ob dieser Tormann überhaupt in der Lagesei, „mit Druck umzugehen“.
Robert Wieschemann, Aufsichtsratschefdes 1. FC Kaiserslautern, brachte es mitseinem pfälzischen Rechtsempfinden zu ei-ner Überschrift in der „Bild“-Zeitung:„Der Kahn gehört in den Käfig – und weg.“Komisch war nur Harald Schmidt: Er spot-tete, Münchens Trainer Ottmar Hitzfeldwerde demnächst dem Gegner vor demAnpfiff erst mal Entwarnung geben: „Dertut nix. Der will nur spielen.“
Das Unheil hatte beim Münchner Gast-spiel in Dortmund seinen Lauf genommen.Oliver Kahn mußte da nach 736 Minuten,

A.
HAS
SEN
STEIN
/ B
ON
GARTS
ßballprofi Kahn die Wertewelt der Fünfziger hineingeboren
einem Rekord in der Geschichte der Fuß-ball-Bundesliga, zum erstenmal wieder einGegentor hinnehmen, und dann war es wieim Zoo.
Mit gestrecktem Bein sprang der Münch-ner nur scharf am Gegenspieler StéphaneChapuisat vorbei – das sah aus, als wolle ereine Tür eintreten. Dann kam ihm HeikoHerrlich vors Gesicht – Kahns Kiefer dock-te am Hals des Dortmunder Stürmers an,und man dachte: Gleich hat er die Schlag-ader freigelegt.
Es mußte ja so kommen. Daß mit demdeutschesten Torwart aller Zeiten – blond,blaue Augen, 1,88 Meter groß, 87 Kiloschwer und ein Kinn wie ein Ziegelstein –etwas anders ist als bei den anderen, ahntedie Fußballgemeinde seit jenem Tag,an dem Kahn mit seinem Mannschafts-kameraden Andreas Herzog zusam-menstieß.
Das war vor drei Jahren, Herzog hat-te in der Abwehr gedöst, Kahn packteihn von hinten am Hals und schüttelteihn durch, als sei er eine Spraydose vordem ersten Gebrauch. Harald Schmidtmachte, wie er selber heute noch meint,„einen kabarettistisch sehr wachenWitz“ und verglich ihn mit einem Go-rilla, und seitdem ist Oliver Kahn in derFußballgemeinde irgendwo zwischenForrest Gump und King Kong zu Hause.
Kein zweiter von denen, die für Bay-ern München demnächst womöglich dieChampions League, die Deutsche Mei-sterschaft und den Pokal gewinnen, kannso überzeugend Modell stehen für das,
FuIn
was Bayern München auch ist: MeistensWeltklasse und manchmal ein Club, dermeint, sich alles erlauben zu dürfen.
Dabei ist es nicht so, daß Kahn nicht wüß-te, was sich gehört. Der gelegentlich Über-spannte ist ein gescheiter Kopf: Hat Abiturgemacht und an der Fernuniversität Hagenstudiert, kennt sich an der Börse genausoaus wie in den Werken von Helmut Schmidt,und wenn die anderen im MannschaftsbusKarten spielen, liest Kahn das „ManagerMagazin“. Manchmal sagt er dabei, sie soll-ten die Musik leiser machen, bitte.
Er hat nur den womöglich unange-nehmsten Job, der im deutschen Fußball zuvergeben ist. Das Amt im Tor von BayernMünchen hat den Nachteil, daß immer
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
gleich das halbe Land mitjubelt, wenn derBall mal im Netz gelandet ist. Manchmalpassiert es auch, daß vor dem Tor gar nichtspassiert, weil die Kollegen so gut sind, unddann kriegt man einen einzigen Schuß, undder ist drin. „Manchmal ist es ein ver-dammter Job“, sagt Oliver Kahn.
Subjektiv stimmt das allemal. Denn woimmer er in fremden Stadien auftritt – dieNummer mit dem Gorilla kriegt er nichtmehr los. Die Leute machen Geräusche wiepaarungsreife Menschenaffen und werfenBananen in seinen Strafraum, meistensschon geschält, damit es richtig matscht.Einmal hat er eine gegessen – der Vater hatihm das jetzt verboten, „weil man ja nieweiß, ob die da nicht Gift reinspritzen“.
Kürzlich in Kaiserslautern war es wiederbesonders arg. Die Westkurve stand zu ei-nem Spottgesang beisammen („Da stehtein Affe im Tor, jaja ein Affe im Tor, der istso häßlich“), und von den Südfrüchten, dievor seinem Tor landeten, hätte Oliver Kahneine ganze Woche satt werden können.
Er behauptet, er stehe da inzwischen drü-ber. „Ich werf’ das Zeug eben einfach weg.Man gewöhnt sich ja an alles.“ Aber er sagtdas nur, weil es gut klingt. Sein Trainer Ott-mar Hitzfeld, ein Mann mit Blick für Men-schen, weiß, was in solchen Momenten mitseinem Torwart passiert: Jedesmal, wenn erdas Zeug um die Ohren kriege, sei das wie-der „eine unglaubliche Demütigung. Unddann sagt er sich: Ich muß hier zu null spie-len, dann gehe ich als Sieger hier raus“.
Das sind profane Reflexe, die nicht zudem Bild passen, das Oliver Kahn gern vonsich schaffen möchte. Geradeaus, intelli-gent, interessiert und einer, der einlöst, wasdie Leute verlangen: Tüchtig Arbeit fürtüchtig Geld. Immer wieder zwängt er sichin eine Rolle, die er nicht durchhaltenkann, wenn es anders kommt, als er sichdas vorgestellt hat.
Bei allem, was er im Kopf hat, ist Kahndoch auch ein Fußballspieler mit arttypi-schen Reaktionen: Wer in sein Tor schießt,bringt ihm eine persönliche Niederlage bei.Wenn sein Minutenrekord gebrochen wird,
wird auch seine eigene Heldengeschich-te kaputtgeschossen, und dann ist er zumaßloser Wut fähig.
Wenn Kahn mal wieder ausgerastetist, leidet er. Unter sich, weil er nichtwill, daß so etwas zu ihm gehört – „dasbin ja nicht ich in dem Moment“. Undunter denen, die ihm dabei zugucken:Die Massen, die ihn verhöhnen, und dieMedien, die ihn hinrichten.
Für Fußballspieler, die so gut sind,daß sie vor großem Publikum auftretendürfen, hat Oliver Kahn immer die blan-ke Bewunderung bereitgehalten. Als erKind war, arbeitete seine Mutter alsKrankenschwester und sein Vater beiSiemens im Einkauf.
Rolf Kahn führte ein bürgerliches Le-ben, nur am Wochenende strahlte er ge-legentlich auf: Er spielte als linker Läu-
A.
HAS
SEN
STEIN
/ B
ON
GARTS
123

Sport
ähopfer Kahn: „Eine unglaubliche Demütigung“
Vater Rolf Kahn, Söhne Axel, Oliver„Wie hat’s ausgesehen, Papi?“
fer beim Bundesligaclub KarlsruherSC. Er kam auf elf Einsätze zwi-schen 1963 und 1965, bis eine Ver-letzung seine Laufbahn beendete.„Jeder, der heute in der Bundesligaspielt“, sagt der Vater, „hat meineAnerkennung, weil er in der Lageist, ein Künstler zu sein.“
Im Raum neben seinem Wohn-zimmer hat früher der inzwischenberühmte Nationaltorwart gelebt.Am Kleiderschrank hängt ein Sport-pullover, vornedrauf ist das Gesichtdes Sohnes gedruckt. Wenn VaterKahn über den spricht, sagt er: „derOliver Kahn“. Das klingt, als redeeiner aus der Stehkurve oder amSat-1-Mikrofon.
Was Rolf Kahn als Fußballspielererlebte, hat sich der Sohn gut ge-merkt. Er ist in eine Wertewelt hineinge-boren worden, die ihre Wurzeln in denFünfzigern hat, und bekam die Chance,das fortzusetzen, was der Vater abbrechenmußte.
„Früher“, erzählt der, „war es nicht denk-bar, daß ein Nationalspieler ausgepfiffenwird.“ Als Jugendlicher hat er unter HelmutSchön trainiert, und wenn der seine Jungsbei der Ehre packen wollte, kamen die An-stand-und-Disziplin-Geschichten von UweSeeler: „50 Fallrückzieher hat der Uwe ge-macht, dann macht der Trainer das Lichtaus, und der Uwe sagt: Licht wieder an,noch mal 25 Fallrückzieher.“ Einmal kamSepp Herberger zu Besuch: „Da sind wirstrammgestanden.“
Am Tag nachdem Oliver Kahn den FCBayern München mit einem phänomenalenAuftritt gegen Dynamo Kiew ins Endspielder Champions League geführt hat, sitzt ermittags im „Gutshof Menterschwaige“ undsticht mit der Gabel in eine Schüssel vol-ler Pellkartoffeln. Nicht, daß ihm jetzt un-bedingt der Sinn nach Pellkartoffeln stün-de – aber er braucht Kohlenhydrate. Er hatgestern beim Spiel drei Kilo Gewicht ver-loren, vor lauter Anspannung. Jeder Jour-nalist, der sich mal mit Oliver Kahn befaßthat, schreibt, er sei „besessen“.
Als Kind ist er mit seinem Vater unddem Bruder am Wochenende immer beimFußball gewesen. Und als er sechs ist, be-schließt er, daß er mal Profi wird. „Mir warnicht nur klar: Ich will das mal werden,sondern mir war klar: Ich werde das mal.“
Aus Seeler wurde „uns Uwe“, weil ereben immer 25 Fallrückzieher extra mach-te. Und weil Kahn kein außergewöhnlichesTalent hat, Fußbälle zu fangen, ist schließ-lich auch klar: „Ich kann nur besser werdenals die anderen, wenn ich mehr arbeite alssie.“ Das hat er „so drin, daß man es nichtmehr rauskriegt“.
Mit 17 Jahren geht er ins Bodybuilding-studio, und zwar nicht in einen dieserschnieken Freizeittempel, „wo man denMädchen auf den Po guckt“, wie der Vatersagt, sondern in eine finstere Kaschemme,
Schm
124
wo nur die kleinen Schwarzeneggers vomLande hinfinden.
„Schweißer-Center“ nennt Oliver Kahndiese Einrichtungen, „schweißen“ ist einsseiner liebsten Wörter. Gute Torhüter müs-sen starke Körper haben, findet er. „DieStürmer sollen Angst vor mir haben“, hater früher mal gesagt. Heute sagt er „Re-spekt“, weil das überlegter klingt.
Weil er nie sicher sein kann, ob seine Ent-würfe auch aufgehen, hört Oliver Kahn nieauf zu schweißen. Denn er weiß ja, wie esfunktioniert. Beim Karlsruher SC, seinemHeimatverein, gab es früher den anerkann-ten Torwart Alexander Famulla. Der hattemal eine kleine Schwächephase und dum-merweise einen ambitionierten Stellvertre-ter, der sich später so erinnerte: Famullahabe es „von den Zeitungen gekriegt, undich habe Gas gegeben. Ich habe gemerkt,daß er das nicht verkraftet, daß er anfälligist. Und dann war er weg vom Fenster.“Und: „Wo ich bin, spiele ich, fertig. Wenn
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
nicht, gibt es Zoff,Ärger, Power undKampf ohne Ende.“
Der Stellvertreter war OliverKahn. Ja, sagt der Fürchtenix jetzt,das hat er zwar mal so formuliert,aber heute würde er das nicht mehrtun, „weil es zu extrem rüber-kommt“. Die Wahrheit ist es trotz-dem immer noch.
Kahn glaubt, er brauche denDruck, um gut zu sein, deshalb trom-petet er auch schon mal durchsLand, er sei „der beste, der mit Ab-stand beste Torwart Deutschlands“.Manchmal setzt er sich damit so un-ter Dampf, daß entweder der Kesselexplodiert oder ein Ball ins Tor fliegt,den er eigentlich halten könnte.
Zuletzt ist ihm so ein Mißgeschickgleich zweimal bei der Nationalelf
passiert. Fünf Jahre mußte er warten, bis erhier erste Wahl wurde, und kaum war er es,langte er daneben. Dann meldete sich JuppDerwall zu Wort und sagte, Kahn sei ein„Sicherheitsrisiko“.
Derwall. Ausgerechnet Derwall. „Prostich bin der Jupp“-Derwall, das größte Si-cherheitsrisiko des deutschen Fußballs, be-vor Erich Ribbeck kam. Muß er den ernstnehmen? Müßte er nicht, tut er aber, weil„dieser Dreck“ überall stand. Er tritt vorJournalisten und sagt, daß ihn so was „über-haupt nicht interessiert“. Unterm Tischkracht dabei unentwegt seine Schuhsohleauf den Boden, und die Menschen, die ihmzuhören, sieht er an, wie er damals AndreasHerzog ansah, bevor er ihn schüttelte.
Denn so fühlt er sich manchmal ja auchin seinem Tor. Nicht als einer von elf, son-dern als einer neben zehn anderen. Ist es daein Wunder, daß er irgendwann durch-knallt? Oliver Kahn hat nachgedacht undsich dann mit sich selbst auf eine logischeKette geeinigt; die trägt er vor, als habe ersie daheim im Mietshaus schon ein paar-mal geübt. Dabei sagt er „ich“, wenn er einEmpfinden beschreibt, das unbedenklich ist.Und er sagt „man“, wenn er das darstellt,was er gern nicht wahrhätte: „Als Torhüterhab’ ich nicht die Möglichkeit, meine Ag-gressionen rauszulaufen, ich stehe und ste-he und stehe. Jetzt kann es sein, daß man sounter Strom steht, daß man sich entladenmuß, denn sonst kann man krank werden.So einfach ist das.“
Daß es vermutlich doch etwas kompli-zierter ist, weiß er ja selbst. Am Abendnach seinem Irrlauf von Dortmund rief erden Vater an und fragte: „Wie hat’s ausge-sehen, Papi?“ Zu seiner Mutter sagte er:„Ich schäme mich.“ Und als er das ganzeDesaster noch mal im Fernsehen sah, dach-te er: „Sollte dich dieses Geschäft so weitbringen, daß du wirklich so bist, dann wür-de ich sofort aufhören.“
Sollte? Würde? Er muß nicht erst noch sowerden, er ist ja schon so, manchmal je-denfalls. Sonst wäre er vielleicht auch nichtso gut. Matthias Geyer
H.
RAU
CH
EN
STEIN
ER

Werbeseite
Werbeseite

12
Sport
Fo
A M E R I C A N F O O T B A L L
„Wer Wind sät“Konsequenter wurde noch kein Sport als Show verkauft:
Ein amerikanisches Konsortium will mit einer künstlichen Ligaden deutschen Markt erobern – ihr jüngster Standort: Berlin.
otball-Spiel der NFLE*: Söldnertruppen ohne Herz und Heimat
CAM
ER
A 4
Footballer Kruse
Als Axel Kruse, 31, in der Karstadt-Filiale zwischen Trikots und Turn-hosen einmarschiert, scheint er auf
einen großen Auftritt vorbereitet. VierMänner mit mächtigen Oberarmen geleitenihn zu einem Podest, auf dem die BerlinerLokalgröße Autogramme schreiben soll.
Doch die Nachfrage ist überschaubar:Zwei Dutzend Kruse-Anhänger verlierensich in der Sportabteilung des Kaufhauses.Nach acht Minuten sind alle Interessentenbefriedigt; wacker füllt der Stargast seinenpersönlichen Vorrat an unterzeichnetenBildchen für den Fan noch ein bißchen auf,dann geht er heim.
Früher, als Kruse in der Fußball-Bun-desliga für Hertha BSC Berlin, den VfBStuttgart und Eintracht Frankfurt auf Tore-jagd ging, wäre ihm so wenig Beachtungauf den Magen geschlagen. Dieser Tage sinddie Ansprüche bescheidener. Kruse fungiertbei den Berlin Thunder, einem neugegrün-deten American-Football-Team, als „Ce-
* Frankfurt Galaxy gegen Berlin Thunder am 17. Aprilim Frankfurter Waldstadion.
6
lebrity-Kicker“.Was dasheißt, weiß der Ost-deutsche griffig zu for-mulieren: „Ich mach’PR, und beim Spiel mußich viel rumstehen, umdann das Ding reinzu-hauen.“
Kruse, für den ein ir-reparabler Knieschadenvoriges Jahr das Karrie-reende als Fußballprofibedeutete, führt nunden Kick nach demTouchdown aus – mitdem gesunden Bein,vielleicht drei-, viermalpro Spiel. Wichtiger alsdie Bonuspunkte, die ermit den Freistößen zwi-schen die Malstangenerzielen soll, ist seinemArbeitgeber ohnehin,daß er gehörig trommeltfür Berlins jüngsten Un-terhaltungsbetrieb.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Mit Sport haben die Thunder nur amRande zu tun. Sie sind ein Retortenclub,geklont von einem amerikanischen Kon-sortium, das sich den deutschen Markt er-schließen will. Hemmungslos bedienen sichdie Kreuzzügler dabei Methoden, die nichtmal in den USA vorstellbar wären.
Die sechs Mannschaften der NationalFootball League Europe (NFLE) sind so et-was wie das Vorauskommando für eine ko-loniale Eroberung, Söldnertruppen ohneHerz und Heimat. Die NFLE gehört zu 51Prozent den Besitzern der 31 Teams derUS-Profiliga NFL, die übrigen 49 Prozenthält Medien-Tycoon Rupert Murdoch. ZumStart der Liga 1995 suchten die Promoter alsStandorte sechs Städte aus, die von Markt-forschern als profitträchtig eingeschätztwurden: Frankfurt, Düsseldorf, Barcelona,London, Edinburgh und Amsterdam.
Während in der hessischen Metropoledas Implantat American Football vom Pu-blikum angenommen wurde – die „Frank-furt Galaxy“ liegen mit einem Zuschauer-schnitt von 35000 pro Spiel fast 20 Pro-zent über dem der Fußballer von EintrachtFrankfurt –, fanden die Engländer keinenGefallen an dem Gemetzel um den eiför-migen Ball. Die „Monarchs“ spielten amEnde vor nicht mal 5000 Zuschauern.
Die NFLE schloß kurzerhand ihre Filia-le auf der Insel und befand die neue deut-sche Hauptstadt als lohnendes Ziel.Als obein neues Waschmittel einzuführen sei,wurden Marktanalysen erstellt und Wer-bestrategien verfaßt. Den Namen desTeams ließen die Manager basisdemokra-tisch ermitteln, indem sie die Leser der„B.Z.“ und die Hörer eines Privatsendersunter fünf Vorschlägen auswählen ließen;das passende Logo für die Thunder er-stellten die NFL-Kreativen in Manhattan.
Rund 30 MillionenMark läßt sich die NFLihre Außenstelle Euro-pa pro Saison kosten.Die Spiele werden vonApril bis Ende Junidurchgezogen, wenn inden USA der FootballBetriebsferien macht.
Das Personal rekru-tiert sich zu Dreiviertelaus Amerikanern, dievon der NFL ausgelie-hen und auf die sechsFilialen verteilt werden– Rekonvaleszenten, dienach Verletzungen wie-der Spielpraxis bekom-men sollen; Profis, diesich nach einem Lei-stungstief wieder anbie-ten wollen, oder Talen-te, die um den erstengroßen Vertrag kämp-fen. Wie unter Leih-arbeitern üblich, lebendie US-Boys im Hotel.
S.
BEH
NE /
WEN
DE

Zwar sehen die Regeln vor, daß auch elf„Nationals“ in den Teams spielen. DochEinheimische, die den Qualitätsstandardsder NFL entsprechen, gibt es kaum: Diemeisten füllen nur als Ersatzkräfte dieMannschaften auf. Zum Stammpersonalzählen bestenfalls die Celebrity-Kicker:Der ehemalige Bremer Fußball-TorjägerManfred Burgsmüller bei den DüsseldorfRhein Fire, Kruse in Berlin oder bei denBarcelona Dragons Jesús Mariano Angoy,ein ehemaliger Torhüter des FC Barcelona.
Daß die neue Klientel versteht, wieAmerican Football mit seinen taktischenFinessen wirklich funktioniert, erwartendie NFL-Manager erst gar nicht. „Fete undSport“ propagiert NFLE-Präsident OliverLuck als „Einheit“. Luck, 39, ehemalsQuarterback bei den Houston Oilers, läßtschon Stunden vor dem Match die Sta-diontore zur „Power Party“ öffnen. DasAreal wird mit Musik beschallt, Spielbudenstehen parat wie auf der Kirmes, Hundefangen Frisbee-Scheiben, in Frankfurt gingsogar ein Zeppelin im Waldstadion nieder.
„Mit dem Remmidemmi“ will Statthal-ter Luck nicht nur das regelunkundige Pu-blikum bei Laune halten, sondern denTraum eines jeden Sportveranstalters ver-wirklichen: den genußvollen Konsum, un-abhängig von Sieg oder Niederlage – damitdie Kasse auch stimmt, obwohl ein Teamder Konkurrenz nicht gewachsen ist.
Doch genau an diesem Punkt scheintLucks Mission vorläufig an Grenzen zustoßen. Fieberhaft studierte die NFLE-Zen-trale im vierten Stock einer alten Maschi-nenfabrik in Frankfurt-Rödelheim die Zei-tungsartikel nach der Premiere der BerlinThunder. Die Neulinge hatten ihr mit vielWerbung („Wer Wind sät, wird Sturm ern-ten“) angeschobenes Debüt ziemlich ver-masselt. Streng ergebnisorientiert mäkeltedie deutsche Presse über die 14:48-Heim-pleite der Thunder. „Keine Silbe“, so stell-ten die NFLE-Vermarkter enttäuscht fest,war „über die Party“ zu lesen, die den10 000 Zuschauern im Jahnstadion amPrenzlauer Berg geboten wurde.
Auch die Live-Übertragung im DSF ge-riet daneben. Weil „stundenlang dickge-polsterte, in einer Art Ritterrüstung ver-steckte Männer aufeinanderfielen“ und„als Knäuel verharren“, befand der Berli-ner „Tagesspiegel“ gelangweilt nach demTV-Auftakt: „Eine Zehn-Minuten-Zusam-menfassung reicht völlig.“
In manchen Belangen indes hat Luck dieKonzernmutter NFL mit seiner Geschäfts-tüchtigkeit bereits abgehängt. In Frankfurtetwa brachte die sponsernde Brauerei ein„Galaxy-Bier“ auf den Markt, was sich inden mit Alkoholwerbung eher vorsichti-gen USA „aus Gründen der Political cor-rectness“ (Luck) nicht ziemte. Und selbstmit seiner schrillen Power Party, schwantLuck, „würden wir in Amerika die Leute,die das Footballspiel verstehen und lieben,wohl verärgern“. Jörg Winterfeldt
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

FO
TO
S:
CO
RBIS
-BETTM
AN
N (
li.
o.)
; R
EU
TER
S (
li.
u.)
; H
. S
CH
WAR
ZBAC
H /
AR
GU
S (
re.
o);
ULLS
TEIN
BIL
DER
DIE
NS
T (
re.
u.)
Telefonieren 1909, 1997; W
VI. Das Jahrhundert der Elektronik und der Kommunikation:1. Die Elektrifizierung (17/1999); 2. Mensch im Netz (18/1999);
3. Vom Film zum Internet (19/1999)
eltraum-TV-Übertragung mit der russisch-amerikanischen „Mir“-Crew; Devisenhändler in Frankfurt am Main (1987)
Das Jahrhundert der Elektronik und der Kommunikation
Mensch im NetzIdeologien starben, eine Utopie siegt – die der globalen Verbindung.
Weltweit boomt die Kommunikationstechnik.Doch ihre Dominanz belastet den Menschen und verstärkt
seine Sehnsucht nach persönlichem Kontakt.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9 131
132
Das Jahrhundert der Elektronik und der Kommunikation: Mensch im NetzSpie
gel des 2
0. Ja
hrh
undert
s
US-Familie beim Fernsehen (Postkarte aus den fünfziger Jahren): Versammeln wie einst an der Feuerstelle
Der kommunizierende MenschVon Karl Otto Hondrich
Alle tun es. Kinder und Eltern, Frau-en und Männer, Verkäufer undKunden, Patienten und Ärzte, Wis-
senschaftler, Finanzakrobaten, Bienen tunes, Hunde mit Menschen, Menschen mitHunden, Stars tun es mit Publikum, sogarFeinde tun es miteinander – manchmal.Alle kommunizieren. Und alle reden dar-über. Kommunikation gibt es, seit es Le-bewesen gibt. Das Kommunizieren überKommunikation ist jüngeren Datums.Ganz neu ist das Loblied auf die Kommu-nikation – weltweit.
„Ich arbeite in einer internationalen Fir-ma“, sagt mein Nachbar, Herr Peters, Soft-ware-Spezialist für Banken-Computer, „je-den Tag habe ich mit Leuten aus Amerika,aus Singapur, aus Nigeria zu tun. Da mußman offen sein, aufeinander zugehen, sichverständigen. Und es klappt auch. ImGrunde ist es wunderbar.“
Wir haben uns zufällig im Stehcafé ge-troffen. Eine Stunde später schon hat ermir die zehn Leitsätze seines Unterneh-mens „für unseren Umgang mit anderenBeschäftigten, Kunden und Geschäftspart-nern“ übermittelt – per Fax. „Communi-cate openly, honestly and directly“ heißt
das vierte Postulat, „listen with an openmind; learn from everything“ das fünfte.
Muß man es noch übersetzen? OpenMind ist bereits einer der globalen Begrif-fe, die Sprachgrenzen mühelos übersprin-gen und – scheinbar – überall verstandenwerden; ein deutsches Wort gibt es dafürnicht. Und die Forderung, offen und direktzu kommunizieren, kommt auch dort an,wo man Englisch noch nicht selbstver-ständlich als zweite Sprache spricht.
Die Zahl derjenigen, die heute mit derWare und mit dem Konzept Kommunika-tion Geld verdienen, ist unüberschaubargeworden. Es sind Computerfirmen undComputerfreaks, Public Relations Specia-lists, Publizisten, Marketing Manager,Wer-bemenschen,Wissenschaftler,Animateure,Reisebegleiter, Geschäftsleute, Politiker,Pädagogen, Künstler, die aus begreiflichemEigeninteresse das Hohelied der Kommu-nikation und ihrer Medien singen. Ein Heervon Organisationspsychologen und Fami-lientherapeuten bietet sich an, um den Dä-mon „Kommunikationsstörung“ auszutrei-ben – selbstredend kommunikativ, mitKommunikationstraining, kommunikativerKompetenz und Meta-Kommunikation.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Und die philosophischen und soziologi-schen Meisterdenker der Bundesrepublikverleihen der Sache Kommunikation diehöchsten theoretischen Weihen; für denjüngst verstorbenen Niklas Luhmann istsie die „Letzteinheit“, aus der soziale Sy-steme bestehen; Jürgen Habermas sieht im„kommunikativen Handeln“, das im Ge-gensatz zum „strategischen Handeln“ nichtam eigenen Vorteil, sondern an Verständi-gung orientiert ist, den Wegweiser zu einerguten Gesellschaft.
Kommunikation als Lebenselixier, alsdas Bezeichnende und Gute der moder-nen Welt – darauf scheinen sich alle ver-ständigen zu können. „Miteinander re-den“ birgt die Hoffnung, daß Streit undMißverständnisse am Arbeitsplatz und inder Familie ausgeräumt werden. Es sollauch Gewalt und Krieg verhindern: Werverhandelt, schießt nicht. „InterkulturelleKommunikation“ als neues Studienfachschließlich soll die Schranken des Nicht-verstehens zwischen den Kulturen nie-derreißen.
Der schwärmerische Ton, mit dem dieeinschlägigen Bücher und Seminare an-gekündigt werden, ergreift auch die nüch-

Internet-Café (in Essen): Was global eindringt, wird lokal gefiltert und gedeutet
M.
MATZEL /
DAS
FO
TO
AR
CH
IV
ternsten Ingenieure, Unternehmer und Sta-tistiker, wenn sie die Entwicklungstrendsder „neuen Medien“ fortschreiben. KeinZweifel: Wenn von Kommunikation dieRede ist, ist nicht nur von Realitäten dieRede, sondern auch von Visionen.
Beenden wir das Zeitalter der Ideolo-gien und Utopien mit einer neuen Utopie?Ohne die Zauberkraft einer Zukunftsideescheinen wir nicht leben zu können. An-ders als Nationalismus, Sozialismus, Libe-ralismus, die vertanen Leitbilder des 19.und 20. Jahrhunderts, bezaubert Kommu-nikation nicht durch die Vorstellung einerbestimmten Gesellschaftsgestalt, sonderndurch die eines Verfahrens: sich mitteilenund verständigen. Es ist für alle Inhalte of-fen. Kommunikation steht für offene, fürdemokratische Gesellschaft. Sie ist der Be-
griff, den sich Gesellschaft von sich selbstmacht, wenn sie sich nicht mehr als natio-nale sieht, sondern als Gesellschaft derGesellschaften, als Weltgesellschaft.
Wie sollen die bald sechs MilliardenMenschen, die diese Weltgesellschaft be-völkern, sich mitteilen und verständigen?Es gibt Tausende von Sprachen, aber kei-ne gemeinsame. Die Wahrnehmungs- undMitteilungsfähigkeiten jedes einzelnensind heillos überfordert. Die Aufgabescheint alles menschliche Vermögen zusprengen.
Der einzig vorstellbare Weg, einer Lö-sung irgendwie näher zu kommen, liegt inder menschlichen Fähigkeit, die eigenenbeschränkten Instrumente durch techni-sche Mittel zu erweitern.Wie der Faustkeil,der Mähdrescher und die Walzstraße die
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Möglichkeiten der Menschenhand erwei-tert haben, so die Kommunikationsma-schinen die Möglichkeiten der Mitteilung.
Dieser Prozeß ist seit Urzeiten imGange. Von beschrifteten Papyrusrollenüber den Briefverkehr zur elektronischenPost, von den handgeschriebenen über diegedruckten Bücher und Zeitungen zu dencomputerlesbaren Mikrofiches und CD-Roms, von den Telegrafen über das Tele-fon und das Telefax zum Handy, von ge-malten Bildern über Plakate zu Compu-terzeichnungen, von Fotografien zu Kine-matographien, vom Grammophon überRundfunk und Fernsehen zu Video-Discs.Die technischen Entwicklungen werdenimmer rasanter.
Jedes neue Medium kann etwas, was sei-ne Vorläufer und die bisher bekannten
„Die Welt funktioniert nur durch das Mißverständnis.Eben durch dieses universale Mißverständnis bringt sich jeder
mit dem anderen in Übereinstimmung.“Charles Baudelaire, französischer Dichter (1821 bis 1867)
133

Das Jahrhundert der Elektronik und der Kommunikation: Mensch im NetzSpie
gel des 2
0. Ja
hrh
undert
s
19
Junge Amerikaner am Radio (1921): „Die Lehre der Schulmeister entwertet“
CU
LVER
PIC
TU
RES
Medien nicht konnten. Die Erfindung desBuchdrucks eröffnete schriftlichen Nach-richten den Weg zu einem Massenpu-blikum. Der Telegraf beschleunigte dieNachrichten, das Telefon fügte ihnen zweiunschätzbare Qualitäten hinzu: den Tonder gesprochenen Rede und die direkteErwiderung. Dafür fehlt dem Telefonat dienachhaltige Dokumentation.
Hier springt das Faxgerät ein, aber ihmfehlt die Stimme. Die hält der Anrufbe-antworter fest. Er vergrößert die Freiräumedes Telefonierens: Dem Anrufer bietet erdie Freiheit, eine Nachricht aufzeichnenzu lassen oder nicht, dem Angerufenen dieFreiheit, einen bestimmten Anruf entge-genzunehmen oder nicht und ihn zu erwi-dern oder nicht. Der Anrufbeantwortermacht den Adressaten unerreichbar, wenner zu Hause ist, und, sofern er abwesendist, erreichbar – allerdings zeitversetzt, wieder Brief. Das Handy steigert noch einmaldie Erreichbarkeit des Menschen, machtihn zu einem allzeit und allerorts An-sprechbaren – und Sprechenden.
Brief, Telegraf, Telefon, Telefax undneuerdings E-Mail treiben die persönlicheoder individuelle Kommunikation immerschneller über immer weitere Entfernun-gen voran. Verbunden sind dabei immernur zwei oder wenige Menschen. Mit Blickauf Exklusivität und Intimität des Mittei-lens ist dies ein Vorzug. Es wird dagegenzum Nachteil, will man möglichst vieleMenschen in den kommunikativen Ver-bund einbeziehen. Das können nur diesogenannten Massenmedien leisten.
Rundfunk und Fernsehen transportierenein und dieselbe Nachricht gleichzeitig anMilliarden Menschen.Was bei dieser Brei-tenwirkung verlorengeht, ist die Vertiefung,insbesondere aber die Gegenseitigkeit derMitteilung.
134
Neuerdings häufen sich die Versuche,dem abzuhelfen. Wie viele Telefone aberauch zugeschaltet werden, um das Publi-kum als ratendes und ratsuchendes, aus-kunftheischendes und auskunftgebendes,mitspielendes, debattierendes und abstim-mendes einzubeziehen: Die Wechselseitig-keit der Kommunikation bleibt doch einekarge, ungleiche und ausschnitthafte.
Die neuen Medien können dieses Bildinsofern ändern, als sie Computer undTelefon, also Systeme der Datenverarbei-tung und der Datenübertragung, mitein-ander verbinden. So entsteht als derzeitbekannteste kommunikative Innovationdas Internet. In diesem Netzwerk kann je-der mit jedem, der Telefon und Computerhat, Informationen austauschen, Waren-und Geldgeschäfte machen, Fachgesprächeführen, spielen odereinfach in Chat-rooms schwatzen –und das weltweit.
Das jeweilige Ge-genüber kann sichauf seiner Home-page, einem selbst-gefertigten Werbe-prospekt, auch perFoto vorstellen. Inder Regel allerdingsbleibt es unsichtbarund unhörbar: Manteilt sich seine Auf-träge, Anträge undAntworten schrift-lich auf dem Bild-schirm mit.
Aber schon be-ginnen die Techni-ker damit, Compu-ter- und Fernseh-bildschirme in eins Propaganda-Plakat (
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
zu bringen, mit Fax zu verbinden und dasGanze per Handy transportabel zu ma-chen. Die technologische Phantasie gipfeltin einer Wundermaschine, die alles kann:eine wahre eierlegende Wollmilchsau.
Es zeichnet diese Vision aus, daß sienicht mit einem Schlag zu verwirklichen istund sich doch Stück für Stück zu erfüllenscheint. Kaum ein Tag vergeht, an demnicht Neues und manchmal Unglaublichesvon der Erweiterung, Vernetzung, Be-schleunigung, Erleichterung der Kommu-nikation durch ihre Medien berichtet wird.Die Medien von heute, gestern noch alsletzter Schrei gefeiert, scheinen morgenüberflüssig zu sein.
Die Vorstellung trügt. Obwohl das In-ternet mit elektronischer Post, ElectronicBanking, Electronic Booking, ElectronicCommerce, Electronic Chatting, elektroni-scher Partnersuche et cetera von Jahr zuJahr schwindelnde Zuwachsraten erzielt,wird immer mehr telefoniert, mit und ohneSchnur. Das Telefon hat das Briefeschrei-ben nicht verdrängt, sondern mitgezogen(seit 1970 in der Bundesrepublik von 10 aufüber 20 Milliarden Sendungen); das Fern-sehen (von 17 Millionen auf 34 MillionenZulassungen) hat das Radio nicht aus demRennen geworfen (von 20 Millionen auf 38Millionen Zulassungen), ja entgegen allenErwartungen nicht einmal das Kino (von3400 auf über 4000 Spielstätten).
Dem klassischen Medium des Bucheskonnten weder die teils noch steigendenAuflagenzahlen von Zeitungen, Illustrier-ten, Roman- und Comic-Heftchen noch Ra-dio und Fernsehen das Wasser abgraben. Inderen Literatursendungen wird sogar kräf-tig für das Buch geworben. Noch mehr hatsich das allerneueste Medium in den Dienstdes Buches gestellt: Keine andere Warewird so häufig über das Internet verkauftwie Bücher. Die Buchtitelproduktion stiegseit 1970 von 47000 auf über 75000 im Jahr.
Daß neue Mediendie älteren meistnicht ersetzen, son-dern ergänzen, wur-de bereits 1911 vondem leitenden Re-dakteur der „Nord-bayerischen Zei-tung“ in Nürnberg,Wolfgang Riepl, als„ein Grundgesetzder Entwicklungdes Nachrichten-wesens“ erkannt. Inseiner Doktorarbeitzur Geschichte desNachrichtenwesensbei den Römernentdeckte Riepl,„daß die einfach-sten Mittel, For-men und Metho-den, wenn sie nureinmal eingebürgert36)
BPK

Medienandrang (beim Simpson-Prozeß 1995 in Los Angeles): Hoheslied der Helden
KIN
GAS
SO
N /
GAM
MA /
STU
DIO
X
und brauchbar befunden worden sind,auch von den vollkommensten und höchstentwickelten niemals wieder gänzlich unddauernd verdrängt und außer Gebrauchgesetzt werden können, sondern sich ne-ben diesen erhalten, nur daß sie genötigtwerden, andere Aufgaben und Verwer-tungsgebiete aufzusuchen“.
Geradezu prophetisch mutet diese Ein-sicht an, wenn man sie an heutigen Ver-hältnissen überprüft. Dieselben Manager,Politiker, Wissenschaftler, die über dievollkommensten Mittel der Mitteilung ver-fügen und per Bildtelefon, Konferenz-schaltung, Telefax, elektronischer Post vonihrem Bürosessel aus bis Feuerland undFidschi vernetzt sind, jetten mehr als jezuvor durch die Welt – nur um auf dieallereinfachste Weise zu kommunizieren:sich zu sehen, zu hören, zu riechen, an-zufassen, manchmal abzuküssen und essich gemeinsam schmecken zu lassen.
Was soll man von soviel kommunikativerZeit- und Energieverschwendung halten?Sind die modernen mobilen Eliten, die sichselbst als höchste Repräsentanz ökonomi-schen Rationalität verstehen, letztlich überdie kommunikativen Rituale der Urväternicht hinausgelangt? Oder sollten in derunmittelbaren Kommunikation von Ange-sicht zu Angesicht Qualitäten liegen, vondenen sich die Traumtänzer der techno-medialen Kommunikation nichts träumenlassen?
Kommunikation ist eine Sache der Sinne.Es sind alle Sinne, die ihren Teil dazu bei-tragen. Und jeder Sinn steuert etwas an-deres bei. Was wir hören, ist nicht durchGelesenes zu ersetzen; das Gesehene nichtdurch das Angefühlte; was wir riechen,gleicht nicht dem, was wir schmecken. Überalle fünf Sinne teilt sich mehr mit als übervier oder nur einen Sinn. Kommunikationunter körperlich Anwesenden enthält Mit-teilungen über alle fünf Sinne – vom sech-sten Sinn ganz zu schweigen. Kommunika-tion über technische Medien dagegen schal-tet immer sinnliche Mitteilungen aus – auchdas Gespräch am Bildtelefon läßt nicht allessehen und hören, geschweige denn tasten,riechen und schmecken.
Zwar wird durch die gleichzeitige Mit-teilung über die fünf Sinnkanäle auch Ver-wirrung gestiftet – bis hin zur Schizophre-nie. Wer vollmundig seine Liebe erklärtund sich zugleich halb abwendet, gibt un-gewollt widersprüchliche Signale.
Aber gerade darin liegt der Vorzug derunmittelbaren Kommunikation: Sie ent-hüllt Widersprüche und setzt das Risikovon (Selbst-)Täuschungen herab. In ihr liegtein Schatz von Erfahrungen, den wir vor al-lem Bewußtsein – in der Beziehung zu denEltern – erwerben. Diese ist nie eine ver-mittelte. In ihrer sinnlichen Qualität undReichhaltigkeit bleibt sie der medialenKommunikation ewig überlegen.
Es gibt also gute, rationale Gründe dafür,daß den modernen Menschen wie ihren
Vorfahren kein Weg zu weit, kein Wasserzu tief ist, um hinüberzugelangen, den an-deren zu sehen. „Ich möchte dich sehen“heißt ja immer sehr viel mehr, als gesagtwird. Die Liebenden wissen das. Selbst-verständlich wissen es die Dichter. Aberauch Geschäftsleute und Politiker. Sie las-sen sich heute nicht mehr durch Gesandtevertreten, sondern reisen selbst. Jelzin undKohl in der Sauna – das ist höhere kom-munikative Rationalität.
Aus Hollywood erfuhr der Medienwis-senschaftler Dieter Prokop, daß die Spit-zenstars, die ihre Geschäfte von Topagen-ten regeln lassen, in der entscheidendenPhase der Verhandlung mit dem Film- oderFernsehproduzenten von weither anreisen,um aus Miene, Gesten, Tonfall ihres Ge-genspielers zu erspüren, wie hoch ihr Wertauf dem Markt der Bilder und Gefühledenn nun wirklich ist.
Hätte man für die jungen Leute, die heu-te aus den Schulen und Universitäten aufden Arbeitsmarkt drängen, nur einen ein-zigen Rat frei (und nicht mehr), dann wür-de er nicht lauten: Stellenanzeigen – mitt-lerweile auch im Internet – lesen und sichbewerben, sondern: hingehen, wo man ar-beiten möchte. Nichts wirbt so eindrucks-voll für einen Bewerber wie ein Gesprächvon Angesicht zu Angesicht. Personalchefsstellen eher jemanden ohne Zeugnis einals ohne Vorstellungsgespräch.
Kommunikation als Mitteilung von In-formationen bezieht sich nicht ausschließ-lich auf Interessen oder auf Gefühlsbezie-hungen. Sie schließt immer beides ein.Ver-haltenswissenschaftler reden deshalb voneinem „Sach-“ und einem „Beziehungs-aspekt“ der Kommunikation.
„Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ichtrete hiermit als Bundesminister der Fi-
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
nanzen zurück. Mit freundlichen Grüßen –Oskar Lafontaine“. Eine schlichte Sachin-formation – über den Rücktritt eines Man-nes von seinem Amt. Aber was hier knappund sachlich mitgeteilt wird – sachlichergeht es nicht –, ist nicht nur eine amtli-che und eine politische Sache; der Mittei-lende tut damit auch ein Bild von sichselbst kund und ebenso ein Bild von sei-nem Adressaten.
Insbesondere aber teilt sich uns als Le-sern oder Hörern das Bild einer Beziehungmit: zwischen Lafontaine und Schröder,dem Minister und dem Kanzler, zwischenParteifreunden, zwischen Rivalen; unddahinter erkennen wir die Beziehungen zuDritten: zum Parteivolk, zu den Wählern,den Ministern der europäischen Partner-länder et cetera.
So ist es mit jeder Kommunikation, seisie noch so banal. Sie teilt immer viel mehr
mit, als sie auf den ersten Blick enthält:über einen Sachverhalt und die darin sichäußernden Interessen; über die individu-elle Identität der Beteiligten („Was bin ichfür einer? Was bist du für einer?“) undüber kollektive Identitäten („Was sind wirzusammen?“, „Was sind wir zusammen mitanderen?“).
Jede Kommunikation, auch wenn siepure Sachlichkeit zu sein scheint, fügt demBeziehungsleben, wie es schon in der Weltist, etwas hinzu. Jede Kommunikation„dient“ dem Zusammenleben, sie hat eineFunktion oder einen Sinn für kollektiveIdentitäten – mögen die kommunizieren-den Menschen selbst auch gerade dies nichtim Sinn haben, sondern statt dessen eige-ne Zwecke oder eben nur „die Sache“.
Oft ist die Sache nicht mehr als ein Vor-wand für die Beziehung, wie in dem Satz„Gehen wir einen Kaffee trinken?“ Die
135

Werbeseite
Werbeseite

Das Jahrhundert der Elektronik und der Kommunikation: Mensch im Netz
Frage wird millionenfach gestellt. Wer siestellt, wer sie hört, wer sie beantwortet, je-der weiß, daß es nicht um Kaffee geht,nicht einmal ums Trinken. Aber niemandkäme auf die Idee, direkt anzusprechen,um was es geht. Die wichtigsten Dinge ei-ner jeden Kommunikation bleiben im Hin-tergrund, im Halbdunkel. Sie brauchen denSchutz des Nichtausgesprochenen.
Der Minister, der sich mit einem einzi-gen Satz aus der Politik zurückzieht,schafft um sich herum eine Aura des Ge-heimnisvollen. Die Öffentlichkeit ist ent-
Spie
gel des 2
0. Ja
hrh
undert
s
FO
TO
S:
DPA (
li.)
; K
. M
EH
NER
(re
.)
Mitteilungsmedien Gespräch, Telefontechnik*: „Gehen wir einen Kaffee trinken?“
täuscht: „Herr Minister, Sie sind uns eineErklärung schuldig!“ Aber er mag so viel– und so aufrichtig – erklären, argumen-tieren, offenlegen, wie er will: Jede Erhel-lung schafft sich ein neues, eigenes Dun-kelfeld. Führt er „fehlenden Mannschafts-geist an“, dann bleibt im dunkeln, werdafür verantwortlich ist. Nennt er Namen,dann fragt sich, wie es aus Sicht der ande-ren, wie es „wirklich“ war. Mit jeder Aus-kunft sehen wir, wie ein Bergsteiger, einStück weiter – auf den nächsten Berg, hin-ter dem wir (noch) nichts sehen. Wenn dieÖffentlichkeit, die nach mehr Mitteilungverlangt, eines Tages Ruhe gibt, dann nicht,weil „alle Fakten auf dem Tisch“ wären,sondern weil man des Kommunizierens indiesem Fall müde geworden ist und sicheinem anderen Fall zuwendet.
Wir hören auf, uns mitzuteilen und nachMitteilungen zu verlangen, nicht weil wirin einem Fall alles wissen, sondern weilwir genug wissen: genug, um in Gesell-schaft, wie gewohnt, weiterzuleben. Es istgenug kommuniziert, wenn ein Ereignisoder eine Einrichtung in den großen Fluß
des sozialen Lebens so eingeordnet ist, daßdie davon Betroffenen hinlänglich über-einstimmen. Anders gesagt: Kommunika-tion hat die Funktion, kollektive Interessenund Identitäten zu einem überlebensfähi-gen Ausgleich zu bringen. Woher wissenwir, wann das der Fall ist? Genau wissenwir es nie. Aber wir merken es daran, daßandere Themen uns wichtiger, störenderwerden als Lafontaines Rücktritt. Nichtssetzt dem Kommunizieren entschiedenereGrenzen als das Kommunizieren: über et-was anderes.
Wir können nicht zur gleichen Zeit allessagen und hören, genausowenig wie wirzugleich alles sehen, riechen, schmeckenund tasten können. Der Mensch kann zwar„mit zwei Zungen sprechen“, aber auchnicht zur gleichen Zeit. Über die Spracheund die fünf Sinne kann er zwar mehrere,auch widersprüchliche Informationen zu-gleich wahrnehmen und mitteilen.Als We-sen mit beschränkten sinnlichen Fähigkei-ten unterliegt er aber dem anthropologi-schen Grundtatbestand der begrenztenKommunikation – unentrinnbar.
Daß man die anthropologischen Gren-zen des Kommunizierens durch technischeMedien überspringen oder hinausschiebenkönne, ist eine Illusion. Jede Mehrleistungeines Mediums erkauft es durch einen Ver-zicht: Je mehr Menschen es zugleich er-reichen kann, wie das Fernsehen, destoweniger kann es sie individuell ansprechenund erwidern lassen. Je schneller es Nach-
* Links: Bundeskanzler Helmut Kohl und PräsidentBoris Jelzin im russischen Sawidowo 1997; rechts: Tele-kom-Schaltstelle in Berlin.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
richten übermitteln kann, wie das Telefon,desto weniger Zeit zu überlegen läßt es.
Für das Unfallopfer auf der Autobahn istdie Schnelligkeit des gehörten Hilferufsüberlebenswichtig. Einen aufgebrachtenLiebenden kann die Schnelligkeit, mit der er seine Wut durchs Telefon los wird,seine kostbarste Bindung kosten. Die Bör-se belohnt den Wettlauf im ersten Augen-blick und bestraft ihn im nächsten.Auch inder schnellebigsten Zeit kann Abwartenund Aussitzen mehr wert sein als dasSchnellsein.
Zu den anthropologischen und den tech-nologischen Grenzen des Kommunizierenskommen die soziologischen. Sie ergebensich aus dem Zusammenleben selbst. DasLeben in Gesellschaft ist nicht nur ein Sich-mitteilen, sondern auch ein Werten, einTeilen und ein Bestimmen. Diese Grund-prozesse, die in allen sozialen Beziehungenablaufen, setzen sich gegenseitig vorausund setzen sich Grenzen: Nichts würdesich mitteilen aus der Fülle des Mittei-lungsmöglichen ohne eine Vorauswahl undein Vorziehen des Mitteilungswerten.
Sich mitteilen setzt ferner voraus, daßMenschen etwas teilen oder gemeinschaft-lich haben, zumindest eine Sprache. Und esist, drittens, nur möglich, wenn es Macht-verhältnisse gibt, die bestimmen, nach wel-chen Regeln oder normativen Vorgabenkommuniziert wird. Werturteile, Zugehö-rigkeit und Macht bilden also Vorausset-zungen des Kommunizierens und setzenihm seine Grenzen.
Werden diese Grenzen nun durch dieInformationstechnologie selbst aufgelöst?„Der Computer dringt schmerzlos in je-
„Das Abhören ausländischer Sender ist ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit unseres Volkes. Es wird auf Befehl des Führers
mit schweren Zuchthausstrafen geahndet.“Aufsteckschild am Volksempfänger (ab 1939)
137

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Das Jahrhundert der Elektronik und der Kommunikation: Mensch im NetzSpie
gel des 2
0. Ja
hrh
undert
s
Satellitenantennen (in Stralsund): Kommun
de soziale Institution ein und beeinflußtjede menschliche Regung“, meint der US-Computerforscher Stephen Talbott.Mutieren wir unmerklich zu anderen We-sen, die ihre Wert-, Gemeinschafts- undAutoritätsbindungen einbüßen, somit aberauch von ihren Vorurteilen, kollektivenZwängen und Machtverhältnissen befreitwerden? Ängste und Hoffnungen, die sichan den neuen technischen Möglichkeitendes Mitteilens entzünden, liegen engbeieinander.
140
Oft hört man,die Fülle des Mög-lichen raube demMenschen die Fä-higkeit, zwischenWichtigem undUnwichtigem zuunterscheiden –die Vermutungmuß sich aufdrän-gen angesichts desZappers vor demFernseher, desSurfers im Inter-net, des überallanrufenden undangerufenen Han-dy-Besitzers.
Aber was auf den ersten Blick als wahl-loses Getriebenwerden in einer Flut undÜberflut von Reizen erscheint, erweist sich bei näherem Hinsehen oft als einspielerisch-lernendes Ausprobieren, dasschnell in gewohnte Bahnen zurück- oderin eine neue Wichtigkeitsordnung über-geführt wird. Gerade die scheinbare Un-endlichkeit des Internet macht dies au-genfällig: Sie verlangt danach, daß mandem Computer Präferenzen oder „Favo-riten“ oder Regeln nennt, nach denen er
ikatives Dröhnen
F. H
OLLAN
DER
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
P O R T R Ä T
Sh
dann Kommunikationsfelder oder -part-ner aussucht.
Gelegentlich führt das in neue Gefilde.Aber Neuland bleibt nicht Neuland. Undauch die flippigsten Computerkids steuerndie ihnen vertrauten Chatrooms und Hob-byzirkel an – und juchzen vor Genugtuung,wenn sich Bekanntes meldet: also das, wasihnen wichtig ist.
Eine Explosion von Angeboten, seien esWaren oder Mitteilungsmöglichkeiten,kann vorübergehend verwirren. Daß sieaber die Menschen ihrer Wertmaßstäbe be-raube und sie orientierungslos mache, isteine aberwitzige und durch nichts belegteBehauptung. Sie besagt nur, daß die Kriti-ker den „überkommunizierenden Men-schen“ abwerten, weil er anders wertet,nicht, daß er selbst zu werten aufhöre. ImGegenteil: Je mehr zu kommunizierentechnisch und sozial erlaubt ist, desto mehrmüssen wir auswählend auswerten, an wel-cher Wirklichkeit wir mitteilend teilhaben,an welcher nicht.
Haltlos ist auch die schaurige Annahme,der den Massenmedien und dem Compu-ter ausgesetzte Mensch verlerne, zwischenWirklichkeit und Fiktion, zwischen realerund virtueller Realität zu unterscheiden.Genaue Untersuchungen zeigen vielmehr,
William ShockleySilizium und Krach
Kein Forscher der Nachkriegszeit setz-te größere Umwälzungen in Gang alser, kaum einer galt als größeres Genie.Trotzdem ging er als Gescheiterter indie Geschichte der Technik ein.WilliamShockley hat den Transistor produk-tionsreif gemacht – mit einem Material,das heute als Inbegriff einer ganzenBranche gilt: Silizium.
Da er sich unter seinen Freunden undBekannten nur Absagen einhandelte,warb er 1955 eine Handvoll junger Wis-senschaftler an und zog mit ihnen ineinen schäbigen Schuppen mitten inden Aprikosenplantagen südöstlich vonSan Francisco. „Shockley Semiconduc-tor Laboratory“ sollte zur Keimzelledes Silicon Valley werden.
Heute, so bemerkte sein frühererMitarbeiter Gordon Moore, werdendort mehr Transistoren gebaut, alsRegentropfen in ganz Kalifornien fal-len. Einen Transistor herzustellen seibilliger, als einen Buchstaben aufPapier zu drucken. Damals aber er-ahnten nur wenige das Potential desSiliziums.
1956 erlebte Shockley seinen größtenTriumph: Er erhielt den Physik-Nobel-preis. Gemeinsam mit seinen KollegenWalter Brattain und John Bardeen hat-te er 1947 am Oszilloskop abgelesen, daßihr Transistor, ein kleines Scheibchenaus Germanium, alsVerstärker taugte.
Wenig später warer mit Brattain undBardeen verkracht.Streit und Rebellionerwarteten ihn auchnach seiner Rück-kehr von der Nobel-preisverleihung. Sei-ne Truppe war des ra-biaten Managementsüberdrüssig, mit demShockley seine Firmaführte. Mit krankhaf-tem Mißtrauen spionierte er hinter sei-nen Mitarbeitern her und schrie jedenWiderstand gegen seine Ideen nieder.
1957 reichten acht seiner besten Leu-te ihre Kündigung ein – es war einer derWendepunkte in der Entwicklung derHalbleiterindustrie. In seinem Tagebuchwidmete Shockley ihm nicht mehr alsdie Worte: „Gruppe gibt auf.“
Nobelpreisträger
Seine Ex-Mitarbeiter Moore undRobert Noyce gründeten später das in-zwischen mächtigste Imperium des Si-licon Valley: den Chip-Giganten Intel,der heute 26 Milliarden Dollar Jah-resumsatz macht. Shockley hingegen
kämpfte noch ei-nige Jahre mit ro-ten Zahlen. Dann,1963, verließ er fürimmer die Indu-strie, wurde Profes-sor für Maschinen-bau und machtefortan nur noch mitrassistischen Theo-rien auf sich auf-merksam.
Der Homo sa-piens, so forderteer, müsse intelli-
genter werden. Deshalb sollten sichMenschen mit einem IQ unter 100 ge-gen eine staatliche Prämie sterilisierenlassen. Auch er selbst, so bekannte erdem „Playboy“, habe einen Beitragzum Ziel einer besseren Menschheit ge-leistet: Er spendete von seinem Spermaeiner kalifornischen Samenbank. Shock-ley starb 1989, 79jährig, in Stanford.
ockley (1975)
AP

Werbeseite
Werbeseite

Das Jahrhundert der Elektronik und der Kommunikation: Mensch im NetzSpie
gel des 2
0. Ja
hrh
undert
s
ng in Telefonzentrale, Call-Center*: Netz ohne Gr
daß das Unterscheidungsver-mögen sich verfeinert. Schonsehr früh lernen Kinder vordem Fernseher wie von selbst(vorwiegend in Kommunika-tion mit anderen), Sinn undGlaubwürdigkeit von Infor-mationen zu unterscheiden,je nachdem ob sie gerade die„Tagesschau“, die „Hitpara-de“, „Pumuckl“ oder Wer-bung sehen.
Mögen auch Werber undJournalisten aus durchsichti-gen Gründen versuchen, dieGrenzen zwischen den Gen-res zu verwischen, etwa eineReality Show für die Realitätzu verkaufen, und mag ihnenauch manche Täuschung ge-lingen: Der Sinn der Men-schen für die verschiedenenSchichten und Ansichten derWirklichkeit schärft sich umso mehr, je mehr sie wissen,daß man sie manipulieren zukönnen glaubt: „Die Klugensterben nicht aus“, wußteschon Erich Kästner.
Was aber, wenn der Stromder Informationen, der unsauf allen Kanälen bedrängt,zu einem „Rauschen“ an-schwillt, in dem wir nichtsmehr verstehen können?Gegen das kommunikativeDröhnen helfen nur zweiDinge: Rückzug – der nichtimmer möglich ist – und, ironischerweise,noch mehr Kommunikation.
Die moderne Kommunikationstechno-logie läuft dort zu ihrer Höchstform auf,wo sie ihre Arbeit gleichsam unterirdischverrichtet, den Menschen vom Kommuni-zieren befreit und, wie ein ergebener undumsichtiger Diener, ihm das Ergebnis aufdem Silbertablett präsentiert. Wenn derFrühmorgenflug von Frankfurt nach Lon-don wegen Nebel zwei Stunden späterstartet, erhält der total vernetzte Passa-gier die Mitteilung nach Hause gleich so,daß sein Wecker zwei Stunden späterklingelt, Kaffeemaschine und Toaster sichspäter einschalten und das bestellte Taxiebenfalls später kommt – und das alles,ohne daß unser Passagier herumtelefonie-ren müßte.
Vermittlu
142
Vernetzte Kommunikation macht daspraktische Leben leichter. Das gilt nichtnur für die Geschäftswelt und den Jet-set,sondern auch für Alleinstehende, Be-hinderte und Schwache. Die Technikbringt ihnen die Beziehungen wiedernäher, die ihnen ansonsten ferner gerücktsind. Sie schafft den Menschen und seineBeziehungen nicht neu, sondern stellt ihnwieder her.
Freilich sehen sich die Menschen durchdie neuen Kommunikationsmedien in ihrenGemeinschafts- und Autoritätsbindungenbedroht. Und das seit 700 Jahren. Um 1300kritisierte Hugo von Trimberg, Schulmei-ster am Stift St. Gangolf bei Bamberg, dasneue Medium Buch: „Seit man Schulbü-
* Oben: in den USA 1900; unten: in Nürnberg.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
cher an die Hand genommenhat und am Gürtel zu tragenbegann, seitdem ist die Lehreder Schulmeister entwertet,ihre Anerkennung, ihre För-derung und ihre Ehre.“
Die Vorstellung, daß dasjeweils neueste Medium zwarden Horizont erweitere, aberauch die Menschen aus ihrenBindungen herausreiße undsie vereinzelt vor der Lein-wand, dem Fernseher, demComputer und mit dem Walk-man zurücklasse, ist nicht aus-zurotten.
Aber sie ist falsch. Die Mas-senmedien zerstören das Ge-meinschaftsleben nicht, son-dern werden von ihm inDienst gestellt und unterlie-gen dabei einer faszinierendenDialektik von Gemeinschafts-bildung und Individualisie-rung: Das Kino begann um dieJahrhundertwende als Kollek-tiverlebnis, insbesondere fürdie kleinen Leute.
Um das Radio und dasGrammophon, die in denzwanziger Jahren auf dembesten Platz in der Wohnungthronten, versammelte sichdie Familie wie einst um dieFeuerstelle. Und währendMusik- und Radiohören –über Schallplatte, Transistor,Autoradio, Walkman – zu ei-
ner individuellen Angelegenheit wurde,kam die Familie seit den fünfziger Jahrenvor dem Fernseher zusammen.
Das hat sich heute trotz Zweit- undDrittgeräten im Haushalt nicht grund-legend geändert. Wenn man nicht zusam-men fernsieht, dann redet man zusammenüber das Gesehene: 44 Prozent der Deut-schen sagten (1989), daß sie den Stoff für Gespräche in der Familie und mitFreunden am besten vom Fernsehen be-kommen, 39 Prozent vom Zeitunglesen.
Auch wenn die Massenmedien immergrößeren Raum einnehmen, ersetzen sienicht die persönliche Kommunikation, son-dern fordern sie heraus. Im kleinen Kreiswird das, was man im TV gesehen hat, aufGlaubwürdigkeit, Nutzen und Moral ge-prüft. Es wird empfohlen und verworfen. So
enzen?H
ULT
ON
GETTY /
TO
NY S
TO
NE
L I T E R A T U RRoland Burkart: „Kommunikationswissenschaft“. Böh-
lau Verlag, Wien 1998 (3. Auflage); 584 Seiten – Ein-führung in Begriffe und Felder der Kommunikation.
Patrice Flichy: „Tele. Geschichte der modernen Kom-munikation“. Campus Verlag, Frankfurt am Main1994; 302 Seiten – Technische und sozialgeschichtli-che Entwicklung der letzten 200 Jahre.
Uwe Jean Heuser: „Tausend Welten. Die Auflösungder Gesellschaft im digitalen Zeitalter“. Berlin Verlag,Berlin 1996; 232 Seiten – Die Medienrevolution undihre gesellschaftlichen Begleiterscheinungen.
Niklas Luhmann: „Was ist Kommunikation?“ in „So-ziologische Aufklärung“, Band 6.Westdeutscher Ver-lag, Opladen 1995 – Unkonventioneller Blick einesmodernen soziologischen Theoretikers.
Gerhard Maletzke: „Kommunikationswissenschaftim Überblick“.Westdeutscher Verlag, Opladen 1998;222 Seiten – Leicht verständlich geschriebene Ein-führung in die Grundlagen einer noch jungen Wis-senschaft.
Marshall McLuhan, Bruce R. Powers: „The GlobalVillage. Der Weg der Mediengesellschaft in das 21. Jahrhundert“. Verlag Jungfermann, Paderborn
1995; 288 Seiten – Nachgelassenes Fazit des Medien-theoretikers McLuhan, der schon in den sechzigerJahren die Vernetzung der Menschheit prophezeite.
Roger Mucchielli: „Kommunikation und Kommuni-kationsnetze“. Otto Müller Verlag, Salzburg 1974; 164Seiten – Praxisnah gefaßte Beschreibung der Proble-me und Anwendungsgebiete.
Joseph Weizenbaum: „Die Macht der Computer und dieOhnmacht der Vernunft“. Suhrkamp TaschenbuchVerlag, Frankfurt am Main 1979; 369 Seiten – Tech-nische und philosophische Überlegungen einesführenden Computerkritikers – bereits ein Klassiker.

Werbeseite
Werbeseite

werden gruppeneigene Werte und Ge-meinschaftsgefühle geschärft. Da dies invielen Kreisen zugleich geschieht, kommenauch Übereinstimmungen im größerenRahmen zustande.
Wenn das Gemeinschaftsleben gegenMassenmedien resistent ist, wird es dannauch dem Internet standhalten? Wie beijedem neuesten Medium gehen die Pro-phezeiungen zunächst in die andere Rich-tung: Die freie Zugänglichkeit des Me-diums für alle scheint alle Gruppengrenzenund -zwänge aufzuheben. Auch dies er-weist sich als Irrtum. Im weltweiten Netzkommuniziert keinesfalls jeder mit jedem.Teilnehmen kann nur, wer Englisch wenig-stens als Zweitsprache spricht – unter achtProzent der Weltbevölkerung – und überdie moderne Maschinerie verfügt.
Wo sich Diskussionsgruppen und Plau-derecken bilden, geschieht dies zwischenLeuten, die vorgängige Berufsinteressen,Wünsche oder Hobbys teilen. Diese raum-übergreifenden Spezialkulturen grenzensich immer mehr voneinander ab.
In dem Maße, in dem sie sich als neueBeziehungsnetze etablieren, verhalten siesich, wie der Frankfurter Soziologe Chri-stian Stegbauer gezeigt hat, genauso wieandere Gruppen auch: Es bilden sich Rol-lenmuster aus, einige wenige führen dasWort, Altbekannte kommunizieren vor-wiegend untereinander, Neuankömmlin-ge haben es schwer, kurzum: Was in derGrenzenlosigkeit des Netzes entsteht,schafft sich die Grenzen der Zugehörig-keit, die uns nur allzu vertraut sind. Kei-ne Spur von einem neuen oder anderenMenschen, von neuartigen oder gar zer-störten Sozialbeziehungen.
Allerdings hat das Internet als technolo-gisches Novum eine soziologische Eigen-schaft, die in ihrer Neuartigkeit sensationellist: Es gehört niemandem. Es kennt keinenHerrn und keine Knechte. Machtverhält-nisse, die unser soziales Leben allüberalldurchziehen, scheinen in ihm erstmaligaußer Kraft gesetzt. Eine Chance, die Kul-turen von gleich zu gleich zu einen?
Bisher war die Entwicklung der techni-schen Mittel der Kommunikation eine Ge-schichte der Konzentration und der Auflö-sung von Macht. Der europäische Staat des19. Jahrhunderts hatte den Telegrafen fürseine Zwecke in Gebrauch genommen. Erübernahm auch das Post- und Telefon-Mo-nopol. Die Diktaturen des 20. Jahrhundertserreichten die Massen über den Rundfunk,später über das Fernsehen. Per Radio dran-gen ihre Demagogen in alle Wohnstubenein.Was wäre Goebbels gewesen ohne denVolksempfänger? Aus jenen Tagen stammtGeorge Orwells Bild des Großen Bruders,der alles gesellschaftliche Leben unter me-dialer Kontrolle hat.
Die Negativ-Utopie war jahrzehntelangprägend für unsere Vorstellung von derFunktion der Medien. Aber kaum war derZeitpunkt vorüber, zu dem die grausige
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9

Das Jahrhundert der Elektronik und der Kommunikation: Mensch im Netz
Spie
gel des 2
0. Ja
hrh
undert
s
M.
DAR
CH
ING
ER
Direktkontakt-Ort Börse (in New York): „Ich will dich sehen“
J. H
. D
AR
CH
ING
ER
Prophezeiung sich – literarisch – erfüllensollte, „1984“, da schlugen die Dinge um.Über Nacht tauchte ein neues Symbol auf– diesmal für die Ohnmacht der totalitärenSysteme: „Tschernobyl“.
Die Reaktorkatastrophe von 1986 zeig-te schlagartig, daß die Großmacht Sowjet-union die Kontrolle nicht nur des Atoms,sondern auch der Information verlorenhatte. Vor Satelliten, Beobachtungsflug-zeugen, superstarken Teleobjektiven undRichtmikrofonen versagen die Versuchepolitischer Geheimhaltung. Steht 1984 nochfür totale Kontrolle, so 1986 für Freiheitdurch Kommunikation. Es markiert dieWende von national-imperialer zu plane-tarer Kommunikation.
Die Freiheit? Wie gewonnen, so zerron-nen. Schon droht, im globalen Rahmen,eine neue und noch gewaltigere Machtdurch Medien. Sie kommt nicht mehrplump daher, als Staatsfernsehen oderStaatskommissar. Die neue Herrschaftbedient sich der Herrschaftsfreiheit: deralten Anarchie des Marktes und der neuenAnarchie im Internet. Es ist die Macht desKapitals, die im World Wide Web ebensozum Ausdruck kommt wie in den weltwei-ten Sendungen von CNN.
Wird es dieser Macht gelingen, ihre Bot-schaften vom richtigen Leben in aller Weltzu verbreiten? Führt die Dominanz derMedien zur Dominanz der westlichen Kul-tur? Rufen Medienereignisse, die sich Mil-liarden Menschen zugleich mitteilen – dieKriege auf dem Balkan und die brennen-den Urwälder Indonesiens, die Olympi-
schen Spiele und die Trauer um PrinzessinDiana – auch einen Gleichklang der See-len, ein Weltgewissen hervor, das die kul-turellen Grenzen und Vorurteile sprengt?
Das Gegenteil ist wahrscheinlicher. Inden Ermittlungen gegen Präsident Clintonwurden die Repräsentanten und Institu-tionen der amerikanischen politischen Kul-tur – und nicht nur der politischen Kultur– der Welt nahegebracht wie nie zuvor.
Wie reagierte die Welt? Die Franzosenschüttelten den Kopf über die Armselig-keit einer (Un-)Kultur, die ihrem mächtig-sten Mann nicht einmal eine Liebesaffäre,geschweige denn eine Mätresse erlaubt;von Deutschland aus beklagte man eineunverständliche Demontage des höchstenStaatsamtes; Araber sahen eine jüdischeVerschwörung; der Vater von Monica Le-winsky fühlte sich als Jude verfolgt.
Ein und dasselbe Medienwissen wirdvon den Empfängern durch ihr unter-schiedliches Vorurteilswissen ergänzt undinterpretiert und führt zu völlig gegen-sätzlichen Bildern der Wirklichkeit! Diegewachsenen Kulturen, ob als familiale, re-ligiöse oder nationale Kommunikations-kreise, verfügen über ein Immunsystem,das sie gegen Informationen von außenschützt. Was global eindringt, wird lokalgefiltert, gedeutet und verortet.
Die Macht der weltweiten Medien brichtsich an der Macht der Kulturen. Ja, dieseerweisen sich als mächtiger: In dem Kul-turkampf, der um jede Nachricht ent-brennt, sitzen die lokalen Kulturen mitihrer alltäglichen Prägekraft am längeren
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Hebel. Grenzüberschreitende Kommuni-kation dient ihnen dazu, sich abzugrenzenund aufzuwerten: „Wie gut, daß wir nichtsind wie jene dort.“ Daß die globalen Me-dien die Macht hätten, nach ihrem Bild einBild der Welt zu formen, ist ein Ammen-märchen unserer Zeit.
Gleichwohl wird im Kommunizierenauch Gemeinsames zutage gefördert. Esteilt sich beides mit: Verbindendes undUnterschiedliches. In einer „gelungenen“Kommunikation, in der das gegenseitigeVerstehen vorankommt, wächst auch dasVerständnis der Unterschiede – und damitdie Reibungsfläche für Konflikte.
Soziale Konflikte und Gewalt sind keinStörfall der Kommunikation. (Sie könnenes gelegentlich sein.) Vielmehr nähren siesich aus der Annäherung und dem Verste-hen. Das ist zwischen Ehepaaren nicht an-ders als zwischen Kulturen. In der Regelkann der Sprengstoff des Verstehens durchgemeinsame Interessen und Gefühle zwi-schen den Beteiligten entschärft werden.
Manchmal hilft auch „Meta-Kommuni-kation“: ein Mitteilen über das Mitteilen,wodurch Einverständnis über Differenzenerzielt werden kann. Viel größere Hoff-nungen aber müssen wir auf das Nichtmit-teilen und das Nichtmitteilbare setzen. DasGeheimnis friedlichen Zusammenlebensliegt oft im Nichtwissen der Differenzen, jaim Mißverstehen: in der Annahme einerÜbereinstimmung dort, wo sie gar nichtvorhanden ist.
Der Trierer Soziologe Alois Hahn hatgezeigt, daß Paare ihre Beziehungen aufsolche „Konsensfiktionen“ aufbauen.War-um sollten nicht auch zwischen denKulturen Grenzen der Kommunikationhilfreich sein – auf die Gefahr hin, daßMißverständnisse bleiben.
„Die Welt“, sagte der französische Dich-ter Charles Baudelaire, „funktioniert nurdurch das Mißverständnis. Eben durch die-ses universale Mißverständnis bringt sichjeder mit dem anderen in Übereinstim-mung; denn wenn man sich durch einenunglücklichen Zufall einmal verstünde,käme man nie zu einer Meinung.“
DIE THEMENBLÖCKE IN DER ÜBERSICHT: I. DAS JAHRHUNDERT DER IMPERIEN; II. … DER ENTDECKUNGEN; III. … DER KRIEGE; IV. … DER BEFREIUNG; V. … DER MEDIZIN; VI. DAS JAHRHUNDERT DER ELEKTRONIKUND DER KOMMUNIKATION; VII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 50 JAHRE BUNDESREPUBLIK; VIII. … DES SOZIALEN WANDELS; IX. … DES KAPITALISMUS; X. … DES KOMMUNISMUS; XI. … DES FASCHISMUS; XII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 40 JAHRE DDR; XIII. … DER MASSENKULTUR
Der AutorKarl Otto Hondrich,61, ist Professor fürSoziologie an derUniversität Frank-furt am Main. Einerseiner Arbeitsschwer-punkte sind die so-zialen Konflikte.
145

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Angola
DemokratischeRep. Kongo
Guinea-Bissau
UgandaSomaliaDschibuti
AfghanistanBurma
Sri Lanka
Kambodscha
GeorgienTürkei
Jugoslawien
in Millionen
1110
ehr alsegt wurden
eniger alsegt wurden
Libanon
*Länder haben mit der Vernichtung der Bestände begonnen
Quelle:US-State-Department:Hidden Killers, 1998
4 bis 53221
Eritrea
7
Große Bestände in unbekannter Höhe lagern u. a.auch in Iran, Irak, Belorußland und Jugoslawien
eit 1998urden
Indien
Schweden*
Albanien
Südkorea
Japan*
Tadschikistan
bis 70
110
Panorama Ausland
Pa
Prinzessin Diana mit Minenopfern in Angola (1997)
REU
TER
S
Kolumbien
Minenvorräte in Depots
China
Rußland
USA
Ukraine*
Länder, in denen m1 Million Minen gel
Länder, in denen w1 Million Minen gel
Italien*
Länder, in denen sMinen neu gelegt w
60
M I N E N
HeimtückischeKiller
Erste positive Ergebnisse zeigt die in-ternationale Kampagne zur Ächtung
von Landminen, ohne jedoch die Gefahrder heimtückischen Sprengkörper bereitswirkungsvoll beschränkt zu haben. Imvergangenen Jahr wurden weltweit erst-mals mehr Landminen entschärft als ver-legt. Dennoch verstümmeln oder zerfet-zen Minen noch immer jeden Monat min-destens 2000 Menschen und machenganze Landstriche unbetretbar, die in denärmsten Ländern vor allem Asiens undAfrikas für die Agrarwirtschaft dringendbenötigt werden. Das geht aus einemBericht hervor, den die 1997 mit demFriedensnobelpreis ausgezeichnete „In-ternationale Kampagne zur Ächtung vonLandminen“ auf dem ersten Treffen derVertragsstaaten diese Woche in der mo-sambikanischen Hauptstadt Maputo vorlegt. Die am 1. März inKraft getretene Konvention verpflichtet inzwischen 135 Staa-ten, ihre Minenvorräte binnen vier Jahren zu vernichten.Wei-terer Erfolg: Nur 16 von einst 54 Staaten stellen noch Anti-Per-sonenminen her. „Die Tage, da ein Land wie Italien binnenweniger Jahre Millionen von Minen in den Irak verschiffte,scheinen endgültig vorbei“, heißt es in dem Bericht. In den Ar-senalen der Staaten, die sich der Konvention bislang nichtangeschlossen haben, lagern allerdings noch Minen in einerMenge, die von der Kommission als „dramatisch unterschätzt“bezeichnet wird. Zu diesen Ländern zählen auch drei der fünfständigen Mitglieder des Uno-Sicherheitsrats: China, Rußlandund die USA.Trotz ihrer Unterschrift haben aber auch Länderwie Angola, Guinea-Bissau und Senegal in Bürgerkriegen wei-tere Landstriche vermint. Und auch im Kosovo sichern UÇK-Rebellen wie serbische Regierungstruppen ihr Terrain derzeitneu mit Tausenden von „versteckten Killern“.
pst Johannes Paul II. in Polen (1997)
AFP /
DPA
VA T I K A N
Gesponserter PapstDie zwölftägige Mammut-Pilgerfahrt
von Papst Johannes Paul II. durchPolen, die am 5. Juni in Danzig begin-nen soll, kann nur mit Hilfe privaterSponsoren finanziert werden. Die Ko-sten des vermutlich letzten Besuchs desPapstes in seiner Heimat, von Expertenauf rund 50 Millionen Mark geschätzt,sollen zu 20 Prozent von Unternehmengetragen werden. Die in Europa unübli-che Finanzierungsaktion hat der Vati-kan bereits erfolgreich in Mexiko undLändern der Dritten Welt erprobt. Bis-lang erhielten knapp 20 Firmen und
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Konzerne den begehrten Titel eines „of-fiziellen Sponsors der Pilgerfahrt“, dar-unter die polnische FluggesellschaftLOT, die BPH-Bank, die AutokonzerneDaewoo und Fiat sowie die PolnischePost. Als Gegenleistung dürfen sie mitdem offiziellen Logo der Pilgerfahrt fürihre Produkte oder mit den Firmen-signets auf Bulletins, im Pressezentrumund an Begleitfahrzeugen werben. „Daswird das größte Medienereignis des Jah-res“, sagt ein Spender, „da zahlt sich je-der Groschen zurück.“ Unmut über„unnötige Gigantomanie“ wehrtBischof Tadeusz Pieronek ab: „Wir wol-len einen teuren Gast mit ganzem Her-zen empfangen, da zählt man nicht dasGeld.“ Hauptsache, die Kasse stimmt.
149

15
Bonino in Afghanistan (1997)
PARTIT
O R
AD
ICALE
Panorama
I T A L I E N
Emma for PresidentVom Himmel hoch schwebte die italienische EU-Kommissa-
rin Emma Bonino, in Brüssel zuständig für Fischerei, Ver-braucherpolitik und humanitäre Hilfe, 1995 in den europäisch-kanadischen Fischereistreit im Nordatlantik: am Seil aus demfliegenden Hubschrauber.Wie die Leibhaftige erschien sie 1997den Mullahs in Afghanistan, attackierte das Steinzeitregimeund landete, für ein paar Stunden, im Knast von Kabul. In War-schau ließ sie sich für die Gewerkschaft Solidarnosƒ verhaften,in New York für das Junkie-Recht auf Einwegspritzen. Jetztversucht die scheidende Kommissarin, 51, mit einer beispiello-sen Kampagne als erste Frau Staatspräsidentin in Italien zuwerden. „Einer wie üblich oder eine wie Emma?“ heißt es aufBroschüren und Plakaten, mit denen Italien seit Wochen über-
d e r s p i e g e0
De Gaulle, Le Pen
flutet wird. Die Antwort steht tausendfach auf T-Shirts: „Emma– endlich der richtige Mann“. Am 13. Mai beginnt in Rom dieWahl des zehnten Nachkriegspräsidenten. Und Emma, so dieMeinungsumfragen, ist die Lieblingskandidatin des Volkes. Über-all im Land haben sich „Emma for President“-Komitees ge-gründet. Film- und Modemacher, Intellektuelle und Frauen-gruppen machen Stimmung für sie. Dumm nur, daß nicht dasVolk den Präsidenten kürt, sondern eine Versammlung aus 1010Wahlmännern: Abgeordnete, Senatoren,Vertreter der Regionen.Bei denen ist Emma nicht gerade Favoritin – den Linken ist siezu spontan, den Rechten zu antikatholisch und allen gemein-sam politisch zu leichtgewichtig. Die Wetten stehen eher auf Se-natspräsident Nicola Mancino, Finanzminister Carlo AzeglioCiampi oder auch Reformminister Giuliano Amato. BoninosAnhänger hoffen, von deren Konkurrenz profitieren zu können:Amtsinhaber Oscar Luigi Scalfaro, 80, brauchte bei der letztenPräsidentenwahl 16 Wahlgänge. Wenn die mächtigen Männereinander erneut blockieren, wäre der Weg vielleicht doch frei.
F R A N K R E I C H
Ende des GaullismusStolz präsentierte Jean-Marie Le Pen
den großen Mann mit der charakte-ristischen langen Nase wie ein Jäger sei-ne edelste Trophäe: Charles de Gaulle,50, der Enkel des legendären Generals,hat sich dem ultrarechten Front national(FN) angedient; er wird hinter Le Penals Nummer zwei auf der FN-Liste am13. Juni für das Europaparlament kandi-dieren. Was der leibliche Enkel überden politischen Enkel des überdimen-sionalen Grand-père – den neogaullisti-schen Staatspräsidenten Jacques Chirac– sagte, erregte Betroffenheit: „Chiracbetreibt das Gegenteil der Politik desGenerals de Gaulle – Unterwerfungstatt Souveränität Frankreichs“, deshalbsei er „kein Gaullist mehr“. So denkeninzwischen große Teile der urgaullisti-schen Basis. Weil er sich mit Chiracs Po-litik der „Unterwerfung“ unter dieUSA im Kosovo-Krieg sowie den „fö-deralistischen“ Tendenzen in Europanicht mehr abfinden mag, trat der Präsi-
dent der Gaullistenpartei RPR, PhilippeSéguin, Mitte April unter Protestzurück. Auch Ex-Innenminister CharlesPasqua sagte sich vom Staatschef los: Erwird gemeinsam mit dem Nationalkon-servativen Philippe de Villiers eine eige-ne Liste für Straßburg anführen.Sechs Wochen vor den Europawahlenist Frankreichs Rechte ein Trümmerhau-fen. Denn auch die ZentristenparteiUDF des ehemaligen Erziehungsmini-sters François Bayrou hat Chirac eine
l 1 8 / 1 9 9 9
Abfuhr erteilt. Der Staatschefwollte eine konservative Ein-heitsliste in die Wahlenschicken und diesen Verbundals Kern einer großen Präsidi-alpartei nutzen – Basis für sei-ne Wiederwahl im Jahr 2002.Europa-Föderalist Bayroumöchte jedoch mit dem einsti-gen Koalitionspartner RPRnichts mehr zu tun haben. Be-gründung vor Vertrauten: „Wirketten uns doch nicht an eineRuine.“ Tatsächlich hat der de-solate Zustand der Gaullisten-bewegung – sie dümpelt um
die 15 Prozent, etwa soviel wie dieRechtsradikalen und 10 Prozent weni-ger als die Sozialisten des Premiers Lio-nel Jospin – eine Grundsatzdebatteausgelöst: Erlischt der Gaullismus mitdiesem Jahrhundert? Das Magazin„L’Evénement“ reiht die Erben des Ge-nerals bereits unter die „bedrohtenArten“. Und der RPR-AbgeordneteLionnel Luca bietet verstörten Partei-freunden eine neue Bleibe – den „Clubder verschwundenen Gaullisten“.
REU
TER
S

Ausland
Britische Neonazi-Propaganda
D.
HO
FFM
AN
N P
HO
TO
LIB
RARY
G R O S S B R I T A N N I E N
Aufmarsch der NeonazisNach rassistisch motivierten Spreng-
stoffanschlägen in London wächstdie Furcht vor rechtsradikalen Überra-schungserfolgen bei der Europawahl imJuni. Finanziert durch Skinhead-Rock-bands, führen die Nationalisten der Bri-tish National Party Wahlkampf wie niezuvor. Die Aktivisten der weitaus stärk-sten Rechtsradikalenorganisation habenihre Hochburgen in den Innenstädtenverlassen und werben jetzt um Stimmenin den Vororten und auf dem Land.Neue Zielgruppen sind Farmer, die un-ter dem Preisverfall für ihre Produkteund der anhaltenden Exportsperre fürRindfleisch leiden, sowie Angehörigedes Mittelstands, deren Angst vor Kri-minalität und vor Zuwanderern sich dieRechten zunutze machen wollen. DieExtremisten hoffen vor allem, denKonservativen Stimmen abjagen zukönnen. Die Tories erschöpfen sichderzeit in innerparteilichen Graben-
Rettungsaktion am Jangtse (im August 1998)
YAN
JU
N /
CH
INA F
EATU
RES
/ S
YG
MA
kämpfen und verzeichnen in Meinungs-umfragen neue Tiefstwerte. Besondersermutigt werden die Nationalistendurch den Wahlmodus: Erstmals wirdbei den Europawahlen in ganz Groß-britannien nach dem Verhältnis-wahlrecht abgestimmt, was kleinereParteien begünstigt.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
PAN
DIS
Schanghai
Jangtsekiang
C H I N AC H I N A
1000 km
I N D O N E S I E N
„Wie ein alterjavanischer König“
Amien Rais, 54, Führer der oppositio-nellen National Mandate Partei, gilt inUmfragen als aussichtsreicher Kandidatfür das Amt des neuen Präsidenten– falls es wie geplant am 7. Juni zu denersten freien Wahlen seit 1955 kommt.
SPIEGEL: Mehr als tausend Menschenstarben in den letzten Monaten bei eth-nischen und religiösen Unruhen in In-donesien, Terroranschläge gefährden dieWahl. Wer ist dafür verantwortlich?Rais: Indonesien ist eine pluralistischeGesellschaft, in der die Religions-gemeinschaften eigentlich keine größe-ren Probleme miteinander haben. DieUnruhen sind von Leuten und Gruppenin der Gesellschaft ausgelöst, die durchdemokratischen Wandel und freie Wah-len nur verlieren können. Denn diekünftige Regierung wird Korruptionund Nepotismus bekämpfen. Das möch-ten diese Kräfte vereiteln.SPIEGEL: Sie verdächtigen vor allem denehemaligen Präsidenten Suharto, Draht-zieher des Aufruhrs zu sein?Rais: Ganz eindeutig. Suharto ist einkaltblütiger, scheinheiliger Mann. Ihmmacht es nichts aus, wenn MillionenLandsleute abgeschlachtet würden. Erwill wie ein alter java-nischer König nicht al-lein an seiner Un-fähigkeit zugrunde ge-hen, sondern dasganze Land mit in denAbgrund reißen.SPIEGEL: Findet Suhar-to noch Unterstützungin der Armee?Rais: Das steht fürmich leider außerZweifel. ZumindestTeile der Sicherheits-kräfte haben kein Interesse daran, dieUnruhen zu unterbinden.SPIEGEL: Wie wollen Sie im Fall einesWahlsiegs das Chaos beenden?Rais: Sehr schnell die Armeespitze unddie Führung der Polizei auswechselnund die neuen Befehlshaber dazu ver-pflichten, die Provokateure schleunigstzu verhaften.SPIEGEL: Was soll dann mit Suharto undseiner Familie geschehen?Rais: Er muß vor Gericht gestellt wer-den. Erweist er sich als schuldig, kommter ins Gefängnis. Wenn er aber die Mil-liarden Dollar zurückgibt, die er demVolk gestohlen hat, kann man vielleichtüber eine Amnestie reden.
Rais
C H I N A
Angst vor der FlutAm Jangtse-Fluß wächst die Gefahr
einer neuen Überschwemmungs-katastrophe. Als der mächtige Stromvergangenes Jahr über die Ufer trat,starben etwa 4000 Menschen, 5,6 Millio-nen Häuser versanken in den braunenFluten, 14 Millionen Menschen wurdenobdachlos. In diesem Jahr liegt dieWahrscheinlichkeit einer neuen undwomöglich noch dramatischeren Kata-strophe am oberen und mittlerenFlußlauf bei 73 Prozent, warnen Exper-ten aus acht Provinzen. Eine schwere
Dürre hat den Boden so ausgetrocknet,daß er Regen nicht mehr aufnimmt.Gleichzeitig rechnen Meteorologen inder zweiten Jahreshälfte erneut mitschweren Niederschlägen und Taifunen.Viele gebrochene Dämme und beschä-digte Schleusen sind bis dahin nochnicht wieder repariert. Nie Fangrong,Chefingenieur der Wasserbauabteilungin der Provinz Hunan, fürchtet, daß„die Zeit zu knapp“ ist. Die Regierungin Peking hat inzwischen eingestanden,daß die letzten Überflutungen nichtallein an den Widrigkeiten der Naturlagen. Mit schuld sei vielmehr dasverantwortungslose Abholzen der Wäl-der am Oberlauf des Jangtse.
151

152
UnterhändleRobustes M
Ausland
B A L K A N
Ein zertrümmertes LandTrotz der Verwüstung Jugoslawiens durch die verstärkten Nato-Bombardements
zögert die Regierung in Belgrad, die russische Vermittlungsaktion mit klaren Konzessionen zu beflügeln. Wird das Kosovo ein Protektorat der Uno?
Die einsame Stimme zweifelnderSelbsterkenntnis war nicht lange zuvernehmen. „Wir können die Nato
nicht besiegen“, hatte in der Nacht zumMontag voriger Woche Jugoslawiens Vize-premier Vuk Dra∆koviƒ in aufsehen-erregenden Interviews die Führung seinesLandes dazu aufgerufen, „das Volk nichtlänger zu belügen“. Denn wenn die Bom-benangriffe mit gleicher Intensität noch 20 Tage weitergingen, stelle sich die Frage,„was von Serbien übrigbleibt“.
Ein zerstörtes, ein zertrümmertes Landwäre wohl die bittere Antwort. Doch solchdefätistische Wahrheiten durfte BelgradsKassandra nicht länger öffentlich verbrei-ten. Der Außenseiter Dra∆koviƒ wurde po-litisch flugs ausgeschaltet, und das Regimevon Slobodan Milo∆eviƒ igelte sich weiterein in seinen atombombensicheren Bun-kern aus der Tito-Zeit.
Qualmwolken aus der brennenden Chemiefabrik Pan‡evo bei Belgrad: „Schritt für Schritt
r Milo∆eviƒ, Tschernomyrdin andat verlangt
AP
Zwar gewann das Karussell der diplo-matischen Vermittlungsversuche letzte Wo-che mit Pilgerzügen westlicher Politikernach Moskau und einer Shuttle-Missiondes russischen Balkan-Maklers WiktorTschernomyrdin erstmals an Schwung.Doch unbeirrt setzte die Luftarmada des
mächtigsten Militärbündnisses der Weltihre Einsätze fort gegen Jugoslawien, umein Einlenken im Kosovo-Konflikt zu er-zwingen.
Was also bleibt übrig von der größtensüdslawischen Nation nach weiteren 20Nächten im Bombenhagel? Ein Leben imArmenhaus, das Vegetieren in einem Land,das ins vorindustrielle Zeitalter zurückbe-fördert wird, gleichsam reduziert auf denStatus eines Agrarstaats. Ein Land, das mitnoch viel mehr Pockennarben übersät seinwird als jenen Kratern, die in der Nachtzum Mittwoch Nato-Bomben in das Weich-bild des südserbischen Surdulica rissen:300 Meter von einer leerstehenden Kaser-ne entfernt, wurden 50 Häuser verwüstetund 20 Menschen in Stücke gerissen. Dar-unter 5 Kinder in einem Luftschutzkeller
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
und die Familie von Vojislav Miliƒ, 31 Jah-re lang Gastarbeiter bei den Ford-Werkenin Köln. Und vergangenen Freitag kostetendie Luftangriffe mindestens elf Menschendas Leben; weitere 63 Zivilisten, so mel-dete Belgrad, seien zum Teil lebensgefähr-lich verletzt worden.
„Nato deeply regrets“, lautet die Stan-dard-Entschuldigung für solche „Kollate-ralschäden“, wie die Militärs beschönigendTreffer auf unbeteiligte Zivilisten, aufKrankenhäuser und Wohnblocks nennen.Nur „ein Bruchteil“ der Angriffe führe zuderlei unbeabsichtigten Folgen, versicher-te Großbritanniens VerteidigungsministerGeorge Robertson. Richtig ist indes auch,daß sich die unerwünschten „Begleitschä-den“ der High-Tech-Präzisionswaffen nun-mehr häufen, eine fehlgeleitete „Harm“-

besc
Rakete sogar in einem Vorort der bulgari-schen Hauptstadt Sofia einschlug.
Der bislang schwerste Fall von „Kolla-teralschäden“ war am 14. April im Kosovodas versehentliche Bombardement einesFlüchtlingskonvois bei Djakovica. Nachserbischen Angaben starben dabei 75 Ko-sovo-Albaner. Nur zwei Tage zuvor hattenUS-Kampfflugzeuge, die einen Großteil al-ler Angriffe gegen Jugoslawien fliegen, eineEisenbahnbrücke bei Leskovac attackiert –und einen internationalen Schnellzug ge-troffen. Es gab wenigstens 14 Tote.
hneiden wir Milo∆eviƒs Fähigkeiten“
Zerstörtes Wohnhaus in Belgrad: „Was bleibt von Serbien übrig?“
FO
TO
S:
REU
TER
S
Zwanzig engbedruckte Seiten lang istmittlerweile ein Schadenskatalog, den ser-bische Beobachter führen. Tag für Tag, seitdie Nato ihre Zielliste von der jugoslawi-schen Luftverteidigung auf andere Objek-te ausdehnte, registriert der serbischeRundfunk die Zerstörung von zivilen Ob-jekten. Selbst wenn sich darunter noch dieeine oder andere Propagandalüge ver-stecken mag, bleibt gleichwohl viel übrig,um den Vorwurf des SPD-Bundestags-abgeordneten Hermann Scheer zu stützen,die Nato-Bombardements hätten ein„kriegsverbrecherisches Ausmaß“ ange-nommen.
Das Bündnis in Brüssel begegnet sol-chen Vorhaltungen mit dem – unbestreit-baren – Hinweis auf die schweren Men-schenrechtsverletzungen, die Belgrads
Schergen im Kosovo an HunderttausendenAlbanern begehen. Doch begangenes Un-recht kann wohl schwerlich Rechtfertigungfür neues Unrecht sein.
Die Strategen in der Brüsseler Zentraleund den Hauptstädten der Allianz wissen,daß die öffentliche Zustimmung zum er-sten Angriffskrieg der Nato in dem Maßeschwindet, wie die Schäden an der serbi-schen Zivilgesellschaft wachsen. Und diesind schon jetzt gewaltig.
Gegenüber der Uno nannte Belgrad ver-gangene Woche rund „tausend tote Zivili-
sten, unter ihnen sehr vieleKinder“, sowie einige tausendVerletzte seit Beginn derLuftangriffe am 24. März.Nicht ganz so einfach ist dieGesamtlast des Krieges zu be-ziffern.
Eine Geheimdienststudieerlaubt es, die Folgen für dieserbische Gesellschaft seitdem Zerfall Jugoslawiensgrob zu schätzen. Acht JahreSanktionspolitik gegen denDespoten Milo∆eviƒ warfendanach das Land, das Anfangdieses Jahrzehnts noch als ei-nes der zukunftsträchtigstenunter den heranwachsendenIndustrienationen galt, aufden Stand von 1968 zurück.Bis zum Jahr 2015, so die Pro-gnose, werde es dauern, ehe
Belgrad wieder auf dem Niveau von 1990angelangt sei – das war die Rechnung vordem Luftkrieg.
Nach über einem Monat Nato-Bombar-dement und mehr als 4400 Einsätzen bei474 Angriffen gegen insgesamt 227 Zielesteht Serbien wieder dort, wo Tito einstbegann – im Jahr 1945. Die Industrie in
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Trümmern, die Infrastruktur zerschlagen,die Bevölkerung schon jetzt zu großen Tei-len ohne Lohn und bald vermutlich auchohne Brot: Die Aussichten für das Reichdes Slobodan Milo∆eviƒ sind erschreckend.
Erste serbische Schätzungen bezifferndie Kriegskosten bereits auf fast 200 Mil-liarden Mark. Aber die Schlußrechnungdürfte noch weitaus höher ausfallen.100000 Arbeitsplätze sollen bislang durchdie Luftangriffe vernichtet worden sein,und das vielfach in Regionen, die schondavor eine faktische Arbeitslosenrate vonrund 50 Prozent verzeichneten.
Die drei industriellen SchlüsselsektorenSerbiens wurden schwer getroffen: Die Pe-trochemie, einträglichster Industriezweigdes Landes, ist mit unabsehbaren ökologi-schen Folgeschäden praktisch ausgelöscht,das Prestigewerk Petrohemija vor den To-ren Belgrads dem Erdboden gleichgemacht(siehe Seite 224). Vernichtet sind ebenfallsdie beiden Düngemittelwerke in Novi Sadund bei Pan‡evo.
Dort standen auch die größten Raffine-rien des Landes, die nun in Trümmern lie-gen. Der Schwarzmarktpreis für einen Li-ter Benzin kletterte auf vier Mark.
Die Energiewirtschaft ist der zweite zen-trale Wirtschaftssektor, der durch die Nato-Bomben empfindlich litt. Dabei wurdenKraftwerke und Verteilerstationen noch garnicht massiv angegriffen.
Im Schlüsselsektor metallverarbeitendeIndustrie wurden die Anlagen der Zastava-
Gruppe, vor allem in Kragujevac, weitge-hend zerstört. 120 Zulieferfirmen hängenan diesem Automobilkonzern.
Zudem wurden fast 40 Industriebetriebebombardiert. 20 Straßen- und Eisenbahn-brücken stürzten unter Treffern ein, dar-unter fast alle Brücken über die Donau,die den Norden des Landes in der Provinz
153

d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9154
Ausland
Serben-Flugzeug „Super Galeb“Triebwerke von Rolls-Royce
J. P
IKE
Vojvodina vom Hauptteil Serbiens tren-nen. Die Verbindungen ins Kosovo wurdennahezu vollständig unterbrochen, die Fern-sehanstalten schwer getroffen.
Angesichts dieses Feldzugs der Verwü-stung ist für den britischen „Guardian“ dieNato-Behauptung wenig überzeugend, derWesten habe nur Streit mit Milo∆eviƒ,„wenn doch das serbische Volk dasHauptopfer der Bombenangriffe ist“. DerNato-Anspruch wirkt noch fragwürdiger,vergleicht man die zivile Hitliste mit denbescheidenen Erfolgen, welche die Allianzgegen militärische Ziele erzielen konnte.
Denn auch nach über fünf Wochen un-unterbrochener Angriffe vermochte der We-sten Belgrads militärische Infrastrukturnicht lahmzulegen. Noch immer kannMilo∆eviƒ zurückschlagen – ein Risiko, dasdie alliierten Luftangriffe behindert und bis-lang den Westen abschreckt, zum Schutzder verbliebenen Albaner wenigstens „hu-manitäre Brückenköpfe“ freizukämpfen.
Die gefürchtete integrierte Luftverteidi-gung der Serben ist nach wie vor weitge-hend intakt, mußte vergangene WocheNato-Oberbefehlshaber Wesley Clark ein-räumen, obwohl sie seit Kriegsbeginn ZielNummer eins der Nato war. Nur etwa 70 von 450 serbischen Kampfflugzeugenkonnten bislang getroffen werden, darun-ter immerhin 23 der 83 moderneren MiG-29 und -21 (siehe Kasten).
Nur gut die Hälfte der 17 Militärflugplät-ze, klägliche 20 Prozent der Munitionslagerwurden beschädigt, gerade mal neun stra-tegische Radaranlagen und lediglich einDrittel der serbischen Flugabwehr-Rake-tenstellungen zerstört. Bei einem geschätz-ten Bestand von 1000 Boden-Luft-Raketenund 1800 Luftabwehrkanonen bleibt Bel-grads Generälen noch genug, womit sie derNato das gefahrlose Herumkurven überJugoslawien kräftig verleiden können.
Ein Grund für die noch immer relativ ge-ringe Erfolgsquote ist die Ungenauigkeitder sogenannten Präzisionswaffen. 15 Pro-zent der satellitengesteuerten Marschflug-körper verfehlen nach Experten-Meinungihr Ziel. Und vom gesamten Arsenal dergelenkten Bomben und Raketen trifft runddie Hälfte ein anderes als das anvisierteZiel, berichtet der britische MilitärexperteJonathan Eyal.
Gleichwohl meldet das Bündnis-Haupt-quartier in Brüssel täglich neue Erfolge.„Schritt für Schritt, Stück für Stück be-schneiden wir Milo∆eviƒs Fähigkeiten,Truppen im Kosovo zu halten“, sagt etwader Nato-Oberbefehlshaber für Europa,US-General Clark. Dann müsse die Natobloß noch „fünf Jahre“ so weiterbomben,wolle sie auf diese Weise ihre militärischenZiele erreichen, spöttelt Eyal.
Hinter den Kulissen wächst die Kritikan der mageren Luftkriegsbilanz. Nurvordergründig kann überraschen, daß Un-mut vor allem bei der U. S. Air Force lautwird. Sie hat bei einem Fehlschlag am mei-
Belgrad kontrolliert die WipfelTrotz der Lufthoheit der Nato setzen
die Serben über dem Kosovo Tiefflieger ein.
Wo bitte geht’s zum Krieg? Dar-auf weiß Bill Johnson-Miles,ein Obermaat der U. S. Navy,
die Antwort: „an der Espressobar vor-bei und dann immer geradeaus zumVorfeld“.
Johnson-Miles dirigiert auf demFlughafen von Bari Marinesoldaten in klapprige Turboprop-Flugzeuge vom
Typ Grumman „Greyhound“, die fast so aussehen wie die gleichna-migen Omnibusse. Ihr Prototyp flog bereits 1964.
Ähnlich betagt sind sonst nur dieMiG-21-Kampfflugzeuge Jugoslawiens,von denen bisher ein Dutzend verlo-rengingen. Und auch die modernerenMiG-29 waren gegen die Armadahauptsächlich amerikanischer Jägerund Jagdbomber bisher chancenlos.
Wie Ironie mutet es da an, daß an-dere Kampfjets der Serben trotzdemnoch im Einsatz sind – ausgerechnetüber dem Kosovo, das ja am Bodenschon von Belgrads Armee und para-militärischen Einheiten beherrschtwird. Jüngst sei die dortige Streitmachtsogar noch verstärkt worden, mußteNato-Oberbefehlshaber Wesley Clarkzerknirscht zugeben.
In erster Linie liegt das daran, daß al-liierte Kampfflugzeuge strikt gehaltensind, eine Mindestflughöhe von 4500Metern einzuhalten. Denn in denTälern des Kosovo und getarnt in denWäldern lauern Luftabwehrraketen,darunter die gefährlichen vom Typ SA-14, die nicht mit verräterischen Ra-darwellen ins Ziel gesteuert werden.Sie besitzen wärmeempfindliche Infra-
rotsuchköpfe und würden die heißenAbgase der Nato-Eindringlinge zumZiel hin verfolgen.
Die grünen Kosovo-Kampfjets derSerben greifen unterdessen im TiefflugBergverstecke der UÇK-Rebellen an,wobei auch schlechtes Wetter und einetiefliegende Wolkendecke sie vor denNato-Maschinen schützen.
Bei den serbischen Tieffliegern han-delt es sich um Zweisitzer vom Typ„Galeb“ und „Super Galeb“, die vomFlugzeugwerk Soko in Mostar gebautwurden – und das bis zur LoslösungBosnien-Herzegowinas von Jugosla-wien im März 1992. Mit Rolls-Royce-Triebwerken, Dunlop-Reifen und ame-rikanischen Schleudersitzen verdien-ten westliche Lieferanten beim Bau derMaschinen mit.
Die Galeb besitzen ein reichhaltigesWaffenarsenal und eine Aufhängevor-richtung für Napalmbomben. Die Su-per Galeb können 1,2 Tonnen tragenund Streu-Sprengkörper abwerfen.
„Wenn die überhaupt in die Luftkommen, dauert ihr Einsatz nicht lan-ge und ist sehr begrenzt“, wiegelt Nato-Sprecher Giuseppe Marani ab, einitalienischer Brigadegeneral. Er hat wo-möglich übersehen, daß die jugoslawi-schen Erdkampfflugzeuge mit Zusatz-tanks bestückbar sind und von primiti-ven Pisten, selbst von Straßen, startenkönnen.
Auch in Höhe der Baumwipfel kon-trollieren Milo∆eviƒs Piloten das Ge-schehen – mit Kampfhubschraubernnamens „Partizan“, die ebenfalls inMostar montiert wurden. FreundlicheHilfe leistete der französische Lizenz-geber Aérospatiale, bei dem das Origi-nal „Gazelle“ heißt.
Rußland wiederum hat die Raketengeliefert, mit denen sich die „Partizan“womöglich den „Apache“-Hubschrau-bern der US-Armee entgegenstellenwerden. Die mußte bereits einenApache-Totalschaden durch Absturznördlich von Tirana verzeichnen.
Das Dilemma im Luftraum über dem Kosovo hat sich bis zu PräsidentBill Clinton herumgesprochen. Er sag-te am Mittwoch vor dem sonnigenWeißen Haus, im Mai, Juni und Juliwerde das Balkan-Wetter besser. Manwerde dann in geringerer Höhe an-greifen. Joachim Hoelzgen

eisetzung eines Gefallenen in Serbien: „Wir können die Nato nicht besiegen“
sten zu verlieren, wenn in Zukunft die Mil-liarden für neue Rüstungsrunden verge-ben werden.
Das Aufbegehren der unzufriedenenLuftwaffe richtet sich gegen die Führungund eine angeblich ineffiziente Nato-Struk-tur. Obwohl die Air Force entscheidend ander Operation „Allied Force“ beteiligt sei,werde das ganze Unternehmen von zweiHeeresoffizieren geführt – General HughShelton, als Vorsitzender der VereinigtenStabschefs Amerikas ranghöchster Soldat,und Nato-Befehlshaber General Clark. Bei-de hätten vom Luftkrieg zuwenig Ahnung.
Clark steht nicht nur bei der Luftwaffein schlechtem Ansehen.Viele Soldaten, diemit oder unter ihm gedient haben, sehen indem General einen gnadenlosen Karrie-risten, der als Supreme Allied Commanderintern oft spöttisch „the Supreme Being“(das „höchste Wesen“) tituliert wird.
Im Kosovo geben Air-Force-Kritiker demOberbefehlshaber Clark die Mitschuld ander zögerlichen Einsatzplanung, für die kei-ne kohärente Strategie entwickelt wordensei. Das graduelle Steigern der Angriffetrainiere die Serben geradezu dafür, mitdem Bombenkrieg zu leben, rügte derStratege im Luftkrieg ge-gen den Irak, General a. D.Charles Horner.
Den Luftkriegern sei zu-nächst ein praktisch uner-reichbares politisches Zielvorgegeben worden, für das ganz andere Waffen,etwa die viel zu spät herbei-geschafften „Apache“-Hub-schrauber des Heeres odergepanzerte Bodentruppen,eingesetzt werden müßten,rügen die Kritiker. Und siebezweifeln, daß PräsidentClinton, Verteidigungsmini-ster William S. Cohen oderAußenministerin MadeleineAlbright „den Karren nochaus dem Dreck ziehenkönnen“.
Schuld daran hat wohlauch die schwerfällige Na-to-Bürokratie, da alle Ent-scheidungen von den 19 Mitgliedsregierungen ein-stimmig getroffen werdenmüssen. Schritt für Schrittzeichnete das „Wall StreetJournal“ nach, wie lange esgedauert habe – nämlichganze zwei Wochen –, bisschließlich auch Frankreichs Präsident Jacques Chirac einer erweiterten Ziellistezustimmte. „Wenn wir das allein machenwürden, könnten wir ganz anders zuschla-gen“, klagt ein Air-Force-Offizier.
Allerdings gibt es derzeit keinerlei Hin-weise darauf, daß Milo∆eviƒ bei einem ver-schärften Bombardement eher nachgege-ben hätte. Beispielhaft habe der Serben-
Militärische B
FO
TO
S:
REU
TER
S
Chef seine militärischen Fähigkeiten be-wahrt, finden westliche Experten. TitosIgel-Strategie, die der Marschall einst füreinen Abnutzungskrieg gegen die Sowjet-union entwickelt habe, werde nun „genaunach Plan“ gegen die Nato angewandt.
Belgrads schwere Waffen bleiben in weitüber das Land verteilten Bunkern verbor-gen. Treibstoff und Munition aus atom-bombenfesten Depots sollen drei Jahre rei-chen, selbst wenn die Nato ihr umstrittenesÖlembargo verwirklichen könnte.
Nicht einmal die beschädigte Komman-dostruktur macht der serbischen Militär-führung wirklich zu schaffen. Ihre Einhei-ten wurden von jeher für selbständigeEinsätze in Landesteilen trainiert, die vomFeind abgeschnitten waren. Das Aussitzeneines Gegners ist Teil der jugoslawischenPartisanen-Strategie. Kriegsherr Milo∆eviƒweiß, daß die Zeit immer noch eher fürihn als für den Westen arbeitet, der zu-nehmend nervöser wird.
Vergebens hoffte der Westen bislang aufeine Belgrader Palastrevolution oder einenPutsch aus der Armee. Die militärischeMachtbasis des Despoten wirkt nach wievor solide. Daß inzwischen elf Generäle
unter Hausarrest gestellt wurden, ist einnicht verifizierbares Gerücht. Schon vorder Zuspitzung des Kosovo-Konflikts wa-ren im letzten Herbst mit GeneralstabschefMom‡ilo Peri∆iƒ und Geheimdienstchef Jo-vica Stani∆iƒ zwei potentielle Verschwörerbeseitigt worden.
Auch das Frohlocken mancher Politikerim Atlantischen Bündnis, die unbotmäßi-
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
gen Äußerungen des Vuk Dra∆koviƒ (sieheInterview Seite 157) offenbarten erste Ris-se in Milo∆eviƒs Machtpyramide, erwiessich als verfrüht. Der einstige Regimegeg-ner und sprunghafte Monarchist von derSerbischen Erneuerungsbewegung, stetsmehr bellend als beißend, hatte sich erst imJanuar als jugoslawischer Vizepremier ein-kaufen lassen. Mit seinem Vorstoß wollte ersich nun wohl als möglicher Ansprech-partner des Westens für den Tag X recht-zeitig in Position manövrieren.
Das ging schief. Dra∆koviƒ hatte sich ver-hoben und verschwand in der Versenkung.„Verräter“, zischte ihm der ultranationali-stische serbische Vizepremier Vojislave∆elj hinterher. Und süffisant gaben ju-goslawische Diplomaten eine angeblicheGeheimstudie („Top Secret“) des CIA-Bal-kan-Instituts vom vergangenen Dezemberin Umlauf, in der die finanzielle Förderung(35 Millionen Dollar) einer „neuen Gene-ration von Führern“ in Belgrad propagiertwird, „die politischen Pluralismus, Markt-reform und die Herrschaft von Recht undToleranz respektieren“.
Der jugoslawische Präsident hat nochgenug Getreue, auf die er sich verlassen
kann, weil sie mit ihm untergehen würden.Milo∆eviƒs neuer Generalstabschef Dra-goljub Ojdaniƒ, 57, hat sich als aggressiverGroßserbe im Krieg mit Kroatien bewie-sen. Der General ist ein Mann feurigerDurchhalteparolen, ganz auf Endsieg ge-trimmt „mit dem Glück des Tüchtigen“.Seine Armee habe bisher 46 Nato-Flug-zeuge abgeschossen, 6 Helikopter und
155

n
182 Cruise Missiles, fabuliert der bulligeGeneralstabschef und sieht die Stärke undEinheit der gesamten Nation von Tag zuTag wachsen – „für unsere Ehre, Freiheitund das Vaterland, jetzt und für immer“.
Schwer vorstellbar, daß Militärs diesesKalibers freiwillig aus dem Kosovo ab-rücken, wie es der Westen zur „nachprüf-baren“ Bedingung jeglicher Feuerpausemacht. Für dieses sofortige Innehalten derNato, um den politischen Dialog mit Bel-grad wiederaufnehmen zu können, warbKreml-Emissär Tschernomyrdin bei seinerParforcetour in der vergangenen Woche.
Daß Tschernomyrdin vor seinem neuer-lichen Belgrad-Trip ausgerechnet Bonn undRom besuchte, löste bei einigen im westli-chen Lager unverhohlen Argwohn aus.Hier glaubt Moskau offenbar jene Wackel-kandidaten in der Allianz auszumachen,bemerkte die Londoner„Financial Times“ spitz,„die für einen Kom-promiß mit Milo∆eviƒ amoffensten sind“. Und die„Neue Zürcher Zei-tung“ („Deutsche Hoff-nungen, deutsche Illu-sionen“) zürnte bom-benfest, einige westeu-ropäische Regierungenversuchten „mit fastkrampfhafter Energie“,den Kosovo-Konfliktwieder einer diploma-tischen Lösung zuzu-führen.
Die Briten dürften da-mit gewiß nicht gemeintsein. Deren Chefdiplo-mat Robin Cook versi-cherte, es werde „keinen Frieden auf Ko-sten von Milo∆eviƒs Opfern geben“, diesichere Rückkehr der Flüchtlinge „in einmulti-ethnisches, demokratisches Kosovo“müsse mit allen Mitteln durchgesetzt wer-den. Auch US-Vizeaußenminister StrobeTalbott mühte sich nach Rückkehr vonMoskauer Sondierungsgesprächen bei ei-nem Zwischenstopp in Brüssel, allzu hoheErwartungen auf einen baldigen Verhand-lungserfolg zu dämpfen. Nicht die HaltungRußlands stehe in Frage, „sondern das Pro-blem heißt Belgrad“.
So ist es in der Tat, doch das wissenDeutsche wie Russen. Beide glauben in-des, daß es sinnvoll ist, „gewisse Annähe-rungen“ (Bundeskanzler Schröder) auszu-loten, um die Automatik der militärischenEskalation zu durchbrechen und „Kontu-ren einer politischen Lösung“ (Außenmi-nister Fischer) aufzuzeigen.
Dabei geht es den Deutschen vorwie-gend darum, die lange Zeit im machtpo-litischen Abseits schmollenden Russeneinzubinden für eine gemeinsame Koso-vo-Resolution im Sicherheitsrat, die Uno-Generalsekretär Kofi Annan präsentierensoll. Denn deren Verabschiedung würde,
Krisenvermittler A
d e r s p i e g e156
vorausgesetzt, China enthält sich der Stim-me, eine völkerrechtsgemäße Handlungs-grundlage für die Intervention der Natoschaffen und Belgrad seine internationaleIsolation drastisch verdeutlichen.
Daß Rußland durchaus bereit ist, hierbeiden Vorstellungen des Westens zu folgen,machte Tschernomyrdin dem jugosla-wischen Präsidenten am Freitag in Bel-grad klar – bei seiner zweiten Visite binnenacht Tagen.
Längst ist auch den Russen bewußt, daßnur eine Friedenstruppe mit „robustem“Mandat, also mit schweren Waffen, dasKosovo befrieden und die über 600 000geflüchteten Albaner zur Rückkehr bewe-gen kann. „Sonst gehen wir selber mit un-seren Brigaden nicht da rein, das wäre zuunsicher“, eröffnete Tschernomyrdin sei-nen Bonner Gesprächspartnern. Und der
Russe machte zudemdeutlich, daß er sich„selbstverständlich auchNato-Kontingente ein-schließlich der Ameri-kaner“ in Serbiens Un-ruheprovinz vorstellenkann.
Scheitern kann derehrlich bemühte Balkan-Makler Tschernomyrdinan zwei weiteren stritti-gen Punkten: Der We-sten besteht kategorischauf dem Abzug sämtli-cher serbischer Soldatenund Sonderpolizisten;Milo∆eviƒ dagegen willzumindest 18000 Serbenweiter im Kosovo statio-niert haben, so wie es
ihm die Vereinbarung mit US-Sonderbot-schafter Richard Holbrooke im vergange-nen Oktober zubilligte.
Doch diese Absprache ist nach demMorden der letzten Wochen ebenso Ma-kulatur wie das Friedensabkommen vonRambouillet. Das garantierte Jugoslawiennoch die volle territoriale Integrität, mitdem Kosovo als festem Bestandteil. Jetztaber will der Westen den künftigen Statusdes Kosovo im ungefähren lassen und steu-ert eine Übergangsadministration unter in-ternationaler Verwaltung an, praktisch alsoein Uno-Protektorat.
Der Tschernomyrdin-Expreß hat offen-sichtlich einiges in Bewegung gebrachtEnde voriger Woche, auch in Belgrad. Dochreicht das für einen ernsthaften Anlaufoder gar Durchbruch zum politischenKompromiß?
In Bonn wollte man sich bei einer erstenZwischenanalyse der Russen-Mission nichtallzu optimistisch geben. „Wir nutzen jedeChance“, resümierte KanzleramtsministerBodo Hombach vorsichtig, „aber die Ame-rikaner sagen: Wir richten uns auf langeFristen ein.“ Olaf Ihlau,
Siegesmund von Ilsemann
nan, Jelzin
l 1 8 / 1 9 9 9

Ausland
„Eine Katastrophe ohne Ende“Der entlassene jugoslawische Vizepremier
Vuk Dra∆koviƒ über seine Friedenspläne, die Kriegspsychose der Serben und die Zukunft des Kosovo
Ex-Vizepremier Dra∆koviƒ: „Die Bomben sind schuld am Haß“
AP
Prügelopfer Dra∆koviƒ (1993)*„Terror gegen Demokraten“
A.
ZAM
UR
/ G
AM
MA /
STU
DIO
X
SPIEGEL: Herr Dra∆koviƒ, die Strafe für Ihreunerwartete Kritik am Regime erfolgteohne Verzug: Sie wurden aus der Regie-rung gefeuert.Warum sind Sie aus der ser-bischen Einheitsfront ausgeschert?Dra∆koviƒ: Ich versuche, der Bevölkerungdie Angst vor einer offenen Diskussionüber die beste Möglichkeit zu einer vor-teilhaften Lösung des Konflikts zu neh-men. Das Regime verheimlicht die tatsäch-lichen Folgen der Nato-Verbrechen – ausAngst, daß wir dem Feind damit eingeste-hen, in der schwächeren Position zu sein.Ich habe mich gegen diese Logik gewehrt,obwohl es riskant ist und unserer nationa-len Mentalität widerspricht. Die serbischeVariante von Shakespeares „Sein oderNichtsein“ lautet nämlich: „Das Unmögli-che möglich machen.“ Dazu gehört auchdie Illusion, wir könnten die Nato besiegen.SPIEGEL: Sie behaupten, Jugoslawien seibereit, bewaffnete Friedenstruppen insKosovo zu lassen, sofern diese der Unounterstellt würden. Gibt es tatsächlich Anzeichen, daß Milo∆eviƒ endlich einlen-ken will?Dra∆koviƒ: Wir forderten von Anfang an,die Kosovo-Krise im Rahmen der VereintenNationen zu lösen. Der Sicherheitsrat wirdentscheiden, in welcher ZusammensetzungFriedenstruppen im Kosovo stationiertwerden sollen, welche serbische Militär-präsenz dort verbleiben kann oder obvorübergehend eine zivile Uno-Verwaltungeingesetzt wird. Jeder Versuch eines Nato-Diktats wird indes durch ein Veto der Rus-sen abgeschmettert werden. Der endgülti-ge Beschluß des Sicherheitsrats würde unsebenso wie die Nato binden. Doch die Ideeeines unabhängigen Kosovo oder einesGroßalbanien muß endgültig begrabenwerden.SPIEGEL: Die Nato könnte sich darauf wohleinlassen, aber die albanische UÇK-Be-freiungsarmee wird die serbische Ober-herrschaft niemals anerkennen und ihrenGuerrillakrieg weiterführen.Dra∆koviƒ: Es wird Aufgabe der Uno sein,diese Terroristen zu entwaffnen. Wir kön-nen eine Vereinbarung auf der Basis derPrinzipien der Kontaktgruppe akzeptie-ren. Die Albaner sollen eine maximale Au-
* Mit Ehefrau Danica in einem Belgrader Krankenhaus,nach einer spontanen Protestdemonstration gegen dasMilo∆eviƒ-Regime.
tonomie erhalten, dazu alle Glaubens- undMenschenrechte. Wir sind auch zu zweiparallelen Rechtssystemen im Kosovo be-reit: einem autonomen für die Albaner undeinem anderen für die dort lebende serbi-sche Minderheit. Die Albaner haben imGegenzug den Staat Jugoslawien anzuer-kennen. Doch mit Terroristen werden wiruns nicht mehr an einen Tisch setzen.SPIEGEL: Die UÇK wird sich nicht ganz aus-schalten lassen. Ihr Sprecher Hashim Thaçiist mittlerweile der neue Übergangspre-mier des Kosovo …Dra∆koviƒ: … der ist Premier, wie mein EselPremier ist. In Rambouillet zwangen dieUSA den legalen Vertreter der Kosovo-Al-baner, Ibrahim Rugova, den TerroristenThaçi als Delegationschef zu akzeptieren.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Rugova wurde zum Zimmermädchen de-gradiert. Serbien hat Rugova zehn Jahregewähren lassen, obwohl er die Alba-ner zum Boykott Serbiens aufrief. Aber erwarf keine Bomben. Haben wir Rugovaetwa für sein Unabhängigkeitsprogrammverhaftet?SPIEGEL: Sie können doch nicht bestreiten,daß die serbische Polizei die albanischeBevölkerung des Kosovo jahrzehntelangschikanierte.Dra∆koviƒ: Tatsache ist: Es gab vor demNato-Angriff keine zerstörten Häuser, kei-ne Militäraktionen, keine Flüchtlinge. UndPolizeiwillkür gab es übrigens auch hier inSerbien. Ich selbst wurde verhaftet, warim Gefängnis, man hat mich mißhandelt –nicht Rugova. Der Terror richtete sich vorallem gegen die demokratische Oppositionin Serbien.SPIEGEL: Aber die Albaner flohen doch inden letzten Wochen nicht vor der Nato zuHunderttausenden in die Nachbarländer,wie Milo∆eviƒ behauptet.Dra∆koviƒ: Die Nato-Bomben sind schuldan dem Haß, der sich auf serbischer Seiteaufgestaut hat. Man erblickt in den Alba-nern die Hauptverantwortlichen für dasUnglück.Aber nach dem Krieg werden bei-de Seiten begreifen, daß sie gemeinsamOpfer einer schrecklichen, kriminellenNato-Strategie geworden sind.
157

Ausland
158
„Die Nato-Bomben haben schlimme Folgen für
die proeuropäischen Kräfte“
SPIEGEL: Die Nato behauptet, Beweise fürMassenexekutionen an Albanern zu ha-ben, die Serben sollen Konzentrationslagererrichten und albanische Frauen in großerZahl vergewaltigen.Wird Jugoslawien Un-tersuchungen des Uno-Kriegsverbrecher-tribunals in Den Haag akzeptieren?Dra∆koviƒ: Ich weiß nicht, was sich konkretim Kosovo abgespielt hat. Doch die Bom-ben haben eine Atmosphäre erzeugt, in derHaß mit all seinen fürchterlichen Folgengedeiht. Wir haben bereits eine Kommis-sion zur Untersuchung von Verbrechen ge-gründet und auch schon 200 Personen ver-haftet. Die Haager Untersuchungsrichterkönnen kommen, wenn sie mit unserenstaatlichen Organen zusammenarbeiten.Verurteilt werden müssen die Schuldigenallerdings nach unseren Gesetzen und vorunseren Gerichten.SPIEGEL: Sie haben öffentlich gesagt, esgebe Kräfte im Land, die den Kriegs-zustand gern zum Dauerzustand machenwürden, um Demokratie und Freiheit inSerbien weiter zu unterdrücken. MeintenSie damit Milo∆eviƒ?Dra∆koviƒ: Ich sprach von Extremisten be-ziehungsweise von Verrückten – und ziel-
te damit fast ausschließlich auf den Ultra-nationalisten e∆elj …SPIEGEL: … der doch als serbischer Vize-premier wohl von Milo∆eviƒ kontrolliertund toleriert wird.Dra∆koviƒ: Es herrscht eben Kriegszustand,und wir stecken alle in einer Kampfma-schine, als Opfer des Nato-Verbrechens.SPIEGEL: US-Präsident Clinton nennt Mi-lo∆eviƒ einen kriegslüsternen Tyrannen, derverschwinden müsse. Sonst werde es kei-nen Frieden und keine Sicherheit auf demBalkan geben. Halten Sie sich als seinNachfolger bereit?Dra∆koviƒ: Das fehlte noch, daß die Ameri-kaner bestimmen, wer unser Präsident seinsoll. Ich habe Milo∆eviƒ nicht gewählt, aberdie Mehrheit unseres Volkes hat sich für ihnentschieden. Und allein die Volkesstimmekann ihn absetzen.Wenn dieser Krieg vor-bei ist, werden sehr schnell demokratischeWahlen stattfinden müssen. Doch ichfürchte, daß die Nato-Bomben schlimmeFolgen für die proeuropäischen Kräfte inSerbien haben werden.SPIEGEL: Also legitimiert der Krieg Mi-lo∆eviƒs Herrschaft aufs neue? Dra∆koviƒ: Vor über zwei Jahren führte ichdrei Monate lang die Demonstrationen ge-gen Milo∆eviƒ. Wir trugen neben der ser-bischen Fahne auch die der EU – als Sym-bol unseres Wunsches, Serbien in Europaund in der westlichen Welt zu integrieren.Einer, der jeden Tag in unsere Parteizen-trale kam, um die amerikanische Fahne zu
holen, war mein Freund Aleksandar Deliƒ.Heute erhielt ich ein Telegramm, daß er beieinem Nato-Angriff getötet wurde. Kön-nen Sie sich vorstellen, wie schwer es füruns sein wird, nach dem Krieg wieder aufdem Platz der Freiheit zu stehen und fürSerbiens Zukunft innerhalb der Europäi-schen Union zu plädieren? Und wie leichtes e∆elj fallen wird, die Europäer zu un-seren Feinden abzustempeln? Die Nato hatunserem Land in 35 Tagen mehr Unglückgebracht als Hitlers Armee in vierjährigerOkkupation.SPIEGEL: Sie wollen doch wohl nicht dieNato mit Hitlers Wehrmacht in eins setzen?Dra∆koviƒ: Unser Volk stellt merkwürdigeGedankenspiele an. Wir erinnern uns aneinige deutsche Generäle und an den deut-schen Feind, und wir begreifen, daß einwürdiger Feind immer ein halber Freundist. Die Zahl der Opfer im Kampf gegenHitler war natürlich größer als heute.Aberdiese Serben fielen ehrenhaft, wir sahendem Gegner in die Augen. Der jetzigeFeind ist verlogen, erbärmlich, feige und imVergleich zum deutschen Generalfeldmar-schall Mackensen von 1915 ein elenderWicht. Mackensen ließ sofort nach der Ein-nahme Belgrads ein Denkmal errichten mitder Inschrift: Dem großen, serbischenFeind. Wer sind diese Feiglinge jetzt, dieein Land vom Himmel aus zerstören, einVolk der kollektiven Rache unterziehenund es vernichten wollen? SPIEGEL: Sie wollten doch, daß Ihr Volknicht länger von der Propaganda belogenwird.Warum kann Serbien nicht begreifen,daß ausschließlich die Sturheit seinerFührung den Krieg hervorgerufen hat?Dra∆koviƒ: O nein. Serbien wird heute zer-stört, weil die USA mit diesem Lehrbei-spiel Europa disziplinieren wollen. DennAmerika weiß genau, daß ein vereintesDeutschland mit seinem Potential, in ei-nem neuen wirtschaftlichen wie politischenBündnis mit Rußland, die Grundlage fürein vereintes Europa schaffen könnte –vom Atlantik bis zum Pazifik. Um dies zuverhindern, wird ein kollektives Verbre-chen an den Serben inszeniert.SPIEGEL: Wird die Friedensmission des rus-sischen Vermittlers Tschernomyrdin einenKompromiß herbeiführen, der auch für denWesten annehmbar ist?Dra∆koviƒ: Zwischen den Russen und unsgibt es nur noch minimale Differenzen, diesich klären lassen.Wir wollen den Frieden,die Russen wollen ihn – ob ihn die Natowill, weiß ich nicht. Ich halte ein Treffen vonClinton und Jelzin für dringend gebotenund hoffe, daß es alsbald stattfinden wird.SPIEGEL: Wenn Belgrad nicht schnellstensnachgibt, könnte die Nato sich gezwungensehen, Bodentruppen einzusetzen. Dannwäre das Kosovo für Serbien wohl endgül-tig verloren. Was dann?Dra∆koviƒ: Eine Katastrophe ohne Ende –für uns und für euch.
Interview: Renate Flottau
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9

Werbeseite
Werbeseite

Ausland
S E R B I E N
„Ich laufe nur über Scherben“Renate Flottaus Kriegstagebuch aus Belgrad
Inspektion der Bombenschäden in Belgrad*: Die Zahl der Opfer wird verschwiegenFO
TO
S:
AP
MONTAG, 26. APRILMilo∆eviƒ ist kein Buschhäuptling, des-
sen Propaganda man verhindert, indemman seine Trommel zerschlägt.Als ich heu-te morgen den privaten Kariƒ-Fernsehka-nal einschalte, sehe ich die Nachrichten-sprecherin des zerbombten Staatsfernse-hens RTS auf dem Bildschirm. Und sie liestwie eh und je mit verbissener Miene diestaatlichen Verlautbarungen vom Blatt.
Überrascht es tatsächlich jemanden, daßdie Redakteure der übrigen serbischen TV-Anstalten jetzt die Staatsnachrichten in ihrProgramm übernehmen müssen?
Allerdings frage ich mich, wo da die Lo-gik der blutigen Attacke auf das Fernseh-gebäude bleibt. Will die Nato in den kom-menden Nächten auch die Redaktionender zahlreichen Regime-Zeitungen aus-räuchern, die vom „vierten Reich“ des„Adolf“ Clinton schreiben oder Schlag-zeilen machen wie: „Schäm dich, Tony“?
Und was ist mit der Wochenzeitung„Svedok“? Die erbaut das Volk mit derBehauptung, Nato-Oberbefehlshaber Wes-ley Clark lasse jetzt die Schleudersitze ausden Nato-Bombern entfernen, damit diePiloten nicht mehr aussteigen können.
Es ist zehn Uhr. Ich reihe mich ein in dieSchlange der Menschen, die vor dem Stadt-
* Durch Verteidigungsminister Bulatoviƒ (2. v. r.) und Ge-neralstabschef Ojdaniƒ (M.) am 30. April.
160
krankenhaus stehen. Die Angehörigen vonsechs getöteten TV-Mitarbeitern nehmenin der Kapelle Abschied von den Opfern.
Da ist die junge, blonde Frau in derschwarzen Lederjacke. Ihr Gesicht istwachsbleich, sie muß fast getragen wer-den. Dann bricht sie ohnmächtig zusam-men. Die Menschen am Straßenrand scheinen vor Mitgefühl gelähmt.
Die Mutter von DraganTasiƒ, dem 31jährigen Fern-sehtechniker, kommt alsnächste. Das schwarzeKopftuch, zusammenge-knotet über dem weißenHaar, ist ihr einzigerSchutz vor dem heftig ein-setzenden Regen. VonWeinkrämpfen geschüttelt,ruft sie: „Dragan, meineSonne, mein Herzenssohn– ich hatte so gehofft, daßdu die Tür noch rechtzeitigöffnen und dich rettenwürdest!“
Als die Särge in die Lei-chenwagen geschoben wer-den, geschmückt mit Mai-glöckchen und Flieder,stellt sich ein italienischerFernsehreporter davor. Erberichtet unbeirrt live „vorOrt“. Daß die sich nicht
Die Balkadentin desRenate Floim KosovoSchutzhaft Führers Ibrin serbischewahrsam wdas Kriegsgezeit aus deJugoslawien
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
schämen, diese Mörder, empört sich eineFrau hinter mir.
Zwei weitere Leichen werden an diesemTag noch unter den Trümmern des zer-störten Fernsehgebäudes hervorgezogen.150 Mitarbeiter sollen während des An-griffs im Sender gewesen sein.
Um 23 Uhr setzt wie üblich der Luft-alarm ein. Exakt um Mitternacht dröhnendie Nato-Maschinen über den Dächern.Doch sie fliegen erst mal weiter. Eine Stun-de später trifft ein Marschflugkörper dieZentrale der Sozialistischen Partei. Das23stöckige Hochhaus war bereits vergan-gene Woche bei einem Angriff nahezu aus-gebrannt. Der Nato werden doch nicht dieZiele ausgehen?
DIENSTAG, 27. APRILIch staune über die Phantasie bei der
Organisation patriotischer Solidaritäts-aktionen. 22 Belgrader Zahnärzte sind be-reit, Zähne kostenlos zu ziehen. Auch Zi-garetten für die Soldaten werden gesam-melt. Das Regime-Blatt „Ve‡ernje Novo-sti“ startete eine Kampagne: „Herr Grass,wir schicken Ihnen Ihre Bücher zurück!“Alle Volksbibliotheken wurden aufgefor-dert, Bücher von Günter Grass zu verban-nen, denn der deutsche Schriftsteller hatdie Nato-Intervention gerechtfertigt.
Ausgebombte Betriebe und Fabriken ha-ben laut Anordnung der Behörden späte-stens nach Ablauf von drei Monaten alleArbeiter wieder einzustellen, die ihren Ar-beitsplatz aufgrund der Kriegsereignisseverloren. Dabei könnten die Beschäftigtenauch zu „niedrigeren Arbeiten“ eingesetztwerden. Das bedeutet: Zwangsarbeit fürden Wiederaufbau.
Firmen und Privatpersonen müssen alle„von ihnen geforderten“ Gegenstände fürdie Landesverteidigung zur Verfügungstellen. Damit sind staatliche Plünderungenlegalisiert und nicht mehr ausschließlich
das Monopol von Frei-schärlerbanden. In Dörfernund Kleinstädten wüten be-reits seit Wochen Mili-tärinquisitoren und Pro-vinzfunktionäre. Sie kon-fiszieren Ferkel, räumen die Warenlager von Klein-händlern aus, deklarie-ren Haushaltsvorräte zuSchmuggelgütern, die demStaat auszuhändigen sind.
Das kostenlose Einkaufs-paradies ist vor allem fürtreue Parteimitglieder derSozialisten und der Jugo-slawischen Linken (JUL)reserviert. So hält man ihreBegeisterung für den Kriegwach.
„Politika Ekspres“ be-richtet über die Todesdro-hungen der UÇK-Befrei-ungsarmee gegen den Al-
Korrespon-SPIEGEL, u, 54, die eugin ders Albaner-im Rugova Polizeige-de, verfolgthehen der-
Hauptstadt
n- tta Zdeahm
ursc
r s.

Werbeseite
Werbeseite

Abwehrfeuer über BelgradBlutroter Horizont
Beisetzung der getöteten TV-Mitarbeiter„Dragan, meine Sonne“
baner-Führer Ibrahim Rugova. Jetzt habendie Offiziellen in Belgrad endlich einenVorwand, seinen Hausarrest zu rechtferti-gen. Rugova, schreiben die Medien, habeden Schutz der serbischen Polizei ausAngst vor den Terroristen akzeptiert.
Milo∆eviƒ ist es gelungen, die albanischeFront im Kosovo aufzubrechen. Rugova hat sich durch seine Kontakte mit dem Re-gime in den Augen der UÇK und der Op-position diskreditiert. Mittlerweile existie-ren zwei Regierungen der Kosovo-Alba-ner – die von UÇK-Mitglied Hashim Thaçi,Verhandlungsführer in Rambouillet, auf-gestellte Übergangsregierung in Albanienund die von Bujar Bukoshi im deutschenExil, der nicht daran denkt, abzudan-ken. Die UÇK beschuldigt Bukoshi, er halte Geld für ihre Armee zurück. Bu-
koshi nennt den Gegenspieler Thaçi einen Putschisten.
MITTWOCH, 28. APRILEs ging Schlag auf Schlag. Während die
Sirenen noch heulten, wankte und dröhn-te schon das Haus, als breche es über mirzusammen. Fensterscheiben splitterten,Türen sprangen auf. Siebenmal in unmit-telbarer Folge wurde die Luft um ein Uhrdurch die Explosion der Bomben zerris-sen, die auf die Top‡ider-Kaserne in derNähe meiner Wohnung fielen. Es ist diegrößte Kaserne Belgrads.
Dann drehten die Nato-Geschwader ab.Der Strom ist weg. Brandgeruch steigt indie Nase. Der Kopf dröhnt, als werde ergleich zerspringen. Mit dem Kauf neuerFensterscheiben warte ich besser, obwohldie Temperaturen nicht gerade sommer-lich sind. In meiner unmittelbaren Nach-barschaft gibt es drei Kasernen.
In der Parteizentrale von Vuk Dra∆koviƒund seiner Serbischen Erneuerungsbe-wegung versammeln sich immer mehrJournalisten, seit Dra∆koviƒ seinen politi-schen Amoklauf startete. Was hat er vor?Profiliert er sich mit seiner Regimekritik imWesten als Milo∆eviƒ-Nachfolger? Oderschiebt Milo∆eviƒ ihn als Boten vor, um dieReaktion der Bevölkerung zu testen? AuchMilo∆eviƒs Ehefrau Mirjana Markoviƒ vonder Jugoslawischen Linken sieht plötzlichkein Problem mehr darin, internationaleFriedenstruppen unter Uno-Mandat im Ko-sovo hinzunehmen – mit den Russen alsstärkstem Kontingent. Das ermögliche ei-nen raschen Wiederaufbau.
Dra∆koviƒs Appell an die Öffentlichkeit,nicht länger den Lügen über die tatsächli-chen Ausmaße der Nato-Angriffe zu trau-en, hat einen Stein ins Rollen gebracht.Plötzlich ist der Bann gebrochen. Man er-zählt, der Nachrichtenchef im RTS-Sender
habe den Mitarbeitern mit Kündigung ge-droht, falls sie das Gebäude verlassen wür-den, obwohl zu diesem Zeitpunkt klar ge-wesen sei, daß es von der Nato bombar-diert werde.
Bewohner der direkt neben derTop‡ider-Kaserne liegenden Wohnhäuserberichten, beim ersten Nato-Schlag gegendiese militärische Einrichtung seien die To-ten kaum noch zu zählen gewesen. Das„tatsächliche Ausmaß“, das Dra∆koviƒmeint, heißt: Die Zahl der Opfer wird ver-schwiegen – aus Angst, es könne zu einemAufstand in der Bevölkerung kommen.
In den südserbischen Orten Kraljevo undNovi Pazar protestierten die Eltern vonReservisten. Nicht ein einziger Sohn eineslokalen Politikers befinde sich unter denRekruten. Auf den Einberufungsbefehlenstand: „Das Vaterland ruft“ und „Nun bistdu an der Reihe“. Wo ist das Vaterland,fragen die Eltern, wenn der Sold nicht aus-gezahlt wird?
Am Abend rücken wieder die Lastwagender Armee aus. Sie sind voll mit Soldatenund Militärausrüstung – bis zum Morgen-grauen pendeln sie durch Belgrad, um ei-

Ausland
AFP /
DPA
Albaner-Führer RIn den Augen d
nem möglichen Angriff aufihre Kasernen zu entgehen.
DONNERSTAG, 29. APRILDie andere Kaserne, ei-
nen Steinwurf von mir ent-fernt, wurde heute nachtgetroffen, allerdings schlugnur eine Bombe ein. Bei mirzersprang das bisher nochheile Küchenfenster. DerPutz, der wieder von Wän-den und Decken fiel, liegtin der ganzen Wohnung
ugova (r.)* er Opposition diskreditiert
REU
TER
S
verstreut.Welche Substanz auch immer beider Explosion frei wird, sie brennt in denAugen, hinterläßt einen metallenen Ge-schmack und scheint mir für die Lungennicht besonders zuträglich zu sein. Alsogreife auch ich zum serbischen Allheilmit-tel: Soda-Bikarbonat aufs Handtuch undvors Gesicht gepreßt.
Mittlerweile habe ich mich damit abge-funden, nachts ständig zwischen Bett undHaustür hin und her zu laufen. Das ferneBrummen der Flugzeuge registriere ichjetzt bereits 30 Sekunden, bevor sie überdas Haus donnern.
Am Nachmittag besuche ich ZoranDjindjiƒ, den Führer der DemokratischenPartei. Zusammen mit Dra∆koviƒ hatte ervor mehr als zwei Jahren die Demonstra-tionen gegen Milo∆eviƒ angeführt. Er leb-te lange in Deutschland. Dort habe er diePrinzipien westlicher Demokratie erlernt,glauben seine Anhänger. Eines hat er ganzsicher in Deutschland gelernt – was aufdem Balkan selten ist: Filterkaffee zu ma-chen. Den trinke ich in seinem Büro.
Er arbeite einen Tag, dann verstecke ersich wieder vier, fünf Tage in einem „pri-vaten Bunker“, erzählt Djindjiƒ. Nicht we-gen der Nato-Bomben, aber als ehemaligerBürgermeister Belgrads habe er noch guteKontakte zu Sicherheitsbeamten, und diehätten ihm gesagt, er stehe auf der Liqui-dationsliste des Regimes ganz oben. DerGeheimdienst habe eigene Killerbanden
* Mit Serben-Präsident Milutinoviƒ am 28. April.
d e r s p i e g e
organisiert. Falls in Jugoslawien Chaos aus-breche, sollten die Todesschwadronen gna-denlos alle Oppositionellen töten.
Djindjiƒ leidet am Syndrom aller Mi-lo∆eviƒ-Gegner: Es fällt ihm schwer, Positi-on zwischen dem Staatschef und den Nato-Bomben beziehen zu müssen. Denn dieCruise Missiles vernichten auch die ideo-logische Basis für eine prowestliche Oppo-sitionspolitik. Dennoch: Serbien, glaubt er,werde bald nur noch einen Wunsch haben– ein Ende des Kriegs. Milo∆eviƒ könne je-den Kompromiß eingehen, niemand werdeihn zur Rechenschaft ziehen. Es wäre nichtdas erste Mal, daß der Präsident eineKehrtwende macht.
FREITAG, 30. APRIL Der bisher schwerste Angriff. Bis in die
frühen Morgenstunden gingen Raketenund Bomben auf Belgrad nieder. Jugosla-wiens Hauptstadt am Zusammenfluß vonDonau und Save schien in einem blutrotenHorizont zu versinken. Die Knez-Milo∆-Straße mit ihren Ministerien und Bot-schaftsgebäuden gleicht einem Trümmer-feld. Die beiden riesigen Bunkergebäudedes Generalstabs sind nur noch Ruinen.Gegenüber wurde das Außenministeriumbeschädigt. Noch stehen die Fassaden mitihrer österreichisch-ungarischen Architek-tur und den kunstvollen Figuren auf demGiebel. Doch innen hat ein Orkan gewütet.
Stumm stehen die Belgrader vor demDesaster. Im Umkreis von fast einem Kilo-meter laufe ich nur über Scherben, ganzeBlocks sind ohne Fensterscheiben. MitWasserschläuchen versucht die Feuerwehr,die von Steinen und Splittern übersäteHauptstraße wieder für den Verkehr frei-zuspritzen. Augenzeugen berichten vonzahlreichen Toten. Offiziell wird bisher nurdie Zahl von neun Verletzten bestätigt.
Die zwei Millionen Belgrader erfahrenaus ihren Zeitungen, daß der dritte Welt-krieg vor der Tür stehe. Das behauptet je-denfalls der Professor der politischen Wis-senschaften Willie Breytenbach von derUniversität Stellenbosch in Südafrika. Erstützt sich dabei auf Nostradamus, den Se-her aus dem 16. Jahrhundert. Demnach be-ginne der Krieg zwischen dem 22. Juni unddem 23. Juli, werde sieben Monate dauernund mit einem Sieg der Nato enden. DerProfessor will auch einen Hinweis für denSturz Milo∆eviƒs gefunden haben. Ein Versbesage: „Die Serben werden ihren Prin-zen wechseln.“
Die Korrespondenten, die noch in Bel-grad arbeiten, werden immer weniger. Mitder Erneuerung der Kriegs-Pressekartenzum 30. April wird ohnehin die Zensur verschärft.
Im übrigen: Der vermeintlich letzteNato-Schlag um 5.30 Uhr, der meineDeckenlampe zu Boden riß und die Mau-ern erneut zittern ließ, war keiner – einErdbeben. Als ob die Gefahr von obennicht schon ausreichte.
l 1 8 / 1 9 9 9 163

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

166
Kosovo-Vertriebene am albanischen Grenzübergang Morina: „Sie werden herumgeschoben, gefüttert und gezählt wie Haustiere“
REU
TER
S
A L B A N I E N
Im Reich des guten WillensErst die Flüchtlingswelle, dann die Spendenflut: Albanien ist
Aufmarschgebiet der humanitären Organisationen geworden – ein gigantischer Tummelplatz der Hilfsbereiten.
Flüchtlingshelfer ReuterStändiger Kampf gegen die Verhältnisse
T. H
AG
ER
/ A
GEN
TU
R F
OC
US
Shkodër ist eine Stadt im Norden vonAlbanien, die aussieht, als hätte sieden Krieg schon hinter sich gebracht,
nachts menschenleer, die Stille nur vonHundegebell und ab und zu dem Ratterneiner Kalaschnikow durchbrochen. Es gibthier eine Tabakfabrik, den Heldenfriedhofund ein Kino, eine Seidenspinnerei und dieForstverwaltung, allesamt aufgegebene Ge-bäude, verfallen, feucht und zur Zeit mit ei-nigen tausend Vertriebenen gefüllt.
Der örtliche Militärflughafen ist nie be-nutzt worden. Er war eine nach Schafdungriechende Wiese, als Thomas Reuter kurznach Beginn des Nato-Luftkriegs hier vor-beikam: „1,6 Kilometer lang, trocken undnoch nicht privatisiert. Ein idealer Ort fürein Lager.“
Reuter ist der Balkan-Verantwortlichedes Malteser-Auslandsdienstes, ein po-lyglotter Islamwissenschaftler mit einer„Hier spricht der Captain“-Stimme, derdie letzten drei Jahre im wüstesten Teil Eu-ropas den Aufbau fördern sollte. Zwei Tagelang trank er mit Schafhirten, zuständigenBürokraten und Männern in zu teuren Au-
tos schlechten Kaffee, dann bekam er denFlughafen und war plötzlich einer der Ge-fragtesten in der Welt der Albanien-Flücht-lingshilfe.
Denn seit den letzten Unruhen 1997 gibtes praktisch keinen Staatsbesitz an Bodenmehr. Jeder, der eine Waffe besaß, stecktesich sein Claim ab, und der Regierung sindnur Sumpfgebiete, Industrieruinen, Flug-pisten und andere wertlose Areale geblie-ben, eben jene schlammigen Plätze, auf de-
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
nen jetzt Flüchtlingslager stehen. Dennochwar Reuter erstaunt, als am nächsten Tagder Kanzlerbeauftragte aus Wien, einOberstleutnant, vier Offiziere des öster-reichischen Bundesheeres und einige un-passend gut gekleidete Herren mit Laptopauf ihn warteten. Sie waren seidenweichvor Charme. Denn nicht nur sie, ganzÖsterreich wartete: „Sie standen unterenormem Druck. Es sollte das Flüchtlings-lager Österreichs werden, und sie hattennoch kein Gelände“, sagt Reuter.
Die Dänen, die Italiener, die Griechenhatten schon ihr Lager. „Und was tut Öster-reich?“ fragte daheim ein Nachrichtenspre-cher, als wieder die Bilder durchfrorenerMütter auf Traktoren zu sehen waren. Esmußte etwas geschehen. Reuter trat der Re-publik Österreich ein Stück Flugpiste ab,unterzeichnete einen Staatsvertrag zwi-schen Wien,Tirana und den Maltesern, unddann fielen 400 Soldaten, 4 Lasthubschrau-ber, ein Fernsehteam und 18 Tieflader aufdem Flugplatz von Shkodër ein.
Die Republik Österreich zeigte, wozusie in der Lage ist. Sie mietete eine Iljuschin

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Ausland
in Kukës: Jeder ist überfordert, jeder ist generv
von den Russen, wuchtete 8 Bulldozer, 61schwere Lkw und 2200 Tonnen Gerät überdie Alpen. Nach zehn Tagen durften auchdie ersten Flüchtlinge kommen und wur-den in einem Zelt registriert, über dem dieFlagge Österreichs wehte.
Angeblich kostet das Lager 150000 Markam Tag, bei inzwischen 1068 Flüchtlin-gen, die von ihren schlechter versorgtenLeidensgenossen in den Tabakfabriken und auf den Heldenfriedhöfen beneidetwerden wie Fünf-Sterne-Gäste. Es ist eine Wagenburg entstanden, autonom wie eine Raumstation, sauber,mit Stromaggregat und Was-seraufbereitung, mit Feld-postamt, Lazarettmodulen,Metalldetektoren gegen UÇK-Waffen, mit Wachturm, drei-fachem Stacheldrahtverhauund striktem Befehl für dieAufpasser, das Camp nur inkompletter Kampfausrüstungzu verlassen. Ein Bunker be-findet sich im Bau.
Draußen ist Feindesland.Es wird von Überfällen aufhumanitäre Organisationenberichtet, von Diebstählenund ständigen Versuchen derEinheimischen, bei Aufträgenzu schummeln.
Drinnen herrscht militäri-sche Ordnung, so gut es geht.Auch wenn es nach 14 TagenDoppelschicht schwerfällt, imhumanitären Diskurs zu blei-ben: „Da wird – verzeihen S’– in die Dusche geschissen,und dann wollen sie fürs Sau-bermachen auch noch be-zahlt werden“, sagt MajorKöchl, der Leiter der Stabs-abteilung. Seine größte Furchtist, eines Tages von zwei-,dreitausend Flüchtlingenüberrannt zu werden: „Wirkönnen das Lager ja schlechtmit Waffen verteidigen.“
„Es sind eben zwei ver-schiedene Ansätze der So-forthilfe“, sagt Reuter und sieht zu, wieweiter hinten ein Schaf aus dem Nato-Draht gerettet wird. „Die Österreicherwollten möglichst schnell einsatzfähig sein.Das geht nur mit militärischen Mitteln.Wir kümmern uns erst mal um die Infra-struktur.“
Das Camp der deutschen Malteser un-mittelbar daneben besteht bislang noch aus20 geschlossenen Toilettengruben. Dennwer keine Armee zur Verfügung hat, dermuß sich auf die albanischen Verhältnisseeinlassen. Also die Vormittage in einemBüro der Präfektur in Shkodër verbringen.Mit Bauunternehmen arbeiten, deren Ma-schinenpark sich im wesentlichen auf einenRaupenschlepper der Mao-Periode undzwei Pferdekarren beschränkt.
Brotausgabe
Reuters Arbeitstag ist ein ständigerKampf gegen die Verhältnisse. Es gibt keine Telefonleitungen, keine Faxe, dafürfragt der Maurer, wo er denn, wenn dasFlüchtlingslager stehe, seine Schafe wei-den lassen solle.
Gerade hat das Uno-Flüchtlingskom-missariat bestimmt, daß auch örtliche Po-lizeikräfte von den Hilfswerken unterge-bracht, verpflegt, bezahlt werden müßten,und zwischendurch meldet die Kölner Zen-trale, irgendein später Vertreter des eu-ropäischen Hochadels habe eine Ladung
Hilfsgüter – welchen Inhalts, sei noch un-klar – nach Tirana geschickt. Reuter sagt:„Der Hilfedruck von außen ist immensgroß. Die Regionalverbände sind frustriert,weil sie ihre Lieferungen nicht loswerden.“
Aber wissen die Regionalverbände, daßman für die 116 Kilometer nach Tirana vierStunden braucht? Daß der Präfekt von Shkodër sauer ist, weil sein Intimus nichtden Bauauftrag bekommen hat, und daß erdroht, das ganze Lager der OrganisationIslamic Relief zu übergeben, schließlichgebe es ja auch andere Helfer im Land?
Guter Wille ist schwer. „Manchmal“,sagt einer von Reuters Mitarbeitern, „hatman das Gefühl, die örtlichen Politiker hal-ten die Flüchtlinge für unser Problem, nachdem Motto: Ihr bringt mir meine Präfektur
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
in Unordnung, also sollt ihr auch dafür be-zahlen.“
In den letzten Wochen ist Albanien einFlickenteppich kleiner und kleinster Po-tentaten geworden, deren Reiche sich oft überschneiden und von denen vielenach der Regel arbeiten: erst helfen, dannüberlegen. 144 größere Hilfsorganisationensind bei der Uno gemeldet. Dazukommendie Kleinststiftungen, Ein-Personen-Initia-tiven und Barfußhelfer, die ihren Jahres-urlaub vorverlegt, den Kombi mit Mäntelnund Babynahrung bepackt und sich Rich-
tung Fährhafen Bari aufge-macht haben.
Im Land vertreten sind Or-ganisationen mit Kürzeln wieACF, ACAP, ARCS, ASB undso weiter bis WVI – ein Wustder guten Absichten. Es gibtdie bis zur Brille verschleier-ten Damen der Qatar Chari-table Society, denen dieSpender zu Hause Limousi-nenschlüssel auf den Schreib-tisch legten: „Ich kann auchlaufen. Bitte helft Albanien!“Es gibt die Yogi-VereinigungAnanda Marga, deren Vertre-ter Kurt als einziger Auslän-der mit dem Rad unterwegsist, und es gibt die WSPA, dieWeltgesellschaft zum Schutzvon Tieren, die sich um dieim Kosovo zurückgelassenenKatzen und Esel sorgt.
Alle wollen helfen, allewerden gebraucht. Auchwenn eine Engländerin beider Koordinierungssitzung imRathaus von Shkodër umNot-Kontingente regelrechtbettelt: „Ich habe nur 2000Flüchtlinge, gebt mir noch18 000, ich habe das Budgetdafür!“
Die Uno war auf den An-sturm der Hilfswerke genau-sowenig vorbereitet wie aufdie Flüchtlingskatastrophe.Erst nach vier Wochen und
einigen alptraumhaften Meetings derEmergency Management Group im Amts-sitz des Premierministers ist die grobe Auf-gabenverteilung definitiv geregelt worden:Das UNHCR der Uno koordiniert dieFlüchtlingshilfe, die Nato kümmert sich umLogistik und Transport, die OSZE ist zu-ständig für Information und versucht,Herrn Ingenieur Leonidha Gjermeni beiLaune zu halten.
Gjermeni sieht aus wie Jacques Brel undist gewiß kein schlechter Mensch – auchwenn seinetwegen kürzlich ein britischerFahrer drei Säcke Altkleiderspenden vomLaster riß, mit Benzin übergoß und an-zündete. Gjermeni sagt: „Ich verstehe denMann. Er wartete seit drei Tagen auf dieZollabfertigung und wollte doch nur
t
REU
TER
S
169

Ausland
Flüchtlingslager, Moschee in Kukës: Mischung aus Anarchie und Formalismus
helfen. Aber wir müssen die Prozeduren einhalten.“
Gjermeni ist der Generaldirektor desHafens Durrës, 100 Kilometer südlich vonShkodër. Er tut sein Bestes: „Wir habentäglich bis zu 180 Lastwagen abzufertigen,zehnmal mehr als früher. Und viele, dieAlbanien nicht kennen, haben ihre Papie-re nicht komplett.“
Wer „Medikamente“ in den Fracht-papieren stehen hat, muß sich im Ge-sundheitsministerium in Tirana einenStempel besorgen. Das ist die Vorschrift.Jedes Frachtpapier muß sechs Stempel tra-gen, sonst bleibt die Ware in Durrës undstapelt sich.
Der Hafen ist voll, zugestellt mit Con-tainern, Paletten und Hängern, auf denen„Aiuti umanitari“ steht, „Les colis de lavie“ oder „Pelzer packt’s“. Gefechtsberei-te Elitesoldaten aus den Niederlanden wa-chen vor einem Berg „World Food Pro-gramme“-Kartons, ein wenig weiter stehteine gänzlich ungeschützte, offene Hallevoller Mehlsäcke.
Die Hilfe ist da. Die Fahrer sind auchnoch da. Sie sitzen in den Bierbuden undwarten, manche einige Stunden, einigeschon seit Tagen. Längst ist ihnen klarge-worden, daß es nicht reicht, Hilfsgüter zusammeln und nach Albanien zu transpor-tieren, wo sie – weit jenseits der Absper-rung, in den Zeltlagern von Kukës, denschlammstarrenden Flüchtlingsdepots inShkodër – dringend gebraucht werden.Aber zwischen Hilfe und Not stehen dieVerhältnisse.
Prinzipiell sind humanitäre Güter vomZoll befreit. Nur finanziert sich der alba-nische Staat zu einem großen Teil über Im-portzölle. Da muß genau geprüft werden,
170
sehr genau, und das ist das Problem. „Un-ser erstes Material war nach einer Wochein Albanien“, sagt Christopher Stoke, derKoordinator von Ärzte ohne Grenzen inTirana. „Aber es dauerte noch einmal solange, die Sachen durch den Zoll zu brin-gen.“ Auf Druck der EU wurde eine neueZollbehörde eingerichtet. Es brauchte Tage,bis diese sich mit der alten geeinigt hatte,in welchem Gebäude die effizientere Kon-trolle stattfinden sollte.
Aber hinderlich ist nicht nur jene Mi-schung aus Anarchie und Formalismus, dieder albanischen Verwaltung eigen ist. FürChaos sorgt auch Übereifer. In den erstenWochen wurden Hilfsflüge erst angekün-digt, als die Maschinen schon in der Luftwaren. Lagerhallen wurden mit Spendenverstopft, deren Abnehmer noch gar nichtim Lande waren. Der gute Wille staute sich,quoll wie jene halbe Tonne deutsche Hefe,die kürzlich, ohne Angabe eines Adressa-ten, eingeflogen wurde. Es hat lange ge-dauert, bis die Spendensammler merkten,daß Albanien keine Altkleider mehrbraucht. Sehr viel schneller merkten sie,daß es auf dem Flughafen Tirana keineneinzigen Gabelstapler gab.
„Inzwischen sind Mittel vorhanden, Gel-der und Material. Aber angesichts der völ-lig unzureichenden Infrastruktur mangeltes an der Koordination der Vielzahl vonKoordinatoren. Das ist das Problem“, sagtReuter. Er ist inzwischen auch noch ver-schnupft, hat fünf frustrierte Malteser-Hel-fer im Büro sitzen, die seit drei Tagenzurück wollen nach Düsseldorf, und derPräfekt in Shkodër hat wieder angedeu-tet, er könne auch anders.
Weil es allen so geht, und weil zumindestder deutsche Anteil am Aufmarsch der re-
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
gierungsunabhängigen Helfer ko-ordiniert werden soll, hält die Bon-ner Botschaft in Tirana zweimalwöchentlich ein Treffen ab. Es isteine Notgemeinschaft der Notlin-dernden, eine Börse der Hilfsbe-reitschaft bei „Premium TiranaPils“: „Ich habe noch ein finni-sches Lazarett, 30 OP-Plätze. AmVierten ist es hier, oder ich stopp’smorgen“, sagt ein Sanitätsoffizier.
Rupert Neudeck von Cap Ana-mur, den alle beneiden, weil erschon 44 Millionen Mark Spendeneingesammelt hat, beklagt wort-reich die verkehrten Arbeits-grundlagen in Albanien: „Wir wer-den geschröpft von den Ämtern.“Und das Technische Hilfswerk haterfahren, daß die Nato für ihreposthumanitären Aktionen einen30 Kilometer breiten Sicherheits-gürtel im Grenzgebiet legen wird:„Seid also vorsichtig mit neuen La-gern in Kukës.“
Der Standardsatz des Abendslautet: „Das steckt noch in derEntscheidungspipeline.“ Jeder ist
überfordert, jeder ist genervt, aber 45000Flüchtlinge werden in irgendeiner Weisevon deutschen Organisationen in Albanienbetreut.
„Die Hilfsorganisationen haben zu vie-le unnötige, unsortierte Spenden und zu-wenig qualifiziertes Personal vor Ort“, sagtein Diplomat und erzählt, er habe zeit-weise ein Matratzenlager in der Botschafteinrichten müssen, um all die Angereistenguten Willens von der Straße wegzube-kommen.
Letzte Woche versuchten die Hilfswerkevor allem, sich auf den Fall der Fälle vor-zubereiten. Was passiert, wenn Milo∆eviƒsTruppen weitere Dörfer im Kosovo ab-brennen, wenn das Österreicher-Lager inShkodër tatsächlich von Flüchtenden über-rannt wird? Was, wenn Kukës beschossenwird und 118 000 Menschen in die Pro-vinzstädte evakuiert werden müssen? Waswird, wenn sich die Hilfsbereitschaft derGastfamilien erschöpft, bei denen gut dieHälfte der vertriebenen Kosovaren unter-gebracht sind?
Da müssen Szenarien entworfen undKatastrophenpläne aufgestellt, „Geber-Agenturen“ und „Lead Agencies“ kon-taktiert, Frachtpapiere bestempelt werden.Es wird schon gehen.
Und die Flüchtlinge? Samuel Nicolas,ein Malteser-Helfer aus Montpellier,erzählt: „Sie tragen alle ihre Kleider über-einander, aus Angst, wieder vertrie-ben zu werden. Sie werden herumgescho-ben von Lager zu Lager, gefüttert, regi-striert und gezählt wie Haustiere. Alleswird ihnen abgenommen. Was sie denganzen Tag über machen? Liebe. Ich glaube, das ist ihre Art, wieder zu sich zu finden.“ Alexander Smoltczyk
T. H
AG
ER
/ A
GEN
TU
R F
OC
US

Werbeseite
Werbeseite

1
Ausland
AU
T
B
K R I E G S V E R B R E C H E N
SchmutzigeSäuberungen
Vertreibung ist Völkermord: EinUrteil des Bundesgerichtshofs
über die Untaten in Bosnien setztMaßstäbe – auch für die
Verfolgung der Greuel im Kosovo.
Verurteilter JorgicEigenhändig zu Tode geprügelt
J. D
IETR
ICH
/ N
ETZH
Der Paragraph 220a steht seit 1954 imStrafgesetzbuch, doch nun wirdzum erstenmal ein Täter rechts-
kräftig danach verurteilt.Am vergangenenFreitag hatte die Bestimmung, die Völker-mord unter lebenslange Freiheitsstrafestellt, in Karlsruhe Premiere.
Der Dritte Strafsenat des Bundesge-richtshofs (BGH) bestätigte den Schuld-spruch des Düsseldorfer Oberlandesge-richts gegen den bosnischen Serben Niko-la Jorgic, 52. Seine Taten von 1992 gleichendem aktuellen Vertreibungsterror im Ko-sovo – der Karlsruher Spruch stellt klar:Die schmutzigen „ethnischen Säuberun-gen“ sind Völkermord.
Als Anführer eines Trupps von etwa 50serbischen Freischärlern hatte Jorgic nachdem Düsseldorfer Urteil an der Vertrei-bung von Muslimen in der Region vonDoboj in Bosnien-Herzegowina mitgewirktund dabei auch 30 Menschen umgebracht.
Allein 22 Menschen ermordete er in derOrtschaft Grapska, als er gemeinsam miteinem Komplizen mit einer Maschinenpi-stole in eine Gruppe wehrloser Muslimefeuerte. Knapp 50 Männer trieb er mit sei-nen Leuten aus dem Dorf Sevarlije, ließ
* 1996 bei Sarajevo.
72
estattung bosnisch-muslimischer Opfer*: Zers
sie brutal mißhandeln, 7 von ihnen er-schießen und anschließend verbrennen.
Einen Menschen hat Jorgic nach Zeu-genaussagen eigenhändig zu Tode geprü-gelt: Im Zentralgefängnis von Doboj stülp-te er einem Häftling einen Blecheimer überden Kopf und schlug mit einem Holz-knüppel so lange und kräftig auf den Eimerein, bis sein Opfer an den Schlägen starb.
Für Jorgics Pflichtverteidiger HansGrünbauer ging es Männern wie Jorgic„um eine Vertreibung der Muslime, nichtum ihre Vernichtung“. Eine solche „Ver-treibungspolitik“ reiche aber nicht aus, umjemanden wegen Völkermordes zu bestra-fen. Dann, so Grünbauer, „würde auch dieVertreibung der Sudetendeutschen ausTschechien unter Völkermord fallen“.
Die BGH-Richter überzeugte diese Fol-gerung nicht. Der Senatsvorsitzende KlausKutzer machte deutlich, daß Völkermordnicht nur dann vorliegt, wenn die Volks-gruppe physisch vernichtet werden soll wie
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
törung der Gruppe
AP
etwa die Juden im Dritten Reich: „Es gehtum die Zerstörung der Gruppe, nicht deseinzelnen“, so Kutzer. „Wenn man dieGruppenmitglieder in alle Welt zerstreut,existiert die Gruppe der Muslime als solchenicht mehr.“
Völkermord im Ausland, bestätigte derBGH, ist in Deutschland strafbar – voraus-gesetzt, es gibt „legitimierende Anknüp-fungspunkte“ für die deutsche Justiz.
Die fanden sich bei Jorgic reichlich. 23Jahre lang hat er in Deutschland gelebt. Erarbeitete im Ruhrgebiet als Schlosser undwar mit einer deutschen Frau, mit der ereine kleine Tochter hat, verheiratet. NachBosnien will er Anfang 1992 nur zurück-gekehrt sein, um seinen Besitz zu schützen:ein Haus mit Swimmingpool und eine Dis-kothek, die er gerade aufbauen wollte.
Dort erfuhr Jorgic auch von den deut-schen Ermittlungen. Er schrieb seiner –mittlerweile von ihm geschiedenen – Frau,er wolle nach Deutschland kommen undalles regeln. Gleich bei der Ankunft aufdem Düsseldorfer Flughafen wurde er ver-haftet. Die Polizei hatte bei einer Haus-durchsuchung seinen Brief gefunden.
Jorgic beteuert nach wie vor, es müsseeine Verwechslung vorliegen: Zum Zeit-punkt der ihm vorgeworfenen Taten habe erselbst als Fluchthelfer von Muslimen inDoboj in Haft gesessen. Das DüsseldorferOberlandesgericht nahm ihm dies nicht ab,lud aber auch keine der Zeugen aus Bos-nien, die Jorgic zu seiner Entlastung an-führte. Jorgic-Anwalt Grünbauer: „Ich habeZweifel, ob das noch rechtsstaatlich ist,wenn man in einem Verfahren wie hier, dasausschließlich Auslandsbezug hat, keinender ausländischen Entlastungszeugen hört.“
Die Verteidigung wehrte sich deshalbdagegen, daß der Fall überhaupt nach deut-schem Recht abgeurteilt wird. Für dieKriegsverbrechen im ehemaligen Jugosla-wien wurde der Internationale Strafge-richtshof in Den Haag eingerichtet. „DasJugoslawien-Tribunal“, so Grünbauer,„hätte diese Probleme nicht, das könnteauch vor Ort in Bosnien-Herzegowina Zeu-gen hören.“ Doch Den Haag überläßt min-derschwere Kriegsverbrechen, zu denendas Tribunal den Fall Jorgic zählt, den Ge-richten in den einzelnen Ländern.
Höchstrichterlich erlaubt Karlsruhe nun,auch Untaten im Kosovo nach Paragraph220a zu verfolgen: Nach Ansicht von Ge-neralbundesanwalt Kay Nehm decken sichdie serbischen Greueltaten in Bosnien-Her-zegowina „ziemlich genau“ mit den Ver-treibungen im Kosovo.
Derzeit werden alle Kosovo-Flüchtlingesystematisch über ihre schrecklichen Er-lebnisse befragt. Sobald sich drei, vier die-ser Schilderungen unabhängig voneinan-der decken, geht die Bundesanwaltschaftauch gegen die Kosovo-Täter wegenVölkermordes vor – wenn sie denn un-vorsichtigerweise deutschen Boden be-treten. Dietmar Hipp

Werbeseite
Werbeseite

Ausland
N A T O
„Wir sollten stolz auf uns sein“Nato-Generalsekretär Javier Solana über die Angriffe
auf Serbien, die Ziele der Allianz und über die Möglichkeiten einer diplomatischen Friedenslösung
Nato-Generalsekretär Solana„Grenzen dürfen nicht verändert werden“
G.
DE K
EER
LE /
GAM
MA /
STU
DIO
X
SPIEGEL: Herr Generalsekretär, ist dieSchlußphase des Kosovo-Kriegs schonerreicht?Solana: Ich kann noch nicht genau sagen,wann dieser Konflikt zu Ende geht. Aberwir sind im Begriff, die Ziele unserer Luft-kampagne zu erreichen. Insofern befindenwir uns tatsächlich in der Schlußphase.SPIEGEL: Teilen Sie die optimistische An-sicht des deutschen VerteidigungsministersRudolf Scharping, eine politische Lösungkönnte im Mai gefunden werden?Solana: Es sind mannigfache diplomatischeBemühungen im Gang. Aber bisher wur-den viele diplomatische Initiativen ergrif-fen, und alle scheiterten stets an Milo∆eviƒ.Dennoch tendiere ich diesmal dazu, dieDinge wie Verteidigungsminister Scharpingzu sehen.SPIEGEL: Ist die Nato zu Kompromissen imInteresse des Friedens bereit?Solana: Es dürfte sehr schwierig sein, beiden Kernforderungen zu Kompromissenzu kommen. Ende des Mordens,Abzug derserbischen Truppen aus dem Kosovo, un-gehinderte Rückkehr der Flüchtlinge, Prä-senz einer internationalen militärischenMacht: Davon können wir nicht abrücken.Die Flüchtlinge würden sonst nicht heim-kehren wollen. Darauf kommt es aber an.Denn die ethnische Säuberung darf kei-nen Bestand haben. Und es muß eine po-litische Übereinkunft gefunden werden,die in den Grundlinien dem Vertrag vonRambouillet entspricht.SPIEGEL: Bei den Verhandlungen in Ram-bouillet hat der Westen noch nicht den Ab-
zug sämtlicher serbischer Soldaten und der Sonderpolizeitruppen verlangt. Beste-hen Sie jetzt darauf, daß wirklich alle ge-hen müssen?Solana: Vielleicht können Grenztruppenbleiben. Ansonsten aber haben alle serbi-schen Truppen zu verschwinden.SPIEGEL: Kann die Nato Flexibilität bei derZusammensetzung der internationalen Mi-litärmacht für das Kosovo zeigen?Solana: Darüber läßt sich reden, aber nurinnerhalb gewisser Grenzen.Wir brauchen
auf dem Boden eine Militärmacht, die starkgenug ist, die Sicherheit der zurückkeh-renden Flüchtlinge zu garantieren. Des-halb müssen jene Staaten dabeisein, dieeine solche robuste Militärmacht stel-len können, also Frankreich, die USA,Deutschland, Großbritannien, sicher auchRußland und die Ukraine. Aber die Nato-Komponente muß das Kernelement sein.SPIEGEL: Besteht die Nato darauf, den Ober-befehl über die Friedenstruppe zu haben?Solana: Ein Nato-Kern ist entscheidend,um eine wirkungsvolle Kommandostrukturzu gewährleisten. Russen und Ukrainersollten jedoch in einem guten Verhältnisbeteiligt sein. Die Truppe muß nicht Nato-Truppe heißen. Auch in Bosnien heißt sie„Stabilisation Force“ oder Sfor, obwohl dieNato-Staaten die meisten Soldaten stellen.In Bosnien sind es mit Rußland und derUkraine über 30 Länder, die Friedenstrup-pen entsenden. Ich stelle mir etwas Ähnli-ches für das Kosovo vor.SPIEGEL: Was halten Sie von der Idee, zumNato-Kern der Friedenstruppen sollten nursolche Länder beitragen, die sich an denLuftangriffen nicht beteiligt haben?Solana: Ich sage dazu ganz klar, daßMilo∆eviƒ keinerlei Veto bei der Zusam-mensetzung der Friedenstruppe habenwird. Es ist natürlich möglich, daß jeneStaaten, die die Friedenstruppen stellen,zu gewissen Verabredungen kommen.SPIEGEL: Die Russen verlangen eine Bom-benpause von zwei oder drei Tagen, weilBelgrad sonst nicht verhandeln will. Einkurzer Waffenstillstand müßte doch mög-

he“-Hubschrauber*: „Luftkampagne wird effektiv
lich sein, um dem Frieden eine Chance zu geben?Solana: Solange Milo∆eviƒ-Truppen im Kosovo morden, brandschatzen und ver-gewaltigen, kann die Nato nicht taten-los zusehen, auch nicht zwei oder dreiTage lang. Ich stimme ausdrücklich demBundeskanzler Schröder zu: Der sagt,erst nachdem Milo∆eviƒ nachprüfbar mitdem Rückzug aus dem Kosovo begon-nen habe, sei es sinnvoll, über eine Aus-setzung der Luftschläge nachzudenken.SPIEGEL: Was soll aus dem Kosovowerden, wenn die Flüchtlinge imSchutz der internationalen Militär-macht zurückgekehrt sind? Kannman den Albanern nach all demSchrecklichen den Wunsch nach völ-liger staatlicher Unabhängigkeit ab-schlagen?Solana: Wir halten daran fest, daßdie Grenzen in Europa nicht verän-dert werden sollen, daß aber inner-halb dieser Grenzen die Selbstver-waltung sehr, sehr weit gehen kann.Alles andere wäre ein schwererFehler.SPIEGEL: Die Nato gerät zunehmendunter Druck, weil immer wiederfehlgeleitete Bomben und Marsch-flugkörper in Wohngebiete ein-schlagen. Arbeitet die Zeit gegen die Al-lianz?Solana: Ich bedauere diese Opfer außeror-dentlich. Die Nato unternimmt größte An-strengungen, um Verluste unter der Zivilbe-völkerung zu vermeiden.Das ist ihr bei ihrenbisher über 12000 Einsatzflügen in einemungewöhnlichen Umfang auch gelungen.Dieser Krieg wird in die Geschichtsbüchereingehen als ein Krieg der geringen Verluste.SPIEGEL: Angenommen, die Nato wüßte si-cher, wo sich Milo∆eviƒ gerade aufhält.Würden Sie die politische Verantwortungdafür übernehmen, ihn mit einem gezieltenBombenabwurf zu töten? Solana: Lassen Sie mich dazu nur eines sa-gen: Die an dieser Kampagne beteiligtenLänder sind Demokratien. Und Demokra-tien haben ihre eigenen Regeln, an die sie
„Apac
ihr Handeln binden. Wir wollen, daß auchin Serbien die demokratischen Kräfte denDurchbruch schaffen und daß nicht auf ei-nen Diktator ein anderer folgt.SPIEGEL: Ist die gewaltsame Besetzung desKosovo durch alliierte Bodentruppen nachwie vor ausgeschlossen?Solana: Unsere Strategie der Luftschlägeträgt ihre Früchte. Wir werden sie fortset-zen und steigern. Gleichzeitig planen wirfür alle anderen Eventualitäten. Ich kannnichts ausschließen.
SPIEGEL: Wäre der Einsatz der „Apache“-Hubschrauber, die zur U. S.Army und nichtzur Air Force gehören, ein wichtiger Schrittin Richtung Bodenkrieg?Solana: Es wird ein gewichtiger Schritt sein,die Luftkampagne noch effektiver zu ma-chen. Der Apache-Einsatz beginnt in dennächsten Tagen.SPIEGEL: War es ein Fehler, den Krieg zubeginnen und dem Gegner die Entschei-dung zu überlassen, wann er genug hat? Solana: Dies ist kein Krieg im klassischenSinn. Wir wollen kein Land besetzen, kei-ne Rohstoffe sichern oder neue Handels-wege öffnen. Dieser Krieg wird um Werteund um die moralische Verfassung jenes
* Vergangene Woche bei einem Landemanöver naheTirana, Albanien.
Europas geführt, in dem wir im 21. Jahr-hundert leben werden.SPIEGEL: Glauben Sie an den gerech-ten Krieg?Solana: O ja, ich bin überzeugt, dies ist eingerechter Krieg. Ich habe den ZweitenWeltkrieg nicht erlebt. Ich bin ein 68er. Ichbin wirklich glücklich, als Nato-General-sekretär in diesen Zeiten von Regierungs-chefs umgeben zu sein, die sagen, genug istgenug, und die dann auch zum letzten Mit-tel greifen, nachdem Monate von Ver-
handlungen mit Milo∆eviƒ nichts ge-fruchtet haben. Wir sollten stolzsein auf das, was wir tun.SPIEGEL: Im neuen strategischenKonzept, das auf dem WashingtonerGipfel verabschiedet wurde, nimmtsich die Nato das Recht, militäri-sche Gewalt gegen andere Staatennotfalls auch ohne ein Uno-Mandatanwenden zu können, wie jetztschon im Kosovo. Gleicht das nichteinem Recht zur Selbstjustiz?Solana: Wir handeln im Geiste derUno. Alle Nato-Staaten wollen dieWerte der Uno verteidigen. FünfNato-Staaten sitzen zur Zeit im Si-cherheitsrat, drei Staaten als stän-dige und zwei als zeitweilige Mit-glieder. Und der Uno-General-
sekretär unterstützt klar die Ziele der Natoim Kosovo-Konflikt.SPIEGEL: Ist das Bündnis nicht dennoch imBegriff, sich zu übernehmen?Solana: Nein, die Nato will kein Weltpo-lizist sein. Sie versucht aber, ein Systemder Zusammenarbeit und Sicherheit zwi-schen allen Staaten aufzubauen, die zuratlantischen Region gehören. Die Allianzist der magnetische Pol, auf den sich dieanderen Staaten der Region ausrichten,der ihnen Stabilität, Sicherheit und damitauch Wohlstand garantiert. Dies gilt auchfür den Balkan. Der deutsche Stabili-sierungsplan für den Balkan von Außen-minister Joschka Fischer wird dabei sehrhilfreich sein. Und ein demokratischesSerbien wird darin ebenfalls seinen Platzfinden. Interview: Dirk Koch
er“
AP

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Ausland
N A T O - S T R A T E G I E
Schurken überallMuß die Bundeswehr künftig im Kaukasus kämpfen oder in
Aserbaidschan? Die neue Strategie des Atlantikpaktsläßt viele Fragen offen – und wird teuer für Deutschland.
Nato-Gipfel in Washington: Wo endet der euro-atlantische Raum?
REU
TER
S
Mit sorgenzerfurchter Miene ver-teilte Joschka Fischer Kompli-mente. Der Kosovo-Krieg mache
klar, umschmeichelte der Außenministervergangene Woche in Berlin Uno-Gene-ralsekretär Kofi Annan, daß die VereintenNationen eine „unverzichtbare Plattform“für die Lösung von Konflikten blieben.
Annan dankte höflich für die „Unter-stützung“. Die mußte dem Ghanaer aller-dings ziemlich scheinheilig vorkommen.
Tatsächlich wirken Annans deutschePartner dabei mit, das „Gewaltmonopol“(Fischer) der Uno auszuhöhlen: Kurz vorseiner Visite hatten sie beim WashingtonerNato-Gipfel ein neues „strategisches Kon-zept“ gebilligt. Darin erhebt sich die Natonicht nur zum Hüter von „Sicherheit undStabilität des euro-atlantischen Raums“.Um „gemeinsame Sicherheitsinteressen zuwahren“, beansprucht sie auch das Recht,ohne Mandate von Uno oder OSZE mi-litärisch zu intervenieren – wie im Kosovo.
Nato-Generalsekretär Javier Solana er-läuterte so knapp wie klar: „Wir brauchenden Uno-Sicherheitsrat nicht.“
Klar ist für den Allianz-Vorsteher aberauch, daß die Nato zu „globalen“ Aktionenweder „fähig noch willens“ ist. In den Fer-nen Osten, nach Osttimor oder Nordkorea,wird sie wohl keine Eingreiftruppenschicken. Dennoch, fordert das neue Kon-zept, müsse die „Sicherheit des Bündnisses
* Bei einer gestellten Fahrzeugkontrolle auf einem Trup-penübungsplatz.
den globalen Kontext berücksichtigen“.Aber wo fängt der globale Kontext an?Und wo endet der euro-atlantische Raum?
Unklar bleibt, wo die Nato künftig gegendie Sicherheitsrisiken ankämpfen will, zudenen sie nicht nur Terrorakte, Sabotageund organisiertes Verbrechen zählt, son-dern auch die „unkontrollierte Bewegungeiner großen Zahl von Menschen“ – wie imKosovo – oder „die Unterbrechung der Zu-fuhr lebenswichtiger Ressourcen“.
Führen Nato-Kriseneinsätze die Solda-ten der Bundeswehr künftig zu Ölquellenund Pipelines – jenseits des Kaukasus, amKaspischen Meer oder am Persischen Golf?
Zum euro-atlantischen Partnerschaftsrat,den die Nato nach dem Zusammenbruch
BG
M.
MATZEL /
DAS
FO
TO
AR
CH
IV
des Sowjetreichs und des Warschauer Paktsgründete, gehören mittlerweile 44 Staaten– von Albanien an der Adria bis Tadschiki-stan und Usbekistan in Zentralasien.
So weit möchte VerteidigungsministerRudolf Scharping die Interessenssphäre derAllianz zwar nicht spannen. Auch Fischerwarnt davor, die Nato zu „überfordern“.Aber Scharping erzählt gern, daß er imeuro-atlantischen Rat „neben dem Kolle-gen aus Georgien“ sitzt – und das Nato-Mitglied Türkei habe eine Reihe „interes-santer Nachbarn“.
Zu den Staaten an der „Peripherie“gehören ehemalige Sowjetrepubliken inder Kaukasusregion wie Armenien und vorallem Aserbaidschan. US-Multis möchtenvon den dortigen Ölvorkommen am Kas-pischen Meer eine Pipeline zum türkischenMittelmeerhafen Ceyhan verlegen. US-Truppen haben den Schutz dieser Res-sourcen schon im Manöver geprobt – da-heim in den USA.
Die Türkei grenzt aber auch an Iran, Sy-rien und den Irak. Aus US-Sicht sind dasSchurkenstaaten, die nach atomaren, bio-logischen oder chemischen Waffen gieren– so wie in Nordafrika der Libyer Muam-mar el-Gaddafi. Für die Abschreckung blie-
ben „in Europa stationierte nukleare Streit-kräfte“ lebenswichtig, so die neue-alteStrategie. Und: „Die Mittelmeerregion istein Raum von besonderem Interesse fürdas Bündnis.“
Um Frieden und Stabilität „in Europaund darüber hinaus“ zu fördern, sollen dieeuropäischen Partner nun erst einmal füretliche Milliarden um- und aufrüsten. „Ver-stärkung ihrer militärischen Kapazitäten“,so heißt dies in der Nato-Sprache.
Die neue Strategie verlangt schnellver-legbare Eingreiftruppen samt „geeigneterHochtechnologie“. Sie müßten jenseits desNato-Gebiets längere Einsätze durchhaltenund „die ungehinderte Nutzung der Ver-bindungslinien zur See, zu Land und in der
undeswehrsoldaten in Mazedonien*renze der Belastbarkeit

Werbeseite
Werbeseite

Ausland
nis*: Freiwillige für Out-of-area-Einsätze
T. E
INBER
GER
/ A
RG
UM
Luft“ gewährleisten – wo immer die Allianzsich gerade zur Intervention berufen fühlt.
Die Amerikaner drängen. Verteidigungs-minister William Cohen, ganz Sachwalterder heimischen Rüstungsindustrie, warnteden deutschen Kollegen Scharping vor einer„Technologielücke“ zwischen europäischenArmeen und dem High-Tech-Heer der USA.Neue Waffensysteme zur Raketenabwehrsollen her, dazu neues Gerät für elektroni-sche Kriegführung und weitreichende Trans-portflugzeuge (siehe SPIEGEL 17/1999).
Dabei wollte Scharping den Umbau sei-ner heimatverbundenen Wehrpflichtarmeegemächlich angehen. „Gründlichkeit gehtvor Schnelligkeit“, lautete die Devise beimAmtsantritt vor einem halben Jahr.
Erst einmal solle die Hardthöhe eine„Bestandsaufnahme“ machen, erklärteScharping, danach könne eine Wehrstruk-turkommission in aller Ruhe Reformvor-schläge austüfteln. Der ei-gentliche Umbau der Streit-kräfte, glaubten Expertenim Verteidigungsausschuß,werde erst nach der näch-sten Bundestagswahl imJahr 2002 beginnen.
Doch unter dem Eindruckdes Kosovo-Kriegs drücktder Minister aufs Tempo.Schon vor dem Abflug nachWashington befahl Schar-ping, zunächst zwei der achtHeeresdivisionen speziellauf Out-of-area-Einsätzeauszurichten. Noch in die-sem Jahr will er über die An-schaffung eines neuen Trans-portflugzeugs entscheiden.
Die Bestandsaufnahme geriet zu einemdicken Mängelkatalog: Auf gut 1600 Seitenwurde zunächst aufgelistet, wie vieleKampfjets, Hubschrauber und Flugab-wehrraketen, wie viele Panzer, Lastwagenund Jeeps tatsächlich noch einsatzbereitsind – und wie viele wegen des chroni-schen Ersatzteilmangels bloß noch zumAusschlachten dienen.
Fazit eines Beteiligten: „Die Bundes-wehr steht vor der Wand.“
Auf 176 Seiten schildert eine Kurzfas-sung der Inventurstudie schwere Versäum-nisse in der Ära des Scharping-VorgängersVolker Rühe. Demnach wurden Rüstungs-und Personalplanung nicht rechtzeitig inEinklang gebracht mit den regelmäßigenKürzungen des Wehretats.Aus Geldmangellitten Ausbildung, Übungstätigkeit und dieInstandhaltung des Kriegsgeräts: Ersatz-teile konnten nicht rechtzeitig oder in dernotwendigen Anzahl beschafft werden.
Das Heer ist laut der internen Bilanz mitden Auslandseinsätzen an die Grenze seinerBelastbarkeit geraten – und wie weilandim Kalten Krieg vor allem auf das „Gefechtder verbundenen Waffen“ zur Vornvertei-
* Am 31. März im bayerischen Oberviechtach.
Soldatengelöb
d e r s p i e g e180
digung getrimmt. Schon für den Einsatzvon nur 2500 Soldaten in Bosnien mußte esEinheiten in allen Teilen der Republik aus-kämmen, um genügend brauchbares Mate-rial und qualifizierte Soldaten zu finden.
Beträchtliche Probleme bereite derNachschub für die „Krisenreaktionskräf-te“. Den Sanitätern fehle Ausrüstung undPersonal, um den bald 10 000 deutschenBalkan-Soldaten eine „angemessene Ver-sorgung“ zu garantieren – und jetzt ne-benbei noch Kriegsflüchtlingen zu helfen.Nur etwa 40000 der knapp 340000 Solda-ten von Heer, Luftwaffe und Marine sind,so das Resümee, hinreichend für Einsätzefern der Heimat trainiert und gerüstet.
Nun will Scharping die Krisenreaktions-kräfte schnell aufstocken – ohne indes dieWehrkommission zu „präjudizieren“, dieunter Vorsitz des Alt-BundespräsidentenRichard von Weizsäcker in dieser Woche
die Reformarbeit beginnen wird. „Denk-verbote“, beteuert Scharping, gebe es nicht. Aber er schickt die 21 Kommis-sionsmitglieder auf eine schwierige Grat-wanderung.
Einerseits möchte der Minister die Wehr-pflicht erhalten – und hat dementspre-chend vorwiegend Befürworter in das Gre-mium berufen. Andererseits soll es dabeibleiben, daß nur Freiwillige zu Out-of-area-Aktionen abkommandiert werden.Das reibt sich kräftig mit der Forderungder Nato, künftig „möglichst alle“ Trup-pen für Einsätze fern der Heimat bereit-zuhalten – und entsprechend auszurüsten.
Egal, ob die Weizsäcker-Kommission amEnde eine Berufsarmee oder eine verklei-nerte Bundeswehr mit einem Restbestandvon vielleicht 50000 Rekruten bei weiterverkürztem Grundwehrdienst empfiehlt –der Umbau und die neue Ausrüstung wer-den Milliarden verschlingen.
Das könnte mit einer Auflage kollidieren,die zwar nicht ausgesprochen wurde,Weiz-säckers Helfern aber durchaus bewußt ist:„Einer rot-grünen Regierung die Erhöhungdes Wehretats zu empfehlen“, so ein desi-gniertes Kommissionsmitglied, „bleibt aus-geschlossen.“ Alexander Szandar
l 1 8 / 1 9 9 9

Werbeseite
Werbeseite

1
U S A
Zeichen derSchwäche
Die US-Regierung will schärfereKontrollen beim Waffen-
erwerb, Großstädte verklagen die Hersteller auf Schadensersatz.
Präsident Clinton bei der Ankündigung seiner Gesetzesvorlage: Nationale Selbstzweifel
R.
ELLIS
/ S
YG
MA
andfeuerwaffen: Urtümliche Freiheit
B.
STR
ON
G /
SIP
A P
RES
S
Das Weiße Haus hatte den Zeitpunktsorgfältig gewählt. Die ganze Na-tion starrte noch immer schockiert
auf die Kleinstadt Littleton, in der zwei Ju-gendliche bei einem schrecklichen Amok-lauf zwölf ihrer Mitschüler, einenLehrer und schließlich sich selbsterschossen hatten. „Why?“ titel-ten die Nachrichtenmagazine,Leitartikler und Psychologen lie-ferten hilflose Erklärungsver-suche für das Unerklärliche.
Doch dann wurde bekannt,daß die 18jährige Freundin einesder Todesschützen zwei derMordwaffen legal gekauft hatte.Einmal mehr geriet ein Heiligtumder US-Gesellschaft in den Mit-telpunkt der Kritik: das in derVerfassung garantierte Recht aufWaffenbesitz. Bill Clinton nutzteden Augenblick nationalenSelbstzweifels und präsentiertevorigen Dienstag eine lang vor-bereitete Gesetzesvorlage zurverschärften Waffenkontrolle.
Den „umfassendsten Vorstoß“ seit einerGeneration nennt das Weiße Haus dasMaßnahmenpaket: Das Mindestalter fürWaffenerwerb soll auf 21 Jahre angehobenwerden. Wer Schießgerät an Jugendlicheabgibt und weiß, daß sie eine Straftat pla-nen, soll für bis zu zehn Jahre in Haft.We-gen Gewaltverbrechen vorbestrafte Ju-gendliche erhalten ein lebenslanges Waf-fenverbot. Zudem will Clinton den Ver-kauf von Munition und Sprengstoff besserkontrollieren.
Am wichtigsten jedoch: Auf Waffen-messen sollen Käufer künftig überprüftwerden. Gerade diese Verordnung würdeein gewaltiges Schlupfloch stopfen. Die103000 zugelassenen Waffengeschäfte derUSA müssen schon seit 1994 Erkundigun-gen über ihre Kundschaft einholen.Vorbe-strafte, psychisch Kranke oder Gesuchtesind nicht kaufberechtigt. Über 250000 In-teressenten wurden so abgewiesen, 27000allein seit vergangenem November, als vie-le Händler eine direkte Leitung zum FBI-Zentralregister erhielten.
Auf den jährlich über 4400 Waffenmes-sen aber herrscht Wildwest-Anarchie. DieBundesbehörde für Alkohol, Tabak undSchußwaffen untersuchte 314 Veranstal-
Kinder, H
82
tungen und fand heraus, daß dort 46 Pro-zent der Waffen an Kriminelle verkauftund 34 Prozent für Straftaten verwen-det wurden.
Angesichts dieser Zahlen bat Clintonsein schießwütiges Volk um Verständnis:Die geplanten Erschwernisse seien für Jäger und Sportschützen zwar lästig, aberzum Schutz der Allgemeinheit erforder-lich, ähnlich wie der Sicherheitscheck anFlughäfen.
Tatsächlich zeigte der Schock von Littleton Wirkung: Die Staaten Colorado,Alabama und Michigan, die gerade ihreWaffengesetze lockern wollten, verscho-ben die Abstimmung darüber.
In Washington dagegen blieb es ver-dächtig still. Zu groß ist der Einfluß derWaffenhersteller und der National RifleAssociation (NRA) mit ihren 2,8 MillionenMitgliedern auf die Abgeordneten, zu starkdie Angst der Volksvertreter, mit dem An-griff auf die urtümlichste aller amerikani-schen Freiheiten Stimmen zu verlieren.
In den gewaltgeplagten Großstädtenaber kippt die Stimmung.Verzweifelte Bür-germeister erhoffen sich nun Hilfe von derJustiz. Chicago,Atlanta, New Orleans, Mia-mi, Cleveland, Bridgeport und Detroit ver-
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
klagten die Waffenproduzenten auf Scha-densersatz – nach dem Vorbild der erfolg-reichen Produkthaftungsverfahren gegendie Tabakindustrie.
Der Vorwurf: Durch die Überversorgungmit Waffen und die laxe Verkaufskontrol-le belieferten die Hersteller indirekt denSchwarzmarkt. Außerdem fehlten Unfall-sicherungen an den Feuerwaffen. Im Rah-men der Produkthaftung sollen die Firmendie dadurch entstandenen Kosten der Städ-te – Krankenversorgung der Opfer, Aufrü-stung der Strafverfolger – ausgleichen.
Die Waffenlobby handelte schnell. Inzehn Staaten erreichte sie, daß die Parlamente den Städten und Landkrei-sen untersagten, Prozesse gegen Waffen-hersteller anzustrengen. Die betroffenenStädte Miami und Atlanta wollen sich da-mit nicht abfinden. Die klagewilligen Bür-germeister hoffen, durch juristischen undöffentlichen Druck den Widerstand derWaffenlobby gegen strengere Gesetze auf-zuweichen.
Die Taktik zeigt erste Erfolge. Währendder NRA-Präsident und frühere Schau-spieler Charlton Heston in unbelehrbarerJohn-Wayne-Manier an seiner harten Hal-tung festhält, würden einige um ihren Rufund ihre Einnahmen bangende Produzen-ten lieber einen Kompromiß schließen.
So zeigte etwa der Chef der Waffen-industrie-Organisation American ShootingSports Council, Robert Ricker, überra-schend Verständnis für Teile des Clinton-Plans, etwa die Überprüfung der Messe-Kunden. Ketzerisch äußerte sich auch einAnwalt der Hersteller: Die NRA sei im-mer mehr Zielscheibe statt Schutzschild.
„Jedes Zeichen von Schwäche erzeugtmehr Angriffe der Waffengegner“, wet-terte hingegen der NRA-Vize Wayne LaPierre. Ungerührt bestanden die Re-volverhelden darauf, ihre Jahresversamm-lung termingerecht abzuhalten. Mit ge-kürztem Programm, ohne Pomp und Show,fand sie am Samstag statt – in Denver,nur ein paar Kilometer entfernt von Littleton. Michaela Schießl

Demonstration religiöser Juden in Jerusalem: „Diese Orthodoxen halten uns nicht zusammen, sie sprengen die Gesellschaft“
N.
NEU
HAU
S /
SYG
MA
Ausland
S P I E G E L - G E S P R Ä C H
„Dann explodiert die ganze Region“Der Publizist Amos Elon über Israels Zukunft,
die Wahlen und die Aussicht auf Frieden mit den Palästinensern
A.
BR
UTM
AN
N
SPIEGEL: Herr Elon, vor den letzten Parla-mentswahlen 1996 haben Sie vorausgesagt:Jetzt kommt der Frieden. Warum ist er bisheute nicht eingekehrt? Elon: Das Gezerre um den Frieden ist einerichtige Katastrophe. Schon die Zeitpla-nung war immer falsch. Mal wollten wirFrieden, aber die Araber nicht, dann ver-hielt es sich wieder umgekehrt. Es ist eineGeschichte der verpaßten Gelegenheiten.Das gilt vor allem für den Sechs-Tage-Krieg1967. Damals haben wir die historischeChance vertan, im Tausch gegen das er-oberte Land einen stabilen Frieden zu erwirken.SPIEGEL: Aber es gab eine zweite Gelegen-heit – den Friedensvertrag von Oslo 1993.Elon: Ja, Oslo war ein Durchbruch, einwirklich magischer Moment. Doch bei al-ler Freude hatte ich irgendwie auch dasGefühl, daß es schon zu spät sein könnte.SPIEGEL: Wieso?Elon: Die Siedler im besetzten Westjor-danland hatten schon zu viele Fakten ge-schaffen. Und im Abkommen selbst stecktein fundamentaler Fehler: Das Konzept derzwei Etappen – erst Teilrückzug aus denbesetzten Gebieten und begrenzte Selbst-verwaltung für die Palästinenser, dann Ver-
handlungen über den endgültigen Status –war falsch angelegt. Alles Entscheidendewurde aufgeschoben: die Grenzen, die Zu-kunft der palästinensischen Flüchtlinge undder israelischen Siedler, ja oder nein zumPalästinenserstaat, der Streit um Jerusa-lem. Die zweite Etappe sollte in Kürze zuEnde gehen. Aber nicht einmal die erstewurde vollständig verwirklicht. Im Grundewollte man in zwei Schritten über einenAbgrund springen. Das geht nicht. Dabeilandet man mitten in der Schlucht.SPIEGEL: Traut Israel nach fünf Kriegen undTerror dem Frieden nicht mehr?
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Elon: Die Wasserscheide war 1967. Dieserunerhörte Sieg über Ägypten, Syrien undJordanien versetzte alle in einen nationa-len Rausch.Auch die Arbeitspartei ließ sichanstecken. Die Religiösen sahen darin ei-nen Fingerzeig Gottes, einige verglichenden Sechs-Tage-Krieg sogar mit den sechsmythischen Tagen, in denen die Welt er-schaffen wurde. Damals kamen in Israeldie jungen Ultras auf, diese Milo∆eviƒ-Ty-pen. Alle Parteien drifteten nach rechts.SPIEGEL: Die Haltung der Regierung heuteerinnert an den stolzen Trotz von Vertei-digungsminister Mosche Dajan, der 1967
Amos Elonnennt die Parlamentswahlen am 17.Mai eine Entscheidung um Friedenoder Nicht-Frieden: Der Publizist undHistoriker, 1926 in Wien geboren undin Tel Aviv aufgewachsen, glaubt, daßsein Land fünf Jahre nach dem Ab-kommen von Oslo an einem Wende-punkt steht. Elon, der schon 1993 Jas-sir Arafat im PLO-Hauptquartier inTunis besuchte, fordert eine radikaleKehrtwende der israelischen Politik.
183

FO
TO
S:
REU
TER
S
AP
PLO-Chef Arafat, Premier Netanjahu, Oppositionsführer Barak: „Die Beziehungen zu den Palästinensern sind vergiftet“
sagte: Frieden gibt es, wenn die Israelis ei-sern da stehenbleiben, wo sie stehen, bissich die Araber zum Frieden bequemen.Elon: Aber Dajan lernte seine Lektion undänderte seine Meinung – anders als der ge-genwärtige Ministerpräsident BenjaminNetanjahu. Dajan hatte Sinn für Poesie undGeschichte, er stand für gewisse Prinzipienein. Netanjahu ist bloß ein hoffnungsloserOpportunist.SPIEGEL: Wird er am 17. Mai abgewählt?Elon: Ach, wissen Sie, der OppositionsführerEhud Barak und Netanjahu sagen ja ziem-lich dasselbe: Der eine will Frieden mit Si-cherheit, der andere Sicherheit mit Frieden.SPIEGEL: Dann bleibt alles beim alten, egal,wer die Regierung führt?Elon: Der Hauptunterschied ist ein morali-scher. Netanjahu ist weitgehend diskredi-tiert, er hat sich unglaubwürdig gemacht,selbst einige seiner Parteifreunde treffensich mit ihm nur noch unter Zeugen. Barakdagegen wird sich nach meiner Überzeu-gung ernsthaft bemühen, den Friedens-prozeß wiederzubeleben, den Netanjahuwillentlich abgewürgt hat. Als Ex-Generalweiß Barak, daß der Krieg im Libanonnicht zu gewinnen ist. Er wird abziehenund mit Syrien um Frieden verhandeln.SPIEGEL: Kann er sich auch mit den Palä-stinensern einigen?Elon: Er müßte den Mut und den histori-schen Sinn eines de Gaulle haben, so ver-giftet sind die Beziehungen mit den Palä-stinensern inzwischen. Wenn Barak, ausAngst vor einem Bürgerkrieg, keinen Sied-ler zum Abzug bewegen will, was kann erden Palästinensern dann schon anbieten?Selbst liberale Wortführer der Arbeitspar-tei halten Räumungen nicht mehr fürdurchsetzbar SPIEGEL: Wie Barak ist auch der Spitzen-kandidat der neuen Zentrumspartei, Jiz-chak Mordechai, ein ehemaliger General.Warum rekrutiert sich in Israel noch immerein großer Teil der Politiker aus der Ar-mee, warum entsteht keine breite zivileFührungsschicht?Elon: Auch die USA hatten Generäle alsPräsidenten. Aber in Amerika wurde dieGesellschaft zivil, hier wurde sie immermilitärischer. In den ersten Jahren standenbei uns ja keine Militärs an der Spitze …
184
SPIEGEL: … Staatsgründer Ben-Gurion warJurist, Israels erster Präsident Chaim Weiz-man ein promovierter Chemiker.Elon: Aber dann wurde die Armee, die we-gen der vielen Kriege als Elite galt, zumHauptreservoir für politische Talente. Diesund das israelische Wahlrecht, das zu vie-le kleine Parteien ins Parlament läßt unddas der politischen Praxis der WeimarerRepublik verhängnisvoll ähnelt, hat die zi-vile Bevölkerung in tiefe Politikmüdigkeitgestürzt.SPIEGEL: Ohne eigenen Staat für die Palä-stinenser kann es keinen dauerhaften Frie-den geben. Aber wie soll der jemals Wirk-lichkeit werden, wenn die Siedlungen nichtgeräumt werden, ja noch immer neue ille-gal gebaut werden? Elon: Ohne Freigabe vieler Siedlungenbleiben den Palästinensern nicht mehr als 10 bis 15 „Reservate“, umzingelt von israelischen Siedlern, Soldaten und Grenz-zäunen. Arafat muß seine Teilrepubliken,die wirtschaftlich und politisch nicht über-lebensfähig sind, per Hubschrauber be-reisen, begleitet von der israelischen Luftwaffe.SPIEGEL: Entscheidet die Wahl in zwei Wo-chen über Krieg und Frieden?Elon: Sie bestimmt über Frieden und Nicht-Frieden, was schlimm genug ist.Wenn Ne-tanjahu wieder gewinnt, heißt das nicht,daß es morgen schon Krieg gibt, aber dieWahrscheinlichkeit, daß es zum Kriegkommt, wird wachsen. Mit ihm an der Spit-ze der Regierung wird der Friedensvertragmit Jordanien zerbrechen, und der Frie-den mit Ägypten, der nie sehr warm war,wird noch kälter.SPIEGEL: Dabei wurde die Versöhnung zwischen Menachem Begin und Anwar el-Sadat vor 20 Jahren wie eine Erlösunggefeiert. Warum ist daraus nicht mehr geworden?Elon: Der Schlüssel für alles liegt im Ver-hältnis zu den Palästinensern. Der hun-dertjährige Krieg hat mit dem Zusammen-prall zweier nationaler Befreiungsbewe-gungen um denselben Streifen Land be-gonnen, und er endet erst, wenn wir ihnteilen, sonst explodiert die gesamte Re-gion.Auch der Frieden mit Ägypten ist da-von abhängig. Nur ein Teil des Vertrags
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
wurde erfüllt, nämlich der Abzug aus demSinai, aber nicht der andere, der einen Rah-men für eine Lösung der Palästinenserfra-ge bilden sollte. Schon damals hatte manihnen volle Autonomie in Aussicht gestellt.SPIEGEL: Israel nahm den palästinensischenNationalismus lange nicht ernst – und hatihn doch durch die Okkupation im Grun-de erst richtig stark gemacht.Elon: Eine nationale palästinensische Be-wegung gab es natürlich schon vor 1967 inder Westbank, aber sie richtete sich gegenJordanien, das das Gebiet 1949 annektier-te. Deshalb begingen die Israelis einenhistorischen Fehler, als sie das Westjordan-land an sich rissen. Sie machten das palä-stinensische Problem damit zu einem israe-lischen. Das Verhalten der Israelis seit demSechs-Tage-Krieg könnte ein ausgezeich-netes Kapitel liefern für das Buch der ame-rikanischen Historikerin Barbara Tuchmanüber „Die Torheit der Regierenden“.SPIEGEL: Wäre statt eines territorialenFlickenteppichs für die Palästinenser auflange Sicht nicht ein gemeinsamer Staatsinnvoller, mit gleichen Rechten für Israe-lis und Palästinenser?Elon: Vernünftig wäre es, aber möglichwird ein solches Modell allenfalls in sehr ferner Zukunft. Die Palästinensermüssen sicher noch viel leisten beim Auf-bau einer demokratischen Gesellschaft.Aber wir dürfen nicht nur auf sie schau-en, auch wir müssen uns ändern. Israelmuß erst einmal ein Staat für alle seineBürger werden.SPIEGEL: Wie soll das gehen, da Israel er-klärtermaßen ein jüdischer Staat ist – sosteht es schon in der Unabhängigkeits-erklärung von 1948?Elon: Diese Definition muß geändert wer-den. Israel ist wohl die einzige Demokratie,die sich gewissermaßen einer Staatsideo-logie verschrieben hat. Das ist auf langeSicht nicht mit Demokratie vereinbar. Diezionistische Idee war nötig als Ermutigungam Anfang, um all die Flüchtlinge, die her-kamen, zu einer Nation zu verbinden. Jetztmuß eine neue Entwicklungsstufe folgen:Alle müssen gleich sein, ob Jude, Muslim,Christ oder Buddhist.SPIEGEL: Das klingt schön, aber geben Siedamit nicht das ursprüngliche Ziel Theodor

Ausland
Herzls preis, eine „gesicherte Heimstätte“für die Juden zu bauen?Elon: Erstens wollte Herzl, der Vater desZionismus, nie einen „jüdischen“ Staat,sondern einen pluralistischen, säkularen,demokratischen „Judenstaat“. Und zwei-tens können Juden heute überall in derwestlichen Welt nach Wunsch und WilleJuden sein, schauen Sie nur in die USA.Zum erstenmal in der jüdischen Geschich-te sind Juden nicht mehr genötigt, sich zwi-schen erzwungener Assimilation oder demGhetto zu entscheiden. Nur in Israel lebenwir unter Zwang, hier brauche ich den Se-gen des Rabbis, um zu heiraten und michscheiden zu lassen, ja sogar um beerdigt zu werden.SPIEGEL: Jüngste Berichte deuten daraufhin, daß der Antisemitismus wieder welt-weit zunimmt. Spricht das nicht dafür, daßeine sichere Zuflucht notwendig bleibt?Elon: Ja, Juden sollen hier sicher leben können. Aber „Staatsideologien“, insbe-sondere religiös geprägte, sind auf langeSicht gefährlich. Jede Ideologie, sagte KarlKraus, tendiert am Ende zum Krieg.SPIEGEL: Was hält die auseinanderstreben-den Gruppen im Staat Israel denn nochzusammen?Elon: Wir leben in einer Demokratie, diewir gemeinsam aufgebaut haben, an derenWerte wir glauben.SPIEGEL: Mit Ausnahme der Orthodoxen …Elon: … übersehen Sie nicht, daß Israel invieler Hinsicht eine Erfolgsgeschichte ist:Die Überlebenden einer der vielleichtgrößten Katastrophen für ein Volk habenein brachliegendes Land aufgebaut; eineHigh-Tech-Wirtschaft geschaffen und einepraktisch tote Sprache wiederbelebt.Aber die Orthodoxen halten uns bestimmtnicht zusammen, sie sprengen die Ge-sellschaft vielmehr auseinander. Vor kur-zem gingen fast 200 000 Ultras gegen unser Oberstes Gericht auf die Straße,diese Fanatiker lehnen den Staat Israeldoch ab.SPIEGEL: Wenn Sie eine Abkehr von derzionistischen Idee verlangen, soll dannnoch jeder jüdische Einwanderer wie einverlorenes Kind begrüßt werden?Elon: Das Rückkehrrecht muß geändertwerden. Wir haben die kritische Masselängst erreicht, die nötig war, um einenStaat zu bilden. Es besteht heute keine
d e r s p i e g e
Elon beim SPIEGEL-Gespräch*: „Leben unter Zw
A.
BR
UTM
AN
N
Notwendigkeit mehr, Menschen aus allerHerren Länder herzuholen, außer viel-leicht aus Rußland, obwohl die Einwande-rer von dort nicht mal alle Juden sind.SPIEGEL: Etliche Ihrer Landsleute treibt dieSorge um, daß die Juden ohne Einwande-rung irgendwann eine Minderheit im eige-nen Land werden könnten – allein schonaus demographischen Gründen, da die ara-bischen Familien mehr Kinder haben.Elon: Diese Argumentation ist genausodumm wie die Warnung vor der „gelbenGefahr“. Ich schreibe gerade ein Buch überdie Geschichte der deutschen Juden im 19.Jahrhundert. Dabei gehe ich durch alle Sta-tionen ihres Kampfes um gleiche Rechte.Das Problem war doch, daß man Christsein mußte, um ein echter und guter Deut-scher zu sein, sonst wurde man als Bürgerzweiter Klasse angesehen. Wir sind da-bei, denselben Fehler zu wiederholen,wenn wir jetzt die israelischen Araber diskriminieren.SPIEGEL: Wie ethnische Konflikte eskalierenkönnen, zeigt sich derzeit auf schrecklicheWeise im Kosovo. Ein Lehrbeispiel auchfür den Nahen Osten?Elon: Mein Alptraum ist, daß die so-genannten ethnischen Säuberungen, dieauf dem Balkan stattfinden, sich hier im Kriegsfall wiederholen, wie 1948 be-gonnen.SPIEGEL: Inwieweit kann Deutschland hel-fen, den Nahost-Konflikt zu lösen?Elon: Nach den USA ist Deutschland derverläßlichste Alliierte Israels. Ich hoffe, daßwir diese Unterstützung nicht auch nochverspielen. Die Deutschen sind und bleibenzu Recht befangen gegenüber Israel. Dasspiegelt ihre geschichtliche Verantwortungwider. Aber die Schlüsselrolle behaltennatürlich die USA.SPIEGEL: Gleichzeitig gehört Deutschlandheute zu den wichtigsten Förderern despalästinensischen Aufbaus …Elon: … das ist gut und gerecht. Viel mehrkönnen die Deutschen allerdings auchnicht beitragen zur Entschärfung des Kon-flikts.SPIEGEL: Sie kennen Deutschland sehr gut,haben Sie Verständnis für den Streit überdas Holocaust-Mahnmal in Berlin?Elon: Aus dieser Klemme kann ich Ihnennicht heraushelfen. Wir haben Jad Wa-schem und andere Erinnerungsstätten ge-
baut, für Ihre müssen Sie schonselbst sorgen. Muß es wirklichein stalinistisches Maxi-Monu-ment sein? Ich fürchte, daß dieDeutschen es in jedem Fallfalsch machen. Wenn sie dasMahnmal nicht bauen, bekom-men sie Ärger. Aber wenn siees bauen, ist es auch verkehrt.SPIEGEL: Herr Elon, wir dankenIhnen für dieses Gespräch.
* Mit Redakteuren Annette Großbon-gardt und Martin Doerry in Jerusalem.ang“
l 1 8 / 1 9 9 9 185

Werbeseite
Werbeseite

Ausland
C H I N A
SchwarzeEnergie
Eine geheimnisvolle Sekte brachte Tausende Anhänger
vor der KP-Zentrale aufdie Straße – zum Schrecken
der Staatssicherheit.
Protest von „Falun Gong“-Anhängern in Peking: Drittes Auge in die Zukunft
AP
hre
Schon morgens um sechs geht es indem lauschigen Park rund um PekingsDitan-Tempel zu wie in einem Kung-
Fu-Film: Wo Chinas Kaiser einst den Göt-tern der Erde huldigten, trainieren Alteund Junge mit Schwertern, üben Schatten-boxen oder machen sich für den Tag mitGymnastik und martialischen Schreien fit.
Nur die rund 200 Menschen, die sich ander Nordseite versammelt haben, beneh-men sich anders: Ordentlich aufgereiht las-sen sie, völlig in sich versunken, ihre Hän-de um den Körper kreisen und zuckendann urplötzlich zusammen.
Sie sind Anhänger des „Falun Gong“-Kults („Rad des Gesetzes“), der bud-dhistische und taoistische Lehren aufbizarre Weise mit alten chinesischen Be-wegungsübungen („Qigong“) verbindet –zur Reinigung von Leib und Seele.
Nun hat die Sekte die KP-Führung gehörig erschreckt.Tausende ihrer Anhänger be-setzten am vorletzten Sonntagdie Gehsteige im Westen undNorden des Pekinger Regie-rungsviertels Zhongnanhai.We-nige Wochen vor dem zehntenJahrestag des Tiananmen-Mas-sakers am 4. Juni erlebte dieHauptstadt zum erstenmal wie-der einen Massenprotest. Dochanders als 1989 verlief die Kund-gebung gespenstisch ruhig, Sprechchöreund Flugblätter fehlten. Die Demonstran-ten starrten nur in stummer Anklage aufdie roten Mauern des schwerbewachtenFunktionärsghettos.
Anlaß der seltsamen Aktion rund umdas politische Machtzentrum Pekings: EineUniversitätszeitschrift in der HafenstadtTianjin hatte Anfang April die „FalunGong“-Bewegung kritisiert, und auf denProtest der empörten Anhänger reagiertedie Polizei mit Schlägen und Festnahmen.Die Sektenmitglieder forderten jetzt dieFreilassung ihrer Brüder und ein Ende derUnterdrückung: „Die Regierung soll unsendlich offiziell anerkennen.“
Völlig überrascht von dem Aufmarsch,empfing Ministerpräsident Zhu Rongji ei-nige Abgesandte, doch großmütig gab ersich nicht. Die Führung habe nichts gegenQigong einzuwenden, erklärte Mitte vori-
Sektenfü
ger Woche der Staatsrat. Aber: Die „ge-sellschaftliche Stabilität“ dürfe nicht ge-fährdet werden.
Chinas KP ist die mysteriöse Massenbe-wegung unheimlich. Immerhin war es derOrganisation gelungen, den allgegenwärti-
gen Staatssicherheitsdienst zuüberrumpeln und gut 10 000Menschen ins Zentrum von Pe-king zu schaffen.
Voller Sorge beobachten dieKommunisten, daß MillionenChinesen ihr Heil statt im Par-teiprogramm in einer der neu-en religiösen Lehren suchen,die überall im Lande wuchern.Der schnelle Wandel in Chi-nas Großstädten, die drohendeMassenarbeitslosigkeit und die
schwindende Glaubwürdigkeit der Parteihaben die Menschen verunsichert und trei-ben sie obskuren Sekten zu.
„Viele werden mit dem schnellen Wech-sel nicht fertig. Sie sehnen sich zurück nacheinem festen ideologischen Gefüge, das ih-nen einst der Marxismus-Leninismus gab“,sagt ein Pekinger Soziologe. Für die Parteiist dies eine alarmierende Entwicklung.Denn Erweckungsbewegungen waren inder langen chinesischen Geschichte oft dieVorboten von Revolte, Umsturz und demEnde einer Dynastie.
Die Grundlage des „Falun Gong“-Kultsist eine traditionelle Meditationstech-nik: Abertausende Chinesen praktizierenQigong, die „Kunst des Atmens“, um mitbedächtigen Bewegungen Geist und Ge-sundheit aufzufrischen. Mittlerweile exi-stieren 123 offizielle Qigong-Verbände mitrund 100 Millionen Anhängern.
r Li
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Der zuständige Sportverband schätzt dieZahl der „Falun Gong“-Anhänger aufknapp 16 Millionen, darunter auch Intel-lektuelle, Beamte und sogar Parteigenos-sen. Deren Vorgesetzte sehen in den Leh-ren der Gruppe nur eine Mischung aus„Aberglauben und falscher Wissenschaft“.
Führer der Sekte ist der in New York le-bende Li Hongzhi, 47. Seine Anhänger, ver-sichert er, könnten „übernormale“ Fähig-keiten erlangen, sich zum Beispiel „ohneFahrstuhl“ in die Luft erheben und mit ei-nem „dritten Auge“ in die Zukunft blicken.Guru Li, vor seiner Erleuchtung schlichterBeamter im Getreideamt von Changchun,verheißt zudem Unsterblichkeit: „Du wirstso lange leben wie der Kosmos“, beteuerter in seiner Bibel.
Das geht so: Der Meister pflanzt jedemGetreuen das „Rad des Gesetzes“ in denUnterleib, das sich unablässig dreht, „kos-mische Energie“ sammelt und „schwarzeEnergie“ ausstößt. Wer dann noch jedenTag die von Li entwickelten fünf Bewe-gungsabläufe übe, werde ein „ehrlicherMensch“ und „eins mit dem Kosmos“.
Nikotin, Alkohol, Drogen, Popmusik,Fernsehen und außerehelicher Sex sind fürLi Teufelswerk – ebenso wie Homosexuel-le, die zuerst „aussterben, denn sie ver-stoßen gegen die Natur“.
Als die Zensoren 1996 sein Buch verbo-ten, setzte sich der Meister nach Amerikaab und sammelte dort eine ständig wach-sende Gefolgschaft. Inzwischen kam derSektenchef, der seine Lehre auch imInternet verbreitet, zu der Erkenntnis,daß er eine „größere spirituelle Autorität“darstelle als Jesus, Buddha oder Mo-hammed. Andreas Lorenz
187

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

d e r s
Szene Kultur
Wesselmann-Gemälde (1964)
VG
-BIL
D-K
UN
ST,
BO
NN
19
99
A U S S T E L L U N G
LeichtbekleideteEmanzipation
Allein Paris galt den amerikanischen Künstlern der dreißiger Jahre alsEpizentrum der Avantgarde.Wer modern sein wollte, ahmte die Eu-
ropäer nach. Bis dann die Heroen der alten Welt über den Atlantik ka-men. Stars wie André Breton, Yves Tanguy oder Max Ernst flüchtetenwährend des Kriegs ins New Yorker Exil – und die US-Kollegen ließensich vom künstlerischen Selbstbewußtsein ihrer europäischen Ikonen infizieren. Bald versuchten die Amerikaner, auch selbst den Ton anzu-geben. Jackson Pollock wurde mit dramatischen Farbgießereien, den„Action Paintings“, berühmt. Robert Rauschenberg bereicherte seineAbstraktionen mit ordinären Straßenschildern oder Autoreifen. Mit die-sen „Combine Paintings“ folgte er zwar noch der Collage-Technik derKubisten, ebnete aber auch der Pop Art den Weg. Andy Warhol ließ sichin den sechziger Jahren endgültig nicht mehr von Picasso, sondern vonWaschmittel-Reklame inspirieren; Tom Wesselmann malte Frauen nochdrastischer, als die Werbung sie präsentierte: glatt, blond und nackt.Amerika hatte seinen Stil gefunden – nun blickte Europa neidisch nachÜbersee. Den weiten Weg bis zu dieser Emanzipation schildert die Frank-furter Schirn Kunsthalle in ihrer Ausstellung „Between Art and Life“ (bis11. Juli): Mit 56 Gemälden von 22 Künstlern gibt sie einen Überblick überdie amerikanische Nachkriegskunst bis 1970.
L I T E R A T U R
Abgründe der SeeleDer Schriftsteller Gerald
Candless ist tot. Er hinter-läßt: ein Haus an der Meereskü-ste von Devonshire, die verzwei-felten Töchter Sarah und Hopesowie eine äußerst erleichterteEhefrau Ursula. In dem lang-jährigen Zusammenleben mitdem gutaussehenden, überauserfolgreichen Autor ist Ursulaemotional verhungert, seelisch mehrund mehr verkrüppelt. Gerald war ty-rannisch, herablassend, egozentrisch na-hezu allen Menschen gegenüber, liebe-voll nur zu seinen Töchtern, tückischund destruktiv zu seiner Gattin.Tochter Sarah, die die Lebensgeschichteihres Vaters aufschreiben möchte, stößtbei der Suche nach seiner Familie aufWidersprüche und Lügen und mußschließlich erkennen, daß ihr Vater nichtder war, der er vorgab zu sein. Nur: Wasveranlaßte ihn, sich eine neue Identitätzu ersinnen? Sarahs Recherchen brin-gen immer neue Ungereimtheiten undschließlich die Wahrheit ans Licht.Die englische Schriftstellerin BarbaraVine alias Ruth Rendell, 69, entwickeltihre Geschichte in gewohnt souveränerManier, schließlich ist sie Spezialistin
für die Abgründe dermenschlichen Seele undgehört zu den besten Thril-lerautoren der Welt. Ent-hüllt wird das Psycho-gramm eines Mannes, der,in Schuld und Lügen ver-strickt, äußerst skrupellosvorgeht, um seine Haut zuretten. Vine schildert einenpedantischen Patriarchenmitsamt seinem rigiden Le-bensentwurf, in dem jedePerson ihre Rolle und Be-
deutung zugewiesen bekommt; siezeigt, wie emotionale Kälte die Men-schen leiden, verrohen oder gleichgültigwerden läßt, wie sich im Familienver-band Deformationen und Beschädigun-gen in immer neuen Formen von Gene-ration zu Generation fortsetzen.Gleichzeitig erzählt Vine die Geschichteeiner langsamen, stillen Befreiung. Siezeigt einfühlsam, wie Ursula langsamwieder zu einem eigenständigen Lebenerwacht nach langer, lähmender Betäu-bung. „Der schwarze Falter“ ist ein prä-zis konstruiertes Familienpuzzle: faszi-nierend, suggestiv, atmosphärisch dichtund voller Melancholie.
Barbara Vine: „Der schwarze Falter“. Aus dem Engli-schen von Renate Orth-Guttmann. Diogenes Verlag,Zürich; 560 Seiten; 46,90 Mark.
p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
M U S E E N
Verärgerte ErbinAls „einzigartig“ wurde das Beuys-
Medienarchiv 1996 bei der Einwei-hung im Hamburger Bahnhof in Berlingefeiert. Doch die Beuys-Witwe Evawar mit der Arbeit des zuständigenKurators bald unzu-frieden. Dessen Den-ken habe nicht dienotwendige Präzi-sion, die Filme seienfalsch betitelt wor-den, Vermerke zuden Werken sprach-lich und fachlich erschütternd. ImHerbst 1998 ließ dieverärgerte Erbin dasArchiv schließen –und gestattet bisheute nicht die Wie-dereröffnung. DerNoch-Generaldirektor der BerlinerStaatlichen Museen, Wolf-Dieter Dube,hat bisher eine Aussprache mit der Dame vermieden. Sie zürnt darob und findet die Situation untragbar.Von Dubes Nachfolger Peter-KlausSchuster, der wohl im August antritt,erwartet Eva Beuys zu Recht mehr Entgegenkommen.
Eva Beuys
HELLG
OTH
191

Szene
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9192
Castorf-Inszenierung „Die Dämonen“
Kino in Kürze
Szene aus „The Loss of S
F E S T I VA L S
Dämonenspukin Wien
All jene, die Frank Castorfs Theaterschon immer zum Gruseln fanden
und dabei herzlich konfus, werden esnur konsequent finden, daß sich der Regisseur an eine Theaterversion vonFjodor Dostojewskis „Dämonen“ macht
LY R I K
SeelentrösterDie Lyrikerin Ulla Hahn, 53, über dieLust am Gedicht, das Auswendiglernenund ihre neue Anthologie „Gedichte fürsGedächtnis“, die nach vier Wochenschon in die zweite Auflage geht (Deut-sche Verlags-Anstalt)
SPIEGEL: Frau Hahn, warum „Gedichtefürs Gedächtnis“?Hahn: Alle Anthologien versuchennatürlich, etwas aufzuheben, was desErinnerns wert ist. Mir gehtes darum, den Leser zu ver-locken, Gedichte wieder inseigene Gedächtnis zurück-zuholen. Und ich wünschemir, daß der Leser zu einemSprecher wird: einprägendurch lautes Lesen. Das Gedicht als Klangkörper.SPIEGEL: Sollen etwa wiederGedichte auswendig gelerntwerden?Hahn: Ich bin gegen Zwang.Deswegen rede ich liebervon „Inwendig-Lernen undAuswendig-Sagen“. Es gehtmir um die individuelle An-eignung, im Gegensatz zumAuswendiglernen: Demhaftet immer etwas Mechanisches an –und etwas von Drill.SPIEGEL: Glauben Sie wirklich, Schülerlernen freiwillig Goethe-Verse?Hahn: Mit Zensuren wird man sie jeden-falls nicht überzeugen können. Notenfür Lyrik sind fragwürdig: Immer wie-
Hahn
der erreichen mich Schüleranfragen, dieGedichte von mir zu interpretieren hat-ten und schlecht benotet wurden.SPIEGEL: Ihre Anthologie bietet das Be-kannte: viel Goethe, Heine und Hölder-lin, auch Mörike, Rilke, Benn undBrecht. Scheuen Sie nicht den Vorwurfmangelnder Originalität?Hahn: Adornos Spott, daß „gut“ gleich„bekannt“ sei, hat mich nicht dazu ver-leiten können, auf den Kanon deutscherDichtung zu verzichten. Ich wollte gera-de die „Ahnenkette großer Seelentrö-ster“, wie Bruno Hillebrand das ge-nannt hat. Außerdem finden Sie neben
den Genannten noch rund40 andere Dichter.SPIEGEL: Ungewöhnlich für eine Lyrik-Anthologiesind neben Ihren Kommen-taren Hinweise auf Inter-net-Informationen über die einzelnen Dichter. Solldas Jüngere verlocken,sich mit Gedichten zu be-fassen?Hahn: Und umgekehrt: Derklassische Lyrikleser sollermutigt werden, diesesMedium zu nutzen – ichhabe damit gute Erfahrun-gen gemacht.SPIEGEL: Können Sie selbstGedichte auswendig?
Hahn: Am liebsten sind mir Hölderlins„Lebenslauf“ und „Hälfte des Lebens“– und Eichendorffs „Mondnacht“.SPIEGEL: „Und meine Seele spannte /Weit ihre Flügel aus …?Hahn: … Flog durch die stillen Lande, /Als flöge sie nach Haus.“
B.
FR
IED
RIC
H
„Place Vendôme“. Sie hat in Paris, neben dem legendären Hotel Ritz, die exklusivsten Läden der exklusivsten Juweliereder Welt zu bieten: Wer da als Ehrenmann im Geschäft bleibenwill, darf nicht in Verdacht kommen, mit Diamanten zweifel-hafter (etwa sibirischer) Herkunft zu handeln. Catherine De-neuve in der Rolle einer depressiven, alkoholkranken Juwe-lierswitwe, deren Gatte wegen solcher Verdächtigungen Selbst-mord begangen hat, muß auf der Suche nach der Wahrheitdurch Erinnerungslabyrinthe tappen.Vieles darf dabei im Zwie-licht bleiben, da der Film von Nicole Garcia ganz und gar aufdie sublime Seelenschauspielerei seiner Primadonna zuge-schnitten ist.
exual Innocence“
TO
BIS
„The Loss of Sexual Innocence“ ereignete sich, wie man aus dem Religionsunterricht weiß, im Garten Eden und mit ir-reparablen Folgen bis auf den heutigen Tag. Der eigenwilligebritische Filmemacher Mike Figgis („Leaving Las Vegas“) er-zählt von einem eigenwilligen britischen Kameramann namensNic, der sich die Geschichte von Adam und Eva in delikaten Bildern zusammenphantasiert, erzählt ferner von dessen Kind-heit, von dessen Eheproblemen, von einem italienischen
Zwillingsmädchenpaar und vom Tod eines afrikanischen Jun-gen bei Dreharbeiten in der Wüste. All das kommt als assozia-tiver Bilderfluß daher, sehr poetisch, sehr prätentiös, macht jedoch den armen Nic immer depressiver, was niemanden wun-dern wird.

Kultur
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
T. A
UR
IN
Am Rande
Szene aus „Doktor Schiwago“
IMPR
ES
S
Tränenbad
Nein, diesmal kein Wortüber Susan Stahnke, 31,die kluge Blonde mitden großen Augen undden noch größeren Plä-nen. Nichts darüber, daßsie zwar immer nochkein Hollywood-Star ist,jetzt aber zumindest ei-nen spielen soll – näm-lich Zsa Zsa Gabor, 80,und kein bißchen geliftet. Verschwie-gen sei, daß Frederic Prinz von An-halt, Gabors derzeitiger Ehemann,unserer armen Stänkie mit Adoptiongedroht hat („in Las Vegas“). KeinerErwähnung wert, daß sie die väterli-chen Gefühle des feschen Blaublü-ters zwar galant zurückwies („weilich doch meine eigenen Elternhabe“), den Pluralis majestatis aberdennoch schon mal ausprobierte:„Wir denken darüber nach“, sprachSusan – über das Filmangebot undbestimmt auch darüber, wieso dieseTopmeldung nicht auf der Titelseiteder „Bild“-Zeitung stand, wo sie hin-gehört, sondern bloß auf Seite 5.Auch ihre Ex-Kollegin Eva Herman,die andere ehrgeizige Blondine vonder „Tagesschau“, möchte über Su-san S. nichts mehr sagen. Bereitwilli-ger spricht sie über den Krieg im Ko-sovo: „Guten Abend, meine Damenund Herren“, liest Frau Herman,dann folgt der übliche Tagesschau-der, die Abenddosis Krieg.Leider kommt man damit noch nichtin die Zeitung. Das gelingt eher so:„Derzeit“, verkündete Frau Hermanin der Münchner „Abendzeitung“,„gehe ich nach den Nachrichten oftraus und weine.“ Arme Eva! Frühermußte sie sich zur Ego-PR noch inder Badewanne fotografieren lassen,indes, O-Ton Herman, „alte Gedan-ken und Erlebnisse sind für mich einSchritt zurück“. Darum badet siejetzt lieber öffentlich in den eigenenTränen. Denn schlimmer als der Mel-dungshorror im Studio ist nicht etwader ganz reale Krieg im Kosovo.Schlimmer sind Selbstdarsteller, dienicht in der Zeitung stehen.
– fängt der Romanklassiker doch mitden Sätzen an: „Hei, das ist ein schau-rig Klingen. Doch wer mag den Sinnverstehn …?“ Castorf, der zuletzt ehermilde Theaterwilde aus Berlin, steuertmit seiner „Dämonen“-Premiere andiesem Sonntag im Wiener Burgtheatereinen ersten großen Theaterstreich zuden Wiener Festwochen bei.Das Traditionsfestival, seit jeher Kon-kurrenzspektakel zu den renommiertenSalzburger Festspielen im Hochsom-mer, dauert diesmal vom 7. Mai bis 20.Juni und präsentiert diverse große
Opernproduktionen – den Auftakt ma-chen in diesem Jahr unter NikolausHarnoncourts musikalischer Leitungdie Wiener Symphoniker mit der „Fle-dermaus“ in Jürgen Flimms Regie.Aus dem bunten Programm mit Gast-spielen nationaler und internationalerTheatertruppen ragt Peter Zadeks jüngste Regietat heraus: Sein „Ham-let“ mit Angela Winkler in der Titelrol-le, von Mittwoch an in Straßburg be-reits vorab zu sehen, feiert am 21. Maiim Wiener Volkstheater offizielle Pre-miere.
U R T E I L E
Fortsetzung folgt nichtDas Buch „Laras Tochter“, die Fort-
setzung des Romans „Doktor Schi-wago“, kommt nicht mehr in den Han-del. Der Bertelsmann Verlag unterlagjetzt beim Bundesgerichtshof (BGH)dem Feltrinelli-Verlag, der die Rechtean Boris Pasternaks „Doktor Schiwago“besitzt. Das Oberlandesgericht Karlsru-he hatte die Vermarktung des Buchesverboten – mit der Begründung, daß dieFortsetzung sich so eng an PasternaksVorlage anlehnte, daß sie keine eigen-schöpferische Leistung darstelle. DerBGH hat das Urteil gegen „Laras Toch-ter“ jetzt bestätigt. Die Grundsätze die-ser Entscheidung sind auch auf Fortset-zungen anderer Werke übertragbar: Wer einen Roman oder einen Film fort-schreiben will, muß vorher ein Fortset-
zungsrecht erwerben – oder ein gänz-lich neues Werk schaffen, gegenüberdem das Original „verblaßt“. Der Autorvon „Laras Tochter“, ein Brite mit demPseudonym Alexander Mollin, hätte esahnen können: Er ist Rechtsanwalt.
193

Kultur
194
S P I E G E L - G E S P R Ä C H
„Es gibt keine Erlösung“Michael Naumann, Staatsminister für Kultur, über die bevorstehende
Bundestagsentscheidung zum Berliner Holocaust-Mahnmal, den Kosovo-Krieg und die Politisierung der intellektuellen Szene der Berliner Republik
SPIEGEL-Gespräch*: „Niemand wird in den Stand der Unschuld zurückfallen“
SPIEGEL: Herr Staatsmini-ster Naumann, wachen Siemanchmal morgens mit demGedanken auf: Wäre ichdoch bloß in New York ge-blieben?Naumann: Danke der Nach-frage. Lassen wir sie einfachim Raume stehen.SPIEGEL: Jetzt ganz sachlich:Werden nach den Entwür-fen „Eisenman pur“, „Ei-senman II“, „Eisenmanplus“, „Eisenman III“ und„Eisenman IV“ womöglichnoch die Varianten V,VI undVII ins Rennen geschickt –kurz, haben Sie eigentlicheine einigermaßen gefestig-te Vorstellung davon, wer,wann und wie endgültigüber das Holocaust-Mahn-mal in Berlin entscheidet?Naumann: Es ist überra-schend, ausgerechnet beimSPIEGEL diesen Hang zumdeutschen staatlichen Dezi-sionismus zu entdecken. Ei-gentlich ist die Sache ganzeinfach: Bauen wir einMahnmal für die ermorde-ten Juden Europas odernicht? Diese Frage wird inden nächsten Tagen, ich hof-fe, noch im Mai, im Deut-schen Bundestag beantwor-tet werden. Die wirklicheDebatte geht danach darum,wie dieses Mahnmal ausse-hen soll. Hier wird es wie-der schwierig, denn einigeinstrumentierten die ästhe-tische Frage, weil sie dasMahnmal prinzipiell ableh-nen. Andere, wie auch ich,waren der Meinung, daßmoderne Kunst diese Auf-gabe prinzipiell nicht lösenkann. Die Mehrheit der Bevölkerung hatdie Feinheiten der Debatte sowieso nichtverfolgt. Das ist eben so.SPIEGEL: War der Streit bis jetzt also einereine Mediendebatte?Naumann: Öffentliche Debatten sind in derRegel Mediendebatten. Was die Bevölke-
Naumann beim
M.
WEIS
S /
OS
TK
REU
Z
rung zu diesen Themen wirklich denkt,dürfte kaum herauszufinden sein.Auch dieDemoskopie hilft da wenig. Dennoch istdie Würde der Debatte eigentlich nie ver-
* Das Gespräch führten die Redakteure Henryk M. Bro-der und Reinhard Mohr in Berlin.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
lorengegangen. Es gab nur ganz wenige Mo-mente, die zeigten, wie die Beschäftigungmit diesem Thema, ganz gegen den Willender Beteiligten, die Sprache und damit auchdas Bewußtsein verbiegen kann. So sagteetwa der Leiter einer KZ-Gedenkstätte in einer öffentlichen Anhörung, ein zum

Mahnmal gehörendes „Haus der Erinne-rung“ sei ein „antifaschistischer Durchlauf-erhitzer“ – wenn ich diesem Wort hinter-herlausche, wird mir bang und bänger.SPIEGEL: Und schon sind wir wieder mitten-drin im Dilemma der zehnjährigen Dauer-debatte, die einfach kein Ende nehmen will.Naumann: Einen richtigen Erkenntniswegzu diesem „falschen“ Ereignis der Ge-schichte wird es nie geben.SPIEGEL: Und heraus auch nicht. Aber gibtes denn jetzt im Deutschen Bundestag we-nigstens eine Mehrheit, die das Mahnmalwill, wie immer es im einzelnen gestaltetsein mag?Naumann: Ich glaube, es wird einen frak-tionsübergreifenden, mehrheitsfähigen An-trag geben, der einem Holocaust-Mahnmalin Berlin am dafür vorgesehenen Platz un-weit des Brandenburger Tors zustimmt.Und dann wird, mit großer Wahrschein-lichkeit, in einer weiteren Abstimmungeine Präzisierung dieses Denkmals zur Ent-scheidung vorgelegt, wobei es sicher ver-schiedene konkurrierende Gruppenanträ-ge geben wird – von völliger Ablehnung al-ler Entwürfe über die Eisenman-Variantenbis zum allerdings seltsamen Vorschlag
Auschwitz-Häftlinge (1944), flüchtende Kosovo-Albaner: „Vertreibung und Tötung aus ethnischen Gründen“
JAD
WAS
CH
EM
DPA
Richard Schröders, das Gebot „Nicht mor-den!“ in den Mittelpunkt zu stellen.SPIEGEL: Also: Im Prinzip ist alles offenaußer einem: Die Debatte geht weiter.Naumann: Nicht wirklich. Erstens: DasMahnmal wird gebaut. Davon gehe ich aus.Zweitens: Einer dieser präzisierenden An-träge wird obsiegen. Das kann auch mit ei-ner relativen Mehrheit geschehen. Die bau-liche und konzeptionelle Realisierung desMahnmals sollte dann einer Stiftung obliegen. Wenn, hoffentlich noch vor derSommerpause, die Entscheidung gefal-len ist, wird mit dem Bau im Jahr 2000 be-gonnen.SPIEGEL: Dennoch gibt es weiter Zweifel.Ignatz Bubis hat Ihnen gar unterstellt, Siehätten das Projekt auch finanziell in solcheDimensionen getrieben, daß es immer un-
wahrscheinlicher werde: „So kann man esauch killen“, sagte er.Naumann: Das bedaure ich, weil ich zuvormit Ignatz Bubis ganz einig war. Ich habeihm geschrieben, daß ich mir den von ihmsuggerierten zynischen Machiavellismusgewiß nicht antrainiert habe – und wenn esanders wäre, würde ich die politischeSphäre verlassen. Daraufhin hat er mirmitgeteilt, ich wisse ja, daß er manchmalprovoziere, um etwas zu Ende zu bringen.Sehr nett, danke.SPIEGEL: Könnte es aber nicht doch sein,daß schließlich die ganze Sache scheitert?Und worin läge eigentlich der Schaden,wenn das Mahnmal nicht gebaut würde?Naumann: Ich bin gegen diese semantischenTricks einer hypothetischen Argumenta-tion. Ob das Mahnmal gebaut wird odernicht: Das Verbrechen des Holocaustbleibt. Es wird – so oder so – keine ästhe-tische Erlösung geben, keine Epiphaniedes gereinigten Geschichtsbewußtseins,niemand wird in den Stand der Unschuldzurückfallen. Mein eigener Lernprozeß hatmir gezeigt, daß es, bei allen theoretischen,kunstkritischen Bedenken einen legitimenPlatz für staatliches Gedenken geben soll-
te. Intellektuellen mag das als schwer hinzunehmender Gedanke erscheinen.Normalerweise sind Denkmäler ja nichtsanderes als marmorierte Schlußpunkte ei-ner markanten, dazu noch „heroischen“Epoche. Das Drama des Holocaust aberwird niemals derart abgeschlossen sein –deshalb die berechtigten Einwände gegenein Monument. Doch der Staat, und das habe ich gelernt, hat eine legitime symbolische Prärogative, ein Vorrecht,den unabschließbaren historischen Re-flexionsprozeß für alle sichtbar zu beglei-ten und zu fördern – auch durch ein künst-lerisches Mahnmal als Stätte der Erin-nerung.SPIEGEL: Kommen wir zur Gegenwart. „Niewieder Krieg!“ habe er gelernt, sagteAußenminister Joschka Fischer anläßlich
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
des Nato-Angriffs auf Serbien, aber auch:„Nie wieder Auschwitz!“ – Nie wieder Völ-kermord, wie er im Kosovo droht. Ist dies,im Lichte der Mahnmal-Debatte, eine un-zulässige Wortwahl, eine Instrumentalisie-rung und Relativierung von Auschwitz?Naumann: Zunächst: Es ist kein Zufall, daßin meinem Konzept des „Hauses der Erin-nerung“ als Teil des Mahnmals ein „Geno-cide Watch Institute“ vorgesehen ist, eine„Völkermord-Vorwarn-Station“. Es hatnach dem Holocaust, nach 1945, ungefähr60 Genozid-Versuche oder gar vollzogeneMordaktionen an einem ganzen Volk oderan Ethnien gegeben – am schlimmsten inPol Pots Kambodscha Mitte der siebzigerJahre. Im Kosovo findet sicher kein zweiterHolocaust statt, doch in der Völkermord-Konvention der Vereinten Nationen wer-den auch die gewaltsame Trennung vonKindern und Eltern, Männern und Frauen,Ghettoisierung,Vertreibung und Tötung ausethnisch-rassischen Gründen als Merkma-le des Genozids angeführt. Ein Überleben-der des Holocaust hat diese Uno-Defini-tion von Völkermord formuliert.SPIEGEL: Jüngst protestierten Holocaust-Überlebende in einem offenen Brief an
Fischer und Scharping „gegen eine neueArt der Auschwitz-Lüge“. Könnte es sein, daß mit der historischen Singulari-tät der Shoah die Meßlatte für Völker-mord derart hochgelegt wird, daß nunMenschenschlächter aller Art bequem darunter hindurch spazieren können?Anders gefragt: Gibt es auch die um-gekehrte Auschwitz-Keule, die blind macht für Massenverbrechen in der Ge-genwart?Naumann: Wenn es ein politisches Ver-mächtnis des Holocaust gibt, dann dies:den Begriff des Völkermordes nicht unhi-storisch einzuengen und statt dessen eineSensibilisierung der Öffentlichkeit für jeneHerrschaftsstrukturen und diktatorischenTendenzen zu stärken, die immer wiederdie Gefahr ideologisch legitimierter Akte
195

Kultur
Nato-Führer Tony Blair, Wim Kok, Bill Clinton, Gerhard Schröder*: „Das Trauma des letzten Kriege
Architekt Eisenman, Mahnmal-Modell: Bald ent
von Gewalt und Terror heraufbeschwören.Dazu reicht es nicht, die Symbolik vonAuschwitz zu zitieren.SPIEGEL: Wie hat sich denn, auch vor dem Hintergrund des Kosovo-Krieges, IhrBild von der intellektuellen SzeneDeutschlands verändert, seit Sie Ihr Amtangetreten haben?Naumann: Vor knapp einem Jahr habe ichden Intellektuellen zugerufen: Kommt her-aus aus euren Schwermutshöhlen, und en-gagiert euch wieder in praktischer Politik.Ich hätte mir einen besseren Anlaß als Ko-sovo gewünscht, wer nicht? Das deutscheFeuilleton ist jedenfalls politischer als zuZeiten des Bosnien-Konflikts. Damals ka-men an die 200000 Menschen ums Leben,und die vorherrschende Haltung war: Dasgeht mich nichts an, da blicke ich nichtdurch.SPIEGEL: Liegt die ungleich größere Anteil-nahme heute aber nicht vor allem daran,daß die Amerikaner und die Nato, alteLieblingsfeinde der kritischen Intellektu-ellen, die Bühne betreten haben – und da-bei auch noch Krieg führen?Naumann: Mag sein. Das verblüffendste die-ser Tage ist freilich die Leichtfertigkeit, mitder unserer Regierung von der CDU vor-geworfen wird, willfährig gegenüber Wa-shington zu sein. Es gibt eben einen linkenund einen rechten Anti-Amerikanismus,und seine Wurzeln reichen tief in unsereGeschichte. Die Uno jedenfalls hat im Bos-nien-Konflikt kläglich versagt. Die Uno-Truppen hatten offenkundig keinen klarenAuftrag und kein durchdachtes Konzept.Bei Srebrenica und anderswo hat die Weltschlicht und ergreifend zugeschaut, wieTausende muslimische Zivilisten von ser-
196
bischen Einsatzkräften niedergemäht wur-den. Die Situation hat sich geändert. Heu-te wird zum erstenmal in der Nachkriegs-geschichte eine militärische Aktion unterBerufung auf die Menschenrechtserklä-rung und die UN-Völkermord-Konventiondurchgesetzt. Das sind ja nun tatsächlichmoralische wie intellektuelle Errungen-schaften der westlichen Gesellschaften. Siekönnen mißbraucht werden. Aber sie sindkritische Hürden vor nackter Interessen-politik.
SPIEGEL: Es gibt aber auch intellektuelleStellungnahmen, die die Katastrophe aufdie ganz große Leinwand projizieren.So hat der Präsident des deutschen PEN,der Schriftsteller Christoph Hein, die Gefahr eines Dritten Weltkrieges be-schworen. Das heißt, die einen wollen sich
* Am 25. April in Washington.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
„ihr“ Auschwitz nicht weg-nehmen lassen, und die anderen flüchten in derNot zur alten deutschenSehnsucht nach der Apo-kalypse.Naumann: Apokalypse heißtübersetzt Offenbarung.Ihre seherischen Vertretersagen: Wir kennen dieWahrheit der Weltläufteund die Vergangenheit derZukunft – die immanente,die säkulare Apokalypseals Vollendung der Ge-schichte. Beim Weltunter-gang applaudiert sich derProphet zuletzt: Er hatrecht gehabt.Andererseits,und das spricht für Hein,ist es schon richtig, daß ein Schriftsteller mahnendübertreiben und zuspitzendarf.SPIEGEL: Ist die, alles in al-lem, weitaus weniger hy-sterische Debatte, vergli-chen etwa mit den Ausein-andersetzungen während
des Golfkriegs 1991, vielleicht auch ein Zei-chen jener erwachsen gewordenen „Berli-ner Republik“?Naumann: Die aparte Mischung der Geg-ner des militärischen Eingreifens der Na-to – Wiglaf Droste, Alfred Dregger, AliceSchwarzer – trägt dazu ihren Teil bei.Das wirkt auf mich wie die unterhaltsameMixtur einer Fernseh-Talkshow. Das bunte Ensemble unserer Talkshow-Kul-tur signalisiert: Jeder darf was sagen. Je-der kann was sagen, und das ist eigent-
lich wunderbar. Hier kön-nen althergebrachte Posi-tionen ohne Gesichtsver-lust verlassen oder auchbeibehalten werden, ganznach Lust und Laune undkraft des eigenen Argu-ments. Das führt anderer-seits natürlich auch zuchaotischen Verwirbelun-gen der öffentlichen Mei-nung, die Außenstehendedurchaus irritieren können.SPIEGEL: Und mittendrin dierot-grüne Regierung alsSpeerspitze des neuen Bel-lizismus …Naumann: … nein, jeder,aber auch jeder in der Re-
gierung ist ebenso unglücklich über dieseEntwicklung wie, frei nach Willy Brandt,alle Bürgerinnen und Bürger „draußen imLande“. Das Trauma des letzten Kriegessitzt sehr tief. Die BundesrepublikDeutschland ist alles andere als ein Hortdes Bellizismus.SPIEGEL: Herr Naumann, wir danken Ihnenfür dieses Gespräch.
s sitzt tief“
AP
schieden?
REU
TER
S

Werbeseite
Werbeseite

Kultur
M U S I K
Halleluja mit Hawaii-GitarreDie Oper Chemnitz wartet mit einer Trouvaille auf: Erstmals
seit der New Yorker Premiere 1937 wird sie Kurt Weills gigantisches Bibelspektakel „Der Weg der Verheißung“ aufführen.
New Yorker Inszenierung „The Eternal Road“ (1937): Highway zwischen Himmel und Hölle
Regisseur Heinicke: Opus drastisch beschnitte
Abraham ist schon aus dem Schnei-der, Mose noch in der Mache.Aaron kommt gerade zur Anprobe:
Die Frontpartie sitzt, der Rücken schlab-bert. An Jesajah und Jeremiah muß erstMaß genommen werden. In der Kostüm-abteilung der Oper Chemnitz wird derzeitdie Bibel nach Stich und Faden ausgelegt.
Die Roben der biblischen Könige Davidund Salomo, schwere, burgunderrote Ge-wänder aus Samt und Seide, hängen fertigan der Stange. Auch die derben, kut-tenähnlichen Überwürfe für die Sklavenbaumeln bereits auf Bügeln.
Hier, bei den Chemnitzer Kleiderma-chern, soll bis Ende Mai fast das halbe Per-sonal des Alten Testaments ausstaffiertwerden: Saul und Samuel, Jakob und Jo-sua, Mirjam und Rahel, dazu ein Rabbi,ein Götzenverkäufer, weiße und schwarzeEngel und drei Chöre; insgesamt müssenfür ein einziges Werk fast 500 Roben fer-tiggestellt werden. 34 Schneiderinnen, Fär-
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9198
berinnen, Büglerinnen, Schuh- und Putz-macher teilen sich seit über einem Monatdiese immense Arbeit. Für die Kostümewerden, nach Entwürfen des israelischenMalers David Sharir, rund eineinhalb Ki-lometer Stoff verschnitten, vernäht undverknotet, in 15 Varianten eingefärbt, ge-säumt, gepaspelt, geplättet.
Im Chemnitzer Malsaal liegen inzwi-schen zwei Horizonte und sechs exotischbemalte Prospekte zum Trocknen aus:
Schleiernessel und Operafoliebis zu einer Größe von 11,5 mal21 Metern. Modelliererinnenspachteln aus riesigen Styropor-würfeln ein Kalb, um das, wennes erst vergoldet auf der Bühnesteht, die Juden ihren berüchtig-ten Tanz aufführen werden.
In Chemnitz proben seit Wochen die 62 Mitglieder desOpernchores, im benachbartenLeipzig die 30 Sänger des Syn-agogalchores, im polnischen Kra-kau die 48 Choristen der Oper:Getrennt üben sie alle dasselbeStück für denselben Event.
Auch die Robert-Schumann-Philharmonie, das Hausorche-ster des Chemnitzer Musikthea-ters, paukt ungewohnte Noten.Letzte Woche stimmten sich vorOrt erstmals die Solisten ein.Bald reisen auch die Gesangs-stars von außerhalb an. Am 31.Mai werden sich erstmals alleBeteiligten treffen, fast 200 Mit-wirkende allein auf der Bühne.
Dann, prophezeit der Chem-nitzer Generalintendant RolfStiska nicht ohne Stolz undBammel, „fängt der Laden hieran zu kochen“, dann „beginntder Countdown zum bislanggrößten Abenteuer dieses Thea-ters“, dann – keine falsche Be-scheidenheit – setzt die sächsi-sche Mittelklassenbühne zumSprung in die Musikgeschichtean: Am 13. Juni wird hier erst-mals seit 1937 „Der Weg der Ver-heißung“ beschritten – der bis-lang dornige Weg eines tönen-den Monstrums.
Denn was der Komponist KurtWeill (1900 bis 1950) da auf einenText von Franz Werfel (1890 bis1945) über rund 1500 Partitur-seiten notiert hat, sprengt alleMaße, Stile und Gattungen – einUnding nach Anspruch und Auf-wand.
„Der Weg der Verheißung“ istkeine Bilderbuch-Oper mit Soapund Action, aber auch kein Ora-torium für gebenedeite Ohr-muscheln. Er ist ein Highway des theatralischen Größenwahnsund führt, über mehr als sechs
KU
RT W
EIL
L F
OU
ND
ATIO
N
n
W.
BELLW
INK
EL

Werbeseite
Werbeseite

Kultur
AP
AKG
Komponist Weill, Textdichter Werfel„Das widerlichste Literatur-Ferkel“
Stunden, vom Himmel zur Hölle und vonder Kirchenorgel zur Hawaii-Gitarre.
Dieser philharmonische Koloß hatnichts vom ordinären Drive der„Dreigro-schenoper“,Weills immergrünem Gassen-hauer. Statt dessen klingt darin Mahler anund, gewiß seltsam, Händels „Messias“,Mendelssohn ist rauszuhören und, nur we-nige Takte später, Strawinskis „Wüstling“.
Die kuriose Mixtur untermalt die altte-stamentarische Geschichte der Juden imZeitraffer. Eingebettet ist die Historien-show in eine zeitnahe Szenerie: Die jüdi-sche Gemeinde eines Dorfes versammeltsich, von Pogromen geängstigt, in ihrerSynagoge. Statt zu beten, beschwört derRabbi die Vergangenheit – Auftakt zurabendfüllenden Rückblende in die Ge-schichte der göttlichen Verheißung.
Als Weill 1934 daranging, Werfels heili-ge Schrift zu vertonen, war der Stoff brand-aktuell: die Nazis an der Macht, der Holo-caust am Horizont. Als Regisseur war be-reits der legendäre Theaterpapst Max Rein-hardt ausgeguckt worden.
Die wachsende Judenhetze hatte die dreiKünstler ins Exil getrieben, „Der Weg derVerheißung“ schien versperrt. Doch inNew York, Weills Zufluchtsort, hatte Mey-er Weisgal, der Initiator des Massenspek-takels, eine sechsstellige Dollarsumme ge-
Opernhaus Chemnitz: „Der Laden fängt an zu
sammelt und das Manhattan Opera Houseals Premierenbühne aufgetan.
Der Bühnenbildner Norman Bel Ged-des, ein Freund gigantischen Budenzau-bers, wollte indes eine so aufwendige, überfünf Etagen geklotzte Kulisse zimmern,daß der Guckkasten nicht reichte. Darauf-hin ließ er, um Raum zu gewinnen, dasFundament aushöhlen. Bei der Sprengungwurde eine Springquelle aktiv, die alle De-korationen vernichtete. Das Theater mach-te Konkurs. Aus der Traum.
Von wegen. Weisgal ging abermals bet-teln und bekam das Geld ein zweites Malzusammen.Aber als die Proben begannen,gab es für die vielen Musiker keinen pas-senden Orchestergraben mehr. Was tun?Die aufwendigen Instrumentalparts wur-den einfach vorab auf Tonträgern festge-halten und später, bei der Premiere am 4.
200
Januar 1937, über Boxen eingespielt. Livewar nur ein Häuflein aufrechter Musikan-ten am Werk – Halleluja aus der Konserve.
Und wenn schon: Der NobelpreisträgerAlbert Einstein machte sich auf einer Galazum Fürsprecher von „The Eternal Road“.Weills Ehefrau Lotte Lenya, die legendäreJenny der „Dreigroschenoper“, übernahmdie Rolle der frommen Mirjam. Die Kritikjubelte.
Gleichwohl schlingerte die ManhattanOpera durch den enormen Aufwand ständigam Rande des Bankrotts, und wegen derGagen waren sich auch die Macher des Pro-jekts immer heftiger in die Haare geraten.
Regisseur Reinhardt,wetterte der enttäuschteKomponist, sei „faul“, ein„müder Schloßherr“ und„ein widerlicher Reklame-geist“: „Sein Respekt vorGeld kotzt mich schon lan-ge an.“ Noch schlimmertraf Weills Wut die Veran-stalter und ihre „aufgelegtePleite“: Er habe sich „vondiesem Saupack schon lan-ge genug an der Nase her-umführen lassen“, es sei„grauenhaft, was die ma-chen“, und „eine unglaub-liche Schweinerei“. Amheftigsten aber krakeelte
Weill gegen den Textdichter: „Werfel“,tobte er, sei „so ungefähr das widerlichsteund schmierigste Literatur-Ferkel, das mirbegegnet ist“.
Der Rest des kuriosen Unternehmens ist– authentische – Räuberpistole. Im Mai1937 macht das Opernhaus nach 153 Auf-führungen zum zweitenmal Pleite.Als überNacht der Strom abgeschaltet wird, ver-schwindet, wie auch immer, ein Großteilder Noten von den Pulten. FotografischeAufnahmen, die die Lenya von Weillshandschriftlicher Notation gemacht hat,erweisen sich weitgehend als unbrauchbar.Eine angeblich komplette Tonaufnahmebleibt verschollen. Es gibt, kaum zu glau-ben, bis heute nur eine aus Druckmate-rial, Handschriften, Skizzen und New Yor-ker Tondokumenten rekonstruierte Ge-samtpartitur – ein monströses Puzzle.
kochen“
W.
BELLW
INK
EL
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Und nun darf ausgerechnet die OperChemnitz, die rührige Provinzbühne amRande des Erzgebirges, dieses vermaledei-te Bibeldrama zusammensetzen, erstmalsin Werfels deutschsprachigem Original; siewird damit das internationale Kurt-Weill-Jahr zum 100. Geburtstag des Komponi-sten eröffnen und „bereitet sich“, wieOberbürgermeister Peter Seifert kundtut,„auf ein großes internationales Ereignisvor“, mit Richard von Weizsäcker alsSchirmherr und Gästen aus aller Welt –wahrlich, „Der Weg der Verheißung“macht wundersame Umwege.
Dabei hatte die New Yorker Kurt WeillFoundation for Music, seit dem Tod derKomponisten-Witwe Lenya 1981 Gralshü-terin des Nachlasses, zunächst diverse In-teressenten an der Hand: die Staatsoperin Berlin, die Opern in Stuttgart, in Bir-mingham, in Weills Geburtsstadt Dessauund Bühnen in Israel. Chemnitz war al-lenfalls als ein Koproduzent im Gespräch.
Doch die meisten Kontakte scheiterten,entweder an den hohen finanziellen An-forderungen der Aufführung oder an denAuflagen der Foundation, die sich als eben-so geschäftstüchtiger wie sendungsbewuß-ter Lizenzgeber weitgehende Mitsprache-rechte vorbehielt. So verlangte sie eine in-ternational repräsentative Premiere mitAuslandsgastspielen, eine abgesicherte Fi-nanzierung und Mitbestimmung in künst-lerischen Fragen. Intendant Stiska: „Keinebequemen Partner.“
Inspizienten aus New York besichtigtendie Bedingungen in Chemnitz, rechnetendie Kalkulationen nach und terminiertenmit den Sachsen den Spielplan: So soll dieNeuinszenierung mindestens zwölfmal inChemnitz, sechsmal in der New YorkerBrooklyn Academy of Music, siebenmal inTel Aviv und je dreimal in der KrakauerOper und, als deutscher Beitrag bei derExpo 2000, im Opernhaus Hannover auf-geführt werden. An den insgesamt mehrals sieben Millionen Mark Produktions-kosten werden sich die Stadt Chemnitz,das Land Sachsen und das Auswärtige Amtbeteiligen.
Eine wirklich vollständige Version desumraunten Opus wird es allerdings auchzum Weill-Jahr nicht geben. Zwar habendie Arrangeure den musikalischen Anteilweitgehend belassen, aber Werfels redseli-ge Story drastisch beschnitten. „Mehr alsvier Stunden Aufführung“, sagt der Chem-nitzer Regisseur Michael Heinicke, „sinddem heutigen Publikum nicht zumutbar“,sonst würde das Stück „manchmal auchgefährlich durchhängen“, schließlich sei„Weill kein Wagner“.
Weills New Yorker Nachlaßpfleger ha-ben die Eingriffe zwar akzeptiert. Gleich-wohl entsenden sie zu den Schlußprobeneinen Aufpasser, der sich im gelobten Landder Musik kritisch umhören und die Ger-mans notfalls ins Gebet nehmen soll. Die-ser Herr sei mit ihnen. Klaus Umbach

Werbeseite
Werbeseite

202
Kultur
S C H A U S P I E L E R
„Einen Alien spielen – das wär’s“Zickige Geliebte oder patente Mutter, Alkoholikerin oder
Schimanski-Erotik widerstehende Staatsanwältin – kaum eine Darstellerin ist derzeit in so verschiedenen Rollen zu sehen wie Suzanne von Borsody.
F. W
EIS
S /
FO
TEX
Borsody in „Dunkle Tage“*Selbstbehauptung im Scheitern
AR
D
lerin Borsody: Anrührende Eigenheit
Als Hans Castorp anfängt, sich im-mer heilloser in die zeitverschlin-gende Welt des Zauberbergs zu
verstricken, erinnert sich Thomas MannsRomanheld an ein Gesicht aus Jugend-tagen. Es sind die Züge seines Mitschülers,dessen bloßer Name Exotik und Vertrauteszauberhaft verbindet: Pribislav Hippe.
Die Augen geben Castorp die Vorstel-lung von Ferne und Gebirge, deren etwasschiefer Schnitt bringt JugendschwarmHippe den Spitznamen „der Kirgise“ ein.Und wenn der hanseatische Held den Rei-zen der russischen MadameChauchat erliegt, dann ist dieLiebe von dieser kirgisischenSehnsucht mitgeprägt.
Im Zauberberg der Fernseh-fiktionen kommen Physiogno-mien, die an Ferne erinnern,eher selten vor. Dort regieren dieIdeale rundäugiger Hübschheit,die Vorstellung, daß ein Antlitzschnell lesbar sein soll. Seicht-heit sucht sich eigene Gesichter.
Wohl deshalb fällt die Schau-spielerin Suzanne von Borsodydem Zuschauer sofort auf. Obsie, wie in dieser Woche, in Mar-garethe von Trottas Film „Dunk-le Tage“ eine Alkoholikerinspielt oder in der vor kurzemgesendeten TV-Komödie „Ichliebe meine Familie – ehrlich“eine patente Mutter gibt, dieFrau mit den Kirgisenaugen be-sticht schon äußerlich durcheine anrührende Eigenheit. Daweigert sich jemand sichtlich, inKlischees aufzugehen.
Es ist nicht allein ihr Ausse-hen, das die schöne Frau her-aushebt. Die Schauspieler- Toch-ter – ihr ungarischstämmigerVater Hans von Borsody istebenso Mime wie ihre MutterRosemarie Fendel – kann sichauch darstellerisch unverwech-selbar machen. An ihrem Auf-tritt diese Woche in „DunkleTage“ läßt sich zunächst studie-ren, wie die Selbstbehauptungeiner Schauspielerin im Schei-tern eines Stücks aussieht.
Eigentlich wollte dieses Dra-ma die Geschichte einer über- Schauspie
forderten Tochter erzählen, die von derAlkoholsucht ihrer Mutter aus der Bahngeworfen wird. Doch der Film verzetteltsich. Seitenaspekte überfluten die Story –am Ende sucht die Regisseurin von Trottamit Rührungseffekten zusammenzubin-den, was total zerfasert ist.
So ein Auseinanderfallen eines TV-Pro-dukts in Episoden ist heute nicht untypisch.In der Branche herrscht die Gier nach op-tischen Reizen und schnellen Gefühlsauf-wallungen. Kann eine Schauspielerin ret-ten, was Drehbuch und Regie verspielen?
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Retten nicht, aber das Beste daraus ma-chen. Borsody, 41, erzählt allein schon mitder Mimik den ganzen Roman einer ge-kränkten Frau. Sie zeigt eine berufstätigeMutter, die ihre Probleme nicht jammerndzelebriert, sondern voll stummem Stolzan ihnen zerbricht. Das Spiel entsprichtder inneren Haltung der Schauspielerin:„Die Leute sollen sich nicht dauernd als Opfer darstellen, mich nervt, daß an al-lem die Kindheit schuld sein soll.“ In derheutigen Therapiegesellschaft klingt so ein Satz wie von Thomas Manns fernemGebirge.
„Ich versuche, meine Figuren immerverletzbar zu machen, etwas anderesdurchschimmern zu lassen, auch wenn diePerson eindimensional aufgeschrieben ist.“In den „Schimanski“-Filmen mit Götz Ge-orge brachte sie erotisch erwärmende Küh-le – sie spielt die Staatsanwältin, die stand-haft bleibt, wenn der Schimi den Sex un-term Parka hervorholt.
Auch als Widerpart zu Senta Berger imTV-Vierteiler „Liebe und weitere Kata-strophen“ rauhte sie die Rolle eigenmäch-tig auf. Sie war als flott-flache Erfolgsfraumit jungem Liebhaber vorgesehen, ver-
mochte sich aber mit Senta Berger, dervom Drehbuch erkorenen Siegerin, dar-stellerisch zu duellieren. Verletzt und stolz zugleich verließ sie die Walstatt – Tri-umph in der Niederlage.
Schauspielerei im Fernsehen, das weißsie, ist in hohem Grade Einzelkämpfertum.Proben wie im Theater gibt es nur selten,der Darsteller muß dem Regisseur eine von
* Mit Stefanie Stappenbeck.

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Kultur
Borsody, Lebensgefährte FerchLeidenschaft für den Beruf
FO
TEX
ihm selbst durchgearbeitete Rollenkon-zeption anbieten.
Beim Erarbeiten einer Figur fühlt sichdie Schauspielerin an ihr Hobby, das Ma-len, erinnert. „Ich will ein grünes Bild ma-len, nehme einen Pinsel, mache einenStrich und merke, daß auch braune Schlie-ren zu sehen sind, weil der Pinsel vorher ineinem braunen Topf war.“ So entsteht einmehrschichtiges Rollengemälde.
Mit solchen Bildern geht die schauspie-lerische Leistungssportlerin auf den Set,wo die Filme entstehen. Und hier, vor derKamera, heißt es auf einmal „die Hosenherunterlassen“. In die vorher erarbeiteteRüstung kommen Risse. Die blonde Kämp-ferin fühlt sich in dieser Situation als – wiesie es nennt – Existentialistin. Soll heißen:Sie liefert sich aus und verlangt von Re-gisseuren eine Art Sadismus. „Schlag ausmir die Psychologie der Rolle.“
Damit meint sie keine faulen Tricks, kei-ne hohle Mienentechnik, die sie an Kolle-gen beobachtet und die ihr mißfällt: Daslaufe immer nur darauf hinaus, vom Re-gisseur zu erfahren: „Sag mir meine Wir-kung, sag mir meine Schokoladenseite.“
Andererseits weiß die „Existentialistin“Borsody auch, daß es Technik und Gestensind, welche die Schauspielkunst ausma-chen. Aber die Wirkung, so lautet das Cre-do der Wahl-Berlinerin, sei dann am besten,wenn die Darstellerin fühle, was sie spielt.
In älteren Zeiten hätte man eine solcheKunstquelle dionysisch genannt. Doch dieGeburt einer modernen Fernsehtragödie
206
Borsody in TV-Film*: „Lernen, lernen, lernen“
ist immer prosaisch. Borsody: „Drehen istBelagerungszustand. Du bist oft monate-lang von 30 Kollegen umgeben.“
Da entstehen neben Frust auch Wahl-verwandtschaften. Die Beziehung zu dem Kollegen Heino Ferch – sie war,wie die Boulevardblätter eifrig berichte-ten, schwer in der Krise, die Rivalin hieß
ausgerechnet Katja Riemann, auch so einAktricen-Alpha-Typ – ist eine typischeSchauspielerliebe: die gemeinsame Lei-denschaft für den Beruf. Dumm nur: Diemeiste Zeit dreht jeder woanders.
Zu Borsodys Wahlverwandtschaftengehört neben von Trotta RegieaufsteigerTom Tykwer. Als die Schauspielerin dessenFilm „Winterschläfer“ gesehen hatte, rief sie
Tykwer an und bat inständigum eine Rolle im nächstenProjekt. Es hätte ihr auch ge-reicht, von links nach rechtsein Tablett durchs Bild zu tra-gen – allein Tykwers Talent zogsie an.Auch das ist typisch fürdie Borsody: Bei allem Trotz,mit dem sie auf den Eigenhei-ten ihres Ausdrucks beharrt,ist sie auch eine unendlich em-sige Schülerin.
Die eisernen Regeln ihrerSchauspieler-Mutter, Rose-marie Fendel, befolgt sie mitungebrochener Tochtertreue:„Wenn du in diesem Beruf arbeiten willst, mußt du ler-nen, lernen, lernen – bis zumSchluß“, so zitiert sie die ver-ehrte Mama, die sich wie dieTochter nie auf einen Typusfestlegen ließ: RosemarieFendel wirkte bei über hun-dert Fernsehspielen mit; dasPublikum liebte sie besondersals Partnerin von Erik Ode inder Serie „Der Kommissar“.
Von der rastlosen Mutterist Suzanne von Borsody al-
* Mit Matthias Schloo in „Liebe undweitere Katastrophen“.
BR
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
lein erzogen worden, der Vater hat die Fa-milie früh verlassen. „Der Papa war im-mer fesch, eine echte Weiberfalle, auchheute noch“, erklärt sie die Abtrünnigkeitdes Edelmanns. Bald sprang der RegisseurJohannes Schaaf als Ziehvater ein – letzt-lich blieb alles in der Familie, von Künst-lern sollte Borsody immer umgeben sein.
Doch die Schauspielerei, darauf bestehtsie noch heute, war nicht ihr ursprünglichesZiel. Nach dem Abitur an einer interna-tionalen Schule in München wollte sie „un-bedingt malen“.Aber die Kunstakademie,bei der sie sich bewarb, wollte sie nicht.
Gekränkt und ratlos, was nun aus ihrwerden solle, nahm sie doch eine Rolle in ei-nem Fernsehstück an, verdiente 3000 Markin drei Wochen und fand das „unendlichviel“. So machte sie einfach weiter, irgend-wann wurde aus dem reinen Brotjob dervolle Lebensinhalt. Heute, 20 Jahre nachihrem Debüt, kann sie sagen: „Ich war nieohne Angebot.“ 13 lange Jahre allerdingshatte sie sich vor allem fürs Theater und ge-gen den Fernsehruhm entschieden. Sie woll-te, ganz fleißige Tochter, „nie Star sein, son-dern immer nur gut“. Doch als vor sechsJahren das Berliner Schiller Theater schloß,hatte sie erst einmal genug von der Bühneund fing wieder an zu filmen. Ihre Deviseblieb: bloß nicht abheben. „Dummheit undStolz wachsen aus einem Holz“, so betet siedie Sprüche ihrer Familie nach, unterlegtdas zwar mit ironischem Unterton, dochklar ist: Sie meint, was sie da sagt.
Einem künstlerischen Kraftpaket wieder Borsody erscheint das Fernsehenmanchmal wie ein Käfig, leider nicht vol-ler kreativer Narren, sondern kleinkarier-ter Rechner, die nur auf eine Nummer aussind: die Nummer Sicher. „Spiele ich ein-mal die Ärztin, kriege ich fünfmal die Ärz-tin angeboten. Es ist nicht mehr so, daßman phantasievoll besetzt.“ Dieses me-chanische Zurichten komme, so Borsody,aus Amerika: „Don’t stretch a star“ heißedas. Und wird übersetzt: Denver-Biest JoanCollins als Florence Nightingale – never.
Über solche Gedanken gerät die Schau-spielerin ins Träumen. Goethes Faustmöchte sie mal als esoterische Kino-Opersehen (und darin mitmachen). LessingsMinna von Barnhelm, die Zähmung einesSoldaten durch weiblichen Esprit, wäre,denkt sie, das richtige Lehrstück für denBalkan – am besten im Kosovo gedreht.
Überhaupt: Historisch starke Figurenreizen die Unermüdliche. Wie wäre es mitMadame Curie oder irgend einer frühenAbenteurerin, die in Männerkleidern durchAfrikas Urwälder reist? Dann hebt Borso-dy endgültig ab: „Ein Alien – das wär’s.“
Doch, soweit ist es noch nicht. Nur ihr Blick schweift kühn ins Weite. Undwieder ist sie präsent, Thomas Manns FataMorgana vom Knaben Pribislav Hippe,mit den schrägen Augen, in denen Ferneund Gebirge liegen. Susanne Beyer,
Nikolaus von Festenberg

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Kultur
S C H R I F T S T E L L E R
Herz der FinsternisFinanzhaie aus dem Westen und Raubritter aus dem
Osten fusionieren zu einem kriminellen Imperium: John le Carrémachte aus diesem Stoff seinen jüngsten Thriller.
Carré: Szenen zwischen Tag und Traum
Schreiben ist Spionieren. Der Autor,wie der Agent, setzt sich eine Maskeauf und versetzt sich in andere; er
sucht nach Spuren, Motiven, Erkenntnis-sen, legt falsche Fährten, stellt Fallen, plantCoups, und er hat allemal, auf dem Papier,die Lizenz zum Töten.
„Single & Single“, John le Carrés 17. Ro-man in 40 Jahren, beginnt mit einer Hin-richtung. Irgendwo weit hinten in der Tür-kei wird ein britischer Rechtsanwalt von ei-nem russischen Mafioso abgeschlachtet. Ineinem finalen inneren Monolog, die Pisto-le am Kopf, liefert der Brite die Exposi-tion. Furios*.
Als ob die „Titanic“ Stück für Stück auf-tauche, fügen sich im Laufe des Buchesdann Splitter, Rückblenden, Sze-nen zwischen Tag und Traum, ero-tische Kabinettstücke, psycholo-gische Trapezakte zu einem Ko-lossalgemälde unserer Tage: EineInternationale der korrupten Wirt-schaft kämpft ihr letztes Gefecht.
John le Carré, 67, der Spion,der aus der Kälte zur Literaturkam, war immer mehr als einbloßer Thriller-Autor. Das GenreThriller ist, überall in der Lite-ratur, ein legitimes Vehikel, umPlots, Stoffe, Storys spannend zutransportieren. Le Carrés Stoffebildeten stets heiße Fracht.
Im Kalten Krieg, als noch Poli-tiker die Welt regierten, war Spio-nage eine Sache der Ideologie. Imglobalen Zirkus, in dem Profiteure die Fä-den ziehen, geht es um Geld – um illegaleTransaktionen, Geldwäscherei, finstere Ma-chenschaften, Drogen, Blutkonserven, Spe-kulationen, Kriminalität.
Im globalen Zirkus kommen le CarrésAgenten nicht mehr, wie früher, aus dem„Circus“, der britischen Geheimdienst-zentrale. Es sind Einzelkämpfer, Pfadfinderim Herz der Finsternis, aber immer nochbeladen mit den Konflikten Verrat-Loya-lität und Vater-Sohn; John le Carrés eigeneKonflikte.
„Single & Single“ ist der Name einerLondoner Firma, die weltweit illegaleGeldgeschäfte in Millionenhöhe betreibtund mit den neuen Raubrittern Rußlands
* John le Carré: „Single & Single“. Deutsch von WernerSchmitz.Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 416 Seiten;45 Mark.
Autor le
J. J
UD
GES
/ R
EX F
EATU
RES
d e r s p i e g e210
das große Ding drehen will. „Single &Single“ sind Vater und Sohn, der Vater läßtsich gern „Tiger“ nennen, der Sohn heißtOliver.
Le Carrés Vater ließ sich gern „Ronny“nennen und war ein Hochstapler zwischenBankett und Bankrott; le Carré floh ihnbeizeiten, studierte deutsche Literatur,lehrte in Eton und verschrieb sich dem bri-tischen Geheimdienst. Auch Oliver Single,Juniorpartner des Tigers, flieht seinen Va-ter, als er dessen menschenverachtendePraktiken durchschaut.
Vorher aber verrät er ihn an eine Spe-zialeinheit des britischen Finanzministe-riums; ihr Chef heißt Brock. Und Olivertaucht ab. Er fürchtet Tigers Rache, die Ra-
che der russischen Raubritter. Denn dasReich des Bösen, das globale Gangster-Im-perium mit geschmierten Helfershelfern inallen Regierungsetagen, beginnt einzu-stürzen.
Lakonisch, ironisch, in vielen Sprach-farben erzählt le Carré; er gibt den Figureneigene Stimmen, dem Zürcher Bankier, derschönen Exotin wie den Kolossen aus Ge-orgien. Landschaften fangen an zu leben,zu glühen; Landschaften der Seele auch,Krater, Abgründe, Sehnsuchtswirbel, eis-kalte Brutalität.
Und Oliver Single, der Held, ist ein Zer-rissener; ein Kinderfreund, dem seine klei-ne Tochter entrissen wurde; der geplagt istvom Verrat an seinem Vater, dem Wind-hund und Verbrecher. Brock, der Finanz-agent, übernimmt die Vaterstelle, Brock,der so lauernde Verhöre führen kann, daßeinem der Atem stockt.
l 1 8 / 1 9 9 9

Plötzlich, nach dem Mord an seinemRechtsanwalt, ist Tiger verschwunden,seine Firma stillgelegt und alles gefähr-lich rätselhaft. Oliver, der Zerrissene, er-wacht, von Brock beschattet, zum Spür-hund, zum Spion in eigener Sache; zumSohn, der seinen Vater liebt. Und ihnsucht.
d e r s p i e g e
Bestseller
Pinguine und Tenöre entdecken
Gemeinsamkeiten
Le Carré, der Mastermind, der schrei-bende Spion, der spionierende Schreiber,zieht nun auch ins letzte Gefecht; mit allenStrategien und Finten seiner Kunst, Über-raschungsangriffen und labyrinthischenVerfolgungen. Eine moderne Odyssee ineine Welt uralter Gefühle. „Single &Single“ ist singulär. Fritz Rumler
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlichermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“
Belletristik
1 (1) John Irving Witwe für ein JahrDiogenes; 49,90 Mark
2 (2) Henning Mankell Die fünfte FrauZsolnay; 39,80 Mark
3 (3) John Grisham Der VerratHoffmann und Campe; 44,90 Mark
4 (4) Marianne Fredriksson Simon W. Krüger; 39,80 Mark
5 (5) Minette Walters WellenbrecherGoldmann; 44,90 Mark
6 (6) Walter Moers Die 131/2 Lebendes Käpt’n Blaubär Eichborn; 49,80 Mark
7 (9) David Guterson Östlich der BergeBerlin; 39,80 Mark
8 (8) Cees Nooteboom AllerseelenSuhrkamp; 48 Mark
9 (10) P. D. James Was gut und böse istDroemer; 39,90 Mark
10 (11) Maeve Binchy
Ein Haus in Irland Droemer; 39,90 Mark
11 (7) Marianne Fredriksson
Hannas Töchter W. Krüger; 39,80 Mark
12 (12) Donna Leon Sanft entschlafenDiogenes; 39 Mark
13 (13) Tom Clancy Operation RainbowHeyne; 49,80 Mark
14 (14) Martin Walser Ein springender Brunnen Suhrkamp; 49,80 Mark
15 (–) Heidenreich/
Buchholz Am Südpol,denkt man, ist es heiß Hanser; 25 Mark
l 1
Erst seine Frau brachte den
Dichterfürsten in die Bestsellerlisten
Sachbücher
1 (1) Waris Dirie Wüstenblume Schneekluth; 39,80 Mark
2 (2) Corinne Hofmann
Die weiße Massai A1; 39,80 Mark
3 (3) Klaus Bednarz Ballade vomBaikalsee Europa; 39,80 Mark
4 (4) Sigrid Damm
Christiane und Goethe Insel; 49,80 Mark
5 (5) Jon Krakauer In eisige HöhenMalik; 39,80 Mark
6 (6) Dale Carnegie Sorge dichnicht, lebe! Scherz; 46 Mark
7 (7) Jon Krakauer Auf den Gipfeln der Welt Malik; 39,80 Mark
8 (8) Tahar Ben Jelloun
Papa, was ist ein Fremder? Rowohlt Berlin; 29,80 Mark
9 (9) Monty Roberts Shy BoyLübbe; 49,80 Mark
10 (11) Gerd Ruge Sibirisches TagebuchBerlin; 39,80 Mark
11 (12) Gary Kinder Das GoldschiffMalik; 39,80 Mark
12 (10) Helmut Schmidt Auf der Suchenach einer öffentlichen MoralDVA; 42 Mark
13 (14) Caroline Alexander
Die EnduranceBerlin; 49,80 Mark
14 (–) Guido Knopp Hitlers KriegerC. Bertelsmann; 46,90 Mark
15 (13) Peter Kelder Die Fünf „Tibeter“ Integral; 22 Mark
8 / 1 9 9 9 211

21
Kultur
Au
K U N S T
Kurzer Frühling in der ProvinzWeimar als Kampfplatz der Avantgarde: Hier blühten Jahrhundertwende-Kunst und
Bauhaus – bis sie rausgeekelt wurden. Nun rekonstruiert eine Ausstellung zum Kulturstadt-Jahr „Aufstieg und Fall der Moderne“ und zeigt auch reichlich NS- sowie DDR-Gemälde.
NS-Gemälde „Aphrodite“ von Oscar Graf (1941): Volkssturm der Kunstgeschichte
Der Grandseigneur hatte einen küh-nen Traum: Er wollte „die philoso-phische Goethesche Kultur mit der
Bismarckschen politischen und der fin-de-siècle ästhetischen vereinigen“. Wo abersollte dieser Geniestreich gelingen können,wenn nicht dort, wo einst schon Deutsch-lands Dichterfürst die Poesie segensreichmit Staatsgeschäften versöhnt hatte?
In Weimar, der thüringischen Mini-Resi-denz, sah Harry Graf Kessler (1868 bis1937) sich bald nach der Jahrhundertwen-de mit der „Oberleitung aller Kunstbestre-bungen“ betraut – von einem Landesherrn,der angeblich der Meinung war, „selbst einKaiser könne die moderne Bewegung nichtmehr aufhalten“. Stolz plante Kessler ein„Neues Weimar“ als Gegenmacht zur mie-figen wilhelminischen Hauptstadtkultur.
Allerdings schwante dem Weltmann inder Provinz auch gleich, daß der WeimarerHof „von Intriguen untergraben“ war und„Reinkulturen des menschlichen Schim-melpilzes“ nährte. Richtig gesehen: Schonnach drei Jahren, 1906, war Kessler ausge-trickst und mußte seine Ambition begra-ben. Ihm blieb „das Glück, nach einem ge-fährlichen Abenteuer wieder frei zu sein“.
„Von draußen geholt, von drinnen raus-geworfen“, so beschreibt nun Rolf Bothe,als Chef der Kunstsammlungen WeimarKesslers später Nachfolger, ein Grundmu-ster der örtlichen Kulturpolitik. In der ab-gelegenen, stets von klassischer Bildungs-aura umwehten Idylle sind neue Strömun-gen oft erstaunlich lebhaft aufgenommen –und dann erbittert weggeekelt worden.Beispielhaft spiegelt die Szene Auf-schwünge und Niederlagen des Zeitgeists.
Sowenig wie Kessler konnte sich seinMitstreiter, der belgische Reformarchitekt
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 92
sstellungsaufbau im Weimarer Schloß: „Selbst ein Kaiser hält die Moderne nicht auf“
J. V
AN
HÖ
FEN
/ O
STK
REU
Z
und -designer Henry van de Velde, in Wei-mar halten; seit dem Ersten Weltkrieg warer als feindlicher Ausländer unerwünscht.Das hier dann 1919 aus seinem Geist ge-gründete Bauhaus mußte 1925 nach Dessauweiterziehen. Schon 1930 reinigte einthüringischer Nazi-Minister die WeimarerStaatlichen Sammlungen von expressioni-stischer und abstrakter Kunst. Ansätze zueiner Bauhaus-Wiederbelebung nach 1945wurden durch Doktrinäre abgewürgt.
Das ist eine farbige, fintenreiche Story,die dringend danach verlangte, im Kultur-stadt-Jahr 1999 nachinszeniert zu werden:

Vom kommenden Sonntag an schilderteine Weimarer Großausstellung „Aufstiegund Fall der Moderne“ in drei Etappen.
So vereinigt, unter Bothes Ägide, dasSchloßmuseum mit historischer Akkura-tesse solche Kunstwerke, die vor 1933 alsNovitäten in die Weimarer Öffentlichkeitgelangten.Auf eigenen Stellwänden machtsich diese Moderne sinnfällig-rabiat imklassizistischen Residenzambiente mit sei-nen Säulen und Kronleuchtern und zwi-schen alten Bildern der Sammlung breit.
Doch das allein wäre offenbar nichtEvent genug. Spektakulär, auch ohne spe-ziellen Ortsbezug, besetzen daher zwei Va-rianten von „Antimoderne“ je ein ganzesHallenstockwerk im einstigen Nazi-„Gau-forum“: unten Kunst des Dritten Reichs,oben solche der DDR. Mit rund 120 undrund 500 Stücken sind so die größten Bil-derpräsentationen seit Untergang des je-weiligen Regimes zusammengekommen.
Achim Preiß, Kunstgeschichtsprofessoran der Weimarer Architektur-Hochschule(jetzt „Bauhaus-Universität“), hat das NS-Sortiment jenem Münchner Depot nach-empfunden, in dem die Schinken für ge-wöhnlich lagern. In der DDR-Schau deuteter eine feierliche Rotunde an, stellt der of-
VG
BIL
D-K
UN
ST,
BO
NN
19
99
DDR-Gemälde „Die Aura der Schmelzer“ von Eberhard Heiland (1988), Kessler-Porträt von Munch (1906): Lehrmeister der Jugend?
fiziellen Produktion aber auch etliche Dis-sidenten-Bilder entgegen. Da wird etwader Eigenbrötler Gerhard Altenbourg, von1948 bis 1959 in Weimar auf der Suche nachRestspuren der Moderne, gewürdigt*.
Die Hochschule, die Altenbourg be-suchte, bis sie ihn 1950 als „gesellschaftlichungenügend, völlig indifferent“ ausschloß,ging, mit Umwegen, auf eine großherzog-liche Gründung von 1860 zurück. Ende des
* Schloßmuseum bis 1.August, ehemaliges Gauforum bis9. November. Katalog im Verlag Hatje-Cantz; 500 Seiten;49 (Buchhandelsausgabe 98) Mark.
19. Jahrhunderts hatte sie sich zu einemrenommierten Zentrum der Landschafts-malerei entwickelt; Absolventen ließensich prompt davon anregen, daß 1889 einGastredner seinen Weimarer Vortrag überden Impressionismus durch drei mitge-brachte Bilder Claude Monets illustrierte –Aufstieg der Moderne in Weimar.
Der große Schub setzte dann mit vande Velde und Kessler ein. Sie hatten sich imBerliner Kreis um die Avantgardezeitschrift„Pan“ getroffen, zu dem auch ElisabethFörster, die Schwester des PhilosophenFriedrich Nietzsche, Kontakte pflegte. Seit1897 wohnte sie in Weimar, wo eine Gön-nerin ein Haus zur Pflege des wahnsinniggewordenen Denkers und zur Archivie-rung seiner Schriften bereitgestellt hatte.1901, nach dem Tod des Bruders, schlug sievor, van de Velde als Leiter der Kunstge-werbeschule nach Weimar zu locken – wasKessler alsbald erfolgreich beim Staatsmi-nister vortrug. Mit Schulbauten und -um-bauten sowie der Jugendstilausstattung desNietzsche-Archivs hat van de Velde Haupt-werke in der Stadt hinterlassen.
Doch es war Kesslers Rolle, das „NeueWeimar“ glamourös zu verkörpern – mitgutem Grund prangt sein 1906 von Edvard
Munch gemaltes Ganzfigurenporträt nunam Ende einer langen Blickschneise in derSchloß-Ausstellung.
Der Dandy aus reichem, in den Grafen-stand erhobenen Hause, dessen schöne bri-tische Mutter Umgang mit dem Preu-ßenkönig und nachmaligen Kaiser WilhelmI. gepflegt hatte und den haltlose Gerüch-te sogar zum leiblichen Sproß des Monar-chen erklärten, besaß Geist und Geld ge-nug, sein Kunstprogramm schon einmal alsPrivatsammler vorzuexerzieren. Er erwarb(und verkaufte später) wichtige Gemäldeetwa von Cézanne, Renoir und Signac.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Drei Bilder des Symbolisten Maurice De-nis ließ Kessler durch van de Velde in dieWandverkleidung seiner Weimarer Woh-nung einfügen. Mit Museumsausstellungenfranzösischer und deutscher Impressioni-sten, Paul Gauguins und Auguste Rodinszog er auf der öffentlichen Bühne nach.
Doch den realen Rückhalt für seine Pro-jekte überschätzte Kessler gewaltig.Van deVeldes Beraterstellung beim Großherzogverglich er ernstlich mit den „Berufungenvon Philosophen-Gesetzgebern durch an-tike Stadtherrscher“. Er selber glaubte sichdurch weitreichende Verbindungen mitKultur- und Gesellschaftsgrößen zum deut-schen „Princeps Juventutis“, einem Lehr-meister der Jugend, berufen und fragte nur:„Lohnt es die Mühe?“ Dabei machte er
sich durch hochfahrendes Wesen und hek-tische Aktivität mit langen Reise-Absen-zen auch anfängliche Förderer zu Feinden.Vom Landesherrn Wilhelm Ernst, der erst1901 mit 24 Jahren auf den Thron gelangtwar, hatte er ohnehin zuviel erhofft.
Zwar veranlaßte der Monarch 1904 nochden Ankauf der Rodin-Skulptur „Das eher-ne Zeitalter“ – zu stark ermäßigtem Preis.Doch als zwei Jahre später erotische Ro-din-Zeichnungen, die der Hof dankend alsGeschenk entgegengenommen hatte, insöffentliche Gerede kamen („Möge derFranzose aus seinem Künstlerkloaken-
213

Werbeseite
Werbeseite

Kultur
in-Werk (um 1900): „Möge der Franzose lachen“
leben sich ins Fäustchen lachen, so et-was in Deutschland an den Mann ge-bracht zu haben“), war es mit derHuld vorbei. Zurück von einer In-dienreise, reichte der Großherzog sei-nen im Spalier angetretenen Amts-trägern einzeln die Hand und richte-te das Wort an sie. Kessler aber sah ernur mit einer Grimasse „offener Ver-achtung“ an und ließ ihn unbegrüßtstehen. Dem Augenzeugen van de Vel-de schien „ein Grundpfeiler des vonuns mit so leidenschaftlicher Begei-sterung errichteten Gebäudes“ ein-zustürzen.
Noch mitten im Ersten Weltkriegwollte der schlichte Landesvater auchKunstschulprofessoren, deren Bilderihm mißfielen, schlankweg auf dieStraße setzen. Ehe der Kasus ausge-standen war, mußte er dann 1918 sel-ber den Abschied nehmen.
„Ganz radikale ungebärdige Ele-mente“ rührten sich nun, zur Freudedes Malers Lyonel Feininger, auch ander ehrwürdigen Akademie. PrivatierKessler machte Atelierbesuche beimMaler Johannes Molzahn und ande-ren Nachwuchskräften auf der Suchenach dem „neuen Menschen“ sowieeiner „völlig abstrakten, expressioni-stischen Kunst“.
In vielen Facetten rekonstruiert die„Aufstieg und Fall“-Schau diese Wei-marer Szene, die ein paar Jahre lang allenAnfeindungen zum Trotz vom Bauhaus be-herrscht war. Die Staatlichen Kunstsamm-lungen verfolgten ein aktuelles Ausstel-lungsprogramm und zeigten Dauerleihga-ben von Bauhaus-Meistern auch noch nachderen Wegzug. Doch 1930, beim ersten,thüringischen Nazi-Bildersturm, schriebPaul Klee dem Museumsdirektor, er habe„jede weitere Lust an Weimar verloren“.
Welcher Ramsch dann statt dessen höch-ste Gunst errang, ist in der „Halle derVolksgemeinschaft“ im „Gauforum“ zu be-staunen. Weimar war eine frühe Nazi-Hochburg. Nirgendwo sonst gedieh eine
Rod
DDR-Gemälde im Weimarer „Gauforum“: „Eine
vielerorts geplante Protzarchitektur für dieregionale Parteileitung so weit wie hier.Die zentrale Halle, zu DDR-Zeiten als Fa-brik- und Lagerraum genutzt, empfahl sichals spezifisch Weimarer Schauplatz für denAusstellungsteil „Die Kunst dem Volke –erworben: Adolf Hitler“.
Die Bilder kommen aus dem Fundus,den der Führer seit 1937 teils nach eigenerWahl aus den Münchner „Großen Deut-schen Kunstausstellungen“ zusammen-kaufte, überwiegend zur Zierde der Reichs-kanzlei. Dergleichen en masse zu zeigen,hat beispielsweise der 1996 verstorbeneGroßsammler Peter Ludwig hartnäckig ge-
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
besonders autistische Version der Antimodern
fordert, doch über den Tabubruch hin-aus bietet die jetzt geöffnete Pandora-büchse keine Sensation.
Man konnte es längst an Repro-duktionen sehen: Von diesen endlosabgewandelten Klischees, den Land-schaften, Bauernszenen und oft my-thologisch verbrämten Akten in ihrerunfreiwilligen Komik, gehen wederästhetische Reize noch dämonischeKräfte aus. Mit der Überredungskraftvon Propagandafilmen können die„grottenschlechten Bilder“ (Ausstel-lungsmacher Preiß) nicht konkurrie-ren. Nachzügler und Dilettanten ver-sammeln sich, gemäß Hitlers dumpfenGeschmacksrichtlinien, zu einemVolkssturm der Kunstgeschichte.
Davon möchte der Westler Preißdie erzieherisch gemeinte DDR-Ma-lerei, die er aus diversen Kollektio-nen vom Palast der Republik bis zurthüringischen Maxhütte schöpft, denndoch unterscheiden; taktvoll wird sieden Besuchern von einer anderen Ge-bäudeseite her erschlossen. Dem Stilnach ähnelt sie, in dieser Auswahl je-denfalls, den Nazi-Bildern allenfallssporadisch – und das in den späterenDDR-Jahren immer weniger.
Honeckers „Weite und Vielfalt“ er-laubte schließlich sogar Arbeiter-Ka-rikaturen. Die am lockeren Zügel ge-führte Malerei war dann gerade noch
dazu gut, im kapitalistischen Ausland Ein-druck und Devisen zu schinden. Nun istauch diese „besonders autistische Versionder Antimoderne“, wie Preiß einleuchtenddiagnostiziert, ebenso Geschichte gewor-den wie die ganze DDR. Nicht einmal diekünstlerische Opposition scheint überlebtzu haben, obwohl sie doch großenteils somodern aussah.
Da steigt bei Preiß ein finsterer Verdachtauf: Könnte dieser stille Tod der staatsfer-nen Ost-Moderne nicht „Vorbote“ für ei-nen baldigen „Untergang der Westkunst“sein? Aber so schlimm wird es schon nichtkommen. Jürgen Hohmeyer
215
e“
J. V
AN
HÖ
FEN
/ O
STK
REU
Z

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

M.
FR
IED
EL
Meysels Anwesen in Bullenhausen: Bühnenreifer Kampf gegen den geplanten Schutzwall
S C H A R M Ü T Z E L
Die alte Dameund der Deich Als Kratzbürste mit Herz lieben sie die Zuschauer.
Im echten Leben nervt Inge Meysel ihre Nachbarn im
Elbmarschdorf Bullenhausen.
eportern*: „Ich kann doch schwimmen“ D
PA
Vorsicht Schafe!, so warnt ein Ver-kehrsschild. Doch die Schafe grasenfriedlich im idyllischen Elbmarsch-
dorf Bullenhausen und ködeln aufs jungeDeichgrün. Aufregendes passiert hier inder norddeutschen Tiefebene, wenige Ki-lometer vor Hamburg, selten.
Doch seit vergangener Woche ist die Be-schaulichkeit dahin. Den Bullenhausenerndroht Ungemach von ihrer prominentestenMitbürgerin –Inge Meysel, 88. Die Fern-sehmutter der Nation, ein Monument derMoral und Redseligkeit, setzt ihre Mitbür-ger dem nassen Tod im Elbwasser aus. Zu-mindest wenn man den tränenersticktenStimmen einiger Dorfbewohner glaubt.
Was ist passiert? Der quirligen Seniorinsoll ein Deich vor ihren Luxusbungalowmit Panoramablick zur Elbe gesetzt wer-den. Der acht Meter hohe Schutzwall istdringend notwendig, sagt das Küsten-schutzamt in Lüneburg, weil durch Elb-vertiefung und Klimaveränderung dieHochwassergefahr heute ungleich größerist als noch vor 20 Jahren.
Aus, Schluß, vorbei mit dem malerischenBlick? Nur noch auf Zehenspitzen recken,um einen Fitzelstreifen trüben Elbwassersam Horizont zu erhaschen? Nicht für die1,56 Meter kleine, schrullige Hutträgerin:„Solange ich hier lebe, wird kein Erdwallaufgeschüttet. Ich will den freien Blick aufdie Elbe.“ Sie wisse sonst ja nicht mehr,daß sie überhaupt am Wasser wohne.
Daß das Mundwerk der kampfbereitenHeroine manchmal schneller arbeitet alsihr Verstand, bewies sie letzte Woche voreingeschalteten Mikrofonen. „Ich kann dochschwimmen“, keifte sie in den Frühnach-richten der Hamburger Lokalsender, „undich bin doch schon so alt, da ist mir egal,wenn das Wasser kommt.“ Empört heultendie Bullenhausener über soviel Egoismusauf. Soll denn das ganze Dorf untergehen?Daß sich „uns’ Inge“ so störrisch stellt,bringt das sonst so sittsame Gemeinwesenin Wallung. „Ich hasse sie“, schluchzte eineEinwohnerin. „Die ist doch im Fernsehen somütterlich“, bellte Meysels Nachbarin vonschräg gegenüber, „dann soll sie Gutes tunund dem Dorf den Deich geben.“ Ein „büh-nenreifer Deichkrieg“, freute sich „Bild“.
Dabei kämpft die Meyseldoch nur so forsch, wie ihreGemeinde sie aus dem Fern-sehen kennt, zum Beispiel alsKäthe Scholz, die in der Sech-ziger-Jahre-Serie „Die Un-verbesserlichen“ eine Ange-stelltenfamilie durch denWirtschaftswunderstreß führ-te, ohne sich die Butter vomBrot nehmen zu lassen. Oderals resolute Putzfrau Mrs.Harris. Da entlarvt sie lieberHeiratsschwindler, als raumpflegerisch tä-tig zu werden. Und sie brilliert auf derBühne. „Spitzenmäßig, super, zum Knien“,lobte sogar der eigenwillige Theaterregis-seur Einar Schleef ihre Schauspielkunst.
Die Meysel sucht die Attitüde der Demut,in Wahrheit lauert in ihr eine unerschütter-liche Kratzbürste. Das Bundesverdienst-kreuz Erster Klasse lehnte sie kiebig ab. „Sieduldet keine Götter neben sich“, polterteKollegin Regine Lutz über die Mimin. Mey-sels kalkulierter Schulmädchen-Charme,mit dem die eloquente Greisin die Talkshowsdominiert, bringt dagegen noch jedes Pu-blikum zum Juchzen – jugendliche Kolle-ginnen bürstet sie gern mit mütterlicher
* Am 27. April in Bullenhausen.
Meysel vor R
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Herablassung („Kindchen“) gnadenlos ab.Das letzte Wort ist ihre Domäne.
Doch nun tritt sie nicht im Fernsehenauf, sondern live in Bullenhausen. DieMeyselsche TV-Mischung aus Sentimenta-lität und Herrschsucht mutiert im echtenLeben zur Nervnummer und realen Bela-stung der Nachbarschaft.
Die Bullenhausener hätten gewarnt seinmüssen: Beim Thema Elbblick kennt IngeMeysel kein Pardon. Schon 1975 nahm sieden Kampf auf – ein Nachbar hatte seinSchlafzimmer erweitert und so von Mey-sels 170-Grad-Flußpanorama 8 Grad ge-klaut. Die streitbare Schauspielerin klagte,verlor aber vor Gericht.
Eine Lösung für ihr aktuelles Sicht-Problem wäre eine 1,80 Meter hohe Flut-
schutzmauer entlang der Rückseite desSchauspieler-Anwesens. Allerdings müß-ten dann die Bewohner aus der zweitenReihe auf Steinwerk – statt auf Blumenund Bäume – gucken. Die Meysel findetdiesen Vorschlag durchaus akzeptabel.
„Ich kann den ganzen Aufruhr nichtverstehen“, krähte sie vergangenen Mitt-woch in die Gegensprechanlage an ihremGartentor. Als sich genügend Journali-sten vor ihrem Haus versammelt hatten,nutzte sie die PR-Chance, rannte quietsch-fidel in Hemd und Miederhöschen in denGarten und begann eine gesten- und wort-reiche Deich-Debatte. Filmaufnahmen verbat sich die alte Dame: nicht der knap-pen Kleidung wegen – ihr Haar war nichtfrisiert. Simone Kaempf
219

Werbeseite
Werbeseite

Prisma Wissenschaft
Regenwald auf KauaiD. MÜNCH / TONY STONE
C H I R U R G I E
Leuchtende TumorenEine Arbeitsgruppe der Neurochirur-
gischen Klinik und des Laser-For-schungslabors am Klinikum Großha-dern in München hat eine mikrochirur-gische Methode entwickelt, mit derenHilfe sich Hirngeschwülste wie Gliomeentfernen lassen, ohne das umliegendegesunde Gewebe zu beschädigen. Dazuwird Patienten vor dem Eingriff die kör-pereigene Substanz 5-Aminolävulinsäu-re verabreicht. Diese verwandelt sich ineinen Farbstoff, der sich bevorzugt inden Tumoren ansammelt. Die Grenzezwischen gesundem und krankhaftemGewebe wird so gut sichtbar. Durch dasebenfalls neuentwickelte OP-Mikroskopkann der Chirurg während der Opera-tion die leuchtenden Geschwülste er-kennen und das kranke Gewebe sauberentfernen. Nach Aussagen des klini-schen Forschungsleiters Walter Stum-mer ist das neue Verfahren mittlerweilean 60 Patienten erfolgreich erprobt wor-den. Damit die Tumoren nicht nach-wachsen, seien jedoch weiterhin Strah-len- und Chemotherapien erforderlich.
Gefärbter Hirntumor
W.
STU
MM
ER
H
U M W E L T
Luftige DüngungEigentlich steht der Regenwald auf der
Hawaii-Insel Kauai fremd in derLandschaft. Der Boden dort ist nämlichzu arm an Nährstoffen, um die üppigeTropenflora zu ermöglichen. Eine Er-klärung für die Laune der Natur liefertnun der amerikanische BodenexperteOliver Chadwick von der University ofCalifornia in Santa Barbara. Chadwick
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
aut vom Entenschnabel-Saurier
NEW
MEXIC
O M
US
EU
M O
F N
ATU
RAL H
ISTO
RY
fand Belege für seine seit langem geheg-te Vermutung, daß die vorherrschendenWestwinde im Staub gebundene Phos-phorpartikel heranwehen, die dem Wald-boden von Kauai zugute kommen. AlsHerkunftsort des luftgestützten Düngerskonnte Chadwick die rund 10000 Kilo-meter entfernte Wüste Takla Makan imWesten Chinas ausmachen. Der Forschervermutet, daß auch andere Tropenwäl-der wichtige Nährstoffe über Luftströ-mungen erhalten; so versorgt beispiels-weise Staub aus der Sahara die Amazo-nas-Region mit Dünger.
D I N O S A U R I E R
Ausgefranste HöckerDas Tier wurde bis zu zehn Meter
groß, sein Gesicht war „tief undschmal“, und vor den Augen wölbtensich „abgerundete Höcker“ – so soll einHadrosaurus nach Ansicht der Dino-Forscher ausgesehen haben. Die phan-tasievolle Beschreibung des vor 70 Mil-lionen Jahren in Nordamerika heimi-schen Entenschnabel-Sauriers kann nunum ein wichtiges Detail ergänzt wer-den. Bei Deming im US-Staat New Me-xico fand George Basabilvazo, Studentder Paläontologie, einen Abdruck ver-steinerter Haut zusammen mit denKnochen der großen Urzeit-Echse. Da-nach war die Hautoberfläche dieser ele-fantenschweren Saurier nicht so glatt,wie sie von Rekonstruktionskünstlernhäufig dargestellt wurde, sondern war-zig wie die einer Kröte. Die ausgefran-
sten pfenniggroßen Höcker vergrößer-ten die Oberfläche und ermöglichten esdem „Entenschnäbler“, schnell aufge-staute Körperwärme loszuwerden, ver-muten die Dinosaurier-Forscher. Sie er-hoffen sich von weiterem Verständnisder Saurierhaut Hinweise auf die großeVielfalt der mehr als 340 Gattungen derUrzeitriesen.
Z U K U N F T
„Wir haben euchgewarnt“
Mit dem Bericht „Die Grenzen desWachstums“ wurde der US-Wirt-
schaftsexperte Dennis Meadows 1972weltbekannt. Unter dem Titel „Die neu-en Grenzen des Wachstums“ folgte 1992eine zweite Warnung. Bei einem Besuchin Deutschland referierte Meadows nunerste Ergebnisse von Testläufen seinesComputermodells „World3“: Der glo-bale Kollaps läßt sich demnach nichtmehr abwenden. Selbst für den Fall,daß bis zum Jahre 2005 eine entspre-chende Politik umgesetzt würde, könne„das Ergebnis nicht mehr nachhaltig ge-nannt werden“. Die Gesamtbilanz willdas Meadows-Teams im nächsten Jahrveröffentlichen; möglicher Titel: „Wirhaben euch gewarnt“.
221

22
rt Knoblauchkröte
Prisma Computer
A R T E N S C H U T Z
Liste derListen
Was haben die Knob-lauchkröte, das Bla-
senmützenmoos und derSchierling-Wasserfenchelgemein? Sie alle sind in ir-gendeiner der unzähligenRoten Listen für bedrohteArten verzeichnet. Das um-fassendste Kompendiumdieser Art bietet jetzt der„Verlag für interaktive Me-dien“ (Gaggenau) mit derCD-Rom „Rote Listen“ an.Drei Jahre lang haben 50Studenten und Schüler unter der Lei-tung des Biologen Christian Köppel ins-gesamt 2000 Artenschutzlisten Mitte-leuropas mit insgesamt einer MillionEinträgen zusammengetragen. Erfaßtwurden nicht nur aktuell bedrohte Ar-ten, sondern auch historische Bestand-saufnahmen bis ins 19. Jahrhundert.Aufalle Datensätze können Umweltaktivi-sten über eine Datenbank zugreifen.Anscheinend haben Biologen Schwie-
Bedrohte A
B.
RO
TH
/ O
KAPIA
2
rigkeiten sich bei ihrer Arbeit auf ein-deutige Schreibweisen ihrer Studienob-jekte zu einigen. Also bestand die we-sentliche Arbeit Köppels darin, die un-terschiedlichen Namensschreibungen zunormieren. Dadurch läßt sich erstmalsdie Gefährdung von Arten in verschie-denen deutschsprachigen Regionen zu-verlässig feststellen. Die Liste der Li-sten kostet 148 Mark und ist beim Ver-lag erhältlich.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
V I R E N
Asiatische Software-Grippe
Nicht nur die Wirtschaftskrise trifftden Fernen Osten hart, jetzt fiel
auch noch ein bösartiger Computervi-rus über die asiatischen Wirtschaftszen-tren her. Zum 13. Jahrestag der Tscher-nobyl-Katastrophe legte der gleichnami-ge Virus dort angeblich Hunderttausen-de PC lahm. Noch schneller als bei demkürzlich aufgetauchten Virus „Melissa“ist der Schuldige identifiziert. Ein ehe-maliger Computerstudent des Tatung-Instituts in Taipeh hatte das Programmerzeugt. Der Virus ist auch unter denInitialen seines Namens bekannt: CIHfür Chen Ing-Hau.
M E D I Z I N
Schneller AutomatRoutinemäßige Abstriche vom Ge-
bärmutterhals sollen Krebs mög-lichst schon im Frühstadium erfassen.Jetzt ließen Forscher vom Imperial Col-lege of Medicine in London menschli-che Experten gegen digitale Analyse-automaten antreten. Das im Fachblatt„Lancet“ veröffentlichte Ergebnis wareindeutig: Die Trefferquote für den Be-fund „richtig positiv“ lag bei Ärztenund „Papnet“, dem Diagnosesystem aufder Basis eines neuronalen Netzes,gleichauf bei rund 80 Prozent. Jedochstempelten Ärzte fälschlich doppelt sohäufig Gesunde zu Kranken („falschpositive Befunde“), und schneller warder Computer auch: Für eine Diagnosebenötigte Papnet im Schnitt 3,9 Minu-ten, die Ärzte brauchten 10,4 Minuten.
Abstrichkontrolle mit Mikroskop
REIN
BAC
HER
/ K
ES
I N T E R N E T
Microsoft investiertÜber eine Million Dollar pro Jahr in-
vestiert die Firma Microsoft in dieZukunft des Internet. Mit dieser Ent-wicklungshilfe unterstützt das Soft-wareunternehmen den Ausbau des so-genannten Internet 2, das im Februar in Washington eröffnet wurde. Der Be-darf für die Überholspur im Netzwuchs, seit das Netz fürs gemeineComputervolk zugänglich wurde undwissenschaftliche Institute die Übertra-gungskapazitäten mit Sexanbietern undBuchhandlungen teilen mußten. Mit su-perschnellen Privatleitungen zwischenUS-amerikanischen Forschungsstättenwill nun ein Verbund aus nunmehr 19High-Tech-Firmen und 150 Universitä-ten die überfüllten Datenstrecken ver-lassen. Auf die Frage, ob Microsoft mitseiner Investition auch über diesesMarktsegment die Kontrolle anstrebe,wiegelte Vize-Forschungschef Rick Rashid ab: „Wir wollen mit ande-ren koope-rieren.“ www.internet2.org
Ü B E R WA C H U N G
Plüschtier als PeilgerätWenn das Kind mit dem
Teddy unterm Armzum Spielen geht, kann esnicht mehr abhandenkommen. Zwei ältereHerren aus Anderson (South Carolina)entwickelten aus Sorge um ihre Enkelein tragbares Ortungssystem. Was inKraftfahrzeugen schon erfolgreich ge-gen Diebstahl eingesetzt wird, soll nunhelfen, entlaufene oder entführte Kin-der aufzuspüren. Überall dort, wo eineHandyverbindung möglich ist, kann dasGPS-System „SatCel“ den genauenStandort ermitteln und ins Telefonnetzeinspeisen. Damit die Batterien länger
halten, wird dasGerät nur dannaktiviert, wenndas Kind überfäl-lig ist und gesuchtwird.

Werbeseite
Werbeseite

Zerbombte Ölraffinerie in Jugoslawien: Ein Rußcocktail, der gesundheitsschädigende Stoffe über große Entfernungen transportiert
AP
Aufräumungsarbeiten* Langzeitfolgen sind programmiert
Nicht als einzige richtet die serbischeJournalistin Dubravca Saviƒ beimtäglichen Presse-Briefing im Brüs-
seler Hauptquartier unangenehme Fragenan Nato-Sprecher Jamie Shea.
Doch als sie, vom äußersten Rand derVersammlung aus, über die ökologischenKonsequenzen der Luftangriffe in Jugosla-wien Auskunft verlangt, sucht der Me-dienprofi hinter seinem Holzpult Zufluchtin bösem Zynismus. „All der Rauch, deraus den 500 brennenden Dörfern im Ko-sovo aufsteigt“, blafft er die dunkelhaari-ge Dame an, „tut der Ozonschicht sicherauch nicht gut.“
Tags zuvor hatten Nato-Bomber den petrochemischen Industriekomplex vonPan‡evo, 15 Kilometer nordöstlich Bel-grads, in ein Inferno verwandelt. Es war derfünfte Angriff binnen weniger Wochen. Ge-waltige Rauch- und Gasschwaden stiegen,als der Tag graute, über der Erdölraffinerie,der Düngemittelfabrik und den riesigenzylindrischen Treibstofftanks auf.
Hundert Kilometer donauaufwärts dasgleiche Bild: Nahe der Industriestadt NoviSad war in derselben Nacht auch die zwei-te Raffinerie des Landes, außerdem ein be-nachbartes Rohöl- und Butangas-Depot inFlammen aufgegangen.
Zu löschen gab es da nichts mehr. Undzu allem Überfluß wuschen Regenschauerin dieser Nacht einen Großteil des Gas-und Rußcocktails aus der Atmosphäre,noch ehe sich die Wolke hätte weiträu-mig verteilen können. Die örtlichen Be-
224
hörden empfahlen den Anwohnern, ihreHäuser nur noch mit Gasmasken zu ver-lassen.
Nicht immer präzise, aber mit fast buch-halterischer Konsequenz nehmen die Nato-Bomber seit Ende März in täglichen An-griffswellen Treibstoffdepots, Raffinerien,Chemiefabriken, aber auch Kraftwerke undandere große Industrieanlagen in Serbienund dem Kosovo aus der Luft unter Feuer(siehe Karte).
Am Boden versetzen beißende Rauch-schwaden die Betroffenen in Angst undSchrecken.Wie Hohn klingt in ihren Ohrendie beschwörende Nato-Formel, der Kriegrichte sich nur gegen die Machtclique umSlobodan Milo∆eviƒ, aber keinesfalls gegendas serbische Volk.
Je näher die Nato ihrem strategischenZiel rückt, die kriegswichtige InfrastrukturJugoslawiens zu zerstören, um so verhee-render entwickeln sich die ökologischenNebenwirkungen. In weiten Teilen Ser-biens und des Kosovo, behauptet BrankaJovanovic, die Vorsitzende der oppositio-nellen Belgrader Grünen, sei schon jetztdie Umwelt schwer verseucht.
Was im Bombenhagel der Nato passiert,ist vergleichbar mit einem katastrophalenGroßunfall in der chemischen oder derÖlindustrie, jedoch nicht in einer Fabrik,sondern an über einem Dutzend über dasgesamte Territorium verteilten Standorten– sozusagen eine tägliche Neuauflage derSandoz-Katastrophe, die 1986 den Rheinheimsuchte.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
„Im Erdöl“, warnt Hans-Joachim Uth,Chemiestörfall-Experte am Berliner Um-weltbundesamt, „ist alles mögliche an Stof-fen drin.“ Aus den zerbombten petroche-mischen Werken dringt rußbeladenerQualm, der polycyclische aromatische Koh-lenwasserstoffe und Schwermetalle übergroße Entfernungen transportiert, dazunoch ein ganzes Sortiment gesundheits-schädlicher Stoffe, die gleichfalls alskrebserregend oder genverändernd einge-stuft werden.
Den zerstörten Chemie- und Düngemit-telfabriken entweichen Ammoniak und un-gezählte andere toxische Verbindungen.Anlagen der Chlorchemie blasen, einmal inBrand geschossen, mit ihren RauchfahnenDioxine, Furane und PCB (PolychlorierteBiphenyle), sämtlich krebserregend, in dieAtmosphäre – ähnlich wie im italienischen
* In der zerstörten Autofabrik Zastava in Kragujevac.
U M W E LT
Warten auf die Giftwelle Bei der Vernichtung der jugoslawischen Infrastruktur durch die Bomberflotten der
Nato werden schwere ökologische Schäden in Kauf genommen. Zurück bleibt eine lebensfeindliche Umwelt – auch wenn die Waffen wieder schweigen.

Belgrad
Ni∆
Kragujevac
Novi Sad
Pri∆tina
Skopje
Leskovac
Sarajevo
Montenegro
J U G O S L A W I E N
RUMÄNIEN
BULGARIENKosovo
Vojvodina
ALBANIEN
Valjevo
Kraljevo
ObrenovacPan‡evo
Sombor
∏a‡ak
Zaje‡ar
Smederevo
Kru∆evac
Ökologische Begleitschäden Nato-Zerstörungen mit hohem Umweltrisiko
Lu‡ani
Podgorica
MAZEDONIEN
BOSNIEN-HERZEGOWINA
KROATIEN
Tanklager
Fabrikanlage
Raffinerie
Chemiefabrik
DonauBari‡
Adria
Wissenschaft
GAM
MA /
STU
DIO
X
Seveso, wo 1976 ein überhitzter Produk-tionskessel explodierte.
Allein die ausgebombten Raffinerienvon Pan‡evo und Novi Sad verfügten überJahreskapazitäten von 5,5 beziehungs-weise 2,5 Millionen Tonnen. Genaue Zah-len sind nicht bekannt, doch müssen esnach Expertenschätzungen Hunderttau-sende Tonnen Benzin, Öl und Gas gewesensein, die seit Beginn der Luftangriffe inFlammen aufgingen.
Aus der Atmosphäre wandert die Gift-fracht in den Boden, von dort über dieNahrungskette oder über das Grundwasserzurück zum Menschen. Langzeitfolgen sindprogrammiert.
Die Regierung in Belgrad warnt seit Wo-chen vor einer Umweltkatastrophe, dieauch die Nachbarländer heimsuchen werde.Einen Ölteppich von 20 Kilometer Länge inder Donau meldete der jugoslawische Um-weltminister Dragoljub Jeroviƒ, alles Lebenin diesem Teil des Stroms sei zerstört.
Die Schadstoffe aus den zerbombten Industrieanlagen treiben bis zur Mün-dung am Schwarzen Meer. „Wir rechnen in drei Wochen mit der großen Giftwel-le“, sagt Andreas Wurzer, Donau-Exper-te des World Wide Fund for Nature inWien. Das Problem seien vor allem die„extrem langfristigen Belastungen derÖko-Systeme“.
Slobodan Tresac, Direktor des petroche-mischen Komplexes in Pan‡evo, beschwordie Nato, die Angriffe auf die Fabrikanlagen,deren Wert ausländische Experten vor
Kriegsbeginn auf fast eine Milliarde Dollartaxiert hatten, einzustellen. Sonst, so Tresac,drohe ein „Umweltdesaster“ mit nicht ab-sehbaren Folgen. Ein paar Tage später wa-ren die Bomber wieder da.
Weil die Rauchfahnen wie Ikonen desLuftkriegs Abend für Abend beweiskräftigüber die Bildschirme ziehen, fällt es derNato nicht leicht, die Einlassungen aus Bel-grad als Propaganda abzutun.
Das ökologische Desaster könnte nocheskalieren: Seit den ersten Kriegstagen zie-len Nato-Bomber auch auf Chemiewerke,in denen sie Milo∆eviƒs Kampfstoffpro-duktion vermuten. Die Produktionsstättenund mögliche C-Waffen-Depots sollen ver-nichtet werden ohne das Risiko dramati-scher Giftgas-Freisetzungen. Vergleichs-weise gefahrlos verbrennen die Ultragiftejedoch nur bei großer Hitze.
An vier Produktionsstandorten, von de-nen mindestens die Anlagen in Bari‡ we-nige Kilometer südlich von Belgrad undim Örtchen Lu‡ani bei ∏a‡ak schon unterNato-Feuer lagen, soll in großem Stil Gift-gas hergestellt oder noch aus Tito-Zeitenübernommen worden sein.
Das Regime in Belgrad, behaupten west-liche Geheimdienste, verfüge über die Ner-
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
vengase Sarin, Senfgas, Phosgen, VX undTabun in Mengen, die ausreichen würden,die gesamte Bevölkerung des Kosovo, Ma-zedoniens und Albaniens umzubringen.Letzte Woche berichtete darüber der britische „Observer“ unter Berufung aufkroatische Militärs, die vor dem Zerfall Ju-goslawiens am Chemiewaffenprogrammder Serben beteiligt waren.
Serbische Regierungsvertreter warntendie Nato vor zwei Wochen, die Chemiefa-brik in Bari‡ erneut anzugreifen. Dort, sohieß es, würden Chemikalien zur Wasch-mittelherstellung produziert. In Lagertanksbefänden sich hochgiftige Vorprodukte. InWirklichkeit, berichtet der „Observer“,werde dort Sarin produziert und gelagert.
Auch in Lu‡ani, das die Nato-Bombermindestens fünfmal ins Visier nahmen,werde das Nervengas hergestellt. Die An-lage sei von serbischen Truppen nach Aus-bruch des Bosnien-Kriegs nahe der StadtMostar ab- und bei Lu‡ani wieder aufge-baut worden.
Präzisionslenkwaffen der Nato, die ihrZiel mitunter weit verfehlen, rücken einweiteres Horrorszenario in den Bereichdes Möglichen. Was, wenn ein solcher Irr-läufer den Forschungsreaktor von Vinca
225

Uran-MunitionPanzerbrechende Giftlast
AP
trifft, ebenfalls in der Nähe von Belgrad?Im Lagerbecken des Uralt-Meilers aus denfünfziger Jahren rosten seit Dekaden 30Atommüllfässer mit rund 5000 verbrauch-ten Uranbrennelementen vor sich hin.
Gasbildung läßt den Druck im Innernder Aluminiumfässer ständig anschwellen.Schon vor der Bedrohung von außen seidas ein wachsendes Problem gewesen,erklärt ein Sprecher der InternationalenAtomenergiebehörde in Wien.
Mit jedem Nato-Treffer auf die jugosla-wische Infrastruktur wächst mittlerweileauch in den Nachbarländern Ungarn, Bul-garien, Rumänien und Griechenland dieSorge, von der Ökokatastrophe vor der ei-genen Haustür in Mitleidenschaft gezogenzu werden.
Mehr noch als in anderen Anrainerlän-dern gaben in Griechenland die Öko-Schützer Alarm und heizten die Anti-Nato-Stimmung im Lande an. Sensoren an derUniversität von Thraki im Nordosten Griechenlands registrierten leicht steigen-de Dioxin- und PCB-Werte in der Luft.Sollte der Anstieg tatsächlich auf die Bom-bardements in Serbien zurückgehen, ließedies Rückschlüsse zu auf Belastungen,denen auch die serbische Bevölkerung ausgesetzt sein muß.
Eine fast schon beängstigende Ruheherrscht dagegen an der deutschen Öko-front. Mit Demonstrationen,Analysen undGutachten stritten die Umweltaktivistenvon Greenpeace vor acht Jahren gegen dieUmweltverseuchung im Golfkrieg; der da-malige BUND-Vorsitzende Hubert Wein-zierl sprach wortgewaltig von einem „Krieggegen die Schöpfung“. Diesmal sind dieÖkopaxe verstummt.
Greenpeace, das sein Golfkrieg-Engage-ment mit schweren Spendeneinbrüchen inden USA bezahlte, erklärt sich nun in ei-nem gewundenen Statement („Das ist nichtunsere Aufgabe“) für unzuständig undsammelt Spielzeug für die vertriebenenKinder aus dem Kosovo. Auch der BUNDgibt sich kleinlaut. Unter Mitgliedern undFörderern gebe es eben Gegner und Be-fürworter der Nato-Angriffe.
Allein die „Ärzte gegen Atomkrieg“meldeten sich zu Wort – auf einem Ne-benkriegsschauplatz. Die atomkritischenMediziner geißeln eine zuerst im Krieg gegen Saddam Hussein eingesetzte pan-zerbrechende Spezialmunition, in derenGefechtskopf zur Verstärkung der Durch-schlagskraft abgereichertes Uran einge-baut ist. Das schwachstrahlende U-238, an-derthalb mal so schwer wie Blei, ist ein Abfallprodukt aus der Atomwirt-schaft.
Die mit dem Schwermetall verstärktenWaffen, so das Argument der Kritiker, hät-ten jene Spätschäden verursacht, von de-nen zivile Opfer des Golfkriegs und an der„Operation Wüstensturm“ beteiligte US-Soldaten heimgesucht wurden. Allerdingskursiert zur Erklärung des sogenannten
d e r s p i e g e226
Golfkriegssyndroms noch eine Vielzahlweiterer Theorien – die Uranthese zähltzu den unwahrscheinlicheren.
Strahlenfachleute wie der MarburgerNuklearmediziner Horst Kuni oder Micha-el Sailer vom Öko-Institut in Darmstadtsehen das Risiko der Panzerknacker-Mu-nition eher woanders. Zwar sei eine krebs-auslösende Wirkung nicht auszuschließen,wenn jemand schwachstrahlende Uran-partikel inhaliert. Doch mindestens eben-so brisant wie mögliche Strahlenschädensei die chemische Toxizität des Schwerme-talls. Metallisches Uran, erläutert Sailer,sei in seiner Giftigkeit vergleichbar mitCadmium, und das bringe schließlich auchniemand mutwillig tonnenweise in dieBiosphäre.
Einstweilen erregt der potentielle Ein-satz der Uranmunition – die von der Natonach eigenen Angaben bisher nicht ver-wendet wurde – die deutschen Gemüterstärker als die realen Giftschwaden überSerbien und dem Kosovo.
Unterdessen denken die Ölmanager we-niger an den Krieg als an die Zeit danach.„We don’t comment on the war“, sagtShell-Sprecher James Herbert in Lon-don. Auch der Mineralölwirtschaftsver-band in Hamburg verspricht Wohlverhal-ten: Das jetzt verhängte internationaleEmbargo werde strikt eingehalten – „aberirgendwann werden da wieder moder-ne Raffinerien gebraucht. Dann sind wirdabei“.
Als einsamer Rufer begründet der SPD-Linke Hermann Scheer seine Gegnerschaftzu den Nato-Angriffen auch mit Umwelt-argumenten. Die Bombardierungen hätteneine „ökologische Katastrophe mit weit-räumigen und langfristigen Konsequen-zen“ ausgelöst.
Unterstützung kommt von führendendeutschen Umweltmedizinern. Die warfender Nato nach einer Tagung in der evan-gelischen Akademie Loccum vor, mit dersystematischen Bombardierung der petro-chemischen Industrie in Jugoslawien wer-de der humanitären Katastrophe eine„Umweltkatastrophe hinzugefügt“.
Knut Krusewitz, Umwelt- und Friedens-forscher an der Technischen UniversitätBerlin, ging noch weiter. Die Nato, die vor20 Jahren beschlossen habe, zur „Schaf-fung einer menschenwürdigen Umwelt“einen bedeutsamen Beitrag leisten zu wollen, führe nun auf dem jugoslawischenTerritorium einen „stummen Giftgas-krieg“. Sebastian Knauer, Gerd Rosenkranz
l 1 8 / 1 9 9 9

Werbeseite
Werbeseite

22
Wissenschaft
Familienfilm „Das Fest“: Den Vater als Vergewaltiger entlarvt
ARTH
AU
S
P S Y C H O L O G I E
Brodeln im TopfWie Geheimnisse und Lügen das Familienleben
vergiften können, beschreibt eine amerikanische Psychiaterin.Der Umgang mit dem Tabu sei oft ein „Hochseilakt“.
Ich hasse Familienfeste.“ Diesen Satzhat die amerikanische PsychiaterinEvan Imber-Black in ihrer langjährigen
Praxis viele Male gehört. Der schöneSchein, mit dem Hochzeiten, Jubiläen undGeburtstage zelebriert werden, verdecktallzuoft Abgründe, in denen es von Span-nungen brodelt.
Ursache sind Geheimnisse, die zwischenPaaren, Eltern und Kindern oder auch er-wachsenen Geschwistern nisten: Ob Adop-tion, Abtreibung oder Alkoholismus,ob sexueller Mißbrauch, Ehebruch, stig-matisierende Krankheiten oder auch diedunkle politische Vergangenheit eines Familienmitglieds – als Tabu prägt Unaus-gesprochenes, mitunter über Generatio-nen, die Beziehungen zwischen Ehepart-nern,Vätern und Müttern und ihren Nach-kommen.
Welchen Einfluß Geheimnisse auf dasSeelenleben des einzelnen und das kom-plizierte System Familie haben können,hat die New Yorker Therapeutin auf „mu-tigen Expeditionen“ (Imber-Black) erfah-ren, die Klienten mit ihr gewagt haben –auf der Suche nach bewußt oder unbewußtzugeschütteten Altlasten. „Die Macht desSchweigens“, so formuliert es Imber-Blackin ihrem Buch, das diesen Titel trägt, habe
8
sich auf das Zusammenleben „wie Betonausgewirkt, der allmählich erstarrt“*.
Aus Scham oder Angst oder auch ausMachtwillen gehütete Familiengeheim-nisse, so zeigt die Autorin anhand vielerFallgeschichten, sind oftmals Ursprungscheinbar unerklärlichen Verhaltens; dasVertuschen und Zudecken „raubt Energie,zerstört Spontaneität und Selbstwertgefühlund behindert die emotionale Entwick-lung“. Manche Betroffenen reagieren mitZwangshandlungen, Gewalttätigkeit oderauch mit Selbstdestruktion.
Ein Befreiungsakt, der die Patienten ausdem Lug-und-Trug-Gespinst erlöst, solltejedoch behutsam vorbereitet und insze-niert sein, rät die Therapeutin, denn derUmgang mit dem Tabu gleiche einem„Hochseilakt“. So müsse die Frage „Ver-heimlichen oder Offenlegen“ in jedem Ein-zelfall neu entschieden werden.
Wer es wagt, das lang und sorgfältig Ver-schwiegene abrupt aufzudecken, hebt da-mit den Deckel von einem Dampfkochtopf– ein schonungsloser Eingriff, wie ihn un-längst der dänische Regisseur Thomas Vin-terberg in seinem Film „Das Fest“ zeigte:
* Evan Imber-Black: „Die Macht des Schweigens“. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart; 376 Seiten; 39,80 Mark.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Am 60. Geburtstag des Vaters entlarvt Sohn Chri-stian in seiner Tischrededen jovialen Patriarchenals Pädophilen, der, mitWissen der Mutter, Chri-stian und seine Zwillings-schwester als Kinder miß-braucht hat; der Selbst-mord der Schwester warvermutlich Folge der jahre-langen Vergewaltigungen.
Als Schock erlebte, inganz anderer Konstella-tion, US-AußenministerinMadeleine Albright dieplötzliche Eröffnung ei-nes wohlverwahrten Fa-miliengeheimnisses. Erst1997 erfuhr die Politikerin,daß ihre Großeltern tsche-chische Juden und inAuschwitz umgekommenwaren. Gleichzeitig siehtsie sich auch mit dem Vor-wurf konfrontiert, daß ihrVater bei der Emigrationaus Prag 1947 unrecht-
mäßig erworbene Kunstgegenstände mit-genommen habe (SPIEGEL 17/1999).
Wie viele andere Kinder, mit denen Psy-chiaterin Imber-Black in der Familienthe-rapie arbeitete, habe auch Madeleine Al-bright lange Zeit „mit einem übermächti-gen Widerspruch gelebt“: Sie fügte sich derRegel, den katholischen Eltern keine lästi-gen Fragen zu stellen, folgte aber zugleichdem inneren Drang, sich als Historikerinmit demjenigen Teil der Welt zu beschäfti-gen, in dem ihre Wurzeln verborgen lagen.
Von der Öffentlichkeit wurde das bloß-gelegte Familiengeheimnis der Ministerinaufgegriffen. Im Zeitalter der Talkshowsmit ihrem Zwang zu Enthüllungen, so klagtdie Psychiaterin, „verliert der einzelnerasch die Verfügungsgewalt über sein Ge-heimnis“. Voyeurismus und Pseudo-Ehr-lichkeit schaden nach ihrer Erfahrung denBetroffenen, die sich „nach wie vor mitder Frage quälen, wie und wann man denKindern mitteilt, daß ihre Mutter Alkoho-likerin oder ihr Vater arbeitslos gewordenist oder daß ihr Bruder an einer manisch-depressiven Erkrankung leidet“.
Nicht der plötzliche Aufwasch, sondernschrittweises und planvolles Enthüllenkonnte denjenigen helfen, die unter Ge-heimhaltung und Lügen jahrelang gelittenhatten. Mit kleineren Diebstählen in Lädenoder zu Hause reagierten beispielsweiseKinder, die sich im Elternhaus von einemschmerzlichen Rätsel ausgegrenzt fühlten– so die zehnjährige Elana, deren Vater we-gen Unterschlagung im Gefängnis saß, an-geblich aber beruflich im Ausland war undvon dort einmal wöchentlich anrief. Dievon Scham gequälte Mutter leugnete auchden unübersehbaren wirtschaftlichen Ab-stieg der Familie.

Familientherapeutin Imber-Black„Das Schweigen wirkt wie Beton“
T. E
VER
KE
Elana spürte instinktiv die Unaufrich-tigkeit und setzte, so die Therapeutin Im-ber-Black, „von einem schmerzlichen Rät-sel ausgegrenzt, das Familiengeheimnis deskriminellen Verhaltens gleichsam selber inSzene“.
Viele scheinbar rätselhafte Verhaltens-weisen dienen in solcherlei Situationen of-fenbar dazu, das „unaussprechliche, jen-seits der Worte dennoch bekannte Ge-heimnis metaphorisch darzustellen“ – undwerden plötzlich verständlich. So erklärtensich die Weigerungen eines Kindes, außer-halb des Hauses den Mund aufzumachen,oder auch die heftigen Magenschmerzeneiner Frau, die immer bei gesellschaftli-chen Anlässen auftraten, bei denen auchdie heimliche Geliebte ihres Mannes an-wesend war.
Weil um das insgeheim allen bekannteGeheimnis ein Geheimnis gemacht wurde– etwa wenn eine Adoption, ein Selbst-mord oder sexueller Mißbrauch ver-schwiegen werden –, entstanden unsicht-bare Trennwände zwischen den Familien-mitgliedern.
Der Schritt zum Therapeuten, bei demdie Betroffenen ihr schmerzendes Ge-heimnis offenlegen können, so betont Im-ber-Black, solle immer nur der Anfang sein:Erst wenn beispielsweise Eltern und Ge-schwister einbezogen worden sind, wennGespräche statt wütender Konfrontation
stattfinden, können Tabu-Themen erfolg-reich angegangen werden, bis sie keineMacht mehr über die Opfer haben – wie imFalle der 32jährigen Anna, die erst zweiJahrzehnte nach einer totgeschwiegenenVergewaltigung, die sie im Alter von zwölfJahren erlitten hatte, ihr Leben und ihre fa-miliären Beziehungen wieder ins Gleich-gewicht brachte.
„Wer hat meiner Familie eingeredet, daßmeine biologischen Wurzeln nicht wichtigseien? Warum diese Geheimniskrämerei?“So klagte, wütend, verwirrt und voller Fra-
gen, ein junger Mann aus der Klientel derTherapeutin. Er schleppte eine schwere Lastmit sich herum: Weil er durch heterologe In-semination gezeugt wurde, blieb ihm dieeine Hälfte seiner Identität verborgen – seinVater ist ein unbekannter Samenspender.
Mit den neuen Fortpflanzungstechnolo-gien, die „etwas so Entscheidendes wie dieHerkunft eines Kindes“ verschleiern kön-nen, aber auch mit dem Einzug der SeucheAids haben sich zusätzlich „enorme Felderder Geheimnisbildung aufgetan“, wie Im-ber-Black sagt.
Über all dem schmerzhaften Verborge-nen dürfe aber auch nicht vergessen wer-den, daß manche Geheimnisse auch „süßund belebend“ sein können. Die Psych-iaterin erinnert Eltern daran, daß Kinder,in einer nicht kontrollierten eigenen Sphä-re, ihre kleinen Geheimnisse brauchen, umSelbständigkeit zu erproben.
„Ein leichtes Unbehagen“ verspürt dieTherapeutin immer dann, wenn Paare ihr erklären, sie hätten keinerlei Geheim-nisse voreinander. Meist seien solche Be-ziehungen „langweilig und trist gewor-den“. Denn wenn es unter Liebenden„keinerlei Abgrenzung, kein unabhängigesSelbst, keine privaten Briefe oder Tage-bücher, keinen Raum für eigene Träume,nichts Rätselhaftes mehr gibt“, sagt Imber-Black, „dann schwindet die Freude am Un-terschied“. Renate Nimtz-Köster

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

232
Wissenschaft
K L I M A
„Sehr komplexe Vorgänge“Atmosphärenforscher Thomas Peter
über die überraschende Ozon-Zunahme am Nordpol
Ozonkon-zentrationin Dobson-Einheiten
450
400
350
300
250
200
150
März1996
März1997
März1998
März1999
DFD
/D
LR
Satelliten messen die Ozondichte über derNord-Hemisphäre. Seit Jahren dünnt die Ozon-schicht im Frühjahr aus – besonders deutlich1996 und 1997. Jetzt veröffentlichte Datenzeigen jedoch: In den beiden letzten Jahren hatsich die Situation entschärft.
Peter, 41, ist Professor für Atmosphären-chemie an der ETH in Zürich. Im Rahmeneiner internationalen Studie simulierte eram Computer die Vorgänge in der Ozon-schicht über der Arktis.
SPIEGEL: Herr Professor Peter, an die Mel-dung: „Die Ozonschicht schwindet“ hatsich die Öffentlichkeit gewöhnt. Jetzt siehtplötzlich alles anders aus: In diesem Früh-jahr wurde über dem Nordpol soviel Ozongemessen wie seit zehn Jahren nicht mehr.Sind Sie überrascht?Peter: Wir wußten, daß der letzte Winterungewöhnlich warm war. Und wenn eswarm ist in der unteren Stratosphäre, alsoin etwa 15 bis 30 Kilometern Höhe, ist dasgut für das Ozon.SPIEGEL: Sie haben noch im März prophe-zeit, daß die Ozonschicht, die die Erde vorUV-Strahlung schützt, sogar schnellerschwinden werde als bisher gedacht.Peter: Die Klimaforscher können auch nichtnach einem einzigen warmen Sommer sa-gen: Der Treibhauseffekt ist da. Dasselbegilt für die Ozonschicht: Die letzten beidenWinter waren warm, aber das liegt im Rah-men der natürlichen Schwankungen. Baldwird es wieder kältere Winter geben. Unddann kann es noch schlimmer kommen alsin den Wintern 1995/96 oder 1996/97.SPIEGEL: Die Produktion der ozonschädi-genden FCKW geht zurück. Was läßt Sietrotzdem fürchten, daß es schlimmer wird?Peter: Die Vorgänge in der Stratosphäresind sehr komplex. Sie besser zu verstehenist Ziel unserer Arbeit. 1985 hat man dasantarktische Ozonloch entdeckt. Damalswurde klar: Chlor wird in eine aggressive,ozonzerstörende Form umgewandelt. Die-se Reaktion läuft aber nur auf sehr kaltenTeilchenoberflächen, in sogenannten Stra-tosphärenwolken, ab.Dem Chlor wirken andere Moleküle, dieStickoxide, entgegen. Man muß sie sichvorstellen wie zwei Mafiagangs: Beide grei-fen das Ozon an. Wenn sie aber zusam-menstoßen, bekämpfen sich diese Gangsgegenseitig. Das heißt, sie reagieren mit-einander und neutralisieren sich.SPIEGEL: Das läßt das Ozonloch noch nichtwachsen …Peter: Nein. Entscheidend ist, daß nun nochder Treibhauseffekt ins Spiel kommt: Erführt am Boden zur Erwärmung. Gleich-zeitig aber kühlt sich die Stratosphäre ab.Das fördert die Bildung von Wolken unddamit von mehr Teilchenoberflächen. Dasheißt: Das Chlor wird besser aktiviert.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Außerdem fallen, wenn größere Wolken-teilchen entstehen, mit diesen auch mehrStickoxide aus der Stratosphäre nach un-ten. Der Gegenspieler des Chlors geht da-bei verloren.SPIEGEL: Wird über der Arktis bald einOzonloch wie über der Antarktis klaffen?Peter: Ich kenne keinen Forscher, der sichgegenwärtig trauen würde, diese Frage mit
Ja oder Nein zu be-antworten. Jeden-falls wird die Arktisder Antarktis ähn-licher. Beunruhi-gend ist zudem,daß die Arktis an einer Schwellesteht: Schon einekleine Abkühlungreicht aus, um die Ausfällung vonStickoxiden dra-stisch zu verstär-ken. Im Laufe des
nächsten Jahrhunderts könnten die Tem-peraturen in der Arktis um rund drei Gradsinken – und unsere Rechnungen zeigen:Dann wird’s ernst.SPIEGEL: Noch scheinen derlei Vorhersagenmit großen Unsicherheiten behaftet zusein. Der Ozonschwund über der Antark-tis ist viel besser verstanden. Warum?Peter: Über dem Südpol zirkuliert die Luftwie festgenagelt in einem gewaltigen Wirbel – ein sehr stabiles Phänomen.Ganz anders in der Arktis: Dort strömtdie Luft über Gebirge. Land- und Wasser-massen sind viel unregelmäßiger verteilt.Das erzeugt Wellen in der Stratosphäre,der arktische Wirbel ist deshalb vielschwächer.SPIEGEL: Und in diesem Jahr hat er sichdann gar nicht gebildet?Peter: Doch. Aber er hatte andere Eigen-schaften als in den Jahren zuvor. In war-men Wintern wird viel Luft aus mittlerenBreiten nach Norden transportiert. Mit ihrgelangt auch Ozon in die Polregion.SPIEGEL: Zuverlässig vorhersehen könnenSie diese Prozesse aber nicht?Peter: Jedenfalls nicht von Winter zu Win-ter.Aber eines scheint ziemlich sicher: DerTreibhauseffekt wird den Ozonabbau be-schleunigen. Die Einzelheiten zu verste-hen ist viel schwieriger. So kann sich dieStratosphäre in den Polarregionen sehrschnell erwärmen: Im Verlaufe von zwei,drei Tagen zerbricht der Wirbel; große Ge-biete ozonarmer Luft werden dann in mitt-lere Breiten gespült.SPIEGEL: Wenn, wie Sie befürchten, derOzonschild über der Arktis schwindet,droht dann Gefahr für die Deutschen?Peter: Für alle Nordeuropäer, für die Kanadier und für Sibirien. Auch wir zählen zur Gefahrenzone. In der End-phase des Winters 1990/91 wanderte derWirbel einmal sogar bis nach Griechen-land. Interview: Johann Grolle
Ozonforscher Peter
R.
DO
ELLY
/ K
EYS
TO
NE P
RES
S Z
ÜR
ICH
/ D
PA

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

236
Technik
Inform
K O M M U N I K A T I O N
Regieren per MausklickEin futuristisches Datennetz verbindet die Ministerien in
Bonn und Berlin. Doch die Modernisierung der Verwaltung ist in zaghaften Ansätzen steckengeblieben.
Regieren mit LichtDer InformationsverbundBerlin-Bonn
Ber l inBonn
Nordtrasse
Südtrasse
Für die Kommunikation der zwischen Bonn und Berlin aufgeteiltenMinisterien und Behörden wurde ein eigenes Datennetz eingerichtet.Für maximale Ausfallsicherheit verbinden zwei Glasfaser-Leitungen,die Nord- und Südtrasse, beide Städte.
An jedem Ort teilenzwei „ZentraleVermittlungsknoten“den Datenstrom auf.Rund ein Dutzend
Ringleitungenversorgen je-weils bis zu dreiGebäude, diewiederum aufzwei Wegen andie Daten-pipeline ange-schlossen sind.
ationsverbund-Videokonferenz (Demonstration): Gepanzert und getarntFO
TO
S:
C.
BAC
H
Schwere Stahltüren schützen die fen-sterlosen Räume, die nur Angestelltemit Spezialausweis betreten dürfen.
Kein Hinweisschild verrät die Gebäude,die den Zentralen Vermittlungsknoten des „Informationsverbunds Berlin-Bonn“(IVBB) beherbergen.
An diesen Orten würde schon eine Na-gelschere ausreichen, um die Regierungs-maschine ins Stottern zu bringen: Hier ver-lassen die Hauptschlagadern des behördli-chen Datenkreislaufs für einige Meter ihredickwandigen Betonkanäle – ein stroh-halmdünner, gelber Kunststoffschlauch trittzutage. Er umhüllt eine haarfeine Glasfa-ser, durch die Hunderte von Millionen La-serlichtblitze pro Sekunde zwischen denRegierungsorten Berlin und Bonn hin- undherflitzen.
„So was gibt es in keinem anderen Landder Welt“, erklärt Projektmanager UweKelm von der Telekom-Tochter DeTeSy-stem.Aufdringlich rauscht die Klimaanlage,steriles Neonlicht fällt auf die langen Reihenvon Schaltschränken. Alle ministeriellenComputernetze, der Telefon- und Fax-verkehr, aber auch Parlamentsfernsehenund Videokonferenzen werden hier auf dieDatenrennstrecke geschickt. So schrumpftdie Entfernung zwischen Berlin und Bonnelektronisch auf Null. Im 21. Jahrhundertkann per Mausklick regiert werden.
Seit Januar läuft der Glasfaserverbundim „Wirkbetrieb“. Rund um die Uhr sind
die Leitstände in Bonn und Berlin besetzt.Alle kritischen Komponenten sind dop-pelt ausgelegt. Zwischen den Regierungs-städten verlaufen zwei getrennte Faser-trassen, in jeder Stadt verbinden Glas-faserringe die angeschlossenen Gebäude(siehe Grafik) – zu 99,75 Prozent störungs-freier Betrieb, so lautet die ehrgeizige Vor-gabe.
Die Leitungen sind zum Schutz vor Sa-botage gepanzert und getarnt. Bis zur Ge-
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
heimhaltungsstufe „Nur für den Dienstge-brauch“ schützen Verschlüsselungsgerätedas elektronische Schriftgut vor unbefug-ten Lauschern.
Die geballte Technik soll zusammenlei-men, was die Politik per Parlamentsbe-schluß zerstückelt hat: Nach dem Um-zugskompromiß von 1991 werden in dennächsten Monaten 8 von 14 Ministerien mitihrem Hauptsitz an die Spree umsiedeln,doch zwei Drittel der Arbeitsplätze bleibenin Bonn.
Kein Problem, versprachen die Planerdes IVBB.Auch Unternehmensberater undVerwaltungswissenschaftler sahen in demhindernisreichen Umzug geradezu eineJahrhundertchance zur Modernisierungder Bundesverwaltung.
Es war die Vision von einem kühnenSprung der Exekutive ins Digitalzeitalter:Die Ministerien, so der Plan, werden zu-nächst intern vernetzt und stellen ihre Ar-beitsabläufe auf die Datentechnik um.Wenndann das Stühlerücken zwischen Bonn undBerlin stattfindet, machen elektronische Ak-ten den Gang ins Archiv überflüssig, sind E-Mail und Videokonferenz alltäglicheKommunikationsmittel der Beamten, undder Standort spielt keine Rolle mehr.
Rund 80 Millionen Mark wurden überJahre hinweg für Pilotprojekte aufge-wendet; da ging es um „multimediale Vorzimmer“ und „elektronische Umlauf-mappen“, um digitale Verwaltungswerk-zeuge mit wohlklingenden Namen wie„Poliwork“ und „Poliflow“. Die Soft-ware „Domea“ wurde entwickelt, die den traditionellen Aktenwagen ersetzensollte.
Die neuen Telefonanlagen, die über denIVBB miteinander verbunden sind, gau-keln der Außenwelt virtuell vereinteBehörden vor – wer die Vorwahl 01888wählt, merkt gar nicht, ob das Telefon sei-nes Gesprächspartners in Bonn oder Ber-lin klingelt. Doch sonst hat die ausgefeilte

Werbeseite
Werbeseite

Technik
verbund-Zentrale: Rund um die Uhr besetzt
Elektronik im Behördenalltag bisher kaumSpuren hinterlassen.
Kurz vor der Jahrtausendwende unddem großen Treck nach Berlin führt in denMinisterien immer noch der dickleibigeAktenordner sein antiquiertes Regiment.Ganze 25 Arbeitsplätze sind bislang aufelektronische Vorgangsbearbeitung umge-stellt: Die Mitabeiter der KBSt („Koordi-nierungs- und Beratungsstelle der Bundes-regierung für Informationstechnik in derBundesverwaltung“) erproben das digita-le Büro im heroischen Selbstversuch.
Schon vor Jahren hatte die Industrie,gute Geschäfte witternd, mit plastischenBildern dargelegt, wie schön das elektro-nische Regieren sein kann: Im Werbefilmfür den IVBB fällt ein Verkehrs-Staatsse-kretär aus dem Fond seiner Dienstlimou-sine multimedial Entscheidungen.
Während das Auto lautlos über sonnigeAlleen in Mecklenburg zu einer Bürger-versammlung gleitet, läßt sich der Chef vonseinem Mitarbeiterstab ins Bild setzen.Aufdem Display im Rückenpolster des Fahrer-sitzes erscheint der Abteilungsleiter ausBerlin. Der hat sich vor demChefgespräch, ebenfalls perVideo, bei einer Referentin inBonn schlau gemacht undzaubert dem Entscheider ak-tuelle Straßenbaupläne aufden Monitor.
Doch die Zukunftsvisionvon Bildschirm und Videoka-mera auf jedem Schreibtischund gar im Auto verblaßt nunin den Hochglanzprospekten.Die Hoffnung auf den„schlanken Staat“, der diePapierberge hinter sich läßt,hat sich nicht erfüllt.
Beinahe nichts wurde ent-rümpelt: Acht Jahre nachdem Umzugsbeschluß siehtdie Wirklichkeit in den Mini-sterialbüros so resopalbeigeaus wie eh und je.
Statt zu modernisieren, haben Politikerund Bürokraten die Zeit mit Graben-kämpfen verbracht. In endlosen Arbeits-gruppensitzungen wurden Stellenquotenfür Berlin ausgewürfelt, Tauschplätze fürBonn gesucht, Abteilungen zerteilt, Refe-rate herüber- und hinübergezogen und Möbelschablonen fürs Büro in der neuenHauptstadt geklebt.
Als Fortschritt muß schon gelten, daß injedem Ressort wenigstens einige Mitarbei-ter per E-Mail kommunizieren. Eine klareStrategie jedoch, wie deren Vorteile gegen-über Fax und Büroboten zu nutzen wären,gibt es nicht. Der IVBB hat für die Ministe-rien auf absehbare Zeit lediglich den ange-nehmen Nebeneffekt, daß innerhalb des Da-tennetzes keine Telefongebühren anfallen.
Videokonferenzen? Alle Forschungs-vorhaben wurden beendet. Die von denEntwicklern erdachten Systeme waren
Informations
238
nur von „Mitarbeitern mit sehr gutem Tech-nikbezug“ zu bedienen, so ein leidgeprüf-ter Versuchsteilnehmer. Erst jetzt sind halb-wegs praxistaugliche Systeme marktreif.
Als erstes sollen nun „Gruppenkonfe-renzräume“ eingerichtet werden, in denensich Arbeitsgruppen zur Telebesprechungtreffen können.
Doch ob die benutzt werden, ist fraglich.Der Verwaltungswissenschaftler WernerJann, Professor an der Universität Pots-dam, sieht schwarz. „Wer wichtig sein will,muß bei der Besprechung persönlich da-beisein“, prophezeit er. Ehrgeizige Mini-steriale würden es sich nicht nehmen las-sen, persönlich zwischen Bonn und Berlinhin- und herzujetten.
Elektronische Aktenarchive? Fehlan-zeige. Die Umlaufmappe läuft und läuft.Andas weitgehend papierlose Büro ist nicht zudenken. „Für so was haben wir gar keineZeit“, sagt der Leiter des Technik-Referatesim Bundespresseamt,Thomas Schmidt, „wirmüssen schließlich den Umzug planen.“
Die Büro-Software Domea versprichtRationalisierungseffekte von hohen Gra-
den. Jedes Schriftstück, das der KBSt insHaus kommt, wird mittels Scanner digita-lisiert. Jedes Mitglied der Arbeitsgruppekann sich ein Abbild des Dokuments aufden Bildschirm seines PC holen.
Am Computer erstellte Schriftsätze wer-den in digitalen Akten verwaltet, Mitar-beiter können Stellungnahmen elektro-nisch anheften,Vorgesetzte sie per Tasten-druck abzeichnen – kein Vorgang mußmehr über den Flur getragen werden.
Die Domea-Akten präsentieren sichnicht als undurchschaubare Stapel, son-dern als wohlgeordnete Aufreihung vonSymbolen auf dem Bildschirm. Auf Befehl durchsucht der Computer dendigitalen Aktenberg nach Stichworten.Allerdings: „Das eigentliche Problem istgar nicht die Technik“, hat KBSt-LeiterRolf Krost erkannt, „das wichtigste ist dieOrganisation der Arbeitsabläufe.“ Nur
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
wenn der verwinkelte Dienstweg begra-digt und gestrafft wird, läßt sich der Ak-tenumlauf elektronisch nachbilden.
Zwei verblüffende Erfahrungen mußteKrost beim Umgang mit der Büro-Softwaremachen: Während die schier endlosen Li-sten identischer Bildschirmsymbole denBenutzer oft eher hilflos machen, vermö-gen alte Verwaltungshasen auch in dickenAktenkonvoluten relevante Informationenaufzuspüren, weil sie Formulare und Brief-köpfe schon beim oberflächlichen Durch-blättern erkennen. Und: Manche Beamtefinden sich von elektronischen Akten inihrer Handlungsfreiheit eingeengt.
Zwar ist im allgemeinen jeder Verwal-tungsakt bis ins kleinste durch Vorschriftengeregelt, doch in jahrzehntelanger Praxishaben sich alle Beteiligten ihre kleinen per-sönlichen Freiräume erobert. Da kann maleine Mappe tagelang auf einem Schreib-tisch verschollen sein oder eine unbeque-me Entscheidung wochenlang durch Um-lauf zur Mitzeichnung verschleppt werden.
Domea hingegen protokolliert für jedensichtbar, wer welches Dokument wann
gesehen und bearbeitet hat.Jeder Vorgesetzte und wo-möglich gar der Bundesrech-nungshof könnten in der glä-sernen Amtsstube online jedesSchriftstück nachverfolgen.
Inzwischen sind, in Bonnwie in Berlin, die hochdotier-ten Pilotversuche ausgelau-fen. Bis zum Ende dieses Jah-res soll nun die KBSt in einerweiteren Studie untersuchen,welche derzeit erhältlichenSysteme für die elektronischeVerwaltung geeignet wären.
Über deren Einführungmuß jedes Ministerium dannfür sich entscheiden. Krosthofft, daß „die Häuser dasAngebot annehmen“. Daselektronische Büro danntatsächlich im Verwaltungs-
alltag zu installieren, schätzt er, dürfte nocheinmal drei bis fünf Jahre dauern.
Die moderne, schlanke Exekutive bleibtfürs erste eine Illusion auf Wiedervorlage.Der Umzug, der eigentlich Anlaß zumgroßen Entrümpeln sein sollte, dient unter-des sogar als wirksame Blockade. Für einelängst überfällige Inventur und Reform des monströsen Apparates anläßlich desOrtswechsels sei es „zu spät“, erklärte resi-gniert der zuständige Innenminister OttoSchily, SPD, schon kurz nach seinem Amts-antritt.
Daß es der Technik jemals gelingen wer-de, den unsinnigen Umzugskompromiß von1991 halbwegs erträglich zu machen, be-zweifeln inzwischen viele. Hinter vorge-haltener Hand verraten Spitzenbeamte ihreletzte verbliebene Hoffnung: „In einigenJahren wird jeder merken, daß das so nichtgeht.“ Petra Bornhöft, Jürgen Scriba

Wissenschaft
S E U C H E N
Sprung über dieArtgrenze
Ein bislang unbekanntes Virus tötet Menschen, Schweine, Hunde
und Pferde in Malaysia.Ein Massaker an den Tieren soll
die Seuche stoppen.
Soldat beim Erschießen von Schweinen: Hauptsache, sie sind aus der Welt
AP
Schweine haben keinen leichten Standin Malaysia. Über die Hälfte der Be-völkerung ist muslimischen Glaubens.
„Babi“, wie das Tier auf malaiisch heißt,gilt ihnen als unrein und widerlich.
Auch den Freunden des Schweins, derMinderheit von Chinesen und Indern, istder Appetit nun vergangen. Schiere Panikist ausgebrochen rund um MalaysiasSchweinefarmen, die bedeutendsten vonganz Südostasien.Tausende Menschen sindaus ihren Dörfern geflohen, denn diequiekenden Borstentiere scheinen dieQuelle zu sein für ein neuartiges, fürSchwein wie Mensch tödliches Virus.
Mindestens 117 Todesopfer, so sagen US-Seuchenexperten, hat das bislang weltweitunbekannte Virus gefordert, fast alle Er-krankten hatten in der Schweinezucht ge-arbeitet. Auch im benachbarten Singapurhat das Virus zugeschlagen. Ein Mann starb,der im Schlachthaus malaysische Schweinezerteilt hatte.
Zum Kampf gegen den Erreger hat Ma-laysia seine Armee ins Feld geschickt. SeitWochen streifen Soldaten durch die Ställe.Sie treiben die Schweine in Pferche undstürzen sie in Erdlöcher hinab, dann feuernsie aus Gewehren auf die zuckenden Lei-ber. Jede füsilierte Sau, so hoffen sie, ist einVirusträger weniger.
35000 Stück Borstenvieh sollen die Sol-daten täglich erschießen, hilfsweise verga-sen oder lebendig unter den Baggerschau-feln in der Grube begraben – Hauptsache,sie sind aus der Welt. Über eine MillionSchweine haben die Keul-Kommandos derArmee in den letzten Wochen umgebracht.Während weite Teile der betroffenen Halb-insel förmlich entschweint sind, hängt übervielen Dörfern pestilenzartiger Gestank –im Tropenklima zeigt sich schnell, wo dieBagger nur eine dürftige Schicht Erde überdie Kadaver geschoben haben.
Das mysteriöse Virus, das mit diesemMassaker bekämpft werden soll, heißt „Ni-pah“, benannt nach dem Bezirk Sungai Ni-pah, in dem es zuerst aufgetaucht ist. Alsweltweit führende Seuchenpolizei habendie Centers for Disease Control (CDC) imamerikanischen Atlanta bereits elf Detek-tive zur Klärung der Epidemie nach Ma-laysia entsandt, auch australische Speziali-sten sind angereist.
Sie alle wissen bislang wenig über das Vi-rus, aber sie sind besorgt, denn der Erregerist gefährlich: Er hat schon viel mehr Men-schen getötet als die Hongkonger Vogel-grippe und BSE zusammen.
Bei Schweinen wie Menschen wurde dasVirus in Lungen, Nieren und Rückenmarkgefunden. Infizierte Tiere atmen schwer,husten und dämmern lethargisch vor sichhin. Jeweils zwei Wochen nach den Tierenerkranken die Menschen, so die Schätzungder Experten. Zur Ansteckung reicht of-fenbar Kontakt mit Körperflüssigkeiten derTiere aus. Nach Fieber und Kopfschmerzfallen die Kranken der Verwirrung anheim,ein großer Teil der Infizierten rutscht insKoma und stirbt. Gegenmittel gibt es nicht.
Das Virus scheint die gespenstischeFähigkeit zu haben, Artgrenzen müheloszu überspringen. Zwei Hunde waren infi-ziert, die vor ihrem Tod offenbar dasFleisch getöteter Schweine gefressen hat-ten. Auch im Pferdestall eines Polo-Clubsnahe Kuala Lumpur wurde das Virus ver-gangene Woche nachgewiesen, einige Rös-ser sollen der Seuche schon erlegen sein.
Womöglich befällt der Erreger sogarRatten, Katzen und Fledermäuse; Testswerden nun auch ausgeweitet auf Hühner,Ziegen und Kühe. Die Armee bekämpftdie Seuche unterdessen weiter mit demSchießgewehr – sie hat Befehl, in den Kri-senregionen Tausende von streunendenHunden und Katzen zu vernichten.
Viele Todesopfer, so werfen Kritiker dermalaysischen Regierung vor, hätten ver-mieden werden können, wenn die Behör-den nicht stur auf den Tourismus geschieltund beständig den Ausbruch des bisher un-bekannten Virus geleugnet hätten. Schon
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
im September 1998 waren Arbeiter aufSchweinefarmen gestorben, wahrschein-lich an dem Nipah-Virus. Mediziner hattendie Seuche damals als die häufig vorkom-mende Japanische Enzephalitis (JE) ge-deutet. Zäh beharrten die Behörden aufdieser Einschätzung – selbst dann noch, alsschon Menschen starben, die gegen JE er-folgreich geimpft waren.
Die Experten der CDC empfehlen Rei-senden, sich der Gefahr vor allem „in derUmgebung von Schweineställen bewußt“zu sein. Ansonsten seien bislang keine be-sonderen Vorsichtsmaßnahmen nötig. Ob-wohl die Übertragungswege noch längstnicht geklärt sind, verbreitet sich das Virusnach bisherigen Erkenntnissen nicht durchAnsteckung von Mensch zu Mensch. Auchder Verzehr von gegartem Schweinefleischgilt als unbedenklich.
Das Nipah-Virus wurde inzwischen ein-geordnet in die Familie der Paramyxo-Vi-ren, der auch die Erreger von Masern undHundestaupe angehören. Sein offenbarnächster Verwandter ist das Hendra-Virus,das 1994 in Australien 15 Rennpferde undzwei Trainer niederstreckte. Größere Epi-demien blieben damals aus.
Viele der rund 300000 Chinesen, die aufder malaysischen Halbinsel Schweinezuchtbetreiben, sind nach den Massentötungenruiniert. Zu ihren Gunsten will die Regie-rung eine Lotterie abhalten.
Auf staatliche Entschädigungszahlungenfür ihre getöteten „unreinen“ Tiere könnendie Bauern nicht hoffen. Die Abneigung derregierenden Moslems gegen „Babi“ geht imzensurgeplagten Malaysia so weit, daß nochnicht einmal das Wort im Fernsehen ausge-sprochen werden darf. Marco Evers
239

Werbeseite
Werbeseite

Werbeseite
Werbeseite

242
Technik
A U T O M O B I L E
Pingpong im TürspaltDas Geschäft mit Panzerlimousinen floriert, seit in Rußland,
Südafrika und Osteuropa die Kriminalität zunimmt. Fachleute warnen: Kein Auto ist völlig schußfest.
Bau einer Panzerlimousine bei DaimlerChrysler*:
Wie Kuchenteig biegt sich das fingerdicke Blech unter dem keilförmigen Stanzkopf der
Hydraulikpresse. 100 Tonnen Druckkraft,gesteuert von der sicheren Hand eines Karosseriebauers, ergeben ein millimeter-genaues Bauteil.
Etwa 500 dieser Teile bilden das zweiteBlechkleid eines im Mercedes-Werk Sin-delfingen hergestellten Modells, das in derFirmensprache „Sonderschutzfahrzeug“oder neuerdings „Guard“ heißt. Bekannt istes unter dem Namen „Panzerlimousine“.
25 Mann-Tage pro Wagen sind nötig, umdie Fahrgastzelle lückenlos mit Dickblechzu füttern. Jede Durchgangsstelle für Ka-bel oder elektrische Fensterheber muß auf-wendig ummantelt werden. SämtlicheSchweißnähte ziehen die Monteure vonHand. In der gesamten Fertigungsstraßeder Mercedes-Sonderschutzfahrzeuge stehtkein einziger Roboter.
Auch Besucher gab es dort bisher nicht.Seit Daimler-Benz vor 70 Jahren die er-sten gepanzerten Limousinen der Welt aus-lieferte, unter anderem an den japanischenKaiser Hirohito, zählte die Sonderschutz-technik zu den bestgehüteten Geheimnis-sen der Autoindustrie.
Die exotische Sparte stellte ohnehin kei-nen rentablen Geschäftszweig dar. Marke-ting schien überflüssig. Zu klein war derpotentielle Käuferkreis. Seit 1928 verkauf-te Mercedes nicht mehr als rund 4000 ge-panzerte Fahrzeuge. Staatsoberhäupterund hochgefährdete Wirtschaftskapitänezu beliefern war eine reine Prestigefrage;Geld wurde damit nicht verdient.
Doch in jüngster Zeit hat sich die Situa-tion gewandelt. Die wachsende Angst vorStraßenkriminalität, vor allem in Osteuro-pa, Rußland, Südafrika, Mittel- und Süd-amerika, führte zu einer Springflut von Be-stellungen. Der Weltmarkt für Panzerli-mousinen, schätzt Josef Schumacher, Lei-ter der Abteilung Sonderfahrzeuge beiDaimlerChrysler, wuchs schlagartig vonwenigen 100 auf über 10000 Neuwagen proJahr an.
Unvermittelt brach in einer bislang im verborgenen dümpelnden Branche der Konkurrenzkampf aus. Mercedes,lange Zeit der einzige Hersteller, der im eigenen Werk Sonderschutzfahrzeuge fertigte, muß nun mit BMW und Audi wetteifern, aber auch mit unab-hängigen Firmen, die entweder in Eigen-
d e r s p i e g e
regie oder im Auftrag anderer HerstellerFahrzeuge in harte Schalen packen. DerBremer Sonderschutzanbieter Trasco etwa wird im August eine neue Fabrikeröffnen und dann 200 Mitarbeiter be-schäftigen.
Der Wettbewerbsdruck lockt die Pan-zerexperten von Mercedes aus derDeckung. Offensiv informieren sie überden bislang streng geheimen Sonderschutzund preisen die Vorzüge der Hochrüstungim Herstellerwerk. „Was wir machen, ist imnachhinein schlicht nicht möglich“, beteu-ert Schumacher. Die Panzerbleche werdenin Sindelfingen schon vor dem Zusam-menbau der einzelnen Karosserieteile ein-gesetzt. Vor allem an den Türkanten, denverwundbarsten Stellen des Fahrzeugs, giltes, den Innenraum gegen drohende Stahl-gewitter abzudichten.
Zwischen Tür und Rahmen entsteht bei den Mercedes-Autos eine abgestufteStruktur. Das eindringende Projektil sollan den Kanten abgelenkt werden, wie einPingpongball im Spalt hin- und herflirrenund so schrittweise seine Energie verlieren.
Im Bereich der Türfugen haben die Stutt-garter Sicherheitstechniker bereits bittereErfahrungen gemacht. Am 16. August 1985wurde der gepanzerte Mercedes 380 SEL
* Mit Simulationsgewichten für den späteren Einbau derPanzerglasscheiben.
l 1 8 / 1 9 9 9

25 M
des deutschen Botschafters in Beirut vonchristlichen Milizen beschossen. Eine vonmehr als 20 Kugeln durchschlug die Dach-säule und tötete den Chauffeur.
Solche Konstruktionsmängel, versichertSchumacher, seien inzwischen behoben.Im Juni 1995 hielt der Dienst-Mercedes desägyptischen Präsidenten Husni Mubarakeinem Kugelhagel stand. Ebenso erfolg-reich schirmte ein gepanzerter S-Klasse-Wagen den georgischen Staatschef Eduard
Test-Einschüsse Türkanten als verwundbarste Stellen
ann-Tage für lückenloses Dickblech
FO
TO
S:
B.
BEH
NK
E
Schewardnadse vor einem Jahr gegen dieSchüsse von Terroristen ab.
Die Schutzwirkung des Fahrzeugs, seies ab Werk oder nachträglich gepanzert,kann relativ genau bestimmt werden. Se-riöse Anbieter lassen sich die Wider-standskraft behördlich beglaubigen. DasBeschußamt Ulm gilt als zentrale Instanzfür Sonderschutzfahrzeuge in Deutschland.Nach einer dreistufigen Untersuchung klas-sifizieren die amtlichen Waffenexpertenden jeweiligen Wagentyp.
Stufe eins ist die Rohbaubesichtigung,bei der Türfugen, Schweißnähte und Ver-schraubungen untersucht werden. Danach
d e r s p i e g e
folgt die Analyse von Materialproben imLabor und zuletzt die Fahrzeugbe-schußprüfung auf dem Schießstand derBehörde, wo gezielt auf die Problemzonender Karosserie gefeuert wird.
Ein in den Klassen VR 1 bis VR 4 einge-stuftes Fahrzeug muß Pistolen- und Re-volverschüssen standhalten.VR 5 bis VR 7steht für die Resistenz gegen Gewehrfeu-er, dessen Projektile erheblich schnellerund somit schlagkräftiger sind. Ein Merce-des der E-Klasse in der Kategorie VR 4 ko-stet etwa 180000 Mark, die S-Klasse in VR-7-Ausführung rund eine halbe Million.
Dennoch bieten auch die extremen Pan-zerungen letztlich keinen totalen Schutz.Rudolf Frieß, Dienststellenleiter des Ul-mer Beschußamts, meidet Begriffe wie„schußsicher“ oder „schußfest“. Der waf-fenkundige Oberbaurat spricht lieber voneiner „Durchschußhemmung“, die seineBehörde bescheinigen könne.
Das Zertifikat gilt nur für einzelneSchüsse aus der jeweiligen Waffengattung.Beim Dauerbeschuß mit Maschinenge-wehren, sagt Frieß, „ist es nur eine Frageder Zeit, bis ich durch bin“.
Der Spielraum der Konstrukteure ist be-grenzt, denn Schutz bedeutet Masse, unddie ist beim Auto ein sensibles Thema. EinWagen der S-Klasse in VR-7-Ausführungwiegt leer 3,4 Tonnen, gut anderthalb Ton-nen mehr als das Serienmodell. Die Schei-ben sind dick wie Tischplatten und wiegenallein mehrere hundert Kilogramm. EineGasdruck-Servo-Unterstützung hilft beimÖffnen der wuchtigen Türen. Aus Ge-wichtsgründen verzichten die Ingenieureauf einen Schutzpanzer für den Tank. Stattdessen ist er mit Kunststoff beschichtet,der sich nach Durchschüssen sofort wiederschließt.
Das Sonderschutzfahrzeug, sagt Mer-cedes-Ingenieur Schumacher, „muß einPkw bleiben, der auf Luftreifen fährt“.Spezialpneus mit einer auf 210 Stunden-kilometer begrenzten Höchstgeschwindig-keit tragen die mobilen Trutzburgen. Las-sen Kugeln den Reifen platzen, so rollt dasGefährt auf Vollgummiringen im Felgen-bett weiter.
„Den Kunden klarzumachen, daß dieSchutzwirkung Grenzen hat“, sagt ein Trasco-Manager, „ist eine unserer oberstenMaximen.“ Vor allem Sprengstoffattentä-tern lasse sich kaum mit Technik begegnen.
Am 30. November 1989 zerfetzte ein amStraßenrand deponierter Sprengkörper inBad Homburg einen schwergepanzertenMercedes der S-Klasse und tötete dessenInsassen Alfred Herrhausen, den Vor-standssprecher der Deutschen Bank.
Nach Einschätzung der Mercedes-Kon-strukteure hätte auch heute, zwei Modell-generationen später, selbst maximaler Pan-zerschutz das Leben des Bankiers nichtretten können. Schumacher: „Der Spreng-satz damals hätte einen Schützenpanzerzerstört.“ Christian Wüst
l 1 8 / 1 9 9 9 243

2
Wissenschaft
Röntgenbild des Nachthimmels*: „Wir schauen den Schwarzen Löchern beim Fressen zu“
A S T R O N O M I E
Suche nach den SternenleichenExplodierende Sonnen, Galaxien auf Crash-Kurs, monströse Sternenfresser – Astronomen wollen
den heißesten Objekten im Universum mit einer Armada von Röntgenteleskopen nachspüren.Als erstes der neuen Weltraum-Observatorien flog der deutsche Satellit „Abrixas“ ins All.
Die Dienstanweisung klang nach ei-ner Schikane. Im letzten Herbst un-tersagte der Bremer Satellitenher-
steller OHB-System seinen Technikern,morgens Rasierwasser zu benutzen.
Mit dem Parfüm-Verbot sollte das Welt-raumteleskop „Abrixas“, das in einemReinraum in Bremen montiert wurde, vorVerunreinigungen geschützt werden. „Vonder Haut verdunstendes Kölnisch Wasser“,erzählt OHB-System-Mitarbeiter AlfredTegtmeier, „hätte sich womöglich alsSchmierschicht auf den empfindlichen Te-leskopspiegeln niedergeschlagen.“
Schon beim Bau der Spiegel war esäußerst pingelig zugegangen. Die Inge-nieure von Carl Zeiss in Oberkochen schu-fen eine der glattesten jemals vonMenschenhand gefertigten Oberflächen.Auf die Fläche des Bodensees hochge-rechnet: Wäre das Gewässer ähnlich spie-gelglatt, dürfte sein Wasser höchstens Wel-len von einem Zehntel Millimeter Höheschlagen.
Der Aufwand galt einem ganz besonde-ren Himmelsspäher: Abrixas soll nicht dassichtbare Licht der Sterne auffangen – son-dern die weit schwerer zu fassende Rönt-
* Aufgenommen mit dem Röntgensatelliten „Rosat“.
44
genstrahlung, die aus den Tiefen des Raumsauf die Erde prasselt.
Jetzt muß sich die deutsche Maßarbeitim Weltraum bewähren.Am Mittwoch letz-ter Woche startete eine „Kosmos“-Raketevom militärischen Weltraumbahnhof „Ka-pustin Jar“ in der russischen Steppe, 150Kilometer östlich von Wolgograd, undbrachte das Teleskop in eine erdnahe Um-laufbahn. Als schon die ersten Krimsekt-korken knallten, wurde das Bodenpersonalnoch einmal nervös: Abrixas meldete sichnicht. Erst kurz nach Mitternacht gelangder Funkkontakt. „Wir haben ein tollesBaby geboren“, schwärmt Abrixas-Pro-jektleiter Joachim Trümper vom Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Phy-sik in Garching. „Nun muß es nur nochzum Leben erweckt werden.“
In den nächsten Tagen werden die Bord-instrumente durchgecheckt. Schon amHimmelfahrtstag könnte das fliegende Ob-servatorium die ersten Bilder aus dem Or-bit funken. Abrixas wird dann einen sehrungewöhnlichen Blick auf den Sternen-himmel bieten: Durch die Röntgenaugendes Satelliten betrachtet, sieht der Welt-raum nicht dunkel aus, sondern scheint zubrennen. Gleichmäßig aus allen Richtun-gen kommt glühendes Schummerlicht.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Die für menschliche Augen unsichtbareRöntgenstrahlung entsteht im Weltall ähn-lich wie in medizinischen Durchleuch-tungsgeräten: Werden extrem schnelleElektronen ruckartig abgebremst, so feuernsie, gleichsam als atomarer Reibungsver-lust, einen energiegeschwängerten Rönt-genlichtblitz ab.
Die Partikel bewegen sich allerdings erstdann ausreichend schnell, wenn unvor-stellbar hohe Temperaturen erreicht wer-den. Das Röntgenteleskop stellt somit eineArt Fieberthermometer für Himmelskör-per dar: Abrixas erfaßt mit seinen Meßin-strumenten Materie im All, die eine Tem-peratur von mehreren Millionen Grad hat.
„Mit dem neuen Röntgensatelliten wer-den wir die heißesten Objekte im ganzenUniversum sehen“, freut sich Günther Hasinger, Abrixas-Projektleiter am Astro-physikalischen Institut in Potsdam. „Rönt-genstrahlen werden meist bei äußerst dra-matischen Ereignissen im All freigesetzt –beispielsweise wenn Sterne explodierenoder wenn Galaxien zusammenstoßen.“
Der Start von Abrixas war nur der Auf-takt. In rascher Folge werden demnächstweitere Röntgensatelliten in die Umlauf-bahn gebracht. Während Abrixas’ Haupt-aufgabe darin bestehen wird, als eine Art

Kundschafter bislang unbekannte Röntgen-quellen im All aufzuspüren, sollen die ihmnachfolgenden Himmelsspäher die interes-santesten Objekte dann genauer erforschen:π Voraussichtlich noch in diesem Sommer
hievt eine Raumfähre den amerikani-schen Satelliten „Chandra“ ins All, einefünf Tonnen schwere, extrem scharf-sichtige Röntgensternwarte (Baupreis:umgerechnet 3,6 Milliarden Mark). Mitdiesem Meß-Monster könnte etwa dasSterben von Sonnen genauer als bisheruntersucht werden.
π Spätestens Mitte Dezember schießt dieeuropäische Raumfahrtbehörde Esa ihrhaushohes Röntgenobservatorium XMMins All – den größten jemals in Europa,unter anderem bei Dornier in Fried-richshafen, gebauten Forschungssatelli-ten (Baupreis: eine Milliarde Mark). Dasfliegende Superteleskop ist so lichtemp-findlich, daß es noch die extrem schwacheRöntgenstrahlung zu registrieren vermag,die kurz nach dem Urknall vor 15 Milli-arden Jahren entstand. Die Astrophysikerhoffen deshalb unter anderem, mit XMMdie Entstehung des Universums besserals bisher zu verstehen.
π Im Januar 2000 soll der japanische Rönt-gensatellit Astro-E ins All gebracht wer-den.Auch Rußland plant ein eigenes erd-umkreisendes Röntgenobservatorium.„Daß jetzt eine ganze Armada von
Röntgenteleskopen ins All fliegt, ist keinZufall“, konstatiert Astrophysiker Hasin-ger. „Zu dieser Offensive hat uns der sen-sationelle Erfolg von ,Rosat‘ ermuntert.“
Erst dieser 1990 gestartete deutsche For-schungssatellit verhalf der Röntgenastro-nomie, die bis dahin ein Schattendasein ge-führt hatte, zum Durchbruch. Das Haupt-problem hatte in früheren Jahren darin be-standen, daß die harte Strahlung aus demAll vom Erdboden aus nicht wahrnehmbarist; sie wird – Voraussetzung für irdischesLeben – von der Atmosphäre vollständigabgeblockt. Anfangs mußten sich die Him-melsforscher damit begnügen, Forschungs-raketen und Höhenballons mit primitivenGeigerzählern an Bord aufsteigen zu lassen.
Vor Beginn der Rosat-Mission warendeshalb nur wenige tausend Himmelskör-per bekannt, die Röntgenlicht abstrahlen.Erst mit Rosat begannen die Himmelsfor-scher eine systematische Fahndung – bisheute haben sie über 150000 neue Rönt-genquellen aufgespürt, darunter äußerstexotisch anmutende Welten.
Der Forschungssatellit beobachtete bei-spielsweise die heißesten Sterne der Milch-straße, sogenannte Weiße Zwerge, derenTemperatur bis zu hundertmal höher istals die der Sonne. In ihrem Innern herr-schen so mächtige Drücke, daß dort Dia-manten gebacken werden. Im SternbildHerkules fotografierte der Satellit einensogenannten Neutronenstern, dessen Ma-terie so dicht gepackt ist, daß ein Fingerhutdavon 100 Millionen Tonnen wiegt. Auch
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9

Wissenschaft
Astrophysiker Aschenbach: Vor 700 Jahren explodierte eine erdnahe Sonne
W.
M.
WEBER
Röntgensatellit „Abrixas“ (Fotomontage) „Blick bis ans Ende der Welt“
wurde Rosat Zeuge eines galaktischen Kan-nibalismus, bei dem eine Galaxie eine an-dere verschlingt. Tausende Astrophysikerauf der ganzen Welt haben mit dem Rönt-gensatelliten eigene Messungen vorgenom-men; aufgrund der von Rosat übertragenenDaten wurden mittlerweile 3500 wissen-schaftliche Arbeiten verfaßt.
Zur Legende wurde Rosat aber vor al-lem wegen seiner Langlebigkeit: Der Sa-telliten-Oldie war einfach nicht totzukrie-gen. Ursprünglich nur für eine Betriebs-zeit von höchstens zwei Jahren gebaut,funkte Rosat auch nach acht Jahren täglichaus seiner Umlaufbahn die Datenmengevon 800 Megabit an die Bodenstation inOberpfaffenhofen (das entspricht 24 Bän-den einer Brockhaus-Enzyklopädie).
Rosat glich einem Auto, das nach Jahr-zehnten noch kaum Roststellen aufweist.Erst im Laufe des letzten Jahres fielen im-mer mehr Instrumente aus, es ging zu Ende.„Ende Dezember wurde der Todkranke inTiefschlaf versetzt“, erzählt AstrophysikerTrümper, der als der Vater des Satellitengilt. „Als wir ihn dann Anfang des Jahreswieder aufweckten, gab Rosat kaum nochLebenszeichen von sich.“
Vor wenigen Wochen schalteten die Ster-nenforscher ihren Satelliten endgültig ab –leichten Herzens auch deshalb, weil derStart der Rosat-Nachfolger unmittelbar be-vorstand.
Von der nächsten Generation der Rönt-genteleskope erhoffen sich die Astrono-men nun einen weiteren Sprung nach vorn:„Mit Rosat haben wir bis ans Ende derWelt geblickt“, so Trümper, „nun werdenwir noch etwas weiter schauen.“
Die Hauptschwäche von Rosat bestandkurioserweise darin, daß er nur energiear-
246
mes Röntgenlicht sehen konnte, also nurStrahlung, die keinerlei Hindernisse durch-dringen mußte. Die neuen Satelliten hin-gegen registrieren auch energiereichereStrahlung. „Das macht einen gewaltigenUnterschied“, erläutert Astrophysiker Ha-singer. „Rosat konnte nur schwaches Rönt-genlicht auffangen, das bereits in einemBlatt Papier steckenbleibt – mit Abrixas,XMM oder Chandra nehmen wir erstmalsStrahlung wahr, die ein Telefonbuch zudurchdringen vermag.“
Die Astrophysiker hoffen deshalb, end-lich jene Orte im All zu durchleuchten, aufdie der direkte Blick bislang versperrt war.Besonders die Galaxienzentren liegen zu-
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
meist hinter dichten Schwaden aus Staubund Gas verborgen. Die neuen Röntgente-leskope könnten Signale aus diesen finste-ren Regionen auffangen, die zu den ge-heimnisvollsten im Kosmos gehören.
In den letzten Jahren fanden die Astro-physiker immer mehr Hinweise darauf, daßin den Herzen vieler Galaxien gigantischeSternenfresser ihr Unwesen treiben. DasSchwerefeld dieser sagenhaften SchwarzenLöcher ist so gewaltig, daß sie, monströsenStaubsaugern gleich, ganze Sonnensystemean sich ziehen und für immer verschlin-gen. Bei diesem Feuerwerk der Vernich-tung entstehen heftige Röntgenblitze.
Der letzte Beweis, daß in fast jeder Ga-laxie ein solches Schwerkraftmonster lau-ert, steht indes noch aus. AstrophysikerHasinger gibt sich zuversichtlich: „Mit Abrixas werden wir den Schwarzen Lö-chern ins Maul schauen und ihnen beimSternenschmaus zusehen.“
Auch eine andere dramatische Todesartvon Sternen soll unter Einsatz des neuenRöntgenteleskops näher erkundet werden.Besonders massereiche Sterne treten miteiner gewaltigen Explosion von der Him-melsbühne ab: Ist ihr Fusionsofen erlo-schen, zerplatzen sie wie ein angestochenerLuftballon und schleudern ihre glühendeGashülle hinaus in den Leerraum. Dabeistrahlt der sterbende Stern, eine soge-nannte Supernova, tagelang so hell wieeine ganze Galaxie. Noch Jahrtausendespäter sind die Gasfetzen einer solchen Ex-plosionswolke, die durch die Weiten desAlls wabern, mehrere Millionen Grad heiß.
Das Röntgenobservatorium Rosat hatviele solcher Supernova-Überreste aufge-spürt und fotografiert. Bei der Auswertungälterer Rosat-Daten stieß der GarchingerAstrophysiker Bernd Aschenbach kürzlichauf einen 30 Millionen Grad heißen Ster-nenkadaver, der 700 Lichtjahre von derErde entfernt durch den Weltraum treibt –so nah wie kaum ein anderer.
„Die fremde Sonne ist vor rund 700 Jah-ren direkt in unserer kosmischen Nachbar-schaft explodiert“, berichtet Aschenbach.„Den Menschen im 13. Jahrhundert könn-te diese spektakuläre Supernova so hell wieder Vollmond erschienen sein.“
Eine derart junge Supernova stellt bis-lang die Ausnahme dar. Ansonsten ent-deckte Rosat nur weit ältere Sternenüber-bleibsel. „Allein in der Milchstraße müßtees in den letzten 5000 Jahren eigentlichüber 20 Supernovae gegeben haben“, sagtAschenbach, „aber mit Rosat konnten wirdie einfach nicht finden.“
Nun soll sich Abrixas auf die Suche nachden verschollenen Sternenleichen bege-ben. Doch was, wenn auch das neue Rönt-genteleskop nicht fündig werden sollte?„Dann wäre klar“, so Aschenbach, „daß al-tersschwache Sterne viel seltener explo-dieren, als wir bislang dachten – und Son-nen fast immer einen ruhigen Tod ster-ben.“ Olaf Stampf

Werbeseite
Werbeseite

d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
HERAUSGEBER Rudolf Augstein
CHEFREDAKTEUR Stefan Aust
STELLV. CHEFREDAKTEURE Dr. Martin Doerry, Joachim Preuß
DEUTSCHE POL IT IK Leitung: Dr. Gerhard Spörl, Michael Schmidt-Klingenberg. Redaktion: Karen Andresen, Dietmar Hipp, BerndKühnl, Joachim Mohr, Hans-Ulrich Stoldt, Klaus Wiegrefe. Autoren,Reporter: Dr. Thomas Darnstädt, Matthias Matussek,Walter Mayr,Hans-Joachim Noack, Dr. Dieter WildDEUTSCHLAND Leitung: Clemens Höges, Ulrich Schwarz.Redaktion: Klaus Brinkbäumer, Annette Bruhns, Doja Hacker,Carsten Holm, Ulrich Jaeger, Sebastian Knauer, Ansbert Kneip,Udo Ludwig, Thilo Thielke, Andreas Ulrich. Autoren, Reporter:Jochen Bölsche, Henryk M. Broder, Gisela Friedrichsen, Norbert F. Pötzl, Bruno SchrepWIRTSCHAFT Leitung: Armin Mahler, Gabor Steingart. Redak-tion: Dr. Hermann Bott, Konstantin von Hammerstein, Dietmar Hawranek, Frank Hornig, Hans-Jürgen Jakobs, Alexander Jung,Klaus-Peter Kerbusk, Thomas Tuma. Autor: Peter BölkeAUSLAND Leitung: Dr. Olaf Ihlau, Dr. Romain Leick, FritjofMeyer, Erich Wiedemann. Redaktion: Dieter Bednarz,Adel S. Elias,Manfred Ertel, Rüdiger Falksohn, Hans Hielscher, JoachimHoelzgen, Siegesmund von Ilsemann, Claus Christian Malzahn,Dr. Christian Neef, Roland Schleicher, Dr. Stefan Simons, HeleneZuber. Autoren, Reporter: Dr. Erich Follath, Carlos WidmannWISSENSCHAFT UND TECHNIK Leitung: Johann Grolle, JürgenPetermann. Redaktion: Dr. Harro Albrecht, Marco Evers, Dr.Stefan Klein, Dr. Renate Nimtz-Köster, Rainer Paul, Alexandra Rigos, Matthias Schulz, Dr. Jürgen Scriba, Olaf Stampf, ChristianWüst. Autoren, Reporter: Klaus Franke, Henry Glass, Dr. HansHalter, Werner HarenbergKULTUR UND GESEL LSCHAFT Leitung: Wolfgang Höbel, Dr.Mathias Schreiber. Redaktion: Susanne Beyer,Anke Dürr, Nikolausvon Festenberg,Angela Gatterburg, Lothar Gorris, Dr.Volker Hage,Dr. Jürgen Hohmeyer, Ulrike Knöfel, Dr. Joachim Kronsbein, Rein-hard Mohr,Anuschka Roshani, Dr. Johannes Saltzwedel, Peter Stol-le, Dr. Rainer Traub, Klaus Umbach, Claudia Voigt, Susanne Wein-garten, Marianne Wellershoff. Autoren, Reporter: Ariane Barth,Uwe Buse, Urs Jenny, Dr. Jürgen Neffe, Cordt Schnibben, Alexan-der Smoltczyk, Barbara SuppSPORT Leitung: Alfred Weinzierl. Redaktion: Matthias Geyer, JörgKramer, Gerhard Pfeil, Jörg Winterfeldt, Michael WulzingerSONDERTHEMEN Dr. Rolf Rietzler; Christian Habbe, Heinz Höfl,Hans Michael Kloth, Dr.Walter Knips, Reinhard Krumm, GudrunPatricia PottSONDERTHEMEN GESTALTUNG Manfred SchniedenharnPERSONAL IEN Dr. Manfred Weber; Petra KleinauCHEF VOM DIENST Horst Beckmann, Thomas Schäfer, Karl-HeinzKörner, Holger WoltersSCHLUSSREDAKT ION Rudolf Austenfeld, Reinhold Bussmann,Dieter Gellrich, Hermann Harms, Sandra Hülsmann, Bianca Hunekuhl, Rolf Jochum, Katharina Lüken, Reimer Nagel, Dr.Karen Ortiz, Gero Richter-Rethwisch, Hans-Eckhard Segner,Tapio Sirkka
BILDREDAKTION Michael Rabanus (verantwortlich für Innere Heft-gestaltung), Josef Csallos, Christiane Gehner; Werner Bartels,Manuela Cramer, Rüdiger Heinrich, Peter Hendricks, Maria Hoff-mann,Antje Klein, Matthias Krug, Claudia Menzel, Peer Peters, Di-lia Regnier, Monika Rick, Elke Ritterfeldt, Karin Weinberg, AnkeWellnitz. Technik: Erich Feldmeier, Carsten Schilke, E-Mail [email protected] Martin Brinker, Ludger Bollen; Cornelia Baumermann,Renata Biendarra, Tiina Hurme, Cornelia Pfauter, Julia Saur,Stefan WolffLAYOUT Rainer Sennewald, Wolfgang Busching, Sebastian Raulf;Christel Basilon-Pooch, Sabine Bodenhagen, Katrin Bollmann,Regine Braun, Volker Fensky, Ralf Geilhufe, Petra Gronau, RiaHenning, Barbara Rödiger, Doris WilhelmPRODUKT ION Wolfgang Küster, Frank Schumann, ChristianeStauder, Petra Thormann, Michael WeilandT ITELB ILD Thomas Bonnie; Stefan Kiefer, Ursula Morschhäuser,Oliver Peschke, Monika Zucht
REDAKTIONSVERTRETUNGEN DEUTSCHLAND
BERL IN Leitung: Heiner Schimmöller, Michael Sontheimer;Georg Mascolo. Redaktion: Wolfgang Bayer, Stefan Berg, PetraBornhöft, Markus Dettmer, Carolin Emcke, Jan Fleischhauer,Jürgen Hogrefe, Susanne Koelbl, Irina Repke, Dr. Gerd Rosen-kranz, Harald Schumann, Peter Wensierski, Friedrichstraße 79,10117 Berlin, Tel. (030) 203874-00, Fax 203874-12BONN Leitung: Jürgen Leinemann; Hartmut Palmer, Hajo Schu-macher. Redaktion: Martina Hildebrandt, Horand Knaup, UrsulaKosser, Dr. Paul Lersch, Dr. Hendrik Munsberg, Elisabeth Niejahr,Olaf Petersen, Rainer Pörtner, Christian Reiermann, Ulrich Schä-fer, Alexander Szandar, Klaus Wirtgen, Dahlmannstraße 20, 53113Bonn, Tel. (0228) 26703-0, Fax 215110DRESDEN Andreas Wassermann, Königsbrücker Straße 17, 01099Dresden, Tel. (0351) 8020271, Fax 8020275DÜSSELDORF Richard Rickelmann; Georg Bönisch, Frank Doh-men, Barbara Schmid-Schalenbach,Andrea Stuppe, Karlplatz 14/15,40213 Düsseldorf, Tel. (0211) 86679-01, Fax 86679-11ERFURT Almut Hielscher, Löberwallgraben 8, 99096 Erfurt,Tel. (0361) 37470-0, Fax 37470-20FRANKFURT A. M. Dietmar Pieper; Wolfgang Bittner, Felix Kurz,Christoph Pauly, Wolfgang Johannes Reuter, Wilfried Voigt, Ober-lindau 80, 60323 Frankfurt a. M., Tel.(069) 9712680, Fax 97126820HANNOVER Hans-Jörg Vehlewald, Georgstraße 50, 30159Hannover, Tel. (0511) 36726-0, Fax 3672620KARLSRUHE Postfach 5669, 76038 Karlsruhe, Tel. (0721) 22737MÜNCHEN Dinah Deckstein, Wolfgang Krach, Heiko Martens,Bettina Musall, Stuntzstraße 16, 81677 München, Tel. (089) 4180040,Fax 41800425
SCHWER IN Florian Gless, Spieltordamm 9, 19055 Schwerin,Tel. (0385) 5574442, Fax 569919STUTTGART Jürgen Dahlkamp, Katharinenstraße 63a, 73728 Esslingen, Tel. (0711) 3509343, Fax 3509341
REDAKTIONSVERTRETUNGEN AUSLANDBASEL Jürg Bürgi, Spalenring 69, 4055 Basel, Tel. (004161) 2830474,Fax 2830475BELGRAD Renate Flottau, Teodora Drajzera 36, 11000 Belgrad, Tel.(0038111) 669987, Fax 3670356BRÜSSEL Dirk Koch; Winfried Didzoleit, Sylvia Schreiber,Bd.Charlemagne 45, 1000 Brüssel, Tel. (00322) 2306108, Fax 2311436I STANBUL Bernhard Zand, Ba≠kurt Sokak No. 79/4, Beyoglu,80060 Istanbul, Tel. (0090212) 2455185, Fax 2455211JERUSALEM Annette Großbongardt, 16 Mevo Hamatmid, Jerusa-lem Heights, Apt. 8, Jerusalem 94593, Tel. (009722) 6224538-9,Fax 6224540JOHANNESBURG Birgit Schwarz, P. O. Box 2585, Parklands,SA-Johannesburg 2121, Tel. (002711) 8806429, Fax 8806484KAIRO Volkhard Windfuhr, 18, Shari’ Al Fawakih, Muhandisin,Kairo, Tel. (00202) 3604944, Fax 3607655LONDON Hans Hoyng, 6 Henrietta Street, London WC2E 8PS,Tel. (0044171) 3798550, Fax 3798599MOSKAU Jörg R. Mettke, Uwe Klußmann, 3. Choroschewskij Projesd 3 W, Haus 1, 123007 Moskau, Tel. (007095) 9400502-04,Fax 9400506NEW DELHI Padma Rao, 91, Golf Links (I & II Floor), New Delhi110003, Tel. (009111) 4652118, Fax 4652739NEW YORK Thomas Hüetlin, Mathias Müller von Blumencron,516Fifth Avenue, Penthouse, New York, N Y 10036, Tel. (001212)2217583, Fax 3026258PARIS Lutz Krusche, Helmut Sorge, 17 Avenue Matignon, 75008Paris, Tel. (00331) 42561211, Fax 42561972PEKING Andreas Lorenz, Qijiayuan 7. 2. 31, Peking, Tel. (008610)65323541, Fax 65325453PRAG Jilská 8, 11000 Prag, Tel. (004202) 24220138, Fax 24220138RIO DE JANEIRO Jens Glüsing, Avenida São Sebastião 157, Urca,22291-070 Rio de Janeiro (RJ), Tel. (005521) 2751204, Fax 5426583ROM Hans-Jürgen Schlamp, Largo Chigi 9, 00187 Rom, Tel.(003906) 6797522, Fax 6797768SAN FRANCISCO Rafaela von Bredow, 3782 Cesar Chavez Street,San Francisco, CA 94110, Tel. (001415) 6437550, Fax 6437530SINGAPUR Jürgen Kremb, 15, Fifth Avenue, Singapur 268779, Tel.(0065) 4677120, Fax 4675012TOKIO Dr.Wieland Wagner, Chigasaki-Minami 1-3-5, Tsuzuki-ku,Yokohama 224, Tel. (008145) 941-7200, Fax 941-8957WARSCHAU Andrzej Rybak, Krzywickiego 4/1, 02-078 Warschau,Tel. (004822) 8251045, Fax 8258474WASHINGTON Michaela Schießl, 1202 National Press Building,Washington, D.C. 20 045, Tel. (001202) 3475222, Fax 3473194WIEN Walter Mayr, Dr. Hans-Peter Martin, Herrengasse 8 Top 81,1010 Wien, Tel. (00431) 5331732, Fax 5331732-10
DOKUMENTATION Dr. Dieter Gessner, Dr. Hauke Janssen; Jörg-Hinrich Ahrens, Sigrid Behrend, Dr. Helmut Bott, Lisa Busch,Heiko Buschke, Heinz Egleder, Dr. Herbert Enger, Johannes Eras-mus, Cordelia Freiwald, Silke Geister, Dr. Sabine Giehle, HartmutHeidler, Gesa Höppner, Christa von Holtzapfel, Bertolt Hunger,Joachim Immisch, Michael Jürgens, Ulrich Klötzer, Angela Köllisch, Anna Kovac, Sonny Krauspe, Peter Kühn, Hannes Lamp,Marie-Odile Jonot-Langheim, Inga Lindhorst,Michael Lindner,Dr. Petra Ludwig-Sidow, Rainer Lübbert, Sigrid Lüttich, RainerMehl, Ulrich Meier, Gerhard Minich, Wolfhart Müller, BerndMusa,Werner Nielsen, Margret Nitsche, Thorsten Oltmer, AnnaPetersen, Peter Philipp, Katja Ploch, Axel Pult, Ulrich Rambow,Thomas Riedel, Paul-Gerhard Roth, Constanze Sanders, PetraSantos, Maximilian Schäfer, Rolf G. Schierhorn, EkkehardSchmidt, Thomas Schmidt, Andrea Schumann-Eckert, MargretSpohn, Rainer Staudhammer, Anja Stehmann, Claudia Stodte,Stefan Storz, Rainer Szimm, Dr. Wilhelm Tappe, Dr. Eckart Teichert, Dr. Iris Timpke-Hamel, Heiner Ulrich, Hans-Jürgen Vogt,Carsten Voigt, Peter Wahle, Ursula Wamser, Peter Wetter, AndreaWilkens, Holger Wilkop, Karl-Henning Windelbandt
BÜRO DES HERAUSGEBERS Irma Nelles
I N FORMAT ION Heinz P. Lohfeldt; Andreas M. Peets, Kirsten Wiedner, Peter ZobelKOORDINATION Katrin KlockeLESER -SERVICE Catherine StockingerSPIEGEL ONL INE (im Auftrag des SPIEGEL: a + i art and infor-mation GmbH & Co.)Redaktion: Hans-Dieter Degler, Ulrich BoomsNACHRICHTENDIENSTE AP, dpa, Los Angeles Times / WashingtonPost, New York Times, Reuters, sid, Time
Nachdruck und Angebot in Lesezirkeln nur mit schriftlicher Ge-nehmigung des Verlages. Das gilt auch für die Aufnahme in elek-tronische Datenbanken und Mailboxes sowie für Vervielfälti-gungen auf CD-Rom.
SPIEGEL -VERLAG RUDOLF AUGSTEIN GMBH & CO. KG
Verantwortlich für Vertrieb: Ove SaffeVerantwortlich für Anzeigen: Christian SchlottauGültige Anzeigenpreisliste Nr. 53 vom 1. Januar 1999Postbank AG Hamburg Nr. 7137-200 BLZ 200 100 20Druck: Gruner Druck, Itzehoe
VERLAGSLE ITUNG Fried von Bismarck
MÄRKTE UND ERLÖSE Werner E. Klatten
GESCHÄFTSFÜHRUNG Rudolf Augstein, Karl Dietrich Seikel
DER SPIEGEL (USPS No. 0154-520) is published weekly. The subscription price for the USA is $310 per annum.K.O.P.: German Language Publications, Inc., 153 South Dean Street, Englewood, NJ 07631. Telephone: 1-800-457-4443. e-mail:
info @ glpnews.com. Periodicals postage is paid at Englewood, NJ 07631, and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to: DER SPIEGEL, German Language Publications, Inc., 153 South Dean Street, Englewood, NJ 07631.
Brandstwiete 19, 20457 Hamburg, Telefon (040) 3007-0 · Fax-2246 (Verlag), -2247 (Redaktion)
E-Mail [email protected] ·SPIEGEL ONLINE www.spiegel.de·T-Online*SPIEGEL#
248
S E R V I C E
Leserbriefe SPIEGEL-Verlag, Brandstwiete 19, 20457 HamburgFax: (040) 3007-2966 E-Mail: [email protected] zu SPIEGEL-ArtikelnTelefon: (040) 3007-2687 Fax: (040) 3007-2966E-Mail: [email protected] von SPIEGEL-AusgabenTelefon: (040) 3007-2948 Fax: (040) 3007-2966E-Mail: [email protected]ür Texte und Grafiken:Deutschland, Österreich, Schweiz:Telefon: (040) 3007-2972 Fax: (040) 3007-2971E-Mail: [email protected]übriges Ausland:New York Times Syndication Sales, ParisTelefon: (00331) 47421711 Fax: (00331) 47428044für Fotos: Telefon: (040) 3007-2869Fax: (040) 3007-2966 E-Mail: [email protected] SPIEGEL auf CD-Rom / SPIEGEL TV-VideosTelefon: (040) 3007-2485 Fax: (040) 3007-2826E-Mail: [email protected], Postfach 10 58 40, 20039 HamburgReise/Umzug/ErsatzheftTelefon: (040) 411488Auskunft zum AbonnementTelefon: (040) 3007-2700Fax: (040) 3007-2898E-Mail: [email protected] Schweiz: DER SPIEGEL,Postfach, 6002 Luzern,Telefon: (041) 3173399 Fax: (041) 3173389E-Mail: [email protected] für BlindeDeutsche Blindenstudienanstalt e. V.Telefon: (06421) 606267 Fax: (06421) 606269AbonnementspreiseInland: Zwölf Monate DM 260,– Studenten Inland: Zwölf Monate DM 182,–Schweiz: Zwölf Monate sfr 260,– Europa: Zwölf Monate DM 369,20 Außerhalb Europas: Zwölf Monate DM 520,– Halbjahresaufträge und befristete Abonnementswerden anteilig berechnet.Abonnementsaufträge können innerhalb einer Wocheab Bestellung mit einer schriftlichen Mitteilung anden SPIEGEL-Verlag, Abonnenten-Service, Postfach10 58 40, 20039 Hamburg, widerrufen werden.Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Abonnementsbestellung bitte ausschneiden und im Briefumschlag senden anSPIEGEL-Verlag, Abonnenten-Service,Postfach 10 58 40, 20039 Hamburg.Oder per Fax: (040) 3007-2898.Ich bestelle den SPIEGEL frei Haus für DM 5,– proAusgabe mit dem Recht, jederzeit zu kündigen.Zusätzlich erhalte ich den kulturSPIEGEL, das monatliche Programm-Magazin.Das Geld für bezahlte, aber noch nicht gelieferteHefte bekomme ich zurück.Bitte liefern Sie den SPIEGEL ab _____________ an:
Name, Vorname des neuen Abonnenten
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Ich möchte wie folgt bezahlen:
^ Zahlung nach Erhalt der Jahresrechnung^ Ermächtigung zum Bankeinzug
von 1/4jährlich DM 65,–
Bankleitzahl Konto-Nr.
Geldinstitut
Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten
Widerrufsrecht
Diesen Auftrag kann ich innerhalb einer Wocheab Bestellung schriftlich beim SPIEGEL-Verlag,Abonnenten-Service, Postfach 10 58 40, 20039Hamburg, widerrufen. Zur Fristwahrung genügtdie rechtzeitige Absendung.
2. Unterschrift des neuen Abonnenten SP99-003
✂

d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Chronik 24. bis 30. April 1999 SPIEGEL TVD
PA
MONTAG, 3. MAI 23.00 – 23.30 UHR SAT 1
SPIEGEL TV REPORTAGEDie Abschlepper – von Parkplatznot und Bußgeldfallen
Abschleppwagen SPIEGEL TV
Rund um die Uhr machen sie Jagd aufParksünder: Politessen und Schlepper-fahrer im Dienst der Straßenverkehrs-ordnung. Ralph Quinke hat sie bei ihrerArbeit in der Münchner Innenstadt be-gleitet, die Reaktionen des gemeinen Au-tofahrers beobachtet und sich in der zen-tralen Kfz-Verwahrstelle umgesehen.
DONNERSTAG, 6. MAI22.10 – 23.00 UHR VOX
SPIEGEL TV EXTRAHochgetunt und tiefergelegt – wenn das Fahrzeug zum Kunstwerk wirdAuf der „Car + Sound“ in Sinsheim tref-fen sich alljährlich Deutschlands Hi-Fi-Fans, um neueste Entwicklungen zu be-wundern. Endstufen und Verstärker, Bo-xen und Bässe – das Angebot auf Europasgrößter Messe für mobile Elektronik istunerschöpflich. Eine Reportage über Tu-ningfans.
SAMSTAG, 8. MAI 22.00 – 23.00 UHR VOX
SPIEGEL TV SPECIALExpedition zum Loch Ness – dem Ungeheuer auf der SpurBereits in den siebziger Jahren hatte einekleine Forschertruppe versucht, Nessieauf die Spur zu kommen – jetzt reiste sieerneut zum legendären Gewässer in denschottischen Highlands, um sich ihrenTraum zu erfüllen, das Geheimnis desUngeheuers zu lüften.
SONNTAG, 9. MAI 22.15 – 23.05 UHR RTL
SPIEGEL TV MAGAZINAuf Stippvisite an der Propagandafront –Bill Clinton besucht Deutschland; amHimmel ist die Hölle los – Europas Luft-verkehr im Kriegschaos; Geld machtglücklich – der Multimilliardär WarrenBuffett und seine Fan-Gemeinde.
S A M S T A G , 2 4 . 4 .
RECHTSRADIKALE Zum zweitenmal inner-halb von acht Tagen detoniert in einemLondoner Ausländerviertel eine Bombe.Fünf Menschen werden verletzt. Für bei-de Anschläge übernimmt die britischeNeonazi-Gruppe „Combat 18“ die Ver-antwortung.
S O N N T A G , 2 5 . 4 .
KRAWALL Nach der Meisterfeier des neuenniederländischen Fußball-Champions Feye-noord Rotterdam wüten die Hooligans in der Hafenstadt. Die Polizei greift zurSchußwaffe – 16 Verletzte, 80 Festnahmen.
M O N T A G , 2 6 . 4 .
BLOCKADE EU-Außenminister beschließenin Luxemburg eine Verschärfung derSanktionen gegen Jugoslawien.
REFORM Bundeskanzler Schröder übt denSchulterschluß mit Andrea Fischer: DieGesundheitsreform soll wie geplant zum1. Januar 2000 in Kraft treten.
PARTEIEN Auf ihrem Erfurter Bundespar-teitag unterstützen die Christdemokratendie deutsche Beteiligung an den Nato-Aktionen auf dem Balkan, lehnen denEinsatz von Bodentruppen jedoch ab.
D I E N S T A G , 2 7 . 4 .
VORHERSAGE Nach Ansicht der sechs Wirt-schaftsforschungsinstitute wird die Ar-beitslosenzahl bis zum Jahresende umrund eine viertel Million sinken, vor al-lem aufgrund der rückläufigen Zahl derErwerbstätigen.
WAFFEN Nach dem Massaker in der High-School von Littleton legt Präsident Clin-ton einen Plan zur Verschärfung der US-Waffengesetze vor. Waffenkäufer sollenkünftig strenger kontrolliert und Eltern
für die Schießereien ihrer Kinder haftbargemacht werden.
M I T T W O C H , 2 8 . 4 .
RENTEN Das Bundesverfassungsgerichtnimmt die nach der Wende verfügtenRentenkürzungen für ehemalige DDR-Funktionäre teilweise zurück.
BELGRAD Ministerpräsident Momir Bula-toviƒ entläßt seinen Stellvertreter VukDra∆koviƒ, über dessen Äußerungen zueiner angeblichen jugoslawischen Kom-promißbereitschaft die Welt drei Tagelang gerätselt hatte.
BLACKOUT Stromtechnikern gelingt es, imBremer Weserstadion die zur Halbzeitausgefallene Flutlichtanlage zu reparie-ren; prompt fangen sich DeutschlandsFußballer, wieder im Hellen, ein Tor zum0:1 gegen Schottland ein.
TÜRKEI Die türkische Justiz eröffnet for-mell den Hochverratsprozeß gegen PKK-Chef Abdullah Öcalan.
D O N N E R S T A G , 2 9 . 4 .
ABGEORDNETE Der Thüringer PDS-Politi-kerin Almuth Beck wird wegen ihrer Sta-si-Verstrickungen das Landtagsmandatentzogen – eine Premiere in der deut-schen Parlamentsgeschichte.
KRISENMANAGEMENT Bei einem Besuch inBonn konstatiert Jelzins Sonderbeauf-tragter Tschernomyrdin eine Annäherungder Standpunkte. Verhandlungen könn-ten jedoch erst beginnen, wenn die Nato-Luftangriffe gegen Serbien eingestelltwürden.
F R E I T A G , 3 0 . 4 .
AUSSTELLUNGEN Ex-Beatle Paul McCart-ney zeigt im westfälischen Siegen seine7o gelungensten Gemälde.
Zur Feier seines 62. Geburtstagseröffnete der irakische DiktatorSaddam Hussein am Tharthar-Seeein luxuriöses Erholungszentrum,das von irakischen Familien sogleich genutzt wurde.
249

Register
FO
TO
S:
DPA
G e s t o r b e n
Konrad Henkel, 83. Fast 30 Jahre lang liefnichts ohne ihn in dem Düsseldorfer Che-miekonzern, dessen Namen er trug und des-sen Produkte jeder kennt: Ata und Coral,Pattex und Pritt oderTheramed und derDrei-Wetter-Taft. Aberkein Produkt ist so engmit der deutschen Ge-schichte verknüpft wiedas Waschmittel Persil– seine Verpackungdiente als Koffer fürFlüchtlinge und Sol-daten, und im Nach-kriegsdeutschland wur-de der „Persil-Schein“ zum Synonym fürdie weiße Weste. Der Enkel des Firmen-gründers, der 1961 die Führung übernahm,setzte die Erfolgsgeschichte der 1907 einge-führten Marke nahtlos fort. Unter dem Mot-to „Firma geht vor Familie“ sorgte er dafür,daß der riesige Familienclan zusammen-hielt und schließlich den Gang an die Bör-se schaffte. Zwar gab der promovierte Che-miker 1980 die Firmenleitung an einen fami-lienfremden Manager ab, doch bis 1990 zogder „König von Persilien“, wie er gern genannt wurde, im Hintergrund weiter dieFäden. Konrad Henkel starb am 24.April inDüsseldorf an einer Lungenentzündung.
AP
Michael Baron Killanin, 84. Sein Ruf, einChef ohne Fortüne gewesen zu sein, läßtden in London geborenen Iren in der Erin-nerung der sportiven Weltjugend etwas blaßerscheinen. Doch nur wer Ohnmacht mitFührungsschwäche verwechselte, konntedem Gemütsmenschen in der Rolle dessechsten Präsidenten des InternationalenOlympischen Komitees (IOC) die Reihe di-plomatischer Niederlagen in seiner Amts-zeit von 1972 bis 1980 persönlich anlasten.Der liberale Lord, Cambridge-Absolvent,Journalist, Direktor von Irish Shell & BPmit Hang zur Schriftstellerei, konnte alsoberster Sachwalter Olympias weder Ka-nadas Einreiseverbot gegen die MannschaftTaiwans verhindern noch den Rückzug der23 afrikanischen Teamsvon den Montreal-Spielen.Vier Jahre spä-ter, bei den Boykott-Spielen von Moskau,trat der schon von einer Herzattacke ge-schwächte Pfeifenrau-cher und Whisky-Ken-ner nicht mehr zur Wiederwahl an. SeineSorge um die Autono-mie der Weltsportorganisation geriet imZuge der Korruptionsskandale jetzt erst wie-der auf die olympische Agenda. MichaelBaron Killanin starb am 25.April in Dublin.
d e r s p i e g e250
Stéphane Roussel, 96. Nur ein Verle-genheitsjob brachte sie in den Beruf und in das Land, denen beiden sie später ihreganze Leidenschaft entgegenbrachte: Denneigentlich hatte Stéphane Roussel 1930nach dem Studium für „Le Matin“ in Ber-lin als Sekretärin gearbeitet, als ihr die Stelle der ersten Auslandskorresponden-tin Frankreichs angeboten wurde. Ihre Auf-gabe als Journalistin im Nazi-Deutschlandsah sie darin, Zeitzeugin zu sein. So bliebsie, obwohl jüdischer Abstammung, bis zurSchließung des Büros 1938, ging dann nachLondon und schrieb für die dort herausge-gebene Zeitung „France“. Nach dem Kriegkehrte die Bewunderin Adenauers in ihrLieblingsland zurück, bemühte sich dann30 Jahre lang für „France Soir“, dasDeutschland-Bild der Franzosen zurecht-zurücken. Aber auch umgekehrt versuch-te die stets elegant gekleidete Französin inWerner Höfers „Frühschoppen“, einemgroßen deutschen Publikum FrankreichsPolitik näherzubringen. Stéphane Rousselstarb am 24. April in Paris.
Jill Dando, 37. Vor zwei Jahren hatten dieBriten die BBC-Moderatorin zu der Persongewählt, die sie sich am liebsten zur Nach-barin wünschten. Die Nachrichtenspreche-rin, die zuletzt das britische Pendant zu„Aktenzeichen XY ungelöst“ – „Crime-watch“ – moderierte, erfreute sich geradewegen ihrer natürlichenAusstrahlung großerPopularität. VorigenMontag wurde das TV-Idol auf den Eingangs-stufen ihres Hauses der-art kaltblütig mit einemeinzigen Schuß nieder-gestreckt, daß die Poli-zei zunächst an die Ar-beit eines Auftragskil-lers glaubte. So unerklärlich war der An-schlag, daß viele einen Racheakt von Ser-ben für die Zerstörung des Belgrader Fern-sehsenders RTS vermuteten. Die Polizeisucht den Mörder jedoch weiterhin vor-nehmlich im Bekanntenkreis des Opfers.
Sir Alf Ramsey, 79. Sein Schüler BobbyCharlton kannte „keinen, der für ihn nichtdurch eine Ziegelmauer rennen würde“.An Aufopferungsfähigkeit verlangte Eng-lands erfolgreichster Fußball-Nationaltrai-ner freilich nicht viel mehr als die Bereit-schaft zu Positionswechseln. Mit seinem Sy-stem ohne Flügelstürmer führte der eisigeStratege England 1966 zum Weltmeisterti-tel nach dem denkwürdigen 4:2-Finalsieggegen Deutschland. Das Konzept entsprangeiner Animosität. Es hieß, er habe in seinerZeit als Verteidiger von Tottenham dieAußenstürmer zu hassen begonnen: Sie wa-ren ihm zu schnell. Sir Alf Ramsey starb amvergangenen Mittwoch in Ipswich.
l 1 8 / 1 9 9 9

Werbeseite
Werbeseite

252
Personalien
Fi
FO
TO
S:
STIL
LS /
STU
DIO
X (
li.)
; M
SI
/ B
ULLS
PR
ES
S (
re.)
O’Connor alias Mother Bernadette
Sinéad O’Connor, 32, irische Sängerin („Nothing Compares 2 U“), wird künftig un-ter anderem Namen ihre Rock- und Popballaden veröffentlichen. Mother Berna-dette, so der Künstlername, mag einer ins Schlingern geratenen Karriere vielleicht neu-en Schwung geben, erhalten aber hat Sinéad O’Connor den Namen bei einer gehei-men Zeremonie in dem katholischen Wallfahrtsort Lourdes. Dort war vor knapp 150Jahren einer gewissen Bernadette Soubirous angeblich die Jungfrau Maria erschienen.Mit dem neuen Namen wurde der rebellische Popstar, der schon mal mit dem Zer-reißen eines Papstbildes auf offener Bühne für Aufregung sorgte, gleichzeitig zur ka-tholischen Priesterin geweiht. Den ketzerischen Akt vollzog der abtrünnige früherekatholische Bischof Michael Cox, ebenfalls Ire. Die alleinerziehende Mutter von zweiKindern hätte „ich nicht geweiht, wenn ich nicht wüßte, daß sie einer wahren Beru-fung folgt“, so der Kirchenfürst. Zum Abschluß der Weihe tanzten Bischof Cox undMother Bernadette gemeinsam zu den Klängen einer Reggae-Aufnahme mit dem Ti-tel „Vampire Slayer“ (etwa Vampir-Mörder).
Susan McDougal, 43, ehemalige Ge-schäftspartnerin des amerikanischen Prä-sidentenpaares, hatte im Gefängnis einigeungewöhnliche Erlebnisse. Dorthin war dieeinstige Immobilienmaklerin an Händen
und Füßen gefesselt trans-portiert worden, nachdem sie 1996 in der Whitewater-Affäre der Clintons dieAussage vor Gericht ver-
weigert hatte. Als derRichterspruch erging,sei ihr erster Gedankegewesen, so erzähltesie jetzt dem „NewYork Time Magazine“,daß sie nun Zeit habe,„die Bücher zu lesen,die ich immer schon lesen wollte“. Doch indem Gefängnis „waraußer der Bibel keineinziges Buch gestattet.Das war ein Schlag“.Ihre Mitgefangenenkannten die Umstän-de ihres Aufenthalts,und sie „konnte siewirklich damit zumLachen bringen,daß ich ins Kitt-
chen kam, weilich nichts gesagthatte“. Anderer-
seits vermißt sie das Gefängnis auch einwenig. „Da warst du etwas wert. Hierdraußen sorgen alle für mich. Im Knastkonnte ich für andere sorgen.“ Mit denClintons hat sie schon lange keinen Kon-takt mehr: „Aber ich würde Hillary meineStimme geben. Ihre Politik ist vernünftig.Und sie würde für alles kämpfen, an das sie glaubt.“ Ein Geschworenengericht inLittle Rock hat Susan McDougal MitteApril vom Vorwurf der Behinderung derJustiz freigesprochen.
McDougal
T. G
LAS
GO
W /
BLAC
K S
TAR
scher
IMO
Dietmar Bartsch, 41, Bundesgeschäfts-führer der PDS, wird eine hohe Ehre zuteil:Als erster PDS-Politiker darf der dem Re-formflügel zugerechnete PDS-Vormann ei-nen Bundeskanzler auf einem Staatsbe-such begleiten – Gerhard Schröder auf des-sen Reise in die Volksrepublik China. Derin Moskau promovierte Wissenschaftlerwertete die Einladung an die PDS-Frak-tion durch das Kanzleramt als „weiterenSchritt zur Normalität“ im Umgang mitder PDS. Bartschs Auftritt in China ist nichtohne Pikanterie: Vor zehn Jahren schlu-gen Chinas Kommunisten auf dem „Platzdes Himmlischen Friedens“ die Protesteder Studenten blutig nieder – SED-Politi-ker äußerten damals Verständnis. Inner-halb der PDS ist derzeit noch umstritten,ob und wie die Partei sich zum 10. Jahres-tag von „Tiananmen“ äußern soll.
Joseph „Joschka“ Fischer, 51, grünerBundesaußenminister, zeigt eigenes Pro-fil: beim Outfit. Während KabinettschefGerhard Schröder sich von italienischenModezaren wie Zegna und Brioni kleidenläßt, mag es sein Vize lieber französisch.Ander vornehmen Place de la Madeleine inParis läßt er sich in der Boutique von Nino
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
Cerruti stylen.Als der Topstar der Grünennoch für Wein und mediterrane Kostschwärmte, reichten ihm Lederjacke,Jeans und Turnschuhe für seine unterhalt-samen politischen Auftritte, auch im Par-lament. Aber kaum daß er „40 Kilo verlo-ren hatte“, erinnert sich jetzt der PariserHaute Couturier Cerruti in einem Inter-
view mit der italienischen Zei-tung „La Stampa“, „klopfte erbei mir an und bat um ästhe-tischen Rat“.
Hans Traxler, 69, FrankfurterZeichner, blickt kurz vor sei-nem 70. Geburtstag am 21. Maiwohlgemut auf einen frühenEntschluß zurück. Der Jubilar,der „traditionell vor Geburts-tagsfeierlichkeiten flüchtet –diesmal nach Wien“ –, hat zwarfrüher Politiker und Päpste ka-rikiert, aber im Laufe der Zeitdas Gefühl bekommen, „sowichtig sind die alle nicht“. Die

r
Anlässe wiederholtensich, und, so der Altmei-ster des trockenen Hu-mors, „irgendwann fandich’s nur noch langwei-lig“. Denn der Politikerscheide aus oder tretezurück, werfe alles hin„und sitzt dann an ei-nem oberbayerischenSee, aber der armeZeichner muß immerweitermachen, ein har-tes Brot“. Traxler wolltedurch die politikferneDarstellung – wie jetztin dem soeben erschie-nenen Sammelband derletzten Jahrzehnte „Al-les von mir!“ (Verlag 2001; 50 Mark) un-terhaltsam nachvollziehbar – „dem Schick-sal von Ernst Maria Lang entgehen“: DerHauszeichner der „Süddeutschen Zeitung“müsse sich immer noch, „und zwar seit denvierziger Jahren, mit Politikern abgeben“.
Traxler-Karikatu
Queen Elizabeth II., 73, Herrscherin überdas Vereinigte Königreich Großbritannien,ließ sich wieder einmal porträtieren. Dochder strenge ruhige Blick der königlichenHoheit auf dem mehr als zwei Meter hohenÖlgemälde täuscht über den Kampf hin-weg, den der Künstler Andrew Festing zubestehen hatte, um Ihre Majestät ruhigzu-stellen, während er sie malte. Ständig seidie Königin während der sechs Sitzungenin Bewegung gewesen, habe herumgezap-pelt, obwohl sie doch, so der geplagte Ma-ler, „sich schon beinahe selber malen kann,so oft saß sie schon Porträt“. Sie habe „ihrTagebuch durchgesehen oder irgendwas
F
anderes gemacht“ odermit ihrem persönlichenDiener Termine bespro-chen, wobei die Königindann natürlich unwill-kürlich Gesichter schnittund die Hände bewegte.Das hatte allerdingsauch seinen Vorteil. Fe-sting „konnte an demBild malen, ohne Kon-versation treiben zumüssen“. Das Bild, dasdie Königin in vollemOrnat neben Van DycksPorträt von König Charles I. stehend zeigtund derzeit in der Aus-stellung der Royal So-
ciety of Portrait Painters in den Mall Gal-leries zu sehen ist, gefiel der königlichenFamilie ausnehmend gut. Festing erhielteinen Nachfolgeauftrag: Jetzt soll er dieKönigin malen, umringt von Freunden undallen Familienmitgliedern. Es wird dasgrößte Gemälde in der königlichen Samm-lung werden und führt den Künstler dem-nächst auch nach Deutschland. Die han-noverschen Vettern der Königin müssenhierzulande skizziert werden, sie sind zubeschäftigt, um nach London zu kommen.
ZW
EIT
AU
SEN
DU
ND
EIN
S
Jürgen Trittin, 44, grüner Umweltminister,gab sich als kenntnisreicher Hedonist zuerkennen. Für ein Gespräch mit der Po-und-Busen-Postille „Max“ schlug der linkeGrüne das Bad Godesberger Restaurant„Halbedel’s“ vor („17 Gault-Millau-Punkte,geschmackssichere Küche, beherrscht sou-verän die Bonner Gourmetszene“). ÜberMontepulciano und Perigordtrüffel-Nudelnbeklagte Trittin, daß „Teile der Industrieden Wahlausgang nicht akzeptiert“ hättenund daß gegen Rot-Grün „der Kampf vollentbrannt“ sei. Im übrigen sei man in einerKoalition mit einer Partei, „die uns nichtwollte“, schlimmer noch, „die reichlichFurcht vor Veränderungen“ habe. Die Wahldes Gourmet-Lokals war kein Zufall: Nörg-ler Trittin müht sich, gelegentlich auch sel-ber als Koch, kreativ um seinen Gaumen:„Beim Essen achte ich auf die Ästhetik, aufdie Farben. Bei der Weinauswahl eher aufdie Stimmung.“ Seinen Hedonismus ver-teidigt das ehemalige Mitglied des Kom-munistischen Bundes mit Brecht: „Wennman nicht nach Genuß strebt, nicht das Be-ste aus dem Bestehenden herausholen willund nicht die beste Lage einnehmen will,warum sollte man da kämpfen?“ Und erspöttelt über einen anderen Genießer imKabinett, Kanzler Schröder, der eine ArtPaul Breitner der deutschen Politik sei: „Zi-garrenrauchen kann der Gerd schon längstso gut wie Breitner.“
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9
esting-Werk

Hohlspiegel Rückspiegel
Aus der „Frankfurter Rundschau“ über einTV-Porträt des Uno-Generalsekretärs KofiAnnan: „Dafür wurde er wie ein Held ge-feiert. Doch schon Ende des Jahres warseine diplomatische Mission Makulatur, fie-len wieder amerikanische Piloten aufIrak.“
Aus der „Bild“-Zeitung
Aus dem „Herborner Tageblatt“
Aus der „Ärzte Zeitung“
Aus „TV-Spielfilm“ über den Sohn vonSonja Kirchberger: „Er kam unter drama-tischen Umständen am 13. Oktober imAlter von sechs Monaten zur Welt.“
Aus der „Eßlinger Zeitung“
Aus den „Stuttgarter Nachrichten“
Reuter-Meldung aus der „HannoverschenAllgemeinen“
Aus dem Frauenmagazin „7 Tage“: „Le-ben Sie in einer glücklichen Partnerschaft,und haben Sie wenigstens fünfmal pro JahrSex mit Ihrem Partner? Auch das machtdrei Jahre jünger.“
254
Zitat
Werner von Koppenfels, Professor fürAnglistik an der Universität
München, in der „SüddeutschenZeitung“ zum ersten gesamt-
deutschen Ranking der Hochschulen im SPIEGEL-Test „Wo
was studieren?“ (Nr. 15/1999):
Akademisches Allheilmittel, Garantie fürWettbewerb und Transparenz, unfehlbarerStachel, um die lahme Alma mater auf Trabzu bringen: das Ranking. Und wenn derSPIEGEL ein gesamtdeutsches Uni-Ran-king betreibt, kann das doppelt weh tun.München findet sich dabei tief im roten Be-reich. In der Einzelwertung auch die An-glistik, der ihre Kunden bezüglich Dozen-tenverhalten, Studieninhalten und Ausstat-tung schlechte Noten verpassen. Weit ander Spitze der Rangliste liegt Siegen, gefolgtvon Magdeburg, Greifswald und Chemnitz.Angesichts solch blühender anglistischerLandschaften stellt sich die Frage nach demStatus des eigenen Brachfelds.Glückwunsch, Siegen, für vorbildliche Be-treuung, die bei einer Relation von 27 Stu-denten pro Hochschullehrer etwas leichterfallen dürfte als bei der für uns errechneten114. Kleiner Trost, daß München in derGunst der separat befragten Fachkollegenganz oben rangiert, aber das gehört in einezweite Statistik, die sich gegenläufig zur er-sten verhält. Und diese erste ist wichtig.Sie vertritt den berechtigten Wunsch derStudenten nach Nestwärme, Praxisnäheund gradlinigem Studium, beargwöhnt ak-tive Forschernaturen als halbherzige Leh-rer; und beleuchtet die Krise der Geistes-wissenschaften, ohne sie auszuleuchten.Denn an sich gehört zu jeder Evaluation die– hier nicht gestellte – Frage nach demInput des Evaluatoren: Nur die Kritik einesengagiert Beteiligten hat Gewicht. Da fälltdie schweigende Mehrheit mancher Semi-narrunden ein, die eine Sachfrage ad per-sonam schon als Verletzung der Intimsphä-re empfindet und nur schwer in die kei-neswegs überfüllten Sprech- und Mentor-stunden zu locken ist; oder jene breite stu-dentische Mehrheit, die das für jede Berufs-praxis essentielle Wagnis eines längerenAuslandsaufenthalts standhaft verweigert.Es stimmt, die Ausstattung des Instituts isttechnologisch ärmlich. Aber haben die Be-fragten registriert, daß deren Kern eine derbesten Fachbibliotheken des Landes ist, alleBücher nur einen Handgriff vom Besucherentfernt? Die Bibliothek müßte zusam-menbrechen, wenn nur ein Drittel unserer2000 Studenten sie regelmäßig benützte;Montag früh, Freitag nachmittag und ge-nerell abends liegt sie verödet. Die vielenBücher wirkten so deprimierend, hat kürz-lich ein Student glaubhaft versichert. DerKlick ins Internet verspricht Erlösung vonder Qual des Bücherwälzens.
d e r s p i e g e l 1 8 / 1 9 9 9