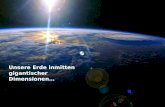Unsere Erde inmitten gigantischer Dimensionen…. Merkur und Sonne Merkur Merkur…
Die Schattenkämpfer_Rheinischer Merkur Nr.3 20
-
Upload
burson-marsteller-emea -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Die Schattenkämpfer_Rheinischer Merkur Nr.3 20

POLITIK 5 Rheinischer Merkur · Nr. 3 / 2008
5 Prozent 10 Prozent 15 Prozent 20 Prozent 95 Prozent
CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK
Nummer: 03, Seite: 5
Die Schattenkämpfer US-VORWAHLEN Sie feilen am Image der Kandidaten und definieren deren Programme. Dem Publikum bleiben die Berater meistens verborgen – das ist der Preis ihres Einflusses
Von Andreas Mink, New York
Schemenhafte Gestalten: Das Rennen um das Weiße Haus wird als Wettkampf von Individualisten inszeniert. Doch hinter ihnen stehen Beraterteams, die mehr bestimmen als die Kandidaten selbst. FOTO: J IM YOUNG/REUTERS
Der Mann hinter Hillary Clin-ton heißt nicht Bill, sondern Mark. Mark Penn ist der Chef-stratege ihrer Kampagne für
die Präsidentenwahl, nachdem er schon Bill Clinton als Marktforscher im Weißen Haus gedient hatte. Penn hat mit den Clintons deren charakteristische politi-sche Strategie entwickelt, die auf detail-lierten und pragmatischen Programmen für genau definierte Zielgruppen beruht. Als Experte für die Identifizierung neuer soziologischer Einheiten hat Penn bahn-brechende Arbeit geleistet.
Für Bill Clinton hat er im Wahlkampf 1996 die „Soccer Moms“ entdeckt, Müt-ter in den Vororten, die in der Sorge für ihre Kinder aufgehen. Penn hat dem Prä-sidenten damals nahegelegt, dieses Milieu mit konkreten Ideen wie dem Kampf ge-gen Gewalt im Fernsehen anzusprechen, und damit entscheidend zu Clintons Wie-derwahl beigetragen. Seit ihrem ersten New Yorker Senatswahlkampf im Jahr 2000 berät Penn auch Hillary Clinton.
Der 54-jährige New Yorker Penn macht keinen Hehl aus seinem Einfluss und mischt sich mit Rundmails an Repor-ter und mit Talkshow-Auftritten aktiv in den aktuellen Wahlkampf ein. Als er Bill Clintons Haus-Demoskop wurde, betrieb Penn schon eine eigene Marktforschungs-firma. Seine Erfolge an der Seite der Clin-tons haben ihm obendrein den Vorsitz des PR-Riesen Burson-Marsteller einge-tragen, der für Ölmultis ebenso Marke-ting betreibt wie für Pharma-, Telekom-
und Nuklearkonzerne. Unterabteilungen von Burson-Marsteller arbeiten auch für republikanische Politiker und Interessen-verbände. Penn unterscheidet nicht zwi-schen Klienten in Politik, Werbung und Wirtschaft. Ihm geht es allein darum, die Produkte seiner Auftraggeber an die Ziel-gruppen verkaufen, die Amerikas Gesell-schaft unentwegt neu hervorbringt.
Aktive Amazonen Darüber hat Penn kürzlich das lesenswer-te Buch „Microtrends“ publiziert, in dem er seine neuesten Erkenntnisse darstellt. „Microtrends“ versteht sich als Moment-aufnahme einer Gesellschaft, die sich ra-pide „atomisiert“ und in gegenläufige Richtungen auseinanderstrebt. Penn bil-det diese Vervielfältigung von Lebenssti-len in 75 Kategorien ab: vom Koffein- und Fastfood-Süchtigen zur „aktiven Amazone“ mit einer Vorliebe für anstren-gende Sportarten. Penn fällt über Männer mit Porno-Obsession ebenso wenig ein moralisches Urteil wie über Leute, die permanent zum Schönheitschirurgen lau-fen oder die ganze Existenz ihren Haus-tieren widmen. All diese Gruppen umfas-sen jeweils mindestens eine Million Men-schen – die Schwelle für ein ernst zu neh-mendes Kundenreservoir.
Auf dem Buchumschlag danken ihm seine prominentesten Kunden für „bril-lante Arbeit“ und dafür, dass er ihnen „die Augen geöffnet hat für eine ganz neue Sicht auf die Welt“: neben Bill Clin-ton der frühere britische Premierminister Tony Blair und Microsoft-Gründer Bill
Gates. Für seine gegenwärtige Kundin hat er große Weitsicht bewiesen, als er im Sommer 2006 Wählerinnen zum ent-scheidenden Faktor bei der nun anstehen-den Entscheidung erklärt hat. Hillarys jüngster Erfolg in New Hampshire ist die-sem „Faktor X“ zu verdanken.
Dass sie auf ihren Wahlveranstaltun-gen und in ihrem PR-Material einen Waschzettel mit detaillierten Vorschlägen für eine breite Palette politischer Fragen offeriert, entspringt nicht nur Clintons biografischem Hintergrund und ihrer langen Erfahrung, sondern den zahllosen Erhebungen, die Penn für Bill und Hillary angestellt hat. Dass er darüber zu einem sehr reichen Mann geworden ist, stört sei-ne Auftraggeber nicht.
In „Microtrends“ hält Penn fest, dass beim Verkauf eines Produkts in Politik oder Wirtschaft meistens nicht die Fakten entscheiden, sondern die Wahrnehmung der Kundschaft. Dass Penn nach Barack Obamas Erfolg in Iowa ein Memo an aus-gewählte Medienkontakte versandte, in dem er einen „Sprung“ in dessen Umfra-gewerten in Abrede gestellt hat, erscheint da nur folgerichtig. Auch die ständigen Imagekorrekturen Hillary Clintons, die nun behauptet, sie habe endlich „ihre ei-gene Stimme gefunden“, und sich „menschlich und offen“ zeigt, stammen direkt aus dem PR-Labor Penns.
Sein Buhlen um Medienaufmerksam-keit birgt jedoch auch Risiken. So war in den bangen Tagen nach Iowa aus der Umgebung Clintons zu hören, Penns Stuhl als Chefstratege wackele. Dass Hil-lary Obama lange Zeit nicht ernst genug
genommen hatte, ging auch auf Penns überzogene Siegesgewissheit zurück. Der Unterschied zwischen Clinton und Oba-ma liegt schließlich nicht in ihren Pro-grammen, sondern in ihrem Ansatz: Obama ist mit seiner auf den Schlagwor-ten Hoffnung, Wandel und nationale Ei-nigkeit basierenden Kampagne Antipode der Pennschen Schule von Politik. Oba-ma hält etwa eine vernünftige Energie-politik nur nach einem fundamentalen „Wandel“ in Washington für möglich. Clinton will dies auf dem traditionellen Weg von Verhandlungen und Kompro-missen erreichen.
Obamas Debattierclub Selbstverständlich geben auch Obama und die Konkurrenten Clintons bei den Republikanern sehr viel Geld für Umfra-gen und Wähleranalysen aus. Aber weder Obama noch John McCain oder Rudolph Giuliani verlassen sich in so großem Maß auf einen einzelnen Berater. Der Senator aus Illinois ist indessen nicht so naiv, wie die Clintons und deren Umgebung im-mer wieder behaupten. Mit den früheren Sicherheitsberatern Zbigniew Brzezinski und Anthony Lake kann Obama auf Männer des demokratischen Establish-ments ebenso zurückgreifen wie auf Ro-nald Reagans Pentagon-Staatssekretär Lawrence Korb, den angesehenen CIA-Veteranen Bruce Riedel und den früheren Nahost-Unterhändler Dennis Ross.
International Schlagzeilen hat die ebenso schöne wie kluge Harvard-Profes-sorin und Pulitzerpreisträgerin Samantha
Power gemacht. Sie will Obamas Außen-politik auf einen humanitären Interven-tionismus etwa in Darfur ausrichten, der unvereinbar ist mit dem kaltschnäuzigen „Realismus“ Brzezinskis.
Verleihen diese Widersprüche dem Be-raterkreis Obamas den Charakter eines Debattierclubs, so wirken die Figuren um Giuliani oder McCain wesentlich strom-linienförmiger. Bei Giuliani stechen au-ßenpolitische Falken wie der ehemalige FBI-Chef Louis Freeh, vor allem aber die proisraelischen Neokonservativen Martin
Kramer und Normon Podhoretz ins Au-ge, die unermüdlich nach Bombenangrif-fen auf den Iran rufen.
Auch McCain hört auf prominente Neocons wie Robert Kagan und William Kristol, den Herausgeber des „Weekly Standard“. Aber in der Umgebung des Vi-etnam-Veteranen überwiegen ehrwürdi-ge „Realisten“ wie die ehemaligen US-Au-ßenminister Alexander Haig, George Shultz oder Henry Kissinger. Mit dem britischen Starhistoriker Niall Ferguson kann McCain sogar auf einen relativ jun-gen Akademiker mit einem Faible für an-gelsächsische Imperien zählen.
Wer einen einzelnen Berater sucht, der besonderen Einfluss auf Obama aus-übt, stößt auf einen Mann, der das Binde-glied zwischen dem jungen Hoffnungs-träger dieser Politikergeneration und dem großen Charismatiker der ame-rikanischen Nachkriegszeit darstellt: Fast blind und mit eisgrauem Haar, macht sich Ted Sorensen, elf Jahre lang der be-gnadete Redenschreiber John F. Kenne-dys, seit vergangenem Frühjahr für Oba-ma stark. Die beiden treten gemeinsam auf, und Obama hat den 79-jährigen An-walt mehrfach öffentlich für dessen rhe-torische Kunst gelobt.
Sorensen hat sich jüngst dafür revan-chiert und erklärt, er habe es satt, dass die Demokraten mit Kandidaten verlieren, die mit Fünf-Punkte-Programmen hau-sieren gehen: „Damit erreichen wir die Herzen der Wähler nicht. Mister Kenne-dy hat die Herzen der Wähler erreicht. Und Obama gelingt das auch.“
SIEHE AUCH SEITE 13
Hillarys Hirn: Mark Penn, Chefstratege der Kandidatin Clinton. FOTO: GETTY IMAGES
Brüsseler Kröten und Moskauer Lockvögel SERBIEN Das Duell um das Präsidentenamt entscheidet über die außenpolitische Orientierung des Landes
Von Andreas Ernst, Belgrad
Nationalisten: Parteichef Tomislav Nikolic in der Hand, den Kriegsverbrecher Ratko Mladic am Hut – ein Anhänger der Radikalen Partei in Nis. FOTO: GETTY IMAGES
Im überschaubaren Kreis fortschrittlicher Serben herrscht Alarmstimmung. Die Wahl zwischen dem amtierenden pro-europäischen Präsidenten Boris Tadic und seinem nationalistischen Herausfor-derer Tomislav Nikolic sei eine Schick-salswahl, meint die 30-jährige Olivera: „Ich habe keine Lust, nochmals zehn Jah-re an einen nationalistischen Traum zu verlieren.“ Die Mutter mit Philosophieab-schluss sitzt in der durchgestylten Kaffee-bar „Speak easy“ am Bulevar Revolucije. „Schon wegen ihm nicht,“ und sie winkt dem halbjährigen Sohn Lav zu, der mit abwesendem Blick am Schnuller saugt.
Nach Brüssel oder nach Moskau? Das ist die Frage, die sich den Serben an die-sem Sonntag und bei der erwarteten Stichwahl am 3. Februar stellt. Corax, der Karikaturist, zeigt Serbien als einfältigen Pinocchio, der vom verschlagenen Fuchs Nikolic und dem bösen Kater (und Minis-terpräsidenten) Kostunica auf den Weg nach Russland gelockt wird. Am Hori-zont schimmern die farbigen Türme des Kreml. Dagegen wirkt der einst hell leuchtende europäische Sternenkranz blass. In fünf Kleinstädten Serbiens ist der russische Präsident auf Betreiben der Ra-dikalen Partei Nikolics Ehrenbürger ge-worden. Nun soll Putin die gleiche Aus-zeichnung auch von den nach Belgrad größten Städten des Landes, Novi Sad und Nis, verliehen werden. Nikolic hat zwar die russische Nationalhymne wie-der gelöscht, die bis vor kurzem ein an-kommendes Gespräch auf seinem Mobil-telefon signalisierte. Auch sein Bedauern, dass Serbien keine russische Provinz sei, will er im Nachhinein als Scherz verstan-
den wissen. Aber die prorussischen Ge-fühle in seiner Partei sind stark.
Russophilie ist indessen kein Privileg der populistischen Opposition: Die regie-rende Demokratische Partei Serbiens (DSS) von Ministerpräsident Kostunica steht den Radikalen nicht nach. Parteide-legierte sind regelmäßig zu Besuch im Kreml, Kostunica war nach Putins Wahl-sieg einer der ersten Gratulanten.
Vor allem aber hat die DSS ihre antiwestliche Rhetorik nochmals verschärft. Mit ihren Stimmen schmetterte die staatliche Wahl-kommission ein Gesuch der amerikani-
schen und britischen Botschaft ab, die Präsidentenwahl im OSZE-Rahmen zu beobachten. Während die Radikalen eine lange antiwestliche Tradition haben und maßgeblich halfen, Serbien in die Kata-strophen der Neunzigerjahre zu steuern, ist der Wandel der DSS von einer natio-nalkonservativen zur europafeindlichen Partei neu.
Er hängt zusammen mit Brüssels Un-terstützung der Unabhängigkeit des Ko-sovo, die viele Serben empört. Umge-kehrt ist es Moskau, das die Zustimmung des UN-Sicherheitsrats blockiert, um ei-nen völkerrechtlichen Präzedenzfall zu
verhindern. Das dankt der Jurist Kostuni-ca dem Machtpolitiker Putin, indem erbei jeder Gelegenheit dessen „prinzipien-treue Haltung“ lobt.
Die aktuelle Auseinandersetzung Bel-grads mit Brüssel dreht sich um die ge-plante Mission der EU im Kosovo, welche die Unabhängigkeit „überwachen“ soll. Während die rechtliche Argumentation Kostunicas sachlich bleibt – er fordert ei-ne neue Uno-Resolution als Vorausset-zung für die Mission –, versteigt er sich politisch in ein Wolkenkuckucksheim: Belgrad, teilte der Ministerpräsident mi, werde das Assoziierungsabkommen mit der EU nur unterzeichnen, wenn Brüssel von der Entsendung einer Kosovo-Mis-sion absehe.
Dagegen wird Tadic nicht müde zu betonen, ein „europäisches Serbien“ sei eher in der Lage, das Kosovo zu behalten. „Keine Rückkehr in die Isolation von 1999 – vor-wärts zur Mitgliedschaft in der EU“ ruft Tadic seinen Anhängern im muslimisch dominierten Sandzak zu und erhält don-nernden Applaus. Er hofft auf die mehr als 70 Prozent der Bürger, die für den EU-Beitritt sind. Mit der Union verbindet sich seit vielen Jahren die Hoffnung auf mehr Wohlstand und persönliche Sicherheit – eine Vision, die von allen Bürgern der Westbalkanländer geteilt wird. Lust auf eine bewaffnete Konfrontation hat nie-mand. Selbst die Radikalen versprechen in ihren säuseligen Werbespots Frieden und Wohlstand.
Liegt Serbiens Zukunft in Brüssel oder in Moskau? Der Schuhmacher um die Ecke blickt scharf über die Brillengläser. Man solle doch die Karte konsultieren. Zur rumänischen EU-Grenze seien es
hundert, zur russischen tausend Kilo-meter: „Wir haben gar keine Wahl.“ Dass sich Serbien in Russlands Arme wirft und der EU den Rücken kehrt, ist auch aus an-deren Gründen unwahrscheinlich. Da und dort geistert zwar die Idee einer christlich-orthodoxen Bruderschaft he-rum. Aber in einem Land, das stark von den Konsum- und Lebensstilwünschen der Gastarbeiterdiaspora in Westeuropa geprägt ist, und eine westlich inspirierte „Andergraund“-Szene hat, bleibt die Re-sonanz oberflächlich. Dazu kommt das eingefleischte Misstrauen gegen alle fremden Mächte, das die Balkanvölker seit dem Zerfall des Osmanischen Rei-ches teilen. „Und hat etwa Russland ver-hindert, das wir 1999 bombardiert wur-den?“, fragt der Schuhmacher.
Aber die Westintegration kann auch schiefgehen. Die aufgeputschte Stim-mung wegen der erwarteten Sezession des Kosovo hat die Chancen für einen Wahlsieg Nikolics klar verbessert. Umfra-gen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Die Koalition zwischen der proeuro-päischen Demokratischen Partei von Ta-dic und der DSS Kostunicas verfügt über immer weniger Gemeinsamkeiten und steht vor schweren Belastungsproben. Wenn sie scheitert, wird eine Verbindung zwischen Kostunica und Nikolic denkbar.
Das würde weder einen Krieg um das Kosovo bedeuten noch, dass Serbien rus-sische Provinz würde. Aber die Befürch-tung von Olivera, der jungen Mutter, gin-ge wohl in Erfüllung: Isolation und Sta-gnation. Es scheint, als habe Tadic doch recht. Auf die Frage eines Reporters ant-wortete er: „Klar, dies ist eine Schicksals-wahl – und das wird bei jeder Wahl so bleiben, bis wir in der EU sind.“
U M S T R I T T E N E S J U N K T I M
Vollmundig war die Ankündigung: Er sehe „ziemlich große Möglichkeiten“, am 28. Ja-nuar das Stabilisierungs- und Assoziations-abkommen mit Serbien zu unterzeichnen, sagte der Vorsitzende des EU-Ministerrats, der slowenische Außenminister Rupel, ver-gangene Woche. Prompt kam der Wider-spruch aus Kommission und mehreren Mit-gliedsstaaten. Belgrad müsse zuerst seine volle Zusammenarbeit mit dem UN-Kriegs-verbrechertribunal sicherstellen, ließ Erwei-terungskommissar Rehn wissen. Ähnlich äu-ßerte sich Außenminister Steinmeier. Auch die Niederlande, Sitz des Gerichts, und Bel-gien, Heimat des neuen Vorsitzenden Serge Brammertz, schlossen aus, dass sie das Ver-tragswerk unterzeichnen, solange Ratko Mladic nicht im Haager Gefängnis sitzt. Die bisherige Chef anklägerin Carla Del Ponte hatte stets erklärt, dass der per Haftbefehl gesuchte Ex-Militärchef der bosnischen Ser-ben von Belgrad gedeckt werde. Daraufhin stellte die EU ein Junktim zwischen seiner Auslieferung und der weiteren europäischen Integration auf. Heute wird es jedoch von Staaten infrage gestellt, die die zu erwar-tende Unabhängigkeitserklärung der Kosovo-Albaner abfedern wollen. „Verwechseln wir nicht die Suche nach Kriegsverbrechern und die Möglichkeit eines Landes wie Serbien, eines Tages der Europäischen Union anzu-gehören“, sagt der französische Präsident Sarkozy und weiß damit Serbiens Nachbarn Griechenland, Bulgarien und Rumänien hin-ter sich. In Kraft treten kann das Vertrags-werk mit Belgrad nur, wenn alle EU-Staaten unterschreiben. Der Januar-Termin ist mit Bedacht gewählt: Er fällt vor die Stichwahl in Serbien und soll den prowestlichen Prä-sidenten Tadic stärken. T. G.