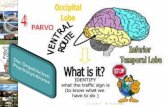Disulfiram
-
Upload
ruben-monroy -
Category
Documents
-
view
22 -
download
0
Transcript of Disulfiram
-
D i s u l f i r a m S h 1 )
[97-77-8]
Nachtrag 1997
MAK/Einstufung
Jahr der Festsetzung
2 mg/m32) Spitzenbegrenzung Kategorie III3) Schwangerschaftsgruppe D1)
19971), 19782), 19833)
1 Al lgeme iner Wirkungscharakter
Disulfiram wird nach oraler Applikation gut resorbiert, mit dem Urin als anorgani- sches Sulfat oder als Glucuronid ausgeschieden und als CS2 abgeatmet. Disulfiram bzw. seine Metaboliten hemmen zahlreiche fremdstoffmetabolisierende Enzyme. Bei der Therapie von Alkoholkranken mit Disulfiram treten als Nebenwirkungen peri- phere Polyneuropathien, Enzephalopathien und Lebertoxizitt auf. Der kritische Effekt ist die durch Disulfiram ausgelste Unvertrglichkeit gegenber Ethanol. Bei gesunden Probanden tritt diese Reaktion bereits bei einer tglichen Dosis von 100 mg Disulfiram (ca. 1,5 mg/kg KG) auf und ist objektiv als Blutdruckabfall und Erhhung der Herz- und Atemfrequenz nachweisbar. Bei Ratten wird bei wiederhol- ter Applikation von 12 mg/kg KG reduziertes Glutathion in Leber und Gehirn verringert und bei 25 mg/kg KG und Tag eine Schilddrsenhyperplasie hervorgeru- fen. Hhere Dosen verursachen periphere Neuropathien. Ein NOEL kann weder aus den Erfahrungen beim Menschen noch aus den Tierexperimenten abgeleitet werden. Disulfiram ist beim Menschen kontaktsensibilisierend. Mibildungen bei Kindern alkoholkranker Frauen, die mit Disulfiram behandelt
wurden, sind nicht auf Disulfiram zurckzufhren, da von den untersuchten Frauen weitere Medikamente eingenommen wurden und ein Alkoholmibrauch whrend der Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden kann. In tierexperimentellen Studien, in denen eine embryo- und fetotoxische Wirkung von Disulfiram beobachtet wurde, fehlen Angaben zur Maternaltoxizitt. Es ist daher unklar, ob ein direkter Effekt auf den Embryo die Ursache darstellt. Es liegen keine Hinweise auf eine Bindung von Disulfiram an die DNA vor. Die Hemmung der Superoxiddismutase und die erhhte Bildung von Wasserstoffperoxid wird als Ursache fr die in einigen In-vitro-Testsystemen beobachtete genotoxische Wirkung von Disulfiram diskutiert. Im Mikrokerntest und im zytogenetischen Test in vivo wurde je ein negatives Ergebnis berichtet. An BALB/c-3T3-Zellen erwies sich Disulfiram als zelltransformierend. In einer 78- Wochen-Kanzerogenittsstudie wurden an einem von zwei Musestmmen deutlich erhhte Inzidenzen von subkutanen Fibrosarkomen und Hepatomen beobachtet. Beim zweiten Musestamm war die Hufigkeit von Lungenadenomen erhht. In
-
zwei weiteren Studien an Ratten und Musen ber 2 Jahre mit umfangreicher histo- pathologischer Auswertung wurden durch Disulfiram keine erhhten Tumorinzi- denzen hervorgerufen, so da der Verdacht einer kanzerogen Wirkung nicht best- tigt wurde.
2 Wirkungsmechan i smus
Disulfiram bzw. seine Metaboliten hemmen zahlreiche fremdstoffmetabolisierende Enzyme (Begrndung 1978; Gessner und Gessner 1992; Johansson 1992) darunter CYP450 2E1, Aldehyddehydrogenase, Dopamin-F-Hydroxylase, Glutathion- peroxidase, Monoaminoxidase und Superoxiddismutase. Dopamin-F-Hydroxylase katalysiert u.a. den letzten Schritt im Syntheseweg von Noradrenalin, die Hydroxylierung von Dopamin zu Noradrenalin in den Nervenzel- len. Disulfiram hemmt nach Metabolisierung zu Diethyldithiocarbamat die Dop- amin-F-Hydroxylase dosisabhngig, nicht-kompetitiv und reversibel durch Chelati- sierung der Cu-Ionen des Enzyms (Gessner und Gessner 1992), wodurch es zu erhhten Dopamin-Spiegeln kommt. Die Hemmung wurde in vitro und in vivo im Tierexperiment (Begrndung 1978; Gessner und Gessner 1992), jedoch noch nicht beim Menschen nachgewiesen (Lake et al. 1977, 1980; Sauter et al. 1977). Die aus der Hemmung der Dopamin-F-Hydroxylase resultierenden verringerten Konzentra- tionen von Noradrenalin wurden jedoch bei Patienten in der Cerebrospinalflssig- keit (Lake et al.1980; Major et al. 1979 a), nicht aber im Blut (Lake et al.1977,1980) nachgewiesen. Die erhhten Konzentrationen von Dopamin im Gehirn, die auch tierexperimentell gefunden wurden, werden fr die beobachteten Enzephalopathien mitverantwortlich gemacht. Dopamin reduziert beim Menschen die Freisetzbarkeit von Thyreotropin (TSH) und Prolaktin durch das Thyreotropin-Freisetzungshormon (TRH) (Besses et al. 1975). Daher wurde vermutet, da die erniedrigten TSH- und Prolaktin-Spiegel im Blut nach Disulfiram-Gabe auf die Hemmung der Dopamin-F-Hydroxylase und der resultierenden Akkumulation von Dopamin im Gehirn zurckzufhren sind (Caval- leri et al. 1978). Die Verringerung der TSH-Spiegel wurde in einer weiteren Studie besttigt (Van Thiel et al. 1979). Bei der Therapie mit Disulfiram zur Alkoholentwhnung kommt es durch die H e m - mung der Isozyme der hepatischen Aldehyddehydrogenase, hauptschlich der mito- chondrialen Aldehyddehydrogenase-1 u n d weniger der zytosolischen Aldehyd- dehydrogenase-2 (Johansson 1992), nach Alkoholeinnahme zur Anhufung von Acetaldehyd im Stoffwechsel und zur sog. Alkohol-Disulfiram-Reaktion (s.u.; Be- grndung 1978). Der eigentlich wirksame Metabolit, der die Aldehyddehydrogenase hemmt, knnte Methyldiethylmonothiocarbamatsulfoxid sein, da bei Unterdrk- kung der Oxidation von Methyldiethylmonothiocarbamat zum Sulfoxid die Alde- hyddehydrogenase nicht mehr gehemmt wurde (Hart und Faiman 1992, 1993). Als Mechanismus wurde eine Carbamoylierung von SH-Gruppen im aktiven Zentrum durch Methyldiethylmonothiocarbamatsulfoxid oder des entsprechenden Sulfons diskutiert (Jin et al. 1994). Das Sulfon, nicht jedoch das Sulfoxid, wird in vitro jedoch durch Glutathion inaktiviert, so da es im Vergleich zum Sulfoxid fr die Hemmung der Aldehyddehydrogenase in vivo weniger bedeutend sein drfte (Mays
-
et al. 1996). Die Hemmung der Aldehyddehydrogenase in vitro konnte weder durch Gabe von Glutathion noch von 2-Mercaptoethanol aufgehoben werden (Johansson et al. 1989). Die Symptome der Alkohol-Disulfiram-Reaktion wie Abfall des Blutdrucks und erhhter Puls knnen durch Acetaldehyd ausgelst werden (Gessner und Gessner 1992). Blutdruckabfall und Acetaldehydplasmaspitzenspiegel waren korreliert (Beyeler et al. 1987). In welchem Ausma die weiteren durch Disulfiram hervorgeru- fenen Effekte wie Alkalose, verringerter Plasma-Kalium-Spiegel und verminderter CO2-Partialdruck fr die Ausprgung der Alkohol-Disulfiram-Reaktion eine Rolle spielen, ist unklar. Bei Patienten mit hoher Dopamin-F-Hydroxylase-Aktivitt war auch der Blutdruckabfall am strksten (Sauter et al. 1977). Das Ausma der Acetal- dehydbildung und der Alkohol-Disulfiram-Reaktion ist u.a. abhngig von der he- patischen Metabolisierung von Disulfiram zu den eigentlich wirksamen Metaboli- ten: Bei Leberzirrhotikern mit einer eingeschrnkten hepatischen Enzymaktivitt betrug die Bildung von Acetaldehyd nach Ethanol- und Disulfiram-Gabe nur ein Drittel des Werts von Personen mit nicht geschdigter Leber. Die Ethanol-AUC fr beide Gruppen war gleich, und bei den Zirrhotikern waren sowohl die Alkohol- als auch die Aldehyddehydrogenaseaktivitten im Vergleich zu den gesunden Personen reduziert (Wicht et al.1995). Auch durch den Metaboliten CS2 kann bei Mensch und Tier ein erhhter Acetaldehydblutspiegel bei mehrstndiger Exposition gegenber 20 ml/m3 und Gabe von Ethanol hervorgerufen werden. Eine Alkoholunvertrg- lichkeit wurde nicht beobachtet (Freundt et al. 1976). Das klinische Bild der peripheren Polyneuropathien hnelt dem bei Intoxikationen mit CS2. Da aus Disulfiram CS2 im Krper entsteht und in einigen Studien, wie fr CS2 typisch, Neurofilamentansammlungen in den Nervenfasern von Disulfiram-Pa- tienten gefunden wurden, wurde angenommen, da CS2 fr die Neuropathien ver- antwortlich ist (Ansbacher et al. 1982; Bergouignan et al. 1988; Bilbao et al. 1984; Hirschberg et al. 1987; Sahenk 1987). Dafr spricht auch, da sowohl CS2 als auch Diethyldithiocarbamat Proteine verknpfen knnen, was als Mechanismus fr die Ansammlung von Neurofilamenten verantwortlich gemacht wurde. Ein gemeinsa- mer Mechanismus von CS2 und Disulfiram liegt auch nahe, da unter physiologi- schen Bedingungen aus der Reaktion von CS2 mit Aminogruppen von Proteinen wiederum Dithiocarbamate entstehen (Graham et al. 1995). Jedoch wurde in Stu- dien an Ratten mit Disulfiram trotz ausgeprgter Polyneuropathien keine Ansamm- lung von Neurofilamenten in den Nervenfasern festgestellt, sondern nur Verlust myelinisierter Nervenfasern und Axon-Degenerationen vom Wallerschen Typ (Anzil 1980, 1985). Deshalb wird CS2 von anderen Autoren nicht fr die Neuropathien nach Disulfiram-Gabe verantwortlich gemacht (Anzil 1985; Bouldin et al. 1980). Weiterhin wurde vermutet, da die Inhibierung der Alkoholdehydrogenase, Alde- hyddehydrogenase und Dopamin-F-Hydroxylase zu den Neuropathien beitrgt (Mokri et al. 1981). Die Hemmung von CYP450 2E1 durch den Metaboliten Diethyldithiocarbamat wird im Zusammenhang mit der antikanzerogenen oder antimutagenen Wirkung von Disulfiram bei Stoffen diskutiert, die ber dieses Enzym aktiviert werden (Brady et al. 1991). Elektrophile knnten auch durch die Bindung an die Thiolgruppe von Diethyldithiocarbamat detoxifiziert werden. Z.B. wird die Mutagenitt von Vi- nylchlorid und Vinylidenchlorid im Salmonella-Mutagenittstest durch Leber-S9-
-
Mix nach Disulfiramvorbehandlung unterdrckt (Bartsch et al. 1979). Im Fall von Ethylendichlorid und Ethylendibromid fhrt Disulfiram- und damit die Hemmung von CYP450 2E1-jedoch zu erhhter Tumorinzidenz oder DNA-Alkylierung, da diese Stoffe oxidativ entgiftet werden (Cheever et al. 1990; Kim und Guengerich 1990). Die Hemmung der Superoxiddismutase und die erhhte Bildung von Wasserstoff-
peroxid wird als Ursache fr die in einigen Testsystemen beobachtete genotoxische Wirkung von Disulfiram oder Diethyldithiocarbamat diskutiert. Bei erhhter Sauerstoffkonzentration erwies sich Disulfiram als schwach mutagen im Salmonel- la-Mutagenittstest an TA100, whrend bei normaler Sauerstoffkonzentration keine Mutagenitt festgestellt wurde. Bei der zu Disulfiram analogen Tetramethylverbin- dung war der Effekt deutlicher (Rannug und Rannug 1 9 8 4 ) . Disulfiram verndert die Verteilung von zweiwertigen bergangsmetallionen d u r c h Bildung lipophiler Komplexe. Die Chelatisierung von Cu und Zn ist als Ursache der neurotoxischen Wirkungen diskutiert worden (Gessner und Gessner 1992). Der Mechanismus der Disulfiram-induzierten Hepatotoxizitt ist nicht bekannt. Es wird diskutiert, da die Hepatotoxizitt die Folge einer immunologischen Reaktion oder einer genetisch bedingten, individuellen Besonderheit im Metabolimus ist. Hin- weise auf einen immunologischen Mechanismus resultieren aus dem Auftreten von Exanthemen und einer Eosinophilie bei einem Viertel der betroffenen Patienten (Zala et al. 1993). Mgliche Ursache knnte auch das entstehende CS2 sein, da CS2 bei mit Phenobarbital behandelten Ratten hepatische Nekrosen auslst und mit CS2 exponierte Arbeiter ebenfalls Lebernekrosen entwickelten (Gessner und Gessner 1992).
3 Toxikokinetik und Metabol i smus
Disulfiram wird nach oraler Gabe gut resorbiert und im Organismus verteilt. Bei oraler Applikation wird eine teilweise Reduktion (Johansson 1992) oder Zersetzung (Andersen 1992) im Magen vermutet. Disulfiram wird durch Reduktionsmittel wie Ascorbinsure, Cu+-Ionen, Cystein, Glutathion und freie Sulfhydrylgruppen von Proteinen zu Diethyldithiocarbamat reduziert. Disulfiram bildet mit reaktiven Sulfhydrylgruppen, z.B. von Albumin oder Hmoglobin, gemischte Disulfide, wobei pro Molekl Disulfiram ein Molekl Diethyldithiocarbamat freigesetzt wird. Fr die Reaktion von Disulfiram mit Albu- min bei einem pH-Wert von 7,4 betrgt die Reaktionskonstante 0,0052 s-1 und die Halbwertszeit 133 Sekunden. Die gemischten Disulfide knnen ihrerseits wieder unter Freisetzung von Diethyldithiocarbamat reduziert werden. Diethyldithiocarba- mat bildet mit zahlreichen zweiwertigen Metallionen sehr stabile lipophile Komplexe (Gessner und Gessner 1992). Es wird angenommen, da Disulfiram bereits im Ma- gen zum Teil zu Diethyldithiocarbamat reduziert wird und mit Cu einen Komplex bildet, der dann leicht ber den Darm resorbiert werden kann (Johansson 1992). Die Reaktion mit Cu ist physiologisch vermutlich von besonderer Bedeutung. Disulfi- ram in 5 Vnolarer Lsung in Blut oder Plasma wurde in 5 Minuten quantitativ zum Diethyldithiocabamat-Kupfer-Komplex umgesetzt (Johansson und Stankiewicz 1985). Weiterhin wird Disulfiram in die Membran und in das Zytosol von Erythrozy-
-
ten aufgenommen. Diese Reaktionen erfordern besondere Bedingungen fr die Ana- lytik von Disulfiram und seinen Metaboliten im Blut (Gessner und Gessner 1992). Das aus Disulfiram entstehende Diethyldithiocarbamat kann auch in vivo wieder zu Disulfiram zurckreagieren. Der intrazellulre Spiegel von reduziertem Glutathion ist jedoch so hoch, da das Gleichgewicht auf der Seite des Diethyldithiocarbamats liegt und damit dessen weiterer Abbau bzw. Konjugation berwiegen (Abbildung 1).
Abt. 1. Metabolismus von Disulfiram (nach Gessner und Gessner 1992).
Der Diethyldithiocarbamat-Kupfer-Komplex wurde bei Alkoholikern unter Disulfi- ram-Therapie im Plasma nachgewiesen (Johansson und Stankiewicz 1985). CS2 und Diethylamin entstehen durch Spaltung von Diethyldithiocarbamat und sind men- genmig als Metaboliten von Bedeutung. Carbonylsulfid entsteht aus CS2 und wurde im Blut von Alkoholikern unter chronischer Disulfiram-Therapie 4 Stunden nach Applikation in Konzentrationen von 20-540 nmol/l gefunden (Johansson 1989). Carbonylsulfid wird von Rattenhepatozyten zu CO2 und Sulfat unter Beteili- gung der Carboanhydrase metabolisiert (Chengelis und Neal 1979). Die aus CS2 und Glutathion oder Cystein gebildete Thiazolidin-2-thion-4-carbonsure fand sich im Urin von Freiwilligen nach Gabe von Disulfiram (Van Doorn et al. 1982). Die
-
Bildung des lipophilen Methyldiethyldithiocarbamats durch Methylierung von Di- ethyldithiocarbamat wird durch die hepatische mikrosomale Thiol-S-Methyltrans- ferase katalysiert (Gessner und Jakubowski 1972). Die hchsten Aktivitten dieses Enzyms finden sich in Leber, Lunge, Niere und Darm (Gessner und Jakubowski 1972). Eine Rckreaktion von Methyldiethyldithiocarbamat zu Diethyldithiocarba- mat findet nur in geringem Umfang statt (Johansson et al. 1989), da nach Applika- tion von Methyldiethyldithiocarbamat keine Abatmung von CS2 erfolgt, wohl aber nach Applikation von Diethyldithiocarbamat (Faiman et al. 1983). Methyldiethyldi- thiocarbamat selbst wird nicht im Urin ausgeschieden (Gessner und Jakubowski 1972), sondern aus diesem, vermutlich durch oxidative Desulfurierung der Thiocar- bonylgruppe zur Carbonylgruppe, Methyldiethylmonothiocarbamat und Sulfat ge- bildet (Johansson und Stankiewicz 1989; Johansson et al. 1989). Methyldiethy monothiocarbamatsulfoxid, das Oxidationsprodukt von Methyldiethyhnonothio- carbamat, wurde im Plasma von Ratten nachgewiesen (Hart und Faiman 1992). Analog zu anderen Monothiocarbamaten knnte Diethylmonothiocarbaminsure surekatalysiert zu COS und Diethylamin umgesetzt werden (Gessner und Gessner 1992). Weiterhin wurden in geringer Menge verschiedene Glutathionkonjugate in vivo nachgewiesen (Jin et al. 1994). Ein berblick ber die bekannten Stoffwechselwege findet sich in Abbildung 1. Daten zur Toxikokinetik der Metaboliten in vivo sind in Tabelle 1 zusammenge- stellt.
Tab. 1. Ausscheidung von Metaboliten nach Disulfiramgabe (verndert nach Gessner und Gessner 1992)
Dosis (mg/kg KG); Applikation Ratte 7; oral
40; oral
70; oral
ca. 137; oral
ca. 146; oral
ca. 4; i.p.
gemessener Parameter; Kompartiment
35S; Urin
35S; Faeces CS2; Atemluft 14C; Urin 14C; Faeces 14C; Plasma 35S; Urin CS2; Atemluft 14C; Urin DEA; Urin 14C35S; Urin 14C35S; Faeces 14C35S; Atemluft Sulfat; Urin
Anteil der Dosis (%)
66,8 (62 % Glucuronid, 38% Sulfat) 6,5 11,6a 90,6 10,5
61,5 16,6 88,01 27,8 77,5a 132 65 22,42
Halbwerts- zeita
11,1 h b
n.b. 5,47 h b
18 h n.b. 7.41 hb n.b. n.b. 14,9 hb n.b. 15,9 h b n.b. n.b. 12,6 hb
Literatur
Faiman et al. 1980
Pedersen 1980
Jensen 1984
Neiderhiser und Fuller 1980 Neiderhiser et al. 1983
Eldjarn 1950 a
-
Dosis (mg/kg KG); Applikation Ratte 7; i.p.
c a . 37; i.p.
70; i.p.
70; i.d.
70; i.v.
30; i.v. 60; i.v.
Hund 7; i.v.
20; i.v.
Mensch (mg)
200; oral 19-38 d
250; oral
250; oral
gemessener Parameter; Kompartiment
35S; Urin
35S; Faeces CS2; Atemluft Glucuronid; Urin Sulfat; Urin CS2; Atemluft 35SPr; Plasma Glucuronid; Plasma 35S; Urin CS2; Atemluft 35S; Urin CS2; Atemluft 35S; Urin CS2; Atemluft CS2; Atemluft CS2; Atemluft
DSH; Plasma
DSH; Plasma DSSD; Plasma DSH; Plasma DSMe; Plasma
CS2 frei; Blut CS2 gesamt; Blut
35S (DSH + Glucuronid, Sulfat: Spuren); Urin 35S; Faeces CS2; Atemluft CS2; Atemluft
Anteil der Dosis (%)
67,2a (57% Glucuronid, 45% Sulfat) 6,8 12,4a 11,2a 8,1 2,5a n.b. n.b. 54,7 8,5 59,7 8,5 64,5 18,2 1,030,19a 1,480,24a
n.b.
29,826,7 n.b. n.b. n.b.
n.b. n.b.
42,418,0a 6,64,5 29,614,1 13,11,4
Halbwerts- zeita
11,1 hb
n.b. 5,47 h b 48,2 min b n.b. 63,2 minb 117 minb 55,3 minb n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 20,1 minb 17,1 min b
10,2 minb
n.b. 19,1 min 30 minc 22 minc
10,6 h (E); 22,8 h (F) 6,9 h (E); 17,3 h (F)
14,7 hb n.b. n.b 4,7-10,7 hb
Literatur
Faiman et al. 1980
Strmme 1965
Jensen 1984
Jensen 1984
Jensen 1984
Prickett und Johnston 1953
Jensen 1984
Faiman et al. 1977
Brugnone et al. 1992
Iber et al. 1977
Rogers et al. 1978
-
Dosis (mg/kg KG); Applikation Mensch
( m g ) 250; oral, einmal
250; oral, 12mal
250; oral
400; oral 400; oral
500; oral 750; oral 1000; oral 800; oral 2000; oral
2000; oral
gemessener Parameter; Kompartiment
Glucuronid; Urin DEA; Urin CS2; Atemluft CS2; Plasma DSSD; Plasma DSH; Plasma DSMe; Plasma DEA; Plasma Glucuronid; Urin DEA; Urin CS2; Atemluft TTCA; Urin
DSMe; Plasma DSMe; Plasma DmSMe; Plasma CS2; Atemluft CS2; Atemluft CS2; Atemluft DSMe; Plasma 35S; Urin Sulfat; Urin 35S; Faeces DSH; Urin
Anteil der Dosis (%)
1,70,3 1,60,8 22,40,5 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 8,3 1,6 5.71,6 31,30,8 0,2-0,4
n.b. n.b. n.b. 44,5 37,8 58,7 n.b. 73,7 63,4a 10 1,64a
Halbwerts- zeita
n.b. n.b. 13,3 h 8 , 9 h 7 , 3 h 15,5 h 22,1 h 13,9 h n.b. n.b. n.b n.b.
6,44 hb 6,31,5 h 11,23,0 h n.b. n.b. 11,8 hc 1,0 h b
13,9 hc 14,6 hb
4,39 h b
Literatur
Faiman et al. 1984
Faiman et al. 1984
Van Doorn et al. 1982 Johansson 1986 Johansson und Stankiewicz 1989 Merlevede und Casier 1961
Pedersen 1980 Eldjarn 1950 b
Linderholm und Berg 1951
a Von Gessner und Gessner (1992) auf Zeitpunkt berechnet b Von Gessner und Gessner (1992) berechnet c Von Cobby et al. (1978) berechnet DEA, Diethylamin; DmSMe, Methyldiethylmonothiocarbamat; DSH, Diethyldithiocarba- mat; DSMe, Methyldiethyldithiocarbamat; DSSD, Disulfiram; i.d., intraduodenal; 35SPr, 35S proteingebunden; TTCA, Thiazolidin-2-thion-4-carbonsure
Von Menschen und Ratten werden mehr als 60 % der verabreichten Menge Disulfi- ram mit dem Urin ausgeschieden. Davon ca. 90 % als anorganisches Sulfat (Eldjarn 1950 b), der Rest bei Ratten als Glucuronid, das bei Menschen nur in geringen Mengen nachgewiesen wurde. Es bestehen jedoch Zweifel an der Spezifitt der verwendeten Methoden (Gessner und Gessner 1992). Die Angaben zur gebildeten Menge an CS2 nach oraler Applikation sind beim Menschen widersprchlich: 13- 60% sollen als CS2 abgeatmet werden (Merlevede und Casier 1961; Rogers et al. 1978). Bei Ratten werden 8-18% als CS2 abgeatmet. Die mengenmig unter-
-
schiedliche Ausscheidung von Diethylamin bei Mensch (Faiman et al. 1984) und Ratte (Neiderhiser und Fuller 1980) kann nicht erklrt werden, da dieser Metabolit bisher wenig untersucht wurde. Beim Menschen besitzen Disulfiram und die Metaboliten Diethyldithiocarbamat, Methyldiethyldithiocarbamat, Diethylamin, CS2 und Methyldiethylmonothiocar- bamat Halbwertszeiten von mehreren Stunden im Plasma (Tabelle 1). Ebenso wird GS2 mit Halbwertszeiten um 10 Stunden abgeatmet. Es ist mglich, da Disulfiram auch beim Menschen seinen eigenen Metabolismus induziert, wie dies bei Ratten nachgewiesen wurde (Neiderhiser und Fuller 1980). CS2 wird bis 130 Stunden nach Gabe von Disulfiram abgeatmet (Merlevede und Casier 1961). 90 % einer oralen Dosis von 250 mg radioaktiv markiertem Disulfiram waren von
Probanden nach 3 Tagen mit Urin, Faeces und Atemluft ausgeschieden, ca. zwei Dri t tel am ersten Tag (Iber et al. 1977). 60-70 % der Dosis wurden in den ersten 48
Stunden von Menschen (Eldjarn 1950 b) und Ratten (Neiderhiser und Fuller 1980) mit dem Urin ausgeschieden. 144 Stunden nach oraler Gabe von radioaktiv markier- tem Disulfiram war im Krper von Ratten keine mebare Radioaktivitt mehr nachzuweisen (Neiderhiser et al.1983). Da auch nach intraperitonealer Gabe Radio- aktivitt in den Faeces und der Galle von Ratten nachgewiesen wurde (Faiman et al. 1980, 1983), ist die nach oraler Gabe in den Faeces gefundene Radioaktivitt (Tabelle 1) kein Hinweis auf eine unvollstndige Resorption im Magen-Darm-Trakt. Es ist daher zu vermuten, da die Resorption von Disulfiram bzw. seiner bereits im Magen-Darm-Trakt entstehenden Metaboliten nach oraler Gabe fast vollstndig ist. Aufgrund der Daten zur Toxikokinetik wurde vermutet, da Disulfiram einem enterohepatischen Kreislauf unterliegt (Faiman et al. 1980, 1983, 1984). Zu beachten ist, da die Formulierung von Disulfiram einen erheblichen Einflu auf Bioverfgbarkeit und Kinetik hat. Dies gilt auch fr den Vergleich von Studien aus verschiedenen Lndern, in denen unterschiedliche Formulierungen zum Einsatz kommen (Gessner und Gessner 1992): Zwischen zwei Disulfiram-Prparaten aus Grobritannien und Dnemark wurde beim Menschen ein Unterschied um den Faktor 3 bei den maximalen Blutspiegeln und der AUC von Methyldiethyldithiocarbamat beobachtet. Auerdem war die Bioverfgbarkeit bei beiden Prparaten um den Faktor 2-3 geringer, wenn die
Einnahme nchtern erfolgte, als nach einer Mahlzeit. Der Autor vermutete, da Disulfiram vor der Resorption z.B. im sauren Magensaft zersetzt wird, da bei
80-90% Bioverfgbarkeit von Disulfiram, wie in der Literatur berichtet, keine derartig deutlichen Unterschiede in der Bioverfgbarkeit beider Prparate nach- weisbar gewesen wren (Andersen 1992). In einer Studie an Ratten wurde dagegen kein Unterschied zwischen der quantitati- ven renalen Ausscheidung des Diethyldithiocarbamat-Glucuronids nach i.p. oder oraler Gabe gefunden (Faiman et al. 1980), was gegen eine Zersetzung im Magen spricht. Bei Probanden konnte keine Kumulation von Disulfiram und des Hauptme- taboliten CS2 nach 12 tglichen Dosen beobachtet werden. Fr Diethylamin, Me- thyldiethyldithiocarbamat und Diethyldithiocarbamat waren die maximalen Plas- maspiegel und die AUC nach wiederholter Gabe ca. 2-3mal hher als nach einmaliger Gabe. Die Autoren weisen auf die hohe interindividuelle Schwankung der Plasmaspiegel von Disulfiram und seinen Metaboliten hin, die sie auf die gute Lipidlslichkeit von Disulfiram, unterschiedliche Plasmaproteinbindung
-
und die Wirkung des enterohepatischen Kreislaufs zurckfhren (Faiman et al. 1984).
4 Erfahrungen beim Menschen
4 . 1 Einmalige Exposition
Zur Symptomatik bei akuter Vergiftung mit Disulfiram siehe Begrndung 1978. Ein Selbstmordversuch mit 20000 mg Disulfiram und Alkohol fhrte bei einer 30jhrigen alkoholkranken Frau zu Nekrosen im Gehirn und Bewegungsstrungen (Krauss et al. 1990). Weitere Fallberichte nach sehr hohen Dosen Disulfiram, die z u peripheren Neuropathien fhrten, liegen vor (Klugkist und Preu 1992). Ein Selbstmordversuch durch Einnahme von Disulfiram und Alkohol fhrte zu myocardialen Infarkten (Rimailho et al. 1984).
4.2 Wiederholte Exposition
Die Festlegung des bisherigen MAK-Werts beruhte auf Beobachtungen, nach denen therapeutische Einzeldosen von 125 mg bei Erwachsenen zu Mdigkeit, Einschrn- kung der Vigilanz, Kopfschmerzen und verminderter Leistungsfhigkeit fhren kn- nen (Begrndung 1978). Da aufgrund der seinerzeit vorliegenden Studien angenom- men wurde, da Disulfiram im Organismus akkumuliert, wurde eine duldbare tgliche aufzunehmende Menge von 20 mg abgeleitet (Begrndung 1978). Seither wurden zahlreiche Studien und Fallberichte zu Nebenwirkungen bei Patien- ten, die mit Disulfiram behandelt wurden, verffentlicht (Tabelle 2). In Dnemark wurden in den Jahren 1968-1991 154 unerwnschte Nebenwirkungen auf Disulfiram gemeldet. Es wurden in absteigender Hufigkeit hepatische, neurolo- gische, kutane, und psychische Reaktionen beobachtet. 14 Todesflle mit der Haupt- ursache Lebertoxizitt wurden verzeichnet. In Schweden wurde hufiger ber neuro- logische und psychische Reaktionen berichtet. Die kutanen und hepatischen Reaktionen werden im Zusammenhang mit einer Nickel-Allergie diskutiert ( E n g h u sen-Poulsen et al. 1 9 9 2 ) . Tab. 2. Nebenwirkungen von Disulfiram (DSSD) Kollektiv
Alkoholiker, Placebo-kontrollierte Doppel-blind-Studie, randomisiert Alkoholiker, Placebo-kontrollierte Doppel-blind-cross- over-Studie
Dosis mg/d (Zahl) 0 (75) 200 (83)
200 (30)
Dauer
6 Wo
1 Mo
Wirkung
keine
Mdigkeit, Muskelschwche, Kurzatmigkeit, bei Patienten die erst DSSD bekommen haben und dann Placebo
Literatur
Christensen et al. 1984
Christensen 1973
-
Kollektiv
Gesunde, Placebo- kontrolliert, .Doppel- blind-cross-over- Studie
Gesunde, mige Trinker
Alkoholiker, Placebo-kontrollierte Doppel-blind-Studie, randomisiert Alkoholiker
chronische Alkoholiker, Confounder fr Neuropathien ausgeschlossen: Diabetes, Unterernhrung, Leber-, Gef- erkrankungen, Medikamentenmi- brauch, frhere Disulfiramtherapie Alkoholiker, randomisierte Studie
Alkoholiker, randomisierte Studie
Dosis mg/d (Zahl) 1 Wo: 500 mg/d 2 Wo: 250 mg/d
Gruppe 1 (15): 1 Wo Placebo 3 Wo DSSD 5 Wo Placebo 2 Wo keine Einnahme Gruppe 2 (15): 6 Wo Placebo 3 Wo DSSD 2 Wo keine Einnahme 500 (7)
0 (12) 250 (13) 500 (12)
250(15)
0 (24) 125 (9) 250 (33)
0(13) 250 (8) 500(6)
0 (15) 250 bzw. 500 ( 3 5 )
Dauer
2 Wo
3 Wo
1 und 3 Mo
1,3 und 6 Mo
3 Wo
3 Wo
Wirkung
whrend Gabe von DSSD: keine Inhibierung der Dopamin-(i-Hydroxylase- Aktivitt im peripheren Blut; Gruppe 1: Mdigkeit , Erinnerungsvermgen , Bauchschmerzen, Gruppe 2: Bauchschmerzen, 2 Flle von Neuropathie, Gesichts- schmerzen (fraglich substanz- bedingt), Zittern und Schwche in Hnden und Fen, neuro- logische Untersuchung o. B.
bei verhaltenspsychlogischen Tests 1/34 Parametern schlechter keine vernderten Depres- sionen und Angstgefhle
keine Neuropathien, keine Nervenfunktionsstrungen
keine peripheren Neuro- pathien, keine Vernderun- gen von Muskelkraft, Reflexen, Berhrungs- und Schmerzempfinden; Reiz- leitungsgeschwindigkeit nach 6 Monaten bei 250 mg, Geschwindigkeit in den Kontrollen siehe An- merkung)
250: kein Anstieg von Serum-Cholesterin 500: nach 3 Wo Serum- Cholesterin 18% , nach 6 Wochen 37 % durchschnittliche Leber- enzymwerte nicht von Kon- trollwerten verschieden
Literatur
Silver et al. 1979
Peeke et al. 1979
Goyer et al. 1984
Palliyath und Schwartz 1988 Palliyath et al. 1990
Major und Goyer 1978
Goyer und Major 1979
-
Kollektiv
Alkoholiker, vor Beginn Leberwerte normal
Alkoholiker, Placebo-kontrollierte Blind-Studie, randomisiert
Alkoholiker
Alkoholiker
Gesunde, Placebo- kontrolliert
Dosis mg/d (Zahl) 0 (108) 250 (27)
200
250 (61)
250 (40)
800, 2 d, dann 400,12 d (12)
Dauer Wirkung
6 Wo Alanin-Aminotransferase hher als Referenzwerte bei 25% der Disulfiram-Behan- delten und bei 4% der nicht behandelten
6 Mo 2 Flle von allergischen Hautreaktionen, 1 vermutete Neuropathie; in Kontroll- gruppe 1 Fall mit linker Hemiparese
bis 4 a Nickelwerte in Serum, Ganzblut und Urin im Vergleich zu Werten vor Behandlung 17-,15-, und 35fach
10d Alkoholdehydrogenase im Vergleich zu Werten vor der Behandlung 165 %
nach 2 d:Thromboglobulin + Plttchenfaktor 4 nach 14 d: Plasminogen- Aktivator-Inhibitor-1-Akti- vitt 30% , euglobulin clot lysis time 40%
Literatur
Wright et al. 1993
Chick et al. 1992
Hopfer et al. 1987
Buris und Varga 1992
Gleerup et al. 1990
Periphere Polyneuropathien
Viele der bisher publizierten Fallbeschreibungen zu peripheren Polyneuropathien wurden von Mokri et al. (1981) und Frisoni und Di Monda (1989) zusammengefat Im wesentlichen wurden folgende Symptome beschrieben (Frisoni und Di Monda 1989): Gangstrungen, sensorische und motorische Beschwerden, Strungen der Hirnnerven, motorische und sensorische Defizite in den oberen und unteren Extre- mitten, fehlender Achillessehnenreflex und Fallfu. Die Latenzzeit lag zwischen 2 Wochen und 30 Jahren. Die Zeit bis zum Auftreten der Symptome war umso krzer und die Symptome umso schwerer, je hher die Dosis war. Dies ist nach Ansicht der Autoren ein Hinweis darauf, da die Neuropathien durch Disulfiram und nicht durch Alkoholmibrauch entstanden. Es konnte kein signifikanter Unter- schied im Auftreten von Neuropathien zwischen Mnnern und Frauen festgestellt werden. Die Geschwindigkeit des Rckganges der Symptome nach Beendigung der Disulfiram-Behandlung hing nicht von der Behandlungsdauer ab. Bei 32 der 37
-
beschriebenen Flle (Frisoni und Di Monda 1989) wurden die Latenzzeit und die Schwere der Symptome ermittelt (Tabelle 3). Die Zeit bis zum vollstndigen Rck- gang der Symptome betrug in 12 Fllen zwischen 1 Woche und 4 Monaten. Zu den brigen Fllen erfolgte keine Angabe. Die Wiederherstellung der motorischen F- higkeiten gelang bei 2 Fllen vollstndig, bei 15 mig, bei 8 kaum und bei 6 nicht (Frisoni und Di Monda 1989).
Tab. 3. Schweregrad und Latenzzeit von Neuropathien bei Disulfirambehandlung (Frisoni und Di Monda 1989)
tgliche Dosis (mg) 250 400-600 750
Fallzahl
8 19 5
davon schwere sensorische und motorische Defizite der oberen und unteren Gliedmaen 1 (13%)
13 (68%) 3 (60%)
Latenzzeit
4,6 Jahre 4,3 Monate 2,6 Monate
Weitere neuere Fallbeobachtungen werden nachstehend beschrieben: Ein 29 Jahre alter Mann, der seit etwa 1 Jahr Alkoholiker war und 1 Monat vorher mit 400 mg Disulfiram/Tag behandelt worden war, nahm in einer Woche 29000 mg und eine hohe unbekannte Dosis an Diazepam auf, ohne zustzlich Alkohol zu konsumieren. Er wurde lethargisch, apathisch und entwickelte einen taumelnden Gang. Innerhalb der nchsten Wochen kam es zu unvollstndigen Lhmungen (Er- schlaffungen), Halluzinationen, Urin-Retention, Tachykardie, Muskelzuckungen, Anstieg der Kreatinin-Kinase und Anstieg der Proteinkonzentration in der zerebro- spinalen Flssigkeit. Bakterien-, Viren- und Einzellertests waren negativ. Nach 3 Wochen verbesserte sich der Zustand: Der Patient wurde ruhiger, erlangte wieder Orientierung und Reflexe in den Armen, aber nicht in den Beinen, und die Muskel- zuckungen hrten auf. Nach 4 Monaten war eine Muskelschwche in distalen Arm- und Beinbereichen zu beobachten, Reflexe an den Enden der Gliedmaen fehlten. Nach einem Jahr klagte der Patient noch ber Schwche in den Armen und Beinen und ber Sensibilittsstrungen in Hnden und Fen (Zorzon et al. 1995). Ein 38 Jahre alter Mann, der seit 10 Jahren Alkoholiker war und mit 400 mg/Tag therapiert wurde, nahm 5 Monate spter spontan 2400 mg/Tag fr 10 Tage. An Symptomen wurden psychomotorische Hemmung, gebeugte Arme, gestreckte Beine, starkes Schwitzen und Bewegungsstarre beobachtet. Die Blut- und Leber- werte waren normal. Nach einem Monat war der Patient wieder erholt, die Blut- Hirn-Schranke war jedoch defekt (de Mari et al. 1993). Folgende ultrastrukturelle Vernderungen bei Patienten mit peripheren Neuropa- thien wurden festgestellt: Axondegenerationen in verschiedenen Stadien (Ansbacher et al. 1982; Bilbao et al. 1984), wobei nichtmyelinisierte Axone nicht beteiligt sind (Ansbacher et al. 1982), Axonschwellungen durch Ansammlung von Neurofilamen- ten (Ansbacher et al. 1982; Bergouignan et al. 1988; Bilbao et al. 1984; Hirschberg et al. 1987; Sahenk 1987). Der letztere Befund wurde jedoch kontrovers diskutiert (Anzil 1985). Mitteilungen ber reversible Neuropathien des Sehnervs (retrobulbre Neuritis), die bei Dosierungen von 500 mg Disulfiram/Tag und mehr auftreten knnen, wurden
-
von Geffray et al. (1995) zusammengefat. Eine retrobulbre Neuritis und andere Wirkungen auf das Auge wurden auch fr CS2 beschrieben (Sepplinen und Haltia 1980).
Lebertoacizitt
Sehr selten trat eine nicht dosisabhngige Lebertoxizitt bei einer Disulfiram- therapie auf. In einer Zusammenstellung publizierter Fallberichte wurden 25 Flle von Lebertoxizitt whrend der Einnahme von Disulfiram beschrieben (Zala et al. 1993), wobei ein Fall (Barth et al. 1987) aufgrund des Nachweises von Antikrpern gegen Hepatitis A und B nicht weiter bercksichtigt wurde. In 5 Fllen konnte e i n virusbedingte Hepatitis A oder B als Ursache mit Hilfe von serologischen Tests ausgeschlossen werden, zu den brigen Fllen liegen darber keine Angaben vor. In 8 Fllen wurde eine Hepatitis ausgeschlossen, da es nach Reexposition innerhalb von 1-14 Tagen zu einer erneuten Reaktion kam. Bei Beginn der Disulfiram-Be- handlung hatten alle 22 Patienten, die wegen Alkoholmibrauchs behandelt wurden, normale Leberwerte. Die verbleibenden beiden Patienten waren Nicht-Alkoholiker ohne Leberschaden; sie waren in kontrollierten Studien wegen einer Nickel-sensiti- ven Dermatitis mit Disulfiram behandelt worden. Die Gesamtdosis von Disulfiram betrug 3750-48 000 mg, im Mittel 11500 mg, die Latenzzeit vom Beginn der Disulfi- ram-Therapie bis zum Auftreten der ersten klinischen Symptome betrug 10-183 Tage, im Mittel 41 Tage. Die Symptome waren: belkeit, Appetitlosigkeit, Gelb- sucht, erhhte Werte von Serum-Bilirubin, alkalischer Phosphatase, Aspartat- und Alanin-Aminotransferase. Wurde die Disulfiram-Therapie unterbrochen, gingen die Nebenwirkungen nach 2-3 Wochen wieder zurck, ansonsten konnte es zu einer massiven Nekrose kommen. Von den 24 beschriebenen Fllen verliefen 9 tdlich. Die Todesursache war Leberkoma mit gastrointestinalen Blutungen. Die Disulfi- ram-Dosen betrugen dabei in einem Fall 200 mg 3mal pro Woche, in 3 Fllen 200 mg/Tag, in 2 Fllen 250 mg/Tag und in einem Fall 400 mg/Tag, zu den anderen Fllen liegen keine Angaben vor (Ranek und Andreasen 1977; Schade et al. 1983; Zala et al. 1993). In einer Studie an Alkoholikern (250 mg/Tag oder 500 mg/Tag, 3 Wochen) wurden keine vernderten Leberwerte gegenber der Kontrollgruppe festgestellt (Parame- ter: Aspartat-Aminotransferase, alkalische Phosphatase, Laktat-Dehydrogenase, Bilirubingehalt) (Goyer und Major 1979). Bei Alkoholikern fhrte eine 6wchige Behandlung mit 250 mg/Tag zu Alanin-Aminotransferase-Werten im Serum, die ber den Referenzwerten lagen. Die Werte vor Behandlung waren normal (Wright et al. 1993).
Enzephalopathien
Reversible Enzephalopathien (Symptome: Verwirrtheit, Desorientierung, paranoide Vorstellungen, Halluzinationen, siehe auch Begrndung 1978) traten selten auf, und zwar bei einer Dosis von 500 mg/Tag bei Patienten mit geringen Blut-Gehalten an Dopamin-F-Hydroxylase (Major et al. 1979 a), thrombozytrer Monoaminoxidase,
-
Plasma-Aminoxidase und einem erhhten Gehalt von erythrozytrer Katechol-O- Methyltransferase (Major et al. 1979 b). Auerdem traten psychische Reaktionen bei Dosen von mehr als 500 mg/Tag auf, wobei sich auch bestehende Psychosen verschlimmern konnten. Nach Beendigung der Therapie verschwanden die Sym- ptome nach einigen Tagen oder Wochen (Gessner und Gessner 1992). In der Zusammenstellung von Frisoni und Di Monda (1989) wurden 5 Flle von Enzephalopathie beschrieben, die bei folgenden Disulfiram-Konzentrationen auf- traten: 250 mg/Tag (nach 30 Jahren Einnahme), 500 mg/Tag (nach 4 Wochen bzw. einigen Monaten) und 1000 mg/Tag (nach 1 Monat bzw. 3 Monaten). 4 von 9 gesunden Mnnern entwickelten bei Gabe von 500 mg Disulfiram/Tag in der zweiten Woche paranoide Gedankengnge (siehe Abschnitt "Endokrines System"; Van Thiel et al. 1979). Da v.a. in Studien, die vor 1960 publiziert wurden, Enzephalopathien berichtet wurden, ist auf die anfngliche im therapeutischen Einsatz verwendte Dosierung von mehr als 500 mg/Tag zurckzufhren. In kontrollierten Studien war die Inzidenz fr psychische Reaktionen bei Patienten, die mit weniger als 500 mg/Tag behandelt wurden, nicht signifikant erhht (Gessner und Gessner 1992).
Endokrines System
Disulfiram steht im Verdacht, Impotenz zu erzeugen, daher wurden seine Wirkungen auf Hypothalamus und Hypophyse untersucht. Die externe Zufuhr des Thyreotro- pin-Freisetzungshormons (TRH) stimuliert beim normalen Menschen die Ausscht- tung des Thyreotropins (TSH), Prolaktins, Thyroxins (T4), Triiodthyronins (T3) sowie des Wachstumshormons (GH). In hnlicher Weise erhhen das Gonadotro- pin-Freisetzungshormon (LRF) sowie Clomifen die Konzentrationen des Luteinisie- rungshormons (LH), des Follikel-stimulierenden Hormons (FSH) und des Testoste- rons im Blut. Es wurde geprft, ob Disulfiram die mittels Stimulatoren erzielbare Freisetzung der genannten Hormone beeintrchtigt. Bei 9 gesunden mnnlichen Nichtalkoholikern mit einem mittleren Alter von 27 Jahren wurden zunchst die basalen Plasma-Spiegel von Testosteron, LH und FSH bestimmt, dann einmalig LRF verabreicht und die Spiegel von LH und FSH whrend der sich anschlieenden 4 Stunden verfolgt. Am Ende des vierstndigen Beobachtungsintervalls wurden die Basalwerte fr TSH, GH, Prolaktin, T4 und T3 bestimmt, dann 400 Vg TRH als Stimulator verabreicht und die Konzentrationen der entsprechenden Hormone in einem sich unmittelbar anschlieenden Beobachtungsintervall von drei Stunden ge- messen. Die Probanden erhielten dann tglich 500 mg Disulfiram oral, eine Woche lang, und am Ende dieser Behandlungsspanne wurden die oben genannten Untersu- chungen wiederholt. Whrend der zweiten Woche erhielten die Probanden ebenfalls tglich 500 mg Disulfiram und zustzlich 200 mg Clomifen tglich, 5 Tage lang. Die Testosteron-, LH- und FSH-Spiegel wurden vor, unmittelbar nach sowie einen bzw. zwei Tage nach der Clomifen-Verabreichung gemessen. Im wesentlichen wurden zwei von der Norm abweichende endokrine Reaktionen beobachtet: Nach einwchi- ger Disulfiram-Behandlung war sowohl die Basalkonzentration von TSH um ein Drittel abgesunken, und auch die nach Stimulation mit TRH erzielte Konzentration erreichte nur die Hlfte des Kontrollwertes. Bei keinem der Probanden unter Disul-
-
firam-Behandlung (n=7) stieg LH nach Clomifen-Gabe an - eine anormale Reak- tion. Im Widerspruch zum Befund des fehlenden LH-Anstiegs steht die Beobach- tung, da Clomifen trotz gleichzeitiger Gabe von Disulfiram die Konzentrationen von Testosteron und FSH erhhte, wobei die gemessenen Anstiege auch in quantita- tiver Hinsicht der normalen Regulation entsprachen. Die Befunde wurden von den Autoren nicht mechanistisch erklrt. In der zweiten Woche entwickelten 4 von 9
M n n e r n paranoide Gedankengnge und waren nicht in der Lage, einigen ihrer normalen Tagesaktivitten nachzugehen. 2 von den 4 Probanden brachen die Studie ab. Alle Untersuchten klagten ber Mdigkeit und in der zweiten Woche ber einen metallischen Geschmack im Mund. Nach Absetzen von Disulfiram verschwanden alle Nebenwirkungen (Van Thiel et al. 1979). 9 gesunde Mnner und 7 gesunde Frauen wurden einmalig mit 1000 mg Disulfiram behandelt, als Kontrollen dienten 6 Mnner und 5 Frauen. Nach 1, 2, 4 und 2 4 Stunden wurden im Blut folgende Parameter bestimmt: TSH, LH, FSH und Prolak- tin. Nach einer Stunde nahm der TSH-Gehalt, sowohl bei Mnnern als auch bei Frauen, gegenber der Kontrollgruppe signifikant ab, der niedrigste Stand wurde nach 24 Stunden erreicht. Der Prolaktin-Spiegel nahm ebenfalls bis 4 Stunden ab, erreichte aber nach 24 Stunden wieder den Ausgangswert. Bei den Mnnern konnte eine geringfgige Abnahme von FSH und bei den Frauen eine geringfgige Ab- nahme von LH beobachtet werden (Cavalleri et al. 1978).
Alkoholunvertrglichkeitsreaktionen
Arbeiter in der Gummndustrie, die dem zu Disulfiram strukturanalogen Tetrame- thylthiuramdisulfid und dem Monosulfid ausgesetzt waren, wiesen eine Alko- holunvertrglichkeit auf. Konzentrationsangaben wurden nicht mitgeteilt (Williams 1937). 52 Nichtalkoholiker erhielten tglich fr je 2 Wochen zunehmende Dosen von 1,100, 200 und 300 mg Disulfiram (dnisches Prparat) und jeweils am Ende der zweiten Woche 150 mg Ethanol/kg KG. Bei 1 mg Disulfiram ergaben sich keine Reaktionen auf Ethanolgabe, whrend bei 100 mg 21 Personen Symptome einer Alko- holunvertrglichkeit entwickelten. Nur 4 dieser Probanden empfanden die Reaktion , als so stark, da sie keinen weiteren Alkohol zu sich genommen htten. Bei 200 m g reagierten 27 Personen und erst bei 300 mg die verbleibenden 4 Probanden. Als Symptome wurden sowohl subjektive Beschwerden als auch ein Abfall des diastoli- schen Blutdrucks um 20 mmHg oder mehr, ein um 20 oder mehr Schlge/min erhhter Puls und eine Zunahme der Atemfrequenz/min von 5 oder mehr gewertet. Unterschiede hinsichtlich Alter, Geschlecht und Krpergewicht bestanden nicht. Bei einer Reexposition mit 100 mg Disulfiram mute einer von 6 weiteren Probanden den Versuch wegen einer zu starken Reaktion abbrechen. Es wurden leichte Neben- wirkungen whrend der Behandlung in Form von Mdigkeit, Kopfschmerzen und Durchfall beobachtet (Christensen et al. 1991). Ab 100 mg Disulfiram war die Al- dehyddehydrogenase in den Erythrozyten zu mehr als 96% gehemmt und der Acet- aldehyd-Spiegel im Blut nach Ethanolgabe signifikant erhht. Noch zwei Wochen nach Beendigung der Disulfiram-Gabe war die Aktivitt der erythrozytren Alde- hyddehydrogenase um 84% vermindert. Die Autoren weisen darauf hin, da die
-
Aktivitt der erythrozytren Aldehyddehydrogenase nach Beendigung der Disulfi- ram-Gabe nicht die Aktivitt der hepatischen Aldehyddehydrogenase widerspiegelt. Die Konzentration an Methyldiethyldithiocarbamat nahm mit der Disulfiram-Dosis zu und betrug bis zu 108 nmol/l Plasma. Bei 1 mg Disulfiram wurde zwar eine geringfgige Hemmung der Aldehyddehydrogenase aber kein nachweisbarer An- stieg der Acetaldehydkonzentration im Blut beobachtet. Die Aktivitten der Dopa- min-F-Hydroxylase im Plasma whrend des Versuchs und danach waren nicht unter- schiedlich (Johansson et al. 1991). Der Versuch zeigt, da Alkohlunvertrglichkeits- reaktionen, wenn auch nur in geringem Mae, bereits bei 100 mg Disulfiram (ca. 1,5 mg/kg KG) auftreten knnen. Erytheme bei Anwendung eines bierhaltigen Shampoos und beim Test mit Ethanol auf angefeuchteter Haut traten bei einem 56jhrigen Mann nur unter Disulfiram-
Therapie auf. Bei Unterbrechung der Therapie wurde eine entsprechende Reaktion nicht beobachtet (Stoll und King 1980). Dagegen riefen Ethanol, Propanol und Isopropanol bei Patch-Tests auf angefeuchteter Haut Erytheme hervor, unabhngig von einer Therapie mit Disulfiram. Bei nicht angefeuchteter Haut wurden an 12 Patienten auch whrend der Disulfiram-Therapie keine Erytheme beobachtet (Had- dock und Wilkin 1982). Somit erscheint eine lokale Alkoholunvertrglichkeits- reaktion unwahrscheinlich.
Beeinflussung des Metabolismus von exogenen und endogenen Substraten
Durch die Hemmung zahlreicher Enzyme (vgl. Abschnitt 2) kommt es zu einer Beeinflussung des Metabolismus von exogenen und endogenen Substraten. Bereits 250 mg (ca. 3 mg/kg KG) ber 4-8 Tage an gesunde Probanden oder abstinente Alkoholiker gegeben, verringerten die metabolische Clearance von Aminopyrin um 48 % und erhhten die Halbwertszeit von Theophyllin um 18 % (Gessner und Gess- ner 1992).
4.3 Wirkung auf Haut und Schleimhute
E s liegen keine Angaben vor.
4.4 Allergene Wirkung
Thiurame wurden 1996 als sensibilisierend markiert, und zustzlich wurde auf Kreuzreaktionen der Thiurame untereinander sowie mit Dithiocarbamaten hinge- wiesen (Begrndung Gummiinhaltsstoffe 1996). Im folgenden werden Studien, in denen die Sensibilisierung gegenber Disulfiram untersucht wurde, beschrieben: Von 408 Bauarbeitern mit Verdacht auf eine berufsbedingte Kontaktdermatitis rea- gierten im Patch-Test 185 auf Gummi-Chemikalien und davon 92 auf Disulfiram (Cond-Salazar et al. 1995). Von 2260 epikutan getesteten Personen reagierten 108 (4,8%) auf Disulfiram, davon 78 auch auf weitere Bestandteile des Thiuram-Mix (Geier und Gefeller 1995). Von 3851 epikutan getesteten Personen mit Kontaktder-
-
matitiden reagierten 145 (3,8%) auf den Thiuram-Mix. 35 dieser Patienten wurden daraufhin gegen die Bestandteile des Thiuram-Mix getestet, wobei 9 (29%) auf Disulfiram reagierten, davon 7 auch auf weitere Bestandteile des Thiuram-Mix (von Hintzenstern et al. 1991). Mitgeteilte generalisierte und lokale allergische Erscheinungen bei Patienten mit subkutanen Disulfiram-Implantaten und bei oraler Einnahme von Disulfiram wur-
d e n von Larbre et al. (1990) zusammengefat. Zu mglichen allergischen hepatischen Reaktionen siehe auch Abschnitt 4.2 Lebertoxizitt.
4.5 Reproduktionstoxizitt 7 von 10 alkoholkranken Frauen, die whrend der Schwangerschaft abstinent b l i e ben und nur Disulfiram einnahmen, brachten Kinder zur Welt, die nicht migebildet waren. Zwei Schwangerschaften wurden abgebrochen und eine endete mit einer Totgeburt. 6 von 11 weiteren Frauen, die whrend der Schwangerschaft Disulfiram und Alkohol zu sich nahmen, gebaren Kinder, von denen 50% das fetale Alko- holsyndrom hatten (Jones et al. 1990, 1991). Weitere Fallberichte von Frauen, die whrend der Schwangerschaft 250-500 mg Disulfiram einnahmen und deren Kinder migebildet waren, liegen vor. Eine gleich- zeitige Einnahme von Alkohol wurde nicht berichtet: Zwei Frauen gebaren Kinder mit Klumpfen. Eine der Mtter brachte zuvor zwei debile Kinder zur Welt. Beide Mtter wurden zustzlich mit Neuroleptika wie Ali- memazin und Chlorpromazin behandelt. Eine weitere Schwangerschaft wurde vor- zeitig abgebrochen (Favre-Tissot und Delatour 1965). Ein Kind, dessen Mutter 125 mg Disulfiram aber keine anderen Medikamente whrend der Schwangerschaft einnahm, wurde mit dem Robin-Syndrom (Gesichtsdeformationen) geboren, dessen Auftreten auch mit dem fetalen Alkoholsyndrom assoziiert sein kann (Dehaene et al. 1984), ein weiteres wies schwere Mibildungen und das fetale Alkoholsyndrom auf (Gardner und Clarkson 1981). Zwei Kinder hatten Phokomelie der unteren Extre- mitten bzw. Wirbelfusionen, Radiusaplasie und eine sophagotrachealfistel (Nora et al. 1977). In fnf weiteren Fllen wiesen die Kinder dagegen keine Mibildungen auf (Favre-Tissot und Delatour 1965; Helmbrecht und Hoskins 1993; Nora et a l 1977). D.h. insgesamt wurden bisher 6 Flle von Mibildungen in Zusammenhang mit einer Disulfiram-Therapie ohne Einnahme von Alkohol beschrieben. Wenn die gleichzeitige Gabe von Neuroleptika, der Verlauf frherer Schwangerschaften und die Schwierigkeit, bei diesen Patientinnen tatschlich eine Alkoholeinnahme auszu- schlieen, bercksichtigt wird, kann auf eine teratogene Wirkung von Disulfiram allein beim Menschen nicht geschlossen werden. Bei 1300 Fllen, in denen migebildete Kinder geboren wurden, konnte keine Ein- nahme von Disulfiram whrend der Schwangerschaft nachgewiesen werden (Nora et al. 1977).
4.6 Genotoxizitt Verglichen mit 7 unbehandelten Alkoholikern oder 4 Kontrollpersonen (zusammen 1100 Metaphasen) waren die Inzidenzen fr Chromosomenaberrationen in periphe-
-
ren Lymphozyten bei 12 mit Disulfiram behandelten Alkoholikern (1450 Metapha- sen) nicht erhht (Lilly 1975).
4.7 Kanzerogenitt
Es liegen keine Angaben vor.
5 Tierexperimente l le Befunde und In-vitro-Untersuchungen
5.1 Akute Toxizitt
5.1.1 Inhalative Aufnahme
Es liegen keine Angaben vor.
5.1.2 Orale Aufnahme
Fr die Ratte wurden orale LD50-Werte von 1300-8600 mg/kg KG angegeben. Fr Kaninchen wurde eine LD50 von 650 mg/kg KG berichtet (Begrndung 1978).
5.1.3 Dermale Aufnahme
Es liegen keine Angaben vor.
5.1.4 Intraperitoneale Aufnahme
Eine einmalige i.p. Dosis von 1,65 mmol Disulfiram/kg KG (ca. 500 mg/kg KG) fhrte 36 Stunden spter an zwei Long-Evans-Ratten zu einer vlligen Degeneration der olfaktorischen Mukosa. hnliche Ergebnisse wurden fr Natriumdiethyldi- thiocarbamat erhalten. 1,25 mmol Disulfiram/kg KG waren unwirksam (Deamer und Genter 1995).
5.2 Subakute, subchronische und chronische Toxizitt
5.2.1 Inhalative Aufnahme
Es liegen keine Angaben vor.
-
5.2.2 Orale Aufnahme
10 SD-Ratten erhielten 60 Tage lang tglich 12 mg Disulfiram/kg KG per Schlund- sonde. Im Vergleich zu den Kontrolltieren war der Gehalt an Glutathion in Gehirn und Leber vermindert, whrend der Gehalt an oxidiertem Glutathion erhht war. Die Summe von GSH und oxidiertem Glutathion war unverndert. Die Aktivitt der Glutathion-Reduktase im Gehirn war vermindert, und die Aktivitt der Gluta-
thionperoxidase war unverndert. Die Na+-, K+-ATPase und die Mg2+-ATPase in den Synapsen waren signifikant gehemmt. Weitere Befunde wurden nicht erhoben (Mamatha und Nagendra 1994; Nagendra et al. 1994). Nach 30 tglichen Dosen von 25 mg Disulfiram/kg KG wurde bei Ratten histolo- gisch eine Hyperplasie und ein erhhtes Gewicht der Schilddrse beobachtet. D ie s war wahrscheinlich auf eine Hemmung der Synthese von Schilddrsenhormonen. zurckzufhren (Telkk und Kivalo 1958; Begrndung 1978). Disulfiram in Konzentrationen von 100, 300 und 1000 mg/kg Futter (ca. 10, 30 und 100 mg/kg KG) fhrte im 2-Jahres-Versuch bei Ratten zu muskulrer Inkoordina- tion. Bei 2500 mg/kg Futter (ca. 250 mg/kg KG) wurden Ataxie und partielle Lh- mungen beobachtet, die zum Tod fhrten. Im Gehirn der Tiere dieser Dosisgruppe wurden calcifizierte Massen in den granularen Schichten von Cerebellum, Basalgan- glia und anderen Gehirnregionen gefunden (Fitzhugh et al. 1952). 10 mnnliche Wistar-Ratten erhielten tglich 100 mg Disulfiram/kg KG. 1,2,4, 6 und 8 Wochen nach der ersten Injektion wurde das Gehirn von je zwei Tieren elektronenmikroskopisch untersucht. In den Synapsen und Postsynapsen des Hypo- thalamus fanden sich Vakuolen ab der ersten Behandlungswoche. Ab 6 Wochen nach der ersten Injektion wurden in den Neuronen der Hirnrinde leicht atrophische Kerne und Cytoplasma hoher Elektronendichte, dilatierter Golgi-Apparat und en- doplasmatisches Retikulum, geschwollene und vakuolisierte Mitochondrien sowie im Hypothalamus stark atrophische Zellen mit hoher Elektronendichte beobachtet (Ueno et aL 1977). Eine lebenslange Verabreichung von Disulfiram in Konzentrationen von 125, 250, 500 und 1000 mg/kg Futter fhrte ab 30 Tagen und ab 500 mg/kg (35-70 mg/ kg KG) dosisabhngig zu verzgerter Gewichtszunahme und verkrzter Lebens- dauer bei mnnlichen und weiblichen Wistar-Ratten (10-22 pro Gruppe). F u t t e r aufnahme und Tumorinzidenzen waren nicht von denen der Kontrolltiere verschieden. Calcium-Ablagerungen im Gehirn der Tiere der beiden Hochdosis- gruppen oder neurotoxische Symptome wurden nicht beobachtet (Holck et al.1970). Die orale Verabreichung von 1250 mg Disulfiram/kg KG zweimal pro Woche fhrte bei Ratten zu einer Hemmung der mitochondrialen Cytochrom-C-Oxidase und der Monoaminoxidase-B im Hippocampus (Simonian et al. 1992). Periphere Neuropathien bis zur vollstndigen Lhmung der Hinterextremitten wurden nach 10wchiger Gabe von 10000 mg Disulfiram/kg Futter (ca. 1000 mg/ kg KG) an Ratten beobachtet (Anzil 1985).
5.2.3 Subkutane Aufnahme
Eine einmal wchentliche s.c. Implantation von 500 mg Disulfiram (1700 mg/ kg KG) fhrte bei Ratten nach 3-4 Wochen zu einer Lhmung der Hinter- und
-
Vorderextremitten. Im Ischias-Nerv wurde keine Akkumulation von Neurofila- menten gefunden. Degenerationen der Muskelfasern und des Myokards wurden beobachtet (Anzil 1980).
5.3 Wirkung auf Haut und Schleimhute
Es liegen keine Angaben vor.
5.4 Allergene Wirkung
Es liegen keine Angaben vor.
5.5 Reproduktionstoxizitt
Die mit Disulfiram durchgefhrten reproduktionstoxikologischen Studien sind we- gen der fehlenden Angaben zur Maternaltoxizitt und der zum Teil nicht untersuch- ten Dosisabhngigkeit nicht ausreichend aussagekrftig. Bei zustzlicher Gabe von Ethanol wurden deutliche Hinweise auf reproduktionstoxische Wirkungen erhalten.
5.5.1 Fertilitt
In einer 2-Generationen-Studie erhielten Wistar-Ratten 500 oder 1000 mg Disulfi- ram/kg Futter ab dem 30. Lebenstag. Ab dem 130. Lebenstag wurden die Tiere verpaart und die F1-Generation erhielt Disulfiram wiederum ab dem 30. Lebenstag und wurde ab dem 90. Lebenstag verpaart (jeweils 6-16 Paare). Die Krperge- wichtsentwicklung der Tiere war gehemmt, die Zahl der Wrfe pro Paar und die Wurfgre war gegenber Kontrollen verringert. Mibildungen bei den Feten wur- den nicht beobachtet (Holck et al. 1970).
5.5.2 Entwicklungstoxizitt
In einer Screening-Studie wurde je eine CD-Ratte am Trchtigkeitstag 13 gegenber 450,670,1000,1500 oder 2250 mg Disulfiram/kg KG dermal exponiert. Die verwen- deten Dosen waren weder maternal- noch embryotoxisch oder teratogen (DuPont 1973). Nach tglicher oraler Gabe von 100 mg Disulfiram (400-500 mg/kg KG) an 11 SD-Ratten vom 3.-11. oder 12. Trchtigkeitstag und Sektion am nchsten Tag wurden durchschnittlich 83% der Feten resorbiert. Bei den Muttertieren traten Lethargie, Verfrbung der Leber, pulmonale Hmorrhagien, Koma und Mortalitt auf. Die analoge Behandlung mit 50 mg/Tag (200-250 mg/kg KG) fhrte zu gerin- geren toxischen Wirkungen (k. w. A.) bei den 4 untersuchten Muttertieren. Es traten keine Resorptionen oder Fehlbildungen auf, selbst bei tglicher Gabe bis zum
-
21. Trchtigkeitstag. Bei Applikation von 100 mg/Tier nach dem 8. Trchtigkeitstag wurden weder Embryotoxizitt noch Fehlbildungen festgestellt (Salgo und Oster 1974). Gruppen von 11-18 Wistar-Ratten erhielten tgliche orale Dosen von 100,200 oder 400 mg Disulfiram/kg KG vom 5. bis 10. Tag der Trchtigkeit. Am 22. Tag erfolgte die Untersuchung der 448 Feten. Das Gewicht der Feten war ab 200 mg/kg KG
verglichen mit Kontrolltieren vermindert. Auer einer Anomalie traten keine Fehl- bildungen auf. Bei gleichzeitiger Gabe von 200 mg Disulfiram in 1 ml 50% Ethanol abortierten 3 der 12 behandelten Ratten. Fehlbildungen traten nicht auf (Favre-Tis- sot und Delatour 1965). Angaben zur maternalen Toxizitt liegen nicht vor, so da unklar ist, worauf die Aborte zurckzufhren sind, die bei Wistar-Ratten selten sind. Bei Wistar-Ratten, die tglich 150 mg Disulfiram/kg KG vom 7. bis zum 16. Tag d e r Trchtigkeit erhielten, wurden 4% der Feten resorbiert, und 11,3% der lebenden Nachkommen wiesen skelettale Retardierungen auf (k.w. A.). Die entsprechenden Werte fr Tiere, die zustzlich 10 ml 40 %igen Alkohol/kg KG erhielten waren 64,7 und 61,1 %, fr Tiere, die nur Alkohol erhielten 12,2 und 14,7% und fr Kontroll- tiere 10,8 und 12,7% (Vghelyi et al. 1978). Damit war Disulfiram allein gegeben ohne Effekt, erhhte aber in Kombination mit Ethanol die Resorptionsrate und die Hufigkeit skelettaler Retardierungen. In einer Screening-Studie erhielten 50 CD1-Muse vom 6.13. Trchtigkeitstag 4900 mg Disulfiram/kg KG und Tag. Diese Dosis entsprach der LD10, die in einem Vorversuch ermittelt wurde. Die Behandlung fhrte zum Tod von 4 Tieren. Die Zahl der Wrfe, der Lebendgeburten pro Wurf, das Geburtsgewicht, die postnatale ber- lebensrate und die Gewichtszunahme waren im Vergleich zu Kontrolltieren nicht verndert. Es wurde nicht auf Mibildungen untersucht (Hardin et al. 1987). Bei C3H-Musen fhrte 1 mg Disulfiram mit dem Futter ab 3 Wochen vor der Trchtigkeit, 5 Tage/Woche und whrend der gesamten Trchtigkeit verabreicht (ca. 30 mg/kg KG und Tag), bei den 83 Feten weder zu Embryotoxizitt noch zu Mibil- dungen (Thompson und Folb 1985). Diese Dosis war somit ein NOEL fr Entwick- lungstoxizitt bei Musen. Die orale Gabe von 10 mg Disulfiram an 13 C3H-Muse (ca. 300 mg/kg KG und Tag) vom 1. bis zum 18. Tag der Trchtigkeit fhrte zu einem erhhten Auftreten v o n frhen Resorptionen (16/13 Wrfen; Kontrolle: 3/12 Wrfen). Es wurden k e i n e Fehlbildungen beobachtet, jedoch wurden nur 41 Feten auf viszerale und 25 auf skelettale Abweichungen untersucht. Bei 30 dieser Feten wurde auerdem das Herz gesondert untersucht, wobei sich keine Aufflligkeiten ergaben (Thompson und Folb 1985). Es fehlen Angaben zur maternalen Toxizitt, um auf die Ursache der Embryotoxizitt schlieen zu knnen. Whrend der Trchtigkeitstage 5-16 erhielten 14 C57/B6J-Muse Flssigfutter mit Ethanol (25% der Kalorien) und 15 Kontrolltiere Flssigfutter ohne Ethanol. Zwei weitere Gruppen von 33 oder 29 Musen erhielten Flssigfutter mit Ethanol bzw. Sucrose (25% der Kalorien) und zustzlich am 8., 9. oder 10. Trchtigkeitstag 300 mg Disulfiram/kg KG p.o. Am 18. Trchtigkeitstag wurden die Zahlen der Implantationen pro Wurf, der toten Feten und der Resorptionen erfat. Zwei Drittel der lebenden Feten wurden auf viszerale Mibildungen untersucht. Der Anteil an migebildeten lebenden Feten war in der Gruppe, die Ethanol und Disulfiram er-
-
hielt, verglichen mit den anderen Gruppen signifikant erhht (24,8 %) und beraddi- tiv im Vergleich zu den Gruppen, die nur Ethanol (7,1 %) oder Disulfiram (2,7%) erhielten (Angaben aus Zusammenfassung; Lambert et al. 1980). Damit ist Disulfi- ram alleine nicht reproduktionstoxisch, aber die Kombination von Ethanol und Disulfiram. In einer anderen Studie war bei einmaliger Gabe von 5 mg Disulfiram an jeweils 10 C57BL/6J-Muse 24 oder 2 Stunden vor einer i.p. Applikation von 2,9 g Ethanol/ kg KG am 7. oder 10. Trchtigkeitstag die Inzidenz von Feten mit Mibildungen des Kopfes im Vergleich zur alleinigen Gabe von Ethanol von 6 auf 13 % erhht. 320 mg Acetaldehyd/kg KG allein gegeben, verursachte ebenfalls Mibildungen, wie fr Ethanol beobachtet (Webster et al. 1983). Eine Vorbehandlung mit Disulfiram er- hht demnach die Rate der durch Ethanol verursachten Mibildungen.
8 Gruppen von je 3-9 Hamstern erhielten am 7. oder 8. Trchtigkeitstag orale Dosen von 63-1000 mg Disulfiram/kg KG in 10 ml Dimethylsulfoxid/kg KG. Mor- talitt bei den Muttertieren trat bei der Behandlung am 7. Tag ab 250 und bei der Behandlung am 8. Tag ab 500 mg/kg KG auf. Die fetale Mortalitt war in beiden Gruppen ab 125 mg/kg KG erhht. Fehlbildungen traten am 7. Tag bereits ab 63 mg/kg KG gehuft, aber nicht dosisabhngig auf. Das Lsungsmittel selbst er- wies sich als embryotoxisch und teratogen im Vergleich zu Carboxymethylcellulose oder zu unbehandelten Tieren. Wurden die Tiere in hnlicher Weise mit 125- 1000 mg Disulfiram in 10 ml Carboxymethylcellulose/kg KG behandelt, trat Morta- litt bei den Muttertieren ab 500 mg/kg KG auf. Die fetale Mortalitt war ab 500 mg/kg KG erhht, Fehlbildungen wurden aber nicht festgestellt (Robens 1969). Wegen der fehlenden Angaben zur Krpergewichtsentwicklung der Muttertiere, der fehlenden Dosisabhngigkeit und der geringen Tierzahl sind die Ergebnisse des Versuchs mit Dimethylsulfoxid als Lsungsmittel schwer zu bewerten. Da der ana- loge Versuch mit Carboxymethylcellulose zu keinen Effekten bei nicht maternaltoxi- schen Dosen fhrte, scheint Disulfiram eher die Wirkung von Dimethylsulfoxid zu verstrken als selbst entwicklungstoxisch zu sein. Bei den weiblichen Nachkommen von Meerschweinchen, die 125 mg Disulfiram/ kg KG tglich whrend der Trchtigkeitstage 19-21 oral erhielten, war das Gehirn- gewicht um ca. 4% reduziert und der Anteil der Feten mit Mikrozephalie (Gehirn- gewicht kleiner als Kontroll-Gehirngewicht minus zwei Standardabweichungen) von 0 auf 10 % (2/20) erhht. Das Krpergewicht war nicht signifikant um etwa 5% reduziert. Bei den mnnlichen Feten wies eines von 14 Tieren Mikrozephalie auf. Die analoge Behandlung vom Trchtigkeitstag 17-19 verursachte nur bei weiblichen Feten eine signifikante Verringerung des Krpergewichts um 11 % und eine signifi- kante Verminderung des Gehirngewichts um 3%, wobei bei einem der 17 Tiere Mikrozephalie festgestellt wurde. 37 mnnliche und weibliche Feten wurden unter- sucht. Fehlbildungen wurden nicht beobachtet. Nach unverffentlichten Ergeb- nissen der Autoren hatte auch die dermale Behandlung von Meerschweinchen mit Monosulfiram zur Entmilbung whrend 19 Trchtigkeitstagen zu Mikrozepha- lien gefhrt (Harding und Edwards 1993). Die nicht untersuchte Dosisabhngigkeit und fehlende Angaben zur Maternaltoxizitt erschweren die Interpretation der Ergebnisse. In einer In-vitro-Studie wurden 8 und 9 Tage alte Museembryonen mit 0,1; 10 und 100 Vg Disulfiram/ml Medium behandelt (Zeit n. a.). Ab 0,1 Vg/ml war die Entwick-
-
lung des ZNS gestrt. Ab 10 Vg/ml traten morphologische Schden am Herz und am Neuralrohr auf. Bei 100 Vg/ml war auerdem die DNA-Synthese verringert. Bei 9 Tage alten Embryonen traten diese Schdigungen erst ab 10 Vg/ml auf (Thompson und Folb 1985).
5 . 6 Genotoxizitt
5.6.1 In vitro
Disulfiram alkylierte Desoxyguanosin in vitro nicht (Hemminki et al. 1980). In menschlichen weien Blutzellen verursachte Disulfiram konzentrationsunabhn- gig bis 150 VM ca. 1500 DNA-Strangbrche pro Zelle, die mit dem Entwindungstest, (alkaline unwinding) nachgewiesen wurden. Mit Dimethylsulfoxid als Kontroll- substanz wurden weniger als 100 DNA-Strangbrche pro Zelle gemessen (Birnboim 1982). Im SCE-Test an CHO-Zellen wurden bei Zugabe eines metabolisierenden Systems bei Konzentrationen von 10-6, 5 10-6 und 10-5 M 8,99; 10,12 bzw. 11,62 SCEs pro Zelle induziert (Kontrolle 9,23). Ab 5 10-6 M war die Erhhung der SCE-Rate signifikant. Ohne metabolische Aktivierung konnte Disulfiram ab 5 10-6 M wegen Toxizitt nicht getestet werden (Donner et al. 1983). In einem Salmonella-Mutagenittstest an den Stmmen TA98, TA100, TA 1535 und TA1537 war Disulfiram in Konzentrationen von 1-100 Vg/Platte ohne metabolische Aktivierung bzw. von 10-1000 Vg/Platte mit metabolischer Aktivierung nicht muta- gen (Zeiger et al. 1987). ber schwach positive (Hedenstedt 1982; Rannug und Rannug 1984; Rannug et al. 1984) und negative (Hedenstedt et al. 1979; Moriya et al. 1978; k.w.A.) Ergebnisse im Salmonella-Mutagenittstest mit Disulfiram wurde berichtet. Die Dokumenta- tion und Interpretation der Tests lassen an der Validitt der Ergebnisse zweifeln, da z. B. bereits eine statistisch signifikante Erhhung der Revertantenzahl als positives Ergebnis bewertet wurde, obwohl der zweifache Wert der Spontanrevertantenzahl nicht erreicht wurde. In einem Thymidinkinase-Test an Mauslymphomzellen (L5178Y TK+/-) w a r Disulfiram mutagen. In jedem der fnf durchgefhrten Experimente, in denen k e i n exogenes Metabolisierungssystem eingesetzt wurde, traten statistisch signifikante Erhhungen der Mutationsfrequenz auf. Bereits bei einer Disulfiram-Konzentration von 0,016 Vg/ml (ca. 0,09 VM) wurde eine erhhte Mutagenitt beobachtet. Mit zunehmender Konzentration nahm die Mutagenitt ab. Bei ca. 0,5-2 Vg/ml wurde ein Minimum der Mutagenitt und der Zytotoxizitt gefunden. Die hchste ge- testete nicht letale Konzentration betrug 2 Vg/ml (ca. 29 VM). Eine Analyse der Grenverteilung der Mutantenkolonien, die einen Hinweis auf den der Mutageni- tt zugrundeliegenden Mechanismus htte liefern knnen, wurde nicht durch- gefhrt (McGregor et al. 1991). Auch Natriumdiethyldithiocarbamat wurde in die- ser Studie mit positivem Ergebnis getestet. Der Stoff fiel durch den ebenfalls biphasi- schen Verlauf der Dosis-Wirkungskurve auf. Bei kultivierten peripheren Lymphozyten von gesunden Probanden wurde die Inzi- denz von Chromosomenaberrationen durch Disulfiram in Konzentrationen von
-
0,01-2000 VM nicht erhht. Pro Konzentration wurden 200-400 Zellen untersucht. Die hchsten Konzentrationen waren zytotoxisch (Lilly 1975). ber einen positiven zytogenetischen Test an Sugerzellen im Rahmen des NTP- Programmes wurde berichtet (k.w.A.; Shelby und Stasiewicz 1984).
5.6.2 In vivo
Disulfiram induzierte in Dosen von 625, 1250 und 2500 mg/kg KG keine Mikro- kerne im Knochenmark von mnnlichen und weiblichen Musen. Die Untersuchung erfolgte 24 und 48 Stunden nach Gabe von Disulfiram. Unter gleichen Bedingungen verursachte das strukturanaloge Tetramethylthiuramdisulfid eine dosisabhngige
Erhhung der Mikrokern-Raten (k.w.A. in der Zusammenfassung; Mirkova und Mitrakova 1993). 2 Gruppen zu je 3 weiblichen Wistar-Ratten erhielten fr 5 Tage Disulfiram im Futter (ca. 350 bzw. 750 mg/kg KG), und einem weiteren Tier wurde einmalig 3300 mg Disulfiram/kg KG per Schlundsonde verabreicht. 24 Stunden nach der letzten Verabreichung wurden die Lymphozyten der Tiere kultiviert und nach weite- ren 48 Stunden jeweils 100-200 Zellen pro Tier untersucht. Es konnte gegenber der Negativkontrollgruppe keine erhhte Frequenz von Chromosomenaberrationen be- obachtet werden. Die Positivkontrolle Aflatoxin erbrachte einen eindeutigen An- stieg der Chromosomenaberrationen, so da der Versuch trotz der Mngel bewert- bar erscheint (Cobon et al. 1982). Disulfiram war in Dosen von 0,1; 0,25 und 0,5 mg/kg KG nicht klastogen bei Ham- stern. Es wurden jeweils 1-2 mnnliche und 2-3 weibliche Tiere getestet und die Erythrozyten nach 30 Stunden untersucht (Donner et al. 1983). Von den Autoren wurde angefhrt, da das verringerte Verhltnis von polychromatischen zu normo- chromatischen Zellen Hinweis auf die Zytotoxizitt des Stoffs ist. In der hchsten Dosierung war das Verhltnis jedoch nicht von dem der Kontrolle verschieden. Wegen der geringen Dosierung (mglicherweise Druckfehler, da fr Tetramethyl- thiuramdisulfid eine 1000fach hhere Konzentration angegeben wurde), der fehlen- den Positivkontrolle und der geringen Tierzahl ist der Versuch nicht geeignet, ein klastogenes Potential von Disulfiram auszuschlieen.
Konzentrationen von 3,7-12,3 mg Disulfiram/ml erhhten den Anteil an SLRL- Mutanten an D. melanogaster nicht (Donner et al. 1983). Genaue Angaben zur Letalitt bei den adulten Tieren erfolgten nicht, eine Positivkontrolle fehlte. Damit ist der Versuch nicht bewertbar.
5.7 Kanzerogenitt
An BALB/c-3T3-Zellen erwies sich Disulfiram, das in zwei unabhngigen Experi- menten in Konzentrationen von 0,02-0,2 VM getestet wurde, jeweils als zelltransfor- mierend (Matthews et al. 1993). In einer Kanzerogenittsstudie an je 18 mnnlichen und weiblichen B6C3F1- und BAKF1-Musen traten bei einmaliger s.c. Applikation von 1000 mg Disulfiram/ kg KG am 28. Lebenstag nach 78 Wochen bei 3 der weiblichen BAKF1-Muse
-
Retikulumzellsarkome auf (17%; Kontrolle: 5/157, 3%). Bei einer mnnlichen B6C3F1-Maus trat ein subkutanes Fibrosarkom auf. Die Hufigkeit anderer Tumo- ren lag im Bereich der Kontrolltiere. In einem weiteren Versuch mit gleicher Tierzahl an den selben Stmmen wurde vom 7. bis zum 28. Lebenstag 100 mg Disulfiram/ kg KG intragastral gegeben und anschlieend 74 Wochen lang Futter mit 323 mg Disulfiram/kg (ca. 35 mg/kg KG) verabreicht. Die Konzentration im Futter wurde
d e r Krpergewichtsentwicklung nicht angepat. In der Gruppe der mnnlichen BAKF1-Muse traten 10 subkutane Fibrosarkome (63%; Kontrolle 0/90) und 8 Hepatome (47%; Kontrolle oral 5/90, 6%; Kontrolle oral und s.c. 6/251, 2%) auf. 5 mnnliche B6C3F1-Muse hatten ein Lungenadenom (28 %; Kontrolle 5/79, 6 %; Kontrolle oral und s.c. 15/220, 7%). Die Hufigkeit weiterer Tumoren lag im Be- reich der Kontrolltiere (NCI 1968). Die Ursache der subkutanen Fibrosarkome i s t ungeklrt. Bei keinem der in der Studie getesteten weiteren 130 Pestizide und a u c h der positiven Kontrollstoffe war die Hufigkeit dieser Tumoren grer als 1/18. Angesichts der Stammes- und Geschlechtsspezifitt der Tumoren und der aus heuti- ger Sicht unzureichend kontrollierten Studienbedingungen ist eine Substanzwirkung unklar. Lungenadenome und Hepatome treten bei den verwendeten Musestmmen relativ hufig auf. Das ebenfalls getestete Natriumdiethyldithiocarbamat verursach- te keine subkutanen Fibrosarkome, aber erhhte Raten an Lungenadenomen und Hepatomen. In einer 2-Jahres-Studie an je 50 mnnlichen und weiblichen F344-Ratten sowie B6C3F1-Musen wurde nach Verabreichung von Futter, das Disulfiram enthielt, keine erhhte Inzidenz von Tumoren gefunden. Die Konzentrationen im Futter betrugen fr mnnliche und weibliche Ratten 300 und 600 mg/kg, fr mnnliche Muse 500 und 2000 mg/kg und fr weibliche Muse 100 und 500 mg/kg. Das entspricht etwa Dosen von 30-200 mg/kg KG. Die Krpergewichte der Tiere waren dosisabhngig vermindert, die Mortalitt war in den Behandlungsgruppen nicht erhht (NCI 1979 a). In einer 2-Jahres-Studie wurde an mnnlichen und weiblichen SD-Ratten bei einer Disulfiram-Konzentration von 0,05 % im Futter kein erhhtes Auftreten von Tumo- ren beobachtet. Von den Autoren wurde die tgliche aufgenommene Menge Disulfi- ram zu 10 mg/kg KG angegeben. Die Tiere waren in ihrer Krpergewichtsentwick- lung gehemmt. Die zustzliche, nicht aber die alleinige Exposition gegenber 50 m l Ethylenchlorid/m3 fhrte dagegen zu Cholangiomen, subkutanen Fibromen, M a m - maadenokarzinomen und Hodentumoren (Cheever et al. 1990).
Kombinationswirkung
Disulfiram verringert die kanzerogene Wirkung mehrerer Stoffe im Tierversuch, kann aber auch deren Wirkung verstrken (Gessner und Gessner 1992; vgl. Ab- schnitt 2).
5.8 Sonstige Wirkungen
Disulfiram bzw. seine Metaboliten induzieren CYP450 2B1 und 2A1 (Johansson 1992).
-
Disulfiram vermindert die DNA-Synthese in Hhner-Embryo-Zellen bei Konzen- trationen bis 0,32 VM und hemmt die Aktivitt der RNA-abhngigen DNA-Poly- merase des Rous-Sarkom-Virus (Levinson et al. 1978). Disulfiram wird bei 37C, pH-Wert 3-3,5 nach einer Stunde zu 21% von einem 3fachen molaren berschu NaNO2 nitrosiert. Das Nitrosierungsprodukt rief keine DNA-Fragmentierung an CHO-Zellen hervor (Brambilla et al. 1985).
6 Bewertung
In einer Studie des NCI (1968) traten nach oraler Gabe von Disulfiram bei Musen nicht interpretierbare subkutane Fibrosarkome sowie die auch spontan relativ hufi- gen Lungenadenome und Hepatome in erhhter Inzidenz auf. Lungenadenome und Hepatome wurden auch durch Natriumdiethyldithiocarbamat hervorgerufen. Da- gegen wurden in zwei moderneren Studien an Ratten und Musen mit Dosierungen, die die Krpergewichtsentwicklung hemmten, und mit umfangreicher histopatholo- gischer Untersuchung, keine erhhten Tumorinzidenzen gefunden. Auch mit Na- triumdiethyldithiocarbamat wurde in einer neueren Langzeitstudie keine kanzero- gene Wirkung an Ratten und Musen beobachtet (NCI 1979 b). Ein genotoxisches Potential von Disulfiram in vitro, mglicherweise als indirekter Effekt ber die Hemmung der Superoxiddismutase ist, wie fr Natriumdiethyldithiocarbamat, nicht auszuschlieen. Eine DNA-alkylierende Wirkung war jedoch in einem In- vitro-Versuch nicht nachweisbar. In vivo liegen keine Hinweise auf eine mutagene oder klastogene Wirkung vor. Bisher wurden keine Beobachtungen ber erhhte Tumorraten an den mit Disulfiram behandelten Patienten verffentlicht. Ein kanze- rogenes Potential fr den Menschen scheint daher insgesamt wenig wahrscheinlich. Der kritische Effekt von Disulfiram ist die Alkoholunvertrglichkeitsreaktion, die bei empfindlichen Personen bei wiederholter Einnahme von 100 mg/Person noch nachweisbar war. Von der berwiegenden Mehrzahl der Probanden wurden die Symptome als nicht so beeintrchtigend empfunden, da sie eine weitere Alkohlein- nahme verweigert htten. Aus Studien zur Bioverfgbarkeit und Toxikokinetik wur- de abgeleitet, da bei oraler Aufnahme eine teilweise Zersetzung von Disulfiram bereits im Magen stattfindet. Da jedoch auch bei inhalativer Exposition ein staub- frmiger Stoff nicht vollstndig ber die Lunge resorbiert wird, ist beim bisherigen MAK-Wert von 2 mg/m3 (tgliche Aufnahme 20 mg) eine Alkoholunvertrglich- keitsreaktion nicht zu erwarten. Es liegen einige Fallberichte vor, nach denen Patientinnen unter Disulfiram-Thera- pie, die whrend der Schwangerschaft angeblich abstinent blieben, migebildete Kinder gebaren. Wegen der Schwierigkeit, eine Alkoholeinnahme sicher auszuschlie- Ben, der gleichzeitigen Medikation mit Neuroleptika und des ungnstigen Verlaufs frherer Schwangerschaften kann aus den wenigen vorliegenden Fallberichten keine teratogene Wirkung bei alleiniger Anwendung von Disulfiram beim Menschen abge- leitet werden. Die tierexperimentellen Daten deuten auf ein gewisses embryotoxi- sches und fetotoxisches Potential bei nicht berichteter Maternaltoxizitt hin. So- lange adquat durchgefhrte und berichtete Untersuchungen nur von einer Spezies (Maus) vorliegen, kann das reproduktionstoxische Potential des Stoffes nicht ausrei- chend bewertet werden. Disulfiram wird deshalb in Schwangerschaftsgruppe D ge-
-
fhrt. Wegen der im Vergleich zum MAK-Wert (0,4 mg/kg KG) hohen Dosen (ab 125 mg/kg KG), bei denen reproduktionstoxische Effekte im Tierversuch auftraten, und des in einer Studie an Musen festgestellten NOELs von 30 mg/kg KG, lt sich eine Tendenz zur Einstufung in Gruppe C ableiten. Wegen der in mehreren Feldstudien nachgewiesenen hohen Sensibilisierungsfre- quenz nach epikutaner Testung und den Kreuzreaktionen zu anderen Thiuramen
w i r d Disulfiram mit "Sh" markiert. Zur Hautgngigkeit liegen keine validen Studien vor. Daher wird der Stoff vorerst nicht mit H markiert.
7 Literatur
Andersen MP (1992) Lack of bioequivalence between disulfiram formulations. Exemplified by a tablet/effervescent tablet study. Acta Psychiatr Scand 86, Suppl: 31-35
Ansbacher LE, Bosch EP, Cancilla PA (1982) Disulfiram neuropathy: a neurofilamentous distal axonopathy. Neurology 32: 424-428
Anzil AP (1980) Selected aspects of experimental disulfiram neuromyopathy. In: Manzo L, Lery N, Lacasse Y, Roche L (Hrsg) Advances in neurotoxicology, Pergamon Press, Oxford, 359-366
Anzil AP (1985) Morphological assessment of neurotoxicity: disulfiram neuropathy as an animal model of human toxic axonopathies. In: Blum K, Manzo L (Hrsg) Neurotoxicology, Marcel Dekker, New York, 535-538
Barth R, Resnick RH, Smoller B (1987) Disulfiram and fulminant hepatitis. Dig Dis Sci 32: 1059
Bartsch H, Malaveille C, Barbin A, Planche G (1979) Mutagenic and alkylating metabolites of halo-ethylenes, chlorobutadienes and dichlorobutenes produced by rodent or human liver tissues. Arch Toxicol 41: 249-277
Bergouignan FX, Vital C, Henry P, Eschapasse P (1988) Disulfiram neuropathy. J Neurol 235: 382
Besses GS, Burrow GN, Spaulding SW, Donabedian RK (1975) Dopamine infusion acutely inhibits the TSH and prolactin response to TRH. J Clin Endocrinol Metab 41: 985-988
Beyeler C, Fisch HU, Preisig (1987) Kardiovaskulre und metabolische Vernderungen whrend der Antabus-Alkohol-Reaktion: Grundlagen zur Erfassung des Schweregrades. Schweiz Med Wochenschr 117: 52-60
Bilbao JM, Briggs SJ, Gray TA (1984) Filamentous axonopathy in disulfiram neuropathy. Ultrastruct Pathol 7: 2 9 5 - 3 0 0
Birnboim HC (1982) Factors wich affect DNA strand breakage in human leukocytes exposed to a tumor promoter, phorbol myristate acetate. Can J Physiol Pharmacol 60: 1359-1366
Bouldin TW, Hall CD, Krigman MR (1980) Pathology of disulfiram neuropathy. Neuropathol Appl Neurobiol 6: 155-160
Brambilla G, Cajelli E, Finollo R, Maura A, Pino A, Robbiano L (1985) Formation of DNA- damaging nitroso compounds by interaction of drugs with nitrite. A preliminary screening for detecting potentially hazardous drugs. J Toxicol Environ Health 15: 1-24
Brady JF, Xiao F, Wang MH, Ning SM, Gapac JM, Yang CS (1991) Effects of disulfiram on hepatic P450IIE1, other microsomal enzymes, and hepatotoxicity in rats. Toxicol Appl Phar- macol 108: 366-373
Brugnone F, Marinelli G, Zotti S, Zanella I, De Paris P, Caroldi S, Betta A (1992) Blood concentration of carbon disulphide in normal subjects and in alcoholic subjects treated with disulfiram. Br J Ind Med 49: 658-663
Buris L, Varga M (1992) Change of alcohol dehydrogenase activity in sera after alcoholism treatment. Eur J Clin Chem Clin Biochem 30: 203-204
-
Cavalleri A, Polatti F, Bolis PF (1978) Acute effects of tetraethylthiuram disulfide on serum levels of hypophyseal hormones in humans. Scand J Work Environ Health 4: 66-72
Cheever KL, Cholakis JM, el Hawari AM, Kovatch RM, Weisburger EK (1990) Ethylene dichloride: the influence of disulfiram or ethanol on oncogenicity, metabolism, and DNA covalent binding in rats. Fundam Appl Toxicol 14: 243-261
Chengelis CP, Neal RA (1979) Hepatic carbonyl sulfide metabolism. Biochem Biophys Res Commun 90: 993-999
Chick J, Gough K, Falkowski W, Kershaw P, Hore B, Mehta B, Ritson B, Ropner R, Torley D (1992) Disulfiram treatment of alcoholism. Br J Psychiatry 161: 84-89
Christensen JK (1973) Bivirninger efter disulfiram. Ugeskr Laeg 135: 1457-1459 Christensen JK, Moller IW, Ronsted P, Angelo HR, Johansson B (1991) Dose-effect relation-
ship of disulfiram in human volunteers. I. Clinical studies. Pharmacol Toxicol 68: 163-165 Christensen JK, Ronsted P, Vaag UH (1984) Side effects of disulfiram. Acta Psychiatr Scand
69: 265-73 Cobon AM, Hunt JM, Lilly LJ (1982) The use of an in vivo rat lymphocyte technique to test
for the non-clastogenicity of disulfiram. Methods Find Exp Clin Pharmacol 4: 559-562 Cobby J, Mayersohn M, Seliah S (1978) Disposition kinetics in dogs of diethyldithiocarbamate,
a metabolite of disulfiram. J Pharmacokinet Biopharm 6: 369-387 Cond-Salazar L, Guimaraens D, Villegas C, Romero A, Gonzales MA (1995) Occupational
allergic contact dermatitis in construction workers. Contact Dermatitis 33: 226-230 de Mari M, De Blasi R, Lamberti P, Carella A, Ferrari E (1993) Unilateral pallidal lesion after
acute disulfiram intoxication: a clinical and magnetic resonance study. Mov Disord 8: 247-249
Deamer NJ, Genter MB (1995) Olfactory toxicity of diethyldithiocarbamate (DDTC) and disulfiram and the protective effect of DDTC against olfactory toxicity of dichlobenil. Chem Biol Interact 95: 215-226
Dehaene P, Titran M, Dubois D (1984) Syndrome de Pierre Robin et malformations cardiaques chez un nouveau-n. Rle du disulfirame pendant la grossesse? Presse Med 13: 1394-1395
Donner M, Husgafvel-Pursiainen K, Jenssen D, Rannug A (1983) Mutagenicity of rubber additives and curing fumes. Scand J Work Environ Health 9, Suppl 2: 27-37
DuPont (1973) Maternal toxicity, embryotoxicity and teratogenic potential of neoprene accel- erators applied to skin of rats during organogenesis, Haskell Laboratory, Report No. 344-73. OTS0514980, NTIS Doc ID 86-870001077, NTIS, Springfield, VA
Eldjarn L (1950 a) The metabolism of tetraethyl thiuramdisulphide (Antabus, Aversan) in rat, investigated by means of radioactive sulphur. Scand J Clin Lab Invest 2: 198-201
Eldjarn L (1950 b) The metabolism of tetraethyl thiuramdisulphide (Antabus, Aversan) in man, investigated by means of radioactive sulphur. Scand J Clin Lab Invest 2: 202-208
Enghusen-Poulsen H, Loft S, Andersen JR, Andersen M (1992) Disulfiram therapy - adverse drug reactions and interactions. Acta Psychiatr Scand 369, Suppl: 59-65
Faiman MD, Dodd DE, Nolan RJ, Artman L, Hanzlik RE (1977) A rapid and simple method for the determination of disulfiram and its metabolites from a single sample of biological fluid or tissue. Res Commun Chem Pathol Pharmacol 17: 481-496
Faiman MD, Artman L, Haja K (1980) Disulfiram distribution and elimination in the rat after oral and intraperitoneal administration. Alcoholism Clin Exp Res 4: 412-419
Faiman MD, Artman L, Maziasz T (1983) Diethyldithiocarbamic acid methyl ester distribu- tion, elimination, and LD50 in the rat after intraperitoneal administration. Alcoholism Clin Exp Res 7: 307-311
Faiman MD, Jensen JC, Lacoursiere RB (1984) Elimination kinetics of disulfiram in alcoholics after single and repeated doses. Clin Pharmacol Ther 36: 520-526
Favre-Tissot M, Delatour P (1965) Psychopharmacologie et teratogenese - a propos du disul- firam: essai experimental. Ann Med Psychol 123: 735-740
Fitzhugh OG, Winter WJ, Nelson AA (1952) Some observations on the chronic toxicity of Antabuse (tetraethylthiuramdisulfide). Fed Proc 11: 345-346
Freundt KJ, Lieberwirth K, Netz H, Phlmann E (1976) Blood acetaldehyde in alcoholized rats and humans during inhalation of carbon disulphide vapor. Int Arch Occup Environ Health 37: 35-46
-
Frisoni GB, Di Monda V (1989) Disulfiram neuropathy: a review (1971-1988) and report of a case. Alcohol Alcoholism 24: 429-437
Gardner RJM, Clarkson JE (1981) A malformed child whose previously alcoholic mother had taken disulfiram. N Z Med J 93: 184-186
Geffray L, Dao T, Cevallos R, Veyssier P (1995) Nevrite optique retrobulbaire due au disulfi- rame (Espral): une observation. Rev Med Intern 16: 973
Geier J, Gefeller O (1995) Sensitivity of patch tests with the rubber mixes: results of the information network of departments of dermatology from 1990 to 1993. Am J Contact Dermatitis 6: 143-149
Gessner K, Gessner T (1992) Disulfiram and its metabolite, diethyldithiocarbamate, Chap- man Hall, London
Gessner T, Jakubowski M (1972) Diethyldithiocarbamic acid methyl ester - a metabolite of disulfiram. Biochem Pharmacol 21: 219-230
Gleerup G, Bostrm S, Hansson G, Teger-Nilsson A-C, Sjquist P-O, Winther K (1990) Effect of disulfiram on the platelet function and fibronolysis in healthy volunteers. Haemostasis 2 0 . 215-218
Goyer PF, Major LF (1979) Hepatotoxicity in disuifiram-treated patients. J Stud Alcohol 40: 133-137
Goyer PF, Brown GL, Minichiello MD, Major LF (1984) Mood altering effects of disulfiram in alcoholics. J Stud Alcohol 45: 209-213
Graham DG, Amarnath V, Valentine WM, Pyle SJ, Anthony DC (1995) Pathogenetic studies of hexane and carbon disulfide neurotoxicity. Crit Rev Toxicol 25: 91-12
Haddock NF, Wilkin JK (1982) Cutaneous reactions to lower aliphatic alcohols before and during disulfiram. therapy. Arch Dermatol 118: 157-159
Hardin BD, Schuler RL, Burg JR, Booth GM, Hazelden KP, MacKenzie KM, Piccirillo VJ, Smith KN (1987) Evaluation of 60 chemicals in a preliminary developmental toxicity test. Teratogen Carcinogen Mutagen 7: 29-48
Harding AJ, Edwards MJ (1993) Retardation of prenatal brain growth of guinea pigs by disulfiram. Congenital Anomalies 33: 197-202
Hart BW, Faiman MD (1992) In vitro and in vivo inhibition of rat liver aldehyde dehydrogenase by S-methyl N,N-diethylthiolcarbamate sulfoxide, a new metabolite of disulfiram. Biochem Pharmacol 43: 403-406
Hart BW, Faiman MD (1993) Bioactivation of S-methyl N,N-diethylthiolcarbamate to S- methyl N,N-diethylthiolcarbamate sulfoxide. Biochem Pharmacol 46: 2285-2290
Hawley RJ, Kurtzke JF, Armbrustmacher VW, Saini N, Manz H (1982) The course of alcoholic nutritional peripheral neuropathy. Acta Neurol Scand 66: 582-589
Hedenstedt A, Rannug U, Ramel C, Wachtmeister CA (1979) Mutagenicity and metabolism studies on 12 thiuram and dithiocarbamate compounds used as accelerators in the Swedish rubber industry. Mutat Res 68: 313-325
Hedenstedt A (1982) Mutagenicity of disulfiram and ethoxyquin. Mutat Res 97: 191 Helmbrecht GD, Hoskins IA (1993) First trimester disulfiram exposure: report of two cases.
Am J Perinatol 10: 5-7 Hemminki K, Falck K, Vainio H (1980) Comparison of alkylation rates and mutagenicity of
directly acting industrial and laboratory chemicals. Arch Toxicol 46: 277-285 Hillbom M, Wennberg A (1984) Prognosis of peripheral neuropathy. J Neurol Psychiatry 47:
699-703 von Hintzenstern J, Heese A, Koch HU, Peters K-P, Hornstein OP (1991) Frequency, spectrum
and occupational relevance of type IV allergies to rubber chemicals. Contact Dermatitis 24: 244-252
Hirschberg M, Ludolph A, Grotemeyer KH, Gullotta F (1987) Development of a subacute tetraparesis after disulfiram intoxication. Eur Neurol 26: 222-228
Holck HGO, Lish PM, Sjogren DW, Westerfeld WW, Malone MH (1970) Effects of disulfiram on growth, longevity, and reproduction of the albino rat. J Pharm Sci 59: 1267-1270
Hopfer SM, Linden JV, Rezuke WN, OBrien JE, Smith L,Waters F, Sunderman FW Jr (1987) Increased nickel concentrations in body fluids of patients with chronic alcoholism during disulfiram therapy Res Commun Chem Pathol Pharmacol 55: 101-109
-
Iber FL, Dutta S, Shamszad M, Krause S (1977) Excretion of radioactivity following the administration of 35sulfur-labeled disulfiram in man. Alcoholism Clin Exp Res 1: 359-364
Jensen JC (1984) Pharmacokinetics and pharmacodynamics of the disulfiram-ethanol reaction, Dissertation, University of Kansas, zit. in: Gessner und Gessner (1992)
Jin L, Davis MR, Hu P, Baillie TA (1994) Identification of novel glutathione conjugates of disulfiram and diethyldithiocarbamate in rat bile by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Evidence for metabolic activation of disulfiram in vitro. Chem Res Toxicol 7:
526-533 Johansson B (1986) Rapid and sensitive on-line precolumn purification and high-performance
liquid chromatographic assay for disulfiram and its metabolites. J Chromatogr 378: 419-429 Johansson B (1989) Carbonyl sulfide: copper chelating metabolite of disulfiram. Drug Metab
Dispos 17: 351-353 Johansson B (1992) A review of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of disulfiram
and its metabolites. Acta Psychiat Scand 86: 15-26 Johansson B, Stankiewicz Z (1985) Bis-(diethyldithiocarbamato) copper complex: a new
metabolite of disulfiram? Biochem Pharmacol 34: 2989-2991 Johansson B, Stankiewicz Z (1989) Inhibition of erythrocyte aldehyde dehydrogenase activity
and elimination kinetics of diethyldithiocarbamic acid methyl ester and its monothio ana- logue after administration of single and repeated doses of disulfiram to man. Eur J Clin Pharmacol 37: 133-138
Johansson B, Petersen EN, Arnold E (1989) Diethylthiocarbamic acid methyl ester: a potent inhibitor of aldehyde dehydrogenase found in rats treated with disulfiram or diethyldithio- carbamic acid methyl ester. Biochem Pharmacol 38: 1053-1059
Johansson B, Angelo HR, Christensen JK, Moller IW, Ronsted P (1991) Dose-effect relation- ship of disulfiram in human volunteers. II. A study of the relation between the disulfiram- ethanol reaction and plasma concentrations of acetaldehyde, diethyldithiocarbamic acid methyl ester, and erythrocyte aldehyde dehydrogenase activity. Pharmacol Toxicol 68: 166- 170
Jones KL, Chambers CC, Johnson KA (1991) The effect of disulfiram on the unborn baby. Teratology 43: 438
Jones KL, Johnson KA, Chambers CC, Cooper J (1990) The effect of disulfiram on the unborn baby: implications relative to the mechanism of alcohol teratogenesis. Proc Greenwood Genet Center 9: 70
Kim DH, Guengerich FP (1990) Formation of the DNA adduct S-[2-(N7-guanyl)ethyl]- glutathione from ethylene dibromide: effects of modulation of glutathione and glutathione S-transferase levels and lack of role for sulfation. Carcinogenesis 11: 419-424
Klugkist H, Preu S (1992) Disulfiram-Neuropathie. Dtsch Med Wochenschr 117: 1278-1282 Krauss JK, Mohadjer M, Wakhloo AK, Mundinger F (1990) Dystonia and akinesia due to
pallidoputaminal lesions after disulfiram intoxication. Mov Disord 6: 166-170 Lake CR, Major LF, Ziegler MG, Kopin IJ (1977) Increased sympathetic nervous system
activity in alcoholic patients treated with disulfiram. Am J Psychiatry 134: 1411-1414 Lake CR, Ziegler MG, Major FL, Brown GI, Ebert MH (1980) The effects of disulfiram. on
peripheral and central norepinephrine metabolism and blood pressure. In: Fann WE, Kara- can I, Pokorny AC, Williams RI (Hrsg) Phenomenology and treatment of alcoholism, Spec- trum, New York, 229-240
Lambert GH, Papp LA, Nishiura B (1980) Disulfiram (D) and the fetal alcohol syndrom (FAS). Pediatr Res 14: 586
Larbre B, Larbre JP, Nicolas JF, Fauvet N, Faure M, Thivolet J (1990) Toxidermie pustuleuse au disulfirame. Ann Dermatol Venereol 117: 721-722
Levinson W, Mikelens P, Oppermann H, Jackson J (1978) Effect of antabuse (disulfram) on Rous sarcoma virus and on eukaryotic cells. Biochim Biophys Acta 519: 65-75
Linderholm H, Berg K (1951) A method for the determination of tetraethylthiuram disulphide (Antabus, Abstinyl) and diethyldithiocarbamate in blood and urine: some studies on the metabolism of tetraethylthiuram disulphide. Scand J Clin Lab Invest 3: 96-102
Lilly LJ (1975) Investigations in vitro and in vivo, of the effects of disulfiram (Antabus) on human lymphocyte chromosomes. Toxicology 4: 331-340
-
Major LF, Goyer PF (1978) Eff