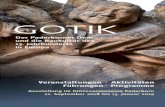„Ein Schulmeister muss singen können“ — Die drei Säulen der Paderborner DISCO
Transcript of „Ein Schulmeister muss singen können“ — Die drei Säulen der Paderborner DISCO

1 Einleitung
Hat Martin Luther mit seinem Satz „EinSchulmeister muss singen k�nnen“ (Luther,Tischreden von Musik 1.) schon die maß-gebliche Qualit�t von Multimedia in derLehre charakterisiert? – Sicher nicht. Mul-timedia muss weder bunt noch laut sein.Erfolgreiche Ans�tze kommen vielleichtsogar eher leise und unauff�llig daher,n�tzlich und nachhaltig, lediglich das bie-tend, was in der jeweiligen Situation ge-braucht wird, und nicht das ausreizend,was medientechnisch machbar scheint.Auch in der Außendarstellung gilt es Be-scheidenheit zu �ben.Wer medienwirksamdie Virtualisierung der Universit�ten ver-k�ndet, ohne zuvor erfahren zu haben, wieman lernf�rderliche Infrastrukturen all-tagstauglich gestalten kann, der l�uft Ge-fahr, nicht nur F�rdergelder zu verschwen-den, sondern sich auch noch der Chancezu berauben, im Zuge einer evolution�renEntwicklungsstrategie wichtige Lernpro-zesse zu durchlaufen [siehe hierzu Keil99].Schließlich ist bez�glich der grunds�tzli-chen Anspr�che und Erwartungen an denMultimediaeinsatz Zur�ckhaltung ange-bracht. Mit Technik lassen sich eben nurtechnische Probleme l�sen. Didaktischeund p�dagogische Probleme werden auchweiterhin didaktische bzw. p�dagogischeL�sungen erfordern. Allerdings stellt sichnun die Frage, worin denn die technischenProbleme des Lehrens und Lernens beste-hen und wie diese situationsgerecht umge-setzt werden k�nnen.
Im nachfolgenden Abschnitt stellen wirdeshalb zun�chst die erste S�ule des Me-dieneinsatzes vor: Das Konzept der Me-dienfunktionen und ihre Umsetzungdurch den Aufbau einer lernf�rderlichenInfrastruktur DISCO (digitale Infrastruk-tur f�r computerunterst�tztes kooperati-ves Lernen). DISCO umfasst den AufbauvonWWW-basierten Serverstrukturen, dieVerkn�pfung aller Lern- und Arbeitsorte�ber eine durchgehende Netzinfrastrukturund die geeignete Ausstattung von Lehr-r�umen. Die Integration dieser drei Berei-che sorgt daf�r, dass Lehrende und Ler-nende die ben�tigten multimedialen Mate-rialien an allen Orten abrufen und bearbei-ten k�nnen, wo Lernen stattfindet.
Die DISCO als Steinbruch des Lernenserweist sich als unerl�ssliche Vorausset-zung zur Entwicklung und Nutzung mul-timedialer Bausteine, der zweiten S�ule des
Medieneinsatzes, die wir im dritten Ab-schnitt vorstellen. Hierzu rechnen wirkleine mediale Darstellungen wie Anima-tionen ebenso wie aufwendig erstellteKonstruktionsumgebungen. Zun�chstk�nnen bereits vorhandene umfangreicheText- und Beispielsammlungen aufgebautund selektiv erschlossen werden. Des Wei-teren ist es z. B. m�glich, Audio-Annota-tionen, die den Vortragstext bezogen aufdie jeweiligen Vorlesungsfolien enthalten,aufzuzeichnen und objektbezogen zu-g�nglich zu machen. Diese Aufzeich-nungs- und Pr�sentationsmedien werdenerg�nzt durch hochgradig interaktiveLernbausteine – sogenannte Explorationen–, mit denen nicht nur vordefinierte Ab-l�ufe veranschaulicht, sondern virtuelletechnische Strukturen durch eigene Kons-truktionsarbeiten aufgebaut, animiert undberechnet werden k�nnen.
Der erfolgreiche Ausbau der ersten bei-den S�ulen in den zur�ckliegenden Jahrenhat Lehrenden und Lernenden nicht nurneue Potenziale er�ffnet, sondern auchneue Probleme und einen teilweise vergr�-ßerten Aufwand f�r Nutzung und Pflegehervorgebracht. Da die Medienfunktionenvorrangig unter dem Blickwinkel der Er-zeugung und Erschließung von Materia-lien umgesetzt worden sind, unterst�tzen
sie zun�chst das kooperative Lernen eben-so unzureichend wie das kooperative Er-stellen und Pflegen eines gr�ßeren Doku-mentenbestandes. Bildungs- und Lernser-ver m�ssen deshalb durch eine dritte S�uleerg�nzt werden, die wir als kooperativeWissensorganisation bezeichnen und imvierten Abschnitt skizzieren. Hier geht essowohl um die technische Unterst�tzungder Erstellung und Nutzung verteiltermultimedialer Materialien als auch um diekooperative lernerzentrierte Strukturie-rung von Informationsbest�nden.
Da erfolgreiches Studieren in einer Uni-versit�t nicht monokausal auf den Einsatzeiner bestimmten Technik zur�ckgef�hrtwerden kann, ist es auch wenig sinnvoll,einzelnen medientechnischen Konzeptenoder Ans�tzen die Eigenschaft zuzuschrei-ben, dass sie das Lernen verbessern w�r-
Dipl.-Inform. ThorstenHampel,Prof. Dr.-Ing. Reinhard Keil-Slawik,Dipl.-Ing. Olaf Nowaczyk, Dipl.-Math.Harald Selke, Heinz Nixdorf Institut,Universit�t Paderborn, F�rstenallee 11,D-33102 Paderborn, E-Mail:{hampel|rks|nowaczyk|hase}@uni-paderborn.de
„Ein Schulmeister musss ingen k�nnen“ –Die drei S�ulen
der Paderborner DISCO
Thorsten Hampel , Reinhard Keil-Slawik,Olaf Nowaczyk, Harald Selke
WI – Schwerpunktaufsatz
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 43 (2001) 1, S. 69–76 69

den. Dies h�ngt letztlich allein von der ArtundWeise ab, wie sie in das soziale, organi-satorische und curriculare Umfeld einge-bettet werden. Lernf�rderliche Infrastruk-turen sind nicht nur Mittel zum Lernen,sondern selbst auch Lerngegenstand. Siegestatten es herauszufinden, welches Lern-arrangement sich unter welchen Einbet-tungsbedingungen als besonders brauch-bar erweist und liefern Anregungen f�r dieweitere Entwicklung und Ausgestaltungmultimedialer Lernarrangements. Auf ab-sehbare Zeit wird dieser Lernprozess je-denfalls nicht abgeschlossen sein; Diffe-renzierung und Innovation bleiben weiter-hin entscheidende Voraussetzungen f�rden Aufbau verbesserter Lernarrange-ments. Insofern lautet das Fazit des f�nftenund letzten Abschnittes auch, dass es inder Tat nicht darauf ankommt, ob derSchulmeister singen kann, sondern ob er inder Lage ist, situationsangemessen unter-schiedliche Instrumente und Spieler zu ei-nemOrchester zu verschmelzen.
2 Lernf�rderlicheInfrastrukturen
Ausgehend von theoretischen �berlegun-gen, nach denen geistige Prozesse gr�ßten-teils mit gegenst�ndlichem Handeln ver-kn�pft sind und dass Verstehen letztlichimmer nur vor dem Hintergrund sozialerBeziehungen m�glich ist [vgl. Engb95],versuchen wir, die Rolle von Technik zurUnterst�tzung von Lehr- und Lernprozes-sen durch das Konzept der Medienfunk-tionen zu fassen [KeSe98]. Prim�re Me-dienfunktionen dienen dazu, Zeichen zuerzeugen, zu bearbeiten und abzulegen.Neuen Medien kommt dabei die Rolle zu,den Aufwand f�r die Erschließung, Ver-kn�pfung und Speicherung der f�r dieLernprozesse ben�tigten Artefakte (alsobeispielsweise der Unterlagen zu einerLehrveranstaltung inklusive eigener Noti-zen) zu reduzieren. Eine effizientere Um-setzung der prim�ren Medienfunktionenhat daher in erster Linie eine Rationalisie-rung desMediengebrauchs zur Folge.
Da Wissen und Bedeutung erst in derWechselwirkung zwischen Lehrenden,Lernenden undMaterialien entstehen, sindnat�rlich die Gestaltung des Lehr- undLernprozesses sowie dessen Einbettung ineinen geeigneten Kontext notwendig. Der-
artiges Wissen �ber die Gestaltung desLehrmaterials, die Umsetzung eines didak-tischen Modells und die Gestaltung vonKooperationsstrukturen werden durch diesekund�ren Medienfunktionen unter-st�tzt. Terti�re Medienfunktionen schließ-lich versuchen, ein Modell des Lernendenzu entwickeln und sich automatisch andiesen anzupassen. Zu diesem Bereich ge-h�ren beispielsweise adaptive Systeme, in-telligente tutorielle Systeme und nat�rlich-sprachliche Systeme.
2.1 Umsetzung prim�rerMedienfunktionen durchlernf�rderliche Infrastrukturen
Der Aufbau lernf�rderlicher Infrastruktu-ren zielt vor allem auf eine effektive undeffiziente Umsetzung der prim�ren Me-dienfunktionen. Aus dieser Perspektivewird schnell deutlich, dass Autorensyste-me zur Produktion von Lernsoftware oderauch gew�hnlicheWWW-Server, wie noch1994 von uns verwendet, schon f�r die Be-reitstellung von Unterlagen seitens derLehrenden keine geeignete technische Ba-sis bieten k�nnen; denn die einmalige Pro-duktion eines in sich geschlossenen Skrip-tums, das nach Fertigstellung nur noch ge-ringf�gig ge�ndert werden soll, scheint unseher die Ausnahme als die Regel in derHochschullehre zu sein.
So entwickelte sich aus der urspr�ng-lichen Idee eines hochwertigen Multi-media-Skripts schnell ein neues Paradig-ma, nach dem die bereitgestellten Materia-lien eher als ein Steinbruch des Lernens[Keil98] dienen, auf den zun�chst die Leh-renden im Rahmen der Vorlesung eine ge-eignete Sicht pr�sentieren. Diese wieder-um erlaubt es den Lernenden, einen struk-turierten Zugang zu den Unterlagen zufinden. Neben den unmittelbar in der Vor-lesung und den Tutorien verwendeten Ma-terialien – in erster Linie Folien und kurze,spezifische Fragestellungen aufbereitendeTexte, aber auch die im n�chsten Abschnittbeschriebenen Audio-Annotationen –wird hier vor allem umfangreiches Hinter-grundmaterial bereitgestellt, das die in derVorlesung vermittelten Inhalte erg�nzt.Nicht zuletzt soll hier auch der selektiveUmgang mit komplexem Wissen ge�btwerden, bei dem die Studierenden anhandgeeigneter �bungsaufgaben das Materialerschließen m�ssen. Zus�tzlich erleichtert
wird die Orientierung in den Unterlagendurch �bersichten (semantische Karten;vgl. [Klem98]) und eine an den einzelnenVorlesungen orientierte Gliederung.
Entsprechend unseres theoretischenAnsatzes ist seitens der Studierenden einaktiver Umgang mit den Materialien uner-l�sslich, bei dem die Lernenden eigeneSichten auf das von den Lehrenden bereit-gestellte Material entwickeln, aber auch ei-gene Dokumente erstellen und mit denvorhandenen integrieren k�nnen. Dazu istes einerseits vorgesehen, dass Studierendeeigene Gliederungsstrukturen f�r den Zu-griff auf die ihnen relevant erscheinendenDokumente anlegen k�nnen. Andererseitswird die Produktion eigener Dokumentein Form von Texten, Bildern sowie ggf. –in Veranstaltungen der Informatik – klei-nen Programmen in den Tutorien sowiedurch – f�r die Vergabe des Leistungsnach-weises erforderliche – �bungsaufgabengefordert. Auch f�r eigene Zwecke wirddie Erstellung von Notizen beispielsweisezu den Vorlesungsfolien oder einzelnenTexten angeregt, jedoch selten genutzt.
2.2 Lernen anverschiedenen Lernorten
Um einen aktiven Umgang mit den Unter-lagen nicht nur technisch m�glich, sondernauch imAlltag nutzbar zumachen, m�ssendie Materialien an allen Lernorten zugreif-bar sein. Mit Hilfe eines Offline-Mediumskann dies nicht zufriedenstellend erreichtwerden; außerdem schließen sich dort eineAktualisierung der Unterlagen (oder garein schrittweiser Aufbau der Materialien,wie wir ihn �blicherweise im Laufe des Se-mesters von Vorlesung zu Vorlesungdurchf�hren) und eine Individualisierungdurch Notizen und eigene Zugangsstruk-turen weitestgehend aus. Es ist also einetechnische Umsetzung erforderlich, beider die Unterlagen auf einem Server abge-legt und �ber dasWWWabgerufen und be-arbeitet werden. Idealerweise wird derOn-line-Zugriff erg�nzt umeineOffline-Varia-nte, die dann einen lediglich lesenden Zu-griff auf die Unterlagen gestattet, sowie ei-ne druckbare Version aller Dokumente, beidenen dies m�glich und sinnvoll ist. Derersten Forderung entsprechen wir, indemam Ende eines jeden Semesters eine CD-ROM mit s�mtlichen Vorlesungsunterla-gen produziert und an die StudierendenzumSelbstkostenpreis verteilt wird.
Thorsten Hampel, Reinhard Keil-Slawik, Olaf Nowaczyk, Harald Selke
70

Die Evaluation der ersten Umsetzungvon Vorlesungsmaterialien f�r das WWWergab, dass die Studierenden s�mtliche alsrelevant erachteten Dokumente ausdruck-ten, den Online-Zugriff also lediglich f�rein Printing-on-Demand verwendeten[BrKe95]. Daf�r schien uns ein wesentli-cher Grund zu sein, dass in der Vorlesungund insbesondere in den Tutorien nicht aufdie Unterlagen zugegriffen werden konn-te. Solange die Vorlesung eine reine Pr�-sentation vorbereiteter Materialien mitHilfe von Folien oder einer Pr�sentations-software ist und auf Hintergrundmateria-lien nicht n�her Bezug genommen wird, istdort ein Zugriff auf die Unterlagen nichtnotwendig, kann aber dennoch w�n-schenswert sein. In den Tutorien dagegenist ein solcher Zugriff von großer Bedeu-tung, da dort einerseits mit den vorhande-nen Materialien gearbeitet werden soll, an-dererseits die Studierenden die M�glich-keit haben m�ssen, ihre eigenen Notizensowie nat�rlich ihre Bearbeitungen von�bungsaufgaben vorstellen zu k�nnen.Als eine zentrale Komponente der DISCOsind daher Seminarr�ume, aber auch einH�rsaal so ausgestattet worden, dass sie ei-nen durchg�ngigen Zugriff auf alle f�r dieLehrveranstaltung relevanten Materialiennicht nur f�r den Dozenten, sondern auchan jedemArbeitsplatz f�r die Studierendenerm�glichen.
2.3 Verwaltung von Lehr-und Lernmaterialien
Es hat sich gezeigt, dass f�r die Verwaltungder Materialien ein gew�hnlicher WWW-Server alleine nicht ausreicht, da die dauer-hafte Pflege von großen Dokumentbest�n-den nicht hinreichend gut unterst�tztwird. Besser geeignet sind hier datenbank-basierte L�sungen oder auch Dokumen-tenmanagement-Systeme, die beispiels-weise dieHypertext-Verweise automatischverwalten und bei Umstrukturierungenanpassen. Außerdem verf�gen derartigeSysteme h�ufig �ber die M�glichkeit, dieZugriffsrechte f�r Dokumente festzule-gen. Dies ist bereits notwendig, wenn dieVorlesungsmaterialien nicht f�r jedermannlesbar sein sollen (beispielsweise werdendie Originaldateien der Folienpr�sentatio-nen auf dem Server abgelegt, sollen jedochnur f�r die die Veranstaltung betreuendenMitarbeiter sichtbar sein). Sp�testens aber,wenn Studierende eigene Dokumente pu-
blizieren k�nnen, wird man deren Schreib-rechte auf bestimmte Bereiche begrenzenwollen. Erfolgt schließlich sogar die Be-wertung von L�sungen zu f�r den Schein-erwerb relevanten �bungsaufgaben inner-halb des Systems, so ist eine benutzerspe-zifische Vergabe von Zugriffsrechtenschon aus Datenschutzgr�nden unum-g�nglich. �ber Zugriffsbeschr�nkungen,die von den Nutzern selber festgelegt wer-den k�nnen, k�nnen die Lernenden so-wohl Einzel- als auch Gruppenarbeits-bereiche anlegen. Auf diese Weise wird ei-ne elementare Kooperationsunterst�tzung
realisiert, die bei aller Einfachheit weit�ber die M�glichkeiten eines E-Mail-Aus-tauschs, der Diskussion inNewsforen oderdes gemeinsamen Dateizugriffs auf Be-triebssystem-Ebene hinausgeht.
Um einen derartigen Dokumenten-bestand nicht nur einmalig produzieren,sondern auch unter alltagspraktischen Be-dingungen aktualisieren und redigieren zuk�nnen, muss die Produktion weitest-gehend mit Standardwerkzeugen gesche-hen, wie sie ohnehin im Arbeitsalltag derLehrenden verwendet werden. Dies giltauch f�r die im Einzelfall selbstentwickel-
Kernpunkte f�r dasManagement
Erst die Verzahnung hochwertiger Einzelprodukte mit lernf�rderlichen Infra-strukturen erm�glicht die nachhaltige Nutzung vonMultimedia in der Hoch-schullehre. Die alltagstaugliche Umsetzung wird durch drei S�ulen getragen:, Die Entwicklung von multimedialen Bausteinen,, ihre durchg�ngige Verf�gbarkeit an allen Lernorten durch den Aufbau von
lernf�rderlichen Infrastrukturen und, neue Formen der kooperativen Erschließung und Nutzung durch verteiltes
Wissensmanagement.
Stichworte: Verteiltes Wissensmanagement, lernf�rderliche Infrastrukturen,multimediale Bausteine
Bild 1 Zugriff auf die Vorlesungsfolien im interaktiven H�rsaal
Die drei S�ulen der Paderborner DISCO
71

ten Lernanwendungen (z. B. die im Fol-genden beschriebenen Explorationen), woauf die lizenzgeb�hrfreie Zug�nglichkeitder Programmiersprache und die betriebs-system�bergreifende Nutzbarkeit geachtetwurde.
3 Multimediale Bausteine
W�hrend die lernf�rderlichen Infrastruk-turen einen physikalischen Tr�ger f�r dieSpeicherung und die Erschließung bieten,sind multimediale Bausteine ein Medium,um Informationen bereitzustellen, mit de-nen Wissen vermittelt werden kann. Hier-bei sollte der Computer ein weitestgehendtransparent einzusetzendesWerkzeug sein,das nicht selbst in den Vordergrund tritt,sondern lediglich eine Sicht auf inhaltlicheThemengebiete gew�hrt. Studien, in denendie Evaluation neuer Medien betriebenwurde, berichten immer wieder davon,dass bei der Einf�hrung multimedialerLernumgebungen eine große Begeisterungf�r „das Neue“ zu beobachten ist, die dannjedoch relativ stark abflacht. Verst�rktwerden solche Reaktionen noch durchLernumgebungen, die ihre Inhalte unterVerwendung von bunten Effekten – oft zuLasten des eigentlichen Inhalts – pr�sentie-ren wollen. Unser Ansatz der Lernbaustei-ne geht in eine andere Richtung. Nicht dieBombardierung der Lernenden mit immermehr Informationen schafft Einsicht undWissen zu einem Themengebiet, sonderndie intensive und vor allem aktive Aus-einandersetzung mit einem Problem. Hier-bei sollen vor allem die spezifischen neuenQualit�ten des Lern- und DenkzeugsComputer angemessen eingesetzt werden.
Die Produktion multimedialer Baustei-ne ist oft mit einem enormenAufwand ver-bunden. Um eine Vorlesungsstunde inForm neuer Medien abzubilden, sind Pro-duktionszeiten von 40 bis 200 Stunden kei-ne Seltenheit. Wie schon erw�hnt, ist hier-bei aber keineswegs eine Korrelation zwi-schen dem Produktionsaufwand und derLernf�rderlichkeit des fertigen Produktesvorhersagbar. Ganz imGegenteil stellt sichoft heraus, dass gerade die schlichten An-s�tze, fernab von aufwendigen „Hoch-glanz-Multimedia-Anwendungen“, einegroße Akzeptanz finden und ganz nat�r-lich in die allt�glichen Lernprozesse ein-fließen.
Im Folgenden soll anhand zweier Kon-zepte, der Audio-Annotationen und derExplorationen, gezeigt werden, wie zumeinen im Fall der Audio-Annotationen mitgeringstem Produktionsaufwand, quasi alsmultimediales Abfallprodukt, wertvolleLerneinheiten erstellt werden k�nnen.Zum anderen wird anhand der Exploratio-nen ein Konzept f�r vielf�ltig nutzbareLernbausteine dargestellt, die als „multi-mediale Perlen“ in didaktisch verschiedenaufbreitete Lernumgebungen integrierbarsind.
3.1 Audio-Annotationen
Die Audio-Annotationen vereinen Vor-lesungsfolien mit einer Aufnahme der zuden entsprechenden Folien gemachtenAusf�hrungen des Dozenten. In Vorlesun-gen, die Folien als prim�res Darstellungs-medium verwenden, sind die zu vermit-telnden Inhalte meist in einer sehr dichtenForm dargestellt. Die Erfahrung zeigt, dassselbst wenn den Studierenden die entspre-chenden Folien schon w�hrend der Vor-lesung vorliegen, es ihnen relativ schwerf�llt, den gesprochenen Worten des Do-zenten zu folgen und gleichzeitig eigeneNotizen zu erstellen, da sie dabei st�ndigentscheiden m�ssen, welche Ausf�hrun-gen zum didaktischen Leitfaden der Ver-anstaltung geh�ren.
In den von der Arbeitsgruppe „Infor-matik und Gesellschaft“ an der Universit�tPaderborn gehaltenen Veranstaltungenwird den Studierenden seit einigen Semes-tern mittels Audio-Annotationen dieM�glichkeit er�ffnet, die Lehrveranstal-tung komplett oder in Passagen noch ein-mal zu h�ren. Besonders in der Pr�fungs-vorbereitung, wenn f�r die Lernenden er-kennbar ist, welche Anmerkungen des Do-zenten in sp�teren Vorlesungen noch ein-mal aufgegriffen wurden und somit vonbesonderer Relevanz sind, haben sich dieAudio-Annotationen als wertvolles Lern-medium erwiesen.
F�r Lehrveranstaltungen erstellte Vor-lesungsfolien werden in der Regel mit Fo-lienpr�sentationsprogrammen erstellt undliegen somit von vornherein in einem digi-talen Format vor. W�hrend der Vorlesungwird nun mit einem Audiorekorder dieStimme des Dozenten aufgenommen. Zu-s�tzlich kann noch ein Video von der Ver-anstaltung erstellt werden, das jedoch nurzu Synchronisationszwecken dient, um die
entsprechenden Teile der Audioaufnahmein der Nachbearbeitung einer Folie zuzu-ordnen. Die Erfahrungen von „Authoringon the Fly“ [BaOt96] haben gezeigt, dassdie zus�tzliche Aufbereitung und Weiter-gabe des Videos keine merkliche Verbes-serung von Lernprozessen hervorrufenw�rde. Daher haben wir uns entschieden,ausschließlich den Audioanteil der Auf-nahmen zu verwenden.
In der Nachbearbeitung wird die vonder gesamten Vorlesung erstellte Audio-aufnahme in Teile zerlegt, die den zu einereinzelnen Folie gemachten Ausf�hrungenentsprechen und in Form von komprimier-ten Audiodateien auf einemWebserver ab-gelegt. Durch hohe Kompressionsraten,die bei Sprachaufnahmen nur einen margi-nalen Klangverlust bewirken, sind dieseAudiodateien auch bei geringer Netzband-breite zugreifbar. Auf demWebserver wer-den nun noch die komprimierten Audio-dateien mit der entsprechenden Vor-lesungsfolie verkn�pft, wodurch sie �ber�bliche Browsertechnologien eingesehenund abgespielt werden k�nnen.
Die Audio-Annotationen zeigen, dassdie Erstellung qualitativ hochwertigermultimedialer Lehr- und Lernmaterialiennicht zwangsl�ufig mit einem hohen Pro-duktionsaufwand verbunden ist. Durchden relativ geringen Aufwand bei derNachbearbeitung k�nnen die von den Do-zenten ohnehin zu vollf�hrenden Arbeits-abl�ufe wie Vorbereitung und Durchf�h-rung von Vorlesungen weitergenutzt wer-den. Gerade die zwangsl�ufig enge Vernet-zung zwischen der Lehrveranstaltung undzus�tzlichen multimedialen Lernmedienscheint ein Indiz f�r die Lernf�rderlichkeitder Audio-Annotationen zu sein. Vor al-lem das durch die Audio-Annotationenunterst�tzte gezielte Repetieren von Vor-lesungen in Verbindung mit der �berpr�-fung und Vervollst�ndigung eigener Mit-schriften wird von befragten Studierendenals sehr hilfreich empfunden, um sich auchglobalere Zusammenh�nge zwischen denim Laufe des Semesters vorgestellten The-mengebieten zu verdeutlichen [GrHo99].
3.2 Explorationen
Neben der Verbesserung der rezeptivenMedienqualit�ten gilt es jedoch vor allem,das Produktionspotenzial digitaler Medienzu erschließen. G�ngige mit Autorensyste-men erstellte Lernsoftware nutzt Inter-
Thorsten Hampel, Reinhard Keil-Slawik, Olaf Nowaczyk, Harald Selke
72

aktivit�t nahezu ausschließlich zur Selekti-on. Dazu geh�ren die Auswahl von anzu-zeigenden Dokumenten, das Verfolgenvon Verweisen, das Selektieren von Ant-worten in Multiple-Choice-Tests oderauch das Setzen von Parametern und An-fangsbedingungen, um bei Animationenund Simulationen vordefinierte Abl�ufeauszul�sen. Der hohe Produktionsauf-wand f�r diese Art von „selektiver Repr�-sentation“ steht meist in keinem angemes-senen Verh�ltnis zum Ergebnis. Dem-gegen�ber verfolgen wir auch bei hoch-wertigen Multimediabausteinen das Prin-zip, dass Medien Ausdrucksmittel sindund Lernen in Bezug auf den Medien-gebrauch als Konstruktion von L�sungenbzw. Antworten aufgefasst werden kann.
Die nach dem Explorationen-Konzepterstellten Lernbausteine erm�glichen esbeispielsweise, technische Konstruktionenzu erstellen, ihr Verhalten zu simulierenund sich mittels der Ergebnisse und ihrerVisualisierung die inhaltlichen Zusammen-h�nge zu verdeutlichen. Sie k�nnen dabeiflexibel in didaktisch unterschiedlich auf-bereiteten Veranstaltungen – sowohl f�rdie Pr�sentation von Sachverhalten in Vor-lesungen als auch f�r die Erstellung undErforschung eigener Konstruktionen in�bungen und Heimlernsituationen – ge-nutzt werden. Explorationen erm�glichennicht nur die Ver�nderung von Parameternund Randwerten, sondern erlauben dieKonstruktion eigener Modelle, um somitein Themengebiet auf unterschiedlichenSchwierigkeitsniveaus erschließbar zu ma-chen.
Die Erstellung einer konstruktiven L�-sung erfolgt dabei in einer grafischen Um-gebung, in der Einzelelemente aus einemVorrat auf der Zeichenfl�che platziert undzu einem zusammenh�ngenden Aufbauverkn�pft werden k�nnen [HaNo99]. Dervon universellen Simulationssystemen ver-langte Zwischenschritt der Modellbildungmittels einer textuellen Beschreibung, un-ter Verwendung einer speziellen Syntax,entf�llt bei den Explorationen vollst�ndig.Bei einem derzeit durchgef�hrten Pilot-projekt in der Mechanikausbildung bei-spielsweise sind die Einzelelemente einerKonstruktion die Bauelemente Balken, La-ger, Federn und Massen, aber auch angrei-fende Kr�fte und Momente. Das Explora-tionen-Konzept ist jedoch nicht auf tech-nische Problemstellungen beschr�nkt:Auch Einzelelemente aus nichttechnischenGebieten wie der Biologie oder den Sozial-
wissenschaften (soweit Simulationsmodel-le vorhanden) sind durchaus realisierbar.Von Bedeutung ist nur, dass die im Vorratenthaltenen Einzelelemente jeweils einemThemenbereich entspringen und zu sinn-vollen Konstruktionen zusammengef�gtwerden k�nnen. Erst durch die Verkn�p-fung der Einzelelemente entsteht ein Sys-tem, das durch ein internes Modell abge-bildet und dann von der Exploration simu-liert werden kann. Die Visualisierung fin-det in einer f�r den gegebenen Fall geeig-neten Form statt, z.B. als Graph oderdurch direkte Animation der Konstrukti-onsskizze. Alle Ver�nderungen an den zusimulierenden Aufbauten werden hierbeikontinuierlich dargestellt.
Es k�nnen somit verschiedene Sichteneiner Problemstellung entwickelt, er-schlossen und zueinander in Verbindunggebracht werden. Aufgabe der Exploratio-nen ist es hierbei sowohl das durch denStudierenden konstruierte System zu si-mulieren und bei dynamischen Abl�ufenzu animieren als auch die Konsistenz zwi-schen den verschiedenen Darstellungsfor-men zu gew�hrleisten.
Ein weiterer Vorteil von Explorationenist, dass sie sowohl zur Pr�sentation einesKonstruktionsvorganges in einer Vor-lesung genutzt werden k�nnen als auchmit Hilfe vordefinierter Aufgaben und ge-setzter Randbedingungen f�r den �bungs-betrieb oder auch f�r das Selbststudium.Dabei legen wirWert darauf, dass Explora-tionen flexibel in unterschiedliche didakti-sche Zusammenh�nge eingebettet werdenk�nnen. Sie bieten Lehrenden wie auchLernenden neue M�glichkeiten, ohne sieauf eine bestimmte Vorgehensweise fest-zulegen. Explorationen weisen durch ihrenhohen Grad an Interaktivit�t und Respon-sivit�t einen deutlichen multimedialenMehrwert gegen�ber klassischen Medienauf. Durch ihren modularen Aufbau undihre vielseitige Nutzbarkeit in unter-schiedlichen Lernumgebungen unterstrei-chen sie die Forderung nach einem „Stein-bruch des Lernens“, in dem sich jeder Ler-nende aber auch Lehrende die f�r ihn inte-ressanten Teilaspekte aus dem Gesamt-gef�ge herausbrechen und verwendenkann.
4 VerteilteWissensorganisation
Je mehr die urspr�nglich mit dem Aufbauund der Nutzung der Paderborner DISCOverbundenen Probleme gel�st werdenkonnten, desto deutlicher zeigte sich, inwelcher Richtung die n�chsten Entwick-lungsschritte liegen. Durch die Orientie-rung auf den konstruktiven Medien-gebrauch und die soziale Einbettung desLernens zeigten sich bestimmte Medien-br�che zunehmend deutlicher. Zwar sindwir mit unserem Ansatz des verteilten Do-kumentenmanagements im Vergleich zumklassischen Web-Publishing deutlich wei-ter, doch bleibt ein klares Defizit bestehen:Der Umfang des Lehrmaterials und dieZugangsberechtigungen werden durch dieLehrenden festgelegt. Die Konsequenz ist,dass der Lernende sich immer nur in einervom jeweiligen Lehrenden vorgegebenenInhalts- und Zugriffsstruktur bewegenkann. Die Lernenden k�nnen das Materialdaher nur in beschr�nkter Weise gem�ß ih-rer eigenen Bed�rfnisse arrangieren undstrukturieren. Es ist ihnen also nicht m�g-lich, eine eigene Lernumgebung aufzubau-en, in der sie beispielsweise Unterlagen ausverschiedenen Lehrveranstaltungen odergar verschiedenen Universit�ten so mit-einander verkn�pfen, dass ihr eigenerLernweg und Wissensstand verk�rpertwerden.
Zwar ist es prinzipiell m�glich, alle �berdas Netz frei verf�gbaren Materialien inunterschiedlichen Zusammenh�ngen zunutzen. Doch sind f�r eine effektive Ver-waltung und Erschließung immer zus�tzli-che Aktivit�ten wie Kopieren, Transfor-mieren oder Indizieren erforderlich, dieschnell einen sehr hohen Aufwand erfor-dern. Außerdem erschweren solche indivi-duell strukturierten Wissensbest�nde diekooperative Bearbeitung und Erstellung.Derartige Medienbr�che und Defizite sol-len mit dem sTeam-Ansatz vermieden wer-den, der gewissermaßen ein Lern-Laborbildet, um neue Formen der verteiltenWissensorganisation zu erforschen, sie all-tagstauglich umzusetzen und die daf�r er-forderlichen Werkzeuge in einem Open-Source-Ansatz zur Verf�gung zu stellen.
Verteilte Wissensorganisation bedeutetin der Grundintention des Wortes die ko-operative Erstellung, Verwaltung und Pfle-ge vonWissen vergegenst�ndlichenden Ar-tefakten. Artefakte, repr�sentiert durch
Die drei S�ulen der Paderborner DISCO
73

Dokumente, Grafiken, Notizen, Anmer-kungen und ihre Verkn�pfung durch Ler-nende, bilden so die Grundlage jeglicherUnterst�tzung von Lernprozessen durchgeeignete Umgebungen und Werkzeuge.Als weiterhin wesentlich sind die zeitlicheKomponente einer Interaktion und Kom-munikation zwischen Lernenden anzuse-hen sowie die r�umliche Differenzierungder Kooperation. Existierende Umgebun-gen und Ans�tze k�nnen in den meistenF�llen entweder in die Klasse der eher syn-chronen, also zeitgleich arbeitenden (eineSitzung unterst�tzenden) Systeme oderaber in die Klasse der asynchronen, einengemeinsamen Ort fokussierenden Systemeeingeordnet werden [Elli91].
Im sTeam-Ansatz steht die Integrationvon zeitlichen und r�umlichen Differen-zierungen der Lernenden im Vordergrund.Es werden asynchrone, typischerweise ausdem Dokumentenmanagement bekannteMechanismen des aktiven Umgangs mitmultimedialen Lernbausteinen oder auchHypertexten mit stark synchronen Ans�t-zen aus dem Bereich der Sitzungsunter-st�tzung verkn�pft. Eine derartige Synthe-se erlaubt neue, so nicht bekannte Misch-formen aus asynchronen und synchronenFormen der Zusammenarbeit zwischenLernenden.
4.1 Lernen braucht einkooperatives Aufenthaltsmedium
Zentrales Instrument zur Umsetzung die-ses Ansatzes ist der virtuelle Raum, eine –wie eine ganze Anzahl von Forschungs-ans�tzen und auch fr�he Prototypen dersTeam-Konzeption zeigen – f�r den Men-schen nat�rliche und unmittelbar akzep-tierte Metapher zur logischen und zeitli-chen Gruppierung von Objekten undWerkzeugen [Hamp99]. Auf diese Weisekann der Raum sowohl Dokumente inOrdnern oder Containern zusammenfas-sen und strukturieren als auch als „Treff-punkt“ f�r eine Gruppe von Lernendenf�r einen Chat o. �. dienen. Der Raumwirkt auf diese Weise �hnlich einer Sam-melstelle, einer Bibliothek oder Daten-bank, ist gleichzeitig aber auch Forum undDorfbrunnen, f�hrt Lernende zusammenund koordiniert ihre Kommunikation. Be-reits in fr�heren Systemen, wie Hendersonund Card sie vorstellen [HeCa85], �berNewsforen, Computerspiele und Avatar-welten bis zu kooperativen Arbeits-
umgebungen ist der Raum ein g�ngigesMedium der Strukturierung und Zusam-menf�hrung von Informationen und Per-sonen. Neu an diesem Ansatz ist jedochdas Zusammentreffen von Selbstadminis-tration und Lernerzentriertheit sowie dieVerkn�pfung von Werkzeugen, Kom-munikationsmechanismen und Dokumen-ten.
Virtuelle Gemeinschaften und speziellvirtuelle Lerngemeinschaften leben vonmenschlichen Beziehungen. Die Frage f�runs ist dabei nun nicht, ob sich diese reindurch das Netz aufbauen lassen, sondernwie bestehende Gemeinschaften ihre Akti-vit�ten �ber das Netz fortsetzen und er-g�nzen k�nnen. Ziel ist daher, einer realenGemeinschaft von Lernenden sowohl realeTreffen als auch virtuelle Zusammenk�nfteim Netz zu erm�glichen. Eine Anzahl the-menorientierter R�ume, in die verschiede-ne Kommunikationsmechanismen, wiez. B. ein Chat, eingebettet sind, bildet hier-zu die Grundlage. Ein Raum dient in die-sem Konzept gleichzeitig zur Einschr�n-kung der Reichweite einer Kommunikati-on.
So k�nnen sich schon in den derzeitexistierenden sTeam-Prototypen Gruppenvon Lernenden dynamisch bilden, um sichin einem virtuellen Raum zu treffen. DieseR�ume sind hochgradig flexibel und k�n-nen von Lernenden jederzeit eingerichtetund mit von der Gruppe festgelegten Zu-griffsberechtigungen versehen werden.Auf diese Weise k�nnen sich Lernendez. B. zu einer Diskussion oder Bearbeitungeines �bungsblattes in einen sTeam-Raumzur�ckziehen. Gleichzeitig dienen R�umeals Ablage- und Strukturierungsorte f�rDokumente. Da der Zugriff mit Standard-werkzeugen �ber das Internet erfolgt,kann von zu Hause, in einem Tutoriumoder auch w�hrend der Vorlesung in einemelektronischen H�rsaal auf sie zur�ck-gegriffen werden. So kann ein Raum imRahmen des �bungsbetriebs verschiedeneVarianten von Aufgabenbl�ttern und L�-sungen einer Gruppe von Studierendenenthalten. Diese �bungsbl�tter k�nnenz. B. zur Abgabe in einen offiziellen�bungsgruppenraum kopiert werden undstehen damit zur sp�teren Nachbereitungbeispielsweise im Rahmen einer Pr�fungs-vorbereitung zu Verf�gung. MaßgeblicherVorteil gegen�ber klassischen Methodender Ver�ffentlichung von �bungsaufgabenund L�sungen im WWW ist hierbei dieM�glichkeit, verschiedene Varianten von
Dokumenten zu verwalten und gleichzei-tig Verweise auf in der Umgebung oder imWWW verf�gbare Lehrunterlagen wie er-g�nzende Texte zu erstellen.
Der Raum als zentrale Struktur undMetapher zur Strukturierung von Lern-unterlagen kann seine volle Leistungs-f�higkeit erst in der Verschmelzung vonKommunikations-, Dokumentenmanage-ment- und Wahrnehmungsmechanismenvoll entfalten. Zun�chst wurden zu diesemZweck einfache Mechanismen der Grup-penwahrnehmung, sogenannte Aware-ness-Informationen, bereitgestellt. Pikto-gramme anderer Nutzer eines Raumes sig-nalisieren die Anwesenheit anderer Ler-nender, mit denen eine Diskussion begon-nen werden kann. Es ist leicht zu erken-nen, wer sich zu welchem Zeitpunkt in ei-nemRaum befindet.
Weiter unterst�tzt wird das Konzeptdurch die M�glichkeit, verschiedeneWerkzeuge in den Raum zu integrieren.Werkzeuge sind dabei kleinere netz-gest�tzte Applikationen, die sehr stark mitder eigentlichen Umgebung verzahnt sind.Die Gesamtarchitektur des Systems ist da-rauf zugeschnitten, dass sich z. B. inner-halb der konzipierten Umgebung Mecha-nismenwie Schwarze Bretter oder „Rekor-der“ – eine Art Protokollwerkzeug – leichtauch von den Nutzern des Systems ent-wickeln und in R�ume einbetten lassen.Das Arbeiten mit Dokumenten, die Anfer-tigung pers�nlicher Notizen und die Er-stellung von Verweisstrukturen auf diesenDokumenten werden durch netzgest�tzteWerkzeuge des sTeam-Raumes bereit-gestellt. Aktives Lernen und Arbeiten mitdem System verlangt also lediglich einenInternetanschluss und einenNetzbrowser.
5 Der digitale Schulmeister :Ein Ausblick
Betrachtet man Lernen vorrangig als indi-viduelle Aktivit�t, die durch verbessertemultimediale Materialien unabh�ngigervon Zeit und Ort einer Veranstaltung (alsoeines sozialen Prozesses) gestaltet werdenkann, dann tritt die Qualit�t des erzeugtenMaterials bzw. die netzgest�tzte �bertra-gung und Betreuung der Lernenden in derFernlehre in den Vordergrund. Zwar l�sstsich nicht immer der genaue Aufwand f�rdie verschiedenen Ans�tze und Verfahren
Thorsten Hampel, Reinhard Keil-Slawik, Olaf Nowaczyk, Harald Selke
74

ermitteln, doch zeichnet sich ab, dass f�rbeide F�lle – Selbstlernen mit hochwerti-gen Materialien und betreute Fernlehre –ein enormer Zusatzaufwand auf der Seiteder Lehrenden zu verzeichnen ist. Um die-sen Zusatzaufwand aber rechtfertigen zuk�nnen, m�ssen zun�chst entsprechende�ußere Rahmenbedingungen hergestelltwerden. Das macht es schwierig, sowohldie Alltagstauglichkeit als auch die Er-folgsaussichten eines bestimmten Ansatzesbewerten zu k�nnen.
Mit der Paderborner DISCO haben wirdemgegen�ber einen Ansatz gew�hlt, beidem Lernen �berwiegend als sozialer Pro-zess aufgefasst wird, in den individuelleLernphasen eingestreut sind. Dadurch ge-r�t sofort die gegenw�rtige Ausgangssitua-tion der Pr�senzuniversit�t ins Blickfeldund auch die Frage, in welcher Form digi-tale Medien geeignet sind, diese Ausbil-dung an einer Pr�senzuniversit�t zu ver-bessern und weiter zu entwickeln. Derzweite, eng damit verbundene Gesichts-punkt offenbart sich in der Einsicht, dasskomplexe Ver�nderungsprozesse wederaus lerntheoretischen Betrachtungen nochaus der Analyse technischer Potenziale al-lein ableitbar sind, sondern ein kontinuier-liches Forschungsumfeld erfordern, das esgestattet, die erwarteten Vorteile auch �ko-logisch valide, d. h. unter Alltagsbedingun-gen erheben zu k�nnen. Sobald aber All-tagsbedingungen und Erfolgsfaktoren insBlickfeld geraten, muss der Nutzen derTechnik nicht nur f�r die Lernenden, son-dern vor allem auch f�r die Lehrenden er-hoben werden.
Anders ausgedr�ckt sind digitale Me-dien sowohl ein Mittel zur Rationalisie-rung als auch zur Qualit�tssteigerung, wo-bei es entscheidend darauf ankommt, wosich die beiden scheinbar zuwider laufen-den Zielsetzungen verbinden und unterwelchen Alltagskonstellationen sich dieseVerkn�pfung erfolgreich umsetzen l�sst.Die Beispiele aus den drei S�ulen der Pa-derborner DISCO zeigen, dass sich bei ei-ner entsprechenden Konzeption des Me-dieneinsatzes sowohl f�r Lehrende alsauch f�r Lernende neue Potenziale er-schließen lassen. Audio-Annotationen bei-spielsweise sind f�r den Lehrenden gewis-sermaßen ein Abfallprodukt, trotzdemaber f�r die Studierenden ein Gewinn. DieErstellung und Nutzung solcher Annota-tionen im Rahmen unserer lernf�rderli-chen Infrastruktur gibt uns im Alltags-betrieb die M�glichkeit, mit Beendigung
der letzten Vorlesung alle Studierendenmit einer CD-ROM auszustatten, die diegesamten Materialien einschließlich einerAufzeichnung der Veranstaltung enth�lt.Die Einbettung dieser Prozesse in ein um-fassendes Dokumentenmanagement er-laubt zus�tzlich, neue Formen der koope-rativen Erstellung und Pflege sowie des Er-schließens zu erproben. Erst aufgrund die-ser Erfahrungen sind wir mittlerweile inder Lage, differenzierte Nutzungsszena-rien zu entwickeln. So setzen wir die Au-dio-Annotationen beispielsweise nur inden studierendenintensiven Lehrveranstal-tungen ein, denn die starke Zentrierungauf den Vortragenden und seine Pr�sentati-on ist f�r st�rker diskursorientierte Haupt-studiumsveranstaltungen nicht angemes-sen. Hier kommen die Vorteile des koope-rativen Erstellens von Dokumenten unddes gemeinsamen Er�rterns und Verglei-chens im interaktiven Seminarraum st�rkerzum Tragen.
Je besser wir in der Lage sind, den Me-dieneinsatz differenziert zu betrachtenund auch zu betreiben, desto mehr wirddeutlich, dass ein Großteil der damit ver-bundenen Aufgaben nicht auf Dauer beiden Lehrenden verbleiben muss oder soll.Pionierleistungen einzelner Forschungs-gruppen m�ssen sich zunehmend in uni-versit�tsweiten Diensten niederschlagen.Der Medienpionier, der selbst singt undspielt, die Noten fertigt und die Tourneedurch das Reich der Unterlagen organi-siert, muss bald der Vergangenheit angeh�-ren. Denn erst wenn der Gebrauch von di-gitalen Medien banal geworden ist, kannman sich wieder verst�rkt auf die eigentli-che Arbeit konzentrieren. In Bezug auf dieerste S�ule haben wir dieses Ziel insoweiterreicht, als mittlerweile auch in anderenuniversit�ren Bereichen Strukturen in An-lehnung an die DISCO aufgebaut werden.Bez�glich der Medienbausteine haben wirdieses Ziel erst partiell erreicht. Insbeson-dere fehlen bis heute noch Standards undSchnittstellenkonzeptionen, um Lernmo-dule austauschen, integrieren und recher-chieren zu k�nnen. Die dritte S�ule hin-gegen ist von einer alltagstauglichen Um-setzung noch weit entfernt, obwohl Teilebereits vor demHintergrund der bestehen-den Infrastruktur erprobt werden.
Der Einsatz digitaler Medien wird sichnoch auf absehbare Zeit zwischen banalerNutzung und anspruchsvoller Forschungbewegen, wobei es darauf ankommt, aufjedem Anspruchsniveau die angemessene
Umsetzung zu erreichen. Ein Schulmeistermuss insofern nicht singen k�nnen, aber ermuss in der Lage sein, die vielen Stimmenzusammenzufassen und zu dirigieren. Malwerden es kleine Sonette sein, mal komple-xe Symphonien. Immer aber werden es Si-tuationen sein, wo die Menschen im Vor-dergrund stehen. Voraussetzung daf�r istjedoch, dass man zun�chst die Instrumenteauch beherrscht, damit sie nicht einenGroßteil der Aufmerksamkeit binden. EinSchulmeister muss also nicht unbedingtsingen k�nnen, aber er muss sich allemgleichermaßen zuwenden, den Menschen,der Musik und nicht zuletzt den Instru-menten.
Literatur
[BaOt96] Bacher, Christian; Ottmann, Thomas:Tools and Services for Authoring on the Fly.In: Carlson, Patricia; Makedon, Filia (Hrsg.):Proceedings of Educational Multimedia andHypermedia 1996. Association for the Advan-cement of Computing in Education, Charlot-tesville (Va.) 1996, S. 7–12.
[BrKe95]Brennecke, Andreas; Keil-Slawik, Rein-hard: Alltagspraxis der Hypermediagestaltung– Erfahrungen beim Einsatz des World WideWeb und Mosaic in der Lehre. In: B�cker,Heinz-Dieter (Hrsg.): Software-Ergonomie‘95 – Mensch-Computer-Interaktion – An-wendungsbereiche lernen voneinander. Teub-ner, Stuttgart 1995, S. 107–123.
[Elli91] Ellis, C.A.; Gibbs, S. J.; Rein, G.:Group-ware: Some Issues and Experiences. In: Com-munications of the ACM 34 (1991) 1, S. 38–58.
[Engb95] Engbring, D.; Keil-Slawik, R.; Selke H.:Neue Qualit�ten in der Hochschulausbildung.Lehren und Lernen mit interaktiven Medien.Technischer Bericht Nr. 45 des Heinz NixdorfInstitut, Universit�t Paderborn 1995.
[GrHo99] Grimm, Robert; Hoff-Holtmanns,Markus: Evaluating a Simple Realization ofCombining Audio and Textual Data in Educa-tional Material – Making Sense of Nonsense.In: Collis, Betty; Oliver, Ron (Hrsg.): Proceed-ings of ED-MEDIA 99 –World Conference onEducational Multimedia, Hypermedia & Tele-communications. Association for the Advance-ment of Computing in Education, Charlottes-ville (Va.) 1999, S. 1390–1391.
[Hamp99] Hampel, Thorsten: sTEAM – Coope-ration and Structuring Information in a Team.In: de Bra, Paul; Leggett, John (Hrsg.): Pro-ceedings of WebNet 99 –World Conference onthe WWW and Internet. Association for theAdvancement of Computing in Education,Charlottesville (Va.) 1999, S. 913–918.
[HaNo99] Hampel, Thorsten; Nowaczyk, Olaf:Explorationen f�r die Mechanikausbildung –eine neue Dimension interaktiver Lehrmateria-lien. 44th International Scientific Colloquium,3.WorkshopMultimedia f�r Bildung und
Die drei S�ulen der Paderborner DISCO
75

Wirtschaft. Technische Universit�t Ilmenau1999, S. 101–103.
[HeCa85] Henderson, A.J. & Card, S.A.: Rooms:The Use ofMultiple VirtualWorkspaces to Re-duce Space Contention, ACM Transactions onGraphics, Vol. 5, No 3, (July 1985), ACMPress.
[Keil98] Keil-Slawik, Reinhard: Multimedia alsSteinbruch des Lernens. In: Hauff, Mechtild(Hrsg.): [email protected]? Entwick-lung – Gestaltung – Evaluation neuer Medien.Waxmann,M�nster 1998, S. 81–99.
[Keil99] Keil-Slawik, Reinhard: Evaluation alsevolution�re Systemgestaltung. Aufbau undWeiterentwicklung der Paderborner DISCO(Digitale Infrastruktur f�r computerunter-st�tztes kooperatives Lernen). In: Kindt, Mi-chael (Hrsg.): Projektevaluation in der Lehre –Multimedia an Hochschulen zeigt Profil(e).Reihe: Medien in der Wissenschaft, Band 7,Waxmann,M�nster 1999, S. 11–36.
[KeSe98] Keil-Slawik, Reinhard; Selke, Harald:Forschungsstand und Forschungsperspektivenzum virtuellen Lernen von Erwachsenen. In:Arbeitsgemeinschaft Qualifikations-Entwick-lungs-Management Berlin (Hrsg.): Kom-petenzentwicklung '98 – Forschungsstand undForschungsperspektiven. Waxmann, M�nster1998, S. 165–208.
[Klem98] Klemme, M.; Kuhnert, R.; Selke H.: Se-mantic Spaces. In:H��k, Kristina et al. (Hrsg.):Workshop on Personalised and Social Naviga-tion in Information Space, SICS Technical Re-port T98:02, Kista, Sweden, March 1998,S. 109–118.
Thorsten Hampel, Reinhard Keil-Slawik, Olaf Nowaczyk, Harald Selke
76