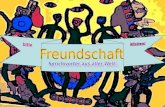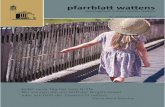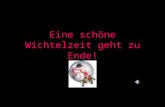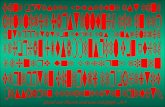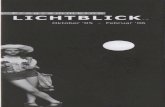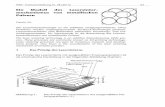Weltweite Auszahlungen auf eine MasterCard - eine echte Alternative
Eine Wasserstoffernleitung
Transcript of Eine Wasserstoffernleitung

tIeft l i. l 4. 4. 1913J
Abstufung f~thig, die normale Nervenfaser kann nur Er- regungen yon einerlei Stih'ke leiten; ein Reiz, der eine Nerveufaser tr iff t , erregt entweder diesclbe oder cr er- regt sic nicht, wenn er sie aber erregt, so ist die St~trke dieser Erregung immer gleieh, mug nun der Reiz ein starker oder ein schwacher gewesen sein (Alles-oder- Niehts-Gesetz). Die Verschiedenheit der Reizerfolge yon starken and sehwaehen Reizen beruht nur auf der Ver- ~:hiedcnheit in der Anzahl der gereizten Nervenfasern.
J . M .
Viele Kalkfleehten leben nicht auf der Oberfl~ebe des Gesteins, sondern dringen ganz in dessert Inheres ein, so da~ ihr Thallus vbllig oder grbl3tenteils im Kalk ver- borgen ist und selbst die Fruchtbecher (Apothecien) im ]nnern des Steins entstehen, um erst sparer naeh aul~en durehzubrechen. Bekanntlich sind die Flechten keine einheitlichen Organismen, sondern bilden ein Konsortium yon Pilzhyphen and Algen (Gonidien), die in einem seinem Wesen nach noeh framer night ganz klargestellten symbiotisehen Verh~ltnis zueinander stehen. Beim Ein- dringen yon Flechten in Kalkstein miissen die Zellen einen Stoff ausseheiden, der den Kalk auflbst. Na,eh den bisherigen Untersuchungen, die zumeist an Flechten mit griinen Algen, z. B. Palmellen, angestellt worden sind, wird das kalklbsende Stoffwechselprodukt yon den Pilz- hyphen ausgesehieden, da die Gonidien allseitig yon diesen bedeekt sind; ob kS auch yon den Hyphen bereitet wird, bleibt dabei allerdings zweifelhaft. E. Bachmann, der schon vor zwanzig Jahren griindliche Untersuchungen fiber die Kalkflechten verbffentlicht hat, macht jetzt Be- obachtungen an einer mit goldgelben Chroolepus-Goni- dien ausgerfisteten Kalkfleehte bekannt, die zeigen, da~ die Alge selbst~tndig in das Gestein eindringen kann. Die yon ihm hergestellten Dtinnsehliffe liei.~en erkennen, datl an einigen Stellen die Hyphen dem lebhaften Wachs- turn der Algenfa.den nicht folgen konnten ur/d diese an den Spitzen freilie~en. Daraus geht hervor, dab die Chroolepusf[tden die F~higkeit besitzen, Kalk selbst~ndig aufzulbsen; sie miissen also die kalklbsende S~ure selbst erzeugen and abscheiden. So fressen sie enge, sehaeht- fbrmige ]:Iiihlungen in den Kalkstein hinein. SobaM sit yon den Hyphen erfaBt worden sind, beginnen sie leb- halter zu waehsen, zum Tell hefeartig zu sprossen and nehmen dabei oft sehr bizarre Form an. Dadureh and durch das Wachstum der lfyphen wird der Kalk schwammartig durchlbchert and erl~ngt infolgedessen die F~higkeit, die atmosplfiixisehe Feuchtigkeit reichlieher aufzunehmen und 15nger festzuhalten. (Bcr. D. Bot. Ges. 1913, 31, 3.) iV. M.
Kallose in Algenmembranen. Unter den Meeresalge~ ha.ben die Caulerpaceen in besonderem Marie die allge- meine Aufmerksamkeit auf sieh gelenkt, da sie bei an- sehnlicher Grbfle nur einzellig sind und dabei die Formen ld~herer Pflanzen mit Wurzeln, Stengeln und Blbttern naehahmen. Man hat bei der Untersuchung ihrer Zelt- wiinde gefunden, dab diese nicht die Eigenschaften eigent- ticher Zellulosemembranen haben; dennoch wird in den Besehreibangen vielfach nicht hierauf Rticksicht ge- nommen, und namentlich wird allenthalben yon den ,,Zellulosebalken" gesproehen, welehe die Zellen dieser Algen durchsetzen. Eine neuerdings von Robert Mirande w)rgenommene Prtifung verschiedener Caulerpa-Arten hat zu dem Ergebnis gefiihrt, dab ihre Membranen tells aus Pektinstoffen, felts aus Kallose bestehen. Die Kallose ist yon der Zellulose u. a. dadurch unterschieden, dab sie in verdlinnten Alkalien 15slich, in Kupferoxyd- ammoniak unlbslich ist nnd sieh mit Chlorzinkjodlbsung nicht blau, sondern rotbrauu f~rbt. AuBerdem ist sie an einer I{eihe eharakteristiseher Farbreaktionen erkenn-
Klc iac Mittci lungcn. 343
bar. Bei Phanerogamen kommt sic vor in den Wand- verdiekungen (dem Kallus) der siebartig durchl5cherten Querw~nde der Siebrbhren, in den Membranen der Pollen- mutterzellen und in kalkhaltigen Membranen, wie ha- mentlich in den als Cystolithen bekannten traubenart igen Zellwandgebilden, die vorztiglich aus den Bt~ttzellen des Gummibaums bekannt sin& Ihr Vorkommen ist ferner bei Pilzen (Membranen yon Peronospora, Sporangien yon Mueor) und bei einigen Algen (Oedogonium, Asco- phyllum, Laminaria) naehgewiesen worden. In allen diesen Fi~llen aber linden wir sie entweder zusammen mit Zellulose oder fiir sieh allein. Fiir die Caulerpen ist dagegen die Vereinigung der Kallose mit Pektinstoffen eharakteristiseh. Weitere Untersuehungen zeigten, da~ dieser besondere Membrantypus aueh anderen Meeres- algen aus der Klasse der Siphoneen, n~mlieh auBer den Caulerpaceen aueh den Bryopsidaceen, Derbesiaceen and Codiaceen eigentiimlieh ist. Die im SiiBw~sser lebenden Vaucheriaceen haben dagegen Zellulosemembranen. (Compt. rend. 1913, 156, 475.) F . M .
Laehskonservierung in Nordamerika. Eines der wiehtigsten Fisehprodukte in Amerika ist der Laehs, and es hat sich dort zur Ver~rbeitung dieses Fisches zu Konserven eine grof3e Industr ie entwickelt. Als die beste Qualitbt gelten die Fische, die das rbteste Fleisch und den grbf.~ten 01gehalt aufweisen. Rund 225 Millionen Pfund yon diesen Fisehen wurdea im vergangenen Jahre konserviert; hierzu werden von dieser Industrie sehr grot3e Mengen Chemikalien, namentlieh S~lzs~ure und Atznatron, ferner Zinnblech, Lbtmetall und Lack ver- braucht. Bei der Konservierung werden die Fische mit l:Iilfe yon Masehinen yon Kopf, Schwanz, Flossen nnd Eingeweiden befreit, in Stticke geschnitten, gesalzen und in Bfichsen verpackt. Wie die ,,Chemilcer-Zeitung" be- richter, werden die Biichsen maschinell verlbtet, sodann gektih]t und durch Eintauchen in heil~es Ws.sser anf luftdichten VerschluI3 geprtift. Hierauf werden sic ein bis zwei Stunden in Dampfretorten gebr~cht, dann wird, w~thrend sie noeh heiB sind, tier Deckel dureh- locht, damit noch etwa vorhandene Luft nnd etwas FRissigkeit entweichen kbnnen. Hierauf werden die Biiehsen wieder gediehtet und eine Stunde lung bei l | 5" sterilisiert. Die Biichsen werden mit Atznatron ge- waschen, nochmals auf ihre Dichtigkeit gepriift and schlieBlieh lackiert und mit Et iket ten beklebt, wormff sic zuln Versand fert ig sind. S.
Eine Wasserstoffernleitung. Der Luftsehiffhafen in Frankfur t a. M. unterseheidet sich hiusiehtlieh der Gas- versorgung wesentlieh yon allen antteren Einriehtungen dieser Art. D~s zum Fiillen der Luftsehiffe nStige Wasserstoffgas wird hier n~mlieh mit Hilfe einer Fern- Ieitung, die wohl die erste ihrer Ar t in Deutschland ist, yon der Chemischen Fabrik Griesheim-Elektron aus nach :l~rankfurt geleitet. Die Leitung hat eine L~nge yon 4½ km und wurde, um Gasverluste infotge yon undichten :Rohrverbindungen zu vermeiden, fast in ihrer ganzen Lbnge autogen gesehweif~t; nur in grbBeren Abst~tnden sin4 die Rohre durch Muffen verbunden. Sie sind so be- messen, dab tItglich bequem 1000 cbm Gas durchgeleitet werden kbnnen, wobei ein Druck yon etwa 1000 mm Wassers~ule zur Anwendung gelangt. Die Leitung endet im Luftschiffh~fen in einen 6000 cbm fassenden Gas- behAlter. Von da gelangt das Gas in unterirdischen Leitnngen in die Halle, in deren Zementboden sich 18 Sch~chte mit Gasentnabmestellen befinden, die dutch Schlguehe mit den einzelnen Gaszellen des Luftschiffes verbunden werden. Der Wasserstoff entsteht in Gries~ helm als Nebenprodukt bei der elektrochemischen Her- stellung yon £ tznat ron und Chlor aus Kochsalz, und

344
zwar in solch groBen Mengcn, [1~1.~ am~h heate noah trogz des gestiegenen Verbrauches ein grolJcr Tell des Gases ungenutzt in die Luft entweicht. Die drei Werke der genannten Fabrik in Griesheim, Bittergeld and Bhein- felden erzeugen t:,tglieh 18 000--20 000 ebm Wasserstogf, eine lVIenge, die ausreiehen wfirde, um tgglieh ein Zeppelin-Lugtsehiff friseh zu ffillen. S.
Lrber die zerst6rcndv Einwirkung yon Kanalgasen auf Zementkonstrukt ionen beriehten W. M. Barr und R. E. Buch a,nar~ in dem Bulletin Nr. 26 des Iowa State E~gineering. Die Zementbedaehung yon Kanalisations- kammera zeigt sieh 5fters zerfressen, wobei freie Schwefeb s~ture und Kristalle yon Caleiumsulgat gebildet werden. Die Schwefelsaure ist hierbei wahrseheinlich dutch Oxy- dation des yon den organisehen Stogfen in der Kammer entwickelten Schwefelwasserstofgs entstanden, tier sich in solchen Kammern stets in groger Menge vorfand. Die starke Entwicklung dieses Gases ffihren Barr and B~whana~ darauf zurtiek, da~l das Spfilwasser in den 1.~ammern reich an Sulgaten war und diese dutch spi.. rillum desulphuricans und andere anSrobe Bakterieu in Sulfide umgewandelt warden, so dug die Bitdung des den Zement zerstSrenden Schwefelwassersioffs ermSg- lieht wurde. (E~tgincefing 95, 90, 1913.) Mlc.
Gefahren der drahtlosen Telegraphie. A. H. Taylor teilt in Eleelriccd World (New York) veto 15. Februar mit, dug in einer Lieht- and Kragtanlage dureh das Aug- treggen elektrischer Welten Resonanzerseheinungen auf- traten, die im Schmelzen mehrerer Sicheruugen, Durch- brennen mehrerer Wolframl'unpen uud dent Aulassen zweier Motoren sigh zeigten. Eine Ver'~nderung der WellenI~inge oder eine Verstimmung der Sehwingungs- zahl des Lieht- and Kragtnetzes vermied die Sti~rnng, Die Wellenl~nge war 245 m. Taylor kommt zu folgendeu Ilatsehl~igen: 1. Letter in tier N~ihe vort drahtlosen Sta- tionen miissen aug gef~thrliehe l)berspannnngen unter- snGht warden. 2. Isolierte 1)riLhte fiber der Erda kSnneu aug kurze Empfanger in ihrer Nithe giinstig wirken. 3. In einem Gebitude mit geerdeten Anlageu (Gas, Wasser, Dampfheizung) stelte man den Empf~hlger m6g- liehst in den oberen Stockwerken aid. 1,'. L.
Von der im September 1912 in New York abge~ h~ltenen Versammhmg des Internatiomden Verbandes fiir Materialprfifungen hut E. G. Colcer eine interessante Anwendung seines in IIeft 4 dieser Zeitsehrift be- sehriebenen optisehen Verfahrens zur Best immung der inneren Spannungen in eiuem ~D~terial vorgefiihrt. Er bildete die ffir Festigkeitspriigungen des Zements fib ~ liehe Form in Zelluloid n~ch und spannte aliases Modell iu der bet Zerreigversuehen angewendetcn Weise ein. Die hierdureh erzeugten Spanmmgen vera.ulasscI~ l.)oppelbrechung des Materials, die slch mit l[ilfe op- fischer Einrichtungen in einem System ~rb iger BSnder kundtut. Das Bild des Modells mit diesen BSndern hat 6'oker in farbige~l Photographien wiedergegeben and ge- zeigt, wig m;m aus diesen die Lage der Spannungen wie auch ihre GrSBe quantitativ ermittetn k~nn. (Engl- neerb~g 94, 824, 1912.) Mk.
Ein bisher anbekanntes Gas yon dem Atomgewicht 8 l~ t anscheinend J. J. ~'homson. entdeckt. Die Methode, d e r e r sich hierzu bedien~e, beruht auf der Anwendung der yon Goldsteia entdeekten Kanalstrahlen. Das naeh dieser Methode zu untersuehende Gasgemiseh be- finder sieh in einem Glasgef'Xg, d~s eine durchlScherte Kathode besitzt. Yon dieser Kathode ffihrt eine auf]er~ ordentlich geine I~Shre die positiv elektriseh getadenen
Kleine Mit tc i lungen. [ Die Na~t~r- [wissenseb,fften
T,,ilchen (l,[aJml~ir~hh,n) im('h einem amleren Tell des Glasgefiil3es, we sie zugleich den Wirkungen eines elek- trischen und eines magnetischen Feldes ausgesetzt werden. Solange die beiden Felder abgestellt sind, treffen die durch die feine RShre mit grol3er Geschwin- digkeit stfirzenden Teilehen s~tmtlich aug einen zentralen Fleck der gegeniiberliegenden Wand des Apparates. Durch Bet~tigung der Felder werden die Teitchen abet naeh zwei zueinander senkreehten Richtungen abgelenkt, wobei die Ablenkung je nach dem Verh~ltnis m/e zwi- sehen tier Masse m u n d der elektrischen Ladung der Teilchen e verschieden ist. Alle Teilchen mit gleicher Masse, abet verscMedener Geschwindigkeit, liegen dabei auf einer und derselben p~rabolisehen B~hn, so daft jede.~ Element des Gasgemisehes seine eigene Par~bel beim Auf- tregfen aug die Wand des Apparates erzeugt, die dureh einen entsprechend pr~tparierten Schirm gebildet wird. Die Anzahl der aug diesem Schirm durch photographische Wirkung entstehenden Parabeln entspricht der Anzahl der versehiedenen in dam Gasgemiseh vorhandenen Par- tiketarten. Aus der Form der Parabel liiBt sicb das Atomgewieht der Substanz ermitteln, uud die zur Aa- wendung dieser Methode erforderliche Menge ist so ga- ting, dab man mit 0,0l mg Substanz noch 1 Prozent Genauigkeit erzielen kann. Auch ist Reinheit der Sub- stanz nicht erforderlich, da die Partikelchen nach dieser Methode ausgesiebt warden. Dieses Vergahren hat Thomsot~ aug die seltenen Gase der Atmosph'~re ange- wandt, die er als Rfiekst:,inde der flfissigen t u f t yon J. De,war in zwei Teilen yon verschiedenem spezigischem Gewichte erhalten hatte. Der schwerere Tell enthielt nur die Guse yon bekannten Elementen: ttg, Xe, Kr, A and Ne. Der leichtere Tell dagegen ~utter Quecksilber, Luft, Argon und Neon oberhalb der Neonkurve eine ]Ante fiir das Atomgewicht 22, die mSglicherweise ether Verbindung you ]t~ und Ne entspricht. Ebenso wurde wiederholt eine Linie ffir d~s Atomgewicht 6 festgestellt, die vMleicht auf eine Verbindung I~elI~ gedeutet warden kanu. Bet seinen Forschungen nach uz~bekannten Gasen entdeckte T]~o,mson aueh eta Gas mit dem Atomgewicht 3, das eta Analog'on des Wasserstogfs zum Ozon, also eiT~ ]1~ sein k' tnn; im Gegensatz zum Ozou ist es ~ber durch- ~tus in~ktiv. ])ieses Gas erhielt Thomson durch Born- bardiereu yon Metallen, wie Eisen, Kupger, Nickeloxyd, mit K~thodenstrnhlen. Diese Stoffe g~ben da.s neue G~s nut ~lneh soleher Behandlung ab, wShrend sie amtere Gase beim Erhitzen schon entwickelten. Auch die Heliumlinie t ra t hierbei auf, doch t ra t sic hie bet einem zweiten Bombardement des Metalles au[, w~ihrend die Liuie 3 naeh einem 20-st(indigen Bombardemeat uud naeh Entgernen des entwickelten Ga.ses von Jtenem er- sehien. Auch eine Probe Blei veto ])ache tier Trini ty College Ch~H)el in Cambridge ergab dieses neue Gas, we- bet TItoltt.8o~b den Eindruck gewann, ~]s ob es nieht iu dem ~et~ll auggespeichert, sondern erst durch die Be- handlung erzeugt worden set, wie Ozon m~s Sauerstoff dutch stille elektrische Entladungen. Sollte es sich hier- bet am ein neues Element handeln, so wtirde es im periodisehen System sich zum Fluor gesellen. Da der vorhandene Vorr~t niGht mehr ats 1 cbmm betritgt, so konnte ein Spektrum davon bisher nicht aufgenommen werden. - - Bet der vor zwei Jt~hren zum ersten MM er- folgten Vorffihrung dieser ?¢iethode in der Iloyal Insti- tut ion zu London sagte J. J. Thomson, dub er nur mi t Angst sieh an ein ehemisehes Problem wage; denn die Chemiker seien strei tbare Mitnner, aber seine Waifen seien Gesehosse, die in der Sekunde mit tausend Meilen Gesehwindigkeit dutch den ]gmml flSgen. (Engineering 95, 126, 1913.) Mle.
Ffir die l~edaktion verantwortlieh: Dr. Arnold Berliner, tlerlln W. 9.