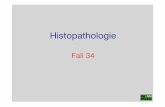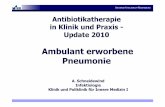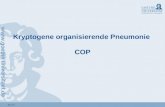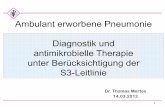Einfacher Husten oder gefährliche Pneumonie?
Transcript of Einfacher Husten oder gefährliche Pneumonie?

ZERTIFIZIERTE FORTBILDUNG_FOLGE 419
Die ambulant erworbene Pneumonie
Einfacher Husten oder gefährliche Pneumonie?
Prof. Dr. med. Johannes BognerSektion Klinische Infektiologie, Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Klinikum der Universität München
Koautor: Prof. Dr. med. Adrian Gillissen, Klinik für Lungen- und Bronchialmedizin, Klinikum Kassel
In Zusammenarbeit mit der In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesärztekammer
Teilnahme unter www.springermedizin.de/kurse-mmw
©A
OK-
Med
iend
iens
t
Erkältungskrankheiten mit Husten sind häu� g, die ambulant erworbene Pneumonie auch. Bevor Sie Entwarnung geben können, ist eine Reihe von einfachen diagnostischen Schritten not-wendig. Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie und wann Sie die Diagnostik eskalieren sollten.
−Die ambulant erworbene Pneumonie (community acquired pneumonia, auch im deutschen Sprachgebrauch inzwi-schen als CAP bekannt) gehört nach wie vor zu den häu� gsten gefährlichen In-fektionskrankheiten in Deutschland. Sie tritt nicht nur in den kalten Monaten auf und wird bezüglich ihrer Häu� gkeit o� unterschätzt: Derzeit liegt die Inzidenz bei etwa einer halben Million Fällen pro Jahr [1].
Der Arzt in der Praxis entscheidet, ob eine Pneumonie rasch erkannt und richtig behandelt wird. Es gibt in Deutschland zwar eine hervorragende Leitlinie, die Vieles zu Diagnostik und � erapie vorschlägt und vorgibt [2]. Dennoch bleibt die Vorgehensweise und � erapieauswahl ein individuell abzustimmendes Procedere, das Risi-kofaktoren, Spezialanamnese und indi-viduelle Voraussetzungen für die � e-rapie zu berücksichtigen hat. Darüber hinaus ist die seit 2009 bekannte Leitli-nie inzwischen von etlichen neuen Er-
kenntnissen � ankiert, die ebenfalls für die Praxis von Bedeutung sind.
DiagnostikAnamneseVereinfacht könnte man sagen: Neu aufgetretener Husten gepaart mit Fie-ber und Dyspnoe ist bis zum Beweis des Gegenteils ein Hinweis auf eine CAP. Die weitere anamnestische Unterglie-derung des Symptoms „Husten“ mit den Fragen nach Auswurf, Hustenatta-cken und Auslösesituationen sowie nach der zeitlichen Dynamik und even-tuellen Prädispositionen (Exposition gegenüber Kälte, Staub, Rauch) kann helfen, zwischen „typischer“ und „aty-pischer“ Pneumonie zu di� erenzieren, wobei letztlich erst durch einen Erre-gernachweis der sicherere Nachweis ge-führt werden kann.
Die Frage nach Ansteckungsquellen in der privaten und beru� ichen Umge-bung ist ebenfalls entscheidend (Tab. 1). Ein Bericht über erkrankte Kinder und
Jugendliche im Umfeld des Patienten oder über den Aufenthalt in Ländern mit anderen Häu� gkeiten von resisten-ten Keimen (Fernreisen, Reisen nach Südeuropa) kann den Verdacht in Rich-tung Mykoplasmenpneumonie, Chla-mydienpneumonie, Legionellenerkran-kung und CAP durch resistente Pneu-mokokken lenken. Dass die Mykoplas-meninfektion nicht immer nur als
„leichte“ Pneumonie aufgefasst werden darf, zeigt eine neuere Arbeit aus Japan,
Die Auskultation der Lunge – wichtig, aber für den Ausschluss oder den Nach-weis einer CAP nicht geeignet.
52 MMW-Fortschr. Med. 2014; 156 (18)

FORTBILDUNG_ÜBERSICHT
die belegt, dass diese Form der Pneumo-nie auch zu sehr schweren Verläufen und Todesfällen führen kann. Die Risikofak-toren hierfür scheinen eine nicht für Mykoplasmen geeignete antibiotische Initialtherapie und die vorhergehende Applikation von Steroiden zu sein [3].
Besondere Erreger gibt es auch in DeutschlandAuch hierzulande sind Regionen und Si-tuationen bekannt, die zu einer Infek tion mit besonderen Erregern führen. Im Um-kreis von mehreren Kilometern von Schaf- und Ziegenherden sind immer wieder Coxiellen-Erkrankungen (Q-Fie-ber) zu beobachten. Eine Auswertung der CAPNETZ-Daten ergab, dass in den Sommermonaten der Anteil der Coxiel-len am Erregerspektrum der CAP bis zu 3,5% betragen kann. Aus diesem Grund sollten entsprechende anamnestische Fragen und diagnostische Schritte be-dacht werden. Bei der Verwendung eines Makrolidantibiotikums oder von Moxi-� oxacin im Behandlungsschema der CAP ist die Wirkung auch gegen Coxiellen ge-währleistet [1]. Ein weiteres Beispiel ist die Legionellen-Pneumonie, die auch nach einheimischer Exposition au� reten kann, und sei es nur nach der Reinigung des Filters eines Lu� befeuchters.
Darüber hinaus ist die Frage nach Ri-sikokontakten für den Erwerb einer HIV-Infektion notwendig. Wichtig ist auch, dass die Immunsuppression unter der Behandlung von rheumatischen Er-krankung so ausgeprägt sein kann, dass eine Pneumocystis-Pneumonie au� ritt.
Neueste Ergebnisse bestätigen die Hypothese, dass Rauchen für CAP prä-disponiert, besonders für die Legionel-lenpneumonie [4]. Ein Vitamin-D-Man-gel ist ein weiterer, an dieser Stelle zu nennender Risikofaktor [5].
Klinische UntersuchungZur klinischen Untersuchung gehört die Erhebung der fünf Vitalparameter Puls, Blutdruck, Atemfrequenz, Temperatur und Bewusstseinslage. Häu� g wird lei-der die Atemfrequenz nicht gemessen oder dokumentiert, obwohl sie einen wichtigen Prädiktor für den weiteren Er-krankungsverlauf darstellt.
Ersatzweise kann auch die Sauer sto� -(O2-)sättigung gemessen werden. Dass dies auch von prognostischer Bedeutung ist, wurde in einer neuen Arbeit gezeigt, die einen Risikoscore „CORB75“ (con-fusion, O2-Sättigung, Atemfrequenz, Blutdruck und Alter > 75) in Anlehnung zum bewährten CRB-65 Score unter-sucht hat. Sie kam zu dem Ergebnis, dass gerade bei älteren Menschen die Pro-gnose des Kurzzeitüberlebens durch die initiale Berücksichtigung der O2-Sätti-gung noch verbessert werden kann [6].
Leider hat die Auskultation der Lunge eine niedrige diagnostische Sensitivität (47–69%) und Spezi� tät (58–75%) [7]. Von Experten, und auch in der CAP-Leit-linie, wird aber auf den hohen negativ prädiktiven Wert hingewiesen [2]. Dem-nach würde das Fehlen von Rasselge-räuschen das Vorliegen einer Pneumonie relativ unwahrscheinlich machen [8]. Andererseits ist bei der atypischen Pneu-monie, z. B. durch atypische Erreger (My-koplasmen, Chlamy dien, Legionellen, Pneumozysten), selbst bei einer deutli-
Tabelle 1
Di� erenzialdiagnostische Überlegungen zu Anamnese, Herkunft und Exposition
Anamnese Hinweis auf Art der Pneumonie bzw. des Erregers
Haustier: Vogel Chlamydia psittaci (Psittakose)
Schaf- oder Ziegenherde (Radius 5 km); betro� ene Rinderbestände
Coxiella burnetii (Q-Fieber-Pneumonie)
Reisen allgemein, marodes Warm-wassersystem in alten Häusern
Legionella pneumophila (Legionellenpneumonie)
Fernreisen; Reisen in Tuberkulose-Prävalenz gebiete
Erreger- und Resistenzspektrum des Reise-lands ins Kalkül ziehen; Tuberkulose (bei Ex-position minimal acht Wochen zuvor)
Reisen nach Frankreich, Spanien Penizillinresistente Pneumokokken
Reisen in Länder mit hoher Prävalenz multiresistenter Erreger (z. B. Grie-chenland)
Multiresistente Krankenhauserreger inkl. Methicillin-resistente Stahylococcus-aureus-Stämme (MRSA), Extended-Spectrum-Beta-lactamase bildende und Carbapenem-resi-stente Keime
Reisen nach Mittelamerika, USA mitt-lerer Westen, Südamerika (Fleder-maus-Höhlen)
Histoplasmen-Pneumonitis
Schluckstörung, z. B. bei Z. n. apoplek-tischem Insult und anderen neurologi-schen Erkrankungen
Abszedierende Pneumonie; Anaerobier des Mund- und Rachenraumes
Alkoholismus Legionellen; abszedierende Pneumonie bei Aspiration/Mikroaspiration
Immundefekte incl. Steroidtherapie Atypische Keime, bei T- Zelldefekt auch an Pneumocystose denken! Aspergillose
Antibiotische Vorbehandlung/Kranken-hausaufenthalt in den letzten zwölf Monaten; P� egeheim; höheres Alter
Höhere Wahrscheinlichkeit von resistenten Erregern und höherer Anteil gramnegativer Enterobakterien
COPD/Bronchiektasen Pseudomonas, Staphylokokken
Einschmelzung im Röntgen Aspiration: Abszess; Staphylokokken, communitiy-acquired MRSA, Tuberkulose, Aspergillom
MMW-Fortschr. Med. 2014; 156 (18) 53

FORTBILDUNG_ÜBERSICHT
chen respiratorischen Insu� zienz nicht primär mit Rasselgeräuschen zu rechnen.
Aus den Ergebnissen der körperli-chen Untersuchung kann der CRB-65-Score (C = Confusion, Verwirrtheit; R = respiratory rate, Atemfrequenz; B = Blutdruck; 65 = Alter ≥ 65 Jahre) schnell und unkompliziert errechnet werden. Nach wie vor erlaubt er die schnellste Strati� zierung in leichte und schwere Pneumonien. Die einfachen CRB-65-Scorewerte (Tab. 2) haben eine hohe Aussagekra� hinsichtlich der Wahr-scheinlichkeit, an der Pneumonie zu versterben [12] und können als Basis he-rangezogen werden, wenn es um die Fra-ge stationäre Einweisung oder ambulan-tes Management geht [13].
Labordiagnostik und BiomarkerDie Rolle der Entzündungsparameter im Blut ist bei der Pneumonie von der Ge-samtsituation und von der Frage der Komorbidität eigentlich unabhängig.
Dennoch wird vor allem für Patienten mit Begleiterkrankungen eine Labordia-gnostik empfohlen. In Zeiten einer er-höhter In� uenzaaktivität hil� o� das Di� erenzialblutbild zusammen mit dem CRP-Wert zu entscheiden, ob eher eine virale oder eine bakterielle Erkrankung vorliegt.
Eine Reihe von Studien hat nachge-wiesen, dass die Bestimmung des Pro-calcitonin-(PCT-)Spiegels für die Ent-scheidung „bakterielle Pneumonie“ ver-sus „nicht antibiotisch behandlungsbe-dür� ige Erkrankung“ wertvoll ist. Je-doch ist dieser prognostische Marker nach wie vor teuer und nicht ubiquitär und am ehesten noch in Notaufnahmen und Notfallpraxen verfügbar.
Neben dem CRB-65-Score besitzen o� ensichtlich auch einige Labormarker eine gewisse prognostische Aussage-kra� . Ein Beispiel hierfür ist das lösliche � rombomodulin (sTM), das in einer Studie mit den Indizes CURB-65 (=CRB plus urea, Serumharnsto� ), CRP und PCT verglichen wurde. sTM und der komplexe Pneumonia Severity Index-Score (PSI) waren unabhängige Prädik-toren der 30-Tage-Letalität. Die Genau-igkeit von sTM alleine war etwa so hoch wie die des PSI-Scores [14].
In� ammatorische Marker sind des-halb relevant, weil bei schwerer CAP hö-here systemische Entzündungsreaktio-nen au� reten [15]. Eine Verbesserung der Prognose-Einschätzung kann auch durch die Kombination des PSI mit dem Marker pro-Adrenomedullin erreicht werden. Eine Übersicht über die neues-ten Studien zu prognostischen Markern bei der CAP verö� entlichten vor Kur-zem Schuetz et al. [16]. Interessant ist die Beobachtung, dass das D-Dimer eine bessere Prognose quoad vitam ermögli-chen kann als die Risikoscores [17].
Bildgebende DiagnostikWann immer möglich, emp� ehlt die CAP-Leitlinie die Durchführung eines Röntgen-� orax zur Diagnosesicherung einer Pneumonie, respektive zum Aus-schluss derselben bei klinischem Zweifel [9, 10, 18]. Begleiterkrankungen sind für weitere di� erenzialdiagnostische Erwä-gungen relevant (kardiale Dekompensa-
tion bei Herzinsu� zienz, COPD-Exa-zerbation, Ausschluss Pneumothorax). Bei Vorliegen eines pneumonischen In-� ltrats im Zusammenhang mit der typi-schen Symptomatik einer Pneumonie kann die Pneumoniediagnose als gesi-chert angesehen werden. Eine schwere Pneumonie liegt vor, wenn mehr als ein Lungenlappen durch das In� ltrat betrof-fen ist.
In einigen Fällen ist eine weitergehen-de Bildgebung wie z. B. eine Schnittbild-gebung (Computertomogramm) zur dif-ferenzialdiagnostischen Abklärung und Ursachen� ndung erforderlich. Von der Art der radiologischen Veränderungen kann jedoch keinesfalls auf den Erreger geschlossen werden [19]. Dies verdeutli-chen die Abbildungen 1–3, die einige Fälle von radiologischen Pneumonie-diagnosen zeigen.
Mikrobiologische DiagnostikIm ambulanten Bereich wird von der CAP-Leitlinie eine Sputumdiagnostik nur in Sondersituationen empfohlen (Re-zidiv, Komorbidität, antibiotische Vorbe-handlung etc.). Cave: Die Unterscheidung zwischen kolonisierenden und pathoge-nen Pneumokokken ist nicht trivial und manchmal nur unter Zuhilfenahme von Biomarkern möglich [20].
Wenn man sich für eine Sputumdia-gnostik entscheidet, sollten einige übli-che Regeln der Präanalytik und Analy-tik beachtet werden. Nur die korrekte Abnahme (Mund vorher ausspülen; nicht „Spucke“ sondern wirklich nur hochgehustetes Material abgeben), die rasche (innerhalb von max. 2 h) und am besten gekühlte (innerhalb von max. 4 h) Weiterleitung und die Entscheidung über die Kultur versus Nicht-Kultur an-hand des zuvor anzufertigenden Gram-präparats führen zu einem verwertbaren Ergebnis.
Aus der Sputumfarbe kann man nicht auf „viral“ oder „bakteriell“ bedingte Pneumonie schließen. Dennoch hält sich die Meinung, gelbes oder grünes Sputum sei gleichbedeutend mit der In-dikation zur antibiotischen � erapie. Dabei kommt z. B. die Farbe „gelb“ auch bei der granulozytären Abräumreaktion bei einer Virusinfektion zustande.
Tabelle 2
Der CRB-65-Score
Verwirrung j/n
Atemfrequenz ≥ 30/min j/n
Blutdrucksystolisch < 90 mmHg oder diastolisch ≤ 60 mmHg
j/n
Alter ≥ 65 Jahre j/n
CRB-65-Score = Zahl der mit Ja-Antworten. Bei einem Score von 0 ist im Allgemeinen eine ambulante Behandlung gerechtfertigt.
©M
od. n
. [13
]
Abb. 1 Bronchopneumonie (Erreger: Haemophilus pneumoniae).
©Bo
gner
/Gill
isse
n
54 MMW-Fortschr. Med. 2014; 156 (18)

FORTBILDUNG_ÜBERSICHT
Therapie der CAPDie CAP-Diagnose umfasst mehrere Krankheiten, die pathogenetisch und ätiologisch deutliche Unterschiede auf-weisen. Gemeinsam ist allen CAPs, dass es sich um eine durch Mikroben ausge-löste Infektion mit In� ammation des Lungenparenchyms handelt. Die Hete-rogenität des Krankheitsbilds legt nahe, dass für die korrekte Behandlung nicht nur das Befolgen einer einheitlichen Leitlinienempfehlung entscheidend ist, sondern auch die Hypothese zur Patho-genese und Erregerätiologie im Einzel-fall berücksichtigt werden muss.
Man könnte sagen: „Die Standardbe-handlung nach Leitlinie bedarf einer klugen Anpassung anhand eigener Überlegungen im Einzelfall“. Die Be-handlungssicherheit durch Anwendung der in der Leitlinie vorgeschlagenen � e-rapeutika ist hoch. Das sollte jedoch nicht dazu führen, dass man eigene Überlegungen zur Pathogenese im indi-viduellen Fall unterlässt.
Die � erapie der CAP erfolgt weitge-hend nach den Prinzipien der kalku-lierten antimikrobiellen/antibiotischen � erapie [2, 13, 21, 22]. Für Patienten in der Praxis ist zunächst zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für eine ambu-lante � erapie gegeben sind und ob die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die orale Einnahme von Antibiotika mit der nötigen Adhärenz erfolgen wird. Da-rüber hinaus hängt die Entscheidung über die Möglichkeit der ambulanten Behandlung von der Möglichkeit ab, den Patienten kurzfristig im Verlauf ambu-lant zu kontrollieren.
Da es sich bei der CAP um eine po-tenziell tödliche Erkrankung handelt, ist insbesondere bei Risikopatienten ra-sches Handeln und eine möglichst schnelle � erapieeinleitung erforderlich. Auf die mikrobiologischen Ergebnisse kann und darf hier nicht gewartet wer-den, bis die � erapie beginnt, da jede Verzögerung des Behandlungsbeginns die Letalität erhöht. In zahlreichen Pneumoniestudien wurde gezeigt, dass die Letalität eine Funktion der Zeit ist, die von der ersten Vorstellung beim Arzt bis zur ersten Antibiotikagabe ver-streicht.
Ambulante Behandlung mit oralen AntibiotikaGrundsätzlich eignen sich nach zahlrei-chen Pneumoniestudien für die Behand-lung der Pneumonien die Betalaktam-antibiotika (Penizilline, Cephalosporine, Carbapeneme), Makrolidantibiotika (Clartithromycin, Roxithromycin, Azi-thromycin), Quinolone der Gruppen 3 und 4 (Moxi� oxacin, Levo� oxacin, kei-nesfalls jedoch Cipro� oxacin oder O� o-xacin) und Doxycyclin (nur bei Patien-ten ohne Risikofaktoren). Zunächst ist jedoch festzulegen, ob Risikofaktoren aus den Diagnosegruppen Herzinsu� -zienz, Leberinsu� zienz, Niereninsu� -zienz, neurologische Störungen und Vorerkrankungen der Lunge vorliegen. Auch alle Formen des angeborenen und erworbenen Immundefekts stellen Risi-kofaktoren dar.
Nur bei Pa tienten ohne Vorerkran-kungen und mit einem CRB-65 Score von 0 kann vom Fehlen aller Risiken ausgegangen werden. Hier schlägt die Leit linie eine � erapie mit Amoxicillin, einem Makrolidantibiotikum oder Doxycyclin vor. Bei Patienten mit Begleit-erkrankungen werden im Fall der ambu-lanten Behandlung aus der Gruppe der Betalaktame Amoxicillin zusammen mit einem Betalaktamaseinhibitor oder Qui-nolone (Moxi� oxacin, Levo� oxacin) empfohlen.
Wichtig für die ambulante Situation: gute orale VerfügbarkeitAntibiotika mit guter oraler Bioverfüg-barkeit sind die Voraussetzung für die ambulante und orale � erapie. Mit Aus-nahme mancher oralen Cephalosporine ist die Resorption bei den in der Leitlinie genannten Medikamenten gut (Tab. 3). Explizit soll hier darauf hingewiesen wer-den, dass weder für die unkomplizierte CAP noch für die CAP mit Risikofakto-ren in der Leitlinie der Einsatz von oralen Cephalosporinen empfohlen wird. Insbe-sondere das in der Praxis häu� g verwen-dete Cefuroxim-Axetil weist eine für die Behandlung einer so schweren Infektion wie einer CAP ungenügende Bioverfüg-barkeit auf. Beim Einsatz von Makroliden muss berücksichtigt werden, dass für Haemophilus und Pneumokokken teils
erhebliche Resistenzraten (bis 20%) be-schrieben sind. Bei diesen Erregern muss ein � erapieversagen befürchtet werden, wenn mit einem Makrolid oder mit Tetra zyklin alleine therapiert wird. Die Wirkung der Betalaktame andererseits erstreckt sich nicht auf die intrazellulären Erreger wie Mykoplasmen, Chlamydien und Legionellen. Bei jüngeren Patienten mit Hinweisen auf die Möglichkeit einer CAP durch atypische Erreger wie Myko-plasmen stellen Makrolide neben Doxy-cyclin eine sinnvolle Alternative dar.
Stationäre AntibiotikatherapieFür Patienten, die stationär eingewiesen werden (müssen), gilt, dass eine intra-venöse Gabe am Beginn der Behandlung steht, zumindest, bis es in den ersten Be-handlungstagen zu einer deutlichen kli-nischen Besserung gekommen ist. Hier
Abb. 2 Lobärpneumonie. Erregernach-weis aus der Blutkultur: Pneumokokken.
©Bo
gner
/Gill
isse
n
Abb. 3 Schwere atypische Pneumonie mit respiratorischer Insu� zienz. Obwohl wenig In� ltrat zu sehen ist: Es wurde eine voll ausgeprägte Pneumocysten-pneumonie nachgewiesen.
©Bo
gner
/Gill
isse
n
MMW-Fortschr. Med. 2014; 156 (18) 55

FORTBILDUNG_ÜBERSICHT
sind in der Liste der empfohlenen Anti-biotika neben Penicillinen auch Cepha-losporine jeweils in Kombination mit ei-nem Makrolid vorgesehen. In einer Me-taanalyse wurde gezeigt, dass die Kom-bination eines Betalaktams mit einem Makrolid gegenüber der Betalaktam-Monotherapie vorteilha� ist [23]. Dies konnte auch für auf der Intensivstation behandelte CAP-Patienten nachgewie-sen werden [24], allerdings sind alle Stu-dien zu diesem � ema retrospektiv.
Da in einigen Studien auch ein positi-ver E� ekt der Makrolide nachzuweisen war, obwohl die Pneumonieerreger nicht auf Makrolide emp� ndlich waren, wurde als Erklärung ein immunmodulatori-scher E� ekt von Makrolidantibiotika postuliert. Dieser Punkt ist weiter strittig. Eine neuere Arbeit fand z. B. bei Pneumo-nien durch Pseudomonas, dass der posi-tive E� ekt von Makroliden auf die Schwe-re des Verlaufs, Intensivp� icht und Tod nicht nachweisbar war [25].
Neuere therapeutische Studien und Überlegungen kreisen um die Frage, ob die Behandlungsdauer, insbesondere bei stationären � erapie, modi� ziert oder weiter verkürzt werden kann. Auch wurde geprü� , ob die initiale Gabe von Steroiden über die Beein� us-sung einer eventuell überschießenden in� ammatorischen Reaktion am Lun-genparenchym für den Verlauf der Pneumonie hilfreich ist. Allerdings ist hierfür die Evidenz längst nicht ausrei-
chend, um den Einsatz bedenkenlos empfehlen zu können [26, 27, 28].
Neu zugelassene Antibiotika mit der Indikation Pneumonie sind alle für die intravenöse Anwendung und damit pri-mär für die stationäre Behandlung geeig-net. Ce� arolin und Cefditoren sind z. B. neue Cephalosporine, für die jeweils eine Nichtunterlegenheit gegenüber anderen, bereits für die CAP als Standard gelten-den Antibiotika gezeigt wurde [29, 30].
Verlaufskontrollen obligatEntscheidet man sich für die ambulante Behandlung einer Pneumonie, so soll nach zwei bis drei Tagen eine Verlaufs-untersuchung vorgenommen werden, bei der über das weitere Vorgehen ent-schieden werden muss. Die Rate des � erapieversagens bei ambulanter � e-rapie einer CAP ist mit 3–6% relativ ge-ring [31]. Als klinische Erfolgsparameter gelten die Ent� eberung und die Besse-rung der Atemfrequenz.
Die Dauer der ambulanten � erapie liegt je nach Vorliegen von Risikofakto-ren bei fünf bis sieben Tagen [13]. Beim Einsatz von Azithromycin werden die Tabletten zwar nur drei Tage lang einge-nommen, wegen der langen Halbwerts-zeit ist jedoch von einer einwöchigen Fortdauer der Wirkung auszugehen.
Bei der unkomplizierten Pneumonie ohne Risikofaktoren wird eine Ausdeh-nung der � erapiedauer auf mehr als sie-ben Tage nicht mehr empfohlen. Eine
Röntgen-Verlaufsuntersuchung sollte auf jeden Fall statt� nden, wenn Risiko-faktoren für eine Tumorerkrankung (Bronchialkarzinom) vorliegen. Sie soll-te aber frühestens zwei Wochen nach � erapieende durchgeführt werden [9].
Falls innerhalb von 72 Stunden kein Fieberrückgang und keine klinische Besserung eintritt, muss die Diagnose
„Pneumonie“ überprü� werden. Meis-tens wird man sich dann für eine statio-näre Einweisung entscheiden.
Literatur unter mmw.de
Für die Verfasser:Prof. Dr. med. Johannes BognerSektion Klinische InfektiologieMedizinische Klinik und Poliklinik IV, Klinikum der Universität München,Campus InnenstadtPettenkoferstr. 8aD-80336 MünchenE-Mail: [email protected]
Interessenkon� ikt: Die Autoren erklären, dass sie sich bei der Erstellung des Beitrages von keinen wirt-schaftlichen Interessen leiten ließen. Sie legen fol-gende potenzielle Interessenkon� ikte o� en: Honorare für Vortragstätigkeiten durch Bayer, Astel-las, AstraZeneca, Novartis und P� zer (Prof. J. Bogner); keine (Prof. A. Gillissen). Der Verlag erklärt, dass die inhaltliche Qualität des Beitrags von zwei unabhän-gigen Gutachtern geprüft wurde. Werbung in dieser Zeitschriftenausgabe hat keinen Bezug zur CME-Fortbildung. Der Verlag garantiert, dass die CME-Fortbildung sowie die CME-Fragen frei sind von werblichen Aussagen und keinerlei Produktempfeh-lungen enthalten. Dies gilt insbesondere für Präpara-te, die zur Therapie des dargestellten Krankheitsbildes geeignet sind.
Tabelle 3
Antibiotikaauswahl bei ambulanter CAP-Behandlung von Patientenmit Risikofaktoren im Sinn von Komorbidität
Substanzen Dosierung (pro Tag)* Therapiedauer
Mittel der Wahl
Betalaktame
Amoxicillin/Clavulansäure 2 x 875/125 mg oral 5–7 Tage
Sultamicillin 2 x 0,75 g oral 5–7 Tage
Alternative
Fluorchinolone**
Levo� oxacin 1 x 500 mg oral 5–7 Tage
Moxi� oxacin 1 x 400 mg oral 5–7 Tage
* Bei vorausgegangener Antibiotikatherapie wird ein Wechsel der zuletzt verwendeten Substanzklasse empfohlen.
** Bei Therapieversagen oder Unverträglichkeit der anderen Substanzen.
©M
od. n
. [13
]
Keywords
Community Acquired Pneumonia in general practice
CAP – pneumonia – antibiotic treatment – diagnosis
Fazit für die Praxis 1. Die ambulant erworbene Pneu-monie (CAP) ist eine häu� ge Erkran-kung, vorwiegend des fortgeschrit-tenen Alters.
2. Sie ist mit den derzeit zur Verfü-gung stehenden Antibiotika bei der aktuell in Deutschland gegebenen Resistenzsituation bei rechtzeitiger Diagnose gut behandelbar.
56 MMW-Fortschr. Med. 2014; 156 (18)

Welche Aussage zur ambulant erworbenen Pneumonie (CAP) trifft zu?⃞ Sie gehört zu den gefährlichsten Infek-
tionskrankheiten in Deutschland.⃞ Sie betrifft 10 000 Patienten pro Jahr.⃞ Sie wird in ihrer Bedeutung überschätzt.⃞ Sie ist ein typisches Problem der Winter-
monate.⃞ Die Diagnose wird vom Patienten gestellt.
Welche Aussage zur Diagnostik der ambulant erworbenen Pneumonie (CAP) trifft zu?⃞ Die klinische Trias „Husten, Fieber, Brust-
schmerz“ beweisen die Diagnose.⃞ Die Detektion der Ansteckungsquellen
spielt anamnestisch keine Rolle.⃞ Der Arzt sollte immer nach einem Aufent-
halt in fremden Ländern fragen.⃞ In der ambulanten Praxis sollte die Spu-
tumdiagnostik routinemäßig erfolgen.⃞ Die typische Verlaufsform der CAP lässt
sich von der atypischen Verlaufsform bereits anamnestisch eindeutig unter-scheiden.
Welche der anamestischen Informationen ist zu vernachlässigen?⃞ Erkrankte Angehörige (z. B. Kinder, Enkel).⃞ Dynamik des Hustens mit oder ohne
Auswurf.⃞ Exposition gegenüber Kälte, Staub und
Rauch.⃞ Alter des Patienten und Komorbiditäten.⃞ Anfallsweise Dyspnoe z. B. bei Belastung.
Welche anamnestische Angabe korreliert mit dem möglichen Erreger einer ambulant erworbenen Pneumonie (CAP)?⃞ Das Vorhandensein eines Vogels als Haus-
tier deutet auf eine Q-Fieber Pneumonie.⃞ Marode Wasserleitungen legen den Ver-
dacht auf eine Infektion mit Chlamydia psittaci nahe.
⃞ Eine Schaf- oder Ziegenexposition gibt einen Hinweis auf eine Coxiella-burnetii-Infektion.
⃞ Reisen durch Frankreich oder Spanien lassen eine gute Keimempfindlichkeit vermuten.
⃞ Bei einer CAP, die nach dem Reinigen von Luftbefeuchtern auftritt, kommt als Erreger typischerweise Staphylococcus aureus in Frage.
Welche Parameter gehören zum CRB-65-Score?⃞ Gangataxie, Kopfschmerz, Nackensteifig-
keit, Doppelbilder⃞ Blutdruck, Atemwegsobstruktion, Geh-
strecke > 65 Meter⃞ Geschlecht, Herzfrequenz, Atemfrequenz,
Ergebnis Lungenauskultation⃞ pO2 (arteriell), pCO2 (arteriell), Basen-
überschuss, O2-Sättigung⃞ Blutdruck, Atemfrequenz, Alter, Bewusst-
seinslage
Welche Aussage zur Röntgenaufnahme der Lunge trifft zu?⃞ Sie ist in der Diagnostik der ambulant er-
worbenen Pneumonie verzichtbar.⃞ Sie ist nur zur Abklärung eventueller
Differenzialdiagnosen indiziert.⃞ Die Thoraxsonografie ersetzt das Rönt-
gen-Thoraxbild.⃞ Zusammen mit typischen klinischen
Symptomen und positiven Entzündungs-zeichen beweist ein Infiltrat die ambulant erworbene Pneumonie.
⃞ Die Infiltratmorphologie lässt eindeutige Rückschlüsse auf den Erregertyp zu.
Welche Aussage zur Labordiagnostik und zu den Biomarkern bei einer ambulant erwor-benen Pneumonie (CAP) trifft zu?⃞ Die Bestimmung von Procalcitonin ist
billig und ubiquitär verfügbar.⃞ Thrombomodulin und der PSI-Score sind
keine Prädiktoren für die Vierteljahres-letalität.
⃞ D-Dimer-Wert hat quoad vitam im Gegensatz zu den Risikoscores keinen Prognosewert.
⃞ Der Procalcitoninwert hilft bei der Unter-scheidung zwischen viraler vs. bakterieller Infektion.
⃞ Die Pneumonie im Rahmen einer Influenza wird mittels D-Dimer diagnostiziert.
Welche Aussage zur mikrobiologischen Diagnostik der ambulant erworbenen Pneu-monie (CAP) trifft zu?⃞ Vor der Sputum-Diagnostik soll der Pa-
tient den Mund mit Wasser spülen.⃞ Bei jeder CAP sollte mittels Bronchosko-
pie ein Erregernachweis geführt werden.⃞ Spucke reicht für die bronchiale Erreger-
diagnostik aus.⃞ Die Biomarkerdiagnostik ersetzt die
Keimisolation aus dem Sputum.⃞ Erst das Ergebnis der Sputumdiagnosik
beweist eine CAP.
Welche Aussagen zur Therapie der ambulant erworbenen Pneumonie (CAP) trifft zu?⃞ Ein langsamer Therapiebeginn senkt die
Letalität.⃞ Doxycylin sollte nur Patienten mit Risiko-
faktoren verabreicht werden.⃞ Das Risikoprofil und die Resistenzlage be-
stimmen die Medikamentenselektion.⃞ Patienten ohne Komorbiditäten erhalten
Amoxicillin plus Betalaktamaseinhibitor oder Quinolone.
⃞ Makrolide sind bei Haemophilus- und Pneumokokken-CAP die Antibiotika der Wahl.
Welche Aussage zum Procedere nach Einlei-ten einer antibiotischen Therapie im ambu-lanten Bereich trifft zu?⃞ Eine Therapiedauer von drei Tagen reicht
bei den Standardmedikamenten aus.⃞ Azithromycin muss wegen seiner kurzen
Halbwertszeit 12–13 Tage gegeben werden.⃞ Sieben Tagen nach Therapiebeginn ist
eine erste Verlaufskontrolle sinnvoll.⃞ Die initiale Gabe von Steroiden kann
evidenzbasiert die Dauer der Antibiotika-therapie verkürzen.
⃞ Entfieberung und Besserung der Atem-frequenz sind Zeichen für einen einset-zenden Therapieerfolg.
Die ambulant erworbene Pneumonie
gültig bis 6.11.2014
FIN MM1418fS
Bitte beachten Sie:• Die Teilnahme ist nur online unter www.springermedizin.de/eAkademie möglich.• ausführliche Erläuterungen unter www.springermedizin.de/info-eakademie
Diese CME-Fortbildungseinheit ist von der Bayerischen Landes ärztekammer mit zwei Punkten in der Kategorie I zur zerti-fi zierten Fort bildung anerkannt.
MMW-Fortschr. Med. 2014; 156 (18) 57
springermedizin.de/eAkademie
DO
I 10.
1007
/s15
006-
014-
3296
-zCME-Fragebogen

Literatur
1. Gillissen A. Weißbuch Lunge. Frische Texte Verlag, Herne, 2014
2. Hö� ken G, Lorenz J et al. Epidemiologie, Diagnostik, antimikrobielle Therapie und Management von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbenen unteren Atem-wegsinfektionen sowie ambulant erworbe-ner Pneumonie – Update 2009. S3-Leitlinie der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemothe-rapie, der Deutschen Gesellschaft für Pneu-mologie und Beatmungsmedizin, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und vom Kompetenznetzwerk CAPNETZ. Pneumologie 2000;63(10):e1-68
3. Izumikawa K, Takazono T et al. Clinical fea-tures, risk factors and treatment of fulmi-nant Mycoplasma pneumoniae pneumonia: A review of the Japanese literature. J Infect Chemother 2014;20(3):181-185
4. Almirall J, Blanquer J et al. Community-ac-quired Pneumonia Among Smokers. Arch Bronconeumol 2013, 30 Dec.
5. Quraishi SA, Bittner EA et al. Vitamin D sta-tus and community-acquired pneumonia: results from the third National Health and Nutrition Examination Survey. PLoS One 2013;8(11):e81120
6. Ochoa-Gondar O, Vila-Corcoles A et al. Vali-dation of the CORB75 (confusion, oxygen sa-turation, respiratory rate, blood pressure, and age ≥75 years) as a simpler pneumonia severity rule. Infection 2014;2:371-378
7. Gillissen A, Reuner K. Basisdiagnostik der Pneumonie: Patient einweisen oder ambu-lant betreuen? MMW Fortschr Med 2010;152(45):35-37
8. Metlay JP, Kapoor WN et al. Does this patient have community-acquired pneumonia? Diagnosing pneumonia by history and physical examination. JAMA 1997;278(17):1440-1445
9. Heckerling PS. The need for chest roentge-nograms in adults with acute respiratory ill-ness. Clinical predictors. Arch Intern Med 1986;146(7):1321-1324
10. Emerman CL, Dawson N et al. Comparison of physician judgment and decision aids for or-dering chest radiographs for pneumonia in outpatients. Ann Emerg Med 1991;20(11):1215-1219
11. Wipf JE, Lipsky BA et al. Diagnosing pneu-monia by physical examination: relevant or relic? Arch Intern Med 1999;10:1082-1087
12. Ewig S, Birkner N et al. New perspectives on community-acquired pneumonia in 388 406 patients. Results from a nationwide mandatory performance measurement programme in healthcare quality. Thorax 2009;12:1062-1069
13. Hö� ken G, Lorenz J et al. Guidelines of the Paul-Ehrlich-Society of Chemotherapy, the German Respiratory Diseases Society, the German Infectious Diseases Society and of the Competence Network CAPNETZ for the Management of Lower Respiratory Tract Infections and Community-acquired Pneu-monia. Pneumologie 2010;3:149-154
14. Yin Q, Liu B et al. Soluble Thrombomodulin to Evaluate the Severity and Outcome of Community-Acquired Pneumonia. In� am-mation 2014.
15. Fernandez-Botran R, Uriarte SM et al. Cont-rasting In� ammatory Responses in Severe and Non-severe Community-acquired Pneu-monia. In� ammation 2014.
16. Schuetz P, Friedli N et al. E� ect of hypergly-caemia on in� ammatory and stress respon-ses and clinical outcome of pneumonia in non-critical-care inpatients: results from an observational cohort study. Diabetologia 2014;2:275-284
17. Nastasijevic Borovac D, Radjenovic Petkovic T et al. Role of D-dimer in predicting morta-lity in patients with community-acquired pneumonia. Med Glas (Zenica) 2014;1:37-43
18. Heckerling PS, Tape TG et al. Clinical predic-tion rule for pulmonary in� ltrates. Ann In-tern Med 1990;9:664-670
19. Erdem H, Kocak-Tufan Z et al. The interrela-tions of radiologic � ndings and mechanical ventilation in community acquired pneumo-nia patients admitted to the intensive care unit: a multicentre retrospective study. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2014;13(1):5
20. Song JY, Eun BW et al. Diagnosis of Pneumo-coccal Pneumonia: Current Pitfalls and the Way Forward. Infect Chemother 2013;4:351-366
21. Ewig S, Welte T et al. Rethinking the con-cepts of community-acquired and health-care-associated pneumonia. Lancet Infect Dis 2010;10(4):279-287
22. Gillissen A. Aktuelle Therapieempfehlungen zur ambulant erworbenen Pneumonie: Wie Sie die Leitlinien praktisch umsetzen. MMW Fortschr Med 2010;45:34
23. Nie W, Li B et al. Bbeta-Lactam/macrolide dual therapy versus beta-lactam monothe-rapy for the treatment of community-acqui-red pneumonia in adults: a systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Che-mother 2014.
24. Sligl WI et al. Macrolides and mortality in critically ill patients with community-acqui-red pneumonia:a systematic review and me-ta-analysis. Crit Care Med 2014;42:420–432
25. Laserna E et al. Impact of macrolide therapy in patients hospitalized with Pseudomonas aeruginosa community-acquired pneumo-nia. Chest 2014;5:1114-1120
26. Sibila O, Laserna E et al. E� ects of inhaled corticosteroids on pneumonia severity and antimicrobial resistance. Respir Care 2013;9:1489-1494
27. Sibila O, Restrepo MI. Corticosteroids for pneumonia: are we there yet? Respirology 2013;2:199-200
28. Sibila O, Restrepo MI et al. What is the best antimicrobial treatment for severe commu-nity-acquired pneumonia (including the role of steroids and statins and other immu-nomodulatory agents). Infect Dis Clin North Am 2013;1:133-147
29. Soriano F, Gimenez MJ et al. Cefditoren in upper and lower community-acquired respi-ratory tract infections. Drug Des Devel Ther 2011;5:85-94
30. Jandourek A, Smith A et al. E� cacy of cefta-roline fosamil for bacteremia associated with community-acquired bacterial pneu-monia. Hosp Pract 1995;1:75-78
31. Cilloniz C, Ewig S et al. Pulmonary complica-tions of pneumococcal community-acqui-red pneumonia: incidence, predictors, and
outcomes. Clin Microbiol Infect 2012;11:1134–1142