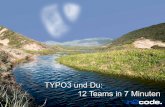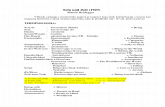ek3b0101
Transcript of ek3b0101

EMC KOMPENDIUM 2003108
Produkte & VerfahrenFilter & KomponentenB
Induktivitäten mit Ferritkern erreicht manWerte bis zu 150, bei SMD-Multilayer-Induk-tivitäten bis zu 60.
Über die Güte ist eine klare Unterscheidungzwischen EMV-Ferrit (Absorber) oder Induk-tivität (Bauteil geringer Verluste/ Energiespei-cher) möglich (Abb.2). Im Frequenzbereich miteiner Güte unter 3, liegt das Entstörbauteil vor.
Die untere Kurve zeigt einen EMV-Ferrit, derin diesem Beispiel von 20 MHz bis weit über1000 MHz absorbierend wirkt.
Die obere Kurve dagegen zeigt eine Induk-tivität, deren Kernmaterial so gewählt wurde,dass sie im Frequenzbereich von 20 MHz bis 200 MHz geringste Verluste aufweist, für z.B.HF-Empfangsstufen- hier soll das Eingangs-signal ja möglichst unbedämpft den HF-Ein-gangsverstärker erreichen.
Zur nachträglichen Entstörung auf Lei-tungen eignen sich besonders Klappferrite für Rundkabel oder Blockkerne für Flach-bandleitungen. Für die Printmontage gibt esz.B. 6-Lochferritperlen (UKW-Entstördros-sel), Hülsendrosseln oder Ferritbrücken. Ummöglichst störungsnah eine Filtermaßnahme zu platzieren, eignen sich besonders SMD-Ferrite.
Entwurfsregeln
Die EMV beginnt stets mit dem Entwurfder Schaltung und dem EMV-gerechten Leiterplattenlayout. Zahlreiche Tipps, prak-tisch erprobte Schaltungen, Layout- und Bauteileempfehlungen finden sich dazu in[1].
in der sogenannten Impedanzkurve (Abb. 1)dargestellt werden.
Designtipp 1: Bei leitungsgebundenen Störun-gen oberhalb einiger 10 MHz NiZn-Entstörfer-rite verwenden
Den Effekt des Absorbierens oder hoher Verlu-ste im Arbeitsfrequenzbereich lässt sich durchdie Güte Q beschreiben.
Mit Luftspulen sind Güten bis zu 400 erreich-bar (keine Verluste im Kernmaterial). Bei
nduktivitäten und EMV-Ferrite sindfür viele Entwickler ‚Kopfschmerz-
bauteile‘. Dies nicht zuletzt wegen dervielen Einzelparameter, die zum richti-gen Einsatz dieser Bauteile zu beachtensind. Dieser Fachbeitrag zeigt den Unter-schied zwischen EMV-Ferrit und Indukti-vität auf, gibt praktische Designtippsund Hinweise zur Bauteilauswahl.
EMV-Ferrite
Ferrite für EMV-Anwendungen basieren aufNickel-Zink als Kernmaterial. Das besondere an dieser Materialzusammensetzung ist, dasshier ab ca. 50 MHz aufwärts der Verlustanteil Rmaßgeblich die Impedanz bestimmt. Damitliegt ein Filterelement vor, welches ohne Mas-seanbindung das Störspektrum absorbiert –sprich in Wärmeleistung umsetzt.
Dieses Verhalten ist für alle EMV-Ferritegleich und kann durch geeignete Messverfahren
B.01
Abb. 1:
Impedanzkurve SMD-
Ferrit 742792034
Designtipps zur Einhaltung der EMV mitFerriten und InduktivitätenLeitfaden für wirkungsvolle EMV-Maßnahmen und zur Auswahl vonInduktivitäten und EMV-Ferriten
Autor
Dipl. Ing. ALEXANDER GERFER,
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co KG;
Max-Eyth-Straße 1, D-74638 Waldenburg
Fon: +49/7942/945-0, Fax: +49/7942/945-400
E-Mail: [email protected]
I
(1)

EMC KOMPENDIUM 2003 109
Produkte & VerfahrenFilter & Komponenten B
Designtipp 2: Die Anstiegsgeschwindigkeit der Signale bestimmt dasauftretende Störspektrum (Fourier !), (Daten, Spannungs- oderStromanstiegsgeschwindigkeit bei schnellen Schaltern) => begrenzenoder störungsnah filtern !
Sind Störungen im System vorhanden, muss Ursachenforschung be-trieben werden um die Quelle ausfindig zu machen. Dazu geeigneteHilfsmittel sind z.B. RF-Schmalbandempfänger mit Scan-Funktion,Spektrumanalysator mit RF-Sonde und natürlich das EMV-Labor.
Designtipp 3: Störquelle identifizieren, benötigte Einfügedämpfungmessen und störungsnah filtern bzw. an potenziellen Störquellen schonim Design Filtermaßnahmen vorsehen!
Ideale Bauteile zur störungsnahen Filterung sind SMD-Ferrite: Diesekönnen unmittelbar an z.B. IC-Pins positioniert werden. Dahersollten schon im Prototypenstadium entsprechende Löt-Pads fürSMD-Ferrite vorgesehen werden. Insbesondere der breitbandigenEntkopplung der Versorgungsspannung sollte besondere Aufmerk-samkeit geschenkt werden. Denn hierüber sind alle Stufen einesGerätes gemeinsam verbunden. Die typisch vorwendeten 100-nF-Stützkondensatoren sind keine wirksame oder gar breitbandige HF-Ent-kopplung! Dies wird erst durch den Einsatz von EMV-Ferriten erreicht.
Welche Ferritimpedanz wird benötigt?
Sind die Störquelle und der Störpfad identifiziert sowie der Störpegelbestimmt, so ist die gewünschte Filterdämpfung bekannt (Abstand zurGrenzwertkurve).
Es muss nun die geeignete Ferritimpedanz ZF gefunden werden, umden Störpegel entsprechend abzusenken. Dazu bedient man sich imersten Schritt der Einfügedämpfung. Abbildung 3 zeigt das Ersatz-schaltbild. Die Einfügedämpfung ist das Verhältnis der Störamplitudenvon unbefiltertem zu mit ZF befiltertem System der Quell- und Sen-kenimpedanzen ZA und ZB.
Für das zu untersuchende Gerät oder die betreffende Schaltung mussabgeschätzt werden, auf welchem Impedanzniveau sich die Störung aus-breitet. Messtechnisch sind die Impedanzen im HF-Bereich vonQuelle und Senke nicht mit einfachen Mitteln zu bestimmen.Von daherstarten wir mit Erfahrungswerten:
Designtipp 4:Impedanz von Störquelle und Störsenke abschätzen:Massestörungen: ZA = ZB; 1 Ω bis 10 ΩVersorgungsspannung (VCC): ZA = ZB; 10 Ω .... 20 ΩDatenleitungen: ZA = ZB; 50 Ω bis über 100 Ω
und benötigte Impedanz des Ferrites ermitteln:
Das Nomogramm (Abb. 4) soll hier eine kleine Hilfestellung geben, umbei gesuchter Dämpfung auf eine entsprechende Ferritimpedanz zurückgreifen zu können.
Beispiel
gesuchte Einfügedämpfung = 8 dB, Systemimpedanz ZA = ZB= 50 Ω(z.B. Datenleitung) aus dem Nomogramm kann der Wert für denEMV-Ferrit abgelesen werden:
(2)

EMC KOMPENDIUM 2003110
Produkte & VerfahrenFilter & KomponentenB
Workbench‘ oder ‚PSPICE‘. Hierzu bieten sichSimulationsparameter an, wie sie in [1] zufinden sind.
Neben den SMD-Ferriten gibt es viele weitereBauformen von EMV-Ferriten für Anwendungauf Kabeln und Leitungen. Die Vielfalt an Bau-formen, Ausführungen und Größen erlaubt es,eine an das Kabel angepasste Entstörung zufinden. Gleichzeitig können durch Klappferriteschon gefertigte Geräte störfest gemacht wer-den – teure Redesigns und damit Verzögerungenin der Vermarktung von Geräten werden ver-mieden. Für alle nachträglichen Entstörungen aufLeitungen gilt:
Designtipp 6:Kabelaußendurchmesser möglichst an
Innendurchmesser Ferrit anpassen längere Ferrithülse => höhere Dämpfung größeres Kernvolumen => höhere Dämpfung
Abblockkondensatoren für Vcc
Designtipp 7:Abblockkondensatoren (C1/ C2) mitmöglichst hoher Eigenresonanzfrequenz ver-
wendenmöglichst in SMD-Bauform einsetzen, die
parasitäre Induktivität bleibt dann imBereich zwischen 1 bis 5 nH (bedrahteteBauteile bis zu 10mal höher)
möglichst kleinem Serienverlustwiderstand(ESR) einsetzen
nur so groß vom Kapazitätswert her wählen,wie der tatsächliche Pulsstrom dI und dererlaubte Spannungseinbruch dV bei der vor-handenen Schaltzeit dt es erfordern (Bei-
=> bei Datenleitung prüfen der Signal-qualität
Einfügedämpfung nicht erreicht=> das System ist im betreffenden Fre-quenzbereich ‚hochohmig‘ - Abschätzen derSystemimpedanz mit Nomogramm (umge-kehrter Weg!)=> EMV-Ferrit mit mehr Impedanz einsetzen=> ggf. Filterkondensator gegen Masse=> bei Ferritringen/-hülsen oder Klappfer-rit: mehrere Windungen testen=> Kopplungsart der Störung beachten!
Ein weiteres Mittel, die Filterschaltung di-mensionieren und abstimmen zu können, ist dieSimulation mittels der Software ‚Electronics
ZF ~ 180 Ω; gewählt: 220 Ω (z.B. in Bauform0603 Würth Elektronik eiSos Typ: 74279263: 220Ω, 0,3 Ω RDC; Imax = 500 mA)
Im Messlabor kann die Filterwirkung unddamit Richtigkeit der Abschätzung der Syste-mimpedanz überprüft werden: Für den Testmit SMD-Ferriten ist ein entsprechendes Mu-sterkit verfügbar – so kann bei der EMV-Mes-sung die Schaltung vor Ort weiter optimiertwerden. Die Messung im EMV-Labor kannfolgende Ergebnisse bringen:
Designtipp 5:Einfügedämpfung erreicht
=> Annahme Systemimpedanz richtig
B.01
Abb. 2:
Vergleich Güte EMV-
Ferrit versus Induktivität
Abb. 3:
Ersatzschaltbild zur Ein-
fügedämpfung

EMC KOMPENDIUM 2003 111
Produkte & VerfahrenFilter & Komponenten B
spiel: Erlaubter Spannungseinbruch dV = 200 mV; Schaltgeschwin-digkeit dt = 5 ns; Pulsstrom dI = 40 mA)
Platzierung des Abblockkondensators derart, dass die Länge derStrecke VCC-Pin-Kondensator-Massepin minimal wird und mög-lichst großflächig und niederohmige Leiterbahnen
Parallelschaltung von Kondensatoren unterschiedlicher Kapazitäts-werte vermeiden, da dadurch weitere Polstellen und Eigenresonanz-frequenzen auftreten. Wenn eine Parallelschaltung verwendet wird,muss ein schwingfähiges System unterbunden werden (Absenken derGüte Q des Resonanzkreises auf Werte unter 2, z.B. durch SMD-Fer-rite); ein Schaltungsvorschlag dazu zeigt Abb. 5
Zusammenfassung
Unter Beachtung der in diesem Beitrag genannten Designtipps wird die Bauteilauswahl und das Filterschaltungsdesign vereinfacht. Die Kom-bination aus SMD-Ferriten und gezielt eingesetzten Entstörkonden-satoren hilft die Forderung nach breitbandiger Entkopplung gerade auchim Versorgungsspannungsbereich gerecht zu werden.
Literatur
[1] Gerfer, A.; Rall, B.; Zenkner, H.: Trilogie der Induktivitäten, 2. erweiterte Auflage,2002, Swiridoff-Verlag, ISBN-3-934350-30-5
Abb. 4: Nomogramm Einfügedämpfung versus Ferritimpedanz mit ZA =
ZB = konst. Kurvenparameter: Impedanz des umgebenden Systems
Abb. 5: Pi-Filter zur breitbandigen Vcc-Entkopplung
Beitrag als PDF im Internet:
www.publish-industry.net
more @ click EK3B0101PDF
(3)