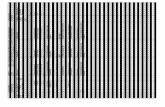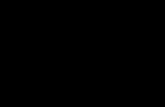Erik P. Bucy/John E. Newhagen (Hrsg.): Media access. Social and psychological dimensions of new...
-
Upload
klaus-beck -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
Transcript of Erik P. Bucy/John E. Newhagen (Hrsg.): Media access. Social and psychological dimensions of new...
BUCHBESPRECHUNGEN
ESSAY
Erik P. Bucy/John E. Newhagen (Hrsg.): Media Access. Social and Psychological Dimensions of NewTechnology Use. – Mahwah/NJ, London: Lawrence Erlbaum 2004, 296 Seiten, USD 79,95 (gebun-den), US 37,50 (paperback).
Im Vorwort preisen die Herausgeber die Vorzüge ihres Sammelbandes geradezu marktschreierisch an:Nicht weniger als vier »unique features« sollen den Band »Media Access« auszeichnen, zugleich soll einneuer Ansatz (Approach) und eine »new area of research« begründet werden: Neue Perspektiven, Inte-gration verschiedener theoretischer Konzepte, multidisziplinäre Ansätze und ein Fortschritt der politi-schen wie der Forschungsagenda werden versprochen. Um es vorwegzunehmen: Gemessen an diesenAnsprüchen können nur einige der 13 Beiträge wirklich überzeugen.
Bucy und Newhagen kritisieren einführend, dass die bisherige Debatte um Digital Divide weitge-hend auf die soziodemographischen Faktoren eines ungleichen Zugangs speziell zu den sog. neuen Me-dien verkürzt wurde, während individualpsychologische Zugangsbarrieren kaum thematisiert wurden.Wer allerdings beispielsweise die Arbeiten der Kanadier Clement/Shade oder den »Zugangsregenbo-gen« (Kubicek/Welling) kennt, weiß schon länger, dass auch der kognitive Zugang eine wichtige Rollespielt. Auf der Aggregatebene differenzieren Bucy/Newhagen den inhaltbezogenen sozialen und dentechnikbezogenen Systemzugang, der auch innerhalb wohlhabender Gesellschaften noch immer mitder Qualität von Hard- und Software sowie Netzanbindung variiert. Unter kognitivem Zugang (cogni-tive access) werden alle individuellen psychischen Ressourcen verstanden, die man benötigt, um sichdie Inhalte des Mediums zu erschließen, Informationen zu verarbeiten und deren Bedeutungen zu ver-stehen. Dabei gehen Bucy und Newhagen von zwei Prämissen aus: Das Internet wird pauschal als text-dominiertes Medium aufgefasst, und das Verstehen von Bildern als »natural or automatic« angesehen,mit der Folge, dass »cognitive access to mediated image is egalitarian; regardless of socioeconomic sta-tus« (P. 13, 14). Mag die erste Prämisse zumindest derzeit realistisch sein, müssen an der zweiten dochZweifel angemeldet werden, denn dem »geschulten Auge« nicht nur des Filmkritikers oder Kunstge-schichtlers, sondern auch des genrekompetenten Vielsehers dürfte sich die Polysemie von Bildern ganzanders erschließen als den übrigen Rezipienten. Auch die verbreitete medienwissenschaftliche Dicho-tomisierung Text vs. Bild beschreibt die Medienrealität nur unzureichend, handelt es sich doch in derRegel um kombinierte, audiovisuelle Angebote. Fragwürdig ist ferner, ob der Hauptunterschied zwi-schen Online- und Massenmedien darin besteht, dass Massenmedien einen linearen und einseitigenInformationsprozess herstellen, bei dem die Kommunikatoren allein für die »information construc-tion« zuständig sind, während nur bei den nicht-linearen Online-Medien Informationskonstruktionim dyadischen Wechselspiel zwischen Nutzer und Anbieter erfolgt. Daher sei der Zugang zu den In-halten der Online-Medien nicht-linear, während er bei den traditionellen Medien linear (system, phy-sical, social, cognitive access) verlaufe. Was die Autoren als spezifisch für den Zugang zu Online-Me-dien beschreiben, gilt tatsächlich auch für andere Medien, und ob sich das »postmodern InformationAge« tatsächlich so grundlegend vom »Age of Enlightment« unterscheidet, die Leitdifferenz also zwi-schen Linearität und Non-Linearität verläuft (p. 20), kann bezweifelt werden.
Die psychologischen Zugangsbarrieren sind Thema des ersten Teils des Sammelbandes. An Befunde derWissenskluftforschung anknüpfend haben Grabe und Kamhawi den Einfluss von formaler Bildungund medialer Präsentationsform (media channel: print, online, television) auf den kognitiven Zugangund die emotionale Bewertung von Nachrichten experimentell (N = 42) untersucht. Die Ergebnissebelegen, dass die Rezeption von Fernsehnachrichten kognitiv keineswegs so anspruchslos ist, wie Bucyund Newhagen zuvor suggerierten. Die formal geringer Gebildeten hielten die Nachrichten zwar fürrelevanter, informativer und glaubwürdiger als die höher Gebildeten, konnte sie jedoch schlechter er-innern. Am besten wurden Fernsehnachrichten verstanden und erinnert, gefolgt von Web- und Zei-tungsnachrichten. Während die höher Gebildeten Zeitungsnachrichten für am schwersten verständ-
lich hielten, waren es bei den geringer Gebildeten die Webnachrichten. Insgesamt halten Grabe undKamhawi daher das Fernsehen für das Medium, das insbesondere den geringer Gebildeten den bestenkognitiven Zugang zu Nachrichten verschafft, während das Web aufgrund der höheren kognitiven Zu-gangsbarrieren die Wissenskluft zwischen den Bildungsschichten weiter vergrößern dürfte. Ob mitexperimentellen Recall- und Recognitiontests (langfristige) soziale Wissensveränderungen gemessenwerden können, muss jedoch bezweifelt werden.
Als »Interaktivitäts-Paradox« bezeichnet Bucy, dass die vergleichsweise hohen Selektionspotenzialeim WWW und die Teilnahmemöglichkeiten an Web-Foren einerseits den Informationszugang für denNutzer erhöhen, andererseits aber erhöhte kognitive Anforderungen an die Webuser stellen. In einemWebnutzungs-Experiment nutzten 74 Undergraduate-Studenten (im Alter von 18 bis 30! Jahren) ver-schiedene Nachrichten-Websites von Tageszeitungen und Fernsehanbietern; dabei mussten sie defi-nierte (»nicht-interaktive«) Lese- oder (»interaktive«) Rechercheaufgaben bewältigen und anschlie-ßend die Websites und ihre Gefühle bei der Nutzung bewerten. Die Angebote der Fernsehsender wur-den als interessanter, informativer, relevanter und glaubwürdiger beurteilt; Websites mit höheren »In-teraktivitäts-« bzw. Selektionspotenzialen bzw. den entsprechenden Aufgabenstellungen wurden insge-samt besser bewertet, galten aber zugleich als komplexer, konfuser und schwieriger zu nutzen. Wie er-wartet, führen höhere kognitive Anforderungen zu ambivalenten emotionalen Bewertungen;allerdings bleibt aufgrund des Designs unklar, was auf die Aufgabenstellung und was auf dieWebangebote zurückzuführen ist.
Auch der Beitrag von Finn und Korukonda trägt wenig zum Verständnis von Media Access bei: An-hand einer Sekundäranalyse von Archivdaten einer regelmäßigen Studentenbefragung sollte der Ein-fluss von fünf zentralen Persönlichkeitsvariablen und fünf Faktoren der sozialen Herkunft auf dieComputernutzung ermittelt werden. Die Ergebnisse sind mager, zumal es sich um ein nicht-repräsen-tatives, selbstrekrutiertes Sample (N = 270) handelt, und die Teilnehmer für ihre wöchentliche Mit-wirkung an der Online-Befragung bezahlt wurden. Erklärungen, warum auch jüngere Menschen dasInternet meiden (p. 73), würde man wohl eher durch eine Befragung von Nicht-Nutzern gewinnen.
Das von Bessière et al. entwickelte »Computing Frustration Model« ist sicherlich psychologisch fun-diert und hilfreich bei der Systematisierung von persönlichen und anlassbezogenen Faktoren sowie derOptimierung von Interfaces, zur Erklärung von Nutzungsungleichheiten müsste es aber in einenargumentativen Zusammenhang gestellt werden.
Insgesamt ergiebiger als die psychologischen sind die Beiträge über soziale und kulturelle Faktoren imzweiten Teil des Buches.
Innovativ und vielversprechend ist Rojas et al. Suche nach Erklärungen für die statistisch nachge-wiesenen Zugangs- und Nutzungsungleichheiten mit Hilfe Bourdieuscher Konzepte: Im Rahmen ei-ner Fallstudie belegen sie, dass die sozialen Milieus mit geringem Interesse und marginalem Zugangzum Internet sich durch spezifische »Technik-Dispositionen« von den Gruppen unterscheiden, die dasInternet intensiv nutzen. Sie unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich des ökonomischen, sondern vorallem hinsichtlich ihres kulturellen Kapitals, das nicht allein durch Schulbildung erworben wird, son-dern über die Elternhäuser und die sozialen Netzwerke vererbt bzw. erworben wird. Hier fehlen viel-fach die sozialen Rollenmodelle erfolgreicher Internetnutzer; der Nutzen des Internet auch für die spä-tere Berufstätigkeit ist für viele Jugendliche aus diesen Gruppen nicht erkennbar und einige männlicheJugendliche betrachteten Computer und Internet als typisch weibliche Technologien, von denen siesich schon aufgrund unhinterfragter Geschlechtsstereotype distanzieren. Computer und Internet sindin ihre Peer-Netzwerken nicht »cool«, sondern »langweilig« – vielleicht mit Ausnahme von »Ballerspie-len«. Es sind also eher Habitus und kulturelles Kapital, die hier den Zugang und bereits den Willenzum Zugang begrenzen, und nicht schlichte Armut, wie die Haushaltsausstattung auch dieserFamilien mit elektronischen Geräten zeigt.
Youtie et al. berichten von einem kommunalen Projekt, bei dem mit öffentlicher Förderung kosten-lose und nutzerfreundliche Breitband-Netzzugänge ermöglicht wurden, nicht zuletzt um die kommu-nale Kommunikation und Partizipation zu fördern. Durch diese Initiative konnten zwar erstmalsHaushalte erreicht werden, in denen zuvor kein Internet genutzt wurde. Das Hauptmotiv der befrag-ten neuen Nutzer bestand jedoch darin, dass das neue Angebot nichts kostete. Den größeren Nutzenzogen diejenigen, die bereits zuvor das Internet kostenpflichtig nutzten. Die ökonomischen Barrieren,
Buchbesprechungen 119
so das Fazit, stellten sich letztlich als die geringsten dar; ausschlaggebend sind hingegen Einstellungenund Nutzenerwartungen.
In die gleiche Richtung weisen auch erste Ergebnisse der »HomeNetToo-Studie«, die Jackson et al.referieren. Hierbei ging es um die Internet-Nutzung von Neulingen aus Familien mit niedrigem Ein-kommen. Ähnlich wie bei den HomeNet-Studien wurde die Internet-Nutzung über einen Zeitraumvon sechs Monaten automatisch protokolliert; eine Reihe von Befragungen ergänzten die Datenerhe-bung. Während Persönlichkeitsfaktoren allenfalls in den ersten drei Monaten von Bedeutung für dieunterschiedliche Internet-Nutzung waren, und die Faktoren Haushaltseinkommen und Geschlechtpraktisch keine Nutzungsunterschiede erklären, erwiesen sich Alter, Bildung und Ethnie als stabilebzw. sich verstärkende Faktoren. Interessant ist auch, dass E-Mail, Mailinglists, Chats undNewsgroups vergleichsweise wenig genutzt wurden, obwohl die Internet-Nutzung insgesamt über-durchschnittlich war. Die geringste Nutzung dieser Dienste wiesen Afroamerikaner auf; als Grund ga-ben sie vielfach an, dass es nicht sinnvoll sei, mit Fremden per Internet zu kommunizieren statt sichpersönlich mit Bekannten zu unterhalten. Hinzu kommt möglicherweise, dass auch der objektiveNutzen von E-Mail in dem Maße steigt, wie Familienmitglieder, Verwandte und Bekannte auf dieseWeise erreichbar sind.
Der Zugang zur Öffentlichkeit steht im Mittelpunkt des dritten Teils.McCerry/Newhagen gehen von einer verkürzten und den normativen Kern vernachlässigenden Inter-
pretation der Theorie Habermas’ aus und stellen die These auf, Öffentlichkeit bestehe aus einer politi-schen »Prozess-Sphäre« und einer »Meinungssphäre« – was den deutschen Leser an die Konstellationvon Arena und Galerie erinnert. Der theoretische Ertrag bleibt insgesamt sehr gering: Statt differen-zierter Betrachtungen erfolgen schematische Dichotomisierungen, denn Öffentlichkeit wird nicht alsProzess oder im Sinne von Habermas als Netzwerk begriffen.
Hofstetters Beitrag über politische Talk- und Call-in-Radios zeichnet sich hingegen durch eine dif-ferenzierte theoretische Fundierung und Berücksichtigung vorliegender Forschungsergebnisse aus.Untersucht wurde neben allgemeinen Mediennutzungsmotiven die Bedeutung der wahrgenommenenInteraktivität für die Motivation, Talk-Formate zu hören sowie sich selbst telefonisch an den Diskus-sionen zu beteiligen. Insgesamt werden Talk- und Call-in-Formate trotz der Vorauswahl der Anruferals sehr interaktiv wahrgenommen. Je höher die wahrgenommene Interaktivität ist, um so höher ist dieIdentifikation der Hörer mit dem Talkmaster sowie den anderen Anrufern, und um so höher werdenauch Glaubwürdigkeit, Sachlichkeit und Fairness dieser Formate bewertet. Hofstetter kommt zu demSchluss, dass politischen Talk-Radios – trotz aller berechtigten Kritik – letztlich eine politischmoblisierende und informierende Wirkung zukommt.
Einer der lesenswertesten Beiträge des Bandes stammt von van Dijk, der die unhinterfragten Annah-men der Digital Divide-Debatte kritisiert und ein differenziertes und dynamisches Bild digitaler Spal-tungen nicht nur entwirft, sondern soweit möglich auch mit internationalen Daten untermauert.Ähnlich wie Rojas et al. geht es ihm um die tieferliegenden sozialen, sozialpsychologischen und kultu-rellen Erklärungen für Ungleichheiten beim Internetzugang, und auch er greift auf Bourdieus Konzep-te des sozialen und kulturellen Kapitals zurück. Van Dijk entwickelt ein vierstufiges »cumulative andrecursive model of types of access to new media«, an dessen Basis nicht der technische und ökonomi-sche Netzzugang steht, sondern der durch soziales und kulturelles Kapital beeinflusste mentale Zu-gang (instrumentelle, informationelle und strategische Medienkompetenzen). Die vier Stufen des Mo-dells (mental, material, skills und usage access) bauen aufeinander auf, und mit jeder medientechnolo-gischen Innovation (auch mit dem Übergang zu breitbandigem Internetzugang) erfolgt ein Wiederein-tritt in eine vorangegangene Stufe. Auf diese Weise kann auch erklärt werden, dass sich einige digitaleSpaltungen (z. B. der technische Zugang hinsichtlich Geschlecht und Einkommen) zunächst oder vor-übergehend verringern, andere hingegen stabil bleiben oder sich gar vertiefen. Grundsätzlich ist diesesModell auch auf die alten Medien anwendbar und trägt zur Erklärung der ungleichen Nutzungsweisevon Fernsehen oder Tageszeitungen bei. Van Dijk liefert nicht nur Erklärungsansätze, er benenntForschungsdefizite, gibt methodologische Hinweise und kommunikationspolitische Schlussfolgerun-gen.
Insgesamt betrachtet enthält der Band – auch wenn er sicherlich keine neue Epoche einleitet, wie esdie Herausgeber annoncierten – eine Reihe innovativer und lesenswerter Beiträge, die jenseits der sta-tistischen Deskription nach Erklärungen für ungleichen Zugang und ungleiche Nutzung nicht nur der
120 Buchbesprechungen
»neuen« Medien suchen. Dabei scheinen qualitative bzw. ethnographische Methoden und ein Rekursauf soziologische Konzepte, wie das von Pierre Bordieu, wohl am vielversprechendsten.
KLAUS BECK, Greifswald
Karsten Renckstorf/Denis McQuail/Judith E.Rosenbaum/Gabi Schaap (Hrsg.): Action Theoryand Communication Research. Recent Develop-ments in Europe. – Berlin, New York: Moutonde Gruyter 2004 (Reihe: Communication Mo-nographs; Bd. 3), ix + 376 Seiten, Eur 94,– (ge-bunden), Eur 29,95 (paperback).
Der Titel des Bandes erweckt zunächst einmalgroße Erwartungen: Die Auswahl an sozialwis-senschaftlichen Handlungstheorien ist groß, dasFeld möglicher Verknüpfungen mit Kommuni-kationsforschung ausgedehnt. Bei genaueremHinsehen stellt man fest, dass der der Überbe-griff der »Handlungstheorie« hier als Kurzformfür deren phänomenologische Variante verwen-det wird, die in der kommunikationswissen-schaftlich adaptierten Form vor allem mit demNamen Karsten Renckstorf assoziiert werdenkann. Der Sammelband dokumentiert das»2. International Colloquium on Action Theore-tical Approaches in European CommunicationResearch«, das 2001 in Nijmegen abgehaltenwurde. Die europäische Perspektive, die Unterti-tel und Vorwort ankündigen, relativiert sich inder Auswahl der hier dokumentierten Vorträge:23 der 26 Autoren und Autorinnen forschen,lehren oder lehrten in den Niederlanden oderBelgien (davon 16 in Nijmegen und vier in Leu-ven, den Heimatuniversitäten der Herausgeberder Communication Monographs), die übrigenin Deutschland. Es ist daher nicht überraschend,dass die vorliegenden Artikel einen thematischwie qualitativ breiten, nicht aber einenakademisch multikulturellen oder repräsentati-ven Querschnitt bieten.
Die Beiträge zur theoretischen Entwicklungsind einer vorwiegend rückwärtsgerichteten Per-spektive verschrieben. Renckstorf und Wester ge-ben einen Überblick über Konzepte und empiri-sche Ergebnisse des handlungstheoretischen Mo-dells, McQuail diskutiert generelle Probleme der
Mediennutzungsforschung und formuliert ehervage Perspektiven für zukünftige Entwicklungen.Huysmans präsentiert eine systemtheoretischeHerausforderung für »die Handlungstheorie« –es überrascht nicht, dass seine Schlussfolgerungdarin besteht, dass individualistische Hand-lungstheorien sehr davon profitieren könnten,wenn sie ihre zentralen Axiome durch system-theoretische Dogmen ersetzten.
Der Abschnitt zu methodischen Fragen wirdvon einem Text von Kepler eröffnet, die überzeu-gend für eine interpretative methodische Aus-richtung argumentiert, die einem handlungs-theoretischen Mediennutzungsmodell, das seinephänomenologischen Wurzeln ernst nimmt, an-gemessen wäre, um zur Klärung der zentralenFrage der Aneignung von Medieninhalten beizu-tragen. Doch eben diese interpretative Herange-hensweise findet sich nur allzu selten in denneun Beiträgen, die empirische Forschungser-gebnisse präsentieren.
Die vorgestellten Studien, die mehr oder weni-ger eng auf handlungstheoretische Konzepte Be-zug nehmen, sind bezüglich der Fragestellungenals auch der Untersuchungsobjekte äußerst he-terogen. Die Bandbreite reicht von der Nutzungvon Fernsehnachrichten über die Untersuchungpersönlicher Homepages bis zu Fragen der Jour-nalismusforschung. Bei der Methodenwahl herr-schen quantitative Verfahren von unterschiedli-cher handwerklicher Qualität vor. Das Bild voneinem empirischen Programm der »handlungs-theoretischen« Kommunikationsforschungbleibt nach der Lektüre diffus. Die verwendeteBegrifflichkeit legt die Frage nach verwandtenhandlungstheoretisch orientierten Konzeptionenund ihrem Bezug zu den hier präsentierten theo-retischen Formulierungen und empirischen Er-kenntnissen nahe. Dabei drängt sich der Ansatzder »Cultural Studies« auf, der in dem Band einenahezu geisterhafte Rolle spielt, da er zwar mit-unter in den Texten Erwähnung findet, ohne
Buchbesprechungen 121