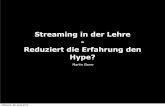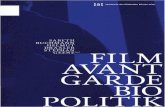Streaming in der Lehre - Relativiert die Erfahrung den Hype?
Eva Geulen Tagung Tyrannen, Schurken, Arnomale Referat · PDF fileFrage gestellt und...
Transcript of Eva Geulen Tagung Tyrannen, Schurken, Arnomale Referat · PDF fileFrage gestellt und...

Eva Geulen Tagung "Tyrannen, Schurken, Arnomale" Referat zu: Agamben, Der Ausnahmezustand Eva Geulen Agamben, „Der Ausnahmezustand als Paradigma des Regierens“ Rekapitulation der Argumentation und drei Gesichtspunkten:
a) Hinsichtlich der Vorgeschichte der vorliegenden Argumentation im 1. Homo Sacer Buch b) Hinsichtlich Agambens Verständnis von Paradigma c) Hinsichtlich der Konsequenzen seiner Argumentation
I. Der Einsatz bei Carl Schmitt Souverän ist wer den Ausnahmezustand entscheidet. Mit Schmitts Formel als verbindlicher Artikulation des „wesensmäßigen Zusammenhangs von Ausnahme und Souveränität“ setzt Agamben ein, um vor dem Hintergrund dieses Axioms das Desiderat einer Theorie des Ausnahmezustands im öffentlichen Recht einzuklagen. Dem Anschein dieses Einsatzes entgegen ist Schmitt jedoch keinesfalls autoritative Instanz. Denn es gibt bedeutsame Unterschied in der Weise wie der „wesensmäßige Zusammenhang von Ausnahmezustand und Souveränität“ bei Agamben und bei Schmitt formuliert wird. Verkürzt und im Rückblick auf die entsprechenden Schmitt-Kapitel aus Agambens erstem Homo-Sacer-Buch gesagt, geht es Schmitt darum, das Wesen der Souveränität aus der Ausnahme abzuleiten. Agamben dagegen möchte umgekehrt das Wesen der Ausnahme aus der Souveränität ableiten. Diese Umkehrung verdankt sich Agambens Bedürfnis, die Schmittsche Unterscheidung von Freund und Feind überbietend abzulösen durch die Unterscheidung von Leben und Recht als Urformation des Politischen. Dies wird dadurch möglich, daß er eine Schmitt überschreitende, gleichsam entgrenzte Logik der Ausnahme entwickelt. In ihr geht es ihm bekanntlich um die Phänomene des einschließenden Ausschlusses und des ausschließenden Einschlusses. Diese Logik der Ausnahme ist sowohl die theoretisch-methodologische Prämisse von Agambens Gesamtkonstruktion als auch das eigentliche Dispositiv, durch das sich das Recht auf das Leben bezieht und sich die Sphäre des Politischen konstituiert. II Was ist ein Paradigma? Im Buch über den Ausnahmezustand, dem das vorliegende Kapitel entnommen ist, wählt eine etwas andere Zugangsart zum selben Grundproblem von Recht und Leben, nämlich die

vornehmlich historische Analyse des Ausnahmezustands im öffentlichen Recht und der rechtshistorischen Diskussionen zwischen 1934 und 2001. Die in mancher Hinsicht einleuchtende These lautet, daß der Ausnahmezustand in den westlichen Demokratien zu einem Paradigma des Regierens geworden sei, zu einer prinzipiellen Technik also, einer regulären Praxis. Die zunächst nur quantitative Ausweitung von Befugnissen der Exekutive hat sukzessive eine qualitativen Sprung herbeigeführt, der es erlaubt vom Ausnahnmezustand als (neuem) Paradigma zu sprechen. Aber das ist nur die eine Seite dessen, was Agamben paradigmatisch nennt. Die andere betrifft den erkenntnistheoretischen Gewinn dieser historisch nachvollziehbaren Entwicklung, daß nämlich nun die Bedeutung der Ausnahme allgemein, „sein für die Rechtsordnung paradigmatisch-konstitutives Wesen ans Licht kommt“ (13). Die historische Rekonstruktion einer spezifischen Entwicklung in den westlichen Demokratien nach 45 wird spätestens an diesem Punkt von einer systematischen Überlegung in den Schatten gestellt. Es geht Agamben offensichtlich nicht, zumindest nicht primär, darum, zu zeigen, daß die westlichen Demokratien fatalerweise totalitäre Züge angenommen haben, sondern um den Nachweis, daß schlechterdings keine Rechtsordnung je ohne einen Ausnahmezustand ausgekommen wäre oder auskommen könnte. Im Aspekt einer Theorie des Ausnahmezustands sind alle denkbaren politischen Formen, einschließlich Monarchie, Demokratie und Totalitarismus auf einem Kontinuum angesiedelt. Die Unterschiede zwischen ihnen sind stets nur gradueller Natur (wie die Unterscheidung von komissarischer und souveräner Diktatur bei Schmitt letztlich auch keine substantielle war) In jeder Demokratie liegt also der Keim zum Totalitarismus; -- freilich theoretisch auch in jedem Totalitarismus der Keim zur Demokratie. Diese Reduktion der qualitativen Unterschiede auf graduelle ist der Effekt der raffinierten Subsumtion nicht unmittelbar als Ausnahmezustandsphänomene erkennbarer Modelle wie Widerstandsrecht oder Bürgerkrieg unter die Rubrik der Ausnahme. Die Pointe der Analogisierung von Widerstandsrecht (also: von Tyrannenmord) und staatlichen Ausnahmevorkehrungen (also: Tyrannis) besteht darin, daß Beherrschte und Beherrscher sozusagen auf gleicher Augenhöhe betrachtet werden. Das geht natürlich nur, wenn man den Ausnahmezustand wie Agamben in eine allgemeinere Logik der Ausnahme zu überführen bereit ist. Die Feststellung, daß im Aspekt der Ausnahme alle Rechtsordnungen nur graduell voneinander zu unterscheiden sind, stellt nun aber die Voraussetzung infrage, unter der Agamben angetreten war: daß die westlichen Demokratien nicht nur ein Fall unter anderen sind, sondern daß ihrer Entwicklung paradigmatischer Charakter in dem Sinne einer Offenbarung des Wesens des Politischen. Das leuchtet mir so nicht ein. III Der seltsame Schluß Weil Agamben substantielle Unterschiede sowohl innerhalb einer Rechtsordnung (zwischen Herrschern und Beherrschten) als auch zwischen verschiedenen Rechtsordnungen (Demokratien, Monarchien etc.) zurückstellt, verbleiben nur formale Unterscheidungskriterien: ob also Widerstands- und Ausnahmerecht explizit verrechtlicht werden (wie etwa im Widerstandsrecht des deutschen Grundgesetzes) oder nicht (wie in Italien, wo man auf einen entsprechenden Paragraphen verzichtet hat.) In dieser Angelegenheit ist Agambens Position von wünschenswerter Eindeutigkeit. Mit drei guten Gründen wendet er sich gegen die legale Verankerung eines Widerstandsrecht: weil aus dem Recht eine Pflicht werden könnte (wie umgekehrt das preußische Recht zum Schutz der Freiheit der Person im Nationalsozialismus zur juristischen Grundlage der Freiheitsberaubung wurde); weil damit der juristischen Normierung politischer Handlungen Tür und Tor geöffnet ist. Und schließlich: weil damit das die Unantastbarkeit der Verfassung in ihr selbst bereits in

Frage gestellt und relativiert wird. -- So weit, so gut. Aber diese Entscheidung gegen Verrechtlichung löst für Agamben noch längst nicht das Grundproblem. Denn Fakt bleibt, daß auch der Verzicht auf eine explizit rechtliche Regelung von Widerstandsrecht und Ausnahmevorkehrungen juristisch signifikant ist. „Es stehen sich hier die These, Recht und Norm müßten übereinstimmen, und die andere, daß das Recht über den Bereich der Norm hinausgreife gegenüber. Aber letztlich treffen sich die beiden Positionen darin, daß sie die Existenz einer Sphäre des menschlichen Handelns ausschließen, die sich dem Recht insgesamt entzöge.“ Über Norm, Normalität und Normativität hat Agamben nicht viel nachgedacht. Aber lassen wir das beiseite und nehmen einfach an, daß hier noch einmal die Debatte zwischen Kelsen und Schmitt durchgespielt wird. Dann ist Agambens Punkt, daß beide Positionen darin konvergieren, ein Handeln ausschließen zu wollen, das bar jeden Bezugs auf das Recht wäre. Ausgeschlossen werde so oder so eine absolut rechtsfreie Ausnahme. Wie hat man zu verstehen? Unter der Sphäre, die sich dem Recht insgesamt entzöge, müßte man sich vielleicht vorstellen, was Agamben mit Benjamin den ‚wirklichen Ausnahmezustand’ nennt, also die Absetzung, Aufzehrung und Schließung allen Rechts überhaupt. Aber der Satz ist von Kafkesquer Komplexität, wenn man ihn zusammenliest mit Agambens Erläuterungen zum Verhältnis von Ausschluß und Ausnahme. Ich lasse das lieber und möchte abschließend nur darauf hinweisen, daß diese Schlußpassagen ein sehr schönes Beispiel für Agambens Fähigkeit sind, auf zwei verschiedenen Ebenen gleichzeitig zu operieren, einer pragmatisch-politischen und einer Meta-Ebene. Hier heißt das: Einerseits dezidierte Stellungnahme gegen Verrechtlichung, andererseits die Relativierung dieser Position, weil sie hoffnungslos verstrickt ist mit ihrem Gegenteil.