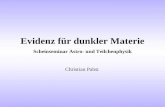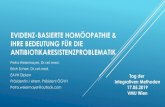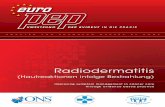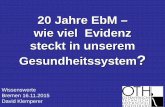Evidenz und Expertise im vorparlamentarischen Gesetzgebungsprozess: Die Rolle von Verwaltung und...
Transcript of Evidenz und Expertise im vorparlamentarischen Gesetzgebungsprozess: Die Rolle von Verwaltung und...

Evidenz und Expertise im vorparlamentarischenGesetzgebungsprozess: Die Rolle von Verwaltung
und externen Experten
SIMONE LEDERMANN
Universit€at Bern
Abstract: Der Evidence-Based Policy-Ansatz hat international Reformen ausgel€ost und Studienzum Verh€altnis von Wissen und Politik angestossen, wobei ein klares Verst€andnis von “Evidenz”nach wie vor fehlt. In diesem Artikel wird eine Typologie politikrelevanter Wissensarten entwi-ckelt, die zwischen systematischer Evidenz und personengebundener Expertise sowie zwischenden Politikdimensionen Policy, Politics und Polity unterscheidet. Auf dieser konzeptionellenGrundlage wird empirisch erfasst, welches Wissen die Verwaltung und externe Experten w€ahrendder bisher kaum untersuchten Fr€uhphase von Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene beitra-gen. Es zeigt sich, dass die federf€uhrenden Verwaltungsakteure kaum €uber Expertise verf€ugen, dief€ur den Gesetzgebungsprozess relevant w€are, doch versuchen sie, ihre Wissensl€ucken je nachDimension unterschiedlich zu kompensieren. Externe Experten leisten einen bescheidenenWissensbeitrag, weshalb ihre Beteiligung prim€ar als Mittel f€ur die politische Kompromissfindungverstanden werden muss. Dies er€offnet aus demokratietheoretischer Sicht Diskussionsbedarf.
KEYWORDS: Switzerland, public administration, public policy
Einleitung1
„Wissen ist Macht” – so lautet ein g€angiges Sprichwort. Es ist deshalb nicht €uberraschend,dass es in der Vergangenheit immer wieder politische Reformbestrebungen gab, die daraufzielten, vorhandenes Wissen besser zu nutzen. Seit der Jahrtausendwende erleben dieseBestrebungen unter dem Label Evidence-Based Policy (EBP) erneut einen Aufschwung(Sanderson 2004; Van Dooren 2008). Urspr€unglich von Blairs Labour-Regierung gef€ordert,steht EBP mit dem Slogan What matters is what works f€ur einen Staat, der seine Politiknicht nach ideologischen Gesichtspunkten gestaltet, sondern danach, was erwiesenermassenfunktioniert (Cabinet Office 1999a; Nutley et al. 2007: 127; Solesbury 2001). Seither hatEBP als Theorie zur Modernisierung der staatlichen Steuerung in verschiedenen L€andernReformen ausgel€ost (Head 2010a; Nutley et al. 2010), so in Kanada (Howlett 2009), D€ane-mark (Hansen und Rieper 2010), den USA (Heinrich 2007), S€udafrika (Strydom et al.2010) oder in der EU (Radaelli und Meuwese 2009). Zudem hat sich EBP von der Gesund-heitspolitik, in der sie zuerst Fuss fasste, auf andere Politikbereiche wie die Bildungs-,
1 Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Untersuchung, die vom Schweizerischen Nationalfonds unterst€utzt
wurde (Projekt Nr. 113420, „La conception des lois. La d�emarche l�egistique entre th�eorie et pratique“). Ich danke
den anonymen Reviewern der SPSR f€ur ihre hilfreichen Kommentare und Fritz Sager f€ur seine Hinweise zu fr€uhe-
ren Versionen des Texts.
Swiss Political Science Review 20(3): 453–485 doi:10.1111/spsr.12114
© 2014 Swiss Political Science Association

Sozial- oder Infrastrukturpolitik ausgedehnt (Frey und Ledermann 2010). In der Schweiztaucht EBP als Begriff bisher zwar kaum auf (Frey 2012), doch sind ebenfalls verschiedeneBestrebungen hin zu einem wissensbasierten staatlichen Handeln zu erkennen (Frey undWidmer 2011; Schedler und Schmucki 2009). So wurde auf Bundesebene sowohl die Regu-lierungsfolgenabsch€atzung (Sager und Rissi 2011) als auch die Evaluationsfunktion (vgl.u.a. Beywl und Widmer 2009) deutlich ausgebaut.
Durch die internationalen Reformbestrebungen hin zu einem wissensbasierten Policy-Making erhielt auch die Forschung €uber das Verh€altnis von Wissen und Politik einen neu-en Schub, und zwar sowohl im Bereich der Policy-Analyse (z.B. James und Jorgensen2009; Weible 2008; Weible und Sabatier 2009) als auch im Bereich der Nutzung von Evalua-tionen (vgl. Johnson et al. 2009). Viele Studien weisen jedoch konzeptionelle Schw€achenauf. H€aufig fehlt eine Definition, was genau als Evidenz z€ahlt (Frey und Ledermann 2010),so dass der Begriff sehr breit verstanden werden kann, wobei seine Grenzen nicht klarsind. Umgekehrt werden zuweilen nur Ergebnisse aus experimentellen Studien als Evidenzgez€ahlt. Ein solch enger Evidenzbegriff deckt angesichts der Komplexit€at von Politik nureinen kleinen Teil des politikrelevanten Wissens ab und bringt deshalb einen geringenErkenntnisgewinn. Die Frage, welches Wissen in Politikprozesse einfliesst, wurde somitbisher nicht befriedigend beantwortet.
Der vorliegende Artikel will hier Abhilfe schaffen, indem eine Typologie verschiedenerArten politikrelevanten Wissens entworfen wird. Einerseits wird zwischen Evidenz undExpertise unterschieden. Evidenz stammt aus wissenschaftlichen Studien, w€ahrend Exper-tise personengebundenes Wissen ist, das durch die langwierige Auseinandersetzung miteinem Thema erworben wird. Andererseits werden Evidenz und Expertise danach typisiert,auf welche der drei Politikdimensionen Policy, Politics oder Polity sie sich beziehen. Damiterf€ahrt das Konzept des politikrelevanten Wissens eine Systematisierung, die es erlaubt, dieFrage, welches Wissen in welchem Ausmass in die Politik einfliesst, klarer zu beantworten.
Die Typologisierung politikrelevanten Wissens erm€oglicht zudem, den theoretischen Kon-troversen auf den Grund zu gehen, inwiefern die Schweizer Bundesverwaltung und externeExperten2 Wissen in den Gesetzgebungsprozess einbringen. Bez€uglich der Bundesverwal-tung wurde einerseits die These aufgestellt, es habe eine deutliche Professionalisierungstattgefunden (Sciarini 2006), w€ahrend die Untersuchung einzelner F€alle einen eherbeschr€ankten Wissensbeitrag der Verwaltung aufzeigte (Frey 2012). Indem einzelne Wissens-arten untersucht werden, l€asst sich die Rolle der Verwaltung im Gesetzgebungsprozess dif-ferenzierter erfassen.
Bez€uglich der externen Experten wird in der Forschungsliteratur einerseits behauptet, dieKonsens- und Kompromissorientierung des schweizerischen Systems f€uhre zu einer starkinteressengeleiteten und damit wenig evidenzbasierten Politik (Bussmann 1997, 2008;OECD 2006; PVK 2005; Sager 2007a; Sager und Rissi 2011; Spinatsch 2002, 2006; Widmerund Neuenschwander 2004). Andererseits wird die Teilnahme unterschiedlicher externerAkteure in der internationalen Literatur (Weiss 1999; Head 2008) sowie auch vereinzelt inStudien €uber die Schweiz (Bussmann 2008; Frey 2010; Germann 1985; Sciarini 2006) alsZugangspunkt f€ur Wissen und damit als Chance f€ur eine evidenzbasierte Politik dargestellt.Diese Kontroverse ist auch aus demokratietheoretischer Perspektive von Interesse: Daexterne Experten in der Regel informell und nicht nach demokratisch sanktioniertenRegeln beigezogen werden, sind sie aus einer Input-Sicht der Legitimit€at des Staates eher
2 In diesem Beitrag wird generell die m€annliche Form verwendet, wobei weibliche Personen immer mitgemeint
sind.
454 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

abtr€aglich. Wird jedoch €uber externe Experten Wissen in den Gesetzgebungsprozess ein-gebracht, das die Probleml€osung verbessert, kann dies der Output-Legitimit€at des Staateszutr€aglich sein (Widmer 2009).
Empirisch befasst sich der Artikel mit einer bisher kaum beleuchteten Stufe des politi-schen Entscheidungsprozesses in der Schweiz, n€amlich mit der Fr€uhphase des vorparlamen-tarischen Verfahrens vor der Vernehmlassung. Die Arbeitsweise der Verwaltung und ihreZusammenarbeit mit externen Experten in dieser ersten Phase wurden noch nie vertieft ana-lysiert (Frey 2012), weshalb die Feststellung, dass bez€uglich des vorparlamentarischen Pro-zesses Forschungsl€ucken bestehen (Sciarini 2006; Varone 2006), ganz besonders zutrifft.Gleichzeitig weisen Prozessanalysen darauf hin, dass Wissen zu Beginn, wenn der Inhaltvon Gesetzen noch nicht festgelegt ist, am besten einfliessen kann (Widmer und Frey 2008;Widmer 2009), weshalb diese Phase f€ur das vorliegende Forschungsinteresse besonders rele-vant ist. Dank dem Zugang zu den Verwaltungsakten bei ausgew€ahlten Gesetzgebungs-prozessen wurde erstmals eine umfassende, systematische Analyse m€oglich.
Der Artikel ist wie folgt aufgebaut: Im zweiten Abschnitt wird die Typologie politikre-levanten Wissens als konzeptionelle Grundlage entwickelt. Dann werden die theoretischenKontroversen zur Rolle von Verwaltung und externen Experten f€ur die wissensbasierte Poli-tikgestaltung aufgerollt und aus der Literatur Hypothesen zum Beitrag dieser beiden Ak-teure zu den einzelnen Wissensarten abgeleitet. Der Erl€auterung des empirischenVorgehens folgt die Beschreibung der Resultate der einzelnen Fallstudien. Anhand einesFallvergleichs werden anschliessend die Hypothesen zum Wissensbeitrag von Verwaltungund externen Experten diskutiert und die Ergebnisse mit Bezug auf die theoretischenKontroversen reflektiert. In den Schlussfolgerungen wird die konzeptionelle, empirischeund theoretische Relevanz des Artikels einschliesslich seiner demokratietheoretischenImplikationen gew€urdigt.
Typologie politikrelevanten Wissens
Evidenz wird in der Literatur unterschiedlich definiert. In ihrem Policy-Paper w€ahlte dieLabour-Regierung urspr€unglich einen sehr breiten Evidenzbegriff:
“The raw ingredient of evidence is information. Good quality policy making depends on high-
quality information, derived from a variety of sources—expert knowledge; existing domestic and
international research; existing statistics; stakeholder consultation; evaluation of previous poli-
cies; new research, if appropriate; or secondary sources, including the internet.” (Cabinet Office
1999b: 33)
Entgegen diesem breiten Begriff (vgl. z.B. auch Nutley et al. 2007), der auch Expertenwis-sen umfasst, werden in Studien h€aufig nur Erkenntnisse als Evidenz gez€ahlt, die mit wissen-schaftlichen Methoden gewonnen wurden, wobei umstritten ist, welche Forschungsmethodenverl€assliche Evidenz hervorbringen (Davies et al. 2000; Donaldson et al. 2008). So gibt eseinen ganzen Strang der Forschung, der ausschliesslich experimentelle Ergebnisse ber€ucksich-tigt (z.B. Coalition for Evidence-Based Policy 2012), womit jedoch viel f€ur diePolitikformulierung relevantes Wissen unbeachtet bleibt. Angesichts der Komplexit€at vonPolitik st€osst aber auch ein breiterer Evidenzbegriff an Grenzen: Die Mess- und Vor-hersehbarkeit der Wirkungen staatlichen Handelns sind beschr€ankt, was die Aussagekraftvon wissenschaftlichen Erkenntnissen schm€alert (Sanderson 2006; Schneider 2008; Weisset al. 2008). Bereits das Problem, das mit einer Politik gel€ost werden soll, ist h€aufig nicht klardefiniert (Parsons 2004: 50), womit unklar bleibt, welche Massnahmen f€ur die L€osung €uber-
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 455
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

haupt in Betracht kommen und somit einer evidenzbasierten €Uberpr€ufung unterzogen wer-den sollten. Gleichzeitig sind aufgrund der Komplexit€at und Kontextabh€angigkeit zu jedereinzelnen politischen Massnahme so vielf€altige wissenschaftliche Abkl€arungen mit entspre-chend grossem Aufwand notwendig (vgl. das Fallbeispiel von Pawson et al. 2011), dass nureine sehr begrentze Anzahl von Massnahmen €uberpr€uft werden kann. Ferner muss Evidenzaufbereitet werden, damit sie von politischen Akteuren zur Kenntnis genommen wird (Frey2012; Tenbensel 2004). In der Praxis sind EBP somit vielerlei Schranken gesetzt. Politik kannnie bis ins letzte evidenzbasiert sein, sondern es handelt sich um ein Kontinuum (Monaghan2008), weshalb in der Literatur auch von evidence-informed, evidence-inspired oder evidence-aware gesprochen wird (Nutley et al. 2003, 2010).
Um der Begrenztheit des EBP-Ansatzes zu begegnen, wurde verschiedentlich vorgeschla-gen, neben wissenschaftlichen Studien andere Arten von Wissen wie namentlich Praxis-und Erfahrungswissen als Teil politikrelevanter Evidenz zu ber€ucksichtigen (Head2008; Nutley et al. 2003, 2007; Parsons 2004; Sanderson 2009, 2010; Strydom et al.2010; Vreugdenhil und Ker Rault 2010), wobei unklar bleibt, was darunter genau zuverstehen ist. Zudem besteht die Gefahr, dass damit verschiedene Wissensarten, die dur-ch unterschiedliche Akteure eingebracht werden und unterschiedlichenGesetzm€assigkeiten folgen, unter einem Begriff subsummiert werden.
In der Folge wird deshalb eine analytische Trennung verschiedener politikrelevanter Wis-sensarten entwickelt. Dabei wird zun€achst zwischen Evidenz und Expertise und anschlies-send zwischen drei Politikdimensionen differenziert.
Evidenz versus Expertise
Um das Praxis- und Erfahrungswissen zu erfassen, f€uhrt der vorliegende Beitrag nebenEvidenz die Expertise als weitere Wissensart ein. Evidenz wird verstanden als forschungsbasierteInformation, die den beiden Kernmerkmalen von Wissenschaftlichkeit entspricht (Sager undLedermann 2008): Sie muss einerseits mittels eines systematischen Verfahrens generiert undandererseits in intersubjektiv nachvollziehbarer Form festgehalten worden sein. Gefordertwird somit nicht nur ein systematisches Vorgehen (Head 2010b: 77: rigourous; Nutley et al.2003: 128), sondern zus€atzlich, was Frey die Transparenz der Ergebnisse nennt:
„Die Darstellung und Interpretation der erhobenen Informationen muss transparent erfolgen,
damit die Angemessenheit bzw. die Validit€at und Reliabilit€at der Erkenntnisse beurteilt werden
kann.” (Frey 2012: 22, Hervorhebung im Original)
Evidenz muss somit unabh€angig beobachtet und €uberpr€uft werden k€onnen (Rycroft-Malone et al. 2004). Daf€ur m€ussen die Informationen objektgebunden sein, d.h. sie m€ussenphysisch auf Papier oder elektronisch in einem Computer bzw. auf einem Server schriftlichfestgehalten und zug€anglich sein. Die Urheberschaft von Evidenz wird bewusst offen gelas-sen; es kann sich um wissenschaftliche Studien von Hochschulen oder Auftragsarbeitenvon Privaten handeln, aber auch um Informationen, welche die Verwaltung selber zusam-mentr€agt, sofern sie den obigen Anforderungen gen€ugen. Evidenz kann sowohl spezifischestaatliche Interventionen als auch generelle gesellschaftliche Ph€anomene und Entwicklun-gen betreffen (Head 2008: 4). Es wird somit ein Evidenzbegriff mittlerer Breite gew€ahlt,der zwar auf wissenschaftliche Erkenntnisse eingeschr€ankt ist, gleichzeitig aber keine be-stimmte Forschungsmethode voraussetzt.
Durch die Objektivierung wird Evidenz statisch, d.h. sie ist nicht so schnell ver€anderbar.Dies unterscheidet die objektgebundene Evidenz von personengebundener Expertise. Als
456 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Experte wird im allgemeinen Sprachgebrauch eine Person bezeichnet, die auf einem be-stimmten Gebiet €uberdurchschnittlich viel weiss, sei dies, weil sie es beforscht oder sich in-tensiv damit besch€aftigt und deshalb viel Erfahrung darin hat. Expertise geht gem€ass derKognitionspsychologie allerdings €uber reines Wissen hinaus und umfasst die F€ahigkeit,Kenntnisse situationsgerecht flexibel abzurufen und anzuwenden (Dreyfus und Dreyfus2005; Gigerenzer 2008; Patton 2014). Experten zeichnen sich dadurch aus, dass sie auchkomplexe Situationen schnell erfassen und deuten k€onnen (Chi et al. 1988). Um dieseF€ahigkeit zu erlangen, ist eine langj€ahrige und bewusste Besch€aftigung mit einem Themanotwendig. Gemeinhin werden in der Literatur zehn Jahre als notwendig erachtet, damitjemand Expertise erlangen kann (Ericsson 2006).
Durch Expertenbefragungen kann Expertise zwar systematisch erhoben und zu objektge-bundener Evidenz werden. Dabei geht die Flexibilit€at und situative Anwendung, die Exper-tise gegen€uber Evidenz auszeichnet, allerdings bis zu einem gewissen Grade verloren.Zudem umfasst Expertise neben explizitem ebenso implizites Wissen (zu den verschiedenenWissensarten vgl. Nutley et al. 2003), das auch mithilfe bestimmter Techniken (vgl. Bekkeret al. 2010; Rycroft-Malone et al. 2004; Tourmen 2009) nur zum Teil explizierbar ist. Umimplizites Wissen zu ber€ucksichtigen, wie dies verschiedentlich in der EBP-Literatur gefor-dert wurde (Hansen und Rieper 2010; Parsons 2004; Sanderson 2010; Tenbensel 2004; Weisset al. 2008), ist der direkte Einbezug von Experten in den Politikprozess unabdingbar.
Policy, Politics, Polity
Dem EBP-Slogan What matters is what works folgend, fokussierten Studien zu evidenzba-sierter Politik bisher auf Wissen zur Zielerreichung von politischen Massnahmen. F€ur eineerfolgreiche wissensbasierte Politikformulierung ist jedoch weiteres Wissen relevant (vgl.z.B. Head 2008, 2010a; Nutley et al. 2003; Pawson et al. 2011), das in der Folge inAnlehnung an die im Englischen begrifflich unterschiedenen drei PolitikdimensionenPolicy, Politics und Polity (Schubert und Bandelow 2003) kategorisiert wird. Alle dreiKategorien von Wissen k€onnen sowohl in Form von Evidenz als auch von Expertisevorliegen (vgl. Abbildung 1).
(1) Wissen zum Inhalt der Politik (Policy): Das f€ur die Politikformulierung notwendigesubstantielle Wissen kann, mit R€uckgriff auf die Wissenstypologie von Nutley, Walter undDavies (2003: 128), in drei Bestandteile eingeteilt werden: (a) Know-what works: die Kennt-nis dessen, inwiefern Interventionen die erw€unschten Wirkungen zeitigen, also ihre Zieleerreichen. Dies entspricht dem oben genannten urspr€unglichen Kern von EBP. (b) Know-about problems: Wissen €uber das Problem, das durch die Intervention gel€ost werden soll,und seine Ursachen. Welche Gruppen sind vom Problem betroffen? Wie stark sind die
Dimension
Policy
Politics
Polity
Evidenz
Inhalt
Prozess
Recht
Expertise
Inhalt
Prozess
Recht
Abbildung 1: Typologie politikrelevanten Wissens
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 457
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Beeintr€achtigungen? Was sind die Ausl€oser des Problems und wie entwickelt es sich vor-aussichtlich in Zukunft? Um eine zielgerichtete politische Massnahme zu formulieren,m€ussen diese Fragen beantwortet werden (vgl. auch Pawson et al. 2011: 520, Box 2, Frage1). (c) Know-how to put into practice: Wissen, wie die Massnahmen umgesetzt werdenk€onnen, wird in der Literatur als sehr wichtig erachtet (Ledermann und Sager 2009; Par-sons 2004; Sanderson 2010; Tenbensel 2004; Weiss et al. 2008). Dieses praktische Vollzugs-wissen (practical implementation knowledge bei Head 2008) umfasst insbesondere dasWissen der Fachpersonen, die mit den Adressaten der Massnahmen in Kontakt stehen.Unter Umst€anden liegt dieses Wissen auch bei den Adressaten selbst (Head 2010a). Letzt-lich geht es darum, dass die formulierten Gesetze umsetzbar sind (vgl. auch Pawson et al.2011: 520, Box 2, Frage 4).3
(2) Wissen zum Prozess (Politics): Hierbei handelt es sich um Wissen zur Gestaltungvon Politikformulierungsprozessen, also dazu, wie man Gesetze macht, d.h. um die Kennt-nis der verschiedenen Phasen eines Politikformulierungsprozesses. Welche Grundlagen sindzu welchem Zeitpunkt notwendig? Welche Konsultationen werden wann durchgef€uhrt usw.(vgl. z.B. Bundesamt f€ur Justiz 2007). Dazu geh€ort auch, was Head (2008) political knowl-edge nennt: die Kenntnis von Strategien, um Themen auf die politische Agenda zu setzen,sie zu einer Priorit€at zu machen und die Hauptbotschaften f€ur die politisch relevanten Ak-teure verst€andlich zu kommunizieren. Schliesslich geh€ort dazu Wissen, wie Verhandlungengef€uhrt und Kompromisse geschmiedet werden und wie gegebenenfalls die Unterst€utzungder Bev€olkerung sicherzustellen ist (vgl. auch Pawson et al. 2011: 520, Box 2, Fragen 2und 3).
(3) Rechtliches Wissen (Polity): Im Gesetzesstaat, wie er in Kontinentaleuropaeinschliesslich der Schweiz existiert (Kickert 2008), muss – im Unterschied zur angels€achsi-schen Welt (Christensen et al. 2010) – s€amtliches staatliches Handeln an ein formales, vomParlament legitimiertes Gesetz gebunden sein (P€otzsch 2009: 28–31). Dem rechtlichenWissen kommt deshalb in institutioneller Hinsicht ein hoher Stellenwert zu.4 Gesetze sindgenerell und abstrakt (Bussmann 2010: 279): Generell bedeutet, dass Gesetze f€ur eine Viel-zahl von nat€urlichen und juristischen Personen, einschliesslich Beh€orden, gelten – h€aufigf€ur die ganze Bev€olkerung und das gesamte staatliche Territorium. Abstrakt meint, dasssie eine Vielzahl von Sachverhalten regeln. Das Formulieren solch generell-abstrakterRechtsnormen, die f€ur die Anwendung im Einzelfall gleichzeitig klar und unmiss-verst€andlich sein m€ussen (Pawson et al. 2011: 520), ist anspruchsvoll. Es erfordert juristi-sches Spezialwissen im jeweiligen Sachgebiet, einschliesslich Wissen zur Rechtsprechungund zum internationalen Recht.
Aus der Differenzierung zwischen Evidenz und Expertise einerseits und den drei Politik-dimensionen andererseits ergibt sich eine Typologie von sechs Arten politikrelevanten Wis-sens (vgl. Abbildung 1). Nun stellt sich die Frage, welchen Beitrag die Verwaltung undexterne Experten zu den unterschiedlichen Wissensarten leisten.
3 Im Unterschied zur Kategorie „Wissen zum Prozess“ bezieht sich dieses Wissen nicht auf den Prozess der For-
mulierung der Politik, sondern auf den Prozess der Umsetzung. Aus der Perspektive der Politikformulierung han-
delt es sich somit um Wissen f€ur die sp€atere inhaltliche Realisierung der Politik.4 Mit der Reduktion auf den rechtlichen Aspekt wird hier ein enger Institutionenbegriff gew€ahlt (zu verschiedenen
Institutionenbegriffen vgl. den ber€uhmten Beitrag von Hall & Taylor 1996).
458 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Verwaltung und externe Experten: theoretische Kontroversen und Hypothesen
In der Literatur wird gerade bez€uglich des schweizerischen Kontexts kontrovers beurteilt,welche Rolle die Verwaltung und externe Experten f€ur eine wissensbasierte Politikformulie-rung spielen. Max Weber verstand die Verwaltung als Hort des Wissens:
„Die b€urokratische Verwaltung bedeutet: Herrschaft kraft Wissen: dies ist ihr spezifisch rationa-
ler Grundcharakter.” (Weber 1947)
Gem€ass Webers Idealtypus ist die B€urokratie allerdings eine von der Politik getrennte,rein ausf€uhrende Gewalt (Sager und Rosser 2009). Mittlerweile ist hingegen anerkannt,dass die Verwaltung nicht nur Politik umsetzt, sondern auch an deren Formulierungwesentlich beteiligt ist (Nicholson-Crotty 2005; Page 2003; Sager 2007b). Inwiefern die Ver-waltung dabei als Hort des Wissens betrachtet werden kann, ist fraglich. Einerseits wurdekonstatiert, die Schweizer Bundesverwaltung sei im letzten Jahrhundert nicht nur kr€aftiggewachsen, sondern auch deutlich professioneller geworden, so dass sie verst€arkt selber€uber das Wissen verf€ugt, um Gesetze zu formulieren (Sciarini 2006). Andererseits wurde inStudien sowohl zur Schweiz als auch international diagnostiziert, dass das Wissen der Ver-waltung beschr€ankt ist. So wurde im Falle Kanadas festgestellt, dass die Verwaltung sogarbeim Vorhandensein spezialisierter Politikanalyseeinheiten kaum selber Analysen durch-f€uhrt (Howlett 2009: 250; Howlett und Walker 2012). In der Schweiz gibt es kaum ver-waltungsinterne Analyseeinheiten. Eine Untersuchung einzelner F€alle ergab denn auch,dass die Bundesverwaltung in beschr€anktem Masse eigenes Wissen in die Politik einge-bracht hat (Frey 2012). Gem€ass Selbstdeklaration dagegen generiert die Verwaltung aufKantonsebene praktisch immer Evidenz im Gesetzgebungsprozess und wertet h€aufig beste-hende Evidenz aus (Balthasar und M€uller 2014). Einhellig zeigt die Literatur, dass dieVerwaltung einen wichtigen Kanal darstellt, €uber den externes Wissen in die Politik einflies-sen kann (Freeman et al. 2011; Frey 2012; Howlett 2011; Sager und Andereggen 2012;Sager 2007b).
S€amtliche modernen Staaten verf€ugen €uber ein System der Politikberatung, das nebenstaatlichen auch private Akteure umfasst (Howlett 2011). Externe Experten sind beispiels-weise in Deutschland (D€ohler 2012), den Niederlanden (Bekker et al. 2010), Island(Guðmundsson et al. 2010), dem Vereinigten K€onigreich (Monaghan 2010), Griechenland(Ladi 2005), den USA (Lavertu und Weimer 2010) und Neuseeland (Tenbensel 2004) re-gelm€assig an der Politikformulierung beteiligt. In der Schweiz ist die Mitwirkung externerExperten im Gesetzgebungsprozess traditionell ausgepr€agt (Sciarini 2004; Vatter 2014). Sieist als Zeichen einer starken Kompromissorientierung zu verstehen, die sich aus den direkt-demokratischen Instrumenten heraus entwickelt hat (Neidhart 1970). Zwischen 1995 und1999 wurde etwa ein F€unftel der im Schweizer Parlament beratenen Gesetzesentw€urfe durcheine formell eingesetzte Expertenkommission vorbereitet (Sciarini 2006). Daneben existie-ren weitere Formen des Expertenbeizugs: Beispielsweise werden einzelne Experten zuspezifischen Fragen mit Gutachten beauftragt oder angeh€ort. Als „Experten” werden oftalle extern beigezogenen Akteure bezeichnet, wobei nicht gesichert ist, dass ihnen in jedemFall ein Expertenstatus im Sinne eines vertieften Wissens bez€uglich des Politikfeldszukommt.
Kontrovers beurteilt wird, inwiefern der Einbezug externer Kreise zu einer wissensbasier-ten Gesetzgebung beitr€agt. Gem€ass dem allgemeinen Tenor der Literatur setzt die Not-wendigkeit von Kompromissen einem evidenzbasierten Ansatz in der Schweiz klar Grenzen(OECD 2006; PVK 2005; Spinatsch 2006). Die Konsens- und Kompromissorientierung
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 459
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

wird h€aufig gar als wichtigster Hemmfaktor f€ur eine evidenzbasierte Politikgestaltunggenannt (vgl. Bussmann 1997, 2008; Kl€oti und Schneider 1989; Sager und Rissi 2011; Sager2007a; Spinatsch 2002). Am pointiertesten formulieren es Widmer und Neuenschwander(2004: 391):
„To avoid failures in subsequent plebiscites, administration, government and parliament
strongly emphasize the need to ensure broad support prior to suggesting any new policy. There-
fore policy making in Switzerland is oriented toward gathering support more than toward
gathering evidence.”
Andererseits erw€ahnen einzelne Autoren die vielf€altigen Konsultationsmechanismen imschweizerischen vorparlamentarischen Prozess (Vernehmlassungen, Expertenkommissionen,Anh€orungen, €Amterkonsultationen und Mitberichtsverfahren) als wichtige Zugangskan€alef€ur Wissen im Gesetzgebungsprozess (Bussmann 2008; Frey 2010; Germann 1985; Sciarini2006). Auch in der internationalen Literatur wird der Zugang externer Experten zum poli-tischen Prozess f€ur die Verwertung von Wissen als wichtig erachtet (vgl. u.a. Ladi 2005;Schrefler 2010; Weiss 1999). Empirische Studien weisen darauf hin, dass Experten in ersterLinie wegen ihrem Wissen in die Politikformulierung eingebunden werden (D€ohler 2012;Lavertu und Weimer 2010). Der Einsatz von Experten in die Politikformulierung ist funk-tional angebracht (Sager und Andereggen 2012), insbesondere wenn eine dauerhafte An-stellung von qualifiziertem Personal sich nicht lohnt. Gerade in komplexen, neuen und sichschnell €andernden Politikbereichen bietet sich der R€uckgriff auf Experten f€ur die Verwal-tung an:
„Administrative agencies in the United States face a challenge in maintaining adequate in-house
expertise to help them perform their regulatory functions in domains involving rapidly changing
technology or knowledge. Civil service laws make it difficult to hire and fire, federal agencies often
are unable to compete with the private sector for expert personnel, and the ad hoc nature of the
expertise agencies require may not justify hiring additional staff. Consequently, agencies routinely
turn to advisory committees for supplemental expertise.” (Lavertu und Weimer 2010: 1)
Ein Beizug externer Experten macht nur Sinn, wenn auf ihren Rat geh€ort wird. Gleich-zeitig stellt sich in diesem Fall die demokratietheoretische Frage, ob Partikul€arinteressen innicht legitimierter Weise Gewicht erhalten (Lavertu und Weimer 2010). Diese Frage stelltsich umso deutlicher, als in der Literatur eine gewisse N€ahe der externen Experten zurPolitik als notwendig erachtet wird, damit deren Expertise dem politisch Machbarenentspricht und verwendet werden kann (Bekker et al. 2010; D€ohler 2012; Lavertu undWeimer 2010; Sager und Andereggen 2012).5 Im politischen System der Schweiz akzentu-iert sich die Problematik dadurch, dass Experten explizit nicht nur zus€atzliches Fachwissenund Sachverstand einbringen, sondern auch eine Repr€asentationsfunktion wahrnehmen sol-len (Germann 1981, 1985; Sciarini 2006).6 Sie sollen gew€ahrleisten, dass bestimmte Interes-sen fr€uhzeitig eingebunden werden, um gut abgest€utzte Kompromisse zu erm€oglichen.Gleichzeitig handelt es sich bei der Gesetzgebung um das Mittel des Staates schlechthin(D€ohler 2012), das ihn von anderen Akteuren unterscheidet (Leresche 2001). €Uber dasGesetz soll der Rechtsstaat gew€ahrleistet werden, weshalb an den Gesetzgebungsprozess
5 Diesbez€uglich stellt sich die in der Diskurstheorie zentral debattierte Frage, inwiefern interessen- oder ideologie-
freies Wissen €uberhaupt m€oglich ist (vgl. z.B. Fischer & Forester 1993).6 Die doppelte Funktion von Interessenvertretung und Expertise ist jedoch nicht einmalig. Sie zeigt sich z. B. auch
in Griechenland, wo Experten h€aufig enge Parteibindungen aufweisen (Ladi 2005).
460 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

hohe demokratische Anforderungen gestellt werden. Der Beizug von Experten l€auft jedochin der Regel informell, insbesondere in der fr€uhen Phase von Gesetzgebungsprozessen, wasaus Sicht der Input-Legitimit€at des Staates, die auf demokratischen Prozessen gr€undet, kri-tisch zu beurteilen ist. Fraglich ist, inwiefern der Beizug von Experten die Output-Legiti-mit€at des Staates erh€oht, indem er zu einer besseren Probleml€osung und damit zurSteigerung der allgemeinen Wohlfahrt beitr€agt (Widmer 2009).
Der Wissensbeitrag von Verwaltung und externen Experten ist somit aus theoretischerPerspektive von Interesse. Anhand der Typologie der politikrelevanten Wissensarten l€asster sich differenziert erfassen. Zu diesem Zweck werden im Folgenden aus der Literatur dietheoretischen Annahmen zum Beitrag von Verwaltung und externen Experten zu den ver-schiedenen Arten von Wissen abgeleitet.
Hypothesen zum Wissensbeitrag der Bundesverwaltung
Gem€ass der Literatur ist davon auszugehen, dass die Bundesverwaltung zu den verschiede-nen Wissensarten unterschiedlich viel beisteuert. In der Folge werden die Hypothesen zumBeitrag der Verwaltung zu den einzelnen Wissensarten formuliert und am Ende inTabelle 1 zusammengefasst.
Um Evidenz beizutragen, muss die Verwaltung laut Howlett (2009) €uber politikanalyti-sche Kapazit€aten (policy analytical capacity) verf€ugen:
“It [policy analytical capacity] refers to the amount of basic research a government can conduct
or access, its ability to apply statistical methods, applied research methods, and advanced mo-
delling techniques to this data and employ analytical techniques such as environmental scanning,
trends analysis, and forecasting methods in order to gauge broad public opinion and attitudes,
as well as those of interest groups and other major policy players, and to anticipate future po-
licy impacts” (Howlett 2009: 162–163).
Politikanalytische Kapazit€aten sind, wie durch Howlett definiert, notwendig, um Evidenzzum Inhalt und, wie die Erw€ahnung von Methoden zur Einstellungsmessung zeigt, Evidenzzum Prozess beizutragen. Laut Howlett sind die politikanalytischen Kapazit€aten in West-europa generell schw€acher ausgepr€agt als in der angels€achsischen Welt, weil der Fokustraditionell eher auf einer starken rechtlichen und finanziellen Kontrolle liege. Dies d€urfteauch auf die Schweiz zutreffen. So fand Frey (2012) nur in einem von vier Politikbereichenin der Verwaltung politikanalytische Kapazit€aten vor. Die verwaltungsinterne inhaltlicheund prozessuale Evidenz werden deshalb als gering angenommen. Hypothesen bez€uglichder rechtlichen Evidenz im Politikprozess lassen sich aus der vorhandenen Literatur keineableiten.
Juristisches Wissen im Sinne von Expertise wird der Schweizer Bundesverwaltung dage-gen durchaus zugestanden (Kl€oti und Schneider 1989; Spinatsch 2006), w€ahrend diegleichen Studien die inhaltliche Expertise als beschr€ankt beschreiben. Frey (2012)
Tabelle 1: Hypothesen zum Wissensbeitrag der Verwaltung
Evidenz Expertise
Inhalt gering geringProzess gering ?
Recht ? gross
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 461
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

differenziert, dass die inhaltliche Expertise der Bundesverwaltung insbesondere in Re-gelungsbereichen, die neu sind oder f€ur deren Umsetzung sie nicht selber zust€andig ist, be-grenzt ist. In England wird Politik gem€ass Page und Jenkins (2005) nicht durch Juristenoder Fachexperten, sondern von Prozessexperten formuliert, die im Regierungsstab arbei-ten. Die Gesetzesformulierung in der Schweiz findet dagegen in den Verwaltungseinheitenstatt. Da diese nicht tagt€aglich mit der Formulierung von Gesetzen besch€aftigt seind€urften, ist fraglich, inwiefern sie €uber Prozessexpertise verf€ugen, doch gibt es hierzu bis-lang keine Literatur.
Hypothesen zum Wissensbeitrag externer Experten
Von „Experten” ist, wie der Begriff bereits suggeriert, Expertise zu erwarten. Wie obenerw€ahnt, spielt die Repr€asentationsfunktion von Experten im schweizerischen Kontext abereine wesentliche Rolle, weshalb h€aufig Personen zu „Experten” ernannt werden, welche nicht€uber besondere Expertise verf€ugen, so dass grunds€atzlich von einem begrenzten Wissensbei-trag auszugehen ist. Externe Experten k€onnen vor allem fachliche Expertise sowie, wenn essich um Juristen mit entsprechender Spezialisierung handelt, rechtliche Expertise beitragen.Hingegen ist von externen Experten als Aussenstehende keine vertiefte Prozessexpertise zu er-warten, weil diese eine gute Kenntnis der verwaltungsinternen Abl€aufe voraussetzt.
Experten, vor allem solche aus der Wissenschaft, k€onnen auch einen Beitrag zurEvidenzbasierung von Gesetzen leisten. Namentlich in Expertenkommissionen, f€ur welcheZahlen €alteren Datums verf€ugbar sind (Germann und Frutiger 1979; Germann 1981,1985), sind Personen aus der Wissenschaft deutlich weniger vertreten als die Kantone undGemeinden oder als Interessenorganisationen. Hinzu kommt, dass die Generierung, aberauch die systematische Aufbereitung von Evidenz aufwendig und kostspielig ist, weshalbvon externen Experten in der Regel nur ein Evidenzbeitrag zu erwarten ist, wenn sie vonder Verwaltung einen bezahlten Auftrag erhalten, was allerdings durchaus €ublich ist(Howlett 2011). Dass externe Akteure von sich aus Evidenz generieren oder aufbereiten(vgl. Beispiele bei Frey 2010), d€urfte aufgrund der damit verbundenen Kosten nur inAusnahmef€allen vorkommen. Der Evidenzbeitrag von externen Experten kann sichgrunds€atzlich sowohl auf den Inhalt (z.B. Evaluation bestehender Massnahmen), denProzess (z.B. Befragung der Interessengruppen zur Unterst€utzung m€oglicher Massnahmen)als auch das Recht (z.B. internationaler Rechtsvergleich) beziehen – je nach Auftrag derVerwaltung und Spezialisierung der externen Experten.
Tabelle 2 stellt die Hypothesen in Kurzform dar.
Empirisches Vorgehen
Die Hypothesen werden anhand eines vergleichenden Fallstudiendesigns €uberpr€uft. Fall-studien eignen sich besonders gut, um kausal komplexe Ph€anomene wie den Einbezug
Tabelle 2: Hypothesen zum Wissensbeitrag externer Experten
Evidenz Expertise
Inhalt gering, ausser bei bezahltem Auftrag an Wissenschaftler gering
Prozess gering, ausser bei bezahltem Auftrag an Wissenschaftler unbedeutendRecht gering, ausser bei bezahltem Auftrag an Wissenschaftler gering
462 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

von Wissen in die Gesetzgebung zu untersuchen (Freeman et al. 2011). Mittels einerProzessanalyse wurde untersucht, inwiefern die Bundesverwaltung und externe Expertendie verschiedenen in Abbildung 1 dargestellten politikrelevanten Wissensarten in derfr€uhen Phase des Gesetzgebungsprozesses eingebracht haben. Damit konzentriert sichdie Studie auf die Input-Seite einer wissensbasierten Politikformulierung. Inwiefern dieeinzelnen Wissenselemente im Policy-Output schliesslich ber€ucksichtigt wurden – d.h.inwiefern das Gesetz tats€achlich wissensbasiert ist –, wird dagegen nicht untersucht.Dies h€atte erfordert, dass jeweils der gesamte Gesetzgebungsprozess untersucht wordenw€are, was den Rahmen der vorliegenden Untersuchung gesprengt h€atte. Sie beschr€anktsich jedoch, wie in der Einleitung erw€ahnt, auf die f€ur die Frage nach demWissenseinbezug besonders relevante und bisher nie vertieft untersuchte Fr€uhphase desvorparlamentarischen Prozesses. Ein Gesetzgebungsprozess beginnt damit, dass eineVerwaltungseinheit von einem einzelnen Bundesrat oder dem Gesamtgremium ein Man-dat f€ur die Erarbeitung eines Gesetzes erh€alt. Die mandatierte, federf€uhrende Verwal-tungseinheit kann die Inhalte der Vorlage und den Prozess der Erarbeitung (z.B. Beizugvon verwaltungsinternen und -externen Akteuren) im Rahmen allf€alliger Vorgaben vonBundesrat und Departementsvorsteher frei gestalten. Es werden ein oder mehrereEntw€urfe erarbeitet. Zu einem der Entw€urfe wird in der Regel bei den Kantonen undInteressenverb€anden eine Vernehmlassung durchgef€uhrt, wobei der Entscheid €uber dieDurchf€uhrung einer Vernehmlassung beim Bundesrat liegt. Die vorliegende Untersu-chung deckt die Fr€uhphase von der Erteilung des Mandats an die Verwaltungseinheitbis zum Entscheid des Bundesrates €uber die Er€offnung der Vernehmlassung ab.
Die Auswahl der F€alle erfolgte aufgrund von theoretischen €Uberlegungen (Blatter et al.2007: 149–157). Als Grundgesamtheit werden komplexe Politikformulierungsprozesse be-trachtet: umfassende Gesetze, die neu erarbeitet oder komplett €uberarbeitet (Totalrevision)werden. Um die Vergleichbarkeit zu gew€ahrleisten, wurde ein homogener Kontext gew€ahlt(Berg-Schlosser und De Meur 2009). Den institutionellen Rahmen bildet die schweizerischeBundesverwaltung. Sie spielt bei der Gesetzesformulierung eine zentrale Rolle, weil derRegierungsstab des Bundesrates klein ist (Varone 2006) und die Verwaltung auchgegen€uber dem Milizparlament eine starke Stellung einnimmt (L€uthi 2009).
Um den Kontext m€oglichst konstant zu halten, wurde eine zeitliche Abgrenzung ein-gef€uhrt. Gew€ahlt wurden F€alle, bei welchen w€ahrend der 46. Legislatur (1999–2003) dieVernehmlassung er€offnet wurde und bei denen mindestens in den vier Jahren zuvor keinWechsel an der Departementsspitze stattgefunden hat, so dass sich der politische Rahmen€uber eine gewisse Stabilit€at auszeichnete. Die F€alle mussten zum Zeitpunkt, als die Arbei-ten am Forschungsprojekt starteten (Oktober 2006), aus Verwaltungssicht abgeschlossensein, d.h. die Botschaft des Bundesrates an das Parlament musste vorliegen, damit derZugang zu den Dokumenten gew€ahrt werden konnte.7
Da sowohl die Rolle der Verwaltung als auch jene der externen Experten hinsichtlich ih-res Wissensbeitrags beobachtet werden soll, wurden F€alle mit unterschiedlichen Erarbei-tungsformen gew€ahlt, namentlich vorwiegend verwaltungsintern und vorwiegend externerarbeitete Vernehmlassungsentw€urfe. Zudem wurden F€alle aus verschiedenen Ver-waltungseinheiten gew€ahlt, in der Annahme, dass deren politikanalytische Kapazit€atunterschiedlich ist (Balthasar 2007; Frey 2012).
7 Das €Offentlichkeitsgesetz, das den Zugang zu Dokumenten der Bundesverwaltung gew€ahrleistet, trat erst am 1.
Juni 2006 in Kraft und gilt nicht r€uckwirkend. Gewisse Verwaltungsstellen lehnten die im Rahmen des For-
schungsprojekts gestellten Gesuche um Dokumenteneinsicht denn auch ab.
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 463
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Schliesslich zeigen empirische Studien deutlich, dass starke Konflikte in Politikprozessendazu f€uhren, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht verwendet werden, um eine bessereL€osung zu finden, sondern dass sie lediglich selektiv herangezogen werden, um bereitsbestehende Positionen zu untermauern (Alkin 1985; Chelimsky 1995; Monaghan 2010; Ris-si und Sager 2013; Sager und Ledermann 2008; Schrefler 2010; Weible 2008; Weiss 1999).Zuweilen wird der Entscheidungsprozess so sehr durch die Konflikte dominiert, dass €uber-haupt kein Raum f€ur die Auseinandersetzung mit vorhandener wissenschaftlicher Evidenzbleibt (Frey 2012; Ledermann 2012). Wie die zitierten empirischen Studien zeigen, hat dasWissen in konfliktiven Situationen auch im Falle einer argumentativen Verwendung keinenEinfluss auf das Resultat des politischen Prozesses. Dies wird damit begr€undet, dass starkeKonflikte in der Regel die Ebene der Ideologie betreffen und sich ideologische Konflikteim Gegensatz zu Auseinandersetzungen €uber die Instrumente einer Politik nicht €uberzus€atzliches Wissen l€osen lassen (Sabatier und Jenkins-Smith 1993; Weible und Sabatier2009). Bei einer hohen Konfliktivit€at muss deshalb davon ausgegangen werden, dass sichWissen, das als Input in den Prozess gespeist wird, nicht im Output manifestiert, also nichtvon einem tats€achlich wissensbasierten Prozess ausgegangen werden kann. Da aber in dervorliegenden Untersuchung nur der Wissens-Input betrachtet und der Output nicht kon-trolliert wird, wurden bewusst keine sehr umstrittenen Gesetzgebungsprozesse betrachtet,sondern nur solche, die sich – zumindest w€ahrend der untersuchten Phase – durch einentiefen oder mittleren Konfliktgrad auszeichneten.
Die F€alle sind in Tabelle 3 aufgef€uhrt. Im Anhang finden sich zudem die Eckdaten zu je-dem Fall.
Methodisch steht die Dokumentenanalyse im Zentrum. S€amtliche in den Archiven derfederf€uhrenden Verwaltungseinheit vorhandenen Dokumente wurden gesichtet und imHinblick auf die interessierenden Dimensionen anhand eines Fallstudienprotokolls in Formeines Rasters analysiert (Yin 2003). Erfasst wurden die beteiligten Personen, die Art ihrerBeteiligung sowie ihr institutioneller und fachlicher Hintergrund, Hinweise bez€uglich Kon-flikten zwischen den beteiligten Personen, der Inhalt der Er€orterungen (wor€uber wurdegesprochen, was wurde abgekl€art bez€uglich Inhalt, Prozess, Recht), archivierte wissenschaft-liche Studien, Arbeitspapiere und Grundlagen sowie Verweise auf Studien.
Zur Validierung wurden mit ein bis zwei Personen pro Fall Interviews durchgef€uhrt. Da-bei handelte es sich um die bei den Verwaltungseinheiten f€ur die Projektleitung zust€andigenPersonen. In einem Fall (Vormundschaftsrecht) wurde zus€atzlich mit einem externen Exper-ten gesprochen, weil der Prozess zu Beginn fast vollst€andig externalisiert worden war. Dadie Gesetzgebungsprojekte f€ur die Personen meist schon mehrere Jahre zur€ucklagen, war ihrErinnerungsverm€ogen beschr€ankt (vgl. Diekmann 1998). Bei den Gespr€achen ging es des-halb vor allem darum sicherzustellen, dass kein wichtiger Aspekt des Falles €ubersehen
Tabelle 3: Fallwahl (federf€uhrende Verwaltungseinheit in Klammer)
politische Konfliktivit€at
mittel tief
Einbezug
Externer
schwach Sicherheitskontrollgesetz
(Generalsekretariat UVEK)
Transplantationsgesetz
(Bundesamt f€ur Gesundheit)stark Sprachengesetz
(Bundesamt f€ur Kultur)Vormundschaftsrecht(Bundesamt f€ur Justiz)
464 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Tabelle
4:Skalenzum
Wissensbeitrag
Auspr€ agung
JuristischeExpertise
Fachexpertise
Prozessexpertise
Evidenz
(zujeweiliger
Dim
ension)
unbedeutend
Keineoder
marginale
BeteiligungvonPersonen
mit
juristischer
Expertise.
Keineoder
marginale
BeteiligungvonPersonen
mit
Fachexpertise.
Keineoder
marginale
BeteiligungvonPersonen
mit
Prozessexpertise.
KeineRezeption
wissenschaftlicher
Studien
UND
keineGenerierungvon
Evidenz.
gering
EffektiveBeteiligungvon
mindestenseiner
Personmit
genereller,aber
nicht
spezialisierterjuristischer
Expertise.
EffektiveBeteiligungvon
mindestenseiner
Personmit
beschr€ ankterFachexpertise
(z.B.erworben
durch
Erfahrung,nicht
Ausbildung).
EffektiveBeteiligungvon
mindestenseiner
Personmit
beschr€ ankter
Prozessexpertise
(beschr€ ankte
Gesetzgebungserfahrung
bzw
.Kenntnisdes
Gesetzgebungsleitfadens
usw
.)
Einzelner
Hinweisaufeinebis
zwei
wissenschaftliche
StudienUND/O
DER
GenerierungvonEvidenz,
deren
System
atiketwas
fragw€ urdig
ist.
moderat
Punktuelle
effektive
Beteiligungvoneiner
oder
zwei
Personen
mit
spezialisierterjuristischer
Expertise.
Punktuelle
effektive
Beteiligungvoneiner
oder
zwei
Personen
mit
ausgew
iesener
Fachexpertise.
Punktuelle
effektive
Beteiligungvoneiner
oder
zwei
Personen
mit
Erfahrungin
Gesetzgebungsprojektleitung.
WiederholteHinweise
aufeine
biszw
eiwissenschaftliche
StudienUND/O
DER
Generierungvon
system
atischer
Evidenzzu
einem
biszw
eiThem
en.
eher
viel
Punktuelle
effektive
Beteiligungvondreioder
mehrPersonen
mit
spezialisierterjuristischer
Expertise.
Punktuelle
effektive
Beteiligungvondreioder
mehrPersonen
mit
ausgew
iesener
Fachexpertise.
Punktuelle
effektive
Beteiligungvondreioder
mehrPersonen
mit
Erfahrungin
Gesetzgebungsprojektleitung.
Hinweise
aufdreioder
mehr
wissenschaftlicheStudien
ODER
Generierungvon
Evidenzzu
dreioder
mehr
Them
en.
viel
W€ ah
rendgesamtem
Prozess
effektiveBeteiligungvon
jeweilsmindestenszw
eiPersonen
mitspezialisierter
juristischer
Expertise.
W€ ah
rendgesamtem
Prozess
effektiveBeteiligungvon
jeweilsmindestenszw
eiPersonen
mitausgew
iesener
Fachexpertise.
W€ ah
rendgesamtem
Prozess
effektiveBeteiligungvon
jeweilsmindestenszw
eiPersonen
mitErfahrungin
Gesetzgebungsprojektleitung.
Hinweise
aufdreioder
mehr
wissenschaftlicheStudien
UND
Generierungvon
Evidenzzu
dreioder
mehr
Them
en.
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 465
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

wurde. Weiter dienten die Interviews dazu, zus€atzliche Informationen €uber die beteiligtenPersonen einzuholen. Diese Informationen wurden anschliessend mittels einer Internetre-cherche erg€anzt.
Hinsichtlich des Einbezugs der verschiedenen Arten von Expertise und Evidenz wurdeeine skalierende Inhaltsanalyse (Mayring 2003) der Fallraster vorgenommen. Die ange-wandte Skala ist in Tabelle 4 aufgef€uhrt.
Fallstudien
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Fallstudien strukturiert dargestellt, indemzun€achst kurz der Kontext beschrieben wird (Thematik des Gesetzgebungsprozesses, fe-derf€uhrende Verwaltungsakteure, Phasen des Erarbeitungsprozesses, Konfliktivit€at desProzesses), bevor die einbezogene Evidenz und Expertise dargestellt und der Wissensbeitragder verschiedenen Akteure tabellarisch zusammengefasst wird (Tabellen 5, 6, 7 und 8).8
Sicherheitskontrollgesetz
Thematik: Ausl€oser des Gesetzgebungsprozesses war ein Seilbahnungl€uck auf der Riederalpim Dezember 1996, bei dem sich die Frage nach der Rolle des Bundes als Aufsichtsbeh€ordestellte. Eine €Uberpr€ufung des zust€andigen Departements UVEK zeigte, dass die Kontrolleder technischen Sicherheit von Anlagen, Fahrzeugen, Ger€aten und Komponenten, f€ur wel-che die €Amter des UVEK zust€andig sind, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. DerDepartementsvorsteher beauftragte daraufhin sein Generalsekretariat, ein neues Gesetz zuerarbeiten, um die Verfahren zu vereinheitlichen und so zu regeln, dass der Staat die Kon-trolle nur noch wo notwendig selber wahrnimmt und sie ansonsten an Private auslagert.
Federf€uhrung: Generalsekretariat UVEK (GS-UVEK). Als Stabsstelle des Departements-vorstehers ist das GS-UVEK normalerweise f€ur die Koordination der Gesch€afte der€Amter, hingegen nicht f€ur Gesetzgebungsprozesse zust€andig. In diesem Fall wird dem GS-UVEK die Federf€uhrung €ubertragen, weil rund zehn €Amter des UVEK betroffen und diesedem Gesetzgebungsprojekt gegen€uber kritisch eingestellt sind (vgl. Konfliktivit€at).
Erarbeitungsprozess: Es lassen sich zwei Phasen unterscheiden:
1 Februar 1998 bis Januar 2000: Konzeptphase. Eine 3-k€opfige GS-interne Ar-beitsgruppe erstellt zwei Zwischenberichte zu den m€oglichen Stossrichtungen desGesetzes, die dem Departementsvorsteher als Entscheidungsgrundlage unterbreitetwerden.
2 Februar 2000 bis September 2001: Formulierungsphase. Die 3-k€opfige GS-interne Ar-beitsgruppe leitet weiterhin die Arbeiten. Zus€atzlich werden gr€ossere Arbeitsgruppengebildet, in denen die betroffenen Verwaltungseinheiten des UVEK vertreten sind undwelche die Gesetzesbestimmungen f€ur die jeweiligen Sachgebiete formulieren sollen.Der Bund sucht den Kontakt zu den Kantonen, welche zwei Vertreter delegieren. Zu-dem finden Aussprachen mit einzelnen Verb€anden statt.
Konfliktivit€at: Mittel. Die €Amter des UVEK lehnen das neue Gesetz ab, weil sie die tech-nische Sicherheit als gew€ahrleistet erachten und eine Einschr€ankung ihres Hand-lungsspielraums bef€urchten. Im Bereich der Motorfahrzeugkontrolle wehren sich die
8 Wie im Rest des Beitrags wird auch bei der Darstellung der F€alle ausschliesslich die m€annliche Form verwendet,
auch wenn es sich um weibliche Personen handelte.
466 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Kantone gegen eine Auslagerung an Private, weil sie zum Teil eigene Infrastrukturenerstellt haben. Verschiedene Verb€ande schalten sich ein, weil sie einen Mehraufwand undMehrkosten bef€urchten. Eine €offentliche Debatte findet in der betrachteten Phase nicht statt.
Evidenz: Die GS-interne Arbeitsgruppe erhebt mittels einer schriftlichen Befragung mitanschliessender Validierungsrunde systematisch die rechtlichen Grundlagen sowie die Um-setzung der sicherheitsrelevanten Aufgaben des Departements. Zudem konsultiert sie sechsMal die betroffenen €Amter und wertet deren Stellungnahmen jeweils systematisch aus, wasihr ein abgest€utztes Bild der Akzeptanz des Gesetzgebungsvorhabens erm€oglicht. Die ver-waltungsintern beigezogenen Akteure weisen die federf€uhrende Stelle nur in einem Fall aufeine wissenschaftliche Publikation zu risikobasiertem Recht (Seiler 2000) hin. Eines der€Amter f€uhrt auf Anstoss der internen Arbeitsgruppe eine Befragung zur Art der Risikobe-wertung in den €Amtern durch und generiert damit fachliche Evidenz. Die beigezogenenKantonsvertreter und konsultierten Verb€ande tragen weder zur Rezeption noch zur Ge-nerierung von Evidenz bei.
Expertise: Die Federf€uhrung obliegt drei Juristen im GS-UVEK, die weder €uber rechtli-ches noch fachliches Wissen auf dem Gebiet der technischen Sicherheit, noch €uber Ge-setzgebungserfahrung, sondern lediglich €uber theoretische Kenntnisse der Gesetzgebungverf€ugen. In der zweiten Erarbeitungsphase werden Juristen aus den einzelnen €Amtern ein-bezogen, die eine gute Kenntnis der rechtlichen Bestimmungen zur technischen Sicherheitin ihren jeweiligen Sachgebieten, jedoch nur beschr€anktes Fachwissen haben. Zudem wirdeine Person mit Erfahrung in Gesetzgebung aus dem Bundesamt f€ur Justiz beigezogen. Diezwei von den Kantonen delegierten Vertreter verf€ugen €uber Fachexpertise zur Motor-fahrzeugkontrolle, jedoch ist diese weitgehend beschr€ankt auf ihre jeweiligen Kantone. Zu-dem bringen sie keine Kenntnisse zur technischen Sicherheit in anderen Bereichen, f€urwelche die Kantone zust€andig sind, mit. Aufgrund der ablehnenden Haltung gegen€uberdem neuen Gesetz zeigen sich sowohl die beigezogenen Personen aus den UVEK-€Amternals auch die kantonalen Vertreter und die Verb€ande eher zur€uckhaltend bei der Weitergabeihrer Expertise.
Sprachengesetz
Thematik: Im M€arz 1996 stimmen Volk und St€ande der Revision des Sprachenartikels inder Verfassung zu. Das R€atoromanische wird zur Landes- und Teilamtsprache des Bundeserhoben, die bestehenden Massnahmen des Bundes zur F€orderung des R€atoromanischenund Italienischen werden auf Verfassungsstufe verankert, und Bund und Kantone erhaltenden Auftrag, die Verst€andigung zwischen den Sprachgemeinschaften zu f€ordern. Mit der
Tabelle 5: Wissensbeitrag der Akteure im Fall Sicherheitskontrollgesetz
Wissensart Dimension
Federf€uhrendeVerwaltungsakteure
Beigezogene
Verwaltungsakteure
Beigezogene
Externe
Evidenz Inhalt moderat moderat unbedeutend
Prozess eher viel unbedeutend unbedeutendRecht moderat gering unbedeutend
Expertise Inhalt gering moderat gering
Prozess gering moderat unbedeutendRecht gering eher viel unbedeutend
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 467
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Totalrevision der Verfassung wird 1999 zus€atzlich die Unterst€utzung der mehrsprachigenKantone durch den Bund beschlossen. Durch ein neues Sprachengesetz soll der Verfas-sungsauftrag umgesetzt werden.
Federf€uhrung: Bundesamt f€ur Kultur (BAK). Auf Entscheid des Bundesrates erh€alt nichtdie Bundeskanzlei, sondern das Eidg. Departement des Innern die Federf€uhrung. Sie wirdim Bundesamt f€ur Kultur an eine Sektion delegiert, die bis dahin nur am Rande mit derThematik zu tun und auch keine Gesetzgebungsprozesse geleitet hatte. Die Leitung derSektion wechselt w€ahrend des Prozesses mehrmals; der zust€andige Mitarbeiter bleibt dage-gen konstant.
Erarbeitungsprozess: Es lassen sich drei Phasen unterscheiden:
1 Januar 1997 bis Juni 1998: Geplant sind zwei separate Gesetze – ein Amtssprachenge-setz und ein Verst€andigungsgesetz. Das BAK setzt je eine interdepartementale Ar-beitsgruppe ein. Die Arbeitsgruppe zum Amtssprachengesetz formuliert einenVorentwurf, den sie in die €Amterkonsultation schickt. Aufgrund der Stellungnahmenwird entschieden, ein umfassendes Sprachengesetz statt zweier separater Gesetze zu er-arbeiten.
2 November 1998 bis September 1999: Zwei Arbeitsgruppen von Bund und Kantonener€ortern die Umsetzung des Sprachenartikels: Die Arbeitsgruppe „EDI/EDK” befasstsich mit der Umsetzung des Verst€andigungsauftrags, die Arbeitsgruppe „Mehrsprachi-ge Kantone” mit der Unterst€utzung der mehrsprachigen Kantone. Ergebnis ist ein Be-richt zuhanden der Departementsleitung.
3 Februar 2000 bis Oktober 2001: Die „Parit€atische Arbeitsgruppe Sprachengesetz”,bestehend zu gleichen Teilen aus Vertretern von Bund und Kantonen sowie einzelnenunabh€angigen Experten, formuliert einen Vernehmlassungsentwurf.
Konfliktivit€at: Mittel. Die Kantone wollen nicht, dass der Bund eigene Massnahmen zurF€orderung der Verst€andigung unternimmt. Der Kompetenzkonflikt dominiert die Diskus-sion in s€amtlichen gemischten Arbeitsgruppen. Bez€uglich der Amtssprachenregelung sindin der Bundesverwaltung die Meinungen, wie weit die Gleichbehandlung aller Sprachen ge-hen soll, geteilt. Eine €offentliche Debatte zur Sprachenfrage findet w€ahrend der betrachte-ten Phase nicht statt.
Evidenz: Zu Beginn des Prozesses f€uhrt die federf€uhrende Verwaltungsstelle mit einem brei-ten Kreis von Adressaten und Betroffenen Aussprachen €uber die Erwartungen an ein Spra-chengesetz durch und wertet diese aus, wobei die Systematik etwas fragw€urdig ist. Ansonstenbringt die federf€uhrende Verwaltungsstelle keine Evidenz in den Prozess ein. Verwaltungsin-tern tr€agt das Bundesamt f€ur Justiz mit einem Gutachten zu den Verfassungskompetenzen ju-ristische Evidenz bei (Bundesamt f€ur Justiz 1999). Die Kantone geben hierzu ihrerseits zweiGutachten in Auftrag und bringen diese in die Parit€atische Arbeitsgruppe ein (K€agi-Dienerund Schweizer 2000; Macheret und Previtali 2000). Daneben liefern die in dieser Ar-beitsgruppe vertretenen Sprachwissenschaftler vereinzelt Hinweise auf wissenschaftliche Er-kenntnisse, beispielsweise zur Mundart-Situation in der Deutschschweiz.
Expertise: Den federf€uhrenden Verwaltungsakteuren fehlt weitgehend relevante Expertise.Die Fachexpertise ist sehr beschr€ankt, Erfahrung mit Gesetzgebungsprozessen fehltg€anzlich, und juristische Expertise stellt das BAK nur in marginalem Umfang zurVerf€ugung. Hingegen bringen andere Verwaltungsstellen juristische sowie vor allem fachli-che Expertise in Sprachenfragen in die interdepartementale Arbeitsgruppe Amtssprachenge-setz ein. Mit dem Einbezug einer erfahrenen Person aus dem Bundesamt f€ur Justiz gelangtzudem eine gewisse juristische und Prozessexpertise in die Parit€atische Arbeitsgruppe. In
468 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

dieser Arbeitsgruppe sind auch drei Sprachwissenschaftler und ein Rechtsprofessor mit fach-licher bzw. juristischer Expertise vertreten, doch wird die Diskussion so stark durch dieKompetenzfrage dominiert, dass sie ihre Expertise nur begrenzt einbringen k€onnen.
Transplantationsgesetz
Thematik: Die Transplantationsmedizin lag urspr€unglich im Kompetenzbereich der Kan-tone, wobei Art und Umfang der vorhandenen kantonalen Bestimmungen stark variierten.Angesichts der steigenden Zahl von kostspieligen Transplantationen und einiger HIV-An-steckungen fordern breite Kreise eine Bundesregelung. Das Parlament erl€asst im M€arz1996 eine €Ubergangsbestimmung. Im Februar 1999 heissen Volk und St€ande dienotwendige Verfassungsbestimmung mit grossem Mehr gut.
Federf€uhrung: Bundesamt f€ur Gesundheit (BAG). Die Federf€uhrung wird zun€achst beieiner Person in der Abteilung Recht angesiedelt. Im Laufe des Fr€uhjahrs 1996 stellt dasBAG drei zus€atzliche Personen (davon zwei Juristen) f€ur den Transplantationsbereich anund schafft eine eigene Sektion. Die vier Personen bilden die Arbeitsgruppe, welche dasTransplantationsgesetz formuliert.
Erarbeitungsprozess: Die 4-k€opfige BAG-interne Arbeitsgruppe zieht von Beginn wegeinen Rechtsprofessor als Berater bei. Bis Ende 1997 arbeitet sie haupts€achlich an der Ver-fassungsbestimmung. Ab Anfang 1998 wendet sie sich dem Gesetzesentwurf zu.
Konfliktivit€at: In der betrachteten Phase gering (vgl. auch Engeli und Varone 2011). DieKantone w€unschen ausdr€ucklich eine Regelung der Transplantationsmedizin auf Bundes-ebene. Zwar geht es beim Gesetz um ethisch heikle Fragen, doch sind sich die Mitglieder derArbeitsgruppe weitgehend einig und werden ihre Vorschl€age von der Departementsleitungund vom Bundesrat unterst€utzt. Der Vernehmlassungsentwurf wird abseits der€Offentlichkeit erarbeitet.Evidenz: Die Arbeitsgruppe ber€ucksichtigt zahlreiche juristische und medizinische Studi-
en, z.B. zu den bestehenden rechtlichen Regelungen der Organspende in den Kantonen,zur Xenotransplantation oder zum irreversiblen Herzstillstand. Auch wird ein systemati-scher Vergleich der Regelungen auf internationaler Ebene sowie ein Rechtsvergleich mitbestimmten L€andern unternommen. Die Arbeitsgruppe tr€agt zudem diverse Zahlen zurAnzahl der verschiedenen Transplantationen im In- und Ausland zusammen (fachliche Evi-denz). W€ahrend von den verwaltungsintern beigezogenen Akteuren kein Evidenzbeitragauszumachen ist, liefert ein Gutachten zur Definition des Todes, das ein spezialisierterRechtsprofessor im Auftrag der Arbeitsgruppe erstellt (Guillod und Dumoulin 1999),zus€atzliche juristische Evidenz.
Tabelle 6: Wissensbeitrag der Akteure im Fall Sprachengesetz
Wissensart DimensionFederf€uhrendeVerwaltungsakteure
BeigezogeneVerwaltungsakteure
BeigezogeneExperten
Evidenz Inhalt unbedeutend unbedeutend geringProzess gering unbedeutend unbedeutendRecht unbedeutend moderat moderat
Expertise Inhalt gering eher viel moderatProzess unbedeutend moderat unbedeutendRecht unbedeutend moderat gering
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 469
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Expertise: Die federf€uhrenden Verwaltungsakteure verf€ugen kaum €uber relevanteExpertise. Da die Mitglieder der Arbeitsgruppe konstant bleiben, k€onnen sie sich aber mitder Zeit in beschr€anktem Rahmen rechtliches und fachliches Spezialwissen aneignen.Prozessexpertise, die €uber die Kenntnis des Gesetzgebungsleitfadens hinausgehen w€urde,fehlt den zust€andigen Personen. Einmal wird eine in Gesetzgebung erfahrene Person ausdem Bundesamt f€ur Justiz beigezogen. Zudem l€asst sich die Arbeitsgruppe durch einenRechtsprofessor mit einer guten Kenntnis des Transplantationsbereichs beraten und ziehtim Rahmen von Hearings und bilateralen Gespr€achen weiteres spezialisiertes juristischesund fachliches Wissen zur Transplantationsmedizin bei, wobei die extern verf€ugbare Exper-tise insgesamt beschr€ankt ist. Die Juristen aus der Bundesverwaltung, welche dieArbeitsgruppe konsultiert, verf€ugen nicht €uber Spezialwissen zur Transplantationsmedizin.
Vormundschaftsrecht
Thematik: Als einziger Teil des Zivilgesetzbuches wurde das Vormundschaftsrecht seit 1912praktisch nicht angepasst. Kritisiert wird, dass die Terminologie (z.B. Vormund, M€undel)nicht mehr zeitgem€ass sei, dass die im Gesetz vorgesehenen Massnahmen es nicht erlauben,auf die individuelle Situation der Betroffenen einzugehen, und dass die Organisation desVormundschaftswesens zu wenig professionell sei. Mit der Totalrevision soll das gesamteVormundschaftsrecht €uberholt werden.
Federf€uhrung: Bundesamt f€ur Justiz (BJ). Die Federf€uhrung liegt beim DirektionsbereichPrivatrecht. Dieser ist zu Beginn stark belastet mit den Revisionen der €ubrigen Teile desZivilgesetzbuches, so dass die Arbeiten zu einem grossen Teil ausgelagert werden.
Erarbeitungsprozess: Es lassen sich drei Phasen unterscheiden:
1 September 1993 bis Juli 1995: Drei externe Experten, allesamt Hochschulprofessoren,erarbeiten im Auftrag des BJ einen Grundlagenbericht f€ur die Totalrevision des Vor-mundschaftsrechts. Der Bericht wird an einer Fachtagung vorgestellt und die Fac-hkreise erhalten Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme.
2 November 1996 bis Juni 1998: Die drei Hochschulprofessoren erarbeiten in reg-elm€assiger Absprache mit Vertretern des BJ einen Gesetzesvorentwurf.
3 Februar 1999 bis Juni 2003: Eine breit abgest€utzte Expertenkommission verfasst aufder Basis des bestehenden Vorentwurfs einen Vernehmlassungsentwurf.
Konfliktivit€at: Tief. Die Notwendigkeit und Stossrichtungen der Totalrevision sind breitanerkannt. Im Detail gibt es in der dritten Phase unter den Mitgliedern der Experten-kommission Meinungsverschiedenheiten (z.B. Organisation des Vormundschaftswesens,
Tabelle 7: Wissensbeitrag der Akteure im Fall Transplantationsgesetz
Wissensart DimensionFederf€uhrendeVerwaltungsakteure
BeigezogeneVerwaltungsakteure
BeigezogeneExperten
Evidenz Inhalt viel unbedeutend unbedeutendProzess unbedeutend unbedeutend unbedeutendRecht eher viel unbedeutend moderat
Expertise Inhalt gering unbedeutend eher vielProzess gering gering unbedeutendRecht gering gering eher viel
470 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Zwangsbehandlung), die jedoch konsensuell gel€ost werden. Eine €offentliche Debatte findetnicht statt.
Evidenz: Die drei externen Experten rezipieren vor allem in der ersten Phase unz€ahligejuristische und fachliche Publikationen und verarbeiten diese in Arbeitspapieren, so etwazur Eignung des Vormunds, zum f€ursorgerischen Freiheitsentzug, zum Arzt- und Patien-tenrecht, zur Ver€anderung von Familienformen oder Verhaltensst€orungen. Im Auftrag desBJ erstellen zudem zwei Rechtsinstitute systematische internationale bzw. interkantonaleRechtsvergleiche zu drei Themenbereichen (Institut suisse de droit compar�e 1995; Institutdu f�ed�eralisme 1995), womit reichlich juristische Evidenz von extern beigetragen wird. Inder dritten Phase der Expertenkommission macht das BJ juristische Literatur zug€anglichund bereitet diese in Arbeitspapieren auf. Nicht-juristische Literatur rezipiert das BJ dage-gen kaum. Prozessevidenz generieren die federf€uhrenden Akteure insofern, als sie dieschriftlichen Stellungnahmen zum ersten Bericht der Experten systematisch auswerten, umdie Akzeptanz der vorgeschlagenen Massnahmen abzusch€atzen. Ein BJ-intern erstelltesGutachten zu Zwangsbehandlungen liefert von Verwaltungsseite zus€atzliche rechtlicheEvidenz (Bundesamt f€ur Justiz 2002).
Expertise: Indem die federf€uhrenden Verwaltungsakteure bereits die €ubrigen Teile desZivilgesetzbuchs revidiert haben, verf€ugen sie €uber grosse Prozesserfahrung. Hingegen istihre juristische und fachliche Expertise beschr€ankt, weil der Bund im Vormundschaftswesenkeine Aufsichts- oder Vollzugst€atigkeiten erf€ullt. Durch die langj€ahrige Besch€aftigung mitder Revision erlangen die zust€andigen Mitarbeiter bis zu einem beschr€ankten Grade jedochfachliches und rechtliches Spezialwissen. Verwaltungsintern, insbesondere auch BJ-intern,wird zus€atzliche juristische Expertise beigezogen, w€ahrend fachliche Expertise nur in einemFall von einem anderen Amt her eingeflossen ist. Die drei Hochschulprofessoren sowie etli-che Mitglieder aus der Expertenkommission verf€ugen €uber ein vertieftes juristisches undfachliches Wissen im Vormundschaftsbereich. Ausserdem wird in der ersten und drittenPhase €uber Hearings zus€atzliche Rechts- und Fachexpertise zu spezifischen Fragen einge-holt. Die extern eingebrachte Prozessexpertise ist dagegen gering; sie beschr€ankt sich beiden Hochschulprofessoren auf die fr€uhere Mitgliedschaft in Expertenkommissionen.
Diskussion der Hypothesen
Ausgehend von den obigen Resultaten der einzelnen Fallstudien werden die Hypothesenzum Wissensbeitrag von Verwaltung und externen Experten anhand eines Fallvergleichs€uberpr€uft und daraus die Folgerungen bez€uglich der jeweiligen theoretischen Kontroversenzur Verwaltung als Hort des Wissens bzw. zum Beizug externer Akteure als Mittel eineswissensbasierten Gesetzgebungsprozesses gezogen.
Tabelle 8: Wissensbeitrag der Akteure im Fall Vormundschaftsrecht
Wissensart DimensionFederf€uhrendeVerwaltungsakteure
BeigezogeneVerwaltungsakteure
BeigezogeneExperten
Evidenz Inhalt gering unbedeutend eher vielProzess moderat unbedeutend unbedeutendRecht eher viel moderat viel
Expertise Inhalt gering gering vielProzess viel unbedeutend geringRecht gering eher viel viel
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 471
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Wissensbeitrag der Bundesverwaltung
Im Vergleich zu den Hypothesen f€allt der Wissensbeitrag der Bundesverwaltung in derFr€uhphase von Gesetzgebungsprozessen gr€osser aus. Die Ergebnisse des Fallvergleichs sindin Tabelle 9 synthetisiert und werden in der Folge f€ur die verschiedenen Arten der Evidenzund Expertise erl€autert.
Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass der Beitrag der Verwaltung zu systematischerEvidenz zu Inhalt und Prozess wegen schwacher politikanalytischer Kapazit€aten gering ist.Tats€achlich hat die Bundesverwaltung nur in einem der vier F€alle bestehende Evidenzaufbereitet (Zusammenfassung fachlicher Studien beim Transplantationsgesetz), doch hatsie entgegen der Annahme in s€amtlichen F€allen selber Evidenz generiert, entweder zum In-halt oder zum Prozess oder zu beidem. So wurde beim Sicherheitskontrollgesetz bei den€Amtern des UVEK sowohl inhaltliche Evidenz als auch Prozessevidenz (Akzeptanz derMassnahmen) erhoben. Beim Vormundschaftsrecht und in beschr€ankterem Masse beimSprachengesetz wurde durch Adressatenbefragungen Prozessevidenz generiert. Beim Trans-plantationsgesetz trug die Verwaltungsstelle inhaltliche Evidenz in Form von in- undausl€andischen Vergleichszahlen zusammen. Insgesamt f€allt der Evidenzbeitrag der Verwal-tung sowohl beim Inhalt als auch beim Prozess damit moderat aus, womit die aktive Rolleder Verwaltung, die von Balthasar und M€uller f€ur die Kantonsebene postuliert wurde, aufBundesebene eine gewisse Best€atigung findet.
Gross fiel der Beitrag der Verwaltung bez€uglich rechtlicher Evidenz, zu der keine Hypo-these formuliert wurde, aus: In allen F€allen wurde juristische Evidenz beigetragen. Sowohlbeim Vormundschaftsrecht als auch beim Transplantationsgesetz haben die federf€uhren-den Akteure die juristische Literatur systematisch aufbereitet. Beim Sicherheitskontrollge-setz haben sie die rechtlichen Grundlagen der technischen Sicherheit aller €Amter gezieltzusammengetragen und verglichen. Beim Sprachengesetz hat zwar nicht die fe-derf€uhrende Stelle selber, jedoch das Bundesamt f€ur Justiz rechtliche Fragen systematischabgekl€art.
Bez€uglich Expertise war postuliert worden, dass die Bundesverwaltung beim Recht einengrossen Beitrag leistet, beim Inhalt dagegen einen geringen, w€ahrend zur Prozessexpertisekeine Annahme formuliert wurde. Was die Rechtsexpertise angeht, so l€asst sich zun€achstfeststellen, dass die Gesetzesarbeit tats€achlich, wie Kl€oti und Schneider (1989) seinerzeit be-haupteten, Juristensache ist: Mit Ausnahme des Sprachengesetzes waren die federf€uhrendenVerwaltungsakteure fast ausschliesslich Juristen. Allerdings verf€ugten diese nur €ubergenerelles rechtliches Wissen, hingegen nicht €uber juristisches Spezialwissen im fraglichenPolitikbereich, was die federf€uhrenden Akteure in drei von vier F€allen aber durchverwaltungsintern beigezogene juristische Spezialexpertise kompensiert haben. So l€asst sich
Tabelle 9: Erkenntnisse zum Wissensbeitrag der Verwaltung
Evidenz Expertise
Inhalt moderat: z.T. systematischesZusammentragen von Fakten
gering
Prozess moderat: z.T. systematischeErhebung von Einsch€atzungen
moderat: Federf€uhrung gering,aber oft verwaltungsintern kompensiert
Recht moderat – gross moderat: Federf€uhrung gering,
aber oft verwaltungsintern kompensiert
472 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

die Rechtsexpertise insgesamt zwar nicht, wie aufgrund der kontinentaleurop€aischenlegalistischen Tradition vermutet, als gross, zumindest aber als moderat qualifizieren.
Best€atigt wurde die Annahme, dass die Verwaltung nur in geringem Masse Fachexpertisebeitr€agt. In neuen Regelungsbereichen (Transplantationsgesetz) oder in Politikfeldern, inwelchen die Bundesverwaltung keine Aufsichts- oder Vollzugskompetenzen besitzt (Vor-mundschaftsrecht), fehlt in der Verwaltung eine kompetente Stelle. In den anderen F€allenwurde die Federf€uhrung aus politischen €Uberlegungen nicht der fachkundigsten Einheitzugewiesen. Im Falle des Sprachengesetzes wurde das Bundesamt f€ur Kultur als zust€andigerkl€art, obwohl die Bundeskanzlei gerade im Bereich der Amtssprachen €uber deutlich mehrExpertise verf€ugt h€atte. Beim Sicherheitskontrollgesetz wurde die Federf€uhrung in sehrun€ublicher Weise dem Generalsekretariat zugewiesen, weil von den eigentlich kompetenten€Amtern Widerstand erwartet wurde. Fachliche Expertise wurde zudem in geringerem Aus-mass verwaltungsintern kompensiert als juristische Expertise (z.B. wurden beimSicherheitskontrollgesetz nur beschr€ankt verwaltungsinterne Fachpersonen beigezogen).
Die Prozessexpertise, zu der keine Hypothese formuliert worden war, f€allt moderat aus.Die federf€uhrenden Stellen selber verf€ugen in der Schweiz kaum €uber Prozessexpertise. Im-merhin wurde aber in drei von vier F€allen die Beratung des Bundesamtes f€ur Justiz inAnspruch genommen, womit die mangelnde Prozessexpertise bis zu einem gewissen Gradeverwaltungsintern wettgemacht werden konnte. Dass die Federf€uhrung nach dem eng-lischen Vorbild (Page 2003) gleich den Prozessexperten im Bundesamt f€ur Justiz €ubertragenw€urde, steht in der stark departementalisierten Verwaltungsstruktur (Varone 2006), in derjeder Departementsvorsteher seine Kompetenzen verteidigt, hingegen wohl ausser Frage.Aus Sicht des l€angerfristigen Wissensmanagements macht dies auch wenig Sinn; wie dieFallstudien zeigen, bieten die langwierigen schweizerischen Gesetzgebungsprozesse f€ur dieBundesverwaltung die Gelegenheit, juristisches Spezialwissen und fachliche Expertiseaufzubauen, die dann in der Phase der Umsetzung der Gesetze genutzt werden kann.
Aus diesen Ergebnissen l€asst sich in Bezug auf die Theorie folgern, dass die Bundesver-waltung nicht als Hort des Wissens im Weber’schen Sinne gelten kann; ihr Beitrag in derFr€uhphase des vorparlamentarischen Verfahrens ist in allen Wissenstypen beschr€ankt. Diefederf€uhrende Stelle, welche einen Gesetzgebungsprozess leitet, verf€ugt h€aufig €uber keiner-lei Expertise, weder in fachlicher, noch in prozessualer, noch in juristischer Hinsicht.W€ahrend die Defizite bez€uglich Prozess- und Rechtsexpertise zumindest zum Teil verwal-tungsintern kompensiert werden, bleibt bei der inhaltlichen Expertise eine L€ucke.
Im Gegenzug steht es bei der Evidenz mit der Verwaltung besser als gem€ass der Litera-tur angenommen. Die Verwaltung hat zu allen drei Politikdimensionen Evidenz generiert.Es handelte sich in allen F€allen um ein systematisches Zusammentragen und Auswertenvon Fakten bzw. Einstellungen zu klar abgegrenzten Problemstellungen. Dies widerspiegeltdie oben erw€ahnten Grenzen von systematischer und nachpr€ufbarer Evidenz, die in derProduktion aufwendig ist und deshalb immer nur einen kleinen Ausschnitt aus der komple-xen Realit€at abbilden kann. Gleichzeitig stellt die Tatsache, dass f€ur diese systematischenAuswertungen keinerlei spezialisierte Methoden zur Anwendung kamen, die Definition po-litikanalytischer Kapazit€aten von Howlett (2009) mit ihrem Fokus auf die Kenntnis sozial-wissenschaftlicher Verfahren in Frage. In Anbetracht des juristischen Hintergrunds dermeisten beteiligten Verwaltungsakteure gilt die Vermutung, dass der Schweizer Bundesver-waltung politikanalytische Kapazit€aten in diesem Sinne gefehlt h€atten. Doch angesichts derKomplexit€at von Politikprozessen scheint weniger ein Bedarf an komplizierten Modell-rechnungen als ein Bed€urfnis nach grundlegendem Wissen zu bestehen, bei dem sich auchdie Frage nach den Grenzen der Aussagekraft weniger eminent stellt. Die Fallstudien legen
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 473
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

nahe, dass der Professionalisierungsgrad der Bundesverwaltung die Bereitstellung solchgrundlegender Evidenz bis zu einem gewissen Grade erlaubt.
Wissensbeitrag der externen Experten
Ist der Beizug externer Akteure in der Fr€uhphase des vorparlamentarischen Verfahrens alsSt€arkung einer wissensbasierten Gesetzgebung zu verstehen? Verglichen mit den Annahmenf€uhrt der Fallvergleich zu gemischteren Ergebnissen (vgl. Tabelle 10).
Die Hypothese, dass externe Experten als Aussenstehende kaum Prozessexpertise bei-tragen, wird durch die betrachteten F€alle klar best€atigt. Dass hingegen externe Expertenim Schweizer System als Repr€asentanten von Interessen auch nur in geringem Masseinhaltliche und rechtliche Expertise beitragen, gilt so allgemein nicht, sondern mussdifferenziert werden. Der Beizug externer Personen war in den betrachteten F€allen immerzumindest teilweise dadurch motiviert, zus€atzliches Wissen einzubeziehen. Dies best€atigtdie Ergebnisse bestehender Studien (D€ohler 2012; Germann 1981; Lavertu und Weimer2010). Offensichtlich im Vordergrund steht das Wissensmotiv beim Beizug von Wis-senschaftlern wie den drei Hochschulprofessoren beim Vormundschaftsrecht oder denSprachwissenschaftlern beim Sprachengesetz. Aber auch von Kantonsvertretern erhofftesich die Verwaltung zus€atzliche Expertise: beim Sprachengesetz zu den staatlichen M€og-lichkeiten einer F€orderung der Verst€andigung sowie zur Problematik einer mehrsprachigenVerwaltung; beim Vormundschaftsrecht zu den Vor- und Nachteilen verschiedener Voll-zugsarrangements und beim Sicherheitskontrollgesetz zu den in den Kantonen angewandtenVerfahren der Sicherheits€uberpr€ufung.
Inwiefern die extern beigezogenen Personen tats€achlich Expertise lieferten, hing wesent-lich vom Konfliktgrad ab. So konnten sich die Sprachwissenschaftler als Fachexpertenbeim Sprachengesetz nur begrenzt in der Parit€atischen Arbeitsgruppe einbringen, weil dieVertreter von Bund und Kantonen die Diskussion stark mit der rechtlichen Kompetenz-frage dominierten. Beim Sicherheitskontrollgesetz waren die Kantonsvertreter prim€ardarauf bedacht, ihre Kompetenzen im Bereich der Motorfahrzeugkontrolle zu verteidigen,ohne dass sie ihre (ohnehin beschr€ankte) Expertise einzubringen versuchten. Umgekehrtbrachten sich die einzelnen Personen in der Expertenkommission zum Vormundschafts-recht trotz der Vielfalt der vertretenen Interessen mit ihrer Expertise in die Diskussion ein.Auch die Hearings, die beim Vormundschaftsrecht und Transplantationsgesetz mit diversenStakeholdern durchgef€uhrt wurden, erm€oglichten der Verwaltung den Einbezug vonzus€atzlicher Expertise (z.B. Wissen zur Organzuteilung bei Transplantationen), w€ahrenddie Aussprachen mit Verb€anden beim konfliktiveren Sicherheitskontrollgesetz keinen er-kennbaren Wissensmehrwert lieferten. Bereits moderate Konflikte f€uhrten dazu, dass dieVerteidigung von Positionen einen sachlichen Austausch verhinderte.
Tabelle 10: Erkenntnisse zum Wissensbeitrag der externen Experten
Evidenz Expertise
Inhalt gering: nur Aufbereitung bestehenderEvidenz durch Wissenschaftler
unterschiedlich: abh€angig von Konfliktivit€atund Auswahl der Personen
Prozess unbedeutend unbedeutendRecht moderat: Generierung von
Evidenz bei Auftrag an Wissenschaftlerunterschiedlich: abh€angig von Konfliktivit€atund Auswahl der Personen
474 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

In einem konfliktiven Umfeld wurden die beigezogenen Personen zudem nicht durch diefederf€uhrende Verwaltungsstelle ausgew€ahlt, sondern von €ubergeordneter Stelle delegiert.Die Expertise stellte dabei nicht das prim€are Auswahlkriterium dar. Die delegiertenKantonsvertreter beim Sicherheitskontrollgesetz k€onnen beispielsweise nicht als Expertensicherheitsrelevanter kantonaler Aufgaben betrachtet werden. Auch einige Kantons- undBundesvertreter in der Parit€atischen Arbeitsgruppe Sprachengesetz wiesen nur geringeKenntnisse der Materie auf. In beiden F€allen wurde die Auswahl der Personen den Kantonenbzw. den betroffenen Bundes€amtern €uberlassen. Bei der Expertenkommission zumVormundschaftsrecht erfolgten die Ernennungen dagegen ad personam durch diefederf€uhrende Verwaltungsstelle. Obwohl auch hier die Vertretung der verschiedenen Interes-sengruppen wichtig war, gelang es der Verwaltung, Experten im Sinne von Fachpersonen miteinem vertieften Wissen zur Mitarbeit zu gewinnen.
In Bezug auf die Evidenz wurden aufgrund der Literatur ebenfalls nur zur€uckhaltendeErwartungen formuliert: Von externer Seite, so wurde vermutet, sei ein Evidenzbeitrag aus-schliesslich von Wissenschaftlern zu erwarten, und zwar aufgrund des mit der Evidenzgene-rierung und -aufbereitung verbundenen Aufwands vor allem, wenn diese einen verg€utetenAuftrag von der Verwaltung erhielten, wobei sich die Evidenz auf alle drei Politikdimensio-nen beziehen k€onne. Diese Annahme wird weitgehend best€atigt. Im einen Fall (Si-cherheitskontrollgesetz), bei dem kein einziger Wissenschaftler beigezogen wurde, fehltauch ein externer Evidenzbeitrag. Ausserdem machten Wissenschaftler als Mitglieder vonExpertenkommissionen (Sprachengesetz, Vormundschaftsrecht) zwar auf bestehende Studi-en aufmerksam und trugen damit inhaltliche und rechtliche Evidenz bei (keine Prozessevi-denz); eine dar€uber hinausgehende Generierung wissenschaftlicher Erkenntnisse fandhingegen nur im Rahmen von Auftr€agen statt, wobei diese durchwegs auf juristischeEvidenz ausgerichtet waren: Beim Transplantationsgesetz wurde ein Gutachten zum recht-lichen Konzept des Hirntods erstellt, beim Sprachengesetz wurden die Kompetenzen vonBund und Kantonen juristisch untersucht, und beim Vormundschaftsrecht wurdensystematische Rechtsvergleiche vorgenommen. Der Fall des Sprachengesetzes zeigt ausser-dem, dass nicht nur die Bundesverwaltung, sondern auch andere Akteure mit einem gros-sen Interesse an Evidenz bereit sind, Studien zu finanzieren (vgl. auch Frey und Widmer2011). In diesem Fall waren es die Kantone, die zwei Rechtsgutachten in Auftrag gaben.
Bez€uglich der theoretischen Kontroverse um den Expertenbeizug l€asst sich aus den Ergeb-nissen folgern, dass die Beteiligung externer Kreise auch in der Fr€uhphase des SchweizerGesetzgebungsprozesses nur beschr€ankt als Chance f€ur eine wissensbasierte Gesetzgebungbetrachtet werden kann. Ein Beitrag zu Prozessexpertise ist von Aussenstehenden aufgrundder fehlenden Kenntnis der internen Abl€aufe nicht zu erwarten. Zu inhaltlicher und rechtli-cher Expertise ist nur ein externer Beitrag m€oglich, wenn keine Konflikte vorhanden sind,weil sonst die Interessenpolitik durchschl€agt. Evidenz wird ihrerseits von externer Seite nurdann in bedeutsamem Masse beigesteuert, wenn ein bezahlter Auftrag zu einer begrenztenProblemstellung vorliegt. Der allgemeine Tenor in der Schweizer Forschungsliteratur, dassder Beizug externer Personen nur punktuell zu einer wissensbasierten Politikformulierungin der Schweiz beitr€agt, gilt somit auch f€ur die Fr€uhphase des Gesetzgebungsprozesses, f€urdie der gr€osste Einfluss von Wissen postuliert wurde.
Damit wird die mit dem Beizug externer Experten verbundene demokratietheoretischeDiskussion umso bedeutsamer: Der aus Sicht der Input-Legitimit€at problematischenPraxis, im Gesetzgebungsverfahren als Kern des demokratischen Rechtsstaats nach unkla-ren Regeln einzelnen Personen Einfluss zuzugestehen, steht angesichts des geringen Wis-sensgewinns, den sie bringen, keine nennenswerte St€arkung der Output-Legitimit€at
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 475
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

gegen€uber. Auf den ersten Blick ist der Beizug von Experten damit demokratietheoretischheikel, weil gewisse Interessen in nicht legitimierter Weise Gewicht erhalten k€onnten. Kon-krete Hinweise daf€ur fehlen in den untersuchten F€allen allerdings. Zwar wurden beimSprachengesetz und beim Sicherheitskontrollgesetz die Kantone von Beginn weg sehr engin die Ausarbeitung des Gesetzes einbezogen, w€ahrend s€amtliche €ubrigen Interessen aussenvor blieben, jedoch gibt es keine Anzeichen, dass es den Kantonsvertretern gelungen w€are,die Vorlage stark zu beeinflussen. So setzte der Bund in beiden F€allen durch, dass Mass-nahmen in den Vernehmlassungsentwurf aufgenommen wurden, welche die Kantonsvertre-ter ablehnten. Die Meinungsbildung wurde somit nicht von vornherein eingeschr€ankt.Kritisch ist auch die Beratung durch Einzelpersonen, wie sie beim Transplantationsgesetzvorgekommen ist, wo die Verwaltung einen Rechtsprofessor zur Begleitung des Prozessesbeigezogen hat. Auch beim Vormundschaftsrecht hat die Verwaltung die Erarbeitung einesGesetzesentwurfs zu Beginn an drei Hochschulprofessoren delegiert. Immerhin handelte essich dabei um politisch unabh€angige Personen. Zudem hat sich die Verwaltung nicht alleinauf ihren Rat verlassen, sondern hat beim Transplantationsgesetz in ausgepr€agtem Masseselbst Informationen beschafft und beim Vormundschaftsrecht eine Fachtagung zur Dis-kussion des Berichts der Professoren organisiert. Ausserdem wurde der Vorentwurf derProfessoren vor der Vernehmlassung durch eine breit zusammengesetzte 20-k€opfigeExpertenkommission weiterentwickelt. Es bestanden somit in allen F€allen aus Sicht derInput-Legitimit€at potentiell heikle Konstellationen, doch traf die Verwaltung unterschiedli-che Vorkehrungen, um die Einflussnahme einzelner Vertreter zu verhindern.
Schlussfolgerungen
Der „Evidence-Based Policy”-Ansatz hat international und auch in der Schweiz Bestrebun-gen hin zu einer st€arker wissensbasierten Politikgestaltung ausgel€ost und zu einer neuenBl€ute der Forschung zum Verh€altnis von Wissenschaft und Politik gef€uhrt. Eine an-erkannte Definition, was als Evidenz z€ahlt, fehlt aber. Gemeinhin werden darunter wissen-schaftliche Erkenntnisse verstanden, doch wurde in letzter Zeit vermehrt eine Ausweitungdes Begriffs verlangt, der das f€ur die Politik relevante Wissen besser abdeckt. In diesemBeitrag wurde deshalb eine Typologie politikrelevanter Wissensarten entwickelt, die erstenszwischen wissenschaftlicher Evidenz und personengebundener, erfahrungsbasierter Exper-tise sowie zweitens zwischen den drei Politikdimensionen – Policy als Inhalt, Politics alsProzess und Polity als rechtlicher Rahmen – unterscheidet. Die Typologie hat sich als kon-zeptionelle Grundlage in der empirischen Anwendung bew€ahrt, um das in der Fr€uhphasedes schweizerischen Gesetzgebungsprozesses eingeflossene Wissen differenziert zu erfassenund die Rolle verschiedener Akteure zu analysieren.
Bis anhin wurde die Arbeitsweise der Bundesverwaltung und ihre Zusammenarbeit mit ex-ternen Experten in der Anfangsphase, w€ahrend der ein Vernehmlassungsentwurf erarbeitetwird, nie im Detail erforscht, obwohl in der Literatur gerade f€ur diese Phase der gr€osste Ein-fluss von Wissen auf die Politik postuliert wurde. F€ur den vorliegenden Beitrag wurden erst-mals vier Gesetzgebungsprozesse genau nachgezeichnet. Damit wurde eine kleine Scholleeines empirischen Terrains umgepfl€ugt, das viel Raum f€ur weitere Forschungsarbeiten bietet.
Der Artikel schliesst an theoretische Kontroversen zur Rolle von Verwaltung und exter-nen Experten f€ur eine wissensbasierte Politikgestaltung an und erm€oglicht dabei eine diffe-renzierte, aus demokratietheoretischer Sicht auch kritische Betrachtung des Verh€altnissesvon Wissen und Politik im politischen System der Schweiz. Die f€ur einen Gesetzgebungs-prozess zust€andigen, federf€uhrenden Stellen der Bundesverwaltung verf€ugten kaum €uber
476 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Expertise, weder in inhaltlicher, noch in prozessualer, noch in rechtlicher Hinsicht. Damitwerden fr€uhere Studien, die ein begrenztes Verwaltungswissen postulieren, best€atigt. Aller-dings waren die federf€uhrenden Stellen bestrebt, die Expertisedefizite zu kompensieren. DerMangel an prozessualer Expertise wurde durch den Beizug des Bundesamtes f€ur Justiz ver-waltungsintern wettgemacht. Bei der fachlichen und juristischen Expertise bestimmt dage-gen die institutionelle Kompetenzordnung, inwiefern es €uberhaupt Personen mitExpertenstatus gibt: In neuen Politikbereichen, in denen der Bund bis dahin kaum €uberKompetenzen verf€ugte, war das Wissen sowohl in der Bundesverwaltung als auch ausser-halb beschr€ankt.
St€arker als erwartet hat die Verwaltung Evidenz in die Gesetzgebungsprozesse einge-bracht, was bis zu einem gewissen Grade als Ausdruck einer Professionalisierung, wie siein der Literatur postuliert wird, begriffen werden kann. Ausschlaggebend f€ur den Evi-denzbeitrag ist n€amlich, inwiefern die federf€uhrende Verwaltungsstelle €uber politikanalyti-sche Kapazit€aten verf€ugt, wobei darunter entgegen Howletts (2009) Konzept keinevertieften sozialwissenschaftlichen Methodenkenntnisse zu verstehen sind, sonderndie grunds€atzliche F€ahigkeit einer wissenschaftlichen, d.h. systematischen undnachvollziehbaren Bearbeitung von Problemstellungen. Denn bei der von den Ver-waltungsstellen beigezogenen und generierten Evidenz handelt es sich um basale systema-tische Informationen wie Fallzahlen. Dies d€urfte kein Zufall sein: Gerade angesichts derKomplexit€at von Politik scheint weniger ein Bedarf an komplexen und mit vielen Unsi-cherheiten behafteten Modellrechnungen zu bestehen als ein Bed€urfnis nach grundlegen-dem Wissen, bei dem sich die Frage nach den Grenzen der Aussagekraft wenigereminent stellt. Allerdings bildet die systematische Evidenz nur einen winzigen Ausschnittder komplexen Realit€at ab. Auff€allig ist dabei, dass sich die meiste Evidenz, welche dieVerwaltung generiert hat, wie auch s€amtliche Mandate an externe Experten auf die juris-tische Dimension bezogen. Es w€are interessant zu untersuchen, inwiefern dies die legalis-tische Verwaltungstradition im deutschsprachigen Raum widerspiegelt (vgl. auch Bekkeund Van der Meer 2000) und sich die Pr€aferenzen f€ur verschiedene Wissensarten je nachpolitischem System unterscheiden.
Die theoretische Kontroverse zum Beizug externer Experten, der in der Schweiz sehrausgepr€agt ist, besteht darin, inwiefern diese tats€achlich einen Beitrag zu einer wissensba-sierten Politikformulierung leisten oder ob ihr Einbezug vielmehr dazu dient, m€oglichstfr€uh einen breit abgest€utzten Kompromiss zu finden. Die Fallstudien zeigen, dass die Ver-waltung mit dem Expertenbeizug zwar immer beides beabsichtigt, dass der Wissensbeitragjedoch beschr€ankt bleibt. Einen nennenswerten Evidenzbeitrag leisten externe Expertenaufgrund der damit verbundenen Kosten nur, wenn sie einen bezahlten Auftrag erhalten.Prozesswissen k€onnen Externe nicht beitragen, weil ihnen die Kenntnis der internenAbl€aufe fehlt. Dar€uber hinaus f€uhren bereits moderate Konflikte dazu, dass Expertise nichtin den Prozess gelangt. Dies h€angt damit zusammen, dass bei der Auswahl der Personendie Repr€asentation von Interessen im Vordergrund steht und ihre Expertise zweitrangig ist.Zudem halten die beigezogenen Personen ihre Expertise bewusst zur€uck – ganz nach demeingangs zitierten Sprichwort „Wissen ist Macht”. Schliesslich dominieren auch moderateKonflikte den Prozess unter Umst€anden so stark, dass Experten ihr Wissen gar nichteinbringen k€onnen. Eine wissensbasierte Politikformulierung wird somit durch Konfliktenicht erst, wie in der Literatur dokumentiert, auf der Output-Seite vereitelt, indem dasWissen f€ur den Ausgang einer Entscheidung keine Rolle spielt, sondern es fliesst gar nichterst als Input in das Gesetzgebungsverfahren ein.
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 477
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Angesichts der Tatsache, dass externe Experten auch in der Fr€uhphase des Ge-setzgebungsprozesses nur beschr€ankt Wissen beitragen, taugt ihr Beizug auf den erstenBlick kaum als Mittel, um die Output-Legitimit€at des Staates zu st€arken. Ber€ucksichtigtman zus€atzlich, dass die federf€uhrenden Verwaltungsakteure ihrerseits kaum €uber relevanteExpertise verf€ugen, stellt sich aus demokratietheoretischer Sicht die dringliche Frage, ob dieBundesverwaltung durch den Einbezug externer Experten, der aus dem Kompromisserfor-dernis herausgewachsenen ist, zum Spielball von Interessen wird. In den untersuchtenF€allen sind grunds€atzlich heikle Konstellationen vorzufinden, doch haben die federf€uhren-den Verwaltungsstellen gewisse Checks durchgef€uhrt: Sie haben verwaltungsinterne Exper-tise beigezogen und selber Evidenz generiert und aufbereitet. Zudem haben sie daf€urgesorgt, dass Vorentw€urfe fr€uh einem breiteren Kreis zur Diskussion vorgelegt wurden unddie Meinungsbildung nicht von vornherein eingeschr€ankt wurde.
Sofern eine solche €Uberpr€ufung stattfindet, kann der Einbezug externer Experten trotz-dem funktional angebracht sein, weil es sich bei der Gesetzesvorbereitung um einevor€ubergehende Aufgabe der Verwaltung handelt und der verwaltungsinterne Mehrbedarfan Ressourcen dadurch reduziert werden kann. Der Beizug externer Experten kann in ge-wissem Masse gar als Erfolgsfaktor f€ur Gesetzgebungsprozesse aufgefasst werden, weil in-teressengebundenes Wissen das politisch Machbare widerspiegelt. Wissen ist letztlich nieg€anzlich objektivierbar; dies gilt f€ur Evidenz und noch viel deutlicher f€ur Expertise. Whatworks h€angt auch von politischen Faktoren ab, weshalb das Ziel des EBP-Ansatzes einerrein wissensbasierten Politikgestaltung unerreichbar bleibt. Wir m€ussen uns wohl oder €ubelzufrieden geben mit einer „wissensbewussten Politik”, die auch bewusst mit den Risikenumgeht, die mit den verschiedenen Wissensarten verbunden sind.
Bibliographie
Alkin, M. (1985). A Guide for Evaluation Decision Makers. Beverly Hills, CA: Sage.
Balthasar, A. (2007). Institutionelle Verankerung und Verwendung von Evaluationen. Chur/Z€urich:
R€uegger.
Balthasar, A. und F. M€uller (2014). Die Verbreitung evidenzbasierter und gleichstellungssensitiver
Informationen in den Entscheidungsprozessen kantonaler Steuer- und Sozialtransferpolitik: eine
quantitative Analyse. Swiss Political Science Review 20(1): 70–95.
Bekke, H. und F. Van der Meer (2000), (Hrsg.). Civil Service Systems in Western Europe.
Cheltenham: Edward Elgar.
Bekker, M., S. van Egmond, R. Wehrens, K. Putters und R. Bal (2010). Linking Research and
Policy in Dutch Healthcare: Infrastructure, Innovations and Impacts. Evidence & Policy 6(2): 237–
254.
Berg-Schlosser, D. und G. De Meur (2009). Comparative Research Design. Case and Variable
Selection. In B. Rihoux und C. Ragin (Hrsg.), Configurational Comparative Methods: Qualitative
Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques. Los Angeles, London, New Delhi,
Singapore: Sage (19–32).
Beywl, W. und T. Widmer (2009). Evaluation in Expansion: Ausgangslage f€ur den intersektoralen
Dreil€ander-Vergleich. In T. Widmer, W. Beywl und C. Fabian (Hrsg.), Evaluation: Ein
systematisches Handbuch. Wiesbaden: VS Verlag f€ur Sozialwissenschaften (13–23).
Blatter, J., F. Janning und C. Wagemann (2007). Qualitative Politikanalyse: Eine Einf€uhrung in
Forschungsans€atze und Methoden. Wiesbaden: VS Verlag f€ur Sozialwissenschaften.
Bundesamt f€ur Justiz (1999). Constitutionnalit�e de mesures f�ed�erales en mati�ere de compr�ehension
linguistique. Bern: Bundesamt f€ur Justiz, 16. Juni 1999.
478 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Bundesamt f€ur Justiz (2002). Zwangsbehandlung und freiheitsbeschr€ankende Masssnahmen. Bern:
Bundesamt f€ur Justiz, 12. Februar 2002.
Bundesamt f€ur Justiz (2007). Gesetzgebungsleitfaden: Leitfaden f€ur die Ausarbeitung von Erlassen des
Bundes (3. Aufl.). Bern: Bundesamt f€ur Justiz.
Bussmann, W. (1997). Evaluationen in der Schweiz. In W. Bussmann, U. Kl€oti und P. Knoepfel
(Hrsg.), Einf€uhrung in die Politikevaluation. Basel, Frankfurt a.M.: Helbing & Lichtenhahn (13–
35).
Bussmann, W. (2008). The Emergence of Evaluation in Switzerland. Evaluation 14(4): 499–506.-(2010). Evaluation of Legislation: Skating on Thin Ice. Evaluation 16(3): 279–293.
Cabinet Office (1999a). Modernising Government. London: Whitepaper.
Cabinet Office (1999b). Professional Policy Making for the Twenty First Century. London.
Chelimsky, E. (1995). The Political Environment of Evaluation and What It Means for the
Development of the Field. Evaluation Practice 16(3): 215–225.
Chi, M., R. Glaser und M. Farr (1988) (Hrsg.). The Nature of Expertise. Hillsdale NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.
Christensen, R., H. Goerdel und S. Nicholson-Crotty (2010). Management, Law, and the Pursuit of
the Public Good in Public Administration. Journal of Public Administration Research and Theory
21: i125–i140.
Coalition for Evidence-Based Policy (2012). What Works in Social Policy? Findings From Well-
Conducted Randomized Controlled Trials. Retrieved from www.evidencebasedprograms.org
[abgerufen am: 6. Mai 2014].
Davies, H., S. Nutley und P. Smith (2000), (Hrsg.). What Works? Evidence-Based Policy and Practice
in Public Services. Bristol: The Policy Press.
Diekmann, A. (1998). Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen (4. Aufl.).
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
D€ohler, M. (2012). Gesetzgebung auf Honorarbasis – Politik, Ministerialverwaltung und das
Problem externer Beteiligung an Rechtsetzungsprozessen. Politische Vierteljahresschrift 53(2): 181–
210.
Donaldson, S., C. Christie und M. Mark (2008). What Counts as Credible Evidence in Applied
Research and Evaluation Practice?. Newbury Park, CA: Sage.
Dreyfus, H. und S. Dreyfus (2005). Peripheral Vision: Expertise in Real World Contexts.
Organization Studies 26(5): 779–792.
Engeli, I. und Varone, F. (2011). Governing Morality Issues through Procedural Policies. Swiss
Political Science Review 17(3): 239–258.
Ericsson, K. (2006). The Influence of Experience and Deliberate Practice on the Development of
Superior Expert Performance. In K. Ericsson, N. Charness, R. Hoffman und P. Feltovich (Hrsg.),
Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. Cambridge: Cambridge University
Press (685–706).
Fischer, F. und J. Forester (1993). The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning. Durham,
NC: Duke University Press.
Freeman, R., S. Griggs und A. Boaz (2011). The Practice of Policy Making. Evidence & Policy 7(2):
127–136.
Frey, K. (2010). Revising Road Safety Policy: The Role of Systematic Evidence in Switzerland.
Governance 23(4): 667–690.- (2012). Evidenzbasierte Politikformulierung in der Schweiz: Gesetzesrevisionen im Vergleich.
Baden-Baden: Nomos.
Frey, K. und S. Ledermann (2010). Evidence-Based Policy: A Concept in Geographical and
Substantive Expansion. German Policy Studies 6(2): 1–15.
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 479
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Frey, K. und T. Widmer (2011). Revising Swiss Policies: The Influence of Efficiency Analyses.
American Journal of Evaluation 32(4): 494–517.
Germann, R. (1981). Ausserparlamentarische Kommissionen: Die Milizverwaltung des Bundes. Bern,
Stuttgart: Paul Haupt.
-(1985). Les hommes de science dans les commissions. In R. Germann (Hrsg.), Experts et
commissions de la Conf�ed�eration. Lausanne: Presses polytechniques romandes.
Germann, R. und A. Frutiger (1979). Les commissions extraparlementaires cr�e�ees de 1970 �a 1977:
Tableaux statistiques. Gen�eve: Universit�e de Gen�eve.
Gigerenzer, G. (2008). Rationality for Mortals: How People Cope with Uncertainty. Oxford: Oxford
University Press.
Guillod, O. und J.-F. Dumoulin (1999). D�efinition de la mort et pr�el�evement d’organes: aspects
constitutionnels. Neuchatel: Institut de droit de la sant�e, Universit�e de Neuchatel, Januar 1999.
Guðmundsson, H., S. J�onsd�ottir und S. J�ul�ıusd�ottir (2010). Evidence-Based Policy and Practice in
Social Services in Iceland. Evidence & Policy 6(2): 195–211.
Hall, P. und R. Taylor (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. Political
Studies XLIV(5): 936–957.
Hansen, H. und O. Rieper (2010). The Politics of Evidence-Based Policy-Making: The Case of
Denmark. German Policy Studies 6(2): 87–112.
Head, B. (2008). Three Lenses of Evidence-Based Policy. Australian Journal of Public Administration
67(1): 1–11.-(2010a). Reconsidering Evidence-Based Policy: Key Issues and Challenges. Policy and Society
29(2): 77–94.-(2010b). Water Policy—Evidence, Learning and the Governance of Uncertainty. Policy and
Society 29(2): 171–180.
Heinrich, C. (2007). Evidence-Based Policy and Performance Management: Challenges and Prospects
in Two Parallel Movements. American Review of Public Administration 37(3): 255–277.
Howlett, M. (2009). Policy Analytical Capacity and Evidence-Based Policy-Making: Lessons from
Canada. Canadian Public Administration 52(2): 153–175.-(2011). Public Managers as the Missing Variable in Policy Studies: An Empirical Investigation
Using Canadian Data. Review of Policy Research 28(3): 247–263.
Howlett, M. und R. Walker (2012). Public Managers in the Policy Process: More Evidence on the
Missing Variable? Policy Studies Journal 40(2): 211–233.
Institut suisse de droit compar�e (1995). Documentation concernant l’�evolution du droit de la tutelle �a
l’�etranger. Lausanne: Institut suisse de droit compar�e.
Institut du f�ed�eralisme (1995). Inventaire des dispositions cantonales concernant la privation de libert�e
�a des fins d’assistance et le traitement forc�e. Fribourg: Institut du f�ed�eralisme de l’Universit�e de
Fribourg.
James, T. und P. Jorgensen (2009). Policy Knowledge, Policy Formulation, and Change: Revisiting a
Foundational Question. Policy Studies Journal 37(1): 141–162.
Johnson, K., L. Greenseid, S. Toal, J. King, F. Lawrenz und B. Volkov (2009). Research on
Evaluation Use: A Review of the Empirical Literature From 1986 to 2005. American Journal of
Evaluation 30(3): 377–410.
K€agi-Diener, R. und R. Schweizer (2000). Gutachten zuhanden der chStiftung und zuhanden der KdK
betreffend Kompetenzen im Sprachen- und Kulturrecht. St. Gallen: Universit€at St. Gallen, 17.
August 2000 / 24. April 2001.
Kickert, W. (2008). The Study of Public Management in Europe and the United States. der moderne
staat 2008(1): 221–236.
Kl€oti, U. und G. Schneider (1989). Informationsbeschaffung des Gesetzgebers. Gr€usch: R€uegger.
480 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Ladi, S. (2005). The Role of Experts in the Reform Process in Greece. West European Politics 28(2):
279–296.
Lavertu, S. und D. Weimer (2010). Federal Advisory Committees, Policy Expertise, and the
Approval of Drugs and Medical Devices at the FDA. Journal of Public Administration Research
and Theory 21(2): 211–237.
Ledermann, S. (2012). Exploring the Necessary Conditions for Evaluation Use in Program Change.
American Journal of Evaluation 33(2): 159–178.
Ledermann, S. und F. Sager (2009). Problem erkannt, aber nicht gebannt – Der Nutzen einer
Verkn€upfung von Konzept- und Umsetzungsevaluation am Beispiel der Strategie “Migration und
Gesundheit”. Zeitschrift f€ur Evaluation 8(1): 7–25.
Leresche, J.-P. (2001). Gouvernance et coordination des politiques publiques. Paris: Pedone.
L€uthi, R. (2009). Im Spannungsfeld zwischen Verwaltung und Politik: Erfahrungen aus der
Erarbeitung von Erlassentw€urfen durch parlamentarische Kommissionen. LeGes 2009(3): 363–374.
Macheret, A. und A. Previtali (2000). Avis de droit concernant la port�ee de l’art. 116 Cst. f�ed. et du
nouvel art. 70 Cst. f�ed. dans le domaine scolaire. Fribourg: Universit�e der Fribourg, 25. April 2000.
Mayring, P. (2003). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (8. Aufl.). Weinheim, Basel:
Beltz.
Monaghan, M. (2008). Appreciating Cannabis: The Paradox of “Evidence” in Evidence-Based
Policy-Making. Evidence & Policy 4(2): 209–231.-(2010). Adversarial Policies and Evidence Utilization: Modeling the Changing Evidence and
Policy Connection. German Policy Studies 6(2): 17–52.
Neidhart, L. (1970). Plebiszit und pluralit€are Demokratie: Eine Analyse der Funktionen des
schweizerischen Gesetzesreferendums. Bern: Francke.
Nicholson-Crotty, S. (2005). Bureaucratic Competition in the Policy Process. Policy Studies Journal
33(3): 341–361.
Nutley, S., S. Morton, T. Jung und A. Boaz (2010). Evidence and Policy in Six European Countries:
Diverse Approaches and Common Challenges. Evidence & Policy 6(2): 131–145.
Nutley, S., I. Walter und H. Davies (2003). From Knowing to Doing: A Framework for
Understanding the Evidence-into-Practice Agenda. Evaluation 9(2): 125–148.
Nutley, S., I. Walter und H. Davies (2007). Using Evidence: How Research Can Inform Public
Services. Bristol: The Policy Press.
OECD (2006). Regulatory Reform in Switzerland: Enhancing Market Openness through Regulatory
Reform. Paris.
Page, E. (2003). The Civil Servant as Legislator: Law Making in British Administration. Public
Administration 81(4): 651–679.
Page, E. und B. Jenkins (2005). Policy Bureaucracy: Government with a Cast of Thousands. New
York: Oxford University Press.
Parsons, W. (2004). Not Just Steering But Weaving: Relevant Knowledge and the Craft of Building
Policy Capacity and Coherence. Australian Journal of Public Administration 63(March): 43–57.
Patton, M. (2014). What Brain Sciences Reveal About Integrating Theory and Practice. American
Journal of Evaluation 35(2): 237–244.
Pawson, R., G. Wong und L. Owen (2011). Known Knowns, Known Unknowns, Unknown
Unknowns: The Predicament of Evidence-Based Policy. American Journal of Evaluation 32(4):
518–546.
P€otzsch, H. (2009). Die Deutsche Demokratie (5. Aufl.). Bonn: Bundeszentrale f€ur politische Bildung.
PVK (2005). Die drei „KMU-Tests” des Bundes: bekannt? genutzt? wirkungsvoll?. Parlamentarische
Verwaltungskontrollstelle (PVK): Bern.
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 481
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Radaelli, C. und A. Meuwese (2010). Hard Questions, Hard Solutions: Proceduralisation through
Impact Assessment in the EU. West European Politics 33(1): 136–153.
Rissi, C. und F. Sager (2013). Types of knowledge utilization of regulatory impact assessments:
Evidence from Swiss policymaking. Regulation & Governance 7(3): 348–364.
Rycroft-Malone, J., K. Seers, A. Titchen, G. Harvey, A. Kitson und B. McCormack (2004). What
Counts as Evidence in Evidence-Based Practice? Journal of Advanced Nursing 47(1): 81–90.
Sabatier, P. und H. Jenkins-Smith (1993). Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition
Approach. Boulder: Westview.
Sager, F. (2007a). Making Transport Policy Work: Polity, Policy, Politics and Systematic Review.
Policy & Politics 35(2): 269–288.- (2007b). Habermas’ Models of Decisionism, Technocracy, and Pragmatism in Times of
Governance: The Relationship of Public Administration, Politics, and Science in the Alcohol
Prevention Policies of the Swiss Member States. Public Administration 85(2): 429–447.
Sager, F. und C. Andereggen (2012). Dealing With Complex Causality in Realist Synthesis: The
Promise of Qualitative Comparative Analysis. American Journal of Evaluation 33(1): 60–78.
Sager, F. und S. Ledermann (2008). Valorisierung von Politikberatung. In S. Br€ochler und R.
Sch€utzeichel (Hrsg.), Politikberatung. Stuttgart: Lucius & Lucius (310–325).
Sager, F. und C. Rissi (2011). The Limited Scope of Policy Appraisal in the Context of Referendum
Democracy: The Case of Regulatory Impact Assessment in Switzerland. Evaluation 17(2): 151–
163.
Sager, F. und C. Rosser (2009). Weber, Wilson, and Hegel: Theories of Modern Bureaucracy. Public
Administration Review 69(6): 1136–1147.
Sanderson, I. (2004). Getting Evidence into Practice: Perspectives on Rationality. Evaluation 10(3):
366–379.- (2006). Complexity, “Practical Rationality” and Evidence-Based Policy Making. Policy &
Politics 34(1): 115–132.-(2009). Intelligent Policy Making for a Complex World: Pragmatism, Evidence and Learning.
Political Studies 57(4): 699–719.- (2010). Evidence, Learning and Intelligent Government: Reflections on Developments in
Scotland. German Policy Studies 6(2): 53–85.
Schedler, K. und L. Schmucki (2009). The Political Rationale of Administrative Reforms:
Parliamentary Support of Output Control in Switzerland. Swiss Political Science Review 15(1): 1–
30.
Schneider, V. (2008). Komplexit€at, politische Steuerung und evidenz-basiertes Policy-Making. In F.
Janning und K. Toens, (Hrsg.), Die Zukunft der Policy-Forschung. Wiesbaden: VS Verlag f€ur
Sozialwissenschaften (55–70).
Schrefler, L. (2010). The Usage of Scientific Knowledge by Independent Regulatory Agencies.
Governance 23(2): 309–330.
Schubert, K. und N. Bandelow (2003). Politikdimensionen und Fragestellungen der
Politikfeldanalyse. In K. Schubert und N. Bandelow (Hrsg.), Lehrbuch der Politikfeldanalyse.
M€unchen, Wien: Oldenbourg (1–21).
Sciarini, P. (2004). The Decision-Making Process. In U. Kl€oti, P. Knoepfel, H. Kriesi, W. Linder
und Y. Papadopoulos (Hrsg.), Handbook of Swiss Politics. Zurich: Neue Z€urcher Zeitung (509–
562).
- (2006). Le processus l�egislatif. In U. Kl€oti, P. Knoepfel, H. Kriesi, W. Linder und Y.
Papadopoulos (Hrsg.), Handbuch der Schweizer Politik (4. Aufl.). Z€urich: Neue Z€urcher Zeitung
(491–525).
Seiler, H. (2000). Risikobasiertes Recht: Wie viel Sicherheit wollen wir? Bern: St€ampfli Verlag.
482 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Solesbury, W. (2001). Evidence Based Policy: Whence it Came and Where it’s Going. ESRC UK
Centre for Evidence Based Policy and Practice Working Paper Nr. 1.
Spinatsch, M. (2002). Evaluation in Switzerland: Moving Toward a Decentralized System. In J.
Furubo, R. Rist und R. Sandahl (Hrsg.), International Atlas of Evaluation. New Brunswick,
London: Transaction Publishers (375–391).-(2006). Kompetent, hartn€ackig, konstruktiv: Die Hauptabteilung Staats- und Verwaltungsrecht des
Bundesamtes f€ur Justiz im Urteil ihrer Partner in der Bundesverwaltung. Bern: Dr. Markus
Spinatsch, Beratung f€ur Politik und Verwaltung.
Strydom, W., N. Funke, S. Nienaber, K. Nortje und M. Steyn (2010). Evidence-based policymaking:
A review. South African Journal of Science 106(5/6): 1–8.
Tenbensel, T. (2004). Does more evidence lead to better policy? Policy Studies 25(3): 189–207.
Tourmen, C. (2009). Evaluators’ Decision Making: The Relationship Between Theory, Practice, and
Experience. American Journal of Evaluation 30(1): 7–30.
Van Dooren, W. (2008). Nothing New Under the Sun? Change and Continuity in the Twentieth-
Century Performance Movements. In W. Van Dooren und S. Van de Walle (Hrsg.), Performance
Information in the Public Sector: How it is Used. Basingstoke: Palgrave Macmillan (11–23).
Varone, F. (2006). L’administration f�ed�erale. In U. Kl€oti, P. Knoepfel, H. Kriesi, W. Linder, Y.
Papadopoulos und P. Sciarini (Hrsg.), Handbuch der Schweizer Politik (4. Aufl.). Z€urich: Verlag
NZZ (289–316).
Vatter, A. (2014). Das politische System der Schweiz. Baden-Baden: Nomos.
Vreugdenhil, H. und P. Ker Rault (2010). Pilot Projects for Evidence-Based Policy-Making: Three
Pilot Projects in the Rhine Basin. German Policy Studies 6(2): 115–151.
Weber, M. (1947). Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie (5. Aufl.).
T€ubingen: Mohr Siebeck.
Weible, C. (2008). Expert-Based Information and Policy Subsystems: A Review and Synthesis. Policy
Studies Journal 36(4): 615–635.
Weible, C. und P. Sabatier (2009). Coalitions, Science, and Belief Change: Comparing Adversarial
and Collaborative Policy Subsystems. Policy Studies Journal 37(2): 195–212.
Weiss, C. (1999). The Interface between Evaluation and Public Policy. Evaluation 5(4): 468–486.
Weiss, C., E. Murphy-Graham, A. Petrosino und A. Gandhi (2008). The Fairy Godmother – and
Her Warts: Making the Dream of Evidence-Based Policy Come True. American Journal of
Evaluation 29(1): 29–47.
Widmer, T. (2009). The Contribution of Evidence-Based Policy to the Output-Oriented Legitimacy
of the State. Evidence & Policy 5(4): 351–372.
Widmer, T. und K. Frey (2008). Erfolgsfaktoren der Programmentwicklung beim Bundesamt f€ur
Gesundheit: Synthesepapier. Bern: Bundesamt f€ur Gesundheit.
Widmer, T. und P. Neuenschwander (2004). Embedding Evaluation in the Swiss Federal
Administration: Purpose, Institutional Design and Utilization. Evaluation 10(4): 388–409.
Yin, R. (2003). Case Study Research: Design and Methods (3. Aufl.). Thousand Oaks, London, New
Delhi: Sage.
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 483
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Anhang
Eckdatender
F€ alle
Fall
Sicherheitskontrollgesetz
Sprachengesetz
Transplantationsgesetz
Vorm
undschaftsrecht
OffiziellerTitel
Bundesgesetz€ uber
die
Pr€ ufung
undKontrolleder
technischen
Sicherheit
Bundesgesetz€ uber
die
Landessprachen
unddie
Verst€ an
digungzw
ischen
den
Sprachgem
einschaften
Bundesgesetz€ uber
die
Transplantationvon
Organen,Gew
eben
und
Zellen
Totalrevisiondes
Vorm
undschaftsrechts
Federf€ uhrung
GeneralsekretariatUVEK
(GS-U
VEK),Eidg.
Departem
entf€ urUmwelt,
Verkehr,Energie
und
Kommunikation(U
VEK)
Bundesamtf€ urKultur(BAK),
Eidg.Departem
entdes
Innern(EDI)
Bundesamtf€ urGesundheit
(BAG),Eidg.Departem
ent
des
Innern(EDI)
Bundesamtf€ urJustiz
(BJ),Eidg.Justiz-und
Polizeidepartem
ent
(EJP
D)
Mandat
Februar1998
Januar1997
Juli1996
September
1993
Vernehmlassung
September
2001
Oktober
2001
Dezem
ber
1999
Juni2003
Botschaft
Juni2006
—(A
pril2004:Ablehnung
Bundesrat;September
2006:
Berichtzu
parlamentarischer
Initiative04.429)
September
2001
Juni2006
Parlamentsbeschluss
—(September
2009:
Nichteintretensentscheid)
Oktober
2007
Oktober
2004
Dezem
ber
2008
Inkraftsetzung
—Januar2010
Juli2007
Januar2013
484 Simone Ledermann
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485

Simone Ledermann, Dr. admin. publ., works at the Parliamentary Control of the Administration, the competence
centre of the Federal Assembly in matters of evaluations. The article is part of her dissertation at University of
Bern. The views expressed herein are entirely her own. Address for correspondence: Parliamentary Control of the
Administration, Parliamentary Services, CH-3003 Berne, Tel. +41 58 322 95 31, Fax +41 58 322 96 63, E-mail:
Evidenz und Expertise im Gesetzgebungsprozess 485
© 2014 Swiss Political Science Association Swiss Political Science Review (2014) Vol. 20(3): 453–485