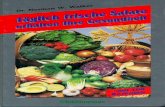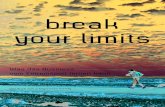Fall: Die Villa -...
Click here to load reader
Transcript of Fall: Die Villa -...

Rechtsanwalt Norman Jäckel · Florian Köhler · Dr. Berend KollAnnina Männig · Solveig Meinhardt · Dr. Anna Mrozek
AG Staatsrecht II
Fall: Die Villa
Der im Bundesland L lebende Eugenius Engelich ist (zunächst glücklicher) Erbe: Nach demTod seiner Großtante fällt ihm allein ein Grundstück mitsamt Gründerzeitvilla zu. EngelichsEuphorie ver�iegt aber schnell, als er bemerkt, dass die Villa in solch miserablem Zustand ist,dass sowohl die Bewohnung als auch die anderweitige Nutzung und Veräußerung schlicht-weg ausgeschlossen ist. Als Engelich deshalb beschließt, sich der Villa durch Abriss zu entle-digen, muss er zu allem Überdruss erfahren, dass das Gebäude ein Kulturdenkmal im Sinnedes einschlägigen Denkmalschutzgesetzes des Landes L (DSchG) darstellt.Engelich stellt daher einen Antrag auf Genehmigung zum Abbruch der Villa nach dem DSchG.Zur Begründung trägt er vor, dass ihm eine wirtschaftliche Nutzung des Grundstücks nichtmehr möglich sei. Angesichts der nach dem DSchG bestehenden Erhaltungsp�ichten seisein Eigentumsrecht mittlerweile zur Last geworden. Die Abbruchgenehmigung wird ihmindes von der zuständigen Behörde versagt: Das DSchG statuiere in § 13 ein grundsätzli-ches Beseitigungsverbot und verlange für eine nur ausnahmsweise zu erteilende Abbruchge-nehmigung, dass „andere Erfordernisse des Gemeinwohls die Belange des Denkmalschutzesüberwiegen und den überwiegenden Erfordernissen des Gemeinwohls nicht auf andere Wei-se Rechnung getragen werden kann“. Diese Voraussetzungen seien nicht gegeben, da demDenkmalschutz hier keine Gemeinwohlbelange entgegenstehen.
Aufgabe: Beurteilen Sie in einemRechtsgutachten, ob Engelich durch die Versagungder Abbruchgenehmigung in seinem Grundrecht auf Eigentum aus Art. 14 Abs. 1Satz 1 GG verletzt ist.
§ 13 DSchG des Landes L(1) Ein durch Verwaltungsakt unter Schutz gestelltes Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung1. zerstört, abgebrochen, zerlegt oder beseitigt,2. [. . . ]werden. Im Falle des Satzes 1 Nr. 1 darf die Genehmigung nur erteilt werden, wenn andere Erfor-dernisse des Gemeinwohls die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalp�ege überwiegen;hierbei ist zu prüfen, ob den überwiegenden Erfordernissen des Gemeinwohls nicht auf andereWeise Rechnung getragen werden kann.(2) [. . . ]
Seite 1

Rechtsanwalt Norman Jäckel · Florian Köhler · Dr. Berend KollAnnina Männig · Solveig Meinhardt · Dr. Anna Mrozek
AG Staatsrecht II
LösungE ist in seinem Grundrecht aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG verletzt, wenn die Versagung derAbbruchgenehmigung einen Eingri� in den Schutzbereich dieses Grundrechts darstellt, dernicht verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist.
A. Schutzbereich
I. Persönlicher Schutzbereich
Der persönliche Schutzbereich müsste erö�net sein. Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG tri�t keine ex-plizite Aussage hinsichtlich des persönlichen Schutzbereiches, so dass davon auszugehen ist,dass es sich hierbei um ein Jedermann-Grundrecht handelt. In Bezug auf E ist der persönlicheSchutzbereich damit erö�net.
II. Sachlicher Schutzbereich
Der sachliche Schutzbereich müsste erö�net sein.Geschützt von Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG ist das „Eigentum“. Dieser verfassungsrechtliche Ei-gentumsbegri� ist nicht mit dem zivilrechtlichen Begri� des Eigentums (§ 903 BGB) gleichzu-setzen, sondern muss „aus der Verfassung selbst gewonnen werden“. Eigentum im Sinne vonArt. 14 Abs. 1 Satz 1 GG sind demnach zunächst alle vermögenswerten Rechte – jedenfalls –des Privatrechts. Dazu zählen vor allem das Eigentum nach bürgerlichem Recht (§ 903 BGB),sonstige vermögenswerten Rechte, das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbe-betrieb (str.), nicht aber das Vermögen als solches, also die Gesamtheit der Vermögenswertedes Einzelnen.Vorliegend ist E infolge der Erbschaft Eigentümer des Grundstücks mitsamt der Gründerzeit-villa im zivilrechtlichen Sinne geworden (§ 1922 BGB). Beides unterfällt mithin grundsätzlichdem Schutz der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG.Fraglich ist aber, ob sich die Reichweite des sachlichen Schutzbereiches (über den Bestandhinaus) auch auf die Nutzung des Eigentums erstreckt. Es geht dem E vorliegend geradedarum, das Grundstück nach Belieben zu nutzen, etwa neu zu bebauen oder zu veräußern.Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG schützt aber nicht nur den Bestand des Eigentums, sondern auchdessen (private) Nutzung.Damit ist auch der sachliche Schutzbereich erö�net.Nicht vom Schutzbereich erfasst sind nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-richts allerdings bloße Erwerbs- oder Gewinnaussichten, die möglicherweise mit einem bestimm-ten Gegenstand erzielt werden können.
Seite 2

Rechtsanwalt Norman Jäckel · Florian Köhler · Dr. Berend KollAnnina Männig · Solveig Meinhardt · Dr. Anna Mrozek
AG Staatsrecht II
B. Eingri�
Ob ein Eingri� in die Eigentumsfreiheit aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG vorliegt, bestimmt sichgrundsätzlich nach den allgemeinen Regeln. Ein (klassischer) Eingri� liegt vor, wenn durchstaatliches Handeln zweckgerichtet mit Befehl und Zwang durch einen Rechtsakt unmittel-bar der Schutzbereich eines Grundrechts verkürzt wird.Ob es sich dabei um Inhalts- und Schrankenbestimmungen (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) oderEnteignungen (Art. 14 Abs. 3 GG) handelt, ist bei der Eingri�sprüfung noch nicht relevant. DieDi�erenzierung kann dennoch bereits hier vorgenommen werden.Durch den ablehnenden Bescheid der Behörde wird dem E untersagt, seine Villa abzurei-ßen. Dadurch ist es dem E nicht möglich, sein Eigentum – das Grundstück – so zu nutzen,wie er es möchte. Der Bescheid entfaltet auch Rechtswirkung gegenüber E. Er zielt geradedarauf ab, ein grundrechtlich geschütztes Verhalten zu unterbinden. Das Abbruchverbot istgegebenenfalls auch mit Zwang durchsetzbar. Mithin liegt ein klassischer Eingri� vor.
C. Rechtfertigung
Der Eingri� könnte allerdings gerechtfertigt sein. Bei der Rechtfertigung von Eingri�en inArt. 14 Abs. 1 Satz 1 GG muss aufgrund der jeweils unterschiedlichen Anforderungen undFolgen zwischen Inhalts- und Schrankenbestimmungen (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) einerseitsund Enteignungen (Art. 14 Abs. 3 GG) andererseits di�erenziert werden.Nach dem Bundesverfassungsgericht ist der Begri� der Enteignung (entgegen vorangegan-gener Rechtsprechungen des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichtshofs, ins-besondere seit dem Nassauskiesungsbeschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1981) engzu de�nieren: Demnach sind Enteignungen im Sinne von Art. 14 Abs. 3 GG nur solche Maß-nahmen, die auf „die vollständige oder teilweise Entziehung konkreter subjektiver, durchArt. 14 Abs. 1 S. 1 GG gewährleisteter Rechtspositionen“ gerichtet sind, um „Güter hoheit-lich (zu bescha�en), mit denen ein konkretes, der Erfüllung ö�entlicher Aufgaben dienendesVorhaben durchgeführt werden soll“. (BVerfGE 104, 1 (9))Demgegenüber sind Inhalts- und Schrankenbestimmungen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2GG Regelungen, die „generell und abstrakt Rechte und P�ichten des Eigentümers festlegen“.(BVerfGE 58, 300 (330)).Vorliegend entzieht die durch das DSchG normierte P�icht zur Versagung der Abbruchge-nehmigung wohl keine konkrete Eigentumsposition zur Erfüllung bestimmter ö�entlicherAufgaben, sondern beschränkt die Nutzungsmöglichkeiten eines mit einem Denkmal bebau-ten Gründstücks. Damit liegt hier keine Enteignung im Sinne von Art. 14 Abs. 3 GG, sonderneine Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG vor.Eingri�e in Form von Inhalts- und Schrankenbestimmungen sind gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz2 GG „durch die Gesetze“ möglich. Dabei handelt es sich um einen einfachen Gesetzesvorbe-halt. Die Eingri�e sind dann gerechtfertigt, wenn sie auf einer formell und materiell verfas-
Seite 3

Rechtsanwalt Norman Jäckel · Florian Köhler · Dr. Berend KollAnnina Männig · Solveig Meinhardt · Dr. Anna Mrozek
AG Staatsrecht II
sungsmäßigen Rechtsgrundlage beruhen, die auch verfassungsmäßig angewendet wordenist.
I. Schranke
Als Schranke kommt vorliegend § 13 DSchG des Landes L in Betracht. Diese Vorschrift müss-te formell und materiell verfassungsmäßig sein.
1. Formelle Verfassungsmäßigkeit
Aus Art. 73, 74 GG ergibt sich keine entsprechende Kompetenz des Bundes, weshalb dasLand L vorliegend für den Erlass des DSchG zuständig war (Art. 70 GG). Hinsichtlich derVerfahrens- und Formvorschriften der Landesverfassung kann per se kein Verstoß gegen dasGrundgesetz gegeben sein. Das Gesetz verstößt mithin nicht in formeller Hinsicht gegen dasGrundgesetz.
2. Materielle Verfassungsmäßigkeit, insbesondere Verhältnismäßigkeit
Fraglich ist aber, ob § 13 DSchG auch materiell verfassungsmäßig, insbesondere verhältnis-mäßig, ist.
a) Legitimer Zweck Der Zweck des DSchG insgesamt liegt im Schutz von Kulturdenk-mälern. Damit besteht jedenfalls ein legitimes gesetzgeberisches Anliegen.
b) Geeignetheit Das DSchG müsste auch zur Erreichung dieses Zwecks geeignet sein.Dadurch, dass der Abbruch eines Denkmals nach § 13 DSchG nur genehmigt werden darf,wenn „andere Erfordernisse des Gemeinwohls die Belange des Denkmalschutzes überwie-gen“ und zu prüfen ist, ob den überwiegenden Erfordernissen des Gemeinwohls „nicht aufandere Weise Rechnung getragen werden kann“, ist der Denkmalschutz in nahezu allen Fäl-len gesichert. § 13 DSchG ist folglich auch geeignet zur Erreichung des legitimen Zwecks.
c) Erforderlichkeit Ein milderes, gleich geeignetes Mittel zur Sicherung des Denkmal-schutzes ist nicht ersichtlich. Damit ist die Regelung aus § 13 DSchG auch erforderlich.
d) Angemessenheit Fraglich ist aber, ob die Norm aufgrund ihres Wortlautes in ihrerAnwendung nicht zwangsläu�g zu einer unverhältnismäßigen Belastung des Eigentümersim engeren Sinne führt, ob sie also angemessen ist.Die bestehende Nutzung eines Denkmals wird durch das grundsätzliche Abrissverbot nichteingeschränkt. „Angesichts des hohen Ranges des Denkmalschutzes und mit Blick auf Art. 14
Seite 4

Rechtsanwalt Norman Jäckel · Florian Köhler · Dr. Berend KollAnnina Männig · Solveig Meinhardt · Dr. Anna Mrozek
AG Staatsrecht II
Abs. 2 Satz 2 GG muss der Eigentümer es grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherwei-se eine rentablere Nutzung des Grundstücks verwehrt wird. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nichtdie einträglichste Nutzung des Eigentums.“ (BVerfGE 100, 226 (242 f.)). In vielen Fällen kannein solches Abrissverbot jedoch zur Folge haben, dass keine Möglichkeit zu einer sinnvollenNutzung des Grundstücks mehr besteht, es sich weder anders bebauen noch veräußern lässt.In ebensolchen Fällen wird die Privatnützigkeit des Eigentums im Prinzip vollständig besei-tigt. „Nimmt man die gesetzliche Erhaltungsp�icht hinzu, so wird aus dem Recht eine Last,die der Eigentümer allein im ö�entlichen Interesse zu tragen hat, ohne dafür die Vorteileeiner privaten Nutzung genießen zu können. Die Rechtsposition des Betro�enen nähert sichdamit einer Lage, in der sie den Namen ‚Eigentum‘ nicht mehr verdient. Die Versagung einerBeseitigungsgenehmigung ist dann nicht mehr zumutbar.“ (BVerfGE 100, 226 (243))Zum Beispiel handelt es sich vorliegend um einen ebensolchen Fall: Durch die aus § 13 DSchGresultierende P�icht zur Versagung einer Abbruchgenehmigung durch die zuständige Behör-de wird es für E unmöglich, sein Grundstück in irgendeiner sinnvollen Weise zu nutzen.Die Regelung des DSchG berücksichtigt lediglich die dem Denkmalschutz entgegenstehen-den „Erfordernisse des Gemeinwohls“, nicht aber etwaige Individualinteressen des betro�e-nen Eigentümers. In Härtefällen – wie etwa dem hier vorliegenden – sieht sie somit nichtmehr zumutbare Entscheidungen vor, ohne dass entsprechende Ausnahmeregelungen er-sichtlich sind oder sich durch (verfassungskonforme) Auslegung gewinnen lassen. Die Rege-lung ist damit nicht angemessen.Exkurs: Um der Berücksichtigung von Individualinteressen gerecht zu werden, wäre etwa denk-bar, dass einerseits Regelungen in das DSchG eingefügt werden, die bei Härtefällen ausnahms-weise die Genehmigung von Abbrüchen denkmalgeschützter Gebäude zugunsten des Einzelnenzulassen, andererseits, dass in solchen Härtefällen, in denen die Versagung einer Abbruchgeneh-migung unter allen Umständen erforderlich scheint, der betro�ene Eigentümer jedenfalls eineEntschädigung in Geld erhält.Hinweis: Bei der Argumentation ist stets darauf zu achten, dass die Ebene der abstrakten Ge-setzesprüfung nicht verlassen wird. Hier kommt es auf den Fall des E nicht an. Er dient nur alsBeispiel.
e) Ergebnis § 13 DSchG ist nicht verhältnismäßig und damit nicht materiell verfassungs-mäßig.
3. Ergebnis
§ 13 DSchG stellt keine verfassungsmäßige Schranke dar.
II. Verfassungsmäßige Anwendung der Schranke
Eine nicht verfassungsmäßige Schranke kann auch nicht verfassungsmäßig angewendet wer-den. Damit ist auch die Versagung der Abbruchgenehmigung durch die Behörde nicht ver-
Seite 5

Rechtsanwalt Norman Jäckel · Florian Köhler · Dr. Berend KollAnnina Männig · Solveig Meinhardt · Dr. Anna Mrozek
AG Staatsrecht II
fassungsmäßig.
III. Ergebnis
Der Eingri� in das Recht des E auf Eigentum aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG ist nicht gerecht-fertigt.
D. Zusammenfassung
E ist durch die Versagung der Abbruchgenehmigung in seinem Recht auf Eigentum ausArt. 14 Abs. 1 Satz 1 GG verletzt.
Erzeugt mit LATEX und KOMA-Script.
Seite 6

Rechtsanwalt Norman Jäckel · Florian Köhler · Dr. Berend KollAnnina Männig · Solveig Meinhardt · Dr. Anna Mrozek
AG Staatsrecht II
Lösungsübersicht
A. Schutzbereich
I. Persönlicher Schutzbereich
II. Sachlicher Schutzbereich
B. Eingri�
C. Rechtfertigung
I. Schranke
1. Formelle Verfassungsmäßigkeit
2. Materielle Verfassungsmäßigkeit,insbesondere Verhältnismäßigkeit
a) Legitimer Zweck
b) Geeignetheit
c) Erforderlichkeit
d) Angemessenheit
Seite 1

Rechtsanwalt Norman Jäckel · Florian Köhler · Dr. Berend KollAnnina Männig · Solveig Meinhardt · Dr. Anna Mrozek
AG Staatsrecht II
e) Ergebnis
3. Ergebnis
II. Verfassungsmäßige Anwendung der Schranke
III. Ergebnis
D. Zusammenfassung
Seite 2