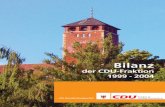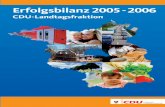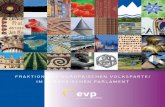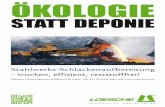Fraktion direkt - Ausgabe 33
-
Upload
team-ruediger-kruse-mdb -
Category
Documents
-
view
7 -
download
2
description
Transcript of Fraktion direkt - Ausgabe 33

33 | 06. März 2015
Zur Lage
Volker KauderVorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Foto
: Lau
renc
e Ch
aper
on
Juden müssen sich sicher fühlenWarnung des Zentralratspräsidenten ist Alarmsignal
Diese Warnung muss für uns alle ein Alarmsignal sein. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat dazu geraten, dass sich Juden in bestimmten städtischen Problemvierteln nicht als Angehörige ihrer Re-ligionsgemeinschaft zu erkennen geben sollen.
Schon in den vergangenen Jahren wurden immer wieder Übergriffe auf jüdische Mitbürger in unserem Land publik. Die Worte des Zentralratspräsidenten zeigen nun aber auf dramatische Weise, wie verunsichert die jüdischen Mitbür-ger mittlerweile sind – ja, wie gefährdet sie sich fühlen. Eine Aussage des Berliner Rabbiners Daniel Alter unter-streicht dies. „Für uns Juden“, so sagt er, „gehören der Terror und Attentate schon lange zum täglichen Leben.“
Solche Bekundungen müssen uns wachrütteln. Gesell-schaft und Staat müssen alles unternehmen, dass sich Ju-den in unserem Land sicher fühlen können. In Deutsch-land hat jeder das Recht, seine Religion frei zu leben. Dazu gehört auch, dass die Gläubigen nach außen zu erkennen geben können, welcher Religionsgemeinschaft sie angehö-ren. Dies muss jeder in unserer Gesellschaft tolerieren.
Hohe Sensibilität nötig
Gerade in Deutschland muss aufgrund der Geschichte die Sensibilität in dieser Frage besonders hoch sein. In unse-rem Land müssen alle Bürger zusammen darauf hinwirken, dass das jüdische Leben, das sich nach 1945 auf fast wun-derbare Weise neu entwickelt hat, nicht mehr schleichend bedroht wird. Wir alle haben eine einzigartige Verantwor-tung gegenüber unseren jüdischen Mitbürgern.
„Probleme nicht unter den Teppich kehren“
Dabei gilt es genau hinzuschauen, wer diejenigen sind, die Juden belästigen, beleidigen oder angreifen. Die Berliner Senatorin für Arbeit und Integration mag die Augen davor verschließen, dass es bestimmte Problembezirke gibt, also solche Gegenden, in denen laut Schuster ein hoher Anteil von Muslimen lebt. Ich vermisse bei der Senatorin aber eine deutliche Auseinandersetzung mit dem Problem. Denn die Zahl der antisemitischen Straftaten steigt nun einmal nachweislich. Und viele Vorkommnisse, auch das hören wir, werden von den Betroffenen überhaupt nicht mehr angezeigt. Man sollte also nichts unter den Teppich kehren. Die Wahrheit sind Staat und Gesellschaft unseren jüdischen Mitbürgern zuallererst schuldig.

2 | Fraktion direkt 33 | 06. März 2015
Inhalt
Headline 1 1
Headline 2 2
Headline 3 3
Headline 4 4
Kommentar
Impressum
HerausgeberMichael Grosse-Brömer MdBMax Straubinger MdBCDU/CSU-BundestagsfraktionPlatz der Republik 111011 Berlin
V.i.S.d.P.: Ulrich ScharlackRedaktion: Claudia Kemmer (verantw.)
T 030. 227-5 30 15F 030. 227-5 66 [email protected]
Diese Veröffentlichung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag dient ausschließlich der Information. Sie darf während eines Wahl-kampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden.
Michael Grosse-BrömerErster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Foto
: Dom
inik
But
zman
n
Wohnraum in Innenstädten muss bezahlbar bleibenMietpreisbremse ist richtige Antwort auf die Explosion der Preise
Inhalt
Juden müssen sich sicher fühlen 1
Wohnraum in Innenstädten muss bezahlbar bleiben 2
Mehr Ärzte für den ländlichen Raum 3
„Putin muss Klima der Repression beenden“ 4
Bezahlbarer Wohnraum durch Mietpreisbremse 5
Frauenquote mit Augenmaß 6
Zwischen Tarifautonomie und Betriebsfrieden 7
Arbeitgeber beklagen „Misstrauen“ gegen Unternehmen 8
Letzte Seite 9
Wir haben mit dem Mietrechtsnovel-lierungsgesetz ein Thema aufgegrif-fen, das viele Menschen in Deutsch-land beschäftigt: die unaufhaltsam steigenden Mieten vor allem in den Großstädten. Im Bundestagswahl-kampf sind immer wieder Bürgerin-nen und Bürger in den Ballungsräu-men an uns herangetreten, die eine politische Antwort auf die Mietpreis-explosion dort für erforderlich gehal-ten haben. Deshalb wurde die Miet-preisbremse in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Die Verhandlungen mit der SPD in den vergangenen Mo-naten dazu waren intensiv. Doch das hat sich ausgezahlt, denn wir haben die aus unserer Sicht entscheidenden Punkte durchsetzen können.
Wir wollen, dass auch künftig in Ballungszentren und Universitäts-städten bezahlbarer Wohnraum in der Innenstadt angemietet werden kann. In einer Stadt wie München können sich inzwischen viele junge Familien nur noch Wohnraum außerhalb der Stadt leisten. Dabei geht durch die Pendelei zwischen Arbeitsort, Wohn-ort, Schulen oder Kindergärten häufig Lebensqualität verloren. Sicherlich wird die Mietpreisbremse in zahlrei-
chen, vor allem ländlichen Regi-onen Deutschlands keine Rolle spielen. Die Bundesländer müs-sen selbst entscheiden, in wel-chen Städten sie zur Anwendung kommt. Aber prinzipiell gilt: Wer seinen Lebensunterhalt erarbei-tet und Kinder groß zieht, sollte auch die Chance haben, im In-nenstadtbereich wohnen zu kön-nen. Innenstädte, in denen es nur noch sozialen Wohnungsbau oder Luxusimmobilien gibt, soll-ten nicht das Zukunftsmodell sein.
Städte müssen mehr Flächen für Neubau ausweisen
Doch kann die Regulierung der Mie-ten in Orten, in denen die Preise ex-plodieren, nicht darüber hinwegtäu-schen, dass gleichermaßen ein zwei-ter Punkt nicht aus den Augen verloren werden darf. Dort, wo Mieten überdurchschnittlich steigen, fehlt meistens Wohnraum. Das heißt, gera-de Neubau wird in vielen Fällen zur Entspannung am Wohnungsmarkt beitragen können. Hier müssen die Großstädte auch ihren Beitrag leisten, indem sie zum Beispiel mehr Flächen für den Neubau ausweisen.
Es ist für uns in der Union daher das richtige Signal, dass Neubauten und vollumfänglich modernisierte Häuser von der Mietpreisbremse aus-genommen sind. Das war ein Kernan-liegen in unseren Verhandlungen mit dem Koalitionspartner. Uns ist es wichtig, dass die Mietpreisbremse nicht zur Investitionsbremse wird.
Und schließlich haben wir mit dem Besteller-Prinzip den Missstand besei-tigt, dass Vermieter Dienste von Mak-lern in Anspruch nehmen, die Kosten dafür aber dem Mieter auferlegen. Wir haben dafür gesorgt, dass derjenige den Makler bezahlt, der ihn auch be-auftragt – eine bereits im Koalitions-vertrag niedergelegte Erkenntnis.

3 | Fraktion direkt 33 | 06. März 2015
Mehr Ärzte für den ländlichen RaumBundestag debattiert erstmals über Maßnahmenbündel zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung
Die Fraktion im Plenum
Die medizinische Versorgung in Deutschland ist gut. Doch angesichts einer alternden Gesellschaft und ei-ner zunehmenden Verstädterung steht das Gesundheitswesen vor Her-ausforderungen. Mit einem Bündel von Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in struk-turschwachen Gebieten will die Koali-tion dem begegnen. Der Bundestag debattierte am Donnerstag erstmals über das sogenannte Versorgungs-stärkungsgesetz.
Zu den Maßnahmen, die der Ge-setzentwurf vorsieht, gehört der Ab-bau von Arztpraxen in überversorgten Gebieten bei gleichzeitiger Förderung von Niederlassungen in unterversorg-ten Regionen. Aus Strukturfondsmit-teln sollen Zuschüsse für Neunieder-lassungen oder die Gründung von Zweigpraxen, für Ausbildung oder Sti-pendien gezahlt werden. Auch Praxis-netze sollen gefördert werden. Dies sind Zusammenschlüsse von Ver-tragsärzten verschiedener Fachrich-tungen zur gemeinschaftlichen Ver-sorgung der Patienten.
Aus einem Innovationsfonds, der in den Jahren 2016 bis 2019 mit jähr-lich 300 Millionen Euro bestückt
© R
ioPa
tuca
Imag
es -
Foto
lia.c
om
wird, sollen Gelder zur Entwicklung neuer Versorgungsmodelle fließen – beispielsweise für die Telemedizin oder den Ausbau der geriatrischen Versorgung. Mehr Hausärzte sollen eine geförderte Weiterbildung erhal-ten. Die Zahl der Stellen dafür soll bundesweit von 5.000 auf 7.500 er-höht werden. Nicht zuletzt sollen Pa-tienten innerhalb von vier Wochen einen Facharzttermin bekommen (s. Infobox).
„Wir müssen handeln, bevor die Unterversorgung eintritt“, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, Annette Widmann-Mauz, die den an Grippe erkrankten Minister Hermann Gröhe vertrat, im Bundestag. Schon jetzt gebe es auf dem Land Regionen, in de-nen die Patienten nur mit Mühe einen Hausarzt und Hausärzte im Rentenal-ter keinen Nachfolger für ihre Praxis fänden. Jungen Ärzten sollten Anreize gegeben werden, sich im ländlichen Raum niederzulassen, etwa über Nie-derlassungshilfen, Weiterbildungs-plätze oder Stipendien, sagte Wid-mann-Mauz. Auch müsse die ambu-lante und stationäre Versorgung besser verzahnt werden.
„Geld allein löst das Problem nicht“
Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jens Spahn, be-tonte: „Geld allein löst das Problem nicht.“ Man brauche ein Bündel von Maßnahmen, um den ländlichen Raum attraktiv zu machen. Er wies da-rauf hin, dass viele junge Mediziner die Selbstständigkeit scheuten und lieber angestellt sein wollten. Deshalb sollten die Kommunen medizinische Versorgungszentren betreiben kön-nen. Auch der stellvertretende Frakti-onsvorsitzende Georg Nüßlein unter-strich, die Kommunalpolitiker hätten die besten Einblicke in die Situation vor Ort und die größte Motivation, die Probleme zu lösen.
Terminservicestellen
Patienten mit akuten Beschwerden, die der Hausarzt alleine nicht behandeln kann, sollen künftig innerhalb von vier Wochen einen Termin bei einem Fach-arzt bekommen. Dafür sollen laut Gesetz Terminservicestellen eingerichtet werden, an die sich gesetzlich Versi-cherte wenden können. Zwar gilt schon heute, dass die Versicherten Anspruch auf eine angemessene und zeitnahe fachärztliche Versorgung haben. Doch berichten immer noch viele Patienten über lange Wartezeiten auf einen Fach-arzttermin.Künftig soll sich der Versicherte darauf verlassen können, dass die fachärztliche Behandlung innerhalb von vier Wochen erfolgt, sei es bei einem niedergelasse-nen Facharzt oder in einem Kranken-haus. Vier Wochen Wartezeit ist als Maximum zu verstehen. In wirklich dringenden Einzelfällen soll und muss es auch schneller gehen. Die Vier-Wochen-Frist gilt nicht für verschiebbare Routi-neuntersuchungen oder Bagatellerkran-kungen. Vermittelt werden kann auch nur zu Fachärzten, die Behandlungska-pazitäten frei haben. Daher haben die Versicherten auch keinen Anspruch auf Vermittlung zu ihrem Wunscharzt.

4 | Fraktion direkt 33 | 06. März 2015
Die Fraktion im Gespräch
Franz Josef JungStellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
„Putin muss Klima der Repression beenden“Franz Josef Jung über den Mord am Kreml-Kritiker Nemzow und den Zustand der Demokratie in Russland
In Moskau ist in der Nacht zum Samstag der Kreml-Kritiker Boris Nemzow auf offener Straße erschos-sen worden. Was dieser Auftragsmord für die russische Demokratie bedeu-tet, darüber sprach „Fraktion direkt“ mit dem stellvertretenden Fraktions-vorsitzenden Franz Josef Jung.
Herr Jung, der Mord an dem Oppositio-nellen Nemzow ist nicht der erste seiner Art. Man erinnere sich nur an die Jour-nalistin Anna Politkowskaja, den Putin-Kritiker Alexander Litwinenko oder die Bürgerrechtlerin Natalja Estemirowa. Was sagt das über den Zustand der Demokratie in Russland?
Jung: Seit dem Amtsantritt von Präsi-dent Putin im Jahr 2012 ist eine stän-dig zunehmende Repression gegen kritische Nicht-Regierungsorganisa-tionen und Oppositionskräfte festzu-stellen. Pressefreiheit, Versamm-lungsfreiheit, Informationsfreiheit und Bürgerrechte sind heute in einem dramatisch schlechten Zustand. Wer in Russland Putin und sein Regime kritisiert, muss nicht nur den Sicherheitsapparat fürchten. Er muss auch mit den Schlägern des
sogenannten „Anti-Maidan“ rechnen, die jede Opposition gegen Putin mit Gewalt im Keim ersticken wollen und die dafür nicht einmal zur Rechenschaft gezogen werden, sondern straflos bleiben. Das zeigt, wie abstrus die For-mulierung des ehemaligen Bundeskanzlers Schröder ist, Putin sei ein „lupenreiner Demokrat“. Wir wissen nicht, welche Auftraggeber für den Mord an Boris Nemzow verant-wortlich sind – aus welchem politischen Lager Russlands sie stammen und welche Motive sie mit dem Mord ver-folgen. Was wir wissen, ist, dass in den vom Kreml gelenk-
ten Medien mit verleumderischer Propaganda ein Klima des Hasses, der Aggression und der Feindschaft gegen Kritiker des Regimes und gegen Andersdenkende geschürt wird. Es überrascht dann nicht, wenn die Saat für solche Gewalt, wie wir sie jetzt erneut erleben mussten, aufgeht.
„Es gibt immer noch eine Alternative“
Für wie glaubwürdig halten Sie Präsident Wladimir Putin, wenn er rückhaltlose Aufklärung fordert und ankündigt, die Täter und Organisatoren zu bestrafen?
Jung: Ich erwarte, dass er alles tut, damit die russischen Behörden die-sen Mord vollständig und nachvoll-ziehbar aufklären. Auftraggeber und Motive des Verbrechens dürfen nicht wieder im Dunkeln bleiben – wie es beispielsweise bei Anna Politkows-kaja, Natalja Estemirowa oder Alex-ander Litwinenko der Fall ist.
In Moskau haben am Sonntag Zehntau-sende an einem Trauermarsch teilge-
nommen, auf dem sie auch ein freies Russland forderten. Sehen wir ein Wie-deraufleben der Demokratiebewegung dort?
Jung: Dass so viele Menschen trotz der Repressionen am Trauermarsch für Boris Nemzow teilgenommen haben, zeigt, dass es in der russi-schen Gesellschaft weiterhin mutige Kräfte gibt, die gegen dieses Klima der Einschüchterung und des Hasses Zeichen setzen – Menschen zum Bei-spiel, die Schilder hoch halten mit der Aufschrift „Ich habe keine Angst“. Ihnen gehört unsere Sympathie und Solidarität! Und es zeigt: Es gibt immer noch eine Alternative. Aber ich fürchte, dass die Repressionen weiter zunehmen werden. Zu groß ist bei den Führenden in Moskau die Angst vor einem „russischen Mai-dan“.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die russische Regierung unter dem Sanktionsdruck von außen und der Demokratiebewegung im Inneren bewegt?
Jung: Ich sehe bei der russischen Führung noch keine Einsicht in die politische Notwendigkeit, dass der derzeitige Kurs beendet werden muss. Dies ist aber erforderlich, denn mit zunehmender politischer Repres-sion und mit dem parallel dazu rapide verlaufenden wirtschaftlichen Niedergang hat das Land keine Zukunft. Putin muss das Klima der Repression beenden. Russland braucht alle Kräfte, die das Land vor-anbringen wollen, auch die kriti-schen Kräfte. Wir wollen kein schwa-ches, isoliertes Russland in Europa. Wir wollen ein berechenbares, modernes und starkes Russland, mit dem wir zusammenarbeiten können. Und das ist auch für die Sicherheit in Europa unverzichtbar.
Foto
: MdB
-Bür
o D
r. Ju
ng

5 | Fraktion direkt 33 | 06. März 2015
Bezahlbarer Wohnraum durch MietpreisbremseGesetz vom Bundestag beschlossen – Union setzt gute Bedingungen für Investitionen in Neubauten durch
Die Fraktion im Plenum
In vielen Großstädten sind die Mieten in den vergangenen Jahren so stark gestiegen, dass selbst Durchschnitts-verdiener Mühe haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Langjährige Mieter werden aus ihren Wohnvier-teln verdrängt. Diese Entwicklung soll nun mit Hilfe einer Mietpreisbremse
gestoppt werden. Der Bundestag ver-abschiedete am Donnerstag ein ent-sprechendes Gesetz. Die Unionsfrak-tion hatte sich während der Verhand-lungen besonders dafür eingesetzt, dass die Neuregelung Investitionen in den Wohnungsbau nicht verhindert. Denn fehlender Wohnraum ist eine der wesentlichen Ursachen für stei-gende Mieten.
In Städten mit „angespannten Wohnungsmärkten“ darf die Miete bei einer Wiedervermietung laut Gesetz künftig nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmie-te liegen. Bei der Ermittlung der Ober-grenze hilft der örtliche Mietspiegel.
Nur Neubauwohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt oder vermietet wurden, sowie Woh-nungen, die umfassend modernisiert wurden, sind von der Mietpreisbrem-se ausgenommen. Dieser Passus war der Unionsfraktion wichtig. Somit wird sichergestellt, dass auch Anreize
für Wohnungsbau und Modernisie-rungen bestehen bleiben. Denn der Neubau ist das beste Rezept gegen steigende Mieten.
Bundesländer in der Pflicht
In welchen Städten die Mietpreisbe-grenzung gilt, müssen die Bundeslän-der anhand einschlägiger Indikatoren festlegen. Sie können von der Miet-preisbremse für höchstens fünf Jahre – also bis Ende 2020 – Gebrauch ma-chen und müssen sich in dieser Zeit darum bemühen, die Lage auf dem be-treffenden Wohnungsmarkt zu ver-bessern. Auf objektive Kriterien für
© R
alf G
osch
- Fot
olia
.com
die Festlegung der „angespannten Wohnungsmärkte“ hatte die Unions-fraktion gedrungen. Denn Gebietsaus-weisungen nach Gutsherrenart darf es nicht geben. Und die Länder werden auf Drängen der CDU/CSU in die Pflicht genommen, Maßnahmen ge-gen die Wohnungsnot zu ergreifen.
Mehr Fairness bei den Maklergebühren
Was die Wohnungsvermittlung an-geht, so sieht das Gesetz eine Neue-rung vor, die mehr Fairness ver-spricht. Musste bisher in der Regel der Wohnungssuchende die Maklerge-bühr bezahlen, so gilt künftig das Prinzip: Wer den Makler bestellt, der zahlt. Vermieter können die Makler-kosten auch nicht per Vereinbarung auf den Mieter abwälzen. Eine solche Vereinbarung ist laut Gesetz unwirk-sam.

6 | Fraktion direkt 33 | 06. März 2015
Frauenquote mit AugenmaßBundestag verabschiedet Gesetz – Starre Vorgaben nur für die größten Unternehmen – Privatwirtschaft nicht überfordern
Die Fraktion im Plenum
Die Anzahl von Frauen in Führungs-positionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst ist seit vielen Jahren unverändert niedrig. Daher haben sich CDU/CSU und SPD daran gemacht, im Sinne des Grund-gesetzes Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts zu beseitigen. Der Unionsfraktion war es dabei wichtig, die Privatwirtschaft nicht zu überfor-dern: Und so gilt die feste Quote von 30 Prozent Frauen in Aufsichtsräten künftig nur für die größten Unterneh-men in Deutschland. Für kleinere Un-ternehmen gibt es eine flexiblere Vor-gabe. Ein entsprechendes Gesetz der Koalition beschloss der Bundestag am Freitag mit breiter Mehrheit.
Im Einzelnen sieht das Gesetz vor, dass eine feste Geschlechterquote von mindestens 30 Prozent ab dem 1. Ja-nuar 2016 für alle neu zu besetzenden Aufsichtsratsposten von voll mitbe-stimmungspflichtigen und börsenno-tierten Unternehmen der Privatwirt-schaft gilt. Betroffen sind 108 Unter-nehmen.
Unternehmen, die börsennotiert oder mitbestimmungspflichtig sind, also mehr als 500 Mitarbeiter haben, müssen sich selbst Zielvorgaben für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, im
Vorstand und in den obersten Ma-nagementebenen setzen. Dies betrifft ca. 3.500 Unternehmen. Die verbind-lich festgelegten Zielgrößen und Fris-ten müssen sie veröffentlichen.
Auch in diesem Teil des Gesetzes hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion Verbesserungen erreichen können. Die Unternehmen haben jetzt bis zum 30. September diesen Jahres Zeit für die erstmalige Festsetzung ihrer Ziel-quote. Sie müssen nicht jährlich, son-dern jeweils erst nach Ablauf der selbst festgesetzten Frist über die Ein-haltung der Zielgrößen berichten. Diese Klarstellung reduziert den Bü-rokratieaufwand für Unternehmen erheblich.
Keine Parität nur um der Parität willen
Nachgebessert wurde in letzter Minu-te die Neufassung des Bundesgleich-stellungsgesetzes. Diesen Teil hatten Sachverständige in der Bundestagsan-hörung als verfassungswidrig kriti-siert. Denn statt gezielter Frauenför-derung auf allen Ebenen der Bundes-verwaltung sah der Gesetzentwurf eine schlichte zahlenmäßige Ge-schlechterparität vor. So sollten Män-
ner auch in Bereichen gefördert wer-den, in denen sie zahlenmäßig unter-repräsentiert sind - unabhängig davon, ob sie tatsächlich wegen ihres Geschlechts benachteiligt oder aus anderen Gründen in geringerer Zahl vertreten sind. Eine Geschlechterpari-tät nur um der Parität willen war mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aber nicht zu machen.
Darüber hinaus hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion Familienfreund-lichkeit als Gesetzesziel im Bundes-gleichstellungsgesetz verankern kön-nen. So muss zum Beispiel erfasst werden, wie sich der berufliche Auf-stieg von Frauen und Männern mit Fa-milien- oder Pflegeaufgaben im Ver-gleich zu den Beschäftigten ohne sol-che Aufgaben verhält. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass künftig mehr Leitungspositionen an teilzeit-arbeitende Mütter und Väter vergeben werden.
Schließlich wurde das Bundesgre-mienbesetzungsgesetz neu gefasst. Bis 2018 soll der Frauenanteil in Gre-mien im Einflussbereich des Bundes schrittweise auf 50 Prozent erhöht werden.
Foto
: pic
ture
alli
ance
/ d
pa

7 | Fraktion direkt 33 | 06. März 2015
Zwischen Tarifautonomie und Betriebsfrieden Bundestag berät erstmals über Gesetzentwurf zur Tarifeinheit
Die Fraktion im Plenum
Bei Streitigkeiten zwischen konkur-rierenden Gewerkschaften soll es künftig stärkere Anreize für eine friedliche Lösung geben. Einen ent-sprechenden Gesetzentwurf zur Ta-rifeinheit beriet der Bundestag am Donnerstag in erster Lesung. Mit der Neuregelung soll der althergebrachte Grundsatz „Ein Betrieb – ein Tarifver-trag“ wieder mehr zum Tragen kom-men.
Laut Verfassung ist die Tarifauto-nomie und das Recht von Arbeitneh-mern, Gewerkschaften zu bilden, ein hohes Rechtsgut. Auch Streiks zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-gen sind mit diesem Verfassungsarti-kel geschützt. Denn wenn eine Ge-werkschaft ihren Forderungen nicht mehr mit Streiks Nachdruck verlei-hen kann, stellt sich für sie die Exis-tenzfrage.
Auf der anderen Seite gibt es ein Prinzip, das zwar nicht gesetzlich fest-geschrieben, aber ebenfalls von ho-hem Wert ist: der Betriebsfrieden. Es hat dazu geführt, dass Deutschland bis heute eines der Länder ist, in de-nen am wenigsten gestreikt wird. Zwischen diesen beiden Prinzipien bewegt sich der Gesetzentwurf.
Sowohl die Tarifautonomie als auch der Betriebsfrieden sollen ge-stärkt werden. Verhindert werden soll
indes, dass sich die Tarifforderungen von Branchen- und Spartengewerk-schaften gegenseitig aufschaukeln. Denn ein solcher Wettbewerb könnte sich auf die Lohnpolitik in einem Be-trieb auswirken und bestimmten Be-rufsgruppen mehr Macht verschaffen.
Tarifvertrag der Mehrheits- gesellschaft soll gelten
Daher setzt der Gesetzentwurf auf die Verständigung der Gewerkschaften untereinander. Unangetastet bleibt das Recht der Gewerkschaften, ihre je-weiligen Zuständigkeiten gegenein-ander abzugrenzen. Dies können sie beispielsweise durch Bildung einer Tarifgemeinschaft oder durch Abspra-chen untereinander erreichen. Weiter schafft der Gesetzentwurf Möglich-keiten zur Konfliktlösung in Fällen, in denen Tarifverträge unterschiedlicher Gewerkschaften in Betrieben aufein-anderstoßen. Auf seiner Grundlage sollen Mehrheitsverhältnisse im Be-trieb geklärt werden. Nur der Tarifver-trag der Gewerkschaft, die im Betrieb die meiste Akzeptanz besitzt, soll dann zur Anwendung kommen.
Im Kern sieht der Entwurf daher vor, dass die Tarifeinheit nach dem Mehrheitsprinzip geregelt wird. Für den Fall, dass sich mehrere Tarifver-
träge zeitlich, räumlich und im Hin-blick auf die Beschäftigten über-schneiden, gilt nur der Tarifvertrag mit den meisten Mitgliedern im Be-trieb.
Im Einzelfall entscheiden weiterhin Arbeitsgerichte
Das Arbeitskampfrecht soll durch den vorliegenden Gesetzentwurf nicht be-einträchtigt werden. Über die Verhält-nismäßigkeit von Arbeitskämpfen, mit denen ein eigenständiger Tarif-vertrag erkämpft werden soll, der sich möglicherweise mit einem anderen überschneidet, sollen im Einzelfall weiterhin die Arbeitsgerichte ent-scheiden.
Diese Klärung der Mehrheitsver-hältnisse kann bei der Bahn zum Bei-spiel dazu führen, dass die konkurrie-renden Gewerkschaften EVG und GdL nicht mehr darüber streiten müssen, wer für wen verhandelt. Die Konflikte bei der Lufthansa allerdings werden damit nicht gelöst werden können, denn hier sind sich die konkurrieren-den Gewerkschaften einig. Diese Ver-ständigung kann die Koalition nicht antasten, denn das Grundgesetz ga-rantiert die Koalitionsfreiheit und da-mit das Streikrecht von Gewerkschaf-ten.
Foto
s: p
ictu
re a
llian
ce /
dpa

8 | Fraktion direkt 33 | 06. März 2015
Arbeitgeber beklagen „Misstrauen“ gegen UnternehmenDiskussion mit dem Parlamentskreis Mittelstand über Mindestlohn – Nachbesserung bei der Dokumentationspflicht gefordert
Die Fraktion in Aktion
Der gesetzliche Mindestlohn gilt seit dem 1. Januar. Mit ihm trat auch eine Dokumentationspflicht in Kraft. Ar-beitgeber sind nun gehalten, die Ar-beitszeiten aller Angestellten aufzu-zeichnen, deren Bruttoverdienst weni-ger als 2.958 Euro im Monat beträgt. Doch die Regelung belastet vor allem Arbeitgeber aus dem Mittelstand. Die Unionsfraktion fordert daher Nach-besserungen. Ihr Parlamentskreis Mit-telstand (PKM) beriet am Montag mit Arbeitnehmervertretern, welche Än-derungen besonders dringlich sind.
Die Kritik an der Durchführungs-verordnung macht sich vor allem an zwei Punkten fest: Zum einen bekla-gen die Unternehmen den enormen bürokratischen Aufwand, der mit der Dokumentationspflicht einhergeht. Zum anderen verlangen sie dringend eine Absenkung des Schwellenwer-tes, der mit knapp 3.000 Euro unver-hältnismäßig hoch angesetzt ist.
Der PKM-Vorsitzende Christian von Stetten nannte als realistische Obergrenze für die Aufzeichnungs-pflicht erneut einen Bruttoverdienst von 1.900 Euro. Bei geringfügig Be-schäftigten solle für die Befreiung ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausrei-chen, in dem Arbeitsstunden und Stundenlohn festgeschrieben sind.
Regelungsdichte gewaltig
Reinhard Göhner, Hauptgeschäfts-führer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und Mitglied der Mindestlohnkommissi-on, sprach von einer „materiellen und bürokratischen Belastung für mittel-ständische Arbeitgeber“. Mittlerweile sei die Regelungsdichte im Arbeits-recht so gewaltig, dass „wir alle mit ei-nem Vollzugsdefizit leben müssen“. Wo neue Bürokratie geschaffen wer-de, müsse alte im Gegenzug abgebaut werden, forderte er. Das Signal, das die Politik mit der Dokumentations-pflicht aussende, sei Misstrauen ge-genüber den Unternehmen.
Foto
: Ste
ven
Rösl
er
BDA-Hauptgeschäftsführer Göhner mit Unionspolitikern auf dem Podium
Die Wirtschaft stehe unter „General-verdacht“, den Mindestlohn nicht zu zahlen, meinten auch viele andere Redner. „Die Gesetzgebung treibt Un-ternehmen in die Illegalität“, sagte etwa Albert Ritter, Präsident des deut-schen Schaustellerbundes. Den von der Unionsfraktion vorgeschlagenen Schwellenwert von 1.900 Euro be-grüßten die Arbeitgeber durchge-hend. Ingrid Hartges, Geschäftsführe-rin des deutschen Hotel- und Gast-stättenverbands, empfahl sogar eine Absenkung auf 1.754 Euro.
Arbeitszeitgrenze praxisfern
Die Verordnung bringt in der Praxis weitere Probleme mit sich. Als praxis-fern wurde beispielsweise die Ar-beitszeitgrenze von zehn Stunden ge-nannt, die etwa für die Schausteller-branche und die Landwirtschaft wegen der saisonalen Schwankungen nicht akzeptiert werden könne.
Auch Stefan Genth, Hauptge-schäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), forderte eine „Flexibilisierung“ der Höchstarbeits-
zeit. Dies gelte gerade für den Einzel-handel, in dem 80 Prozent der Unter-nehmen weniger als zehn Mitarbeiter haben. Karsten Schulze, Leiter eines mittelständischen Berliner Busunter-nehmens, bemängelte, dass Lohnbe-standteile wie Provisionen nicht in den Arbeitslohn eingerechnet wür-den. So fielen deutlich mehr Arbeit-nehmer unter den Schwellenwert.
Die stellvertretende CDU-Bundes-vorsitzende Julia Klöckner bekräftig-te, dass der Mindestlohn als solcher nicht mehr hinterfragt werde. Die Art der Umsetzung sei allerdings proble-matisch. Sie bat darum, Praxiserfah-rungen mit den Auswirkungen des Mindestlohns zu sammeln und in die Überprüfung der Durchführungsver-ordnung einfließen zu lassen. Nur wenn es Erleichterungen für die Un-ternehmen gebe, könnten Arbeits-plätze erhalten werden. Der arbeits-marktpolitische Sprecher der Frakti-on, Karl Schiewerling, bot an, mit den Branchen im Gespräch zu bleiben. Gleichzeitig dämpfte er die Erwartun-gen: Am Ende werde ein Kompromiss stehen.

9 | Fraktion direkt 33 | 06. März 2015
Die CDU/CSU-Fraktion im Internet www.cducsu.deDer Blog der CDU/CSU-Fraktion blogfraktion.deFraktion direkt www.cducsu.de/fd
www.facebook.com/ cducsubundestagsfraktion
twitter.com/ cducsubt
www.youtube.com/cducsu
Letzte Seite
Fraktion direkt bestellen
Unser Newsletter „Fraktion direkt“ erscheint in den Sitzungswochen des Deutschen Bundestages. Wenn Sie ihn künftig regelmäßig lesen wollen, können Sie ihn unter www.cducsu.de/newsletter abonnieren.
Termine www.cducsu.de/veranstaltungen
11. März 2015 Gesundheitstag der CDU/CSU-Fraktion16. März 2015 Fachgespräch Radikalisierung junger Männer und Frauen im Dschihad18. März 2015 Fachgespräch Ziviler Einsatz von Drohnen in der Entwicklungszusammenarbeit23. März 2015 Kongress Inklusion von Behinderten in Arbeit und Gesellschaft 25. März 2015 Kongress zur Zukunft des Automobils16./17. April 2015 Tagung der GfV von CDU/CSU- und SPD-Fraktion in Göttingen
Betriebliche Altersvorsorge beliebtGleich hinter der „Riester-Rente“
Zeic
hnun
g: T
omic
ek
Beschäftigte in Deutschland haben im Jahr 2012 durchschnittlich 362 Euro in ihre betriebliche Altersvorsorge in-vestiert. Wie das Statistische Bundes-amt mitteilte, waren das 0,9 Prozent der Bruttojahresverdienste. Hochge-rechnet auf alle Beschäftigten in Deutschland entsprach das einem Ge-samtvolumen von 9,5 Milliarden Euro.
Die Summe lag damit knapp unter den Investitionen in die „Riester-Ren-te“. Nach vorläufigen Angaben der Zentralen Zulagenstelle für Altersver-mögen (ZFA) betrugen die Gesamtbei-träge für geförderte „Riester-Verträge“ für das Beitragsjahr 2012 rund 10,1 Milliarden Euro. Sie setzten sich aus Eigenbeiträgen von 7,3 Milliarden Euro und staatlichen Zulagen von 2,8 Milliarden Euro für die Zulagenbe-rechtigten zusammen.
Beschäftigte in Branchen mit ho-hem Verdienstniveau investierten laut Statistischem Bundesamt im Durchschnitt mehr in die betriebliche Altersvorsorge als Beschäftigte in Niedriglohnbranchen. Am höchsten fiel der Umwandlungsbetrag in den Finanz- und Versicherungsdienstleis-tungen aus. Hier investierten Be-schäftigte durchschnittlich 1.115 Euro. Dies entsprach einem Anteil von 1,8 Prozent am Bruttojahresver-dienst. Die niedrigsten Umwand-lungsbeträge wurden in der Leihar-beitsbranche mit 36 Euro oder 0,2 Prozent des Bruttojahresverdienstes ermittelt, gefolgt von der Gastrono-mie mit 59 Euro oder 0,3 Prozent des Bruttojahresverdienstes.
Die Betriebsgröße des Arbeitge-bers, gemessen an der Anzahl der Be-schäftigten, war im Gegensatz zum
Wirtschaftszweig für die Entschei-dung der Beschäftigten zur Entgelt-umwandlung beziehungsweise Betei-ligung an der betrieblichen Altersver-sorgung nicht relevant. In allen betrachteten Unternehmensgrößen-klassen betrug der Anteil der umge-wandelten Verdienste zwischen 0,8 Prozent und 0,9 Prozent.
Das meiste Entgelt wurde in Direkt-versicherungen (3,25 Milliarden Euro) investiert. Dahinter folgten Pensions-kassen (2,25 Milliarden Euro), Zusatz-versorgungseinrichtungen (1,75 Milli-arden Euro), Direktzusagen (1,25 Milli-
arden Euro) und Unterstützungskassen (0,75 Milliarden Euro). In Pensions-fonds (0,25 Milliarden Euro) wurde vergleichsweise wenig Arbeitslohn eingebracht.
Bei der Entgeltumwandlung bezie-hungsweise Arbeitnehmerbeteiligung an der betrieblichen Altersversorgung verzichten Arbeitnehmer auf einen Teil ihres künftigen Verdienstes. Im Gegenzug erhalten sie vom Arbeitge-ber eine Zusage auf eine im Rentenal-ter auszuzahlende Betriebsrente be-ziehungsweise ergänzen diese um ei-nen Eigenanteil.