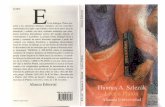»Gedanken ohne Inhalt sind leer«
Transcript of »Gedanken ohne Inhalt sind leer«
„Gedanken ohne Inhalt sind leer“ 135
„Gedanken ohne Inhalt sind leer“
von Mario Caimi, Buenos Aires
Absicht dieser Arbeit ist, den seltsamen Satz Kants zu erklären: „Gedanken ohneInhalt sind leer“1. Der Satz ist wohlbekannt; er findet sich in der Einleitung zurTranszendentalen Logik, und macht dort einen Teil eines längeren Satzes aus, dessenzweiter Halbsatz besagt: „Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“2 Es ist abernicht unser Vorhaben, den Sinn des Satzes, sondern nur seine merkwürdige Form zuerklären. Er gehört in einen Zusammenhang, in dem die gegenseitige Bedingtheitvon Sinnlichkeit und Verstand (und somit die gegenseitige Bedingtheit von An-schauungen und Begriffen) hervorgehoben wird:
Keine dieser Eigenschaften ist der andern vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Ge-genstand gegeben und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer,Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Daher ist es eben so nothwendig, seine Begriffe sinn-lich zu machen (d. i. ihnen den Gegenstand in der Anschauung beizufügen), als seine Anschau-ungen sich verständlich zu machen (d. i. sie unter Begriffe zu bringen). Beide Vermögen oderFähigkeiten können auch ihre Functionen nicht vertauschen. Der Verstand vermag nichts an-zuschauen und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, daß sie sich vereinigen, kann Er|kennt-niß entspringen.3
Diese gegenseitige Abhängigkeit wird dann in der Transzendentalen Analytik dar-gestellt. An der Stelle, die hier betrachtet wird, wird sie einzig als eine Vorausset-zung aufgeführt, die der weiteren Erklärung bedarf. Was uns jetzt aber interessiert,ist nicht das Verhältnis von gegenseitiger Bedingtheit zwischen Anschauungen undBegriffen4 bzw. zwischen Sinnlichkeit und Verstand; unsere Ansprüche sind beschei-dener: Wir möchten nur die merkwürdige rhetorische Struktur des ersten Halbsat-zes betrachten.
In der Tat stellt sich dieser Halbsatz als eine rhetorische Parallele, nur leider alseine misslungene. Wollte man der gegenseitigen Abhängigkeit von Gedanken undAnschauungen bzw. von Verstand und Sinnlichkeit Ausdruck geben, so hätte man
1 A 51 / B 75.2 Zum zweiten Teil des Diktums siehe Erich Rothacker: Anschauungen ohne Begriffe sind
blind. In: Kant-Studien 48, 1956–1957, 161–184, sowie Bernd Dörflinger: Das Leben theo-retischer Vernunft. Teleologische und praktische Aspekte der Erfahrungstheorie Kants. Ber-lin/New York 2000, 147ff.
3 A 51 / B 75f.4 Neulich hat Norbert Hinske eine Interpretation des kantischen Satzes veröffentlicht: Ohne
Fußnoten. Prämissen und Folgerungen. Würzburg 2000, 52. (Für entscheidende Hinweisebezüglich vorliegender Arbeit möchte ich Herrn Professor Hinske an dieser Stelle danken.)
Kant-Studien 96. Jahrg., S. 135–146© Walter de Gruyter 2005ISSN 0022-8877
Brought to you by | University of Washington LibrariesAuthenticated
Download Date | 11/29/14 7:53 PM
136 Mario Caimi
genauer schreiben sollen: „Begriffe ohne Anschauungen sind leer“,5 damit der ersteHalbsatz dem zweiten genau entspricht: „Anschauungen ohne Begriffe sind blind“.Nehmen wir die Gleichwertigkeit von „Begriff“ und „Gedanke“ an, so bleibt dieParallele gleichwohl unvollständig, denn es heißt immer noch „Gedanken ohne In-halt“ und nicht „Gedanken ohne Anschauungen“, wie es des Parallelismus wegensein sollte.
Was aber noch bedenklicher ist: der Satz bildet nicht nur eine unvollkommene Pa-rallele, er drückt auch eine triviale Tautologie aus. Denn es ist doch selbstverständ-lich, dass etwas, das einen Inhalt haben sollte, aber keinen hat, eben leer ist. Dasmuss nicht gesagt werden. Wir wissen, dass der Inhalt, den Kant hier meint, die An-schauungen sind; dies veranlasst uns zur Annahme, dass er möglicherweise schreibenwollte: „Gedanken ohne Anschauungen sind leer.“ Eben das hat er aber nicht ge-schrieben. Er hat stattdessen vielmehr jenen Satz von verwunderlicher Trivialität ge-bildet. Allzuleicht wäre es, den Wortlaut des Satzes auf Unachtsamkeit des Verfasserszurückzuführen. Diese Lösung unseres Problems liegt auf der Hand, umsomehr alsder Kontext uns fast unumgänglich zur sich anbietenden Ersetzung von „Inhalt“durch „Anschauung“ führt. Auf diese Weise könnten wir die rhetorische Vollkom-menheit wiederherstellen, ohne dem Sinn Abbruch zu tun. Wir möchten jedoch die-ser einfachen Lösung widerstehen. Wir möchten sie zumindest hinauszögern, bis wirdas Problem näher geprüft haben. Vielleicht wollte Kant uns durch diesen trivialenSatz inmitten einer unvollständigen Parallele doch etwas sagen. Dieser Prüfung we-gen wollen wir also zunächst untersuchen, was hier unter „Leere“ verstanden wirdund unter welchen Bedingungen ein Gedanke als leer betrachtet werden kann.
Auf der Argumentationsstufe, auf der der uns beschäftigende Satz vorkommt,wurde der Unterschied von allgemeiner (formaler) und transzendentaler Logik nochnicht festgestellt. Unsere These ist: dass der Satzbau, eben durch das, was dem Satzden Schein einer Tautologie verleiht, die Vorstellung der transzendentalen Logikvorbereitet, ja noch mehr: dass er zur Aufstellung der transzendentalen Logik selbstführt.
1. Die leeren Begriffe in der transzendentalen Logik
Im Unterschied zur formalen Logik eignet sich die transzendentale Logik nichtdazu, dass ihre Begriffe leer sind. Sie ist eine Logik, „in der man nicht von allem In-halt der Erkenntniß abstrahirte“6; es ist aber möglich, dass die Begriffe der trans-zendentalen Logik des Inhalts entbehren.
Hier sind die Begriffe leer, wenn ihnen keine entsprechende Anschauung gegebenwerden kann. Sie sind alsdann „Gedanke[n] der Form nach, aber ohne allen Gegen-
5 So schreibt Vaihinger den Satz in: Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Aalen1970 (1881), I. Band, 54.
6 B 80.
Brought to you by | University of Washington LibrariesAuthenticated
Download Date | 11/29/14 7:53 PM
„Gedanken ohne Inhalt sind leer“ 137
stand“7. Das dürfte aber auf zweierlei Weise verstanden werden: a) der Begriff hörtauf, leer zu sein, wenn ihm eine reine Anschauung als Inhalt zukommt. Somit hatder Begriff eigentlich noch keinen Gegenstand, er hat aber schon einen Inhalt. Die-ser Inhalt ist bloß formal, so dass die Begriffe, die solchen Inhalt aufweisen, nochkeine Erkenntnisse ausmachen. Das bedeutet also: auch bei dem Gedanken, der sicha priori auf Gegenstände bezieht (bei dem Gedanken also, der das Thema der trans-zendentalen Logik ausmacht) finden wir die Möglichkeit der Leere; die Leere be-steht hier in dem Mangel einer dem Begriff entsprechenden Anschauung.
b) Die Leere eines Begriffes kann aber auf eine zweite Weise aufgefasst werden:Wenn wir nämlich nicht bloß auf irgendeinen anschaulichen Inhalt im Allgemeinen,sondern auf die in der sinnlichen Anschauung gegebene Existenz achten. Dement-sprechend sind die Begriffe leer, wenn sie keinen wirklichen Gegenstand zum Inhalthaben. Es reicht hier nicht, wenn eine Anschauung dem Begriffe entspricht. Etwasmehr wird benötigt, nämlich die empirische, durch Empfindung bestätigte Wirk-lichkeit. Das Nicht-leer ist jetzt das Nicht-bloß-Formale. Der Inhalt aber, der Stoff,kann nur durch Empfindung gegeben werden. Also erst als Bedingungen der in ihrerWirklichkeit durch Empfindung bestätigten Gegenstände dürfen die Kategorien als„nicht-leere Begriffe“ bezeichnet werden.
Nicht nur die bloße reine Anschauung kann also einen Inhalt zum Begriff abge-ben. Es wäre ein Fehler gewesen, wenn wir die Parallele im Text von A 51 / B 75durch die Einführung der reinen Anschauung hätten wiederherstellen wollen. Dennwir finden jetzt etwas, das die Funktion eines Inhalts besser und genauer erfüllt,nämlich die empirische Anschauung, die den Stoff (Empfindung) mit sich führt.
An einer nachfolgenden Stelle in der Kritik der reinen Vernunft erklärt Kant imRückblick auf die Transzendentale Deduktion sein Verständnis vom „leeren Be-griff“:
Ein Begriff, der eine Synthesis in sich faßt, ist für leer zu halten und bezieht sich auf keinen Ge-genstand, wenn diese Synthesis nicht zur Erfahrung gehört, entweder als von ihr erborgt […]oder als eine solche, auf der als Bedingung a priori Erfahrung überhaupt (die Form derselben)beruht.8
Hier stellt sich nun in ihrer vollständigen Bedeutung die Frage: Warum hatKant nicht: „Gedanken ohne reine bzw. ohne empirische Anschauungen sind leer“geschrieben? Handelte es sich bloß um einen Fall der Unachtsamkeit, als er stattdes-sen den tautologischen Ausdruck schrieb, der besagt: „Gedanken ohne Inhaltsind leer“? Oder wollte er uns vielleicht durch diesen merkwürdigen Satzbau etwassagen?
7 B 146; s.a. B 148.8 A 220 = B 267.
Brought to you by | University of Washington LibrariesAuthenticated
Download Date | 11/29/14 7:53 PM
138 Mario Caimi
2. Die allgemeine Logik und ihre leeren Begriffe
In der transzendentalen Logik ist die Zusammenarbeit von Anschauungen undBegriffen unentbehrlich; denn nur so erhalten die Begriffe dieser Logik einen Inhaltund somit erlangen sie Geltung als Erkenntnis. Das Leersein wäre bei diesen Begrif-fen der Transzendentalen Logik ein Mangel. Bei der formalen Logik dagegen ist eskein Mangel, wenn sie von jedem Inhalt abstrahiert. Das ist vielmehr das Eigentüm-liche der formalen Logik;9 hörte sie auf, vom Inhalt der Erkenntnis zu abstrahieren,so würde sie sogleich aufhören, formale Logik zu sein. Nur wenn man gegen jedeLegitimität die formale Logik als organon, als Werkzeug zur Erkenntnis benutzenmöchte, nur dann müsste man ihr einen Erkenntnisinhalt beigeben. Das aber, wiegesagt, wäre der Legitimität im Gebrauch der Logik zuwider.
Der Inhalt eines Gedankens lässt sich vom Inhalt einer Erkenntnis unterscheiden.Dementsprechend schreibt Kant in der Jäsche-Logik-Vorlesung den Begriffen einenInhalt und eine Materie zu. Inhalt eines Begriffes (als bloßen Gedankens) sinddie Merkmale, oder Teilbegriffe, die ihn als eben solchen Begriff ausmachen. Die-ser Inhalt stellt sich als „Teilbegriff“ in der Vorstellung eines Gegenstandes vor.10
Ein Begriff hat dagegen eine Materie, indem er sich auf einen Gegenstand bezieht:„Die Materie der Begriffe ist der Gegenstand, die Form derselben die Allgemein-heit.“11
Die allgemeine Logik abstrahiert sowohl vom Inhalt der Begriffe, als auch von derMaterie derselben. Sie achtet nur auf die Allgemeinheit der Begriffe, d.h. auf ihreForm,12 durch die sie zur Verbindung miteinander in Urteilen bzw. in Vernunft-schlüssen geeignet sind. In diesem Sinne sagen wir, dass die allgemeine Logik leerist. Es wäre jedoch ein Fehler, wenn wir annähmen, dass diese Leerheit der formalenLogik für Kant auf der Hand liegt und dass sie als eine selbstverständliche Voraus-setzung angenommen werden darf. Kants formale Logik ist das Ergebnis einer Um-gestaltung der überlieferten Logik seiner Zeit.13 „It must be kept in mind that ourtime’s view of logic, as formal logic, […] was completely foreign to philosophy untilthe beginning of the nineteenth century. […] logic was never dissociated from themethodological consideration of the substance of thought, that is, from subjects
9 Vgl. A 55 = B 79.10 Vgl. Log, AA 09: 95; s.a. Herbert James Paton: Kant’s Metaphysic of Experience. A Com-
mentary on the First Half of the Critique of Pure Reason. London [1936] 1970, Bd. I, 193,Anm.
11 Log, AA 09: 91.12 Vgl. Log, AA 09: 13; s.a. Béatrice Longuenesse: The Divisions of the Transcendental Logic
and the Leading Thread (A 50 / B 74–A 83 / B109; B 109–116). In: Immanuel Kant. Kritikder reinen Vernunft. Hrsg. von Georg Mohr und Marcus Willaschek. Berlin 1998, 131–158,hier 134f.
13 María Jesús Vázquez Lobeiras: Entwicklungsgeschichtliche Betrachtung des Verhältnisseszwischen formaler und transzendentaler Logik im Denken Kants. In: Proceedings of theEighth International Kant Congress Memphis 1995. Hrsg. von Hoke Robinson. Vol. II,245–255, hier 249.
Brought to you by | University of Washington LibrariesAuthenticated
Download Date | 11/29/14 7:53 PM
„Gedanken ohne Inhalt sind leer“ 139
which we assign today to the theory of knowledge, and from others as well.“14 Selbstinnerhalb von Kants Denken findet De Vleeschauwer einen Widerspruch zwischeneiner „puristischen“ Auffassung der Logik (als rein formale Lehre, auf das Studiumder Regel vom richtigen Denken beschränkt) und dem kantischen Gebrauch bei demLogikunterricht, durch den die psychologischen und erkenntniswissenschaftlichenZusätze in die Logik wieder eingeführt werden, die die Theorie von ihr ausschließt.15
Schon die Tatsache, dass Kant gerade das Handbuch von Meier als Vorlage für seineVorlesungen genommen hat, macht diesen Widerspruch unvermeidlich.16
Weder die Logik von Port Royal17 noch die Logiken leibnizianischer Abstam-mung fassten die formale Logik (die „Kunst des Denkens“) als leer auf. Bei der Lo-gik von Port Royal ist das eine Folge der Bemühungen, Ergebnisse der CartesischenPhilosophie in die Logik einzuführen. Gewiss hat sich Descartes eher mit der Theo-rie der Erkenntnis und mit der Metaphysik als mit der Logik beschäftigt. Die Bemü-hungen aber, die Logik auf den Stand dieser neuen Philosophie zu bringen, führtendazu, die Logik als eine Sammlung von heterogenen Bestandteilen zu verstehen, indenen sich die neuen wissenschaftlichen Entdeckungen widerspiegelten. „Die Logikdieser Periode zeichnet sich durch ihre Abhängigkeit von der Neubegründung derPhilosophie durch Descartes aus. Sie beschäftigt sich mit der Theorie der Erkenntnissowie mit der Methode, und zeigt einen betonten Psychologismus.“18 Gerade Kantist es, der (zusammen mit Geulincx) die Aufgabe übernimmt, die Logik von dieseninhaltlichen Zusätzen zu befreien, die wir heute in die Psychologie der Erkenntnisbzw. in die allgemeine Theorie der Wissenschaften einordnen.19
14 Giorgio Tonelli: Kant’s Critique of Pure Reason Within the Tradition of Modern Logic.Ursprgl. in: Akten des 4. Internationalen Kant-Kongresses Mainz 6–10 April 1974. Hrsg. vonGerhard Funke. Berlin 1975, vol. III, 186–191; jetzt in: Kant’s Critique of Pure Reason Withinthe Tradition of Modern Logic, a Commentary on its History. Edited from the UnpublishedWorks of Giorgio Tonelli by David H. Chandler. Hildesheim, Olms 1994, 1–10, hier 2 und 3.
15 Herman J. de Vleeschauwer: Logica genuina ou le Purisme logique. Kant et Geulincx. In:Kritik und Metaphysik. Studien. Heinz Heimsoeth zum achtzigsten Geburtstag. Hrsg. vonFr. Kaulbach und J. Ritter. Berlin 1966, 159–173, hier 161, s.a. 173.
16 In seiner „Vorrede“ zu Kants Logik (AA 09: 3) berichtet G. B. Jäsche, dass „[s]eit dem Jahre1765 […] Herr Prof. Kant seinen Vorlesungen über die Logik ununterbrochen das Mei-er’sche Lehrbuch (George Friedrich Meiers Auszug aus der Vernunftlehre, Halle bei Ge-bauer 1752) als Leitfaden zum Grunde gelegt“ habe. Die Gründe, die Kant zu dieser Wahlbewegt haben, erklärt er selbst in der Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen indem Winterhalbenjahre von 1765–1766. AA 02: 310f.
17 L’Art de penser. Deuxième discours. Erstausgabe 1662. Wir zitieren nach der Ausgabe Paris,1683, 20–22, hrsg. von Bruno Baron von Freytag Löringhoff et Herbert E. Brekle. Stuttgart1967, Band II, 42–44. Angeführt bei de Vleeschauwer, a.a.O. 162.
18 María Jesús Vázquez Lobeiras: „Estudio preliminar“ zu ihrer Übersetzung der Logik Jäsche.In: Immanuel Kant: Lógica. Un manual de lecciones. (Edición original de G. B. Jäsche.) Edi-ción y traducción de María Jesús Vázquez Lobeiras. Madrid 2000, 35–36.
19 Solche Inhalte schließen eine „allgemeine Lehre von der Vernunft“ aus (noch in der Einleitungder Logik Jäsche zu finden). Darüber Norbert Hinske: „Nicht nur die reine Vernunft, auch die„allgemeine menschliche Vernunft“, wie Kant zu sagen pflegte, braucht eine eigene Lehre. Ge-rade diese Lehre der allgemeinen menschlichen Vernunft, die Kant sonst in seinen veröffent-
Brought to you by | University of Washington LibrariesAuthenticated
Download Date | 11/29/14 7:53 PM
140 Mario Caimi
1662 veröffentlichte Geulincx die Logica suis fundamentis quibus hactenus col-lapsa fuerat restituta (Leyden 1662). Seine Absicht war, die Logik zu bereinigen undsie auf ihre eigentlichen, d.h. auf ihre formalen Gründe zurückzuführen. Die logicagenuina muss laut Geulincx von jedem außerlogischen Zusatz frei sein.20 Selbst dieBeschreibung des menschlichen Denkens muss ausgeschlossen sein, denn sie ist Auf-gabe der Psychologie. Das Geschäft der Logik ist normativ: Sie soll die Regeln desrichtigen Denkens aufstellen. Völlig parallel zu diesem Programm von Geulincx, dieLogik in ihrer Reinheit wiederherzustellen, ist das Vorhaben Kants, nämlich die Wie-derherstellung des logischen Purismus.21 Deswegen erklärt Kant die Logik als die Wis-senschaft der formalen Regeln des Denkens. Aber ebensowenig wie Geulincx bleibtKant diesem Programm treu. In seiner Logik (Jäsche) schließt er weitläufige Ausfüh-rungen über die Methodologie der Wissenschaften ein.22 Wir dürfen also behaupten,dass Kants Aussagen über die Leerheit der formalen Logik nicht als selbstverständlichgelten dürfen. Sie geben vielmehr einem Programm Ausdruck, das sich die Reformdes zu seiner Zeit geltenden Verständnisses der Logik vornimmt. Man muss zunächsteinmal beweisen, dass die Begriffe der formalen Logik leer sind: dass sie als organonzur Erkenntnis nicht taugen. Um dies richtig zu bewerten, ist es ratsam, das Verständ-nis vom leeren Begriff in der Kritik der reinen Vernunft zu untersuchen.
3. Leere Gedanken in der „Kritik der reinen Vernunft“
Kant sagt uns, dass jener Begriff ein leerer Begriff ist, der keinen Inhalt hat. Under stellt dies als eine Neuigkeit dar, auch wenn es uns auch wie eine Tautologie vor-kommt. Damit wir das Neue daran wahrnehmen, müssen wir den Horizont Kantserforschen, um zu sehen, ob es dort eine weitere Weise gibt, wie ein Begriff leer seinkann, außer der, dass der leere Begriff keinen Inhalt hat. Nur so kann die Aussage„Begriffe ohne Inhalt sind leer“ dem Tadel einer Tautologie entgehen.
lichten Schriften meistens vernachlässigt, wurde mit der Zeit zum Hauptthema seiner Logik-vorlesung. Somit rivalisieren bei Kant zwei unterschiedliche Logikauffassungen.“ NorbertHinske: Prefacio. In: Immanuel Kant: Lógica. Un manual de lecciones, s. Anm. 18; hier 10.
20 Geulincx: Logica restituta. In: Opera philosophica. Ed. Land, Band I, 170–173, angeführtbei de Vleeschauwer, a.a.O., 167.
21 de Vleeschauwer, a.a.O., 172f.22 Tonelli findet, dass Kant in Logik Herder (1762–1764), AA 24: 3, die Logik als ein organon
oder Werkzeug zur Erkenntnis betrachtet. Im angeführten Text lässt sich das nicht deutlich er-kennen. Viel deutlicher steht derselbe Gedanke der Logik als organon in Logik Blomberg(1771), AA 24: 20, und in Logik Philippi (1772), AA 24: 314 (alles nach Tonelli, a.a.O., 37,42, 43). Aber die Behauptung, dass die allgemeine Logik kein organon ist und keins werdenkann, findet sich gleichermaßen in den Reflexionen 1601–1608, von 1773–1775 (AA 16:31–34) sowie in den Vorlesungen über Philosophische Enzyklopädie (1777–1780), AA 29: 13und 32, (alles nach Tonelli, a.a.O. 47, 51–52).Vorsicht ist aber bei der Deutung dieser Stellengeboten, denn „in a period close to that of the Critique of Pure Reason, the term organon isnot explicitly and exclusively referred to extendig knowledge, and its positive function seemsat least on some occasions to coincide with that of canon“. (Tonelli, a.a.O., 82–83.)
Brought to you by | University of Washington LibrariesAuthenticated
Download Date | 11/29/14 7:53 PM
„Gedanken ohne Inhalt sind leer“ 141
In der Kritik der reinen Vernunft finden wir vier Arten des leeren Begriffes bzw.vier Weisen, wie ein Begriff leer sein kann:
1. Ein Begriff ist leer, wenn er sich auf ein Noumenon bezieht: auf etwas, das nichtbloß nicht gegeben ist, sondern auch nicht gegeben sein kann in der Anschau-ung. Ein solcher Begriff entbehrt des Gegenstandes im eigentlichen Sinne.
2. Ein Begriff ist leer, wenn er sich auf eine fehlende Empfindung, d. i. auf etwasbezieht, das nicht in der empirischen Anschauung gegeben werden kann, weil esin einem Mangel besteht. Das ist der Fall bei den Begriffen von Dunkelheit oderKälte (Mangel an Empfindung, Grad Null der Realität.23).
3. Ein Begriff ist leer, wenn er sich auf die bloße Form der Anschauung bezieht,diese Anschauung dabei aber keinen Inhalt der Empfindung aufzeigen kann.Das ist der Begriff von einem Wesen der Einbildung, wie etwa die Gegenständeder Geometrie („Folglich sind alle mathematischen Begriffe für sich nicht Er-kenntnisse.“24).
4. Ein Begriff ist leer, wenn er an sich unmöglich ist und sich auf keinen Gegen-stand beziehen kann. Hier gibt Kant das Beispiel der flachen Figur, die zwischenzwei Geraden eingeschlossen wird.25
Von diesen vier Weisen, wie ein Begriff leer sein kann, können wir zwei (2. und 3.)außer Acht lassen: Die Begriffe des Mangels und die mathematischen Begriffe sindzwar leer bezüglich der Erkenntnis von etwas, sie sind aber nicht leer in dem Sinne,dass es zu ihnen eine entsprechende Anschauung gibt, wenn diese Anschauung auchselbst bloß formal (leer) ist.
Wir wollen uns aber jetzt auf die zwei übrigen Fälle, 1. und 4., konzentrieren.Hier liegt der Schlüssel zum Verständnis der scheinbaren Tautologie von A 51 / B 75.Ich möchte behaupten, dass Kant mit diesem scheinbar tautologischen Satz eine um-stürzende Neuigkeit in die Logik seiner Zeit einführt.
Zunächst möchte ich die vierte Art betrachten, wie ein Begriff leer sein kann: EinBegriff ist leer, wenn er an sich unmöglich ist (etwa einen Widerspruch einschließt)und sich auf keinen Gegenstand beziehen kann. Kant führt ein Beispiel an, das sichals recht problematisch aufweist: der Begriff vom Bilineum rectilineum, der flachenFigur, die zwischen zwei Geraden eingeschlossen wird (A 291 / B 348). Dieses Bei-spiel ist eigentlich nicht ganz geeignet, denn der Begriff vom Bilineum rectilineumschließt keinen Widerspruch ein. Erst die Konstruktion in der Anschauung erweistsich als unmöglich. Aber Kant hat hier dieses Beispiel angeführt, weil Wolff ebendasselbe Beispiel anführte, als er einen unmöglichen Begriff anhand eines Beispielesvorstellen wollte.26 Es steht aber außer Zweifel, dass Kant hier das bilineum rectili-
23 Vgl. A 167 / B 209.24 B 147.25 Vgl. A 291 / B 348.26 S. Christian Wolff: Philosophia rationalis sive Logica, methodo scientifica pertractata et ad
usum scientiarum atque vitae aptata. Frankfurt u. Leipzig 1740 (Repr. Hildesheim 1983),§ 629, 459: „Notionem bilinei rectilinei nonnisi deceptricem habemus.“
Brought to you by | University of Washington LibrariesAuthenticated
Download Date | 11/29/14 7:53 PM
142 Mario Caimi
neum als Beispiel für einen Begriff anführt, „der sich selbst widerspricht […] wieetwa die geradlinige Figur von zwei Seiten (nihil negativum)“.27
Die Tatsache, dass Kant gerade dieses ungeeignete Beispiel ausgewählt hat, lässtuns erkennen, wer der Gesprächspartner Kants in diesem Passus ist. Denn ChristianWolff führt eben das bilineum rectilineum als Beispiel für diejenigen Begriffe an, dieer als notiones impossibiles bezeichnet. Diese Begriffe heißen deswegen unmöglicheNotionen, weil sie einen Widerspruch in sich einschließen. Wir dürfen also anneh-men, dass diese vierte Weise, wie ein Begriff leer sein kann, dem Verständnis vomleeren Begriff durch die wolffsche Schule entspricht.
4. Der leere Begriff nach Leibniz, Wolff und deren Schule
Für die Logiker der leibniz-wolffschen Schule galt nur die vierte Weise, wieein Begriff leer sein kann. Ein Begriff konnte dementsprechend nur dann leer sein,wenn er einen Widerspruch einschloss. Das aber heißt: die Logik leibnizschen Ur-sprungs hatte kein Verständnis für Begriffe ohne Inhalt. Begriffe sind ohne Weiteresder Erkenntnis fähig. Die Erkenntnis erfolgte somit durch Begriffe. Wahrheit oderFalschheit eines Begriffes stehen unter bloß logischen Bedingungen: eine Idee istwahr, „wenn der Begriff möglich ist; sie ist falsch, wenn sie einen Widerspruch ein-schließt“.28 Einfache Ideen werden intuitiv erkannt; zusammengesetzte Ideen sindreal (d.h. sie sind keine leere Chimären), insofern sie keinen Widerspruch ein-schließen. Die einzige Bedingung für die Realität eines Begriffes ist, nach Leibniz, dieKompossibilität seiner einfachen Bestandteile.29 Chimären (leere Begriffe) werdennach Leibniz mittels der Zergliederung des Begriffes als solche anerkannt.30 Kanndiese Zergliederung durchgeführt werden, ohne dass ein Widerspruch im Innerendes Begriffes aufgefunden wird, so ist dieser Begriff wahr.31 Ist die Zusammenstel-
27 A 291 / B 348. S. dagegen A 221 und den Kommentar von Alberto Rosales: Sein und Sub-jektivität bei Kant. Zum subjektiven Ursprung der Kategorien. Berlin / New York 2000,259.
28 „Patet etiam, quae tandem sit Idea vera, quae falsa, vera scilicet cum notio est possibilis,falsa cum contradictionem involvit.“ Leibniz: Meditationes de cognitione, veritate et ideis.Ed. Gerhardt: G. W. Leibniz: Die philosophischen Schriften. Bd. IV, 425.
29 Leibniz: Nouveaux Essais sur l’entendement humain. Livre II, chapitre XXX: „[…] etl’esprit ne sauroit s’y tromper, pourveu qu’il ne joigne point des idées incompatibles.“ Ed.Gerhardt V, 245.
30 „Le meilleur moyen de prouver qu’une notion est possible, c’est-à-dire non contradictoire,est de l’analyser complètement.“ Louis Couturat: La Logique de Leibniz d’après des docu-ments inédits. [Paris 1901.] Hildesheim 1969, 194.
31 S. Brief an Arnauld vom 4/14 Juli 1686: „Et comme nous pensons souvent sans idées […] etque nous nous formons des chimères impossibles, je tiens que la marque d’une idée véritableest qu’on en puisse prouver la possibilité.“ Leibniz: Discours de métaphysique et correspon-dance avec Arnauld. Introduction, texte et commentaire par Georges Le Roy. Paris, 31970,128. Alle einfache Ideen sind miteinander kompatibel. Leibniz: Quod ens perfectissimumexistit. Ed. Gerhardt VII, 261. Angeführt bei Couturat, a.a.O., 194.
Brought to you by | University of Washington LibrariesAuthenticated
Download Date | 11/29/14 7:53 PM
„Gedanken ohne Inhalt sind leer“ 143
lung der Elementarbegriffe richtig, dann schließt der Begriff eine adäquate Erklä-rung der Sache ein. Unter einer solchen Definition versteht man diejenige, welchedie Möglichkeit des Definierten zeigt, „de sorte qu’un concept adéquat est nécessai-rement vrai“32. Dagegen wäre ein Begriff, der in sich selbst leer ist (ein Begriff, dersich auf keinen Inhalt, weder real, noch möglich, bezieht),33 für Leibniz etwas Un-vorstellbares.34 Man hätte in diesem Fall keinen Begriff, sondern nur ein Wort. Wirkönnten dieses Wort sehr wohl beim Reden verstehen, wir haben aber keine ihmentsprechende Idee35 (wie bei der „allerschnellesten Bewegung“). Zu einer Zeit, inwelcher die leibniz-wolffsche Logik vorherrscht, ist es eine ganz neuartige Behaup-tung, dass ein Begriff eines Inhalts bedarf, damit er nicht leer bleibt. In jener Logikgalt vielmehr als leerer Begriff nur der, der keinen Inhalt haben kann, weil er selbsteben kein Begriff ist; nämlich weil er einen formalen Fehler (einen Widerspruch)enthält. Der leere Begriff ist also in diesem Zusammenhang kein richtiger Begriff.Deswegen wird der Ausdruck „leerer Begriff“ in den Logiken Wolffscher Abstam-mung als „notio deceptrix“ übersetzt. Das aber heißt: trügerische Notion. Eine sol-che Notion ist trügerisch, weil sie vorgibt, selbst ein Begriff zu sein, während siekein solcher ist. Wäre sie ein Begriff, so hätte sie eben deswegen einen Erkenntnis-inhalt. Entsprechendes finden wir in der Geschichte der Wolffschen Philosophie vonCarl Günther Ludovici. Dieser Autor behauptet ausdrücklich, dass der deutscheAusdruck „leerer Begriff“ bei Wolff durch den lateinischen Ausdruck „notio decep-trix“ übersetzt wird36. Für Wolff ist die notio deceptrix eine Variante der notio im-possibilis37, jenes Begriffes, der auf Grund eines inneren Widerspruchs nicht denk-bar und somit eigentlich kein Begriff ist38. Als Beispiel einer notio deceptrix führtWolff den Bilineum rectilineum an, die geometrische Figur, die durch zwei geraden
32 Louis Couturat: a.a.O., 194.33 Nouveaux Essais. Ed. Gerhardt V, 246f.34 Das hat seinen Grund in der leibnizschen Metaphysik, denn die Monade führt seit ihrer Ent-
stehung ihre sämtlichen Vorstellungsinhalte in sich. Siehe Hans Heinz Holz: Vorbemerkungdes Herausgebers. In seiner Ausgabe von G. W. Leibniz: Kleine Schriften zur Metaphysik.Philosophische Schriften. I. Band, Frankfurt 1996, 31.
35 „intelligimus enim utique quid dicamus, et tamen nullam utique habemus ideam rerum im-possibilium“ Meditationes de cognitione, veritate et ideis. Ed. Gerhardt IV, 424.
36 Carl Günther Ludovici: Ausführlicher Entwurf einer vollständigen Historie der WolffischenPhilosophie zum Gebrauche Seiner Zuhörer heraus gegeben von Carl Günther Ludovici.Leipzig 1738. [Repr. Hildesheim 1977.] § 329, 242: „Leerer Begriff, notio deceptrix“.
37 Christian Wolff: Philosophia rationalis sive Logica, methodo scientifica pertractata et adusum scientiarum atque vitae aptata. Frankfurt u. Leipzig 1740. [Repr. Hildesheim 1983.]§ 1151, 808f. „Et enim qui possibilitatem notionis sive a priori, sive a posteriori stabilirenovit, ille certum est, notionem non esse impossibilem […] consequenter nec deceptricem.“
38 Wolff: a.a.O., § 38, 129 (Definitio termini inanis): „Si quis sibi videtur habere notionem ali-quam, cum tamen nullam habet, eamque voce quadam indigitat, tum terminus notionem de-ceptricem significat, quae cognoscenti imponit, cum sit re vera sine mente sonus. Terminumistum inanem appellamus. Atque adeo Terminus inanis est, qui notionem deceptricem signi-ficat.“ Vgl. § 547, 411.
Brought to you by | University of Washington LibrariesAuthenticated
Download Date | 11/29/14 7:53 PM
144 Mario Caimi
Linien eingeschlossen wird39. Als conceptus deceptor begegnet uns die notio decep-trix bei Baumgarten wieder: „CONCEPTVS, quem habere putamus, quum nullumhabeamus, DECEPTOR est.“ In diesem Sinne, als conceptus deceptor, übernimmtdann Meier diesen wolffschen Gedanken.40
Die Leere ist also in der wolffschen Philosophie eine formal-logische Eigenschaftdes Begriffs, etwa eine Folge seiner logischen Unmöglichkeit. Bei Kant dagegen istder leere Begriff nicht mehr einzig dem „conceptus deceptor“ gleichzusetzen. Erkennt sehr wohl den „conceptus deceptor“ als einen, der logisch nicht möglich ist.41
Der leere Begriff aber ist für ihn derjenige, der keinen wirklichen Gegenstand hat,der ihm entspricht:
Ein Begriff, der eine Synthesis in sich faßt, ist für leer zu halten und bezieht sich auf keinenGegenstand, wenn diese Synthesis nicht zur Erfahrung gehört, entweder als von ihr erborgt […]oder als eine solche, auf der als Bedingung a priori Erfahrung überhaupt (die Form derselben)beruht.42
Der leere Begriff kann somit logisch möglich sein, und zwar als „leerer Begriffohne Gegenstand“43, der „zwar ohne Widerspruch, aber auch ohne Beispiel aus derErfahrung gedacht“ wird.44 Vom logischen Standpunkt aus ist dieser Begriff tadel-los. Nichtsdestoweniger bleibt er leer. Bei Kant hängen Fülle oder Leere eines Be-griffs nicht mehr ausschließlich von seiner logischen Möglichkeit ab. Etwas Neuesist über die logische Möglichkeit hinaus als Merkmal des Nicht-leer-Seins hinzuge-treten. Das dürfte nebenbei das Schwanken von Friedrich Gottlob Born erklären, alser in seiner lateinischen Übersetzung der Kritik der reinen Vernunft die Verdoppe-lung „vacui sunt ac inanes“ dort einführte, wo Kant nur „leer“ schreibt.45 Born be-durfte zweier Worte, um diese neue Leerheit auszudrücken, möglicherweise wegender Neuheit des Gedankens, der keineswegs selbstverständlich war.
39 Christian Wolff: a.a.O., § 629, 459: „Notionem bilinei rectilinei nonnisi deceptricem habe-mus.“
40 Vgl. G. F. Meier: Auszug aus der Vernunftlehre. § 449. In: AA 16: 821.41 In der Reflexion 3414 (AA 16: 821) führt er als Beispiel dafür „die kleinste Zeit, größte Ge-
schwindigkeit“ an. Ob diese Begriffe als logisch unmöglich verstanden werden, bleibt aufGrund der unsicheren Datierung der Reflexion (w,j,x) unklar.
42 A 220 / B 267.43 B 348.44 Vgl. A 291 / B 347.45 Born: „Motus animi sine materia vacui sunt atque inanes, et visiones sine conceptibus cae-
cae.“ Immanvelis Kantii Opera ad philosophiam Criticam. Volumen primum, cvi inest Cri-tica rationis pvrae. Latine vertit Fredericvs Gottlob Born. Lipsiae, MDCCLXXXXVI, 54.Hier übersetzt Born durch eine Umschreibung, die schon eine Interpretation enthält. Er folgtdem Text nicht wörtlich (das kann er auch nicht, denn das klassische Latein hat m. W. keinanderes Wort für „Inhalt“ als „materia“). Er ersetzt „Inhalt“ durch „materia“. Und er gibt„leerer Begriff“ nicht mehr durch „notio deceptrix“, sondern durch notio inanis oder notiovacua im neuen kantischen Sinne wieder.
Brought to you by | University of Washington LibrariesAuthenticated
Download Date | 11/29/14 7:53 PM
„Gedanken ohne Inhalt sind leer“ 145
5. Schluss
Das Neue, das Kant hier vorbringt, besteht in der Einführung einer neuen Weise,wie ein Begriff als leer betrachtet werden kann. Das finden wir an der ersten Stelleder Tafel vom Nichts dargestellt: leer ist demnach der Begriff ohne Gegenstand:
ein Begriff ohne Gegenstand, wie die Noumena, die nicht unter die Möglichkeiten gezählt wer-den können, obgleich auch darum nicht für unmöglich ausgegeben werden müssen (ens ratio-nis), oder wie etwa gewisse neue Grundkräfte, die man || sich denkt, zwar ohne Widerspruch,aber auch ohne Beispiel aus der Erfahrung gedacht werden und also nicht unter die Möglich-keiten gezählt werden müssen.46
Ein Begriff kann also leer sein, wenn er auch nach formallogischen Kriterientadellos ist. Er kann nämlich auf diese neue Weise leer sein, indem er keine ihm ent-sprechende Anschauung aufweisen kann. Kants Leistung, seine Neuerung der leib-niz-wolffschen Philosophie, tritt hier hervor. Sie besteht in der Anerkennung derAnschauung als notwendige Bedingung der Erkenntnis. Das bringt die Anerken-nung der Unzulänglichkeit des Verstandes als alleinige Erkenntnisquelle mit sich.Diese Unzulänglichkeit kommt in der scheinbaren Tautologie zum Ausdruck: „Ge-danken ohne Inhalt sind leer“; denn dieser Satz sagt soviel wie: Die intellektuelleErkenntnis (der Gedanke) mag zwar logisch vollkommen sein, sie kann aber nicht-destoweniger leer bleiben. Die Leerheit wird nicht nur jenen Begriffen zugeschrie-ben, die in Wirklichkeit keine solchen sind: nicht nur die notiones deceptrices, diesich als Begriffe ausgeben, sondern auch richtige Begriffe können leer sein, wenn sienämlich keinen Inhalt haben.
Der leere Begriff ist und bleibt als Begriff möglich. Das heißt: durch ihn kannetwas gedacht werden. Er hat also in gewisser Weise doch einen Inhalt: nämlich dasin ihm Gedachte. Das durch einen leeren Begriff Gedachte kann aber niemals Ge-genstand im eigentlichen Sinne werden: weder gehört es zur Erfahrung, noch kannmöglicherweise zu ihr gehören. Den Inhalt eines leeren Begriffs nennt Kant ens ra-tionis. Mit diesem Ausdruck bedeutet er uns, dass das Sein des Inhalts sich in seinemGedachtwerden erschöpft, d. i., dass das Sein des Inhalts bloß im Gedachtwerdenbesteht. Der Begriff bezieht sich auf keine Wirklichkeit, auf keinen außergedank-lichen Gegenstand. Die Existenz des ens rationis ist bloße objektive Realität.47
So sehen wir, wie ein Begriff, der ursprünglich zur Erkenntnis gehört (ein Begriffder transzendentalen Logik), leer sein kann. Das ist nämlich der Fall, wenn der Be-griff gerade noch zum Denken, nicht aber zur Erkenntnis seines Gegenstandes dient.
46 A 290–291 / B 347.47 Siehe Eustachio a Sancto Paulo: Summa philosophica quadripartita. Paris 1609, IV, 17–19:
„Esse objective in intellectu nihil aliud est quam actu objici intellectui cognoscenti, sive illudquod objicitur cognoscendum vere sit in intellectu aut extra intelectum, sive illud vere nonsit. […] At vero quaedam sunt quae nullum habent aliud esse praeter istud objectivum seuesse cognitum ab intellectu, et haec dicuntur entia rationis.“ (Angeführt bei E. Gilson: IndexScolastico-cartésien. Seconde édition […] seule autorisée par l’auteur. Paris 1979, 107, unter„Être“.)
Brought to you by | University of Washington LibrariesAuthenticated
Download Date | 11/29/14 7:53 PM
146 Mario Caimi
Einem solchem Begriff entspricht höchstens die objektive Realität, nicht aber dieWirklichkeit seines Gegenstandes.
Es ist natürlich richtig, dass wir den Satz Kants so verstehen, als ob er sagte:„Begriffe ohne Anschauungen sind leer.“ Diese Ersetzung von „Inhalt“ durch„Anschauung“ ist aber nur unter der Bedingung möglich, dass wir den Ausdruck„leerer Begriff“ dermaßen verstehen, dass er sich auf den Begriff ohne Inhalt be-zieht. Eine solche Deutung des Ausdrucks „leerer Begriff“ war der vorkantischenLogik unbekannt. Dass Begriffe ohne Inhalt leer sind, ist etwas Neues in der Ge-schichte der allgemeinen Logik. Dass der Inhalt eine Anschauung sein muss, istein Grundbegriff der neuen, transzendentalen Logik. Mit dem Satz: „Begriffe ohneInhalt sind leer“ bedeutet Kant also seine Auffassung der formalen Logik als Kanon(also schon nicht mehr als organon) und führt zugleich seinen neuen Gedankeneiner transzendentalen Logik vor, in der die Sinnlichkeit als legitime Erkenntnis-quelle anerkannt wird. Es steht fortan fest, dass die allgemeine Logik kein Werk-zeug zur Erkenntnis, kein organon, sondern nur ein canon zur Beurteilung der for-malen Richtigkeit der Erkenntnis sein kann.48
*
Zu der Zeit also, als Kant diesen Satz schrieb, war die Meinung, dass Begriffeohne Inhalt leer sind, etwas ganz Neues und Unerwartetes. Der Satz war weder tri-vial noch tautologisch. Unsere Deutung zeigt den logischen Sinn des Satzes, so dasswir eine psychologistische Deutung wie etwa die von Peter Strawson aufgeben kön-nen. Strawson meint, die Bedeutung des Satzes liege in einer Feststellung der Bedürf-nisse des Verstandes, der als psychologisches Vermögen aufzufassen ist.49 Wir woll-ten dagegen beweisen, dass die Behauptung Kants auf einer Prüfung der Begriffegründet, so dass der Text einen logischen und keinen psychologischen Sinn hat.
48 Tonelli (a.a.O., 5 und 81) weist darauf hin, dass die transzendentale Logik eben die spezielleLogik ist, die als Methodologie einer besonderen Wissenschaft, nämlich der Metaphysik,dienen soll. Er verweist auf Metaphysik Volckmann, AA 28: 363.
49 P. F. Strawson: The Bounds of Sense. An Essay on Kant’s Critique of Pure Reason. London1978 [11966], 20f. hier 48.
Brought to you by | University of Washington LibrariesAuthenticated
Download Date | 11/29/14 7:53 PM