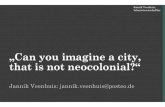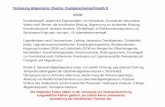Gesundheitszentren Allgemeine standesrechtliche Erwägungen
Transcript of Gesundheitszentren Allgemeine standesrechtliche Erwägungen
● Das – von den ärztlichen Selbstver-waltungen gestaltete – ärztliche Be-rufsrecht ist weitestgehend von Vor-schriften zu „entschlacken“, die derErrichtung und Vorhaltung von Ge-sundheitszentren zuwiderlaufen.
● Vor allem die Vorschriften des SGB Vmüßten für die Einbindung von Ge-sundheitszentren „kompatibel“ ge-staltet werden. Derzeit scheitert dieEinbindung allein am Fehlen einergrundsätzlichen Zulassungsvorschrift,sieht man von den genannten Aus-nahmen ab. Hier liegt die derzeit we-sentliche, grundsätzliche rechtlicheHürde, die der Einbindung von Ge-sundheitszentren entgegensteht.
● Im Ergebnis wird die an Gesetz undRecht gebundene Rechtsprechungkeinen entscheidenden Beitrag fürdie Einbedingung von Gesundheits-zentren leisten können. Insoweit istder Gesetzgeber gefordert.
»Wechsel« des Arztes innnerhalb der Gemein-
schaftspraxis bedarf der Kassenpatient keiner
Überweisung.
2. BGB1. I S. 1744.
3. BGHZ 70, 158.
4. BGHZ 70, 158 (167); seitdem st. Rspr.; vgl. nur
BGH MedR 1992, 328; MedR 1994, 152; Laufs,
MedR 1995, 11.
5. Vgl. z.B. BGHZ 97, 273, 276 f.: Zur Haftung des
Mitinhabers einer ärztlichen Gemeinschafts-
praxis für Verletzungen des Arztvertrages
durch den behandelnden Arzt (hier: von Radio-
logen gemeinschaftlich betriebenes ‘Institut
für Röntgen- und Nuklearmedizin’).
6. Zum ganzen vgl. Schneider, Handbuch des
Kassenarztrechtes, 1994, Rdnr. 792 ff. und Rdnr.
870 ff.m.w.N.
Dr. Günther SchneiderSächsisches LandessozialgerichtChemnitz
Literatur1. Vgl. etwa BGHZ 97, 273, 276 f.: Die Beklagten
betreiben Ihre Gemeinschaftspraxis in der
Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts
und treten nach außen hin als eine Einheit auf.
Das ergibt sich aus der rechtlichen Struktur der
von ihnen gewählten Form der Zusammenar-
beit. Unter dem Begriff „Gemeinschaftspraxis“
wird verstanden die gemeinsame Ausübung
ärztlicher Tätigkeit durch mehrere Ärzte der
gleichen oder verwandter Fachgebiete in ge-
meinsamen Räumen mit gemeinschaftlichen
Einrichtungen und mit einer gemeinsamen
Büroorganisation und Abrechnung, wobei die
einzelnen ärztlichen Leistungen für den jewei-
ligen Patienten während der Behandlung von
einem wie von dem anderen Partner erbracht
werden können. .....Nicht der einzelne Arzt
steht der Krankenkasse und dem Patienten ge-
genüber, sondern das »Institut«, in dem sich
die Ärzte zusammengeschlossen haben. Der
Krankenschein des Kassenpatienten ist regel-
mäßig auf die Gemeinschaftspraxis, nicht auf
einen bestimmten der in ihr zusammenge-
schlossenen Ärzte ausgestellt; für einen
| Der Internist 3·99M 76
D. Schulenburg
GesundheitszentrenAllgemeine standesrechtliche Erwägungen
1.
In sog. „Gesundheitszentren“ arbeitenunterschiedliche – ärztliche u. nicht-ärztliche – Gesundheitsberufe unter ei-nem – evtl. auch rechtlichen – Dach zu-sammen. In der Regel gibt es eine Be-treiber- oder Trägergesellschaft – meistin der Rechtsform einer GmbH –, dieauch nicht-ärztlichen Investoren offensteht. Die Betreibergesellschaft dientder Sammlung investiven Kapitals.
Aus Sicht der „Leistungserbringer“stehen neben der optimierten Patien-tenversorgung wirtschaftliche Erwä-gungen – insbesondere die bessere, weilgemeinschaftliche Nutzung von Res-sourcen – im Vordergrund.
Aufgabe der Ärztekammer ist es u.a.
● „für die Erhaltung eines hochstehen-den Berufsstandes zu sorgen und die
Erfüllung der Berufspflichten derKammerangehörigen zu überwachen“
sowie
● „die beruflichen Belange der Kam-merangehörigen wahrzunehmen“ (§6 Abs. 1 Nr. 5, 6 HeilBerG NW).
Der Arzt soll alle Verträge über seineärztliche Tätigkeit vor ihrem Abschlussder Ärztekammer vorlegen, damit ge-prüft werden kann, ob die beruflichenBelange gewahrt sind (§ 24 MBO-Ä1997).
2.
Der Arzt übt seinen Beruf nach seinemGewissen, den Geboten der ärztlichenEthik und der Menschlichkeit aus (§ 2Abs. 1 MBO-Ä 1997).
Hinsichtlich seiner ärztlichen Ent-scheidungen darf er keine Weisungenvon Nicht-Ärzten entgegennehmen (§ 2Abs. 4 MBO-Ä 1997).
Die Zusammenarbeit mit Angehö-rigen anderer Gesundheitsberufe istdemnach zulässig, wenn die Verantwor-tungsbereiche des Arztes und der Ange-hörigen der anderen Gesundheitsberufeklar erkennbar voneinander getrenntbleiben.
Nach § 1 Abs. 2 Bundesärzteord-nung (BÄO) ist der ärztliche Beruf „sei-ner Natur nach“, d.h. unabhängig vonder Form der Berufsausübung, ein„freier Beruf“.
Die aus Sicht des ärztlichen Berufs-rechtes und des ärztlichen Selbstver-ständnisses entscheidenden Fragen derfachlichen Weisungsfreiheit und Unab-hängigkeit sowie der Abgrenzung vonnicht-professionell Tätigen erfordert
eine Gesamtbetrachtung der tatsächli-chen und vertraglichen Umstände derBerufsausübung des Arztes.
3.
Die Ausübung ambulanter ärztlicherTätigkeit außerhalb von Krankenhäu-sern einschließlich konzessionierterPrivatkrankenanstalten ist an die Nie-derlassung in eigener Praxis gebunden,soweit nicht gesetzliche Vorschriften et-was anderes zulassen (§ 17 Abs. 1 MBO-Ä 1997 u. § 29 Abs. 3 HeilBerG NW).
Unter „Niederlassung“ ist die Ein-richtung einer mit den notwendigenräumlichen, sächlichen und personel-len Mitteln ausgestatteten Sprechstellezur Ausübung der ärztlichen Tätigkeitan einem frei gewählten Ort untergleichzeitiger Ankündigung gegenüberdem Publikum zu verstehen.
Unerheblich ist – und dies insbe-sondere im Hinblick auf die hier zu dis-kutierenden „Gesundheitszentren“ –die rechtliche Eigentümerstellung desArztes, d.h. die Inanspruchnahme frem-der Räume, fremder Geräte und frem-den Personals ist berufsrechtlich un-problematisch; entscheidend ist alleindie eigenveranwortliche Ausübung derärztlichen Tätigkeit.
Die Zahlung eines „Nutzungsent-gelts“ durch den Arzt für die Inan-spruchnahme vom Träger des Gesund-heitszentrums vorgehaltener Räume,Geräte und Personals ist grundsätzlichnicht zu beanstanden.
Problematisch sind aber umsatzbe-zogene Entgeltzahlungen an den Trä-ger/Betreiber des Gesundheitszentrums– insbesondere, sofern die marktange-messene Äquivalenz zur Gegenleistungfehlt, ist die wirtschaftliche Unabhän-gigkeit des Arztes tangiert, da von ihmein gewisser Umsatz bzw. eine gewisseGeräteausnutzung stillschweigend er-wartet wird.
Bei Vereinbarung einer Gewinn-oder Honorarbeteiligung könnte zudemdas Verbot der Errichtung einer Ge-meinschaftspraxis zwischen einem Arztund einem Nicht-Arzt tangiert sein.
Grundsätzlich besteht in diesen Fäl-len die Gefahr „fachfremder“ Entschei-dungen durch den Arzt (im vertragsärzt-lichen Bereich könnte das „Wirtschaft-lichkeitsgebot“ tangiert sein).
In rechtlicher Hinsicht ist die Zu-sammenarbeit mit anderen Nutzern des
Dem Arzt ist es zudem nicht gestat-tet,Patienten ohne hinreichenden Grundan bestimmte Apotheken, Geschäfteoder Anbieter von gesundheitlichenLeistungen zu verweisen (§ 34 Abs. 5MBO-Ä 1997).
Mit der erwünschten „kollegialenZusammenarbeit“ sind nicht etwa sog.„Ringüberweisungen“ gemeint; hierkann auf die Rechtsprechung zu Ärzte-häusern mit Fachärzten verschiedenerFachrichtungen verwiesen werden.
Zu bemerken ist schließlich, daßunter das Verbot der „Zuweisung gegenEntgelt“ auch eine Überweisungstätig-keit im „Gegenseitigkeits- oder Aus-tauschverhältnis“ fällt.
4.
Im Ergebnis muß bei der ärztlichen Be-rufsausübung im Rahmen eines Ge-sundheitszentrums gewährleistet sein,daß der Arzt seinen Beruf eigenverant-wortlich und selbständig ausübenkann, daß die Verantwortungsbereicheder unterschiedlichen Leistungsanbie-ter getrennt bleiben, daß der Arzt dieEntscheidung über Diagnose und The-rapie alleine trifft und der Grundsatzder freien Arztwahl gewahrt bleibt.
Die vertragliche Gestaltung mußunzulässigen unmittelbaren und mit-telbaren „fachfremden“ Einflußnahmenauf die ärztlichen Entscheidungen imRahmen des Behandlungsverhältnissesvorbeugen.
Dem Arzt soll durchaus das, wasTaupitz „kumulative Kommunikations-effekte auf Grund der Standortent-scheidung“ nennt zu Gute kommen.
Das Berufsrecht soll die berufli-chen Entwicklungsmöglichkeiten desArztes in Richtung auf eine effizienterePatientenversorgung nicht behindern,wohl aber die erforderliche Unabhän-gigkeit der ärztlichen Tätigkeit im In-teresse der Patienten und des Vertrau-ensverhältnisses der Patienten zumArzt schützen.
Dr. jur. Dirk SchulenburgJustitiar der Ärztekammer NordrheinTersteegenstraße 31D-40474 Düsseldorf
Gesundheitszentrums – jedenfalls so-fern es sich nicht um Ärzte handelt – le-diglich in der Rechtsform einer (partiel-len) Praxisgemeinschaft oder Partner-gesellschaft möglich. Die gemeinsameNutzung von Einrichtungsgegenstän-den und Apparaten zwischen Ärztenund selbständig tätigen Angehörigenanderer Gesundheitsberufe begegnetgrundsätzlich keinen berufsrechtlichenBedenken.
Durch geeignete organisatorischeMaßnahmen ist jedoch die Wahrungder ärztliche Schweigepflicht sicherzu-stellen. Hier ist zu beachten, daß bereitsdie Tatsache, daß ein Patient in Behand-lung eines Arztes ist, der ärztlichenSchweigepflicht unterliegt, d.h. schonein gemeinsamer Warte- und Rezepti-onsbereich wäre als problematisch an-zusehen.
Aus Sicht des Patienten muß klarsein, wer am Behandlungsgeschehenteilhat und in wessen Mitwissen um sei-ne Behandlung er einwilligt. Der Bun-desgerichtshof (BGH) kennzeichnetunter diesem Aspekt die Arztpraxis alseinen „von vornherein und sicher fürden Patienten überschaubaren Be-reich“; dies muß auch im Rahmen derBerufsausübung in einem Gesundheits-zentrum gelten, da das Vertrauensver-hältnis des Patienten zu seinem Arzttangiert ist.
Mit den Patientendaten umgehendürfen dementsprechend nur die wei-sungsabhängigen Gehilfen des Arztes.Personal der Betreiber- oder Trägerge-sellschaft des Gesundheitszentrum, diegegebenenfalls zentralisiert bestimmteVerwaltungsaufgaben (z.B. Liquidation,Personal u. Gebäudeangelegenheiten)übernimmt, darf zumindest ohne aus-drückliche – gegebenenfalls schriftliche– Einwilligungserklärung keine Einsichtin Patientendaten erhalten.
Ein weiterer wichtiger Punkt ausSicht des ärztlichen Berufsrechts imZusammenhang mit Gesundheitszen-tren ist das Verbot der „der Zuweisunggegen Entgelt“, das in engem Zusam-menhang mit dem Grundsatz der freienArztwahl steht.
Dem Arzt ist es nicht gestattet, fürdie Zuweisung von Patienten oder Un-tersuchungsmaterial ein Entgelt oderandere Vorteile sich versprechen odergewähren zu lassen oder selbst zu ver-sprechen oder zu gewähren (§ 31 MBO-Ä 1997).
Der Internist 3·99 | M 77
Mit
teilu
ng
en BDI