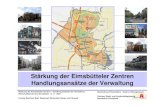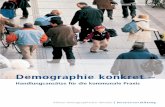Governance im Peripherisierungskontext – Handlungsansätze der Stadtpolitik
Transcript of Governance im Peripherisierungskontext – Handlungsansätze der Stadtpolitik

This article was downloaded by: [Florida Atlantic University]On: 11 November 2014, At: 14:54Publisher: RoutledgeInforma Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41Mortimer Street, London W1T 3JH, UK
disP - The Planning ReviewPublication details, including instructions for authors and subscription information:http://www.tandfonline.com/loi/rdsp20
Governance im Peripherisierungskontext –Handlungsansätze der StadtpolitikMatthias Bernt & Heike LiebmannPublished online: 20 Nov 2012.
To cite this article: Matthias Bernt & Heike Liebmann (2012) Governance im Peripherisierungskontext – Handlungsansätze derStadtpolitik, disP - The Planning Review, 48:2, 34-43, DOI: 10.1080/02513625.2012.721602
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/02513625.2012.721602
PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE
Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in thepublications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations orwarranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinionsand views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of orendorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independentlyverified with primary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims,proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arisingdirectly or indirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of the Content.
This article may be used for research, teaching, and private study purposes. Any substantial or systematicreproduction, redistribution, reselling, loan, sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone isexpressly forbidden. Terms & Conditions of access and use can be found at http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions

34 disP 189 · 48.2 (2/1012) Governance im Peripherisierungskontext – Handlungsansätze der StadtpolitikMatthias Bernt und Heike Liebmann
Abstract: Recent discussions on urban gover-nance regularly emphasize a trend towards an “entrpreneurialization” which is said to be re-flected in a growing importance of local and re-gional scales, an increased relevance of partner-ships and the strategic positioning of localities in an environment of intensified place-compe-tition. Building a case study in six medium-sized German cities that are characterized by eco-nomic losses and population decline, the article discusses different trajectories of local gover-nance. First, it shows that the actual modes of local governance gain importance. Second, it shows that the actual local modes of governance are fairly different among the cases studied. Therefore, many localities are more dependent on resources from the national government than on private investment, lending more sig-nificance to public-public cooperation than to public-private cooperation. Third, the paper ar-gues that the ability to implement long-term lo-cal development strategies is severely compli-cated by a dependence on external resources. As a consequence, short-term project-orienta-tion prevails in the majority of cases. The pa-per focuses on these different experiences and discusses implications for the analysis of urban governance in peripheralized cities and regions.
English Title: Governance and Peripheralization – experiences and approaches in six mid-sized German cities
1. Einleitung
Im Beitrag von Kühn und Weck in diesem Heft werden Abwanderung, Abkopplung und Ab-hängigkeit als Prozesse der Peripherisierung beschrieben, die für die betroffenen Städte starke Restriktionen mit sich bringen. Sie füh-ren zu einer Situation, in der einerseits ein ho-her Handlungsdruck besteht, andererseits aber gerade die zur Bewältigung der Probleme nö-tigen Ressourcen (Geld, Macht, Knowhow) vor Ort nur noch in sehr begrenztem Masse zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund ge-winnen die Fragen, welche Handlungsoptionen Kommunen in peripherisierten Räumen haben
und wie sie diese nutzen können, grosse Be-deutung. Die Antwort, die aktuelle Forschun-gen zu Handlungsansätzen der Stadtpolitik in Bezug auf diese Problemstellungen geben, ist ziemlich eindeutig: Strukturschwache Kom-munen, denen die Ressourcen zu eigenstän-digem Handeln fehlen, müssen sich verstärkt dem Standortwettbewerb stellen. Dies führt, so argumentieren zumindest viele Beiträge, zu einer wachsenden Ausrichtung von Entwick-lungsansätzen am Leitmotiv der unternehme-rischen Stadt (Harvey 1989; Heeg 2001), einer zunehmenden Relevanz partnerschaftlicher An-sätze und einer stärkeren Orientierung in Rich-tung Profilbildung und strategische Planung (zu Letzterem vgl. Hamedinger et al. 2008).
Die empirische Basis für diese Argumen-tation bilden in der Regel Grossstädte, häu-fig sogar Metropolen. Die Situation kleinerer und mittlerer Städte – und hier insbesondere die Konstellationen in Orten, die zu den Ver-lierern wirtschaftlicher Restrukturierungspro-zesse gezählt werden können – hat bislang we-niger Aufmerksamkeit gefunden. Vor diesem Hintergrund diskutiert der vorliegende Beitrag die Stichhaltigkeit der oben skizzierten Argu-mentationslinie für kleinere Mittelstädte in pe-ripherisierten Räumen Deutschlands. Er stützt sich dabei auf eine empirische Untersuchung der Handlungsmuster von Stadtpolitik in sechs Kommunen, die von 2009 bis 2011 in Zusam-menarbeit des Leibniz-Institutes für Regional-entwicklung und Strukturplanung (IRS) und des Institutes für Landes- und Stadtentwicklungs-forschung (ILS) durchgeführt wurde (vgl. Kühn, Weck 2012). Im Zentrum dieser explorativ an-gelegten Untersuchung standen dabei zwei Fra-gen: Wie werden die Handlungsoptionen loka-ler Akteure durch Peripherisierungsprozesse geprägt? Wie gehen die lokalen Akteure mit Problemen der Peripherisierung um, d.h., in welcher Form nehmen sie Handlungsoptionen wahr?
Die Antworten auf diese Fragen stellen wir im vorliegenden Artikel für drei von uns bear-beitete Fälle dar, die hiermit sozusagen pars pro toto für die gesamte Studie stehen sollen. Da-bei gehen wir wie folgt vor: Zunächst zeichnen wir aktuelle Diskussionen der stadtbezogenen
Dr. phil. Matthias Bernt ist seit 2008 wissenschaftlicher Mit arbeiter der Forschungs-abteilung Regenerierung von Städten am Leibniz-Institut für Regional ent wick lung und Strukturplanung in Erkner bei Berlin sowie Lehrbeauftragter an der Humboldt Universität zu Berlin; Arbeitsschwerpunkte: Urban Governance, schrump-fende Städte, Gentrifizierung.
Dr.-Ing. Heike Liebmann war bis April 2012 Leiterin der For-schungsabteilung Regenerierung von Städten am IRS – Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner bei Berlin. Seit Mai 2012 Leiterin des Bereichs Stadtentwicklung bei der Branden burgischen Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Moderni-sierung, Lehrbeauftragte an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus; Arbeits-schwerpunkte: Stadtentwick-lung und Stadt politik unter Schrumpfungs bedingungen, Stadtumbau.
Dow
nloa
ded
by [
Flor
ida
Atla
ntic
Uni
vers
ity]
at 1
4:54
11
Nov
embe
r 20
14

disP 189 · 48.2 (2/2012) 35Governanceforschung nach und skizzieren ihre Annahmen für die Handlungsmöglichkeiten von Städten im Umgang mit Peripherisierungs-problemen. Im Anschluss stellen wir die Situ-ation in den Städten Sangerhausen, Eschwege und Pirmasens dar und diskutieren die Hand-lungsschwerpunkte der Stadtpolitik in diesen Städten. Dabei fokussieren wir vor allem auf das Zusammenspiel von lokalen und überloka-len Faktoren, um die jeweilige «Stadtkarriere» zu erklären. Im Fazit führen wir die Ergebnisse der Fallstudien bezogen auf die oben genannten Fragen zusammen.
2. «Neoliberalisierung» und «unternehmerische Stadt» – Modelle aus der urbanen Governanceforschung
In der wissenschaftlichen Literatur zu Prob-lemen urbaner Governance ist es heute na-hezu zum Allgemeinplatz geworden, von einer durchgreifenden Bedeutung des ökonomischen Standortwettbewerbs für die Ausrichtung kom-munaler Entwicklungsansätze auszugehen. Der damit einhergehende Wandel der Stadtpolitik wird, in Anlehnung an einen Aufsatz von David Harvey (1989), meist mit dem Begriff der un-ternehmerischen Stadt verbunden und hat vor allem in der letzten Dekade zu einem wahren Boom an Beiträgen über neoliberale Stadtpo-litiken geführt (vgl. Brenner, Theodore 2002; Peck, Tickell 2002; Jessop 1994, 2002; Bren-ner 2004; Hackworth 2007). Die verbindende Klammer dieser Beiträge ist die These einer Rekonfiguration lokaler Institutionen und Stra-tegien entlang einer Agenda des Standortwett-bewerbs, durch die es zu einem umfassenden Wandel der Stadtpolitik käme. Diese Neolibe-ralisierung der Stadtpolitik, so wird in der Re-gel argumentiert, sei sowohl nach innen wie auch nach aussen gerichtet. Sie erfordere des-halb simultan eine stärker proaktive Ausrich-tung lokaler Politiken an Notwendigkeiten des Standortwettbewerbs, wie auch einen Umbau der Stadtverwaltungen entlang unternehmeri-scher Organisationsprinzipien (Verwaltungs-modernisierung). Die Diskussion spannt damit eine ganze Breite von Themen auf und die Liste der in der Literatur diskutierten Veränderungen ist beträchtlich. Sie reicht von Beiträgen über die Rekalibrierung intergouvernementaler Be-ziehungen und Debatten zur Restrukturierung von Wohlfahrtssystemen über Analysen der Privatisierung öffentlicher Einrichtungen und Studien zur Diffusion von «broken windows»-Konzepten bis hin zu Untersuchungen, die die
Ausbreitung von Public-private-Partnerships, «Quangos» und «Neuen Steuerungsmodellen» für die Kommunalverwaltung belegen (vgl. Hall, Hubbard 1998; Brenner, Theodore 2002; Bren-ner 2009).1
Was diese thematisch eher weit gefassten Beiträge eint, ist eine jeweils ähnliche Beschrei-bung des gesellschaftlichen Kontextes, in dem sich Kommunalpolitik heute bewegt: intensi-vierter Standortwettbewerb, zurückgehende zentralstaatliche Unterstützung bei gleichzeiti-ger Devolution von Aufgaben. Wirtschaftlicher Strukturwandel und Budgetprobleme werden dabei als massgebliche «Driver» verortet, wel-che die Stadtpolitik auf einen Weg zwingen, der durch proaktive Standortförderung und eine wachsende Kollaboration öffentlicher und pri-vatunternehmerischer Akteure gekennzeichnet ist. Unternehmerische Politiken, ein «manageri-alistischer» Umbau der Kommunalverwaltun-gen und eine proaktive Profilierung der Stadt werden damit – zumindest im Gros der Ver-öffentlichungen – zu einer Art universellem Handlungsmuster heutiger Stadtpolitik.
Obgleich in den meisten Beiträgen immer wieder die hohe Bedeutung unterschiedlicher Kontexte, Politikfelder und Entwicklungspfade betont wird, wird mit diesem Konzept implizit ein Modell aufgestellt, dass gleichermassen für wachsende und schrumpfende Städte, für Met-ropolen und Kleinstädte wie auch für Industrie-, Verwaltungs-, Dienstleistungs- und Universi-tätsstädte innerhalb desselben nationalstaatli-chen Kontextes gelten müsste. Da Globalisie-rung, Standortwettbewerb und zurückgehende zentralstaatliche Unterstützung die Auslöser des beschriebenen Wandels sind, müsste eine unternehmerische Stadtpolitik sogar in solchen Städten am stärksten zu beobachten sein, die von den Folgen am meisten betroffen sind. Die unterstellte Konvergenz von Stadtentwicklungs-politiken müsste also dazu führen, dass in Met-ropolen beobachtete neoliberale Politikmuster auch in kleineren Städten (und dort vielleicht sogar verstärkt) wiederzufinden sind.
Empirische Studien zu neoliberalen Stadt-entwicklungspolitiken sind jedoch bisher weitgehend durch einen Metropolenbias ge-prägt. Klein- und Mittelstädte und insbeson-dere strukturschwache Gemeinden sind bislang kaum im Hinblick auf neoliberale Politikmus-ter untersucht worden. In der Folge ist eigent-lich unklar, inwieweit die aus der Analyse von unternehmerischer Stadtpolitik gewonnenen Einsichten zu einem Typus von Stadt passen, der in Deutschland durchaus einen Normalfall darstellt. Eine Untersuchung zentraler Charak-
Dow
nloa
ded
by [
Flor
ida
Atla
ntic
Uni
vers
ity]
at 1
4:54
11
Nov
embe
r 20
14

36 disP 189 · 48.2 (2/1012) teristika unternehmerischer Stadtpolitik in die-sem Kontext hat daher nicht nur in Bezug auf die räumliche Kulisse Neuigkeitswert, sondern könnte darüber hinaus als eine Art Lackmustest betrachtet werden, mit dem sich genauere Aus-sagen über Reichweite und Varianz unterneh-merischer Stadtpolitiken treffen lassen.
Aus der gängigen Literatur haben wir des-halb zwei Hypothesen zusammengefasst, die allgemein als zentrale Merkmale neoliberaler Stadtpolitik gelten:a) Es kommt zu einer Ausrichtung von Städten am Standortwettbewerb, zentrale Projekte der Stadtentwicklungspolitik zielen daher auf eine Attraktivitätssteigerung der Stadt als Standort und damit verbundene externe Investitionen.b) Privatunternehmerische Akteure spielen eine wachsende Rolle in der lokalen Politik. Das spiegelt sich sowohl in der Zunahme von Anzahl und Bedeutung der Public-private-Partnerships und anderer Formen der Kollaboration als auch in einem wachsenden Einfluss von privaten Ak-teuren auf die kommunale Politik wider.
Diese Hypothesen haben wir für sechs struk-turschwache Mittelstädte untersucht, von denen drei im Weiteren noch näher vorgestellt werden. Die Auswahl des Untersuchungsgegenstands wurde dabei vor allem von zwei Überlegungen geleitet: Zum einen gelten Städte, je kleiner und strukturschwächer sie sind, um so eher als Pro-blemfall der Regionalentwicklung (Gatzweiler et al. 2003; Kretschmer, Usbeck 2003). Ökono-mische Restrukturierungen treffen hier häu-fig auf eine Wirtschaftsstruktur, die durch we-nige Branchen und Betriebe geprägt ist, sodass Verluste eine stärkere Auswirkung auf die ge-samtstädtische Entwicklung haben. In der Folge verzeichnen strukturschwache und durch tradi-tionelle Industrien geprägte Mittelstädte häufig starke Bevölkerungsverluste und gelten als ex-emplarisch für Schrumpfungsprobleme. Zum zweiten – und eng damit verbunden – leiden diese Mittelstädte in der Krise häufig beson-ders stark unter einer ungünstigen Finanzsitu-ation, da sie gleichzeitig von hohen Ausgaben für die Bewältigung des wirtschaftlichen und demografischen Wandels (vgl. Mäding 2004) und von unzureichenden Einnahmen aufgrund zurückgehender Bevölkerung und mangelnder Wirtschaftskraft betroffen sind (Pohlan, Wix-forth 2005).2 Hinzu kommt in vielen Fällen der durch Bevölkerungsverluste und staatliche In-frastrukturentscheidungen bedingte Verlust zentralörtlicher Funktionen. Trotz nach wie vor hoher Transferleistungen seitens Bund und Länder ist der finanzielle Spielraum vieler «Kri-
senstädte» daher so klein, dass die Kommunen kontinuierlich genötigt sind, neue Ressourcen zu erschliessen. Zusammengefasst stellen Mit-telstädte in strukturschwachen und peripheri-sierten Räumen zugespitzte Problemfälle dar, in denen ein besonders starker Handlungsdruck auf die Kommunalverwaltungen besteht und in denen die oben beschriebene Reorientierung der Stadtpolitik theoretisch eine besondere Re-levanz besitzen müsste.
3. Handlungsmuster der Stadtpolitik in peripherisierten Mittelstädten – drei Beispiele
Trifft dies zu? Orientieren sich strukturschwa-che, peripherisierte Städte an oben beschriebe-nen Mustern neoliberaler Stadtpolitik? Anhand der drei Städte Sangerhausen, Eschwege und Pirmasens stellen wir Handlungsmuster der Stadtpolitik im Umgang mit Peripherisierungs-prozessen vor und diskutieren, wie sie sich zu dem oben beschriebenen Bild der unternehme-rischen Stadt verhalten.
3.1 Sangerhausen – Von der Bergbaustadt zur Hauptstadt der Arbeitslosen
Sangerhausen (ca. 30 000 EW), Kreisstadt des Landkreises Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt war vor der deutschen Wiedervereini-gung eine prosperierende Industriestadt. Auf der Basis des Kupferschieferbergbaus erfuhr die gesamte Region nach 1945 ein anhaltendes Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum. Die Einwohnerzahl der Stadt verdoppelte sich im Zeitraum von den frühen 1950er- bis zur Mitte der 1980er-Jahre. Obwohl Ende der 1980er-Jahre bereits absehbar war, dass der Bergbau in der Region keine Zukunft haben wird und erste Schritte zu einer Umstrukturierung der Wirtschaftsstruktur eingeleitet worden waren, führte die politische Wende 1989 doch zu einem beschleunigten und in seiner Radikalität auch für ostdeutsche Regionen besonders massiven Strukturbruch. Die tragende Kupferindustrie wurde quasi «über Nacht» geschlossen. Infolge dieser rasanten Deindustrialisierung kehrten der Stadt vor allem qualifizierte Arbeitskräfte und junge Menschen nach dem Schulabschluss den Rücken. Allein in den ersten 15 Jahren nach der Wende sank die Bevölkerungszahl so um 28 Prozent. Trotzdem liegt die Arbeitslosigkeit mit 15,9 Prozent (2010) 3 nach wie vor deutlich über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Dies brachte der Stadt in überlokalen Medien bereits
Dow
nloa
ded
by [
Flor
ida
Atla
ntic
Uni
vers
ity]
at 1
4:54
11
Nov
embe
r 20
14

disP 189 · 48.2 (2/2012) 37in den 1990er-Jahren das bis heute immer wie-der aufgegriffenes Stigma als «Hauptstadt der Arbeitslosen» ein. Die seitdem erfolgten Bemü-hungen um eine wirtschaftliche Neustrukturie-rung hatten bislang nur wenig Erfolg. Grösster Arbeitgeber in der Region sind die Mitteldeut-schen Fahrradwerke mit ca. 700 Beschäftigten, davon die meisten im Niedriglohnbereich. Es ist eines der wenigen Unternehmen vor Ort, denen der Sprung in die Marktwirtschaft gelungen ist. Trotz vielfältiger Bemühungen um Investoren blieben die Ansiedlungserfolge von Wirtschafts-unternehmen begrenzt.
Die Wirtschaftsförderung ist nichtsdes-totrotz ein wesentlicher Handlungsschwer-punkt der lokalen Politik. Bereits in den frühen 1990er-Jahren setzte diese auf die Neuauswei-sung von Gewerbegebieten und die Verbesse-rung der infrastrukturellen Anbindung durch den Anschluss an die Autobahn, der im Jahr 2009 erfolgte. Im Jahr 2008 erhielt Sangerhau-sen zudem von der Landesregierung den Zu-schlag für die Entwicklung des Industrieparks Südharz, der für grössere Neuansiedlungen im Bereich der Industrie vorgehalten werden soll. Es ist einer von fünf Vorrangstandorten für die industrielle Entwicklung, die im Landesent-wicklungsplan Sachsen-Anhalts ausgewiesen sind.
Einen weiteren Handlungsschwerpunkt bil-det – ebenfalls bereits seit den frühen 1990er-Jahren – die Stärkung der historischen In-nenstadt. Unterstützt durch umfangreiche Fördermittel wurden öffentliche Plätze aufge-wertet und historische Gebäude saniert. Heute verfügt die Stadt über eine – für ostdeutsche Städte dieser Grösse – erstaunlich gut erhal-tende und lebendige Innenstadt. Seit 2001 stellt der Stadtumbau einen neuen Handlungs-schwerpunkt dar. Dabei nehmen Stadt und Wohnungsunternehmen Fördermittel aus dem Programm «Stadtumbau Ost» in Anspruch und reissen leer stehende Wohnungen in den rand-städtisch gelegenen Grosswohnsiedlungen ab.
Ein drittes Handlungsfeld der Sangerhäu-ser Stadtentwicklung der letzten Jahre ist das Bemühen um den Erhalt von Zentrumsfunkti-onen in einem sich entleerenden Raum. Hier ist vor allen der Wettbewerb um den Status der Kreisstadt von Bedeutung, den Sangerhausen im Jahr 2007 im Vorfeld einer Kreisgebietsre-form mit der ca. 30 km entfernten Lutherstadt Eisleben ausgetragen hat. Mit dem Kreissitz sind eine Reihe von Mittel- und Funktionszu-weisungen verbunden. Daher stellte der Statu-serhalt für beide Städte eine hohe Priorität dar. Auf Landesebene wurde diese Frage vor allem
anhand der Einwohnerzahlen entschieden. Um ihre Einwohnerzahl zu steigern, griffen daher beide Gemeinden zum Mittel der Eingemein-dung umliegender Ortschaften. Im Ergebnis konnte Sangerhausen innerhalb kürzester Zeit ca. 7700 Einwohner hinzugewinnen, was ihr ei-nerseits den erstrebten Kreisstadtstatus, ande-rerseits aber auch eine verfünffachte Stadtflä-che einbrachte.
Fasst man die stadtentwicklungspolitischen Initiativen von Sangerhausen zusammen, wird deutlich, dass keiner der drei genannten Hand-lungsschwerpunkte der Kommune ohne erheb-liche Ressourcentransfers seitens Bund und Land funktioniert. Mit dem Ziel eigene Hand-lungskapazitäten zu stärken, hat sich Sanger-hausen in den letzten Jahren an einer Vielzahl von Wettbewerben, Förderprogrammen und Ausschreibungen beteiligt. Diese Aktivitä-ten brachten jeweils eigene Notwendigkeiten der reibungslosen Zusammenarbeit, der poli-tischen Unterstützung durch die Landesregie-rung und der kohärent wirkenden lokalen Ziel-formulierung mit sich.
Die Folge dieser hohen Orientierung an För-dermitteln ist ein lokaler Politikstil, der eher auf gemeinsames Arbeiten an der «Sangerhäu-ser Sache» als auf parteipolitischen Wettbewerb ausgerichtet ist. Dabei hat sich in der Stadt in den letzten Jahren eine relativ überschaubare Gruppe von «Machern» in der Lokalpolitik und Verwaltung herauskristallisiert, die über Partei-grenzen hinweg eng zusammenarbeitet und die in der Vergangenheit in Kooperation mit dem Landrat wichtige landespolitische Entscheidun-gen immer wieder im Sinne Sangerhausens be-einflussen konnte. Die handlungsleitenden Ori-entierungen dieser Gruppen lassen sich als ein Setzen auf Geschlossenheit, gemeinsames Auf-treten sowie gegenseitige Verlässlichkeit und beiderseitiges Vertrauen beschreiben.
Privatwirtschaftliche Akteure, die gekenn-zeichnet sind durch zumeist kleinbetriebliche Strukturen, Ressourcenschwäche und nahezu nicht vorhandene arbeitsteilig-kooperative Ver-flechtungen, spielen demgegenüber kaum eine Rolle. An die Stelle der Einzelunternehmer könnten die Wirtschaftsorganisationen – Indus-trie- und Handelskammer, Handwerkskammer oder Innungen – treten. Allerdings verstehen sich diese – nicht allein in Sangerhausen – vor allem als Plattform für die Unternehmen, ohne daraus den strategischen Anspruch zu entwi-ckeln, Einfluss auf Stadtentwicklungsprozesse zu nehmen.
Im Ergebnis entsteht vor Ort eine «Grant Machine», die sich auf den Zugang zu staatli-
Dow
nloa
ded
by [
Flor
ida
Atla
ntic
Uni
vers
ity]
at 1
4:54
11
Nov
embe
r 20
14

38 disP 189 · 48.2 (2/1012) chen Geldern ausrichtet und in die eine sehr überschaubare Zahl von Entscheidungsträgern der Stadtentwicklung eingebunden ist. Ange-sichts der lokalen Ressourcenschwäche ist ein solches Vorgehen wahrscheinlich alternativlos – gleichzeitig verschiebt es aber den Fokus der lo-kalen Strategiebildung auf überlokale Ebenen und macht kommunale Handlungsmöglichkei-ten von diesen abhängig.
3.2 Eschwege – Mittendrin und doch am Rand 4
In einer nicht unähnlichen Situation befindet sich auch die Kreisstadt Eschwege (ca. 20 000 EW) in Nordhessen, die bereits seit der Nach-kriegszeit durch Peripherisierungsprozesse gekennzeichnet ist. Mit der Grenzziehung zur DDR brachen nicht nur die ehemals engen Ver-flechtungen zum Nachbarland Thüringen ab, sondern die Stadt geriet auch in eine Rand-lage innerhalb der Bundesrepublik. Mit der deutschen Wiedervereinigung rückte Eschwege dann wieder in die geografische Mitte Deutsch-lands. Allerdings konnte die Stadt nur kurzzei-tig von der Grenzöffnung profitieren. Allein in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre liess sich der bereits seit Mitte der 1970er-Jahre andau-ende Bevölkerungsrückgang – aufgrund aus-bildungsbezogener und arbeitsmarktbedingter Abwanderungen – für eine kurze Zeit stop-pen. Trotz zahlreicher Versuche über staatliche Förderungen und Anreize für Investitionen in Zonenrandregionen ab 1971 blieb die lokale Wirtschaftsstruktur der Stadt schwach und ge-genüber konjunkturellen Schwankungen anfäl-lig. Dies zeigte sind insbesondere nach 1989, als die Zahl der Industriearbeitsplätze nach dem Abschwingen eines kurzzeitigen Nachwende-booms deutlich zurückging. Die Stadt ist daher bereits seit Mitte der 1990er-Jahre durch eine im Vergleich zum Land Hessen beziehungs-weise zur Bundesrepublik insgesamt über-durchschnittlich hohe Arbeitslosenquote ge-kennzeichnet. Nach einem leichten Rückgang lag diese im Jahr 2010 bei 8,2 Prozent.5
Von den lokalen Akteuren vor Ort wird die Peripherisierung der Stadt Eschwege als multi-ple Problemlage wahrgenommen. Diese reicht von der verkehrlichen Abkopplung aufgrund eines fehlenden Autobahnanschlusses über die Schrumpfung und Alterung der Bevölke-rung bis hin zur geringen Innovationsdynamik im wirtschaftlichen Bereich und die Schlies-sung von Unternehmen. Hinzu kommt noch die Schwächung der Funktion als Einkaufsstadt (Kühn, Sommer 2010: 21f.).
Ebenso vielfältig wie die Peripherisierungs-prozesse sind die Aktivitäten der Stadtpolitik. Das Stadtumbaukonzept von 2006/07 definiert eine Vielzahl von Handlungsfeldern (u.a. Ver-kehrsinfrastruktur, Tourismus, Einzelhandel, Technologiesteuerung) und darin verankerten Projekten und Massnahmen. Zum Ausdruck kommt hier, dass es der Stadt angesichts der Mannigfaltigkeit an Problemen und der di-versifizierten Wirtschaftsstruktur schwer fällt, Stärken und Alleinstellungsmerkmale zu de-finieren. Mit den Worten eines Interviewpart-ners ausgedrückt, muss die Stadt «versuchen, auf allen Gebieten gut zu sein.» (Kühn, Sommer 2010: 33).
Dieser Ansatz wurde seitens der Stadt vor allem über eine Strategie der Professionalisie-rung der eigenen Verwaltung forciert. So wur-den in den letzten Jahren mehrere Führungs-positionen in der Verwaltung im Rahmen von bundesweiten Ausschreibungen neu besetzt. Verbunden damit war nicht nur die Erwartung, die Verwaltung fachlich zu verstärken, sondern auch der Anspruch, «kreative Köpfe» mit neuen Ideen zu gewinnen. Für die Stadt eröffneten sich damit neue Wege im Umgang mit Proble-men. Dazu gehören die Stärkung von Netzwer-ken innerhalb der Stadt (bspw. zur Stärkung des Einzelhandels), Ansätze der interkommunalen Kooperation (bspw. in Bezug auf die Tourismus-region Werratal) oder auch eine stärkere Ziel-gruppenfokussierung (bspw. das Thema «Woh-nen» für Familien in der Innenstadt). Zudem entwickelte die Stadt ein besonderes Engage-ment bei der Teilnahme an Wettbewerben und Förderprogrammen.
Allerdings führte die intensive Beteiligung an allen möglichen Ausschreibungen und Pro-grammen auch zu einer zunehmenden «Ver-zettelung» (ebd.: 32) des Handelns und einer Fokussierung auf immer kürzere Zeiträume. Die Vielfalt der Förderthemen und die geringe Ausstattung der meisten Programme erschwe-ren strategische Orientierungen und Schwer-punktsetzungen (Kühn, Sommer 2010). Vonsei-ten der Stadt wird dies als «Notwehrmaßnahme und ein notwendiger Instrumenteneinsatz zur Bewältigung der anstehenden Probleme» (Stadt Eschwege 2007: 9) gesehen, auch wenn sich die Stadt damit in finanzielle und auch inhalt-liche Abhängigkeiten von Fördermittelgebern begibt.
Insgesamt ist das stadtentwicklungspo-litische Handeln in Eschwege ähnlich wie in Sangerhausen durch eine Dominanz öffentli-cher Akteure der Stadtverwaltung im Sinne ei-ner «Grant Machine» gekennzeichnet. Akteure
Dow
nloa
ded
by [
Flor
ida
Atla
ntic
Uni
vers
ity]
at 1
4:54
11
Nov
embe
r 20
14

disP 189 · 48.2 (2/2012) 39der privaten Wirtschaft sind eher schwach, ein Grossteil der ansässigen Betriebe besteht – zum Teil bedingt durch Verkäufe ehemals inhaberge-führter Unternehmen – aus Filialen oder Zweig-werken überregionaler Konzerne mit geringer Entscheidungsbefugnis. In der Stadtentwick-lung spielen diese Akteure kaum eine Rolle.
3.3 Pirmasens – Von der Schuhmetropole zum Schuhkompetenzzentrum 6
Etwas anders liegen die Dinge in der westpfäl-zischen, nahe der französischen Grenze gele-genen Stadt Pirmasens. Die Geschichte von Pirmasens (ca. 41 000 EW) ist seit Beginn des 19. Jahrhunderts eng mit der Schuhproduktion verbunden. 1913 befand sich fast die Hälfte al-ler Schuhfabriken in Deutschland in Pirmasens, was den Ruf der Stadt als «deutsche Schuh-metropole» begründete (Wagner 1997: 12). Bis in die 1960er/1970er-Jahre hinein waren fami-liengeführte Schuhfabriken und deren Zulie-ferindustrien Garanten für die wirtschaftliche Blüte der Stadt. Die wachsende Konkurrenz im Ausland führte allerdings ab Mitte der 1960er-Jahre zu einer zunehmenden Strukturverände-rung. Die Zahl der Beschäftigten in der Schu-hindustrie sank von über 30 000 im Jahr 1960 auf weniger als 1000 im Jahr 2008 (Stadtent-wicklungskonzept Pirmasens 2007). Das einzige noch in grösserem Masse in Pirmasens pro-duzierende Unternehmen ist heute die Peter-Kaiser-AG mit rund 500 Beschäftigten vor Ort. Weitere Unternehmen haben ihre Produktion weitgehend ins Ausland verlagert beziehungs-weise an Fremdlieferanten abgegeben, auch wenn sie in Pirmasens weiterhin ihr Verwal-tungs-, Marketing- oder Designzentrum haben beziehungsweise dort im Schuhfachhandel tätig sind. Zudem haben sich frühere Zulieferunter-nehmen der Schuhindustrie neue Wirtschafts-felder erschlossen, etwa im Bereich der Kunst-stoffproduktion, des Gerätebaus (Fitness- und Cardiogeräte) und der Logistik. Aus der wirt-schaftlichen Monostruktur konnte sich so all-mählich eine breiter diversifizierte Wirtschafts-struktur entwickeln.
Ein weiterer wichtiger Wirtschaftsfaktor für Pirmasens waren von 1951 bis in die 1990er-Jahre hinein die in der Stadt stationierten Ein-heiten der US-Armee. Bis zu 6000 Soldaten und ihre Familienangehörigen sowie 4000 Ar-beitsplätze für Zivilbedienstete waren mit der Kaserne auf der Husterhöhe verbunden. Der Abzug der Streitkräfte hinterliess nicht nur ein grosses Kasernengelände am Rande der Kernstadt, sondern schlug sich auch in einem
sprunghaften Anstieg der Arbeitslosenzahlen (13,7 Prozent im Jahr 2010) 7 sowie im Rück-gang der Kaufkraft vor Ort nieder. Damit ver-bunden war eine verstärkte Wahrnehmung von Peripherisierung bis hin zum Gefühl einer tief greifenden Krise.
Im Gegensatz zu Sangerhausen und Eschwege führte die Krise hier allerdings zu einer stärkeren Kooperation von Wirtschaft, Stadtpolitik und Verwaltung. Die Herausbil-dung und Konsolidierung von Entscheidungs-netzwerken zwischen Stadt und Wirtschaft war dabei unter anderem das Ergebnis eines Füh-rungswechsels an der Stadtspitze, in dessen Folge sich das Handeln der Stadtpolitik von ei-ner eher reaktiven zu einer pro-aktiven Politik wandelte. Grundlage dafür war die Erarbeitung eines Stadtleitbildes und die Inangriffnahme verschiedener Schlüsselprojekte, die sich stra-tegisch in dieses einbetteten. Zu nennen sind z. B. Projekte zur Belebung der Innenstadt wie der Umbau der ehemaligen Schuhfabrik Rhein-berger in ein Dienstleitungszentrum und das interaktive Museum Dynamikum.
Über die intensivere Standortpolitik der Stadt hinaus fällt in Pirmasens eine hohe Ak-tivität der lokalen Wirtschaft auf, die sich in die Stadtentwicklung einmischt. Der wichtigste Grund hierfür ist das Vorhandensein einer gan-zen Reihe von Privatunternehmern, die an den Ort gebunden sind, sich als Pirmasenser ver-stehen und sich für die Entwicklung ihrer Stadt engagieren. Die Schuhproduktion in Pirmasens beruhte in der Vergangenheit auf einem Netz-werk grosser Schuhfabriken mit einer Reihe kleiner Unternehmen und Zulieferbetriebe. Während die meisten grossen Schuhfabriken dem Wettbewerbsdruck im Zuge der Globali-sierung der Schuhproduktion nicht standhal-ten konnten, entwickelten sich einige kleinere Unternehmen innovativ weiter. Diese Privatun-ternehmer, die die alte wirtschaftliche Elite der sogenannten «Schuhbarone» ablösten, brach-ten sich über die Gründung eines bis heute aktiven Stadtmarketingvereins in die Stadtent-wicklung ein.
Im Vertrauen auf endogene Stärken und Po-tenziale entwickelte diese Koalition aus Politik und Wirtschaft das für die Karriere der Stadt prägende Thema der Schuhproduktion weiter hin zu einem Schuhkompetenzzentrum. Das heisst, die verbliebene Schuhkompetenz wird in Richtung ihrer Technologieorientierung un-terstützt und befördert, um daraus ein neues Alleinstellungsmerkmal der Stadt zu entwi-ckeln. Das Segment der vor Ort noch vorhande-nen hochwertigen Schuhproduktion sowie die
Dow
nloa
ded
by [
Flor
ida
Atla
ntic
Uni
vers
ity]
at 1
4:54
11
Nov
embe
r 20
14

40 disP 189 · 48.2 (2/1012) Kompetenzen im Design und Verkauf werden ergänzt durch beziehungsweise zusammenge-führt mit weiteren Institutionen, etwa aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Prüf-technik sowie Zertifizierung und Ausbildung. Neu gegründet wurde dafür das International Shoe Competence Center (ISC) 8, dem bei der weiteren Entwicklung des Clusters eine wich-tige Bündelungsfunktion zukommt. Die in der Stadt vorhandenen Schuhkompetenzen bilden damit heute die Grundlage für einen technolo-gischen und postindustriellen Strukturwandel.
Im Ergebnis ist die Stadtentwicklung in Pir-masens kaum weniger abhängig von überloka-len Ressourcenzuweisungen, Ausschreibungen und Förderprogrammen als die anderen beiden Beispiele. Allerdings erfolgt die Inanspruch-nahme dieser Ressourcen hier auf der Basis eines stabilen Netzwerkes zwischen Politik, Ver-waltung und Wirtschaft – und mit einer strate-gischen Orientierung, indem Schlüsselprojekte auf der Basis eines Leitbildprozesses und eines Stadtentwicklungskonzeptes definiert und um-gesetzt werden. Die eher selektive Einwerbung von Fördermitteln orientiert sich dadurch stär-ker als in den anderen untersuchten Städten an den in öffentlich-privaten Kooperationsprozes-sen ausgehandelten Prioritäten. Dies zeigt auch folgender Interviewauszug: «Der Ansatz, der in-zwischen verfolgt wird ist der, dass Projekte ent-wickelt und schon im Vorfeld aufeinander abge-stimmt werden, […] wenn es dann zu dem Punkt kam, dass wir in der Lage waren ein Förderpro-gramm zu finden, das auf eines dieser Projekte passte, dann war das kein stand-alone Projekt mehr, keine Einzelmaßnahme, sondern es war eine Maßnahme, die integriert war in dieses Gesamtkonzept.» (Beißwenger, Weck 2010: 34)
4. Fazit
Trotz der gewichtigeren Rolle, die lokale wirt-schaftlicher Akteure in der Pirmasenser Stadt-entwicklung spielen, bleibt festzuhalten, dass die Situation in den drei näher vorgestellten Städten nur zum Teil dem Bild entspricht, das die Literatur zu unternehmerischer Stadtpo-litik von der Ausrichtung kommunaler Ent-wicklungsansätze zeichnet. Die beiden oben skizzierten Hypothesen, in denen wir zentrale Merkmale neoliberaler Stadtpolitik zusammen-gefasst haben, lassen sich also in den von uns untersuchten Gemeinden nur mit Abstrichen bestätigen.
Zwar sind Ansätze einer proaktiven Stand-ortförderung in allen Städten und partner-
schaftliche Governancenetzwerke zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren we-nigstens in Pirmasens erkennbar – allerdings resultieren die Ressourcen hierfür eher aus staatlichen Mehrebenenverflechtungen als aus der Integration von Unternehmen in die Stadt-politik. Dementsprechend richtet sich strate-gisches Handeln in allen Städten zwar an den Maximen des Standortwettbewerb aus – dies ist jedoch, anders als in der Literatur in der Re-gel diskutiert, in erster Linie ein Wettbewerb um die Inanspruchnahme überlokaler staatli-cher Ressourcen und nicht ein Wettbewerb um Investoren. Damit wird zwar die unternehme-rische Grundausrichtung von Stadtpolitik bei-behalten und es kommt auch zu dem in der Literatur häufig beschriebenen Bedeutungszu-wachs von kollaborativen Entscheidungsstruk-turen – die tatsächlichen politisch-planerischen Entscheidungen folgen in peripherisierten Städten aber anderen Logiken. Grundlegend für die Stadtentwicklung bleiben staatliche Res-sourcenflüsse, die die Opportunitätsstrukturen lokalen Handelns prägen. Statt den aus der US-amerikanischen Forschung bekannten «growth machines», in denen Geschäftsleute und Stadt-verwaltung gemeinsam versuchen, Investitio-nen in ihre Stadt zu lenken (vgl. Molotch 1976) entstehen eher «Grant Machines»: Netzwerke lokaler Akteure, die gemeinsam handeln, um Zugang zu öffentliche Ressourcen zu erlangen und diese in ihre Stadt zu kanalisieren. Neben projektbezogenen Fördermitteln geht es dabei auch um staatliche Investitionen (bspw. für das Dynamikum in Pirmasens oder den Industrie-park Südharz in Sangerhausen) sowie um die Übernahme beziehungsweise den Erhalt von Funktionen (bspw. International Shoe Compe-tence Center in Pirmasens oder Funktion als Kreisstadt in Sangerhausen). Ziele der Aktivi-täten sind letztendlich die Sicherung und der Ausbau der Attraktivität der Stadt als Standort. Die Feinausrichtung der Stadtpolitik orientiert sich dabei jedoch nicht vorrangig an den Anfor-derungen von potenziellen Investoren, sondern eher an den Vorgaben übergeordneter staatli-cher Institutionen.
Die jeweiligen lokalen Netzwerke vermö-gen es zwar – mehr oder weniger erfolgreich – in allen von uns beobachteten Städten, für die Entwicklung der Stadt nötige Ressourcen ein-zuwerben. Sie bleiben aber in ihrem Hand-lungsspielraum begrenzt und von einer steten Unterstützung durch EU-, Bundes- und Lan-desinstitutionen sowie deren Mitteln abhän-gig. Ändern sich auf diesen Ebenen wichtige Rahmenbedingungen, z. B. durch Kürzungen
Dow
nloa
ded
by [
Flor
ida
Atla
ntic
Uni
vers
ity]
at 1
4:54
11
Nov
embe
r 20
14

disP 189 · 48.2 (2/2012) 41von Zuweisungen und Änderungen von Sub-ventionstatbeständen, durch die Verschiebung von Förderschwerpunkten oder das Ausschei-den von Entscheidungsträgern, kann das für die Städte zu erheblichen Problemen führen, die auch durch ein gutes lokales Management nicht mehr aufgefangen werden können. Lo-kale Entscheidungen werden damit abhängig von überlokalen Konstellationen und müssen sich an diesen ausrichten. Obwohl die Orien-tierung auf überlokale Ressourcen damit auf der einen Seite lokales Handeln ermöglicht und stärkt, zwingt diese Abhängigkeit die Städte oft auch zu einer Orientierung an Themensetzun-gen und Prioritäten, die ausserhalb der Kom-mune entstehen.
Hinzu kommen problematische «Nebenwir-kungen» von für die Mittelakquisition nötigen Aktivitäten, z. B. die Belastung des Gemeinde-haushaltes mit Kofinanzierungsanteilen oder die mit Eingemeindungen einhergehende Ver-vielfachung von Interessenlagen. All diese Pro-bleme verweisen auf die Grenzen des lokalen Managements von Peripherisierungsprozessen. Dennoch ist die Art und Weise, wie die beob-achteten Städte diese Abhängigkeit gestalten, durchaus unterschiedlich. Hierbei fällt insbe-sondere die bedeutendere Rolle wirtschaftlicher Akteure in Pirmasens auf, die zu einer stärke-ren strategischen Orientierung in Bezug auf die Inanspruchnahme von trotzdem unabdingba-ren staatlichen Ressourcen geführt hat. Ob der hierdurch eingeschlagene Kurs Erfolg haben kann, welche Auswirkungen die Ausrichtung auf das Leitbild «Schuhkompetenzzentrum» für andere Bereiche der Stadtentwicklung haben wird und welche Risiken damit einhergehen, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Deutlich ist aber schon jetzt, dass die Unterstützung lokaler staatlicher Akteure durch lokale Unternehmer die Kohärenz und Bindekraft der eingeschla-genen Strategie gestärkt hat. Allerdings verfü-gen zwei der drei von uns näher vorgestellten peripherisierten Städte nicht im selben Masse wie Pirmasens über lokal gebundene und am Standort interessierte und zugleich handlungs-fähige Unternehmer. Die Verallgemeinerbarkeit der Pirmasenser Erfahrung ist also begrenzt.
Insgesamt kann also festgestellt werden, dass die Peripherisierung in den untersuch-ten Städten zu einer wachsenden Bedeutung überlokaler Entscheidungsebenen geführt hat, an denen sich lokale Konstellationen ausrich-ten. Die Notwendigkeit eines proaktiven loka-len Handelns wird hierdurch nicht reduziert. Es wird allerdings zu einer Art «Schnittstellen-mangement», bei dem lokale Akteure möglichst
geschickt versuchen müssen, die vor Ort feh-lenden Ressourcen aus einer sich in ständiger Bewegung befindlichen Landes-, Bundes- und EU-Förderlandschaft in ihre Stadt zu holen.
Dieses Ergebnis unserer Forschungen hat sowohl theoretische als auch politisch-plane-rische praktische Implikationen: In Bezug auf die urbane Governanceforschung zeigt unsere Untersuchung, dass Globalisierung, Standort-wettbewerb und zurückgehende staatliche Un-terstützung nicht unbedingt zu einer Konver-genz von Stadtentwicklungspolitiken entlang eines neoliberalen «Drehbuchs» führen müssen. Anstelle einer Konvergenz von Entwicklungs-pfaden scheint sich eher eine breite Varianz durchzusetzen, bei der die Governanceprozesse peripherisierter Städte besonderen Dynamiken folgen. Die starke Einbindung lokaler Gover-nanceformen in überlokale Politkprojekte ver-weist darüber hinaus methodologisch auf die Notwendigkeit, ein «localist bias» zu vermeiden und lokale Politiken im Wechselspiel zwischen lokalen Gegebenheiten und überlokalen Verän-derungen zu untersuchen. Politisch-planerisch zeigt unsere Untersuchung, dass modische Auf-forderungen zu mehr Kooperation, mehr Pro-fil und mehr Innovation im Kontext peripheri-sierter Städte nur wenig Erfolg haben können, wenn sie nicht von einer besseren finanziel-len Grundausstattung begleitet werden, die es den Städten ermöglicht, nicht mehr nach jedem Strohhalm greifen zu müssen.
Anmerkungen
1 An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass eine Ökonomisierung der Verwaltung und ein Abschied von überkommenen «Weberschen» Bürokratiemodellen zwar in der Diskussion um neoliberale Stadtentwicklung zu den typischen Merkmalen eines «unternehmerischen» Umbaus lokaler Staatlichkeit gezählt wird – umgekehrt die Diskussion um «Neoliberalismus» aber kam Eingang in die sehr detaillierte und empirisch hervorragend fundierte Forschung über kom-munale Verwaltungsmodernisierung (u. a. Bogu-mil et al. 2007; Kuhlmann 2004; Jann 2001) gefunden hat. Obwohl der sich verändernde globale Kontext und interne Verwaltungsmoder-nisierung in enger Beziehung stehen, handelt es sich deshalb um sehr verschiedene Diskussions-stränge, deren Schnittpunkte kaum untersucht wurden.
2 Hinzu kommt noch das Problem der kommuna-len Verschuldung, das zu oft restriktiven Bedin-gungen der Schuldenaufnahme führt und den ohnehin vorhandenen Investitionsstau in den Kommunen noch vergrössert. Obwohl die kom-
Dow
nloa
ded
by [
Flor
ida
Atla
ntic
Uni
vers
ity]
at 1
4:54
11
Nov
embe
r 20
14

42 disP 189 · 48.2 (2/1012) munale Situation überaus vielfältig ist, kommen Boettcher, Brand, Junkernheinrich in einer Untersuchung der kommunalen Finanz- und Schuldensituation in Rheinland-Pfalz dennoch zu dem Ergebnis: «Von einer exogenen Verur-sachung der Kassenkreditbelastung ist primär dort auszugehen, wo eine unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft mit überdurchschnittlich hohen sozial- und siedlungsstrukturellen sowie demo-graphisch bedingten Ausgaben bedarfen zusam-menfällt.» (Bertelsmann Stiftung 2010: 109)
3 Diese Angabe der Agentur für Arbeit bezieht sich auf den gesamten Landkreis Mansfeld-Südharz.
4 Die Fallstudie zur Stadt Eschwege wurde von Manfred Kühn und Hanna Sommer vom Leib-niz-Institut für Regionalentwicklung und Struk-turplanung (IRS) erstellt (vgl. Kühn, Sommer 2010).
5 Diese Angabe des Hessischen Statistischen Lan-desamtes für den Monat Juli 2010 bezieht sich auf den gesamten Werra-Meißner-Kreis.
6 Die Fallstudie zur Stadt Pirmasens wurde von den Projektpartnern Sabine Beißwenger und Sabine Weck vom ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund er-stellt (vgl. Beißwenger, Weck 2010).
7 Quelle: Bundesagentur für Arbeit8 Das ISC ist ein Lehr- und Forschungszentrum
für die Leder- und Schuhindustrie sowie für den Handel. Träger der gemeinnützigen GmbH sind das Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V. (PFI), der Hauptverband der Deutschen Schuh-industrie e. V. und die Stadt Pirmasens
(www.isc-pirmasens.de).
LiteraturBeißwenger, S.; Weck, S. (2010): Pirmasens. Fall-
studie im Rahmen des Projektes «Stadtkarrieren in peripherisierten Räumen. Dortmund (abrufbar unter www.ils-forschung.de/down/Pirmasens-Bericht_ Endfassung_012011.pdf).
Bernt, M.; Liebmann, H.; Becker, S. (2010): San-gerhausen. Fallstudie im Rahmen des Projektes «Stadtkarrieren in peripherisierten Räumen. Er-kner (abrufbar unter www.irs-net.de/download/Fallstudie_Sangerhausen.pdf).
Bertelsmann Stiftung (2010) (Hrsg.): Kommunaler Finanz- und Schuldenreport Rheinland-Pfalz. Gütersloh (abrufbar unter www.wegweiser- kommune.de).
Bogumil, J.; Grohs, S.; Kuhlmann, S.; Ohm, A. K. (2007): Zehn Jahre Neues Steuerungsmodell. Eine Bilanz kommunaler Verwaltungsmodernisierung. Berlin: edition sigma.
Brenner, N. (2004): New state spaces. Urban Gover-nance and the rescaling of statehood. Oxford: Oxford University Press.
Brenner, N. (2009): Cities and Territorial Competi-tivness. In Rumford, C. (Hrsg.), The Sage Hand-
book of European Studies. Los Angeles et al.: Sage, S. 442–463.
Brenner, N.; Theodore, N. (2002): Cities and the geographies of ‹actually existing neoliberalism›. Antipode, 34 (3), S. 356–386.
Gatzweiler, H.-P.; Meyer, K.; Milbert, A. (2003): Schrumpfende Städte in Deutschland? Fakten und Trends. Informationen zur Raumentwick-lung, 10/11, S. 557–574.
Hackworth, J. (2007): The neoliberal city. Gover-nance, Ideology, and Development in American Urbanism. Ithaca, London: Cornell University Press.
Hall, T.; Hubbard, P. (1998): The entrepreneurial city. Geographies of Politics, Regime and Repre-sentation. Chichester: John Wiley and Sons.
Harvey, D. (1989): From Managerialism to Entre-preneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism. Geografiska An-naler. Series B, Human Geography, 71 (1), S. 3–17.
Hamedinger, A.; Frey, O.; Dangschat, J. S.; Breit-fuss, A. (2008) (Hrsg.): Strategieorientierte Pla-nung im kooperativen Staat. Wiesbaden: VS Verlag.
Heeg, S. (2001): Unternehmen Stadt zwischen neuen Governanceformen und Sicherheitspolitik. Zeit-schrift für Soziale Politik und Wirtschaft (SPW), 118, S. 41–43.
Jann, W. (2001): Verwaltungsreform als Verwaltungs-politik: Verwaltungsmodernisierung und Policy-Forschung. In Schröter, E. (Hrsg.), Empirische Policy- und Verwaltungsforschung. Lokale, nati-onale und internationale Perspektiven. Opladen: Leske + Budrich, S. 321–344.
Jessop, B. (1994): Post-Fordism and the state. In Amin, A. (Hrsg.), Post-Fordism. A Reader. Oxford: Blackwell.
Jessop, B. (2002): Liberalism, neoliberalism, and urban governance. Antipode, 34 (3), S. 452–472.
Kretschmer, T.; Usbeck, H. (2003): Bevölkerungs-entwicklung und Stadtumbau in kleinen und mittleren Städten Sachsens. wohnbund-informa-tionen, 2, S. 12–13.
Kuhlmann, S. (2004): Evaluation lokaler Verwal-tungspolitik: Umsetzung und Wirksamkeit des Neuen Steuerungsmodells in den deutschen Kommunen. Politische Vierteljahresschrift, 3, S. 370–394.
Kühn, M.; Sommer, H. (2010): Eschwege – Vom Zonen-rand zur inneren Peripherie. Fallstudie im Rahmen des Projektes «Stadtkarrieren in peripherisierten Räumen». Erkner (abrufbar unter www.irs-net.de/download/Fallstudie_Eschwege.pdf).
Kühn, M.; Weck, S. (2012): Peripherisierung – Pro-zesse, Probleme und Strategien in Mittelstäd-ten. disp, 189, S. 14–26.
Mäding, H. (2004): Demographischer Wandel und Kommunalfinanzen – Einige Trends und Erwar-tungen. Deutsche Zeitschrift für Kommunalwis-senschaften (DfK), 1, S. 84–102.
Molotch, H. (1976): The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place. Journal of Sociology, 82 (2), S. 309–332.
Dow
nloa
ded
by [
Flor
ida
Atla
ntic
Uni
vers
ity]
at 1
4:54
11
Nov
embe
r 20
14

disP 189 · 48.2 (2/2012) 43Peck, J., Tickell, A. (2002): Neoliberalizing Space. Antipode, 34 (2), S. 380–404.
Pohlan J.; Wixforth, J. (2005): Schrumpfung, Sta-gnation, Wachstum – Auswirkungen auf städti-sche Finanzlagen in Deutschland. In Gestring, N.; Glasauer, H.; Hannemann, C.; Petrowski, W.; Pohlan, J. (Hrsg.), Jahrbuch StadtRegion 2004/2005. Schwerpunkt «Schrumpfende Städte». Wiesbaden: VS Verlag, S. 19–48.
Stadtentwicklungskonzept Pirmasens (o. J. [2007]): Teil I. Stadtumbau West. Pilotprojekt im ExWoSt-Forschungsfeld «Stadtumbau West». Erstellt im Auftrag der Stadt Pirmasens durch Bachtler, Böhme und Partner.
Stadt Eschwege (2007): Integriertes Stadtumbau-konzept Stadt Eschwege 2006/07. Erstellt im Auftrag des Magistrats der Kreisstadt Eschwege durch FIRU mbh.
Wagner, M. (1997): Hauenstein und die deutsche Schuhindustrie. Ein historischer Überblick. Hrsg. vom Museum für Schuhproduktion und Industrie geschichte Hauenstein. Schriftenreihe 1. Hauen stein: Eigenverlag.
Dr. Matthias BerntIRS – Leibniz-Institut für Regio nal ent wick lung und Struktur planungFlakenstr. 28–31D-15537 [email protected]
Dr. Heike LiebmannB.B.S.M. Brandenburgische Beratungsgesellschaftfür Stadterneuerung und Modernisierung mbHBehlertstr. 3a, Haus GD-14467 Potsdamheike.liebmann@bbsm- brandenburg.de
Dow
nloa
ded
by [
Flor
ida
Atla
ntic
Uni
vers
ity]
at 1
4:54
11
Nov
embe
r 20
14