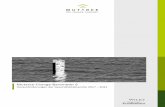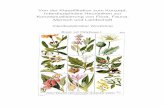Interdisziplinäre Herausforderungen der Karsthydrogeologie
Transcript of Interdisziplinäre Herausforderungen der Karsthydrogeologie

Grundwasser – Zeitschrift der Fachsektion Hydrogeologie (2013) 18:223DOI 10.1007/s00767-013-0238-0
E D I TO R I A L
Interdisziplinäre Herausforderungen der Karsthydrogeologie
Nico Goldscheider · Tobias Geyer
Online veröffentlicht: 5.11.2013© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
Karstgrundwasserleiter sind in vielen Regionen der Weltwertvolle Trinkwasserressourcen, aber gleichzeitig auf-grund ihrer speziellen Struktur und Eigenschaften besondersverletzlich gegenüber Schadstoffeinträgen und oft schwie-rig zu erkunden und zu bewirtschaften. Daraus ergeben sichvielfältige praktische Fragestellungen und wissenschaftli-che Herausforderungen für die Karsthydrogeologie sowieein ganz eigenes Instrumentarium an Methoden und Model-lansätzen, von denen einige in diesem und dem folgendenThemenheft präsentiert werden.
Karstsysteme sind weit mehr als Wasserressourcen. Siesind Ökosysteme, Inseln der Biodiversität, natürliche Sen-ken für CO2, Klimaarchive und mehr. An der Oberflä-che bieten sie vielfältige und einzigartige Lebensräume fürPflanzen und Tiere, darunter zahlreiche endemische Arten –bis hin zum hochgradig bedrohten Delacour’s Langur, ei-ner Primatenart, die ausschließlich in einigen vietnamesi-schen Karstgebieten anzutreffen ist. Auch unterirdisch undim Grundwasser beherbergen Karstsysteme viele endemi-sche Tierarten, darunter Wirbellose, Fische und Amphibi-en, wie den Höhlensalamander Proteus anguinus. Hierausergeben sich spannende interdisziplinäre Forschungsfragenzwischen Karsthydrogeologie und Biologie.
Böden in Karstlandschaften bilden die Grundlage für na-türliche Vegetation und landwirtschaftliche Produktion, sind
N. Goldscheider (B)Institut für Angewandte Geowissenschaften,KIT – Karlsruher Institut für Technologie,Kaiserstr. 12, 76131 Karlsruhe, DeutschlandE-Mail: [email protected]
T. GeyerLandesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbauim Regierungspräsidium Freiburg,Albertstr. 5, 79104 Freiburg, DeutschlandE-Mail: [email protected]
aber besonders anfällig gegenüber Erosion. Ist der Bodeneinmal verschwunden, bleibt nur nackter Kalkstein übrig.Eine Neubildung ist in menschlichen Zeithorizonten kaummöglich. Erodierte Bodenpartikel werden in den Untergrundeingespült und bilden dort Höhlensedimente. Mit dem Ver-lust des Bodens verschwindet eine wichtige Schutzschichtgegenüber Schadstoffeinträgen ins Grundwasser. Der Ver-karstungsprozess, also die Lösung von Karbonat-Mineralen,stellt eine natürliche Senke für atmosphärisches CO2 darund wirkt daher dem Klimawandel entgegen. Dieser Prozessist unter Bodenbedeckung effektiver als auf nacktem Kalk-stein, weil im Boden durch mikrobiellen Abbau abgestor-bener Pflanzenreste höhere CO2-Partialdrücke auftreten alsin der Atmosphäre. Bodenerosion verringert also die Wirk-samkeit des Karstprozesses als CO2-Senke. Die skizziertenZusammenhänge verdeutlichen das Potenzial bzw. den Be-darf an interdisziplinärer Forschung zwischen Bodenkun-de, Agrarwissenschaft, Mikrobiologie, Klimaforschung undKarsthydrogeologie.
Stalagmiten aus Karsthöhlen werden zunehmend als Kli-maarchive genutzt und sind als solche den Eisbohrkernen inmancher Hinsicht überlegen, denn Stalagmiten findet manin fast allen Höhlen, überall auf der Welt, in allen Klima-zonen, während brauchbare Eisbohrkerne nur in Grönlandund der Antarktis gewonnen werden können – mit größtemtechnischem Aufwand. Paläoklimatische Daten aus Stalag-miten sind nur dann vernünftig interpretierbar, wenn die hy-drologische Funktion der ungesättigten Zone oberhalb derbetrachteten Höhle besser verstanden wird – eine weitere in-terdisziplinäre Herausforderung für die Karsthydrogeologie.
Aufgrund der skizzierten vielfältigen Zusammenhängezwischen Wasser, Böden, Biodiversität und Klima solltedie zukünftige Karstforschung wesentlich interdisziplinärerausgerichtet sein als dies heute der Fall ist, wobei demGrundwasser – und damit auch der Hydrogeologie – bei al-len genannten Aspekten eine wichtige Rolle zukommt.