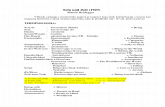KMU_LIFE_05_2011
-
Upload
tobias-merz -
Category
Documents
-
view
227 -
download
9
description
Transcript of KMU_LIFE_05_2011

05 / 2011
Neue Dimensionen ermöglichenPassende Unternehmenssoftware
•MehrWissenfürdenWettbewerb•FremdeMärkteinunsicherenZeiten

KMU Business-Software. Damit Ideen Erfolg haben. www.sageschweiz.ch
Unsere Lösung für eine leistungsfähige Business-Software.
Ihre Garantie für ein fortschrittlich geführtes KMU.
Michael Kunz, Sage-Mitarbeiter
Sage_KMU_KMULife_A4_d.indd 1 13.10.2011 08:49:56

1KMU LIFE · 05/2011
EDITORIAL
Liebe Leserinund Lieber Leser
Wer in diesen Zeiten in die Tagespresse schaut, dem springt immer wieder das Wort «Krise» ins Auge. Da ist die Rede von Staats-krisen, Eurokrise oder auch Bankenkrise.
Es stellt sich dabei die Frage, warum das Mainstream der Ökonomiegurus diese Krisen nicht kommen sah und dementsprechend Vorschläge zur Verhinderung einbrin-gen konnte, und jetzt wie die Politiker, Strukturkrisen mit schnellen Feuerwehraktionen bekämpfen muss.
Nehmen wir nur das Beispiel der Finanzmärkte. Sie galten und gelten als der Gipfel ökonomischer Effizienz, stürzten in den letzen Jahren aber immer wieder in die Tiefe. Nur durch massive staatliche Bürgschaften und Finanzsprit-zen für Banken, ganz im Widerspruch zur vorherrschen-den Lehre, konnte ein Zusammenbruch vermieden werden. Jetzt stehen einige europäische Banken wieder vor dem Aus und das staatliche Geld droht, auszugehen. Die analytische Hilflosigkeit der Neoklassik ist mit Händen zu greifen.
Eine erste Antwort auf dieses Versagen kann uns ein etwas anders gestrickter Klassiker geben: John Maynard Key-nes. Er glaubte, dass menschliche Stimmungen die Wirt-schaft stark beeinflussen. Bürgerinnen und Bürger sind keineswegs die rational handelnden Individuen, wie sie die klassische Theorie darstellt. Das Ökonomen-Mainstream hat aber rationale Individuen und freie Märkte in den letz-ten Jahrzehnten zu einem Dogma erhoben. Der Blick und das Verständnis für Strukturkrisen, die sich jenseits von Konjunkturzyklen bewegen, sind dabei verloren gegan-gen. Das merkt man auch an Universitäten, denn in den Fachbereichen Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissen-schaften ist die Neoklassik omnipräsent. Auch der akade-mische Nachwuchs kann mit diesen Krisen herzlich wenig anfangen. Wir werden in einer der nächsten Ausgaben dies zum Thema machen.
In unserm aktuellen Themenschwerpunkt kann auch von einer Krise gesprochen werden. Es geht dabei um die Krise der öffentlichen Aufmerksamkeit der ICT-Branche. Ohne Software funktionieren heute kein industrieller Ferti-gungsprozess, kein Produkt und kaum eine Dienstleitung. Trotzdem ist die dahinterstehende Informatik in der Ge-sellschaft kaum präsent. In den Lobbyhallen in Bern be-völkern Vertreterinnen der Agrar- und Pharmabranche die Wandelhallen. Die ICT-Branche sucht man dort vergebens. Gerade eine Handvoll Nationalräte fühlt sich dem Thema verpflichtet. Auch in der Schule freut man sich zwar über die neuen Handys, was aber dahinter steckt, bleibt meist völlig im Dunkeln. Die eigene Branche kann zwar auf eini-ge renommierte Unternehmen wie Abacus oder Opacc ver-weisen, die gemeinsame Aussendarstellung hat aber noch viel Luft nach oben.
Hier gilt es, einen Prozess anzustossen, den wir gerne publizistisch begleiten wollen.
Georg LutzChefredaktor KMU [email protected]

06 36Markterschliessung in volatilen Zeiten
Gerade für KMU sind Auslandmärkte schon immer eine spezielle Herausforderung ge-wesen. Jetzt ist es an der Zeit, mit heissem Herz und kühlem Kopf zu handeln. Wir fra-gen einen Experten mit theoretischem und praktischem Hintergrund nach den vorherr-schenden Tendenzen und den Abbau von zentralen Hürden.
20Elektronische Zertifikate
Die elektronische Welt bestimmt schon längst den kaufmännischen KMU-Geschäftsalltag. Rechnungen werden nicht mehr in Papierform ausgetauscht, Verträge einfach noch als Word- oder PDF-Dokument hin und her gesendet und wichtige geschäftliche Abmachungen per E-Mail bestätigt. Das geht schnell, kann aber juristische Verwicklungen zur Folge haben. Dar-auf gilt es, sich einzustellen.
Aufstellung der ICT-Branche
Auf den ersten Blick ist die ICT-Branche gut aufgestellt. Es gibt hervorragende Universitä-ten und ein hoch gelobtes duales Ausbildungs-system. Allerdings ist die Branche in vielen Teilen der Gesellschaft wenig verankert. Die Folge sind fehlende Fachkräfte und Ausbil-dungsplätze. Wo liegen die Gründe für die De-fizite? An der letzten topsoft gab es ein Panel mit Antworten.
Inhalt
2 KMU LIFE · 05/2011

3KMU LIFE · 05/2011
XXXXXXXXXXXXX
42Transport und Logistik bei Weinen
Weinlogistik ist ein komplexes und zeit-aufwendiges Aufgabenfeld. In Basel gibt es jetzt Lösungen, bei der sich Weinhänd-ler wieder auf ihre Kernkompetenzen kon-zentrieren können. Wir präsentieren ein Weinhotel.
56Competitive Intelligence im Einsatz
Die Auseinandersetzung um die Wettbe-werbsfähigkeit ist Alltag in Unternehmen. Ein zentraler Baustein dabei ist die Aufstel-lung von Mitbewerbern. Dieser Beitrag stellt das Konzept «Competitive Intelligen-ce» (CI) vor. CI ist als Disziplin und als Pro-zess zu verstehen.
52Kreativitätskultur in Unternehmen
Was heute in ist, ist morgen Schnee von ges-tern. Menschen kommen und gehen. Trends entstehen und werden wieder begraben. Wer auf dem Markt erfolgreich sein will, muss nicht nur sich, sondern auch seine Pro-dukte immer wieder neu erfinden. Wie geht man in turbulenten Zeiten mit dieser Schnell-lebigkeit um?
RubrikenEditorial 01Kommentar 05Das Thema 06Dokumentenmanagement 20Hardware 24Kommunikation 26Marketing 32
Aussenwirtschaft 36Mobilität 42Human Ressource 52Recht 76Gadgets 78Impressum 80

Wie erstklassig unser Service ist, zeigt auch das Bonusprogramm SWISS PartnerPlusBene t für KMU. Auf jedem Geschäfts ug mit uns oder einer der Bene tPartner Airlines sammeln Sie für Ihr Unternehmen wertvolle Punkte für Frei üge, Upgrades, Bargeld oder Prämienartikel.
Wer ist schon gerne Passagier, wenn er Gast sein kann?
Jetzt registrieren und mit 1000 Willkommenspunkten starten:swisspartnerplusbene t.ch
057_300_TaxiPlane_SPPB_205x275_KMU_Life 1 13.10.11 08:44

5KMU LIFE · 05/2011
KOMMENTAR
von Herbert Brändli
Wie können Pensionskassen ihre Renten retten
Pensionskassenrenten sind von verschiedensten Sei-
ten gefährdet. Mit der behördlich verordneten Sen-
kung der BVG-Zinsen werden sie bereits beim An-
sparen stark nach unten korrigiert. Daneben steht
politisch die Senkung der Umwandlungssätze schon wieder
auf dem Tapet. Die erwartete Inflation droht derart massiv
gekürzte Renten vollends zu verdampfen.
In der Zweiten Säule bleibt wenig Spielraum, sich gegen die
momentan widerlichen politischen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse zu wehren. Die Schweizer Arbeitnehmer sind im
Zuge einer grassierenden Regulierungswut mit einer zuneh-
menden Enteignung ihrer Altersvorsorgegelder konfrontiert.
Ihre Pensionskassen müssen sich in einem aus technisch und
wirtschaftlicher Sicht weit überdefinierten engen Korsett be-
wegen. In der Folge lassen höhere Kosten und tiefere Erträge
die Renten sinken.
Was können Pensionskassen gegen diesen selbstmörderischen
Aderlass vorkehren? Volatile nach unten orientierte Börsen-
kurse fressen ihre Reserven weg. Die Konzentration auf den
Deckungsgrad lassen weitere Interventionen der Regulato-
ren erwarten, welche die Leistungskraft der Zweiten Säule
nochmals schwächen, nachdem bereits viele Vorsorgeeinrich-
tungen im Nachgang zu den Krisen 2002 und 2008 in eine
Zinsfalle getreten und dort gefangen sind. Solange die Welt
nicht untergeht, besteht berechtigte Hoffnung, dass Pensions-
kassen mit einem adäquaten Risikomanagement Ordnung in
ihren Anlagebereich bringen und zu ihrer tragenden Rolle der
sozialen Sicherung zurückfinden.
Vorweg gilt es, zu beherzigen, dass die zunehmende Langle-
bigkeit für Pensionskassen kein Risiko ist. Es ist eine zentrale
Aufgabe diesem seit langem bekannten Wachstum wirksam
zu begegnen. Sie können das mit Erträgen schaffen. Konkret
sind bei der aktuellen Alterszunahme jährlich ein Viertel
bis ein halbes Prozent zusätzlicher Ertrag erforderlich, um
die Renten jeweils bis zum verzögerten Ableben bezahlen zu
können. Entsprechend erhöhen sich die Sollerträge der Pen-
sionskassen. Mit dieser Aufgabe stehen sie vor einem riesi-
gen Finanzteich. Darin wimmelt es von Händlern und Ver-
mögensverwaltern, aber auch Finanzhaien, Abzockern und
Spekulanten, die mit immer neuen Versprechen an das Geld
der Pensionskassen wollen. Scheingewinne produzierende Fi-
nancial Engineers wurden in ihrem Machbarkeitswahn die
eigentlichen Rattenfänger der Finanzindustrie. Reihenweise www.bb-vorsorge.ch
Herbert Brändli ist Verwaltungsratspräsident und Gründer der B+B Vorsorge AG.
Weitere Informationen
stolpern Pensionskassenmanager und Politiker über ihre
Lockvogelangebote, verpackt in vermeintlich günstige ETFs,
Indices und Securities. Diese teils rein synthetischen Vehikel
werden zulasten der Kunden zwischen Versicherungen, Ban-
ken, Hedge- und Anlagefonds verschoben und verlocht. Die
kaskadenartigen Kostenberge dieser Finanzintermediäre re-
duzieren die echten Erträge der Basisanlagen massiv. Noch
schlimmer: Sogenannte risikolose Konstrukte bergen teils ge-
waltige verschleierte Risiken. Es war reiner Zufall, dass Ado-
boli bankeigene Mittel und keine Kunden- und Pensionskas-
sengelder verzockt hat.
Haben Pensionskassen diesen kostenträchtigen Finanzteich
mit vertrauenswürdigen Vermögensverwaltern überwunden
und befinden sich endlich im transparenten Basisanlageuni-
versum, sollten sie sich auf das Machbare beschränken. Pro-
fond, eine effiziente Sammelstiftung für KMU beispielsweise,
macht nur Anlagen in produktive Vehikel, die regelmässig Er-
trag in Form von Zins, Miete oder Dividenden abwerfen. Speku-
lationen mit Rohstoffen, Versicherungen, Währungen, Katas-
trophen oder Kunst werden tunlichst vermieden. Diese be-
währte Strategie stützt sich auf langjährige Erfahrungswerte.
Entsprechend konzentriert sich mein Haus auf produktive
Sachanlagen, die langfristig, entgegen Anleihen und Kredi-
ten, kosten- und teuerungsbereinigt immer positive Erträge
abgeworfen haben. Damit konnten das hohe Leistungspo-
tential erhalten und Krisen überbrückt werden. Im Vertrau-
en und Wissen, dass die Märkte bis zur Apokalypse immer
wieder korrigieren und nach einem allfälligen Weltuntergang
auch keine Renten mehr nötig sind, nimmt Profond natürliche
Vermögensschwankungen in Kauf. Gleichzeitig ist sie gut ge-
rüstet, wenn Schuldner Haare und Gläubiger Vermögen liegen
lassen, sobald die erwartete Teuerung einsetzt.

6 KMU LIFE · 05/2011
XXXXXXXXXXXXX
PoLitik und iCt-branChe in der sChweiz
Warum ist in der Schweiz kein iPhone oder Facebook erfunden worden? Diese Frage beschäftigt auch uns immer wieder. Die Rahmendaten sind eigentlich nicht schlecht. Es gibt hervorragende Universitäten und ein hoch gelobtes duales Aus-bildungssystem. Allerdings ist die Branche in vielen Teilen der Gesellschaft wenig verankert. Wo liegen die Gründe für die Defizite und was ist zu tun? Um diese beiden Fragen ging es an einem Roundtable an der letzen topsoft.
von Georg Lutz
Luft nach oben
Die letzte topsoft packte ein hei-sses Eisen an. «Politik und IT in der Schweiz» war der Titel eines span-nend besetzten Roundtables in Bern.
Folgende Kernfragen standen auf der Agenda: Stimmen in der Schweiz die politischen Rah-
menbedingungen für «swiss made software»? Wie muss sich der Staat als Auftraggeber ver-halten? Was tut die Politik gegen den Ressour-cenmangel und dessen Auswirkungen auf den ICT-Standort Schweiz? Wo steht die Informatik als Schulfach?
Es fehlt an allen Ecken und KantenBeginnen wir mit den Ausbildungsdefiziten. Ohne Frage sind die Vorteile des dualen Bil-dungssystems offensichtlich. Die Struktur der praktischen Ausbildung einerseits und der wissenschaftlichen Qualifikation andrerseits haben sich bewährt. Aber wenn die Menschen fehlen, die das Konzept mit Leben ausfüllen können, nutzt die beste Struktur nichts. Das be-ginnt schon bei den ganz Kleinen. Jüngere Ge-nerationen haben zwar viele Kompetenzen was Computerspiele und Social Media-Kommunika-tion betrifft. Informatik an Schulen fristet aber weiter nur ein Mauerblümchendasein. Viele

7KMU LIFE · 05/2011
XXXXXXXXXXXXX
Lehrerinnen und Lehrer sind sich dieser Defizi-te gar nicht bewusst. Auch aus diesem Grund fehlen in den nächsten Jahren in der Schweiz 32’000 ITC-Arbeitskräfte. «Es fehlen uns Fach-leute in der Informatik. Ich habe drei bis vier Damen in meinen Seminaren bei gleichzeitig 30 männlichen Teilnehmenden», konstatierte die Moderatorin Prof. Martina Dalla Veccia, Dozentin für E-Business und Online Marketing an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Das Bild vom Informatiker ist immer noch von den pubertierenden blassen IT-Freaks geprägt, die nachts mit einer Pizzaschachtel den Bildschirm anglotzen.
Eigene Hausaufgaben machenEs gibt aber auch ein Manko in den Teppiche-tagen. Immer noch stellen viel zu wenige Un-ternehmensverantwortliche in der ICT-Bran-che Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die Schlussfolgerung von Beat Bussmann (CEO Opacc Software AG) ist daher folgerichtig: «Es liegt an der Branche selber, ihre Hausauf-gaben zu machen.»
Dabei geht es «nicht nur um Quantität, son-dern auch um Qualität», wie Dr. Matthias Stürmer (Senior Advisor Ernst & Young und Geschäftsführer der parlamentarischen Grup-pe «Digitale Nachhaltigkeit») betonte. Die zu-kunftsweisenden Arbeitsplätze bei Google sind für ihn ein positives Beispiel. Die Abwicklung der Entwicklungssparte von Microsoft sieht er demgegenüber als negatives Beispiel.
Wenig Präsenz in BernDie Frage nach den Aktivitäten der Dach- und Fachverbände stellt sich nicht nur an diesem Punkt. Luc Haldimann ist Initiant von swiss made software. Die Interessensvertretung der Branche, die auch ein Label ist, hat gerade ein Buch veröffentlicht (siehe Infobox). Ziel ist es, «die Branche sichtbar zu machen». Das ist auch dringend notwenig. Im Parlament ist die Bran-che erschreckend unterrepräsentiert.
Die rhetorisch beste Figur lieferte Kathy Riklin (Nationalrätin der CVP). Für sie ist «die Schweiz ein Agrarland». Zunächst erntete sie ungläubi-
ges Staunen aus dem Publikum und vom rest-lichen Panel. Schnell wurde aber klar, was sie damit meinte. Die Lobbyarbeit der Branche ist im Vergleich zur Agrar- oder Pharmabran-che unterirdisch schlecht in Bern präsent. Eine Handvoll Räte hat sich das Thema auf die Fah-nen geschrieben. Auch eine kleine Umfrage an der topsoft bestätigt das schwache Standing im Parlament. Den meisten fällt gerade noch Ruedi Noser, der umtriebige FDP-Politiker ein. Da ist noch viel Luft nach oben.
Fehlende transparente AusschreibungenEin Unterpunkt betrifft die Ausschreibungen der öffentlichen Hand.Hier bezog das Panel überraschend klare Positionen. Zunächst stell-te Dr. Matthias Stürmer fest, dass «Software immer Abhängigkeiten schafft, egal wie man sich entscheidet». Für die Verbands- und Unter-nehmensvertreter stehen beim Thema öffentli-che Hand weniger die Subventionen, sondern die möglichen Aufträge im Vordergrund. Die-se müssen nach Matthias Stürmer aber offen und transparent ausgeschrieben werden.
Die Branche hat in der Politik in Bern einen schweren Stand.

8 KMU LIFE · 05/2011
DAS THEMA
«swiss made software das Buch 2011» Das grundlegende Buch zur ICT-Branche bietet einen Überblick über die wichtigsten Player der Schweizer Softwareindustrie und stellt deren Ziele, Strategien und Lösungen vor. Dabei werden folgende Themenansätze verfolgt:
• Facts,FiguresandTrends zu swiss made software• Who is who: Exponenten der Schweizer
Softwareindustrie über ihre Strategien, Lö-sungskonzepte und Erfolgsaussichten
• Nachwuchsförderung–DasICT-BerufsbildimWandel–WelchesSkillsetbrauchtderSchweizer Softwarewerkplatz?
• Public:DerStandderDingeinder öffentlichen Ausschreibung• AgileDevelopment:DieSchweizunddie Zukunft der Softwareentwicklung• WolkenamHorizont:Chancen,Risikenund
Nebenwirkung des Cloud Computings für die Schweizer Softwareindustrie
• Innovation:Zukunftsweisendes BPM aus der Schweiz• Trends:WastutsichamSchweizerMarkt?• Showcases:KonkreteBeispiele aktueller Entwicklungen
swissmadesoftware–dasbuchvol.1240 SeitenISBN: 978-3-9523372-2-6CHF 69
«Ausschreibungen finden nicht oder nur unzu-reichend statt». Das ist aus seiner Sicht ein kla-rer Verstoss gegen die WTO-Richtlinien, die die Schweiz ja auch unterschrieben hat. Ergänzend betonte Beat Bussmann dann: «Die öffentliche Hand soll ihre Ausgaben strukturieren». Gerne hätte man als Zuschauer auch die Position von Microsoft, die sich ja schon einige juristische Auseinandersetzungen mit der parlamentari-schen Gruppe «Digitale Nachhaltigkeit» gelie-fert haben, gehört.
Auf jeden Fall sind auch hier die Defizite in Bern sehr deutlich sichtbar. Die Fach- und Dachver-bände müssen dazu mehr tun, als ein Buch zu publizieren.
Kernforderung des PanelsEs blieb Marius Redli (Nationalratskandidat der FDP und früherer Direktor des Bundesamtes für Informatik und Telekommunikation) über-lassen, die übereinstimmende Forderung des Tages zu präsentieren: «Aufträge der öffentli-chen Hand sollen nur an die Firmen vergeben werden, die auch Ausbildungsplätze schaffen.»
Damit wurden die beiden zentralen Themen des Panels in einer Forderung zusammenge-führt. Es gibt aber noch viel zu tun. Wir vom KMU LIFE werden publizistisch am Ball bleiben.
Fehlendes Thema: FinanzenEin zentrales Thema wurde leider am Panel «Politik und IT in der Schweiz» nicht angespro-chen. Das betrifft die Finanzen. Durch sie erklä-ren sich auch die Unterschiede, die beim durch die Medien geisternden Vergleich zwischen der Schweiz und dem Silicon Valley, gezogen werden. In den USA gibt es Risikokapital, wel-ches spektakuläre Produktentwicklungen erst ermöglicht.
In der Schweiz hat man es oft mit Spin-offs von Universitäten und Grossunternehmen zu tun, die sehr vorsichtig agieren müssen. Ein Produkt kann hier nur sehr langsam wachsen. Dies ist ein zentraler Grund, warum ein neues Face-book hier nicht entstehen kann. Ein weiterer betrifft die unternehmerische Persönlichkeiten. Ohne mehr Risikokapital können sich auch kei-ne Persönlichkeiten mit Visionen durchsetzen.
Die Branche in der Diskussion an der topsoft: Luc Haldimann, Beat Bussmann, Jörg Aebischer, Marius Redli, Kathy Riklin und Dr. Matthias Stürmer (vlnr).
Georg Lutz ist Chefredaktor von KMU LIFE.
www.swissmadesoftware.orgwww.topsoft.ch
Weitere Informationen

Ihr CRM und ERP Partner
Wir lassen Sie nicht im Regen stehen
www.km-u.ch
Als Schweizer KMU kennen wir die Anforderungen an CRM- und ERP-Lösungen aus erster Hand. Deswegen umfasst unser Portfolio nicht nur von uns getestete Softwarelösungen. Vielmehr bieten wir ein ganzheitliches Dienstleistungsangebot und betreuen Sie kompetent rund um Ihr CRM und ERP.
Wertschöpfung, Zukunftssicherheit, Qualität, Kompetenz
Für jedes Schweizer Unternehmen die passende Lösung
Für Ihre Finanz- und Lohnbuchhaltung
Massgeschneidert für Handels- und
Produktionsbetriebe
CRM und ERP für Dienstleister
Inserat_KMU_CRMEPR.indd 1 12.10.2011 16:14:48

10 KMU LIFE · 05/2011
wandLungen in der iCt-MesseLandsChaft
Die topsoft ist bisher eine klar fokussierte Softwaremesse. Inzwischen gibt es aber neue Themen, wie Social Media-Kommunikation, die mit an Bord geholt werden und mit der Aufgabe der klassischen ICT-Messe aiciti ergeben sich neue Spielräume. Zudem wird der Sprung über den Röstigraben gewagt. Das sind genug Gründe für ein Interview.
Interview mit Cyrill Schmid von Georg Lutz
Aufbruch zu neuen Ufern
Ihr aktuelles Logo zur topsoft zieren drei Rüebli. Auf den ersten Blick seh-en diese identisch aus. Was ist denn bei Software heute identisch?
Kunden haben heute bei verschiedenen An-geboten von Businesssoftware das Gefühl, sehr ähnliche Produkte vor sich zu haben. Das schlägt sich auch hier an der Messe, wie auch in sehr ähnlichen Verkaufsargumenten nieder.
Es geht um flexible Lösungen, um Produkte, die skalierbar sind …
… genau. In der Realität, wenn man genauer hinsieht sind die Rüebli sehr unterschiedlich. Sie sind gekocht, geschmort oder roh.
Was heisst das für die Software?
Für mich als Kunde muss die Software passen. Das ist das wichtigste Kriterium. Sie muss mei-ne Prozesse und Mitarbeitenden unterstützen.
Heute gibt es auf dem Markt keine technisch schlechte Software mehr. Diese Art von Anbie-ter ist verschwunden. Aber es gibt passende und weniger passende Lösungen. Es kann bei-spielsweise sein, dass eine neue Software mit bestehenden Applikationen, die wichtig sind, nicht kommunizieren kann. Das ist dann fatal. Das Projekt muss richtig aufgesetzt werden. Es gilt, alle Prozesse anzuschauen und dann die richtige Lösung zu finden.
Wo liegen denn die neuen Trends? Ich sehe hier einen Social Media-Park. Das gab es vor zwei Jahren noch nicht.
Ja, das ist tatsächlich neu. Die Messe bewegt sich langsam in die Richtung, ICT umfassender abzubilden. Der Fokus unserer Kernkompe-tenz liegt aber weiter auf Businesssoftware, aber es gibt zunehmend Themen, die wir heute und morgen integrieren müssen. Die IT-Freaks tun dies auch. Geschäftsführer ge-
hen demgegenüber mit dem Thema Facebook oder Twitter meist sehr kritisch um. Die Frage lautet: Was nützt mir das? Diese wollen wir hier sehr praktisch beantworten. Wir stellen im Social Media-Park nur Projekte vor, die auch funktionieren.
Themenwechsel: Wie viele andere Messeveranstalter setzen Sie auf ein inhaltliches Begleitprogramm? So gab es ein Panel zum Thema Politik und ICT-Branche. Da zeichnet sich ja nicht gerade ein erfreuliches Bild ab. Es fehlen Ausbildungsplätze und Fachkräfte. Auch die Lobbyarbeit in Bern hat noch viel Luft nach oben. Sehen Sie das auch so?
Tatsächlich. Die Kernthese von Frau Kathy Riklin (Nationalrätin der CVP) «Die Schweiz ist politisch noch ein Agrarland», hat die Situation auf den Punkt gebracht …
Damit meint Sie, dass die Bauern eine wirkungsmächtigere Vertretung in Bern haben als die ICT-Branche?
Wenn man sich anschaut, was die ICT-Branche alles leistet, dann schlagen wir uns in Bern weit unter Preis.
DAS THEMA

Die besten Stellenangebote der Schweiz und direkte Verbindungen zu Ihrem
Netzwerk auf XING. Jetzt auf Topjobs. Das neue Portal für Fach- und Führungskräfte.
Treffen Sie sich jetzt auf topjobs.ch
Klick. Neue Arbeitskollegen.
31300205 D_KOL_178x120.indd 1 03-10-11 14:15
Jetzt gibt es doch Dach- und Fachver-bände. Warum passiert da zu wenig?
Fragen Sie das bitte die Verbände selbst. Ohne Frage, die Entwicklung einer besseren Stoss-kraft gestaltet sich sehr schwer. Wir haben das selbst bei dem Versuch erlebt, die Messeland-schaft in unserer Branche zu konsolidieren. Die Branche selbst muss mehr in einer Sprache re-den, damit die Konturen viel schärfer werden. Man darf nicht nur delegieren. Auch wir haben noch einige Hausaufgaben zu lösen.
Sie sprechen damit auch die Koope-ration mit der aiciti in Zürich im letz-ten Jahr an. Die aiciti, die frühere Orbit, hat das Handtuch geworfen. Die topsoft ist aber im nächsten Mai wieder in Zürich. Können Sie einige der Aufgaben der klassischen ICT-Messe schultern? Wir waren bereits in den Räumlichkeiten der Messe Schweiz, welche uns auch weiterhin als
Gastausstellung willkommen heisst. Wir kön-nen unsere Aufgaben weiterhin schultern und haben zudem aus der letzten Durchführung in Zürich einiges gelernt, was wir als graduelle Verbesserungen einfliessen lassen werden.
Die Messe in Oerlikon dürfte auch finanziell in einer anderen Liga spie-len. Wie wollen Sie diese Hürde, im Hinblick auf Ihre Kunden angehen?
Da wird sich voraussichtlich nichts ändern. Mit unserem Standkonzept und dem fachlichen In-put können wir ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.
Zudem springen Sie jetzt auch noch über den Röstigraben. Das sind ja zwei unterschiedliche Welten. Wie wollen Sie die unterschiedlichen Ge-schäftskulturen beheben?
Wir wollen und können nichts an grundlegen-den Strukturen verändern. Wichtig ist auch an www.topsoft.ch
Cyrill Schmid ist geschäftsführender Partner der Schmid+Siegenthaler Consulting GmbH und unterstützt Unternehmen bei der Evaluation und Einführung von Businesssoft-warelösungen.
Weitere Informationen
diesem Punkt, den richtigen Partner vor Ort zu haben. Wir pflegen eine sehr gute Partnerschaft mit E-Com. Die dortigen Verantwortlichen ha-ben Erfahrungen mit IT-Kongressen. Das wird eine gute Symbiose geben. Wir selbst haben Mitarbeitende die aus der Romandie kommen. Ich selbst werde mich da sehr zurückhalten.
DAS THEMA

12 KMU LIFE · 05/2011
stoLPersteine bei einer neuen software
Neue ERP-Lösungen sind ein komplexer Prozess, der das Unternehmen auf den Kopf und gerade KMU auch vor immense organisatorische und finan-zielle Hürden stellt. Im folgenden Interview beleuchten wir die strategi-schen Stolpersteine.
Interview mit Michael Mors von Georg Lutz
Den richtigen Weg wählen
Auf Messen oder bei Verkaufsgesprä-chen habe ich oft den Eindruck, es geht beim Thema ERP nur um die beeindru-ckenden technischen Funktionalitäten. Um was geht es noch, um für KMU spannende Lösungen zu finden?
Inzwischen können die Basisfunktionalitäten von fast allen Anbietern in vollem Umfang bereitgestellt werden. Das Rückrat von ERP-Lösungen steht.
Da stehen wir auf der sicheren Seite?
Ja, jetzt kommen wir in den Bereich der Opti-mierung. Unser Ansatz richtet sich auf passen-de Lösungen. Dabei gilt es, die Kosten immer
im Auge zu haben. Bei Grossprojekten, und das ist eine ERP-Lösung ohne Frage, laufen diese gerne aus dem Ruder. Nicht mehr viele gut klin-gende Funktionalitäten, sondern Effizienz ist das aktuelle Thema. Das passt auch zum Trend des mündigen Kunden.
Allerdings gibt es beim Kaufprozess viele Hürden. Der Anbietermarkt ist sehr unübersichtlich und KMU-Ver-antwortliche bekommen oft grosse ERP-Päckchen über den Tresen ge-schoben, die Module enthalten, die sie vielleicht gar nicht brauchen oder auf die sie nicht vorbereitet sind. In der Schweiz, so bestätigen es einige Studien, sind viele der Unterneh-
menskunden mit ihrer Lösung nicht zufrieden. Kann man das in Deutsch-land ebenfalls beobachten?
Deutsche Unternehmen sind mit ihrer Lösung durchschnittlich zufrieden. Aber das kann immer noch besser werden. Sie haben Recht, es gibt für KMU Hürden bei der Auswahl. Wichtig ist zu-nächst, dass KMU-Verantwortliche den richtigen Partner oder Anbieter finden, der ihre Sprache spricht und auch die Branche kennt. Manchmal macht es auch Sinn, einen externen Berater ein-zuschalten. Es braucht den scharfen Blick, um zu passenden Lösungen zu kommen. Noch vor fünf Jahren wurden die von Ihnen erwähnten Päck-chen über den Tresen geschoben. Heute ist dies bei seriösen Anbietern nicht mehr der Fall.
Eine neue Lösung stellt aus meiner Sicht die ganzen Unternehmensab-läufe auf den Kopf. Von welchen Di-mensionen reden wir hier?
Der laufende Betrieb wird im Rahmen eines KMU im oberen Bereich mit USD 1.2 Millionen belastet. Das sind auf jeden Fall signifikante Be-träge. Wir versuchen aber, immer deutlich unter dem Durchschnitt zu liegen, ohne an Qualität zu verlieren. Es gibt unabhängige Studien, die uns den Faktor 3.5 nach unten gegenüber den üblichen grossen Anbietern zubilligen. Ich bin auf jeden Fall ein Verfechter integrierter Lösun-gen. Am Ende sollten nicht viele Schnittstellen, sondern eine passende integrierte Lösung ste-hen. Es geht dabei nicht nur um die Erstimple-mentierung, sondern die optimale Bewältigung des laufenden Betriebs ist häufig die zentrale Herausforderung. Oft wird leider noch zu viel auf die initialen Anforderungen geschaut und zu wenig auf den laufenden Betrieb. Gerade bei Strukturveränderung sind oftmals kosten-intensive Nachbesserungen notwendig. Nicht bei UNIT4.
Der Weg zu einer passenden ERP-Lösung ist kurvig, sollte aber klare Leitplanken haben.
DAS THEMA

Jetzt haben aber kleine Unternehmen oft kaum Know-how, um hier erfolgreich Kontroll- und Fragepositionen aufzubauen. Sie müssen ihrem Anbieter vertrauen. Das ist taktisch nicht gerade eine günstige Position ...
Wie gesagt, ist das Einschalten eines externen Beraters ein probates Mittel. Dies in Kombination mit einer passenden Referenzliste aus der Branche ist eine hilfreiche Entscheidungsleitplanke.
Geht der Trend in eher spezialisierte Branchenlösungen oder baut man auf integrierte Grundmodule auf, die aus-gebaut werden können?
Die Frage Module oder Branche stellt sich für uns nicht in dieser Alterna-tive. Der Trend geht in die Richtung «Best Practice-Lösungen», die ver-gleichbares Branchen-Know-how beinhalten. Auf dieser Basis wird dann spezifisch aufgebaut. Bei Null fängt heute kein Anbieter mehr an. Früher haben das grosse Anbieter gemacht, da sie sehr individuelle Anforderun-
gen zu bewältigen hatten. Unsere Faustregel bei KMU lautet: 80 Prozent der Anforderungen werden durch Best Practice-Lösungen abgedeckt. Nur 20 Prozent kommen individuell dazu, wobei ein Standardrahmen im-mer im Vorfeld definiert werden muss.
Ihr Haus hat sich auch auf kommunale Bedürfnisse spezi-alisiert. Wo liegen die Unterschiede im Vergleich zu Un-ternehmenslösungen?
Es ist richtig, wir haben im öffentlichen Sektor ein starkes Standbein. In Skandinavien sind wir der grösste Anbieter in diesem Bereich. In Europa sind wir die Nummer drei im öffentlichen Sektor.
Lassen Sie mich raten, davor steht sicher SAP …
SAP steht auf dem Treppchen ganz oben.
Können von diesen Erfahrungen auch Unternehmen profitieren?
Ich würde eher die umgekehrte These vertreten. Die öffentliche Hand profitiert von unseren Erfahrungen in Unternehmen. Unternehmen sind auch in der Frage, wie sie ERP leben, meist weiter entwickelt als die öf-
Wir wissen, wie man in Asien Türen öffnet: mit Höflichkeit.Wer die besten Routen kennt, mit den zuverlässigsten Partnern
arbeitet und weiss, wie man neben offiziellen auch kulturelle
Hürden meistert, hat überall gute Karten. Gondrand ist weltweit
zu Hause und sorgt vor Ort persönlich dafür, dass Ihr Transportgut
stets in besten Händen ist und an jedem Ort pünktlich ankommt.
www.gondrand-logistics.com
Personally worldwide.
GD_CH.KMUlife.US/AS/WE/OE.indd 2 25.3.2010 16:13:55 Uhr
«es brauCht den sCharfen bLiCk,
uM zu Passenden Lösungen zu koMMen.»
fentliche Verwaltung. Die Rechnungslegung der öffentlichen Hand orien-tiert sich immer stärker an betriebswirtschaftlichen Konzepten aus der Privatwirtschaft. Auch weitere Themen, wie DV-gestützte Personalver-waltung, werden stärker integriert.
Wie ist Ihr Haus auf dem Schweizer Markt präsent?
Unser Fokus liegt heute noch auf dem deutschen Markt. Wir sind auf dem Schweizer Markt mit über 30 Kunden vertreten. Aber das wollen wir ausbauen. Wir planen eine direkte Präsenz in 2012.
www.unit4agresso.de
Michael Mors ist Geschäftsführer der UNIT4 Agresso GmbH.
Weitere Informationen
DAS THEMA

14 KMU LIFE · 05/2011
Passende erP-Lösungen
Mit einer neuen Unternehmenssoftware soll ein Unternehmen grosse Sprünge in Richtung Effizienz und Prozessbeschleunigung machen. Was ist heute bei der Einführung einer modularen und integrierten Businesssoftware zu beach-ten? Dazu haben wir mit dem CEO von SOLVAXIS ein Interview geführt.
Interview mit Pierre-Alain Schnegg von Georg Lutz
Den richtigen Weg finden
Unternehmensverantwortliche stehen jeden Tag vor der Situation, mit einer Masse von unstrukturierten Daten berieselt zu werden. Was hat man sich demgegenüber unter struktu-rierten Daten vorzustellen?
In unserem Geschäftsalltag verkaufen wir ERP-Lösungen. Ein ERP ermöglicht die Ver-waltung von strukturierten Daten. Diese Da-ten beschreiben geschäftliche Transaktionen, welche aus rechtlichen Gründen und im Sinne der Nachvollziehbarkeit langfristig aufbewahrt werden müssen. Sie müssen also genau wis-
sen, was, von wem, wie verwaltet werden soll und was, wo gespeichert werden muss.
Das eine kommt in strukturierte Ka-näle und das andere in den Papier-korb. Ist dieses Bild richtig?
Nein, es geht nicht nur um den Weg, sondern auch um den Inhalt. Nehmen Sie beispielsweise eine Rechnung: Die Angaben auf einer Rech-nung sind strukturierte Daten. Hier wissen Sie genau was, wie, wo, zu welchem Preis und mit welchem Rabatt verkauft wurde. Aber wenn es um den Bericht eines Technikers oder eines
Verkäufers geht, den Sie auch langfristig auf-findbar behalten und personell zuordnen wol-len, geht es um Wege, Personen und Inhalte. Genauso wie die Rechnung ist auch der Bericht des Technikers für viele Personen in einem Un-ternehmen wichtig, allerdings setzt sich der Bericht aus strukturierten Daten (Anschrift des Kunden oder Ansprechpartners) und unstruk-turierten Informationen, welche den Besuchs-inhalt wiedergeben, zusammen. Ob und wann Informationen in den Papierkorb wandern, hängt nicht mit deren Struktur zusammen.
Ganz komplex wird es bei dem Jah-resrapport eines Unternehmens ...
Richtig, es enthält sehr viele interessante In-formationen–zumBeispiel füreinenVerkäu-fer. So weit, so einfach. Aber Sie können den Rapport nicht immer gleich strukturieren, denn
DAS THEMA

15KMU LIFE · 05/2011
jedes Jahr gibt es Neuerungen und Verände-rungen. Diese Informationen wollen Sie einer-seits behalten und gleichzeitig finden, sowie schnell darauf zugreifen. Der Zugriff muss sowohl über unstrukturierte als auch struktu-rierte Daten funktionieren. Sie wollen darauf auf dem direkten Weg, über das Stichwort Jahresrapport zugreifen können. Wenn Sie aber über das CRM bei einem Kunden gelan-det sind, wollen Sie über diesen Weg ebenfalls auf die Informationen des Jahresberichts zu-greifen können.
Sie wollen Struktur in unstrukturierte Daten bringen?
Genau. Es wird immer mehr Entwicklungsar-beit in das Erfassen und Wiederfinden von un-strukturierten Daten gesteckt. Das bekannteste Beispiel dafür sind sicher die Suchmaschinen. Es geht dabei inzwischen nicht mehr nur um einzelne Wörter, sondern schon um komplexe Sachverhalte.
Welche strategische Vorgehensweise kommt bei diesem umfassenden An-satz und Anspruch zum Zug?
Die Grundlage bei vielen Kunden ist meistens eine bestehende ERP-Lösung. Damit sollten die strukturierten Daten strukturiert verwal-tet werden können. Der Kunde hat bereits während des Vorbereitungs- oder Implemen-tierungsprozesses bemerkt, dass es viele unstrukturierte Daten zu verwalten gilt. Zu-sammen mit dem Kunden erarbeiten wir die Anforderungen und mögliche Lösungsszena-rien. Entweder können wir die ERP-Lösung mit den bestehenden Applikationen verbin-den, oder wir verwenden ergänzende, oder gar komplett neue Lösungen. Dabei gehen wir Schritt für Schritt vor und prüfen immer, ob der Weg auch den Bedürfnissen des Kunden entspricht.
…Worum geht es hier?
Um Bilder, Webseiten und E-Mails: Dann kann eine Lösung wie V-Doc verwendet wer-den. Wenn es hingegen um eine reine Da-tenorganisation geht, sprich Struktur in un-strukturierte Informationen zu bringen und allenfalls mit dem ERP-System zu verbinden, dann kann eine Lösung wie Docuware inter-essant sein.
In der Realität lässt sich diese scharfe Trennung allerdings nur selten beobachten.
Sie brauchen hier doch einige Kom-petenzen vor Ort. Es geht nicht nur um IT-Qualitäten, sondern auch um HR-Kenntnisse und juristische Kom-petenzen. Liege ich da richtig?
Das ist richtig. Sowohl Technologie- als auch Branchen- und Fachkompetenz müssen vor Ort abrufbar sein. Denn nicht nur HR und juristi-sche Kompetenzen sind nötig. Strukturierte und unstrukturierte Daten werden in allen Betäti-gungsfeldern einer Unternehmung geschaffen, respektive verwendet. Im Vertrieb, Einkauf, in der Produktion, im Service und in anderen Dienstleis-tungen. Wir bieten den Kunden die Möglichkeit, ihre Anforderungen, Wünsche, Kenntnisse und Fragen mit uns zu besprechen und wir helfen ihnen, die richtigen Produkte und Lösungen zu finden.
Bei dem Implementierungsprozess muss sich der Kunde «nackt» auszie-hen. Da braucht man ein sehr enges Vertrauensverhältnis.
«die Verantwort-LiChen haben jederzeit
den genauen Über-bLiCk Über den
stand der arbeiten.»
DAS THEMA

16 KMU LIFE · 05/2011
Die Vertrauensfrage ist der zentrale Stolper-stein, den die Beteiligten gemeinsam aus dem Weg räumen müssen. Der Kunde bringt sowohl bei einer neuen ERP-Lösung, als auch bei einer Prozess- oder Dokumentenmanagementlösung, seine Daten in ein transparentes System, in das mehr Beteiligte Einblicke haben können als vor der Implementierung. Vertrauen reicht aber nicht aus. Ganz wichtig ist das Verständnis mit dem Kunden. Wer soll wann auf welche Daten Zugriff haben? Wie funktionieren die Prozesse und Abläufe? Welches Verhalten möchte ich än-dern, respektive beibehalten und so weiter.
Diese Fragen müssen wir als Anbieter beant-worten können. Ein KMU-Verantwortlicher kann, im Gegensatz zu einem Grossunterneh-men, nicht für jede Frage einen Spezialisten aufbieten. Da gilt es schon, den richtigen Part-ner zu finden, damit seine Prozesse und seine Verwaltung wirklich effektiver funktionieren.
Neben ERP und CRM steht bei Ihnen ECM im Vordergrund. Was verbirgt sich dahinter?
Eigentlich haben die vorhergehenden Fra-gen alle in Richtung ECM gezielt. ECM ist die Abkürzung für «Enterprise Content Manage-ment». Ziel ist es, damit die verschiedenen di-gitalen Dokumente wie Verträge, Rechnungen, Bilder, E-Mails oder Webseiteninhalte et cetera zu verwalten und mit den strukturierten Daten zu verbinden. Als Bindeglied stehen die Prozes-se und der Workflow.
Sie unternehmen hier wieder den Versuch, zum papierlosen Büro zu kommen.
Es geht tatsächlich in diese Richtung. Lassen Sie mich das an einem Beispiel verdeutlichen: Ein Kunde hat sehr viele Lieferantenrechnun-gen, die in Papierform eintreffen. Die Rech-nungen werden an einer zentralen Stelle sofort gescannt und damit digitalisiert. Die Software erkennt die Informationen, übergibt sie zusam-men mit dem elektronischen Dokument an das ERP und stösst den Prozess der Buchung und Rechnungsfreigabe an. Je nach Prozessdefini-tion, kann die Rechnung automatisch gebucht und zur Zahlung freigegeben werden. Das wäre dann möglich, wenn zur Rechnung eine entsprechende Bestellung vorliegt und die Da-
ten übereinstimmen. Häufig liegt aber keine Bestellung vor, das heisst die Rechnung muss üblicherweise vom Verwender und Leiter der Kostenstelle freigegeben werden Die involvier-ten Personen werden über das System oder per E-Mail zur Freigabe, Korrektur oder Rückwei-sung aufgefordert. Dabei wird eben kein Papier mehr intern weitergegeben, sondern auf rein elektronischer Basis gearbeitet. Abschliessend erfolgt wiederum die Zahlungsfreigabe.
Jede Person, welche über die notwendigen Zu-griffsberechtigungen verfügt, kann diese Rech-nung sehen. Dazu muss nicht mehr in dicken Ordnern geblättert werden. Der Finanzleiter hat zu jedem Zeitpunkt die Übersicht zu den Rechnungen, die bereits eingetroffen, aber noch nicht freigegeben sind. Die Bearbeitungs-zeit von eintreffenden Rechnungen lässt sich somit um 90 Prozent verkürzen.
Was mit Rechnungen möglich ist, kann auch auf Spesenmeldungen, Einsatzrapporte, Ferien und Krankmeldungen sowie Budgetprozesse ausgeweitet werden.
Das hört sich nach dem «just in time»-Prinzip in der industriellen Fertigung und Lagerhaltung an.
Genau. Nehmen Sie ein weiteres Beispiel aus der Personalabteilung: Sie haben eine offene Stelle zu besetzen. Diese Daten sind teilweise strukturiert. Sie ergänzen diese Daten mit der Stellenbeschreibung, Kompetenzen und An-
sprechpartner. Der ganze nachfolgende Pro-zess, wie die Publikation von Inseraten, die E-Mail-Korrespondenz, die Einladung von Kan-didaten bis hin zur Zu- respektive Absage wird automatisch gesteuert. Die Prozesse werden schneller und die Verantwortlichen haben je-derzeit den genauen Überblick über den Stand der Arbeiten.
Wie ist Ihr Unternehmen organisato-risch aufgestellt? Sie haben ja einige Partner.
Ich möchte dafür ein Bild mit drei Kreisen verwenden. Der erste Kreis ist der Kern. Wir nennen das die zentralen Applikationen. Das sind ERP-Applikationen, welche die Finanz, Logistik, Produktion, Löhne et cetera betreffen. Dann gibt es einen zweiten Kreis. Das sind spe-zialisierte Anwendungen. Hier arbeiten wir mit unseren eigenen Anwendungen und mit den Anwendungen von Partnern, die sehr tief inte-griert sind. Der Kunde darf nicht merken, ob er mit unserem Produkt oder mit einem Produkt unseres Partners arbeitet.
Das betrifft dann auch unterschiedliche Branchen.
Genau. In einigen Branchen brauchen Sie zum Beispiel eine sehr detaillierte Feinplanung, in anderen geht das etwas schneller.
Der dritte Kreis betrifft Anwendungen, die auch ohne ERP-Basis laufen können. ECM-Produkte
DAS THEMA

www.solvaxis.com
Pierre-Alain Schnegg ist CEO von SOLVAXIS.
Weitere Informationen
oder Produkte aus dem Bereich der Business Intelligence sind hier Beispiele. Hier verwalten Sie Daten, die sowohl vom ERP generiert wer-den, als auch externe Ursprünge haben. Das sind meist externe Produkte, zu denen wir eine Schnittstelle zur Verfügung stellen.
Ihr Haus ist eines der wenigen Unter-nehmen, das auf beiden Seiten des Röstigrabens arbeitet. Ist das eine spezielle Herausforderung?
Ja, die Welten sind unterschiedlich, aber es gibt Gemeinsamkeiten in Branchen, die wir auf bei-den Seiten finden. Die Erfahrungen einer Seite können wir transferieren und nutzen. Das hilft uns und unseren Kunden. So kommen wir zu Synergien und können beide Märkte und damit mehr Kunden bedienen.
Die Zusammenarbeit mit uns als Software-hersteller während der Lösungsfindung ist regional unterschiedlich. In der deutschspra-chigen Schweiz werden die Projekte oft von Beratungsunternehmen gesteuert. Und zwar von A bis Z. Im Welschland wickeln die Firmen ihre Projekte eher intern und mit dem Partner/Softwarehersteller direkt ab. Die Beratungsun-ternehmen werden nur zu spezifischen Dienst-leistungen zugezogen. Das kann zum Beispiel das Verfassen eines Pflichtenhefts sein. Sobald wir aber ein erstes Projekt mit den Unterneh-men gemacht haben, gelten wir als primärer Ansprechpartner – sowohl in der Deutschen,als auch in der Welschen Schweiz.
Wo liegt aus Ihrer Sicht die zent-rale Herausforderung für die nahe Zukunft?
Der Bedarf, unstrukturierte Daten besser in den Griff zu bekommen, steigt. Für uns ist es wichtig, dass der Kunde von uns alles aus einer Hand bekommen kann. An unserem User Day am 24. November 2011 wollen wir das prak-tisch demonstrieren.
Sie sind herzlich eingeladen.
DAS THEMA
Ihr Partner für wirtschaftlichen Klimaschutz
„Ressourceneffi zienz heisst Kosteneinsparung. Darum arbeiten wir mit dem KMU-Modell.“Marc Wegmüller Geschäftsführer / Wegmüller AG Attikon
KOSTENSPAREN DURCH ENERGIEEFFIZIENZ
das
KMUmodell* 044 404 80 31
www.kmu-modell.ch*SO GEHT DAS KMU-MODELL:
1. VOR-ORT ENERGIE CHECKUP
2. ERARBEITUNG EINES MASSNAHMENKATALOGS
3. ZIELVEREINBARUNG UND MONITORING
4. KLIMASCHUTZLABEL

18 KMU LIFE · 05/2011
Passende CLoud-Lösungen fÜr kLeine unternehMen
Schnell, sicher und ortsungebunden arbeiten: Cloud-Dienstleistungen erhö-hen die Produktivität und senken gleichzeitig die Betriebskosten – eine clevere Lösung, die insbesondere auch KMU bei ihrer täglichen Arbeit entlastet.
von Vanessa Kammermann-Gentile
Willkommen auf Wolke Sieben
www.microsoftbusiness.ch
Vanessa Kammermann-Gentile ist Cloud Marketing Manager bei Microsoft Schweiz
Weitere Informationen
Wer im globalen Markt erfolgreich sein will, muss sich flexibel be-wegen können und innovativ sein. Das setzt hohe Anforde-
rungen an die IT-Infrastruktur. Die Informa-tions- und Kommunikationstechnologie (IKT) unterstützt nahezu alle Geschäftsprozesse und beschleunigt die Verarbeitung von Daten und Informationen. Eine Anpassung in der Ge-schäftstätigkeit stellt meistens auch die IKT vor neue Herausforderungen. Sie muss angepasst werden–unddasschnell,möglichstohneIn-vestitionen und Sockelkosten.
Mehr Sicherheit und GeschwindigkeitCloud Computing bietet inzwischen auch klei-nen und mittelständischen Unternehmen eine echte Alternative, um dynamisches Wachs-tum ohne Investitionen abzufedern. Anstatt Soft- und Hardware selber zu kaufen, werden Ressourcen nach Bedarf flexibel bezogen. Die Abrechnung erfolgt monatlich auf der Basis der tatsächlich beanspruchten Dienstleistungen und Kapazitäten. Benutzer erhalten so immer die passenden Werkzeuge für ihre Arbeit und Unternehmen bezahlen nur für Ressourcen, die sie auch tatsächlich beanspruchen. Der Cloud-Anbieter übernimmt die Infrastrukturwartung. Gleichzeitig ist er auch als Spezialist für die
Datensicherheit sowie die Einhaltung der be-triebsinternen Standards verantwortlich und hält die Infrastruktur mit laufenden Updates in Schuss. Cloud-Dienstleistungen entlasten den eigenen IT-Support und helfen, sowohl Be-triebs- wie auch Unterhaltskosten deutlich zu reduzieren. Unternehmen erhalten mit Cloud Computing insgesamt mehr Freiraum, um ihre Kernkompetenz und Innovationskraft schnell und gewinnbringend im Markt umzusetzen.
Arbeiten immer und überallDie Cloud-Dienstleistungen von Microsoft sind so ausgelegt, dass Mitarbeitende jederzeit und ortsungebunden auf Office-Anwendungen und Daten zugreifen können. Die E-Mail-Korres-pondenz erfolgt über den Internetbrowser, wo auch Kalenderfunktionen und Kontaktangaben zur Verfügung stehen. Die Funktionen sind unabhängig vom Betriebssystem über mobile Geräte einsetzbar und man hat so wichtige Dokumente und Informationen durchgehend zur Hand. Unternehmen entscheiden aufgrund ihrer Anforderungen, ob sie eine komplette Of-fice- und Office-Web-Applikationslösung brau-chen, oder ob sie sich am Anfang auf einzelne Anwendungen konzentrieren. Punktuelle oder umfassende Ergänzungen sind jederzeit frei skalierbar möglich.
Microsoft Office 365 ist eine Komplettlösung für Selbständigerwerbende und KMU, da sie tagesaktuell den Anforderungen anpasst werden kann. Im Zusammenspiel mit Sprach-, Video- und SharePoint-Technologien können sich Mitarbeitende jederzeit dezentral und unternehmensübergreifend austauschen. Und das alles in der Cloud, wo sie mit minimalen Investitionen maximale Geschwindigkeit und Sicherheit erhalten.
«Sicherheit, Flexibilität, Mobilität: Cloud Computing eröffnet KMU neue Möglichkei-ten für ihre IT-Infrastruktur. Microsoft Cloud Produkte sind in der Benutzung vertraut und bewährt, und die Kosten vertragen sich mit KMU-Budgets. Deshalb sind sie für un-sere Kunden die erste Wahl.»
Hansruedi Knaus Geschäftsleiter itConcept AG
DAS THEMA

19KMU LIFE · 05/2011
daten zur riChtigen zeit korrekt anaLysieren
ERP-Lösungen werden meist über viele Jahre eingesetzt, um die Geschäfts-prozesse softwaretechnisch zu unterstützen. Ändern sich Abläufe im Unter-nehmen oder gibt es sonstige betriebliche Veränderungen, entstehen neue Anforderungen an diese Unterstützung und damit Schwachstellen bezie-hungsweise Optimierungspotentiale. Die Frage, wo diese Potentiale genau liegen, lässt sich allerdings häufig nicht ohne weiteres beantworten. Hier schafft eine strukturierte Analyse, ein sogenannter ERP Audit, Abhilfe.
von Christoph Richard
ERP Audit
Eine solcher Audit, oder besser gesagt eine solche «Potential»-Analyse, macht bereits nach wenigen Jahren Echtbetrieb des ERP-Systems Sinn.
Die Veränderungen innerhalb des Unterneh-mens beschleunigen sich immer weiter und die IT muss dieser rasanten Entwicklung fol-gen. Dabei entstehen unweigerlich Lücken. Oft spüren die ERP-User diese Schwachstel-len tagtäglich und formulieren auch ihren Unmut. Diese vereinzelten Hinweise sind jedoch nicht als qualifizierte Grundlage für Entscheidungen und Massnahmen, welche schlussendlich immer auch Investitionen be-deuten, geeignet. Es drängt sich somit eine strukturierte Analyse auf, sei es, um Potenti-ale innerhalb des bestehenden ERP Systems aufzuzeigen, oder die Stossrichtungen und Grundlagen für eine Ablösung und Neueva-luation zu erhalten.
Analysieren und Fragen stellenDie strukturierte Ist-Analyse muss dabei alle Aspekte der IT-Unterstützung abdecken.
Wichtige Themen sind:• Das erste Sichtwort heisst Prozessunterstüt-
zung: Werden die Geschäftsprozesse lückenlos unterstützt? Gibt es funktionale Lücken? Wer-den solche Lücken mit Hilfsmitteln geschlossen (typischerweise MS-Excel oder Access)?
• DiezweiteHürdeistdieDatenqualität:Wiegut ist die Datenqualität? Gibt es redundan-te und/oder inkonsistente Daten?
• Leider wird oft der Support vernachlässigt:Nimmt der Support alle erforderlichen Auf-gaben wahr? Kann angemessen schnell auf Störungen reagiert werden?
• ZentralerBaustein istdesWeiterendieAn-wenderzufriedenheit: Können die Anwender ihr Tagesgeschäft effizient mit IT-Mitteln er-ledigen? Sind die Anwender mit den verfüg-baren Lösungen zufrieden?
• NichtvergessendarfmandasBerichtswesen:Erhält der Anwender alle für seine Entschei-dungen relevanten Informationen auf Knopf-druck oder herrscht der Excel-Dschungel?
• UndlastbutnotleastgehtesumdenSchu-lungsstand: Wie schätzen die Mitarbeiter ihr Know-how bezüglich der IT-Lösung ein? Wo gibt es Lücken beziehungsweise Nachholbe-darf in der Schulung von ERP-Funktionen?
Optimale Ausgangslage herstellenUm diese Themen auszuleuchten, kann ein Fragenkatalog erarbeitet werden, der alle rele-vanten Aspekte berücksichtigt und an die in-dividuellen Strukturen und Prozesse des Unter-nehmens angepasst ist. Anschliessend werden diese Fragen durch die betroffenen Mitarbei-tenden beantwortet und gleichzeitig systema-tisch Verbesserungspotentiale erfasst. Diese qualitativen Ergebnisse können schliesslich ge-wissen quantitativen, statistischen Daten aus dem ERP-System (Aufwand je nach System sehr unterschiedlich) gegenübergestellt und so verifiziert werden. Dieses Gesamtbild stellt eine optimale Ausgangslage zur Planung und Umsetzung von geeigneten Verbesserungs-massnahmen dar.
Für eine systematische, effiziente Erstanalyse steht zum Beispiel das kostenpflichtige Online Werkzeug (IT-Matchmaker ERP Audit) der Fir-ma Trovarit, einem Partner der 2BCS AG, zur Verfügung. Das Resultat dieser Analyse zeigt auf, wo Handlungsbedarf besteht und wo die Prioritäten aus Organisations- und IT-Sicht zu setzen sind.
www.2bcs.chwww.it-matchmaker.ch
Christoph Richard ist Senior Consultant bei der 2BCS AG.
Weitere Informationen
DAS THEMA

20 KMU LIFE · 05/2011
DOKUMENTENMANAGEMENT
eLektronisChe zertifikate und digitaLe signaturen
Ob wir es wollen, oder nicht – die elektronische Welt bestimmt schon längst den kaufmännischen KMU-Geschäftsalltag. Rechnungen werden nicht mehr in Papierform ausgetauscht, Verträge einfach noch als Word- oder PDF-Dokument hin und her gesendet und wichtige geschäftliche Ab-machungen per E-Mail bestätigt. Das geht schnell, kann aber juristische Folgen haben. Die rechtliche Seite, genauer sichere und gesetzeskonforme Anwendungen und Lösungen im elektronischen Geschäftsumfeld sind The-ma des folgenden Beitrags.
von Carl Rosenast
Die nützlichen Helfer im Geschäftsalltag
Unsere ICT-Welt bietet viele Annehm-lichkeiten und macht unsere Ge-schäftswelten effizienter. Es lauern aber auch Fallstricke. Was ist, wenn
die MWST- oder AHV-Revision elektronische Belege und Abläufe abfragt, oder der Ge-schäftspartner auf einmal nichts mehr von ei-nerbestimmtenE-Mailwissenwill–odernochgravierender: Mit einer fast identischen E-Mail
mit verändertem Inhalt aufwartet? Dann ist es meistens zu spät, sich über sichere und geset-zeskonforme Anwendungen und Lösungen im elektronischen Geschäftsumfeld Gedanken zu machen. Das muss nicht so sein.
Rechtsgültige UnterschriftenInzwischen sind digitale Signaturen im elektro-nischen Geschäftsumfeld kaum mehr wegzu-
denken. Erst mit dem Einsatz der digitalen Sig-natur werden elektronische Geschäftsprozesse bindend, vertrauenswürdig, nachvollziehbar und damit auch beweisfähig. Elektronische Zer-tifikate, mit deren Hilfe eine digitale Signatur entsteht, sorgen im kaufmännischen Alltag für die notwendige Gesetzeskonformität und Si-cherheit. Ein digital signiertes Dokument weist die Identität des Informationserzeugers klar und nachvollziehbar aus, sichert die Integrität des Dokumentinhalts (Dokument kann nicht mehr nachträglich verändert werden, ohne dass die Signatur gebrochen wird) und die digitale Sig-natur kann erst noch zur vertraulichen Übermitt-lung (Verschlüsselung) benützt werden. Zudem – und nicht ganz unwichtig – hat ein elektro-nisch unterzeichnetes Dokument die gleiche Beweiskraft wie ein auf Papier unterzeichnetes Dokument (Art. 957 ff OR).

21KMU LIFE · 05/2011
DOKUMENTENMANAGEMENT
Aufbewahrung von elektronischen DokumentenDer Gesetzgeber hat sich schon vor Jahren mit der digitalen Signatur beschäftigt und diese weltweit anerkannte Technologie in die Ge-setze und Verordnungen einfliessen lassen. Im Jahr 2003 wurde die Basis dazu gelegt, indem im Obligationenrecht die elektronische Un-terschrift der Handunterschrift gleichgestellt wurde. Das Schweizerische Signaturengesetz (ZertES) und dessen Verordnungen regeln die Ausgabe der elektronischen Zertifikate und legen die strengen Auflagen und Verantwort-lichkeiten für die Zertifikatsherausgeber fest. KPMG überprüft im Namen der Schweizeri-schen Akkreditierungsstelle SAS im jährlichen Zyklus die Einhaltung dieser Richtlinien bei den vier anerkannten Zertifikatsanbietern (Swiss-com, QuoVadis, SwissSign und Bundesamt für Informationen BIT). 1)
Auf Basis der aktuellen gesetzlichen Grundla-gen, der seit Jahren vorhandenen Technologie und dem bestehenden Lösungsangebot, nüt-zen Unternehmen die Fähigkeiten der elektro-nischen Zertifikate und der digitalen Signatur. Dabei stehen die nachfolgenden Anwendun-gen im Vordergrund.
Rechtsgültiges Unterschreiben von elektroni-schenDokumenten–genausoverbindlichwievon Hand. Unterschriften dienen dazu, Doku-
mente einer ganz bestimmten Person zuzuord-nen und diese damit gleichzeitig rechtsgültig zu unterzeichnen. Dies ist bei der elektronischen Signatur nicht anders. Schliesst eine natürliche Person Geschäfte elektronisch verbindlich ab, muss sich der andere Vertragspartner darauf verlassen können, dass die richtige Person unterzeichnet hat (Authentizität) und dass die Daten nach der Unterzeichnung nicht mehr verändert worden sind (Integrität). Dies stellt das auf eine Person ausgestellte elektronische Zertifikat sicher. Zeiteinsparungen, Wegfall des Postwegs, Übermittlung unabhängig von Ort und Zeit und natürlich die Vereinfachung der Prozesse sind die nützlichen Folgen dieser Anwendung für Unternehmen oder auch Pri-vatpersonen.
Der elektronische Identitätsnachweis Sichere und verlässliche elektronische Identi-täten sind wichtige Voraussetzungen für den rechtsgültigen elektronischen Geschäftsver-kehr zwischen Unternehmen, Behörden, Kun-den, Mitarbeitenden und Bürgern. Der Schlüs-sel dazu heisst SuisseID.
Unter der Federführung des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO, entstand mit der SuisseID das erste standardisierte Produkt für einen si-cheren Identitätsnachweis in der Schweiz. Ge-schäfte können zwischen Privatpersonen oder Mitarbeitenden und Firmen, zwischen Firmen
untereinander sowie zwischen Bürgern und Verwaltung einfach und zeitunabhängig direkt über das Netz abgeschlossen werden.
Mithilfe der SuisseID kann sich der Benutzer eindeutig und sicher bei einem Webdienst oder Online Service authentisieren, E-Mails vertrauenswürdig und beweisfähig signieren und elektronische Dokumente rechtsgültig un-terschreiben. Die Einsatzmöglichkeiten für den SuisseID-Inhaber wachsen laufend. Die aktuel-le Liste der Einsatzmöglichkeiten und Anwen-dungen wird laufend publiziert unter: www.suisseid.ch
Bekanntlich ist die Kommunikation über E-Mail einfach, schnell und sehr effizient, doch leider nicht die sicherste und verlässlichste Art des Informationsaustausches. In kürzester Zeit und ohne grossen Aufwand können Inhalte, An-hänge oder auch Absender verändert werden, ohne dass der ahnungslose Empfänger dies sofort bemerkt. Die Beweisfähigkeit in einem Streitfall anhand einer nicht signierten E-Mail ist unmöglich.
Beweisfähige E-MailsMit der digitalen Signierung einer E-Mail mit-hilfe eines elektronischen Zertifikats – zumBeispiel der SuisseID–wirddieDatenintegri-tät und damit die Unanfechtbarkeit, der E-Mail sicher gestellt. Die E-Mail, inklusive ihrer
Leistungsfähigkeit digitaLer signaturen
Authentizität: Kann verlässlich die Identität einer Person oder Organisation nachweisen.
Autorisierung: Kann Rechte, Privilegien und Befugnisse eines Zertifikatsinhabers sicherstellen.
Integrität: Kann die Unveränderbarkeit und Unverfälschbarkeit von elektronischen Dokumenten und Informationen sichern.
Vertraulichkeit: Prüft, kontrolliert, verschlüsselt und leitet den Informationsfluss.
Nicht-Anfechtbarkeit/Unleugbarkeit: Unterstützt die Nichtabstreitbarkeit und damit die Beweisbarkeit.

22 KMU LIFE · 05/2011
Anhänge (Word, PDF, Excel und so weiter) wird sicher und beweisfähig. Gleichzeitig mit der Signierung kann der Benutzer auf Knopfdruck (ist alles bereits in den gängigen E-Mail-Programmen implementiert) die E-Mail auch verschlüsselt versenden. Je nach Kundenan-forderung und Sicherheitsanspruch, kann das Signieren und Verschlüsseln vom einzelnen Ar-beitsplatz aus erfolgen oder zentral von einem Gateway übernommen werden.
Viele E-Mail-Systeme beinhalten bereits die notwendigen Funktionen für das Signieren und Verschlüsseln. Für erweiterte Anforderungen
stehen spezifische Lösungen zur Verfügung. So ist es auch möglich, eine «eingeschriebene E-Mail» über eine sogenannte sichere Zustell-plattform zu versenden (www.privasphere.ch).
Geschäftsdokumente, und die darin enthalte-nen Informationen, stellen für Unternehmen einen bedeutenden Wert dar. Sie dienen der Sicherstellung der ordentlichen und nachweis-baren Geschäftsführung, dem Nachweis der Er-füllung gesetzlicher Vorschriften, der Stärkung der eigenen Position im Falle eines Rechts-streits sowie der Bewahrung des firmenspezi-fischen Gedächtnisses.
Je mehr das Unternehmen seinen geschäftli-chen Tätigkeiten in elektronischer Form nach-geht, umso mehr wachsen die Anforderungen, dass diese elektronischen Dokumente und In-formationen auch langfristig, unveränderbar und zugriffsgeschützt erhalten bleiben. Dies vor allem auch unter dem Aspekt, dass elek-tronische Dokumente ihre Beweiskraft nur in elektronischer Form behalten.
Für die Ablage und Archivierung von elektroni-schen Dokumenten ist die elektronische Signatur von grosser Bedeutung. Die elektronische Signa- www.quovadis.ch
Carl Rosenast ist einer der Gründer von QuoVadis Trustlink Schweiz AG und für die Geschäftsleitung sowie den Ver-kauf verantwortlich.
Weitere Informationen
tur stellt die Datenintegrität (Unverfälschbarkeit), Authentizität (Urheberschaft) und die Unanfecht-barkeit des Dokuments sicher. Mit dem Signie-ren der Dokumente werden die Vorgaben der Geschäftsbücherverordnung erfüllt, ohne dass spezielle Speichersysteme eingesetzt werden müssen. Die elektronische Signatur verhindert, dass Dokumente nachträglich und unentdeckt manipuliert oder verändert werden können, denn eine nachträgliche Veränderung führt automa-tisch zur Ungültigkeit der elektronischen Signa-tur. Viele Archiv-, Dokumentmanagement- und Workflow-Systeme unterstützen mit integrier-ten und automatisierten Massensignierungs-
komponenten und Zeitstempelanbindungen den Einsatz von elektronischen Zertifikaten und digitalen Signaturen.
Rechnung einfach elektronisch versendenDie elektronische Rechnung (eRechnung) und der damit verbundene elektronische Versand der Rechnungen erlangt vermehrt an Bedeu-tung. Unternehmensübergreifende Geschäfts-prozesse können damit markant effizienter und rascher abgewickelt werden. Getrieben von den grossen Rechnungsempfängern (Migros, Coop et cetera), haben viele Lieferanten ihre Prozesse angepasst und versenden getreu den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwal-tung (ElDI-V) ihre eRechnungen gesetzeskon-form elektronisch signiert.
Viele Unternehmen kommen nun auf die Idee, ihre Rechnungen einfach und schnell als PDF unsigniert per E-Mail an den Rechnungsemp-fänger zu senden. Ist dieses Vorgehen korrekt? Oder handelt es sich bei dieser Transaktion um eine elektronische Rechnung, die es nach Vorgabe von ESTV zwingend zu signieren gilt? Da kann ich nur mit einem klaren Ja antwor-ten: Wenn eine Rechnung nicht auf Papier zum Rechnungsempfänger gelangt, handelt es sich
um eine elektronische Rechnung, egal in wel-cher elektronischen Form dies erfolgt (PDF, Word, Excel, XML und so weiter). Somit gelten für alle elektronisch übermittelten Rechnungen die Vorgaben des ElDI-V.
Der Gesetzgeber (in diesem Fall ESTV), schreibt dem Rechnungssteller zwingend vor, dass Rechnungen elektronisch signiert werden müssen, die versendeten Rechnungen in elek-tronischer Form zehn Jahre aufbewahrt und die damit verbundenen Prozesse dokumentiert werden müssen. Der Rechnungsempfänger hat die Aufgabe, die Signatur der einkommenden Rechnungen auf ihre Gültigkeit zu prüfen, die Prüfung zu protokollieren, das Prüfjournal und die eRechnung zehn Jahre zu speichern und auch den damit verbundenen Prozess zu doku-mentieren.
Doch keine Sorge, liebe KMU-Unternehmer, für die Erfüllung dieser Anforderungen gibt es heu-te verschiedenste Lösungen, die in Ihren beste-henden Rechnungsprozess eingebunden wer-den können. Auch stehen externe Serviceleister zur Verfügung, welche in der Lage sind, diese Aufgaben zu übernehmen. Zum Schluss noch ein Tipp: Eine gute Informationsquelle rund um das Thema eRechnung ist die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) mit dem swissDI-GIN-Forum (www.swissdigin.ch).
Anmerkung1)Wichtige gesetzliche Grundlagen:ZertES: Bundesgesetz über die elektronische Signatur, Dezember 2003GeBüV: Geschäftsbücherverordnung, Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher, April 2002MWSTG/MWSTGV: Bundesgesetz über die Mehrwertsteu-er, inklusive dazugehöriger VerordnungenElDI-V: Verordnung des EFD über elektronisch übermit-telte Daten und Informationen (eRechnung), Januar 2002
DOKUMENTENMANAGEMENT


24 KMU LIFE · 05/2011
XXXXXXXXXXXXX
strategisChe ausriChtung der MobiLeanbieter
Nokia, Blackberry oder Palm waren vor wenigen Jahren das Nonplusultra auf dem Mobiltelefonmarkt. Heute kämpfen sie alle um eine Strategie, die das Überleben sichert. Dagegen hat sich Apple vom trendigen Nischenplayer zu einem Giganten entwickelt. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Situation und wagen ein kleines Ranking, auch auf der Grundlage einer eigenen Kun-denumfrage, der aktuell ersten vier Plätze.
von Georg Lutz
Schnelle Wechsel
Das schnelle Mobilegeschäft verzeiht kaum Strategiefehler. Wer falsche oder keine Entscheidungen trifft, landet trotz beeindruckender Perfor-
mance und klingendem Namen im Abseits. So war es mit Siemens Mobile, die noch unter dem inzwischen historischen Namen BenQ die Segel streichen mussten. Auch beim Namen Palm schnalzten Kenner mit der Zunge. Das beein-druckte auch den Brachenriesen HP, er wollte hier ein Zeichen im Mobilemarkt setzen. Die strategische Kaufentscheidung erwies sich al-lerdings als Missgriff. Der Blackberry-Hersteller Research in Motion (RIM) ist bei Businessmen-schen eine beliebte Wahl. Allerdings erodieren in letzter Zeit die Zahlen dramatisch und in-zwischen ist es fraglich, ob die Kurve nicht ins bodenlose fällt.
Der Absturz des SpitzenreitersKommen wir aber zunächst zum aktuell be-kanntesten negativen Beispiel. Nokia hat eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Der finnische Konzern kann auf eine wechselvolle Geschichte verweisen. Vom Papier- und Gummistiefelher-steller führte der Weg zum Weltmarktführer im Mobiltelefoniemarkt. Der Brand galt lan-ge Zeit, in Kombination mit den Pisa-Studien der OECD, als Speerspitze für ein überlegenes skandinavisches Gesellschaftsmodell. Offen-sichtlich sonnten sich die Verantwortlichen zu lange darin. In den letzten Jahren hat Nokia den Smartphone-Boom verpasst. Das Unter-nehmen steht am Abgrund. In unserer kleinen Kundenumfrage telefoniert niemand mehr mit einem Nokia-Mobile, selbst wenn der Umstieg auf ein Smartphone noch bevorsteht.
Man glaubt es kaum, aber vor wenigen Jahren stand das Unternehmen noch an der Spitze. Nokia produzierte die besten Brot- und But-ter-Mobiles für den Alltagsgebrauch. Zudem kamen die Spitzenprodukte trendig daher. So machte Keanu Reeves das Modell 8110 im ers-ten Teil der Matrix-Trilogie populär. Heute be-setzen genau Apple und Samsung diese beiden Eigenschaften. Dagegen wirken die heutigen Mobiles von Nokia umständlich, schwerer und sehr bieder.
Das hat Folgen: Jahrelang hatte der finnische Hersteller rund 40 Prozent Marktanteil im weltweiten Mobiltelefonmarkt. Nun aber, da immer mehr Mobilenutzer auf Smartphones umsteigen, ist der Anteil von Nokia rapide ge-schrumpft: Auf gut 30 Prozent in 2010 und nur noch 22.8 Prozent im August 2011, analysiert das Marktforschungsunternehmen Gartner.
Anstatt nun aber in die Forschung zu inves-tieren und spannende neue Produkte auf den Markt zu bringen, setzt der angeschlagene Mobiltelefonhersteller eine drastische Sparrun-de nach der anderen in Szene und greift nach

25KMU LIFE · 05/2011
jedem externen Strohhalm. So greift Pessimis-mus bei allen Stakeholdern um sich. Besonders drastisch fällt die geplante Schliessung des Mobiltelefonwerks im rumänischen Cluj auf. Es war erst vor gut drei Jahren errichtet worden, um die Nokia-Fertigung in Deutschland zu er-setzen. Zynisch könnte man bemerken: Die Ka-rawane zieht weiter. Eine schlüssige Strategie ist allerdings weiter nicht zu erkennen. Die Ein-schnitte werden von den Managern im üblichen Sparjargon als «schmerzhaft, aber notwendig» bezeichnet. Das mag richtig sein. Allerdings bietet reines Sparen keine Zukunftsperspekti-ve, sondern führt in den Niedergang. Dies kann man, nebenbei bemerkt, auch aktuell bei der wirtschaftlichen Entwicklung der griechischen Volkswirtschaft beobachten. Solange keine Strategie erkennbar ist, wie die Wettbewerbs-fähigkeit wieder herzustellen ist, führt das pure Sparen in eine klassische Rezession.
Jetzt im Herbst, gibt es von Nokia zum ersten mal seit langer Zeit wieder positive Signale. Ende Oktober findet die Entwicklerkonferenz Nokia World statt, auf der vermutlich Nokias Windows-Mobile vorgestellt werden soll. Die strategische Partnerschaft der beiden Schwer-gewichte dürfte die letzte Möglichkeit sein, eine Trendwende einzuleiten. Der Schrump-fungsprozess in Europa und USA deutet aber eher darauf, hin im asiatischen Markt sein Heil zu suchen.
kLeines ranking
Vierter Platz: Motorola Der wichtigste Treiber für Motorolas Erfolg ist das Google-Betriebssystem Android. Im August 2011 zog Google die Konsequenz aus dieser Erfolgsstory – und der wach-senden Konkurrenz durch andere Betriebs-systeme. Vor allem um sich in der Patent-schlacht gegen Konkurrenten zu rüsten, schluckte der Internetgigant die Mobilfunk-sparte von Motorola. Jetzt gibt es eine eige-ne Android-Hardware unter Google-Regie. Das verspricht noch Luft nach oben.
Rang zwei und drei: Samsung und HTC Der südkoreanische Hersteller Samsung liefert sich mit dem Branchenprimus Apple nicht nur eine juristische Schlacht. Es geht immer wieder um neue innovative Model-le, die klassische Computerlösungen immer weiter in die Nische verweisen. So wurde im Sommer auf der Internationalen Funkaus-stellung in Berlin das Modell «Galaxy Note» präsentiert, ein sogenanntes Zwittergerät zwischen Tablet-PC und Smartphone, auf dem auch geschrieben werden kann.
Gleichauf liegt der taiwanesische Hersteller HTC. Er verzeichnete in den letzten Mona-ten weltweit ein rasantes Wachstum beim Smartphone-Absatz–undhatnochvielAp-petit. Mit gewaltigem Aufwand werden die Zukunftsmärkte bearbeitet. So stellte die Bollywood-Schauspielerin Riya Sen im Som-mer in Bombay das Modell «ChaCha» vor, mit dem der Zukunftsmarkt Indien ange-gangen werden soll. Bei den Verbrauchern kommen die Android-Smartphones mit der «Sense»-Oberfläche von HTC gut an.
Spitzenreiter Apple Unangefochten an der Spitze bei der Kun-denzufriedenheit liegt Apple mit seinem iPhone – nach wie vor mit Abstand dasmeistverkaufte Smartphone.
Wandelnde BusinesstrendsBlackberrys, das waren früher die Statussymbole der Manager. Zu Zeiten, als die meisten Mobile-nutzer vom mobilen Internet nur träumen konn-ten, tippten die Blackberry-Besitzer am Flughafen und im Zug schon mal schnell E-Mails. Sie ver-fügten über ein angemessenes Statusprodukt. Doch dann kam Apple 2007 mit dem iPhone und plötzlich hiess mobiles Internet auch surfen im Web und Musik hören. Ein Trendprodukt löste das andere ab. Auch Manager sind eine wech-selfreudige Zielgruppe. Das Ausruhen auf dem Ruhekissen des Erfolgs erwies sich für Blackber-ry als fatal. Die Tastatur blieb, während doch die Kunden ganz fasziniert vom berührungsempfind-lichen Bildschirm des iPhones waren. Blackberry steht heute in der zweiten Reihe. Dieses Image hat der kanadische Hersteller RIM bis heute nicht abschütteln können. Die Verkaufsverluste sind fast schon eine logische Folge.
Im Rahmen unserer kleinen Kundenumfrage benutzen einige Unternehmensverantwortli-che noch ein Blackberry, bei einem künftigen neuen Produkt wird man sich aber eher für ein Smartphone von Apple entscheiden. Der Druck wird schon aufgebaut, da der eigene IT-Verant-wortliche und die Töchter und Söhne bereits ebenfalls mit einem iPhone arbeiten.
Neue Angriffswelle auf den BranchenprimusApple belegt auch in unserer Kundenumfrage ganz klar den ersten Platz. Die Faszination scheint durch alle Zielgruppen hindurch ungebrochen. Allerdings rütteln Konkurrenten wie Samsung heftig am Stuhl des Spitzenreiters. Noch jetzt im Herbst, sollte daher die fünfte Generation des iPhones vorgestellt werden. Inzwischen ist es bei einer neuen Version des iPhone 4 geblieben. Der Innovationsvorsprung droht verloren zu gehen. Andere Mobilehersteller bauen längst leistungs-stärkere Prozessoren, grössere Bildschirme und höher auflösende Kameras in ihre Smartphones ein. Nur die neue Cloud-Lösung dürfte den Druck auf die Konkurrenz erhöhen. Mit dem Tod von Steve Jobs, der nicht Produkte, sondern eine Phi-losophie vermittelte dürfte die Situation ebenfalls schwierig werden. Auch die angeschlagene Repu-tation durch die unhaltbaren Zustände bei asia-tischen Zulieferern, werden einige Kunden nicht vergessen. Last but not least, sollte sich Apple weiter auf gute Produkte und weniger auf gute Anwälte verlassen.
Weitere Informationen
Georg Lutz ist Chefredaktor von KMU LIFE
HARDWARE

26 KMU LIFE · 05/2011
XXXXXXXXXXXXX
teLekoMMunikationsanbieter iM wettstreit
Kommunikation ist auch in der Schweiz ein umkämpftes Marktsegment. Ne-ben dem Platzhirsch Swisscom, haben andere Anbieter wie Orange und Sun-rise immer noch einen vergleichbar schwierigen Stand. Welche Gründe gibt es dafür? Wir haben die Unternehmensvertreter, der drei grossen Player, Josef Huber, Therese Wenger und Jon Erni um Antworten gebeten. Die historische Ausgangssituation beantworten alle drei. Die strategische Ausrichtung von Orange und Swisscom können Sie im Folgenden lesen. Sunrise präsentiert sich im folgenden Beitrag.
von Georg Lutz
Umkämpfte Positionen
Das Ranking der Schweizer Teleko-manbieter ist keinesfalls ein sta-tisches Gemälde. Die beteiligten Unternehmen agieren mit Haken
und Ösen und investieren viel Geld, um alte Fehler auszubügeln und neue Produkte auf den schnell schwankenden Markt zu werfen. Aus diesem Grund verändert sich das Ranking jedes Jahr und es gibt im Vergleich zu ande-
ren europäischen Staaten auch kaum neue Anbieter auf dem Markt. Ein dritter Trend ist zu konstatieren: Nach einer Phase der Ausdif-ferenzierungen gleichen sich die Angebote im-mer mehr an. So gibt es aktuell nicht nur bei Swisscom und Orange das iPhone und nicht nur beim dominanten Kabelnetzanbieter Cable - com Digital-TV. Interessanterweise machte Ca-blecom im letzten Jahr im Fixnetbereich einen
Sprung nach vorne. Offensichtlich hat sich bei Cablecom nicht nur das Logo, sondern auch der lange Zeit unterirdische Kundensupport verbessert. VTX, E-Fon und Sipcall spielen eine wichtigere Rolle. Demgegenüber verschlech-terte sich Netstream deutlich und landet nur noch auf den hinteren Plätzen. Das Auf und Ab ist offensichtlich.
Auch grosse Player brauchen sich nicht über mangelnde Bewegung zu beklagen. Das Verbot mit Sunrise zu fusionieren sowie der bevor-stehende Eigentümerwechsel dürfte sich bei Orange im Geschäftskundenmarkt nicht gera-de verkaufsfördernd auswirken, währenddem das Privatkundengeschäft offenbar geradezu floriert. Vergleichsweise wirkt Sunrise hier, zum Beispiel mit seinen neuen Aktivitäten im Businessbereich frischer aufgestellt. Man kann

27KMU LIFE · 05/2011
KOMMUNIKATION
nur hoffen, dass die Strategien und Strukturen auch einige Jahre durchgehalten werden. Nur dann kann man Swisscom gefährlich werden. So ist Swisscom im Mobilfunkbereich dieses Jahr die erste Wahl. Lange war hier Orange füh-rend. Nach unten durchgereicht im Businessge-schäft wurde der frühere Primus Colt. Auch in der Telekommunikation kann man es sich nicht leisten, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen.
Kleiner Blick in die GeschichteUm über diesen schwankenden Markt ein kla-reres Bild zu bekommen, gilt es zunächst, einen Blick in die Geschichte zu werfen. Wir haben die Vertreter von Orange, Sunrise und Swiss-com zunächst nach der historischen Ausgangs-situation gefragt. Wie auch in anderen Län-dern gab es noch vor zwei Jahrzehnten einen Monopolisten. Die Marktöffnung verlief in der Schweiz aber schleppender.
Jon Erni von Sunrise gibt die historische Einfüh-rung aus seiner Sicht: «Die letzte grosse Revi-sion der Fernmeldegesetzgebung per 1. Januar 1998 ermöglichte privaten Telekomdienstleis-tern, in den Fernmeldemarkt im Bereich Fest- und Mobilfunknetz einzusteigen. Allerdings ermöglichte erst die Teilrevision per 1. April 2007 die von den Wettbewerbern lange herbei-gesehnte Entbündelung der letzten Meile. Zum ersten Mal konnten private Telekomdienstleis-ter die grösstenteils zu Monopolzeiten ent-standenen Teilnehmeranschlussleitungen der Swisscom mieten, die Swisscom Ortszentralen mit einer eigenen modernen Ausrüstung be-stücken und so mit eigenen Telekomdienstleis-tungen dem Kunden Mehrwert bieten. Der Ver-gleich mit Europa zeigt jedoch ein nachdenklich stimmendes Bild: Erstens kam die Öffnung des Fernmeldemarktes später als in den meisten europäischen Ländern. Zweitens behindert der Interessenskonflikt des Bundes als Regulator und Mehrheitseigentümer der Swisscom noch immer den Wettbewerb. So werden alternative Anbieter bei der Nutzung der Infrastruktur der vormaligen Monopolistin nach wie vor durch überteuerte Preise diskriminiert. Drittens ist die Liberalisierung weiterhin unvollständig, so ist der Zugang auf die Glasfasernetze im Fal-le der Marktbeherrschung im Unterschied zur EU nicht reguliert. Diese Rahmenbedingungen begünstigen in der Schweiz den Ex-Monopo-listen noch immer und verhindern schärferen Wettbewerb. Von der Änderung einer Reihe
von Rahmenbedingungen würden Privat- wie Geschäftskunden gleichermassen profitieren.»
Josef Huber, der Leiter des Mediendienstes der Swisscom, analysiert die Situation demgegen-über naturgemäss etwas anders: «Aufgrund der starken Verbreitung der Kabelnetze (über 90 Prozent der Haushalte) ist der Schweizer Telekommarkt seit langem stärker vom Wett-bewerb der verschiedenen Infrastrukturen geprägt als die meisten europäischen Länder. Dieser Wettbewerb hat in der Schweiz zu hoher Innovation und zu einer sehr guten Versorgung landesweit geführt.»
Und wie beurteilt er die beklagte verspätete Marktöffnung? «Die Öffnung des Marktes er-folgte 1998 im Gleichschritt mit den meisten europäischen Ländern. Im Festnetz wurde der Wettbewerb vor allem mit dem Einstieg der Kabelnetze in den Telefonie- und Internetmarkt stimuliert. Im Gegenzug hat Swisscom in nur knapp fünf Jahren nach dem Einstieg ins TV-Geschäft Cablecom als Marktleader im digita-len Fernsehen abgelöst.»
Dem widerspricht Therese Wenger, Kommu-nikationsleiterin von Orange. Die ungleichen Startvoraussetzungen sind für sie überdeut-lich: «Die späte Liberalisierung des Schwei-zer Marktes durch den Bund, der auch noch heute Mehrheitseigentümer ist, verschaffte Swisscom schon zum Start zahlreiche, stra-tegisch wichtige Vorteile, die bis heute die Marktdominanz des staatlich kontrollierten Unternehmens zementieren: So gab es eine 95 prozentige Netzabdeckung und einige Tausend Standorte für Mobilfunkanlagen, deren Bewilligung längst nicht den rechtli-chen Anforderungen zu genügen hatten, wie dies seit der Liberalisierung bei den Heraus-forderern der Fall ist. Dieser Vorteil ist auch heute noch wirksam. Das Finden von neuen Standorten und Bauen von neuen Anlagen gestaltet sich sehr schwer und ist nur mit sehr grossem Aufwand möglich. Bestehende Standorte mit neuen Technologien auszurüs-ten, ist unvergleichlich einfacher und günsti-ger. Zudem gab es eine Marktdurchdringung im Mobilfunk mit über 25 Prozent (jeder Vier-te mit einem Mobiltelefon). Kaum ein anderer europäischer Mobilfunkmarkt wurde erst so spät bei einer so hohen Marktpenetration li-beralisiert.»
Der Staat und die AnbieterDen Interessenskonflikt des Bundes als Regu-lator und Mehrheitseigentümer der Swisscom schwächt Josef Huber deutlich ab. «Die Rollen des Bundes als Miteigentümer (Finanzdeparte-ment) und Regulator (UVEK) sind getrennt. Zu-dem gelten die Bestimmungen des branchen-übergreifenden Kartellrechts.»
Werden so nicht alternative Anbieter bei der Nutzung der Infrastruktur der vormaligen Monopolistin nach wie vor durch überteuerte Preise diskriminiert? Darauf gibt es eine klare Antwort: «Sie sprechen wohl die von unserer Konkurrenz kritisierte Berechnungsmethode LRIC an. Diese wird aber in den meisten eu-ropäischen Ländern angewendet und bietet einen angemessenen Investitionsschutz. Bei einer der wichtigsten Kennzahlen, der Pro-Kopf-Investition in der Telekommunikation, steht die Schweiz denn auch im internationalen Vergleich sehr gut da. Dies gilt auch für die in-ternationalen Preisvergleiche.»
Die Frage nach der unvollständigen Liberalisie-rung ist für Josef Huber nicht nachvollziehbar. «Wie wollen Sie ein Netz ‹liberalisieren›, das erst im Aufbau ist? Angesichts der ungebro-chenen Investitionsdynamik, zum Beispiel im Glasfaserausbau, steht die Schweiz auch in diesem Bereich sehr gut da. Glasfaserverbin-dungen bis in die Wohnungen sind zudem nicht isoliert zu betrachten, sondern eine Alternative zur heutigen Kupferinfrastruktur und zu den Kabelnetzen.»
Demgegenüber sieht Therese Wenger auch an diesem Punkt strategische Nachteile. «Die Mehrfachrolle des Bundes (Gesetzgeber, Re-gulator, Branchen- und Aufsichtsbehörde, Mehrheitsaktionär, Grosskunde et cetera) erscheint aufgrund der Geschäftsdimensionen (rund CHF 12 Milliarden Umsatz im 2010; CHF 4.6 Milliarden EBITDA) als deutlich mehr, als ein einfacher, dem Wettbewerb nur hinderli-cher Interessenskonflikt. Dem Marktdomina-tor wird von politischer Seite gestattet, den Markt systematisch und nach Belieben zu dominieren und insbesondere für sich abzu-schotten. ‹Liberalisiert› wurde und wird der Markt nur so viel, dass es dem Marktdomina-tor nicht weh tut, beziehungsweise dass die erwähnten Mehrfachinteressen nicht gefähr-det werden.»

28 KMU LIFE · 05/2011
KOMMUNIKATION
Interne und externe GründeJetzt kann es aber nicht nur darum gehen, im-mer mit dem Finger auf andere zu zeigen. So ist die Situation von Orange beispielsweise durch die ungeklärte Eigentümerfrage labil. Zwar läuft das operative Geschäft weiter, jedoch können strategische Fragen bis zur Klärung der Verhältnisse nicht bearbeitet werden. In diesem Zustand kann man sicher schwer dem Platzhirsch Paroli bieten. Von welchen strate-gischen Überlegungen lässt sich Orange leiten?
Therese Wenger argumentiert hier taktisch: «Aufgrund der oben erwähnten Rahmenbedin-gungen konzentriert sich Orange mit ihrer Strate-gie auf jene Bereiche, in denen sie angreifen und sich zufriedene und loyale Kunden sichern kann, unabhängig von den Verkaufsplänen der France Telecom Orange-Gruppe. Orange fokussiert sich mit der Angebotsstrategie im Privatkundenbe-reich auf die mobile Kommunikation und Un-terhaltungsdienste; im Geschäftskundenbereich auf die mobile Kommunikation sowie integrierte Mobil-undFestnetzlösungen–diesjeweilszumbesten Preis-Leistungs-Verhältnis.»
Trotzdem haben nicht nur wir vom KMU LIFE den Eindruck, dass Orange den Businessmarkt, im Vergleich zu den Privatkunden, nur defensiv bearbeitet.
Hier gibt es von Therese Wenger klaren Wi-derspruch: «Der Preisplan Orange Me, den wir im August 2010 eingeführt haben, richtet sich insbesondereanSoHoundKMU–esgibtkei-nen anderen Preisplan im Schweizer Markt, der unlimitierte Gesprächsminuten für internatio-nale Gespräche in der Grundgebühr inbegrif-fen bietet. Hier adressieren wir typischerweise KMU und der Erfolg – über 400’000 OrangeMe-KundeninzwölfMonaten–gibtunsRecht.Zudem lancieren wir aktuell mit HD Voice ei-nen weiteren, einfachen, innovativen, aber für Geschäftskunden wichtigen Dienst. Gerade für Geschäftskunden ist es wichtig, auch in lärmi-ger Umgebung gut verstanden zu werden. Mit HD Voice gehen wir als Pionier in die Offensi-ve. Und last but not least bieten wir derzeit ein konkurrenzloses Paketangebot für Start-up-Un-ternehmen mit zahlreichen Vergünstigungen für Firmengründer an.»
Blick in die ZukunftAm Schluss der virtuellen Debatte gilt es noch, einige Blicke in die Zukunft zu werfen. An die-sem Punkt liegen die Konkurrenten nicht weit auseinander.
Wo liegen die strategischen Herausforderun-gen der nächsten Monate?
Für Josef Huber stehen fünf Hürden im Vorder-grund, die es für alle Anbieter zu überspringen gilt, sprich, sie müssen hier passgenaue Ange-bote anbieten können.
«Erstens werden Telekomnetze zu Nervenbah-nen der Informationsgesellschaft. Immer mehr Tätigkeiten im Alltag erfolgen über Internet und die rasante Entwicklung der Elektronik ermöglicht leistungsfähigere Geräte und An-wendungen. Sinkende Preise sorgen zweitens für die rasche Verbreitung digitaler Techno-logien: 75 Prozent der in den Monaten Juni/Juli 2011 verkauften Mobilfunktelefone sind Smartphones. Im Mobilfunkbereich hat sich drittens das Verkehrsvolumen im letzten Jahr
Grosse Investitionen für die neue Generation von Telekommunikationskanälen und Telekommunikationsprodukten stehen auf der Agenda.

Josef Huber ist Leiter Mediendienst Swisscom.
Therese Wenger leitet die Kommunikationsabteilung bei Orange.
Jon Erni ist Executive Director bei Business Sunrise und Mitglied des erweiterten Management Boards von Sunrise.
Weitere Informationen
verdoppelt; im Festnetz verdoppelt es sich alle 19 Monate. Für die Marktentwicklung heisst dies: Hohe Investitionen und vermehrt Kon-solidierungen sind die Folge. Viertens stehen grosse Investitionen im Mobilfunk (Auktion und Ausbau der vierten Mobilfunkgeneration) und Festnetz (FTTH) an. Fünftens werden der Telekommarkt, IT, Medien und Entertainment weiter zusammenwachsen.»
Orange bündelt in ihrer Antwort die Herausfor-derungen in zwei Themenkomplexe. Zunächst geht es um den Ausbau/Betrieb der Mobilfun-kinfrastrukturen: «Das Wachstum der mobilen Datendienste (Smartphones, Apps, mobiler Internetzugang mit Tablets, Laptops und PCs) boomt weiter. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die-ser Boom stellt uns im Zusammenhang mit den Eigenheiten im Schweizer Markt (zehnfach strengere Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung, föderalistisches Baubewilligungsverfahren, Gemeindeautonomie bei der Zonenplanung et cetera) vor eine grosse Herausforderung beim bedarfsgerechten Ausbau der Mobilfunkinfra-
strukturen. Orange intensiviert die Kooperati-on mit den Mitbewerbern zur Erstellung und Nutzung von gemeinsamen Antennenstand-orten (Site Sharing), verstärkt den Dialog mit den zuständigen Behörden in den Kantonen und Gemeinden und unternimmt grössere An-strengungen, dass die Rahmenbedingungen für den Infrastrukturausbau jenen in der EU angepasst werden.»
Das zweite zentrale Thema für Orange ist die Wandlung des Unternehmens von einer Mobil-funkanbieterin zum Unternehmen, welches di-gitales Entertainment in den Fokus stellt. «Die künftigen Marktanteile werden vor allem über das ‹Gesamtpaket Kundenerlebnis› gewonnen. Die Kundinnen und Kunden erwarten dabei zunehmend auf sie zugeschnittene Unterhal-tungsangebote, nebst einem hoch stehenden Service. Orange geht mit ihren heutigen En-gagements im Musik- und Filmbereich, mit der konsequenten Nähe zum Kunden durch die regionale Ausrichtung der Marketing- und Verkaufsaktivitäten sowie dem Fokus auf die
höchste Kundenloyalität bereits diesen Weg. Daher bietet Orange den Kunden nebst den Mobilfunkdienstleistungen ein breites Multi-mediasortiment an.»
Ob Orange auf diese Weise Boden gut machen kann, bleibt abzuwarten. Wir werden im nächs-ten Jahr alle drei grossen Anbieter zu einer De-batte einladen, um diesen aktuellen Zwischen-stand analytisch vertiefen zu können.
KOMMUNIKATION
Mit einem massgeschneiderten Kommunikationssystem von Aastra erhöhen Sie die Produktivität Ihres Unternehmens: Zur klassischen Telefonie oder Voice over IP (VoIP) kommen sinnvolle Anwendungen wie Mobilitätslösungen, Anbindung an Outlook™ und interne Datenbanken, Präsenzmanagement oder Konferenzlösungen. Aastra Lösungen sind in Unternehmen jeder Branche und Grösse zuhause.
Aastra optimiert Ihre Geschäftskommunikation. Aastra Telecom Schweiz AG
Erfolgreiche Geschäftskommunikation
www.aastra.ch
Aastra_KMUlife_205x135_4f.indd 1 13.10.11 11:42

30 KMU LIFE · 05/2011
Passende koMMunikationsLösungen fÜr kMu
Flexibilität ist für KMU besonders wichtig. Sie sind stärker den Wogen des Marktes ausgesetzt als grosse, schwere «Businesstanker». Ihre Mitarbeiten-den müssen in vielen Situationen kommunizieren können, weil sie sich da auf-halten, wo sie gebraucht werden: zum Beispiel beim Kunden. Die ICT-Infra-struktur der KMU muss deshalb einfach und überall funktionieren.
Der Mensch kommt vor der Technologie
Miteinander sprechen und sich aus-tauschen–dasistderSauerstoffder Wirtschaft. Telekommuni-kation ermöglicht genau das.
Eine solche Infrastruktur verbindet Niederlas-sungen, Geschäftspartner, Mitarbeitende und Kunden von KMU. Sie muss gerade deshalb einfach, hoch verfügbar und sicher funktionie-ren. Für ein reibungsloses Tagesgeschäft.
KMU haben spezielle BedürfnisseSo sehen das auch die Gründer der 2m Archi-tektur GmbH in Wädenswil. Stefan und Co-
rinne Müller betreiben ihr Büro oft unterwegs –imZug,imAutooderaufderBaustelle.Dasschnelle, mobile Datennetz von Business Sunri-se ist ein Baustein ihres geschäftlichen Erfolgs. Bei der Berner cosma dialog ag liegt der Fall etwas anders: Ihr Geschäftsmodell ist bereits aus dem Namen ersichtlich. Das Unternehmen stellt Kunden wie Amag Schweiz, Mobility Carsharing oder KPT Kommunikationsdienst-leistungen zur Verfügung. Es verfügt über rund 60 Arbeitsplätze und nutzt seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2000 für die Tele-fonie ein schnelles Datennetz. Nur so können
Geschäftsleiterin Barbara Schär und ihre Mit-arbeitenden Tausende von Kundengesprächen effizient managen. «Wir brauchen das Internet einfach, ohne steht bei uns alles still.»
In beiden Unternehmen sind unterschiedliche Technologien im Einsatz, doch eine Gemeinsam-keit verbindet sie: Der Wunsch nach einer per-sönlichen Betreuung. Sie schafft das Vertrauen, dass allfällige Probleme, die jede Technologie zwangsläufig nach sich zieht, gelöst werden
Der Betrieb von ICT-Infrastruktur erfordert viel Know-how. Weder die 2m Architektur GmbH noch die cosma dialog ag verfügen über Zeit und Ressourcen, sich selbst um die ICT zu kümmern.
Technologie ist zweitrangig«Es gibt heutzutage bezüglich der technischen Dienstleistungen zwischen den Anbietern
KOMMUNIKATION

31KMU LIFE · 05/2011
kaum einen Unterschied mehr», sagt Jon Erni, Executive Director Business Sunrise. Anders gesagt: «Die Kommunikationstechnologien ha-ben alle im Griff. Als KMU sollte man sich aber gar nicht erst mit technischen Spezifikationen beschäftigen, sondern sich fragen: Habe ich den richtigen Partner und hält er sein Verspre-chen ein?»
Für Barbara Schär ist die Antwort auf letztere Fragen ungleich wichtiger als jene nach der Bandbreite. «Bei einem Notfall will ich eine persönliche Betreuung haben», sagt sie. Die Internetverbindung ist für die cosma dialog ag absolut geschäftskritisch. Den Ausschlag zum Wechsel zu Business Sunrise gab denn auch nicht die technische Qualität des da-maligen Providers, sondern der Wechsel des Kundenbetreuers zu Business Sunrise. «Seine KompetenzundderdirekteDrahtzuihm–daswar entscheidend», sagt Barbara Schär. Rund um die Uhr steht ihr zudem der Business Help Desk zur Verfügung.
Persönliche Betreuung schliesst nicht nur tech-nisches Wissen, sondern auch das Gespür für die Bedürfnisse des Kunden ein. Die cosma dia-log ag befindet sich auf Wachstumskurs und ist als Outsourcing-Dienstleisterin immer wieder mit neuen, wechselnden Kundenbedürfnissen konfrontiert. Das weiss der Kundenbetreuer. So bot er Barbara Schär den Umstieg von DSL auf der Kupferleitung zur flexibleren und schnelle-ren Glasfaser an. Die Kosten für die Gebäudeer-schliessung übernahm Business Sunrise.
Telekommarkt im UmbruchDas Bilanz-Telekom-Rating 2011 belegt die Auf-bruchstimmung bei Business Sunrise. Das Unter-nehmen wird klar besser benotet als im Vorjahr und liegt in allen Bereichen auf Augenhöhe mit Swisscom. Besonders im Support hat Sunrise quer durch alle Produktbereiche markant zuge-legt–hierhatsieinletzterZeitauchstarkinves-tiert, Kapazitäten ausgebaut und Prozesse neu aufgesetzt. «Wir sind auf dem richtigen Weg, wollen uns in den nächsten Jahren aber noch weiter verbessern», sagt Jon Erni.
Die Auswahl des passenden DienstleistersKMU verfügen meist über keine oder nur eine kleine IT-Abteilung. Umso wichtiger ist ein kompetenter Ansprechpartner, der auch
«aM PuLs der kunden»
Interview mit Jon Erni von Georg Lutz
Wie charakterisieren Sie Business Sunrise?
Persönliche Betreuung und Flexibilität ge-paart mit hoher Servicequalität.
Was steht im Vordergrund: Business oder Technologie?
Eindeutig das Business. Die Technologie muss die Prozesse unterstützen. Wir be-raten KMU persönlich, wie sie daraus das Optimum herausholen.
Wie steht es um Ihre IT-Kompetenz?
Wir verfügen inhouse über Mitarbeiten-de, die im Bereich VoIP und Datennetze von allen führenden Herstellern zertifiziert sind. Zudem arbeiten wir mit wichtigen IT-Anbietern zusammen und setzen hier mit-tels innovativer Vertriebsmodelle auf enge, langjährige Partnerschaften.
Jon Erni ist Executive Director bei Business Sunrise und Mitglied des erweiterten Management Boards von Sunrise.
Über Business SunriseSunrise hat Anfang 2011 den Geschäfts-kundenbereich neu positioniert und den Subbrand «Business Sunrise» lanciert. Das Angebot ist noch stärker als früher auf die unterschiedlichen Unternehmensgrössen und Firmenstrukturen angepasst worden. Von hochgradig standardisierten bis zu individuel-len Lösungen: Business Sunrise bietet jedem Unternehmen vom Start-up bis zum global tätigen Konzern optimale Lösungen für die komplette Geschäftskommunikation an.
Weitere Informationenwww.business-sunrise.ch
die IT-Sprache spricht und über ein breites Partnernetzwerk verfügt. Der Support ist mit Vorteil dreistufig organisiert: Der persönliche Ansprechpartner sollte im Hintergrund über ein funktionierendes Customer Relation Team verfügen, das einspringt, falls er einmal nicht verfügbar sein sollte. Auf der dritten Stufe deckt der rund um die Uhr erreichbare Help Desk alle übrigen Zeiten ab. Nebst Produk-ten von der Stange sollte der zukünftige Te-lekompartner auch die Hand zu individuellen Lösungen und Service Level Agreements (SLA) bieten: Darin werden die Verfügbarkeit der Services festgelegt und die Reaktionszeiten bei Störungen.
KMU, die sich mit der Wahl des richtigen Te-lekompartners befassen, sollten sich die Mög-lichkeiten aufzeigen lassen, welche die Inter-pretation der Telefonie (Festnetz und Mobil) mit den Applikationen am Arbeitsplatz bieten. Telefonie, Applikationen und Daten beschleu-nigen Geschäftsprozesse und führen Mitar-beitende, Geschäftspartner und Kunden enger zusammen. Und überall dort zu arbeiten, wo mansichgeradebefindet–stetsmitZugriffaufdieaktuellstenFirmendaten–erhöhtdiePro-duktivität der Mitarbeitenden markant. Dabei unterstützt eine einzige Telefonnummer, über die Anrufe sowohl am Handy und am Festnetz entgegengenommen, ausserdem abgehende Anrufe wahlweise mit der Festnetz- oder Han-dynummer signalisiert werden können. Und das alles ganz ohne Installation von zusätzli-cher Infrastruktur oder Software.
Grosse Auswahl – aber nicht für KMUDie Kernkompetenzen der KMU betreffen kaum den Unterhalt und Betrieb einer eigenen ICT-Infrastruktur; sie werden durch das Auslagern der entsprechenden Dienste gestärkt. Die Aus-wahl unter den IT- und Telekomdienstleistern ist gross, doch nur ganz wenige sind in der Lage, die Infrastruktur von Festnetz- und Mo-biltelefonie, sowie von Arbeitsplatzapplikatio-nen und Smartphones anzubieten, da bekannt-lich nur zwei Anbieter in der Schweiz über die notwendige Mobil- und Festnetzinfrastruktur verfügen: Einer davon ist Business Sunrise. Aus der Erfahrung mit mehr als 60’000 Geschäfts-kunden hat sich Business Sunrise ein grosses Wissen angeeignet. Wer permanent im Dialog mit seinen Kunden steht, kennt ihre Bedürfnis-se und antizipiert deren Entwicklung.
KOMMUNIKATION

32 KMU LIFE · 05/2011
XXXXXXXXXXXXX
starke Präsentationen dank riChtiger Vorbereitung
Eine Präsentation steht vor der Tür. Wie vorgehen? Der Hellraumprojektor ge-hört ins letzte Jahrhundert, Folien sind schmutzig und wirken spiessig. Auch PowerPoint bringt die Zuschauer immer häufiger zum Gähnen. Nicht aber, wenn man PowerPoint richtig einzusetzen weiss – hierfür einige wertvolle Tipps.
von Thomas Skipwith
Powerful
Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie PowerPoint einsetzen können: Zur Erstellung von Dokumenten, Doku-mentationen, Berichten, Unterlagen
und Handbüchern. Oder Sie benutzen Pow-erPointals«Teleprompter»–alsManuskript,um ablesen und im schlimmsten Fall vorlesen zu können. Eine dritte Möglichkeit besteht darin–unddasistmeinebevorzugteVarian-te–PowerPointinderFormzubenutzen,fürdie es entwickelt wurde: als visuelle Präsenta-tionsunterstützung.
Der Wurm muss dem Fisch schmeckenOb eine Präsentation vor den Mitarbeitenden oder den Kunden stattfindet: Sie darf nicht langweilen. Wer langweilt, hat verloren. Oder anders ausgedrückt: Wenn der Wurm dem Fisch nicht schmeckt, dann beisst er nicht an. Genauso ist es mit dem Publikum. Das Publi-kum soll (und will) einen schmackhaften Köder zum Anbeissen.
Vorbereitung ist die halbe MieteDas Sprichwort «Vorbereitung ist die halbe Miete» bringt es schön auf den Punkt. Natür-lich hört das kaum einer gerne, aber für eine interessante Präsentation braucht es eine gründliche Vorbereitung; und zwar nicht nur der Folien. Leider (oder zum Glück) ist das so. Denn dank einer gründlichen Vorbereitung kann ich die Chancen steigern, dass ich mich vom langweiligen Einheitsbrei der anderen ab-heben kann. Zur Vorbereitung gehört unter an-derem auch die Frage nach dem Einsatzgebiet vonPowerPoint–obesüberhauptSinnmacht,PowerPoint zu verwenden.
PowerPoint soll helfen, nicht ersetzenAngenommen, Sie haben sich für PowerPoint entschieden, gilt die nützliche Faustregel: Sind die Folien einmal erstellt, sind erst 50 bis 80 Prozent der Vorbereitung erledigt. Die restlichen Prozente holen Sie sich mit «üben, üben, üben».
Machen Sie es sich nicht zu einfach! Schreiben Sie nicht einfach Ihr Manuskript auf die Folien. Und lesen Sie es dann nicht einfach von der Leinwand ab. Viele von Ihnen würden wahrscheinlich mit den Worten «das ist doch klar» reagieren, den-noch erlebe ich dieses Vorgehen nur zu häufig. Womit wir wieder bei der Langweile wären. Mer-ke: Eine Präsentation soll keine Vorlesung sein.
Wenn die Präsentationsfolien so gestaltet sind, dass sie auch ohne Ihre Erklärung verstanden werden, dann sind Sie als Redner überflüssig. Besser, Sie verschicken die Datei per E-Mail und sparen sich und den anderen den Aufwand, zur selben Zeit am selben Ort zu sein. Wenn Folien, dann solche, die Ihre Präsentation unterstützen.
Erst Papier, dann PowerPointAngenommen, Sie kennen das Ziel Ihrer Prä-sentation bereits, haben eine Idee für die ein-leitenden Worte, das Thema, die Behauptung, und Ihre Inhalte, dann empfehle ich Ihnen, bevor Sie Ihr Notebook aufklappen oder den Computer anschalten und Ihre Präsentation in PowerPoint umsetzen, einen Zwischenschritt: Beginnen Sie auf Papier. Zeichnen oder schrei-ben Sie Ihre Folien auf Papier. Setzen Sie die Zeichnungen erst danach in PowerPoint um.

XXXXXXXXXXXXX
Die Welt der Werbeartikel:fi rmenpresente.ch
Diametral-Firmengeschenke Steinbruchweg 3b 3072 Ostermundigen info@fi rmenpresente.ch Tel. 031 932 32 32
5571 Safebrella® LED Automatik-Taschenschirm
633-00.001Metmaxx® Megabeam «LaserTechPen»
623-00.001 Metmaxx® Kugelschreiber «Genau»
313-00.001 thanxx® Antirutschmatte «CarGrip»
850-00.008Metmaxx®
LED MegaBeam «PocketSecurity»
148-12.004 CreativDesign Eiskratzer «Time&Ice»
Mini-Taschenschirm mit integrierter
LED-Lampe.
Notfalllampe mit 4 LEDs, Gurtcutter, Scheibendorn, Gürteltasche.
Exclusiv-Penlight mit LED, Laserpointer, Wasserwaage,
Zentimeterskala und Magnet.
Die Parkscheibe, welche im Winter auch
komfortables Eiskratzen erlaubt.
Kugelschreiber mit Zentimetereinteilung,
für Handwerker.
Perfekter Halt für die Schlüssel,
Handy, etc.
Mit diesem Vorgehen sparen Sie sich eine Men-ge Zeit. Schreiben Sie so wenige Textfolien wie möglich. Stellen Sie sich immer die Frage, ob es möglich ist, Ihre Gedanken in ein Bild umzuset-zen. Für Bilder eignet sich PowerPoint nämlich besonders gut.
PowerPoint will gelernt seinVielleicht geht es Ihnen wie mir: Sie zappen durch eine Präsentation und sehen auf der Leinwand, wie beim Wechsel der Folien das Logo herumspringt: die Position des Logos ist mal mehr links, mal mehr rechts. Dabei hat sich der Präsentator so viel Mühe gegeben und auf jeder der 99 Folien das Logo von Hand rein kopiert. Das muss nicht sein. Hilfe bietet die Funktion «Masterfoliensatz». Wechseln Sie hierfür in die Folienmasteransicht und kli-cken Sie «Ansicht Folienmaster».
Im Masterfoliensatz definieren Sie Titel, Schrift-grössen und auch deren Platzierung. Ausser-dem können Sie Logos, Fussnoten, Copyright-vermerke anbringen und verschiedene Layouts festlegen. Im Folienmaster definieren Sie auch den Hintergrund und die Farbgestaltung Ihrer Präsentation. Viele Unternehmen stellen Ihnen firmeneigene Vorlagen (so genannte «templa-tes») zur Verfügung. Diese sind meist fixfertig und brauchen von Ihnen nur noch eingesetzt zu werden. Wenn nicht, fragen Sie Ihre Marketin-gabteilung nach einer Vorlage.
Tipp: Bei Firmenpräsentationen fügen Sie auf der Titelfolie (auch) das Kundenlogo ein. Ihr Publikum fühlt sich so direkter angesprochen.
Wenn Ihnen all das wie Fachchinesisch vor-kommt, lohnt es sich, zu überlegen, einen
PowerPoint-Kurs zu besuchen. Damit hat sich schon manch einer viel Zeit und Ärger gespart.
Reduce to the maxEine beschriebene Folie ist nicht wirklich attraktiv. Hier meine Empfehlung, ganz nach einem ehema-ligen Werbeslogan von Smart «Reduce to the max»: Die 5 mal 5-Regel ist als Faustregel sehr nützlich. Schreiben Sie nicht mehr als fünf Punkte mit nicht mehr als fünf Worten auf die Folie. Oder weniger. Wenn Text, dann bitte in einer Grösse, die auch vom Publikum gelesen werden kann. Im Minimum 16 Punkte gross. Vermeiden sie auf jeden Fall Quellenangaben in Punktgrösse acht.
Bringen Sie nur Folien, wenn die Folien einen Mehrwert bedeuten. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn es um ein Modell oder eine technische Zeichnung geht.
Gut vorbereitet, kann eine PowerPoint-Präsentation eine durchaus starke Wirkung haben.

34 KMU LIFE · 05/2011
www.descubris.ch
Thomas Skipwith ist lic. oec. HSG Präsentations-coach, mehrfacher Rhetorikeuropa-meister und Buchautor.
Weitere Informationen
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte«Ein Bild sagt mehr als tausend Worte» heisst nicht, dass wir für alles ein Bild per Beamer an die Leinwand projizieren müssen. Bilder kön-nen auch mit Requisiten erzeugt werden. Und mit Worten. Letzteres wird häufig vergessen. Der Mensch denkt in Bildern. Geben Sie ihm diese. Je mehr sie die fünf Sinne (Augen, Oh-ren, Hände, Nase, Zunge) ansprechen können, desto einfacher wird es Ihrem Zuhörer fallen, mit Ihnen auf Ihre Gedankenreise zu gehen.
PowerPoint, ja oder nein?Soll ich PowerPoint einsetzen oder nicht? Ein Bekannter hat mir erzählt, dass er dabei war, als fünf Konkurrenten an einem Wettbewerb für ein Architekturprojekt gegeneinander angetreten sind. Jedes Team versuchte, die Bauherrschaft von seinem Projekt zu überzeu-gen. Vier Teams haben dabei mit PowerPoint gearbeitet. Ein Team hat ohne PowerPoint, mit Kartontafeln, Pre-PowerPoint, präsentiert. Wer hat gewonnen? Das Team mit den Kar-tontafeln. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hat dem Team geholfen, dass es anders war als die anderen. Das Team ist mit seiner Präsentation aus der Masse herausgestochen. Man darf also gerne auch mal ohne PowerPoint präsentieren. PowerPoint ist nicht die eierlegende Wollmilch-sau. Wohlüberlegt kann PowerPoint aber sehr wohl zu einer guten Präsentation beitragen.
Übung macht den MeisterErgreifen Sie jede Gelegenheit zum Üben. Ein Jubiläum, ein Kundenanlass, eine kleine Tisch-rede. Wie Cicero schon sagte: «Reden lernt man nur durch reden.»
Wenn Sie sich an die obigen Tipps und Tricks halten, werden Sie nicht mehr nur nicht lang-weilen, sondern Ihr Publikum mit Ihrer Bot-schaft begeistern können.
LiteratureMPfehLung
Der Wurm muss dem Fisch schmecken. Mit Power präsentieren und rhetorisch punkten.Thomas Skipwith; Reto B. RüeggerOrell Füssli, 2011Bei Amazon: EUR 29.90
Täglich werden Millionen von Präsentationen gehalten. Leider meistens falsch. Die Zu-hörer langweilen sich, wissen nicht, worauf der Redner hinaus will. Wie präsentiert man so schmackhaft, dass die Zuhörer sofort anbeissen? Und wie schafft man es, dass sie während der Präsentation nicht wieder vom Angelhaken gehen?
Zwei Meister in Sachen Rhetorik und Präsentationstechnik machen es vor. Sie zeigen, wie man zielgruppengerecht, witzig und strukturiert Fachwissen vermittelt: mit packen-den Einleitungen, kernigen Aussagen, visuellen Animationen und überzeugender Gestik. Ob für Videokonferenzen, Kongresse oder betriebsinterne Meetings: Die Autoren halten Tipps und Tricks bereit, die mitreissen und überzeugen. Zusätzlich stösst man im Buch auf Tipps für den Einsatz von PowerPoint, das Power-Präsentationsmodell, die Clear-Message-Struktur (zehn Schritte zum roten Faden) und für internationale Auftritte.
MARKETING

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.
Schlüsselerlebnisse an der Messe «Sicherheit» Besuchen Sie uns vom 15. bis 18. November in Zürich – Halle 3, Stand 108.
www.keso.com
honourable mention 2011

36 KMU LIFE · 05/2011
XXXXXXXXXXXXX
MarktersChLiessung in VoLatiLen zeiten
Gerade für KMU sind Auslandmärkte schon immer eine spezielle Herausfor-derung gewesen. Jetzt ist es an der Zeit, mit heissem Herz und kühlem Kopf zu handeln. Wir fragen einen Experten mit theoretischem und praktischem Hintergrund nach den vorherrschenden Tendenzen und den Abbau von zent-ralen Hürden.
Interview mit Michael Neubert von Georg Lutz
Den Sprung wagen

AUSSENWIRTSCHAFT
37KMU LIFE · 05/2011
Kennen Sie schon KMU-Verantwort-liche, die wegen der Frankenstärke auf gepackten Koffern sitzen?
Das ist ein übertriebenes Bild. Diese Situation ist historisch nicht neu für Schweizer Unter-nehmen und die Verantwortlichen in der Zen-tralbank. Denken Sie an die Situation Ende der siebziger Jahre. Die Deutsche Mark drückte den Franken in die Höhe. Die Währungsturbulenzen beschleunigen aber schon vorhandene Trends und differenzieren sie aus.
Sie meinen den Trend der Produktionsverlagerung.
Ja, das ist ein zentraler Punkt. Allerdings gibt es Verschiebungen. Früher war klar, dass erste Schritte einer Markterschliessung in erster Li-nie innerhalb des nächsten Wirtschaftsraums, bei uns ist es die Europäische Union, relativ ri-sikolos ablaufen. Man geht nach Deutschland, Österreich, Italien oder Frankreich. Inzwischen haben sich die politischen und ökonomischen Risiken massiv erhöht. Es ist nicht mehr ausge-schlossen, dass es innerhalb der EU nicht nur private, sondern auch staatliche Zahlungsaus-fälle geben wird. Diese Situation ist neu. Zwei-tens hat sich der Euro gegenüber den Währun-gen der meisten Schwellenländer abgewertet. Somit werden insbesondere wachstumsstarke Schwellenländer im Vergleich zu den Ländern der EU attraktiver.
Zwei Stichworte prägen aus meiner Sicht die Situation: Internationale Markterschliessung und verunsicher-te Märkte. Diese sind auf den ersten Blick nicht gerade kompatibel. Wie analysieren Sie die Situation?
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten haben Unternehmen grundsätzlich zwei Handlungsal-ternativen: Die meisten Unternehmen agieren vorsichtig und fokussieren sich auf etablierte Märkte – dies ist meistens der Heimatmarkt–und sparen. SoverständlichdieseEntschei-dung auch ist, so wenig macht sie in der aktu-ellen politischen und wirtschaftlichen Situation der Triade-Länder (= USA, EU, Japan) Sinn. Die Konzentration auf stagnierende Märkte mit wachsenden Risiken und oftmals auch zuneh-mender Regulierung ist keine gute Rahmen-bedingung für nachhaltiges und profitables Wettbewerbsfähigkeit durch Diversifikation erhalten.

38 KMU LIFE · 05/2011
AUSSENWIRTSCHAFT
Wachstum. Hier ist eher Angst als innovatives und nachhaltiges Unternehmertum das Hand-lungsmotiv.
Damit kommen wir zur zweiten Handlungsal-ternative: Sie gehen aktiv in Wachstumsmärk-te und entwickeln diese nachhaltig. Dies bein-haltet explizit keine «Hit-and-run»-Strategie. Der Schritt in neue Märkte erfordert Geduld, Nachhaltigkeit und vor allem ein professionel-les Management, weil Sie in ein neues Land gehen, dessen Rahmenbedingungen und Strukturen Sie kaum kennen. Neben den Risi-ken gibt es aber auch positive Grundlagen und Erfahrungen. Es gibt eine Vielzahl von Bei-spielen wie sich eigentümergeführte KMU mit einer Internationalisierungsstrategie die Rolle des Weltmarktführers in ihrer Marktnische si-chern konnten, weil sie schnell entscheiden, vielleicht sensibler auf lokale Anforderungen eingehen, wirklich vor Ort bleiben wollen und nicht den hohen Druck von Quartalsabschlüs-sen haben.
Wie kann ein KMU sich in einer solch komplexen Situation orientieren? Die Verantwortlichen sind doch oft schlicht überfordert und können sich keinen teuren Consultant leisten.
Davon würde ich auch abraten. Es gibt doch in der Praxis erfolgreiche Schweizer KMU. Schauen wir uns deren strategischen Schritte an. Zunächst geht es um Exporte, den Verkauf der eigenen Produkte im Ausland. Zudem schauen sie nach Zulieferern aus anderen Währungsräumen, um Währungsrisiken zu minimieren. Das ist der erste Schritt zur Sammlung wichtiger Erfahrungen.
Ein nächster Schritt ist zum Beispiel die Grün-dung einer lokalen Vertriebs- und Service-niederlassung, um Kunden vor Ort besser zu betreuen oder der Verkauf von Lizenzen, die Gewinnung von lokalen Franchisenehmern und Joint Venture Partnern. Nun ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Verlagerung einzelner Kom-ponenten und Produkte.
Wie steigert ein KMU seine Wettbe-werbsfähigkeit durch eine Erschlies- sung internationaler Märkte?
Durch die Diversifikation des Umsatzes auf verschiedene Märkte und Regionen reduziert sich das Risiko. Mit der Erschliessung mehrerer Auslandsmärkte ist auch von einer Umsatzstei-gerung für jedes einzelne Produkt auszugehen. Diese führt zu Synergie- und Skaleneffekten, welche einerseits zu niedrigeren durchschnitt-lichen Produktionskosten führen sollten und durch die Lerneffekte zu besseren Produkten.
Viele KMU haben auch begonnen, die Produk-tion in Schwellenländer zu verlagern. Dies gilt vor allem für Produkte mit ausgereiften Tech-nologien, welche im Produktlebenszyklus die Marktreife erreicht haben. Hier geht es meis-tens um den Erhalt der Profitabilität bei einem steigenden Preiswettbewerb. Damit verlängert man den Produktlebenszyklus und erhält sich eine «cash cow».
«Man darf siCh aLs unternehMer niCht bLind VoM MediaLen krisengerede ansteCken Lassen.»
Neue Märkte erfordern Geduld, Nachhaltigkeit und vor allem ein professionelles Management.

ALPHABET. IHR FLOTTENMANAGEMENT VON A BIS Z.
Als markenunabhängiger Flottenmanagementpartner sind wir kein gewöhnlicher Fuhrparkverwalter. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden exzellenten Service und ein perfekt auf sie zugeschnittenes Mobilitätskonzept.
Gerne passen wir unsere Dienstleistungen optimal Ihren Bedürfnissen an. Finden Sie mehr über uns heraus: www.alphabet.ch
telefon +41 58 269 65 67 e-mail [email protected] www.alphabet.ch
Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J KE F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O PW Y Z A B C D E L I V E R I N G E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZT U V W Y Z A B C D E X C E L L E N C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
■ Full-Service-Leasing■ Finanzleasing■ Fleet-Management■ Mitarbeiterleasing■ Motivationsleasing
■ Car-Policy-Consulting■ Fleet-Consulting■ Onlinereporting■ Autovermietung■ Schadenmanagement
405.001.01_11.009_Financial_Services_Alphabet_210x297+3_d_4f_KD.indd 1 15.07.11 17:37

40 KMU LIFE · 05/2011
AUSSENWIRTSCHAFT
Von einem Produktionsstandort in einem Schwellenland ist es oftmals auch einfacher die Produkte an lokale Marktanforderungen anzu-passen. So sind die Anforderungen in Schwel-len- und besonders Entwicklungsländern un-terschiedlich. Stromausfälle, Schwankungen in den Produktionsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) aufgrund fehlender Klimaan-lagen und Luftfilter, der Ausbildungsstand der Mitarbeitenden erfordern oftmals robuste und einfache Maschinen, die nicht die letzte tech-nologische Neuheit enthalten müssen.
Viele Kommentatoren malen den Hori-zont für Schweizer Unternehmen we-gen der Frankenstärke trotzdem eher schwarz. Können sie mit pessimisti-schen Sichtweisen etwas anfangen?
Nein, überhaupt nicht. Man darf sich als Un-ternehmer nicht blind vom medialen Krisen-gerede anstecken lassen. Wenn Sie historisch verschiedene Fallbeispiele von starken Wäh-rungen anschauen, erleben Sie fast immer den gleichen Mechanismus. Wenn Währungen stärker werden, werden auch Volkswirtschaf-ten stärker. Die aktuelle Problematik besteht in einem Zeitfaktor. In den letzten Monaten gab es zu viele und zu schnelle Aufwertungs-schübe. Mit der de facto-Fixierung des Euro-Wechselkurses kauft die Nationalbank den Schweizer Exportunternehmen Zeit zur An-passung an die neuen Rahmenbedingungen.
Diese nutzen diese kleine Atempause und su-chen sehr aktiv Synergien zwischen den ein-zelnen Standorten. Der starke Franken und die aktuelle Talfahrt an den Börsen haben auch Vorteile für Schweizer KMU. So lassen sich heute Konkurrenten sehr preiswert erwerben und somit die internationale Marktposition einfach, günstig und schnell ausbauen.
Es gibt gerade in der Pharmabranche einige kleine Unternehmen, die sehr erfolgreich auf dem Weltmarkt sind. Ich habe ein Problem, solche Strate-gien auf andere Branchen im Werk-platz Schweiz zu übertragen. Wie sieht das im Maschinenbau aus?
Dies gilt für alle Unternehmen und Bran-chen. So gibt es immer Sieger und Verlierer des Wandels. Ich kenne kleine spezialisierten Maschinenbauer, die mit gut 200 Mitarbeiten-den und einer Produktion in der Schweiz und in China profitabler Weltmarktführer in ihrer Nische sind.
Beim Stichwort Schwellenländer fal-len wir immer die beiden konträren Sichtweisen ein. Entweder spricht man fast schon euphorisiert von den Zukunftsmärkten oder im gegenteili-gen Fall geht es um die Plagiate aus China. Sollten wir aber nicht auch aus sehr nüchternen Gründen eher
vorsichtig sein? In Südamerika gab es noch vor einem Jahrzehnt in Argenti-nien eine riesige Wirtschaftskrise ...
Als Unternehmer darf ich weder zu euphorisch sein noch die Augen vor Risiken verschliessen. Trotz der zweifellos guten Entwicklung der Schwellenländer ist deren Attraktivität vor allem relativ gestiegen, dass heisst durch die Schwäche von Japan, der USA und von Teilen Europas. Darüber hinaus hat jedes Land spezi-fische Risiken und Herausforderungen, die man vor dem Markteintritt kennen muss.
Gibt es strategische Tipps, die Sie un-seren Leserinnen und Lesern beson-ders ans Herz legen?
Märkte und Kulturen sind anders, aber weder besser noch schlechter. Als Unternehmer wissen Sie nie, ob Ihre Wettbewerbsvorteile auf einen an-deren Markt übertragbar sind. Zur Beherrschung der Komplexität einer Präsenz in verschiedenen internationalen Märkten benötigen Sie eine pro-fessionelle, dass heisst strukturierte Vorgehens-weise. Aus dieser Situation und vor dem Hinter-grund meiner beruflichen Erfahrungen habe ich einen Prozess entwickelt. Der heisst «company to new markets». Dieser Prozess erlaubt es mir schneller, billiger und mit weniger Risiken in neue Märkte zu gehen. Die Internationalisierung selbst kann dann zu einer Kernkompetenz und zu einem Wettbewerbsvorteil werden.
Ihr Buch «Internationale Markter-schliessung: Vier Schritte zum Auf-bau neuer Auslandsmärkte» ist jetzt in einer dritten Auflage erschienen. Üblicherweise verwendet man bei einem Standortwerk einige Zahlen und präsentiert ein neues Vorwort. War dies bei Ihnen auch so?
Nein, leider nicht. Ich hatte viel mehr Arbeit. Lassen sie mich ein Beispiel verraten: Früher gab es üblicherweise einen Auslandsmanager der für das Auslandsgeschäft zuständig war. Heute ist oft das ganze Unternehmen schon in-ternational aufgestellt. Solche fundamentalen und strukturellen Veränderungen sollten sich in einem Buch zur Aussenwirtschaft niederschla-gen. Als Autor eines Standardwerks bekommt man heute auch sehr viele Rückmeldungen, die man dann in sein Buch zusätzlich einarbeitet.
Sich am Start richtig in Position bringen.

AUSSENWIRTSCHAFT
3
Die eigene Website, ganz einfach. Mit dem WebsiteCreator schnell und kostenlos gestalten.
1. Design auswählen 2. Inhalt bearbeiten 3. Publizieren !
1 2
n.
JETZTGRATIS AUF
www.webland.ch
RZ_1_MAL_WEBSITECREATOR_205X135.ai 19.7.2011 14:52:24 Uhr
Dritte Auflage erschienenDie dritte Auflage des Standardwerks «Inter-nationale Markterschliessung: Vier Schritte zum Aufbau neuer Auslandsmärkte» ist jetzt verfügbar.
Gerade in ökonomisch unsicheren Zeiten braucht es Leitfäden für eine Internationa-lisierungsstrategie. Die zunehmenden poli-tischen und wirtschaftlichen Risiken in der EU und der wachsende Wettbewerb aus den Schwellenländern machen die internationale Markterschliessung selbst für KMU immer in-teressanter. Die Verbindung zwischen Praxis und Theorie beziehungsweise die Umwand-lung von Theorien in Werkzeuge, die die Erschliessung neuer, internationaler Märkte noch schneller, günstiger und risikoärmer werden lassen, machen dieses Buch für KMU-Verantwortliche wertvoll.
www.company2newmarket.com
Michael Neubert war, im Rahmen seiner mehr als fünfzehnjährigen Be-rufserfahrung, an Expansionsprojekten in zehn unter-schiedlichen Märkten beteiligt, in denen er Funktionen vom Projektleiter über den Leiter des Auslandsressorts eines Konzerns, den Geschäftsführer einer Auslandsgesell-schaft, den CEO eines Unternehmens mit Präsenz in sechs verschiedenen Ländern bis zum Verwaltungsrat innehatte. Er unterrichtet unter anderem als Dozent für Internationa-les Management in MBA-Programmen.
Weitere Informationen

42 KMU LIFE · 05/2011
XXXXXXXXXXXXX
ÜbernaChtungsMögLiChkeiten fÜr weine
Weinlogistik ist ein komplexes und zeitaufwendiges Aufgabenfeld. In Basel gibt es jetzt Lösungen, bei der sich Weinhändler wieder auf ihre Kernkompe-tenzen konzentrieren können. Wir führten ein Interview mit dem Geschäfts-führer des WeinHotels.
Interview mit Rolf Lang von Georg Lutz
Gut gebettet

MOBILITÄT
Stellen Sie sich vor, Sie sind Inhaber einer kleinen Wein-handlung. Wie sind Ihr Transport, Lagerung und Ihre Lo-gistik im Normalfall aufgestellt?
Meist sind die einzelnen Bereiche komplett getrennt. Für den Transport werden verschiedene Anbieter eingesetzt, das Lager führt man entweder selber in einer gemieteten Räumlichkeit, mietet Lagerfläche bei einem externen Anbieter oder lagert die Weine im Keller der Firma. Kommt eine Bestellung, geht man ins Lager, rüstet die Weine selber und stellt die-se zum Versand bereit. Bei der Auslieferung setzt man auf Partner oder liefert selber aus. Das sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Die Praxis ist aber oft mühsam. Die einzelnen Schritte, abgeschottet vonein-ander behandelt, kosten viel Zeit. Das wollen wir ändern.
Können Sie die Defizite weiter spezifizieren?
Ich weiss nicht, ob man hier von Defiziten sprechen kann. Es ist vielmehr so, dass enorm viel persönlicher Aufwand und Zeit investiert werden muss–undzwarineinenBereich,dernichtzwangsläufigzudenKern-aufgaben des Weinhandels gehört, sprich die Logistik und die Bewirt-schaftung des Lagers. Wenn die Weinhandlung diese zeitlichen Ressour-cen nicht aufwenden muss und sie dafür in die Lieferantenbetreuung, den Verkauf und das Marketing investieren kann, bringt das viele ent-scheidende Vorteile.
Sie kommen ja auch aus der Logistikbranche.
Richtig, dort habe ich während rund 20 Jahren meine Erfahrungen ge-sammelt. Es gibt in klassischen Speditionen viele Weintransporte. Weine werden aus dem Ausland in die Schweiz transportiert, gelagert und dis-tribuiert. Dies geschieht aber nicht als Prozess aus einer Hand, sondern ist Stückwerk. Hier setzt das WeinHotel an.
Kommen wir zu Ihren Zielgruppen. Es gibt hier in der Region grosse Anbieter. Dazu gehört die traditionelle Weinkellerei Schuler oder der Bioweinanbieter Delinat. Die haben von den Vertriebskanälen, über den Transport und die Lagerung alles im Programm und brauchen kein WeinHotel, oder?
Im Prinzip nicht, denn deren Logistikkette ist sehr professionell aufge-stellt. Grössere Anbieter haben in der Regel auch eigens dafür verant-wortliche Mitarbeiter welche oftmals aus der Logistikbranche kommen und sich somit bestens damit auskennen.
Sehe ich das richtig, dass Sie eher auf kleine Anbieter und private Weinliebhaber setzen?
Genau, das sind die Zielkunden. Einerseits unterstützen wir die klei-nen und mittelgrossen Weinhandlungen mit einer sehr professionellen Logistikdienstleistung. Damit können auch die «Kleinen» mit den oben erwähnten «Grossen» mithalten; bieten ihren Kunden einen Top Service und können sich durch die gewonnene Zeit intensiver um die Konsumen-ten kümmern. Andererseits gehen die Angebote des WeinHotels ja noch
viel weiter: Wir unterstützen auch den Verkauf und bieten mit dem Wein-laden und dem Webshop zusätzliche Absatzkanäle. An diesem Punkt sprechen wir auch den privaten Weinliebhaber an. Dieser trifft beim WeinHotel auf das mehr oder weniger ganze Sortiment verschiedenster Weinhandlungen an einem zentralen Ort. Die Verkaufspreise sind die gleichen wie beim Weinhändler selbst. Somit ist das für alle eine klassi-sche W(e)in-w(e)in-Situation.
Können Sie uns den Ablauf eines typischen Fallbeispiels skizzieren und verraten, welche Dienstleistungen der Kunde von Ihnen bezieht?
Gerne!WeinHotelerhältdieWeinedesWeinhändlers–meistensausdemAusland–angeliefert.DieLieferungwirdaufVollzähligkeit,Schädenundauch den optischen Eindruck überprüft. Stimmt etwas nicht, werden gleich Vorbehalte angebracht und dem Weinhändler gemeldet. Danach werdendieWeineerfasst–jedeeinzelneFlasche–undeingelagert.Sindes neue Weine, werden diese ebenfalls in den WeinHotel-Webshop sowie ins Ladensortiment aufgenommen.
43KMU LIFE · 05/2011

MOBILITÄT
Bestellt dann zum Beispiel Herr Müller aus Zürich bei diesem Weinhändler ein paar gute Tropfen, trifft die Bestellung über die Wein-handlung beim WeinHotel ein, wird gerüstet in spezielle Versandkartons gepackt und bereit-gestellt. Erfolgt die Bestellung vor 14:00 Uhr verlässt die Sendung das WeinHotel am glei-chen Tag und wird tags darauf in der ganzen Schweiz ausgeliefert. Ist Herr Müller zufällig in
der nächsten Zeit in Basel, kann er die Weine auch gerne bei uns abholen und spart sich so die Auslieferungskosten.
Das sind automatische Prozesse, die im Hin-tergrund ablaufen und den Weinhändler sowie seine Kunden nicht belästigen.
Im WeinHotel können, wie der Name sagt, sensible Weine «übernachten»?
Richtig, das WeinHotel verfügt über optimal temperierte und befeuchtete Lagerräume für unsere «Weingäste». Es geht aber nicht nur
um die sensiblen Weine. Privatpersonen kön-nen uns ihren ganzen Weinkeller zur Einla-gerung geben. Dies, weil sie vielleicht keine geeigneten Räumlichkeiten oder zu wenig Platz zur Verfügung haben. Allerdings la-gern wir auch eine einzelne Flasche ein. Es wäre doch schade, wenn Sie zum Beispiel einen Mouton-Rothschild aus dem Jahrgang 2005 geschenkt erhalten und diesen man-
gels Möglichkeiten in der 20 Grad warmen Küchenschublade aufbewahren müssten. Bei uns ist dieser bis zu seiner optimalen Trinkreife bestens aufgehoben. Zu dieser Dienstleistung gehört auch, dass WeinHotel dem Kunden die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt und eben zum Beispiel dieser Mouton zusammen mit Freunden bei uns getrunken werden kann.
Haben Sie eigentlich schon Anrufe von Touristen bekommen, die bei Ihnen ein Zimmer mit Wein buchen wollen?
Ja, da gibt es immer wieder Verwechslungen. Wir erhielten auch schon Beschwerdeanrufe, dass die Zimmerpreise nicht auf der Homepage aufgeführt sind …
Vielleicht gibt es auch in den Hotels in Basel zu wenig gute Weine. Das wäre doch eine neue Businessidee …
(Lacht) Ja, vielleicht in einigen Jahren.
Kommen wir zurück zu Ihrem Alltag. Sie kommen, wie bereits erwähnt, aus der Logistikbranche. Das ist ein Rahmen mit vielen staubtrockenen Zahlen und Themen. Wie hat sich Ihre Beziehung zu guten Weinen auf-gebaut?
Für Insider wie mich ist Logistik kein trockenes Thema. Aber kommen wir zu meinem persönli-chen Verhältnis zu Wein. Zuerst war das Thema Wein nur ein Hobby, danach eine Leidenschaft. Diese bringt mit sich, dass man Weingebiete bereist, sich mehr und mehr Literatur beschafft sowie Seminare und Kurse besucht. Danach haben sich meine beruflichen Weiterbildungen ausschliesslich auf das Thema Wein fokussiert. Abgesehen davon, dass mich das Wissensge-biet «Wein» enorm interessiert, ist es mir auch wichtig, gegenüber meinen Kunden ein kom-petenter Ansprechpartner zu sein. Wenn ein
«iCh bringe diese untersChiedLiChen Prozesse zusaMMen.»

1 Nettopreise exkl. MWST für gewerbliche Kunden mit Handelsregistereintrag. Angebot gültig bis 31.12.2011.
Die Wirtschaft swunder: Jetzt bis zu Fr. 11’000.- Preisvorteil.Mit seinen brandneuen, hocheffi zienten Euro-5-Motoren erreicht der neue Transit beeindruckend niedrige Kilometerkosten. Die Fahrzeugpalette mit Front-, Heck- oder Allradantrieb deckt als Kastenwagen, Chassis-Kabine oder Personentransporter alle Bedürfnisse ab. Erfahren Sie mehr zu den Ford Nutzfahrzeugen bei Ihrem Ford Business Center oder Ford Händler.
TRANSIT ford.ch
LIEFERWAGEN START-UPAB FR.
20’990.-1
KIPPER 350 PLUSAB FR.
38’990.-1
PERSONENTRANSPORTERAB FR.
27’990.-1
Weinhandelskunde Weine aus Concà de Barbe-ra importiert oder ein privater Weingeniesser Fragen zu Taurasi hat, sollte ich schon wissen, um welche Weine es sich dabei handelt. Ich kann jetzt das Gelernte mit meiner emotiona-len Beziehung zum Wein zusammenbringen.
An der Schnittstelle, zwischen dem emotionalen Thema Wein und den Businessthemen Logistik und Lage-rung, haben Sie eine Lücke entdeckt. Die Geschäftsidee kam Ihnen sicher bei einem Glas Wein?
Bei einem Glas Wein kommen immer sehr gute Ideen, leider lassen sie sich dann nicht immer so einfach umsetzen. Nein, diese Geschäftsidee
entwickelte ich während rund drei Jahren und beruht natürlich auf Erfahrungen im berufli-chen und privaten Umfeld. In der internationa-len Transportbranche hat man viel mit Weinen aus aller Welt zu tun. Sie werden transportiert, gelagert und geliefert … Als Konsument erle-be ich die Dienstleistungen meines Lieferanten ebenfalls und sehe, dass die Logistik für diese sehr aufwendig und zeitraubend ist. Ich bringe diese unterschiedlichen Prozesse zusammen. Das Effizienzpotential steigert sich und die Kosten nehmen ab.
Werfen wir doch zunächst beispiel-haft einen Blick auf den Weinmarkt in der Region Basel. Wie ist der auf-gestellt und aufgeteilt?
Dieser ist fantastisch! Wenn man sich die Mühe macht und genau hinschaut, findet der Konsument fast alles. Es gibt alleine in der Region Nordwestschweiz über 120 Weinan-bieter. Man trifft auf die bekannten Marken-weine, absolute Spezialitäten aus allen Län-dern dieser Welt und natürlich die Angebote im Detailhandel. Basel ist eine internationale Stadt. Dies hilft sicher dabei, Spitzenweine aus der ganzen Welt hier geniessen zu kön-nen. Schwerpunkte sind zurzeit Weine aus Ita-lien, aber auch deutsche und österreichische Weine treffen wir vermehrt an. Last but not least sind die Schweizer Winzer zu erwähnen. In ihrer Mehrzahl, haben sie in den letzten Jahren an Qualität zugelegt.
Bei Ihnen kann man die Weine auch geniessen und kaufen?
Das ist ein weiteres Argument für das Wein-Hotel. Der Weinliebhaber hat ein sehr grosses Sortiment an Weinen zur Auswahl, in der Regel kann er die bei uns degustieren oder glaswei-se trinken. Wir verkaufen aber die Weine nicht als WeinHotel, sondern unter dem Namen des Weinhändlers. Das WeinHotel ist kein Wein-händler, sondern eine zusätzliche Verkaufs- und Präsentationsplattform.
Weiter zum Praxistest.
MOBILITÄT

46 KMU LIFE · 05/2011
Jetzt springen wir ins kalte Wasser. Ich nenne Ihnen den Gang einer Menüfolge und Sie spielen Somme-lier, geben Ihre Weinempfehlung dazu ab.
Wir fangen mit einer italienischen Vorspeise an. Welchen Wein würden Sie zu Vitello Tonnato empfehlen?
Es gibt die unerschütterlichen Weisheiten, die nicht ganz falsch sind. Das gilt auch hier: Zu einem klassischen italienischen Gericht würde ich auch einen italienischen Wein empfehlen. In diesem Fall wähle ich einen schönen Soave aus dem Veneto. Der Soave unterstützt das Es-sen, seine harmonische Säure harmoniert hier hervorragend mit der Speise.
Machen wir es etwas komplizierter. In England gibt es meines Wissens kaum Weinanbaugebiete. Ein eng-lisches Lamm mit Pfefferminzsauce und Kartoffelstock braucht sicher auch einen speziellen Wein?
Das ist eine Strafaufgabe, aber versuchen wir es. Ein Lamm mit einem starken Eigenge-schmack verlangt nach einem charaktervollen
Wein. Eigentlich wäre ein Gran Reserva aus Spanien hierzu prädestiniert, allerdings käme er nicht mit der Pfefferminzsauce zurecht. Ich würde es also mit einer Riesling-Spätlese von der Mosel oder der Pfalz probieren. Der Ries-ling mit seiner Restsüsse und seinem vollen Körper könnte hier sehr interessant sein.
Umgekehrt gibt es Gerichte, die auf den ersten Blick flach wirken und Un-terstützung brauchen. Nehmen wir eine Gemüsepfanne. Wie lautet Ihr Tipp hier?
Hier sollten wir beim Weisswein mit schöner Frucht und einer belebenden Frische bleiben. Weissweine sind für mich grundsätzlich, auch wenn Sie da Widerspruch hören werden, die besseren Essensbegleiter. Wenn asiatische Ge-würze mit ins Spiel kommen würde ich mich im Elsass oder Ungarn umschauen. Hier darf es ein blumiger Weisswein mit etwas Restsüsse sein, zum Beispiel ein Gewürztraminer oder ein schöner Furmint.
Bei einem geschmorten Rinderfilet auf einem Gemüsebett schwenken Sie aber auch sicher auf einen Rot-wein um? www.weinhotel.ch
Rolf Lang ist Geschäftsführer im WeinHotel.
Weitere Informationen
Der Praxistest
Ja, hier darf es ein hochwertiger, körpervoller Rotwein sein. Ein guter Barolo oder ein tradi-tioneller Rioja ist immer noch etwas Phantas-tisches.
Kommen wir zum Dessert. Dessert-weine sind ein heikles Thema. Wir kredenzen einen Fruchteisbecher.
Ich bin froh, dass der Moscato wieder eine Re-naissance erlebt und würde solch eine Flasche auf den Tisch stellen.
MOBILITÄT

Wasserspender von Oxymount liefern erfrischendes Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Still, oder angereichert mit Kohlen-säure und Sauerstoff. Oxymount Wasserspender sind die ökologische und ökonomische Lösung für mehr Power und längeren Atem Ihrer Mitarbeiter. Testen Sie das passende Gerät für Ihren Betrieb jetzt einen Monat lang gratis und franko.Mehr Informationen unter www.oxymount.ch oder 044 783 86 66.
Wasserspender von Oxymount liefern erfrischendes Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Still, oder angereichert mit Kohlen-
WER
BEAN
STAL
T.CH
023_0311004_Oxymount_Anz_205x275_KMU_Life.indd 1 13.10.11 16:49

48 KMU LIFE · 05/2011
finanzieLL fLott Mit fLottenLeasing
Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise und der verstärkten Finanzmarkt- regulatorien für Kreditinstitute haben einen deutlich spürbaren Einfluss auf die Einschätzung der Kreditwürdigkeit von KMU, die Kapitalbeschaffungs-kosten sowie die Berichterstattungspflicht gegenüber Finanzinstituten. Fast scheint es, als würde der Druck von oben an die Kundschaft weitergereicht werden. Aus dieser Situation ergeben sich einige Fragen, die im folgenden Beitrag beantwortet werden: Welchen Stellenwert haben nun Finanzierungs-formen wie das Fuhrparkleasing im Umfeld der betrieblichen Fremdkapital-struktur? Und welche Vorteile erwachsen daraus, die Finanzierung von Be-triebsmitteln in mehrere Hände zu legen?
von Beat Imwinkelried
Luft zum Atmen
Die Massnahmen zur Umsetzung der EU-Richtlinien aus dem Jahr 2006 für Eigenkapitalvorschriften und eine bessere Aufsicht des Bankenwesens,
die unter dem Terminus «Basel II» bekannt sind, wurden vom Basler Ausschuss für Bankenauf-
sicht vorgeschlagen und müssen seit Januar 2007 in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union für alle Kredit- und Finanzdienstleistungs-institute angewendet werden. In der Schweiz wird die Umsetzung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) überwacht.
Eines der Hauptziele von Basel II ist die Siche-rung einer angemessenen Eigenkapitalausstat-tung von Finanzinstituten, um ihr Insolvenzrisiko bei Forderungsausfall zu minimieren. Die staat-lich verlangten regulatorischen Anforderungen verlangen ausserdem, dass das tatsächliche Risi-ko bei der Kreditvergabe stärker gewichtet wird. Als Folge davon wird der Firmenkunde einem Rating unterzogen, welches seine Bonität und Kreditwürdigkeit definiert. Generell gilt: höhere Risiken gleich höhere Zinsen. Wenn die Bank bei einem schlechten Rating mehr Eigenkapital un-terlegen muss, erhöhen sich ihre Eigenmittelkos-ten. Das macht den Kredit durch höhere Zinsen teurer. Umgekehrt profitiert ein Kreditnehmer mit gutem Rating von niedrigeren Kreditzinsen, weil die Bank für den Kredit geringere Eigenmit-tel hinterlegen muss.
MOBILITÄT

49KMU LIFE · 05/2011
Parallel zu dieser Entwicklung schlitterten die Weltwirtschaft und das Bankenwesen jedoch in die im Frühjahr 2007 beginnende Subprime-Krise und in die im Herbst 2008 kulminierende, vom Investmentsektor ausgehende US-Ban-kenkrise. Dies verschärfte den Druck und der Ruf nach weiterführenden Regulatorien wurde lauter. Deshalb wurde auf der Basis der Erfah-rungen von Basel II das im Dezember 2010 veröffentlichte Regelwerk «Basel III» ins Leben gerufen, das ab 2013 schrittweise in Kraft tre-ten soll. Zusätzlich zu den Anforderungen an eine Risikomessung sowie bankenaufsichtli-che Überprüfungs- und Offenlegungsprozesse kommen künftig noch die sogenannte Levera-ge-Ratio (die Höchstverschuldungsrate) sowie Regelungen zur Mindestliquidität hinzu.
Ein «circulus vitiosus» und Wege hinausAlles in allem werden die Rahmenbedingungen für eine Kreditaufnahme bei einem Finanzie-rungsinstitut nicht einfacher aber teurer. Mehr noch verstärken die eingeleiteten Massnahmen anstelle einer antizyklischen Förderung einen konjunkturellen Abschwung:
• Unternehmen des Mittelstandes verfügenhäufig über eine schlechtere Eigenkapital-struktur, was zu einem schlechteren Rating und infolge dessen zu höheren Finanzie-rungskosten sowie Auflagen an den Kredit-rahmen führen kann.
• Die Entwicklungskraft von KMU wird ge-bremst, weil ihnen durch die oben beschrie-benen Regulatorien durch höhere Zinsen und eine Kreditlimite weniger finanzielle Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen. Da-mit erhöht sich der Druck auf die Liquidität.
• Den Finanzinstituten steht heute wenigerKapital für die Kreditvergabe zur Verfügung. Das heisst, Kreditanträge mit Risiko werden unter Umständen zurückgewiesen.
• Gerade inwirtschaftlichangespanntenZei-ten, wenn es womöglich auf den zugespro-chenen Bankkredit ankommt, sinken die Finanzierungsmöglichkeiten der Banken, weil steigende Kreditausfallraten zu einem höheren Eigenkapitalerfordernis führen.
Wie können sich kleine und mittelständische Unternehmen dennoch bestimmte Freiräume mit finanzieller Luft zum Atmen schaffen?
Der Finanzierungsmarkt bietet heute eine ganze Reihe von Produkten für die kurz-, mittel- und langfristige Finanzierung an: vom klassischen Bankkredit über die Forderungsabtretung (Fac-toring), Mezzanine-Kapital (stimmrechtsloses Eigenkapital) bis hin zum Leasing von Anla-gevermögen respektive Betriebsmitteln wie Produktions-/Bau- und Büromaschinen, IT-In-frastruktur und Fahrzeugen wie Personenwa-gen und Nutzfahrzeuge.
Steht Eigenkapital zur Verfügung wird dieses eher in werterhaltendes oder gar wertsteigern-des Anlagevermögen wie Grundstücke oder Beteiligungen investiert und am ehesten in zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören-de Anlagen oder Lizenzen.
Fremdkapital kostet immer Geld, die Frage ist nur wie viel. Die für den Zweck oder das Objekt beste Finanzierung ist zu suchen unter der
Finanzierungsmöglichkeiten beim Flottenmanagement passgenau auswählen.
MOBILITÄT

50 KMU LIFE · 05/2011
www.auto-interleasing.ch
Beat Imwinkelried ist Vorsitzender der Geschäftslei-tung und Präsident des Verwal-tungsrats bei Auto-Interleasing AG.
Weitere Informationen
Berücksichtigung, die Kreditwürdigkeit für wichtige Projekte nicht zu blockieren oder zu gefährden. Beispielsweise ist ein Bankkredit für die Finanzierung des Wagenparks, welcher einer naturgemässen Fluktuation unterliegt, in der Regel teuer und unflexibel. Unter Um-ständen belegt er auch noch benötigtes lang-fristiges Fremdkapital für Erneuerungen oder Erweiterungen von Produktionsanlagen.
Schauen wir uns im Folgenden die Möglichkei-ten und die Vorteile des Fuhrparkleasings et-was genauer an.
Flottenleasing – Finanzierung mit geringem RisikoEine umsichtige Geschäftsführung sucht immer nach einem möglichst effizienten Einsatz der fi-nanziellenMittel–einbedeutenderAspektfürdie nachhaltige Entwicklung des Unternehmens. Um den finanziellen Spielraum für wichtige In-vestitionen und Entwicklungsschritte zu bewah-ren, werden Betriebsmittel wie Fahrzeuge am besten durch Leasing finanziert. Leasingraten sind objektbezogene, kalkulierbare und bud-getierbare Verbindlichkeiten, welche im Rah-men der monatlichen Rechnungsstellung einen durchlaufenden Posten darstellen. Sie belasten die Bonität und die vollumfängliche Ausschöp-fung einer Kreditlimite für grössere Anschaffun-gen nicht. Ausserdem werden beim Leasing in der Regel keine Sicherheiten verlangt.
Das Motto heisst: Nutzen, statt kaufen. Fahr-zeuge verlieren naturgemäss rasch an Wert, und mit dem derzeitigen Euro-Franken-Wech-selkursverhältnis bieten sie darüber hinaus keinen echten Vorteil für das Anlagevermögen. Innert kürzester Zeit haben Autos bis zu knapp einem Drittel ihres Neubeschaffungswertes verloren, was sich auch im Wiederverkauf nie-derschlägt und somit auch bei der Veräusse-rung deutlich weniger an Umlaufvermögen in die Kasse zurückfliesst.
Ein weiterer Aspekt ist die Verteilung der Fi-nanzmittelbereitstellung auf mehrere Pfeiler. Die Zeiten der Hausbank, die für alle Notfälle einspringt, sind längst vorbei. Heute haben die Informationsbeschaffung und verschiedene Geschäftsbeziehungen eher virtuellen Charak-
ter angenommen. Vieles wird über das Internet eingeholt und abgewickelt, so auch Finanzie-rungsmöglichkeiten. Warum die bestmögliche Finanzierung nicht dort beschaffen, wo ich die beste Leistung für mein Geld erhalte? Im Fall des Fahrzeugleasings eignen sich reine Lea-singgesellschaften hierfür am ehesten, weil sie keine Quersubventionierung betreiben müssen wie bei den bankenangegliederten Leasingpro-fitcenters oder der herstellereigenen Leasing-firma. Darüber hinaus verfügt eine klassische Leasinggesellschaft in der Regel über eine langjährige, solide Erfahrung und ist bewährter Profi in seiner Geschäftstätigkeit.
Mehrwert durch FlottenmanagementHinzu kommt der ausgesprochene Mehrwert, welcher ein Leasingprofi zu leisten vermag; nämlich das Fahrzeugmanagement von der Be-schaffung über die Dienstleistungen während der Laufzeit bis hin zum Wiederverkauf nach Vertragsende. Das hält dem Personal den Rü-cken frei, sich voll auf die geschäftsnotwendi-gen Prozesse zu konzentrieren.
Gesellschaften für Flottenleasing bieten ver-schiedene Finanzierungs-/Dienstleistungslö-sungen an:
• DasreineFinanzleasing,wobeidiegesamteadministrative Abwicklung und Betreuung der Flotte beim Leasingkunden bleibt.
• DassogenannteFullServiceLeasing,beidemsämtliche Dienstleistungen wie Wartung/Unterhalt, Treibstoffmanagement, Schaden- management, Verkehrssteuer bis hin zur Vi-gnette und dem Ersatzwagen ausgelagert werden. Eine Teilauswahl von definierten Services und Outsourcing an den Flottenma-nager ist ebenfalls möglich.
• Die reine Fahrzeugverwaltung (Manage-ment only), bei dem der Kunde die Fahr-zeuge selbst beschafft und alle zur Flotten-verwaltung gehörenden Dienstleistungen auslagert. Dies bietet zwar den Vorteil, Per-sonal zielgerichtet für das Kerngeschäft ein-zusetzen, hilft aber nicht primär beim Erhalt der vollen Bonität bei engeren Eigenkapital-verhältnissen.
Ausserdem können Fahrzeug«flotten» bereits ab einem Fahrzeug ins Leasing überführt wer-den – ein Vorteil, den sich die vielen kleinenund mittelständischen Unternehmen in der Schweiz zunutze machen können.
Neuere Finanzierungsansätze beim Fahrzeug-leasing berücksichtigen ausserdem die Nut-zung der Fahrzeuge. Beim klassischen Fahr-zeugleasing wird die Leasingrate auf der Basis einer definierten Gesamtlaufzeit und Jahres-kilometerleistung berechnet.
Will oder kann sich der Leasingkunde noch nicht gleich zu Beginn auf eine Gesamtlaufzeit des Fahrzeugs festlegen und müssten noch saisonale Schwankungen im Einsatz der Fahr-zeuge berücksichtigt werden, kann auch die monatliche Abrechnung nach effektiv gefah-renen Kilometern erfolgen. Im Kilometerpreis sind dann alle definierten Dienstleistungen eingerechnet.
MOBILITÄT

Harsch weltweite Umzüge undRelocation Service
Einen Umzugohne Qualen und Sorgen
wird Ihnen Harsch besorgen
www.harsch.ch
� Höchster Qualitätsstandard
� Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
� Spezialist für Kunsttransporte
� Relocation Service
� Experte für Umzüge weltweit
Bertrand HarschCEO
Steve ScheiwillerDirector Filiale Zürich
GENEVA10, rue Baylon � 1227 CarougeTel. +4122 / 300 4 300Fax +4122 / 300 17 46 e-mail: [email protected]
ZÜRICHIm Vorderasp 4 � 8154 OberglattTel. +4144 / 851 51 00 Fax +4144 / 851 51 05 e-mail: [email protected]
BASELSchlossmattweg 27 � 4142 MünchensteinTel. +4161 / 411 56 17 Fax +4161 / 411 56 18e-mail: [email protected]
LAUSANNE3, Av. du Tribunal Fédéral � 1005 LausanneTel. +4121 / 320 4 300 Fax +4121 / 320 43 01e-mail: [email protected]
Umzüge Relocation Archiv Verwaltung Kunsttransporte
Gratis Nummer 0800 HARSCH oder 0800 016 016Gratis Nummer +800 SWISSMOVE oder +800 88 44 88 44
ann BHA+SSC all_ann BHA+SSC all 20.01.11 09:40 Page1

52 KMU LIFE · 05/2011
unternehMenskuLturen und kreatiVität
Was heute in ist, ist morgen Schnee von gestern. Menschen kommen und gehen. Trends entstehen und werden wieder begraben. Wer auf dem Markt erfolgreich sein will, muss nicht nur sich, sondern auch seine Produkte immer wieder neu erfinden. Wie geht man in turbulenten Zeiten mit dieser Schnelllebigkeit um? Gerade in Zeiten der Krise hätten auch abnormale Ideen viel grössere Chancen, umgesetzt zu werden, meint Betty Zucker.
Interview mit Betty Zucker von Georg Lutz
«Die guten Zeiten sind vorbei, bessere stehen an»

53KMU LIFE · 05/2011
HUMAN RESSOURCE
In der ICT-Branche geht alles immer schneller. Dadurch wird die Produkti-on – auch in anderen Branchen – im-mer effizienter und manchmal sogar nachhaltiger. Das ist auf den ersten Blick eine tolle Entwicklung. In Wirk-lichkeit geht diese aber immer nur in eine Richtung. Ist das auf den zwei-ten Blick nicht bedenklich?
Selbstverständlich gibt es auch eine Kehrsei-te: Unsere High Performance-Leistungsge-sellschaft steht auf der Kippe zur Müdigkeits-gesellschaft. Die Schöpfer werden erschöpft. Und Erschöpfte sind selten kreativ. Gleichzeitig brauchen wir vor allem Innovation.
Krankheiten wie Depression, Aufmerksam-keitsdefizits- und Burnout-Syndrome nehmen zu. Jedes Zeitalter hat seine Leitkrankheiten. Ging es früher noch darum, gefährliche Fremd-körper von aussen durch ein starkes Immunsys-tem abzuwehren, müssen wir heute vielmehr «systemimmanente» Bedrohungen bekämp-fen. Wir laufen Gefahr, uns selbst krank zu machen und Täter und Opfer zugleich zu wer-den–unddasfreiwillig!Früher«durften»wir–oderauchnicht–, esgabVerboteundGe-setze, Kommandos und Kontrollen. Heute gibt es Projekte und Initiativen, es dominiert das Paradigma des «Könnens». Yes we can! Perfo-mance! «Sollen» ist viel weniger motivierend undeffizientals«Können»–biswirnichtmehrkönnen. Wir bestehen ja aus circa 60 Prozent Wasser, sprich die «wetware» macht oft nicht mehr mit.
Bis vor ein paar Jahren glaubten wir, wir hät-ten dank Multitasking und Informationstech-nologien mehr Zeit, um mehr zu erledigen. Inzwischen zeigen Studien, dass wir von Mul-titasking buchstäblich high werden, weil unser Hirn Dopamin ausschüttet. Wir fühlen uns wie der Herr des Universums, in Wirklichkeit neh-men unsere Leistung und Kreativität mit jeder dieser Aufgaben ab. Im Moment geht es uns zwar besser, unter dem Strich leisten wir jedoch weniger.
So halten viele auch immer häufiger die Bedeu-tung von «Suchen» und «Nachdenken» nicht mehr auseinander. Wir googeln und finden eine von vielen Antworten, die wir akzeptie-ren. Die Ergebnisse sind rasch gut genug. Dabei
ginge die kreative, wertschöpfende Arbeit jetzt erst los. Wenn wir nur die ersten Hits anschau-en, blenden wir die interessanten Nischen und Überraschungen einer Google-Recherche oft aus. Doch solche Entdeckungen brauchen ZeitundMusse–kaumjemandwillundkanndies noch auf sich nehmen. Ausserdem warten schon die nächsten 20 «tasks», das Lichtlein blinkt – und eine Dopamin-Belohnung lockt.So begnügen und vergnügen wir uns mit den tief hängenden Früchten, hier und da wird ein bisschenoptimiert–diegrossenInnovationenbleiben allerdings aus.
Schliessen sich Managementlogik und Innovationslogik dabei nicht aus?
Die Managementlogik für das operative All-tagsgeschäft basiert auf der Planung, der Be-rechenbarkeit, der Disziplin und der Einhaltung von Regeln. Innovationen, das Finden und Er-
finden und die so heiss ersehnten Durchbrüche basieren jedoch auf Verletzungen der allgemei-nen Regeln. Es sind Grenzüberschreitungen, kreative Veränderungen der Routinen im Den-ken und Handeln. Das Motto lautet «rules are forfools»–dercasusknaxus,derdieKunstdesManagements herausfordert.
Innovationen entstehen oft aus Fehlern, Zufäl-len, grossen Träumen (Fliegerei, Olympische Spiele, Datenautobahn, Wikipedia), Frustra-tionen (Facebook). Die Ideen entwickeln sich dann oft in andere Richtungen als erst erwartet –jenseitsvonQuartalsrhythmenunddenCon-trollingvorgaben. Neue Gedanken und grosse Ideen verlangen Zeit, Grosszügigkeit und eine Art innere Ruhe, um blühen zu können. Ich weiss, das ist leichter gesagt als getan. Der normale betriebliche Wahnsinn, verbunden mit seinem nervtötenden Geprassel, seinem See-lenverschleiss, «always on» zu sein und dabei nach aussen stets ein reputierliches Gesicht
zeigen zu müssen, und das in jeder Lebenssitu-ation ... Das alles summiert sich zum manageri-alen Konzentrationsschredder – Gift für eineinnovative Atmosphäre.
Wo findet man heute in Unterneh-men noch Oasen der Kreativität be-ziehungsweise kreative Geister?
Mankann sie an vielenOrten finden–wennman es zulässt. Oft findet sich der kreative Geist im «Querulant», dessen quere Gedanken und Anliegen die betrieblichen Routinen und Konzepte stören, oder im «Schwätzer», der zu oft und zu lange in der Cafeteria mit Espressi hantiert, oder draussen mit seinen Kollegen raucht oder Spaziergänge den Sitzungen oder «conf calls» vorzieht, da diese ihn unendlich anöden und seinen letzten Nerv töten. Irgend-wann kriegt er eins aufs Dach: «not compliant» oder «mangelnde Disziplin» heisst der Vorwurf, und schwuppdiwupp ist er weg.
Was die Disziplin betrifft: Klar, die ist sehr wichtigfürInnovationen–nämlichdann,wenndie Idee glasklar ist und konkret umgesetzt werden soll.
Oft verstummt der kreative Geist auch, denn sobald er eine Idee äussert, wird er kurzerhand gefragt, was diese bringen soll. Und zwar mor-gen schon. Wie soll ein vernünftiger Mensch das so kurzfristig wissen? Wenn er eine neue Art und Weise vorschlägt, die Aufgaben zu lö-sen, dann heisst es: Wer macht das sonst so? Die Herde blökt. Der wirklich Innovative hat jedoch keine Lust, mit der Herde zu laufen, da gibt es wenige Möglichkeiten für Wettbe-werbsvorteile.
Aber, Sie wissen ja, wer Neues schaffen will, hat den zum Feind, der aus dem Alten Nutzen zieht. Und wenn es nur die alten Gewohnheiten sind–unddas sindviele, sehr viele!Und siesind mächtig. Das ist übrigens vielleicht auch
«wer niCht träuMt, der sChLäft nur.»

54 KMU LIFE · 05/2011
ein Grund dafür, dass in der Regel fünf bis sie-ben Jahre benötigt werden, bis die Software-entwickler neu lancierte Hardware voll nutzen können.
Handelt es sich auch um eine neue Fehlerkultur?
Die geschriebenen und ungeschriebenen Re-geln in der Branche, im Betrieb, die Prozeduren und Strukturen wirken wie mentale Gitter und begrenzen das Denken und Handeln derjeni-gen, die Grenzen sprengen sollen. Ein häufig auftretendes Gitter zeigt sich in der Null-Feh-ler-Politik. Diese wird übrigens durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologi-en befördert, da die Ergebnisse jetzt immer an jedem Ort im ganzen Konzern sofort sichtbar sind. Jedes Problem ist stets präsent, jedes Mal, wenn bei einem Kunden ein Computer ausfällt, ertönt ein Alarm. Dann heisst es: Wer hat das verbockt?
Dabei stammen die meisten Innovationen aus der Freiheit, Fehler machen zu dürfen, zu schei-tern, um Neuland zu entdecken.
AuchKolumbusmachteFehler–zumGlück.
Heute stehen wir, ähnlich wie Ko-lumbus, vor einem Datenozean. Wo finden sich Orientierungspunkte?
Vor allem in uns selbst! Denn andere kommen und gehen. Menschen, Moden, Lebensformen, Denkweisen sind schnelllebig. Es passiert im-mer häufiger, dass wir selbst unser einziger lebenslanger Partner sind. In dieser Situation ist es hilfreich zu wissen, was wir wollen be-ziehungsweise was wir auf keinen Fall wollen, was unsere Vorstellungen oder hellwachen Träume sind. Diese wirken wie Leitsterne. Der permanente Wandel ist unsere Realität, die Veränderung ist unser Status quo. Um den Sta-tus quo zu ändern, müssen wir die Veränderung verändern, dem steten Wandel entkommen, der in Wirklichkeit ja meist wenig Neues bring. Ein klarer Traum ist ein Ausbruch aus dem re-petitivenWandel–einAufbruchinnochnichtentdeckte Kontinente des Wissens, der Formen des Lebens und des Zusammenlebens, kurz: der Innovation. Wer nicht träumt, der schläft nur–«standby»imStatusquo.
Heute muss man sich immer wieder neu erfinden. Das kann zu einem Zwang ausarten. Nicht jeder hat die Qualitäten von Lady Gaga.
Im Moment lernen wir mit Twitter, Facebook und Co. zu kommunizieren. Wir erlernen neue Befindlichkeiten und Begrifflichkeiten. Wir stu-dieren gerade ein, sich auf Datenfluten einzu-lassen, ohne absorbiert zu werden. Wir lernen auch, mit Lüge, Täuschung und Betrug zu rech-nen, Masken zu tragen, den schönen Schein zu wahren, sich gegen seine eigene Gutgläu-bigkeit zu impfen und gleichwohl die Möglich-keiten dieser neuen Medien zu nutzen – einschleichender Prozess, den wir alle mehr oder weniger mitmachen. Es muss ja nicht immer so dramatisch und laut sein wie bei Lady Gaga.
Wir dürfen also weiterhin träumen?
Wenn wir nicht im Status quo wursteln wollen, sollten wir das sogar tun. Meine Vorstellung wäre beispielsweise, die Investitionen in Bil-dung und KMU schockartig zu erhöhen. Es gibt starke Indizien, die dafür sprechen, dass die
Hätte Kolumbus keinen «Fehler» gemacht, hätte er Amerika wahrscheinlich nie entdeckt.
HUMAN RESSOURCE

Literaturempfehlung
Top DreamsWenn Manager träumenAutorin: Betty ZuckerVerlag: Linde, 2009ISBN: 978-3-7093-0275-0CHF 39.90
Wovon träumen Topmanager und führen-de Politiker insgeheim? Was bewegt die Menschen an den Hebeln der Macht? Als persönliche Beraterin von herausragenden Führungskräften aus sämtlichen Sparten der Wirtschaft und Politik hat die Autorin Betty Zucker 40 CEOs und Spitzenpolitiker zu ihren Träumen befragt. Ihre Antworten geben Auskunft über die wahren Motive unserer Elite. Das Buch stellt individuelles Verhalten der Führungspersönlichkeiten in den gesellschaftlichen Zusammenhang, regt zum Nachdenken an und gibt damit eine neue Orientierung und Perspektive. www.bettyzucker.ch
Betty Zucker ist persönliche Beraterin von herausra-genden Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft und der Politik. Die Ge-schäftsführerin der BettyZucker+Co. in Zürich ist Autorin von mehreren Bü-chern und publiziert auch regelmässig in der Tagespresse.
Weitere Informationen
Grossunternehmen unter dem Strich Arbeits-plätze reduzieren, wogegen die KMU, die in-novieren und kreieren, Arbeitsplätze schaffen. Dieser Schritt würde ein starkes Signal für die Zukunft setzen.
Wie darf ich folgendes Zitat von Ih-nen verstehen: «Die guten Zeiten sind vorbei, bessere stehen an»?
Wir befinden uns in der Krise, die allgemeine Unordnung ist sehr gross, die Suche nach neu-en Perspektiven immens. In turbulenten bezie-hungsweise abnormalen Zeiten haben auch abnormale Ideen, Vorstellungen, Lebens- und Organisationsentwürfe viel grössere Chancen, umgesetzt zu werden. Es tun sich Möglichkei-ten auf, «windows of opportunities», die ge-nutztwerdenkönnen–vorallemvondenjeni-gen, die darauf vorbereitet sind: von potenten, mutigen und hellwachen Träumern.
HUMAN RESSOURCE
W R I T I N G I N ST R U M EN TS E Y E W E A R CU F F L I N KS L E AT H ER ACCES S O R I ES WATCH ES
CROSS IN DER SCHWEIZ:Sigrist & Schaub SAwww.sigristsa.ch
INTRODUCING NILE:
THE perfectly affordable CORPORATE GIFT
11-0214_Nile_Ad_Swiss_July25_R2.indd 1 7/25/11 12:00 PM

56 KMU LIFE · 05/2011
CoMPetitiVe inteLLigenCe iM einsatz
Die Auseinandersetzung um die Wettbewerbsfähigkeit ist Alltag in Unter-nehmen. Ein zentraler Baustein dabei ist die Aufstellung von Mitbewerbern. Dieser Beitrag stellt das Konzept «Competitive Intelligence» (CI) vor. CI ist als Disziplin und als Prozess zu verstehen: CI kann Entscheidungsträgern in Zeiten der Informationsflut jederzeit erfolgsrelevante Informationen zu Umwelt-, Markt- und Wettbewerbsentwicklungen liefern.
von Monika Giese
Mehr Wissen - besser im Wettbewerb
Globalisierung, ganze Wirtschafts-systeme im Umbruch – gerade ineinem solchen Umfeld sind Mana-ger einmal mehr gefordert, für ihre
Firmen erfolgreiche, nachhaltige und dyna-mische Firmenstrategien zu entwickeln, die sowohl aktuelle Marktpotentiale ausschöpfen
als auch frühzeitig neue Veränderungen im Markt erkennen, und für neue Produkte und Serviceleistungen zu sorgen.
Fundiertes Wissen über Wettbewerb, Marktum-feld, Trends und technologische Entwicklungen ist die notwendige Grundlage für kontinuier-
liche Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigen Erfolg. Eine kontinuierliche und systematische Sammlung sowie die professionelle Auswertung relevanter Informationen können zur Basis für unternehmerischen Erfolg werden.
CI ist eine Königsdisziplin, die es den heutigen Unternehmensverantwortlichen ermöglicht, al-ternative Zukunftsszenarien zu antizipieren und proaktiv ihr Wettbewerbsumfeld zu beeinflussen.
Eine EinordnungDie Disziplin CI hat es im deutschen Sprach-raum nicht leicht. Bis heute gibt es noch keine adäquate Übersetzung. Am häufigsten wird
HUMAN RESSOURCE

57KMU LIFE · 05/2011
CI gleichgesetzt mit dem Begriff der «Wett-bewerbsbeobachtung und -analyse», ande-rerseits assoziiert man Competitive Intelli-gence auch immer wieder mit dem Konzept von Nachrichtendiensten und positioniert es im Bereich der Spionage. Letztere beschreibt die Informationsbeschaffung mit illegalen Mitteln, wie zum Beispiel Erpressung, tech-nischen Angriffen (hacking), oder mittels fal-scher Identität. Diese 007-Zeichen des Kalten Krieges haben aber mit der heutigen Business-welt wenig zu tun. Seriöse CI-Fachleute dis-tanzieren sich ganz klar von dieser Seite des Geschäfts. Der internationale Berufsverband SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals) gibt mit seinem Code-of-Ethics klar die Richtlinien vor.
Aber selbst im englischen Sprachgebrauch ist der Begriff in den letzten Jahren so inflationär gebraucht worden, dass eine gewisse Verun-sicherung auf Seiten der Entscheidungsträger nicht verwundert. Aus diesem Grund liefere ich im folgenden zunächst eine allgemeine Defini-tion, die ich dann weiter auffächere.
Competitive Intelligence liefert Ein- und Aus-blicke. Die Inhalte und Themenschwerpunkte werden aus dem entscheidungsrelevanten Kontext vorgegeben beziehungsweise defi-niert. Handwerklich geschieht dies mittels ei-nes Prozesses, der kontinuierlich, innerhalb und ausserhalb eines Unternehmens primäre und sekundäre Informationen sammelt, diese analysiert und validiert, zusammenfasst und dann effektiv innerhalb eines Unternehmens kommuniziert.
Erstens stammen die Informationen sowohl aus primären als auch aus sekundären Quellen. Als «primär»bezeichnetmanalldie–nichtvertrau-lichen – Informationen, die öffentlich zur Ver-fügung stehen und in der Regel in Gesprächen und Interaktionen mit Menschen ausgetauscht werden. Sekundärinformationen beschreiben publiziertes Material. Zweitens umschreibt der Prozess die systematische Sammlung, Auswer-tung, Analyse, Validierung und Synthese von relevanten Informationen. Drittens umfasst die professionelle Ausbildung zu einem «Competiti-ve Intelligence Officer/Agenten» ein fundiertes
Wissen der Informationsquellen und Medien, das Wissen um ethische und legale Richtlinien –nationalundinternational–dieklareGrenzendefinieren, und natürlich das Handwerkszeug: Techniken zur Informationssammlung, analyti-sche Modelle zur Datenauswertung, Grundprin-zipien der Validierung von Informationen, deren Synthese und Kommunikation.
Positionierung in UnternehmenEffektive und erfolgreiche CI ist im Idealfall immer ein integrativer Teil der Unternehmens-kultur. Einführung und zielgerichteter Res-sourceneinsatz sind daher Chefsache: Alle Mitarbeitenden brauchen ein grundsätzliches Verständnis für das Konzept und dessen Gren-zen (Training), um die Sicherheit und Reputation des Unternehmens nicht zu gefährden. Zudem sind schutzwürdige Informationen für das eige-ne Unternehmen klar definiert und klassifiziert. Im CI-Prozess gibt es einen zentralen Ansprech-partner mit entsprechender CI-Fachkompetenz (CI-Manager/CI-Abteilung), der unbürokratisch alle Informationen entgegennimmt und profes-sionell hinterfragt. Die inhaltlichen Prioritäten
Informationen finden, verarbeiten und einsetzen.
HUMAN RESSOURCE

58 KMU LIFE · 05/2011
Monika Giese hat eine langjährige Industrieer-fahrung und ist international als CI Expertin tätig. Mit ICOCI hat sie eine eigene Beraterfirma, die in der Schweiz ansässig ist. Zudem ist sie Vorstandsmitglied der Schwei-zer CI Association.
Weitere Informationen
sind definiert und im Unternehmen bekannt. Last but not least sind CI-Ergebnisse, Instrumen-te und Methoden integrativer Bestandteil bei der Entscheidungsfindung.
Die Komplexität eines solchen Programms er-fordert eine geplante und gesteuerte Einfüh-rung, und benötigt ausreichend Zeit (ein bis drei Jahre), um sich vollständig zu etablieren. Der Einsatz lohnt sich, denn am Ende steht die optimale Nutzung der internen Primärquellen (alles in den Köpfen der Mitarbeitenden kann genutzt werden). Das Vorgehen reduziert die Ausgaben für teure Unternehmensberater, ist zudem ein adäquater Schutz der eigenen Or-ganisation und der Überraschungsmoment, im Rahmen von heiklen Situationen, wird dras-tisch eingedämmt.
Ein klarer WettbewerbsvorteilInternationale Konzerne und Grossunternehmen haben den Wert von Competitive Intelligence erkannt, und das Berufsbild des CI-Managers hat dort viele Facetten. Grundsätzlich bekleiden diese Kollegen eine interne Beraterfunktion auf potentiell all den funktionalen beziehungsweise operativen Ebenen, auf denen lang- und mittel-fristige strategische Entscheidungen gefällt wer-den und Risikominimierung wichtig ist. Beispiele dafür wären die Produktentwicklung, Markt-neueinführungen, Outsourcing, Supply Chain, Produktion(sstätten), Akquisitionen, Lizenzver-einbarungen und Internationalisierung.
Als Beispiel, ein paar klassische CI-Fragestel-lungen zur Unterstützung im Strategieentwick-lungsprozess:
• Wostehenwirundwowollenwirhin?• Wie positionieren sich die Wettbewerber
zukünftig im Markt? Wie sehen deren Unter-nehmensstrategien aus?
• WelcheTrendswerdensichimMarktdurch-setzen?
• WelcheVeränderungenimpolitischen,legis-lativen oder soziokulturellen Umfeld werden unsere Marktsegmente beeinflussen?
• Welche neuenTechnologien/Entwicklungenwerden einen Einfluss auf unser Geschäft haben?
Firmen, die diese Fragen für sich zufriedenstel-lend beantwortet haben, nutzen dann häu-fig spezielle CI-Instrumente und -Methoden
(Business Wargaming, Signal Analysis und Early Warning Systems), um ihre strategischen Grundannahmen regelmässig, zum Beispiel im Rahmen des strategischen Planungsprozesses, zu überprüfen (Stress Test) und potentiell neue Erkenntnisse zu integrieren. Die genannten Punkte verdeutlichen, dass auch KMU davon betroffen sind, nur ist das Thema bislang dort nur unzureichend angekommen.
Competitive Intelligence und KMUAuf den ersten Blick scheinen CI den finanziel-len Rahmen von KMU zu sprengen. Ohne Frage muss man sich immer das Kosten-Nutzen-Ver-hältnis anschauen. In diesem Rahmen kann dies nur in Form einer Momentaufnahme zu gehen.
Im letzten Jahr hat eine industrieübergreifende Studie in der Schweiz 1) eine CI-Bestandsauf-nahme bei KMU in der Schweiz unternommen. Es gibt kaum ein Unternehmen, das nicht in der einen oder anderen Form CI betreibt. Al-lerdings lassen die Ergebnisse darauf schlie-ssen, dass weniger als die Hälfte der KMU mit dem Gesamtkonzept CI vertraut sind, und die Wettbewerbsbeobachtung und -analyse sich vornehmlich auf Sekundärdaten stützt und versucht, retrospektiv Einsichten zu schaffen. Die Erschliessung von Primärquellen scheint vernachlässigt zu werden, obwohl gerade die-se Quellen einen Ausblick ermöglichen würden.
Gleichzeitig scheint die Kehrseite der Medaille, die Abwehr von Konkurrenz- und Wirtschafts-spionage, sehr unstrukturiert, und nicht über die gesetzlich empfohlenen Schutzmassnah-men hinauszuführen. Gebäude- und Daten-schutz, Schutz bei Informationsübermittlung und Informatik sind implementiert. Training und Bewusstsein für Primärangriffe über Men-schen/Mitarbeitende scheinen ausgeblendet. Das ist unverständlich, angesichts der Informa-tionen, die die Abwehrbehörden der Schweiz (NDB) über Personen und Unternehmen pub-lizieren. 2)
Aller Anfang ist leichtDer Einstieg in die Praxis ist nur auf den ersten Blick schwierig. Auch die Kosten sind über-schaubar. CI-Fachleute/-Berater können inner-halb weniger Tage einen Fahrplan/Roadmap zur Einführung für Ihr Unternehmen zuschnei-den, der in Etappen operativ umzusetzen ist. Dabei sei zu beachten, nur solche Berater ins
Haus zu holen, die nachweislich selbst solche Programme in Unternehmen hauptverantwort-lich eingeführt haben und ihre praktische Er-fahrung mit einfliessen lassen können!
Einkauf/Entwicklung eines Basis-Mitarbeiter-trainings und damit einhergehende Richtlinien sind ist eine einmalige Investition. Ziel ist es hier, Verständnis für CI zu entwickeln:
• JederMitarbeitendeistalspotentielleInfor-mationsquelle wertvoll und relevant.
• Jeder Mitarbeitende versteht die CI-Richtli-nien und verpflichtet sich, diese zu befolgen.
• JederMitarbeitendeweiss,wiepotentiellre-levante Infos weitergegeben werden sollen/müssen.
Organisatorisch ist es wichtig, einen Hauptver-antwortlichen zu benennen, der per Voll- oder Teilzeitstelle die zentrale Anlaufstelle für die Sammlung von relevanten Informationen re-präsentiert. Idealerweise engagiert man einen CI-Experten, aber talentierte Mitarbeitende können durch gezielte Fort- und Weiterbildung schnell in diese Rolle hineinwachsen.
Es bleibt zu hoffen, dass sich CI in den nächsten Jahren zugunsten und innerhalb der Schweizer KMU verstärkt weiterentwickelt. CI-Experten gibt es reichlich im eigenen Land, aber leider auch viele schwarze Schafe. Die seriösen Kol-legen sind in einem eigenen Berufsverband auf nationaler Ebene (Swiss CI Association/SCIA) beziehungsweise internationaler Ebene (SCIP) gut vernetzt und arbeiten nach den strengsten ethischen Richtlinien.
Anmerkungen1) Titel der Studie: Competitive Intelligence in Schweizer KMU von M. Giese, B. Stoll und Dr S. Schuppisser, 2011. 2) Genauere Informationen bekommt man auf
www.vbs.admin.ch oder in den Jahresberichten des Schweizer Bundesnachrichtendienstes (NDB).
HUMAN RESSOURCE

Das Digital-TV-Erlebnis via
Internet!
cyberlink.TV
JETZT2 MonateGRATIS
TESTEN
ab 18.–/Mt., provider-unabhängig, für jeden Haushalt www.cyberlink.tv
cyb_ins_cltv_a4.indd 1 13.10.11 14:11

60 KMU LIFE · 05/2011
die sChweizer wirtsChaft und der kLiMasChutz
Die vereinbarten Ziele beim Thema Klimaschutz verlangen von allen gesell-schaftlichen Gruppen höhere Anstrengungen, um etwas gegen die Erderwär-mung und ihre Folgen zu unternehmen. Auch die Schweizer Wirtschaft zieht hier mit. Mit der Geschäftsleitung der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) führten wir dazu ein Interview.
Interview mit Dr. Armin Eberle von Georg Lutz
Auf gutem Kurs
Im Zuge der Umsetzung des Kyoto-Abkommens wurde am 1. Januar 2008 in der Schweiz erstmals die CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe eingeführt, da die CO2-Emissionen im Jahr 2007 im Vergleich zu 1990 statt gesunken, praktisch stabil geblieben sind. Ging den Verantwortlichen in Bern der Prozess zu lange?
Der Rahmen ist im CO2-Gesetz vorgegeben. Als erkannt wurde, dass die vereinbarten Ziele nicht erreicht würden, konnte der Bundesrat die Lenkungsabgabe einführen. Für diesen Entscheid waren die Daten von 2007 massge-bend. Zu diesem Zeitpunkt war das Total der Emissionen deutlich vom Soll entfernt. Zwar hatten Industrie und Haushalte deutliche Fort-schritte gemacht …
… aber beim Thema Abgase von Treibstoffen gab und gibt es noch viel Luft nach oben?
Ja, hier gibt es national und international noch Handlungsbedarf. Allerdings sehen wir auch positive Zeichen. Die EnAW hat beispielsweise mit 84 Unternehmen Treibstoffemissionsziele vereinbart. Diese Unternehmen konnten gezielt die Emissionen ihrer Transportflotten reduzie-ren und haben pro Jahr Einsparungen von über 50’000 Tonnen CO2 erreicht.
Können Sie das noch konkreter formulieren?
Die Unternehmen setzen gezielt Massnahmen um und erfassen deren Wirkung. Neben tech-nischen Massnahmen wie der Beschaffung der neusten Generation von Motoren sind auch betriebliche Massnahmen wie die Optimierung der Betriebsabläufe von Bedeutung. Potential hat auch die interne Weiterbildung, wie zum Beispiel die Fahrerschulung zum sparsamen Fahren. Zusätzlich ist die Einführung von Treib-stoffen wie Biodiesel eine wirksame Massnah-me. Es gibt Potentiale und ein breites Spektrum
von Handlungsoptionen in unterschiedlichsten Bereichen. Mit unserem Ansatz, Ziele zu defi-nieren und diese mit konkreten wirtschaftli-chen Massnahmen zu hinterlegen, lösen wir Handlungen aus.
Die Politik betont, dass es sich nicht um eine Steuer- sondern Lenkungs-abgabe handele. Der Klimarappen ist solch ein Beispiel. Wie ist Ihre Sicht der Dinge?
Die Lenkungsabgabe ist vom Prinzip her tat-sächlich keine Steuer, denn die Einnahmen werden an Unternehmen und Bevölkerung zurückverteilt. Zur Verstärkung der Wirkung wurde beschlossen, einen Teil der Abgabe als Fördermittel für den Gebäudebereich einzu-setzen. Mit dieser sogenannten Teilzweckbin-dung im Gebäudebereich wurde das Prinzip der Lenkungsabgabe durchbrochen. Im Treibstoff-bereich wurde statt der Lenkungsabgabe der Klimarappen geschaffen, dessen Mittel direkt zur Kompensation der Treibstoffemissionen eingesetzt werden.
Und damit haben Sie Probleme?
Man kann das so machen, denn die so ein-gesetzten Mittel wirken direkt auf die Re-
HUMAN RESSOURCE

61KMU LIFE · 05/2011
duktion beziehungsweise Kompensation von Emissionen. Aber es ist eine Verfälschung der ursprünglichen Idee, die Mittel staatsquoten-neutral wieder zurückzugeben. Somit erhält es Steuercharakter.
Sie betonen öfters das Thema «frei-willige Zusammenarbeit». Weshalb?
Wir betonen die Freiwilligkeit, da dies unsere Grundlage und Philosophie ist. Die EnAW ist seit 2001 operativ tätig und hat seither mit über 2’200 Unternehmen Ziele vereinbart. Das Gros der Unternehmen ist solche Ziele einge-gangen, lange bevor die Verordnung bezie-hungsweise die Lenkungsabgabe eingeführt worden ist. Dieses Engagement, in dem sich Unternehmen organisieren und überlegen, welche Effizienz- und Klimaziele sie erreichen möchten, begleiten wir. Das ist für uns ein be-währter Grundsatz: Der Staat gibt die globalen Ziele vor, aber die Umsetzung erfolgt durch die betroffenen Sektoren.
Ist die Wirtschaft hier aus Ihrer Sicht weiter als andere gesellschaftliche Gruppen?
Auf jeden Fall ist sie nicht das Problem, sondern ein Teil der Lösung. Wenn wir CO2-Emissionen senken wollen, müssen Unternehmen inves-tieren und sich engagieren. Und das tun sie auch. So haben die Instrumente der Wirtschaft (Zielvereinbarungen und Stiftung Klimarap-pen) einen wesentlichen Teil zur Erreichung der schweizerischen Klimaziele beigetragen.
Kommen wir zum Stichwort Emissi-onshandel. Besteht hier nicht oft die Gefahr von rein symbolischen Akti-onen, die nicht zu einer wirklichen Umsteuerung führen? Ich bringe das einmal auf den kritischen Punkt: Man spendiert zwar ein Windrad in Afri-ka, aber in der Unternehmenspolitik und in der Wertschöpfungskette fin-det kaum ein Umdenken statt, wel-ches in klaren Zahlen ökologische Veränderungen verdeutlicht.
Es gibt hier zwei Varianten: Erstens gibt es die Möglichkeit, dass Emissionsrechte zwischen den Unternehmen gehandelt werden können. Das ist etwas sehr Gutes. So wird sichergestellt, dass
unterschiedliche Voraussetzungen der Unterneh-men über einen Marktmechanismus ausgegli-chen und zusätzliche Anreize geschaffen werden können. Die zweite Möglichkeit betrifft den An-kauf von ausländischen Zertifikaten, wenn die eigenen Einsparmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Auch dies ist vom Grundsatz her eine gute Idee, sofern die Zertifikate seriös sind. Mit den offizi-ellen, nach anspruchsvollen Standards geprüften Emissionsreduktionszertifikaten ist sichergestellt, dass man in sehr gute Projekte investiert. Bei de-nen bekommt man für den investierten Franken ein Mehrfaches an CO2-Einsparungen als durch Massnahmen im Inland. Insofern ist das eine öko-logisch und ökonomisch sehr sinnvolle Ergänzung zu den eigenen Effizienzbemühungen.
In welcher Form kommunizieren Sie die Themen Klima- und Energieeffi-zienz in die Unternehmen?
Wir kommunizieren auf verschiedenen We-gen und mit unterschiedlichen Mitteln. Die-se reichen von unserem Tätigkeitsbericht über regelmässige Newsletter bis hin zu den Gruppenmeetings. Bei Letzteren treffen sich Unternehmen, die sich nach Branchen oder Regionen zusammengeschlossen haben zum regelmässigen fachlichen Austausch. Zum Bei-spiel steht die Frage auf der Agenda, welche erfolgversprechenden technologischen Innova-tionen auf dem Markt sind, um effizienter und ökologischer agieren zu können und wo die Gruppe bezüglich ihrer Zielsetzung steht. Diese Diskussionen motivieren und führen zu einem Know-how-Gewinn unter den Teilnehmenden.
Wie können Sie sich dabei kontrollieren?
Über ein jährliches Monitoring wird schnell klar, wo die einzelnen Unternehmen bezüglich Energieeffizienz, CO2-Reduktion stehen. Das verschafft Transparenz, und gibt den Verant-wortlichen ein regelmässiges Feedback zum Stand der Umsetzung.
Damit ist das Thema Ökologie aus der Nische herausgetreten, in der es vor wenigen Jahren noch war.
Ja, wobei es immer um die Verknüpfung von Wirtschaftlichkeit und Ökologie geht. Das muss zusammen gedacht werden. Mit den www.enaw.ch
Dr. Armin Eberle ist in der Geschäftsleitung der Energie-Agentur der Wirtschaft.
Weitere Informationen
Zielvereinbarungen auf Basis wirtschaftlicher Massnahmen wird Energieeffizienz zum Aufga-benbereich, der die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verbessert.
Mit welchen anderen Verbänden agieren Sie, um das Thema Wirt-schaft und Ökologie weiter voranzu-treiben? Sie sind ja hier nicht alleine auf dem Handlungsmarkt.
Wir sind getragen von den wichtigen Wirt-schaftsverbänden der Schweiz. Diese unter-stützen unsere Arbeit direkt und in der Kom-munikation gegenüber ihren Mitgliedern. Wir sind auch Partner des Bundes, haben von die-sem einen Leistungsauftrag und sind Partner des Programms EnergieSchweiz. Mit den bei Energieeffizienz und Klimaschutz zu betreu-enden Unternehmen haben wir eine klare Ziel-gruppe, inhaltliche Schwerpunkte und einen ausgezeichneten Leistungsausweis. Zusätzlich suchen wir aber auch Synergien mit Partnern aus der Wirtschaft und mit Agenturen und Pro-grammpartnern des Bundes, die zum Beispiel im Bereich Energieversorgung, Emissionshan-del oder Mobilität tätig sind.
Wie hilft das den Unternehmen?
Wir sind mit der Klimastiftung Schweiz eine Partnerschaft eingegangen. Die von namhaf-ten Dienstleistungsunternehmen gegründete Stiftung unterstützt KMU finanziell beim Ener-giesparen und bei der CO2-Reduktion. Sie hilft unbürokratisch und rasch, fördert Innovationen und übernimmt 50% des EnAW-Teilnehmerbei-trags (www.klimastiftung.ch). Ausserdem hel-fen verschiedene Elektrizitätsversorger Ihren Firmenkunden bei der Verbesserung der Ener-gieeffizienz. Dies durch Investitionsbeiträge, Boni oder Übernahme von Teilnehmerbeiträ-gen (www.kmu-modell.ch).
HUMAN RESSOURCE

62 KMU LIFE · 05/2011
XXXXXXXXXXXXX
soziaLe koMMunikation iM wandeL der zeit
Datenschutz im Internet ist kein Nischenthema. Das juristische Gerangel um Google Street View oder die Ankündigung einer automatischen Gesichtser-kennung auf Facebook haben auch viele Unternehmensverantwortliche auf-geschreckt. Auch aus diesem Grund trafen wir uns mit dem Country Manager von XING zum Interview.
Interview mit Robert Beer von Georg Lutz
Schutz und Transparenz
Social Media repräsentiert aus der Sicht Ihres Hauses nicht nur wach-sende Kommunikationskanäle, son-dern XING spricht auch von einer Be-wegung. Was können wir darunter verstehen?
Die Kommunikation zwischen den Menschen hat sich grundlegend verändert. Wir sprechen heute beim Thema Social Media nicht mehr von Trends oder Modethemen, sondern von Stan-dards mit Grundlagen. Social Media ergänzt oder ersetzt andere Kommunikationskanäle.
Das würde ich gerne konkretisieren. Sprechen wir eher von etwas Neuem oder von Ergänzungen?
Soziale Kommunikation ist ein uraltes Thema. Inzwischen sind Familien, Jugendliche und Se-nioren vernetzt. Die Gesellschaft ist flächende-ckend dabei. Neu sind die effizienten Möglich-keiten, die durch neue Technologien getrieben werden. Spätestens jetzt ist die Geschäftswelt gefordert. Zudem kann man über den Teller-rand schauen. Wer aus seinem eignen Zirkel heraustreten kann, dem öffnen sich gerade in
der Businesswelt immer wieder neue Türen. Die Strategie von «More of the same» stösst an Grenzen.
Kommen wir zu einem weiteren Stichwort: «Networking». Auch frü-her habe ich mein Netzwerk als Ge-schäftsmensch gepflegt. Heute läuft dies unter dem Stichwort «Old Boys-Netzwerk». Mir kommt da das Bild von rauchenden Managern im Club in den Sinn. Wie sieht die Situation heute aus?
Man pflegt heute sein Netzwerk nicht nur im Rahmen der eigenen Interessen oder aufgrund persönlicher Sympathie, sondern man bewegt sich in Gruppen, die zu einem Thema oder unter geografischen Aspekten zusammenkommen. Old Boys-Netzwerke haben oft ein negatives Image:

63KMU LIFE · 05/2011
XXXXXXXXXXXXX
Man bekommt Aufträge mit Vitamin B. Heute ist das nicht ausreichend. Man braucht Kontakte, muss diese aber auch erreichen, professionell und kompetent sein. Wir stehen alle in einem transpa-renten Kommunikationsprozess, den wir sorgfäl-tig aufbauen und pflegen müssen.
Aber das braucht Zeit, die wir alle nicht haben.
Ohne Frage braucht die Pflege von digitalen Netzwerken Zeit. Aber ohne dieses Netzwerk hat man nur sehr beschränkte Möglichkeiten. Wenn Sie ein Netzwerk effizient auf- und aus-bauen, haben Sie mit einem Zeitaufwand, den man sehr genau definieren kann, einfach viel mehr Möglichkeiten.
Wir wissen alle nicht, wie die schnel-len Bewegungen in der Zukunft wei-
tergehen. Nicht nur die Börsen sind volatil. Nur ein Beispiel: Facebook war und ist inzwischen eine gewal-tige Kommunikationsmaschine. Je-doch verabschieden sich schon viele Businessmenschen wieder, da es ih-nen zu viel um Partygeplauder geht. Folglich müssen wir doch alle zu Kommunikationsprofis werden, die schnell und richtig agieren. Sind wir dabei nicht schlicht überfordert?
Wir haben doch heute auch keine Probleme mehr, uns im Internet mit einem Browser zu bewegen. Vor 15 Jahren war das noch eine He-rausforderung. Lebenslanges Lernen darf aber dabei kein theoretisches Schlagwort bleiben. In wenigen Jahren werden die eingeübten Me-chanismen bei kaum jemandem Fragezeichen aufwerfen. Der Mensch will kommunizieren,
das war schon am Lagerfeuer so. Neue Genera-tionen gehen ja auch ganz natürlich mit Social Media um.
Heute haben Sie auf jeden Fall für sich privat als auch für Ihr Unternehmen Vorteile beziehungs-weise Wettbewerbsvorteile.
Es gibt viele Zeitgeister, die prophezei-en im Rahmen des massiven Vordrin-gens der neuen Sozialen Medien einen Verlust der Privatsphäre. Diese Ein-schätzung teilen Sie vermutlich nicht.
Die Privatheit hat eine sehr bewegliche Defi-nition. Mit jeder Generation wird sie neu de-finiert. Damit es hier keine Missverständnisse gibt; auch für junge Leute ist die Privatsphäre wichtig, sie definieren sie nur anders. Man kann das in einem Bild beschreiben. Es gibt für
«in eineM soziaLen netzwerk kann Man MarktanteiLe aber niCht kaufen ...»
Privatheit ist eine sehr bewegliche Situation und wird von jeder Generation neu beantwortet.

64 KMU LIFE · 05/2011
www.xing.com
Robert Beer ist Country Manager von Xing.
Weitere Informationen
sie verschiedene Kreise, die unterschiedliche Informationen zu sehen bekommen. Wir als Anbieter von Sozialen Netzwerken müssen da zielgerichtet darauf eingehen. Das heisst, wir geben den Nutzern Werkzeuge an die Hand, damit sie ihre Privatheit selbst steuern können.
Datenschutz ist ein Thema bei XING?
Das ist bei uns ein sehr grosses Thema. Wir un-terliegen ja dem deutschen Datenschutz. Wir haben dort unsere Server stehen und haben in einigen Studien auch sehr gut abgeschnitten. Nicht zuletzt hat uns der Schweizer Daten-schutzbeauftragte Hanspeter Thür vorbildliche AGB zugestanden. Wir gehen proaktiv mit dem Thema um und machen ein USP daraus.
Kommen wir nochmals konkret auf XING zurück: Im deutschsprachigen Raum ist XING gut aufgestellt. Auch die Funktionalität der Seite wird im-mer besser. Defizite sehe ich noch aus globaler Sichtweise. Die Busi-nesssprache Englisch führt bei Ihnen ein stiefmütterliches Dasein.
Sprachen kann man bei uns einstellen. In einem Sozialen Netzwerk kann man Marktanteile aber nicht kaufen. Wenn man im Ausland eine Plattform kauft und in die eigene Plattform integriert, springen einem sehr wahrscheinlich die Nutzer ab und das ist gut so. Das Netzwerk muss sich viral verbreiten und dabei Qualität anbieten. Wir möchten, dass unsere Nutzer intensivmiteinanderkommunizieren–unddasauf sehr unterschiedliche Weise. Wir legen bei-spielsweise sehr viel Wert auf Offline Events. Man kann nicht gleichzeitig der Grösste, Schönste und Schnellste sein. Wir bauen unsere Schwerpunkte qualitativ aus.
Es fiel gerade das Stichwort «offline». In welcher Form kommunizieren heu-te Offline- und Online Welten.
Die Sozialen Netzwerke ersetzen nicht die Face-to-face-Kommunikation. Diese Erfahrung haben wir ja schon vor 15 Jahren mit dem In-ternet gemacht. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Deshalb gibt es auf XING Tausende von Gruppen, die sich beispielsweise im Rah-men eines regionalen Zusammenhangs auch real treffen. Diese Gruppen organisieren An-lässe und wir unterstützen sie dabei. Allein in der Schweiz gab es letztes Jahr über 9’000 solcher Anlässe, wo sich die Leute persönlich getroffen haben. Diese Treffen sind Teil unserer Wertschöpfungskette. XING ist ein Karriere- und Geschäftsanbahnungsnetzwerk und dabei kommt man in Gesprächssituationen. Wir sind sehr gut in dicht besiedelten, kleinräumigen Märkten unterwegs, da sich die XING-User dort auch unkompliziert treffen können. Bei virtuellen transatlantischen Treffen, geht es eher darum, den Kontakt nicht zu verlieren.
Wie kann ich als Unternehmen strategisch vorgehen?
Wenn man als Firma in Social Media unterwegs ist, soll man nur so viel abbeissen, wie man schlucken kann. Es geht nicht darum, überall dabeizusein. Nur ein Beispiel: Wenn man in ei-
ner Krisensituation kommunizieren muss, muss man das auch über alle Kanäle machen, die man sonst pflegt. Sonst schadet man sich nur. Diese Zeit muss vorher eingeplant werden.
Wie ist XING in der Schweiz aufgestellt und wo sehen Sie noch Potentiale?
Wir sind einer Phase starken Wachstums. Das freut uns. Trotzdem ist die Durchdringung von Sozialen Netzwerken in der Schweiz nur halb so hoch wie beispielsweise in den USA. Da können wir trotz tollen Zahlen für uns noch nicht zu-frieden sein. Lassen Sie mich das mit dem Bild einer Champagnerglaspyramide verdeutlichen: Wenn man oben füllt, ist die erste obere Ebene schnell voll, bei der nächsten muss man schon mehr aufwenden. Diese Ebenen kann man sich als Informationsstufen vorstellen. Oben sind die Kernzielgruppen. Es reicht aber nicht aus, nur diese zu bedienen, weil jede Stufe wieder neue Kontakte ermöglicht. Unsere Herausfor-derung wird sein, die Zielgruppen, die nicht jeden Tag stundenlang im Internet sind, mit einem klaren und einfachen Produkt zu bedie-nen und gleichzeitig Kernzielgruppen nicht zu vernachlässigen.
Heute ist der Faktor Vitamin B nicht mehr ausreichend.
HUMAN RESSOURCEHUMAN RESSOURCE

Die Data Center SwitChing-LöSungvon AlcAtel-lucent
Die alcatel-Lucent Data Center Story ba-siert auf application Fluent network (aFn) und auf den drei einheiten Pod, Mesh und Virtual Machine Management (VMM). aPPLiCatiOn FLuent netwOrKDas Application Fluent network (AFn) ermöglicht eine einzigartige, hochqualitative user experi-ence bei reduzierter Komplexität: Das ist unsere vision! «If you can dream it, you can do it.» (Walt Disney). Wir träumen von einem netz, welches in der lage ist, Fehler selbst zu beheben, für hohe Datensicherheit sorgt, alle Applikationen ermög-licht, neue Geräte automatisch provisioniert und konfiguriert und zugleich die Geräte mit Strom versorgt; und das bei hoher Energieeffizienz.
Die Drei einheitenDer Ost-West-Traffic – d.h. der Datenverkehr in-nerhalb des Datacenters – steigt massiv und die clients verlangen geringste latenzzeiten in der Kommunikation. Dies erfordert innovative lö-sungskonzepte. Pod: Der Pod sorgt durch die Bereitstellung von Server-zu-Server-Konnektivität und mit einer ein-zigartigen Direct-connect-Architektur für niedrige latenz und hohe leistung - ohne sich dabei auf einen Traffic generierenden Core-Switch zu ver-lassen. Mit dieser Architektur wird der Server-zu-Server-Datenverkehr unter 2μs Latenz gehalten.
Mesh: Die «Mesh»-Architektur verbindet die Pods. So entsteht eine Switch-Kapazitätsmatrix von bis zu 169 tbps. Pod- und Mesh-Ansatz sind heute schon Realität und zudem auch für 40/100 Gbit ethernet ausgelegt. VMM: ein novum ist der virtual Machine Mana-ger, der die virtual Machine verschiebungen im Data center automatisiert. Alcatel-Lucent Enterprise Data Center Switching-Lösung – eine völlig neue Netzwerkinfrastruktur für das moderne Rechenzentrum.
www.alcatel-lucent.com/enterprise/datanetworks
Die Alcatel-lucent enterprise Data Center Switching-Lösung stellt eine völlig neue netzwerkinfrastruktur für das moderne Rechenzentrum bereit. Diese lösung dehnt die Alcatel-lucent enterprise-vision der Application Fluency (Alcatel-lucent - Application Fluent network) auf Rechenzentren aus. Möglich wird dies durch einen einzigartigen, auf Services basierenden Ansatz, mit dem das Datacenter in eine private cloud verwandelt wird, die naht-los mit öffentlichen Cloud-Services koexistieren kann. Damit können für bestimmte gemeinsam agierende Arbeitsgruppen virtuelle Datencent-er definiert werden. Und Services-Ansatz bedeutet, dass das netzwerk ‚fliessend’ versteht, was erforder-lich ist, damit eine Applikation wie gewünscht arbeitet.
al_ins-a4_switching_lay.indd 1 08.07.11 14:25

66 KMU LIFE · 05/2011
die PotentiaLe Von soCiaL Media-Marketing
Die vielfältigen Dialogmöglichkeiten des Social Web, auch Web 2.0 genannt – sprich Foren, Blogs, Meinungsportale, Facebook, Twitter und Co. – haben die Beziehungen zwischen Kunden und Unternehmen grundlegend verändert. Was vor ein paar Jahren noch als Marketinghype der Online Freaks belächelt wur-de, ist heute längst in den Marketing- und PR-Abteilungen der Unternehmen angekommen. Auch immer mehr Schweizer KMU beschäftigen sich mit diesem Thema, oder sind bereits aktiv auf den Social Media-Kanälen präsent.
von Sandra Albisser
Richtig einsteigen
Die grossen Player haben bereits Ausru-fezeichen gesetzt: über 34 Millionen Fans bekunden ihre Liebe zu Coca-Cola auf Facebook. Bei McDonald’s
gibt es seit April den ersten «Social Media Bur-ger», über den Millionen von Fast Food-Fans ab-gestimmt haben. Und die Rollerbabys von Evian aus dem Jahr 2009 zählen bis heute zu einem der populärsten Videos auf YouTube. Für grosse Marken ist die Präsenz in den Social Media zur Pflicht geworden. Doch was bringt der Einsatz von Social Media für KMU-Verantwortliche?
Mit der Entwicklung von Social Media nimmt auch die Bedeutung dieser Medien für die Steuerung des Konsumentenverhaltens zu. Menschen bilden sich ihre Meinung über eine Marke, eine Unternehmung oder ein Produkt im Web – nicht über die offizielle Webseite,sondern über User Generated Content. Laut einer Studie des Lehrstuhls für Marketing und Unternehmensführung der Universität Basel üben Social Media, branchenspezifisch in un-terschiedlichen Dimensionen, bereits einen si-gnifikanten Einfluss auf das Markenimage aus.
So ist im Tourismus der Einfluss von Social Me-dia auf das Markenimage heute bereits grösser als derjenige von klassischen Kommunikations-instrumenten. Heute muss jeder Hotelbetreiber sich mit mehreren Bewertungspülattformen und vielen individuellen Blogs auseinander set-zen. Aber woher kommt dieser Wandel?
Kommunizierende RöhrenMedieninnovationen verändern die Art und Weise, wie wir öffentlich und privat kommu-nizieren. Das hat auch Auswirkungen auf das Marketing von KMU. Die Veränderungen in den Kommunikationskanälen und neue Mar-ketingstrategien agieren wie kommunizierende Röhren: Sie verstärken sich gegenseitig.
Das Internet hat sich in der Schweiz zum meist-konsumierten Medium entwickelt. Viele Unter-nehmen sind aber in der klassischen Kommuni-kation stehengeblieben und geben immer noch
HUMAN RESSOURCE

Victorinox AGCH-6438 Ibach-Schwyz, SwitzerlandT +41 41 81 81 211, F +41 41 81 81 [email protected], www.victorinox.com
MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE
Dual Pro
Die neue Tool-GenerationSofort im Einsatz, speziell griffig und sicher!
042_304_Dual_Pro_Layout 1 14.04.10 13:58 Seite 1
horrende Beträge für klassische Werbung aus, obwohl sie ihre Zielgruppen über das Internet und allenfalls auch über die Social Media-Kanäle besser erreichen könnten. Insbesondere bei So-cial Media-Ausgaben sind viele Unternehmun-gen noch mit dem Klammerbeutel gepudert. Nicht nur ich frage hier nach den Gründen. Die Antwort liegt auf dem Grund der Unterneh-mensphilosophie. Social Media ist eine Frage der Unternehmenskultur. Sind Werte wie Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz und die Teilhabe aller Mitarbeitenden bereits vorhanden? Nur gemein-sam und generationsübergreifend kann eine So-cial Media-Strategie erfolgreich im Unternehmen eingeführt werden. Social Media ist eben nicht nur ein neuer Marketingkanal, dieses Missver-ständnis gibt es leider immer noch, sondern eine neue und gelebte Unternehmensphilosophie.
Herausforderungen klar beantwortenDie zentrale Überschrift kreist um die Präsenz auf den Social Media-Kanälen. Wo macht ein Auftritt für mich Sinn? Um diese Frage zu be-antworten, müssen sich auch KMU ganz gezielt die Unterfragen stellen; zum Beispiel wo ihre Zielgruppen Informationen konsumieren und ob sie aktiv auf Social Media-Kanälen präsent sind. Wenn diese Frage mit Ja beantworten werden kann, dann benötigt auch ein KMU eine Social Media-Strategie und eine aktive Präsenz auf die-
sen Kanälen. Es lohnt sich daher auch für KMU Social Media-Marketing einzusetzen, wenn sie es richtig anpacken und entsprechend agieren. Dabei sind einige Stolpersteine aus dem Weg zu räumen: Starten Sie nie ohne Social Media-Strategie! Das ist einer der grössten Fehler bei Schweizer KMU-Verantwortlichen, dass ohne strategisches Vorgehen gestartet wird. Eine Facebook-Fanseite oder ein Twitter-Account ist ja schnell eröffnet und kostet nichts. Jedoch staunt man dann, dass sich die Community nicht wie gewünscht entwickelt und keine Fans oder Followers generiert werden. Genau hier ist Unterstützung gefragt. Mein Unternehmen hat dafür extra Module entwickelt: Die «SocialCom® 8-Steps-Methode» ist ein zentrales Werkzeug aus unsrem Hause. 1)
Häufigste Fehler Nebst dem Fehlen einer Social Media-Strategie denken viele Unternehmen nicht daran, dass Ressourcen für die Bewirtschaftung dieser Kanäle eingeplant werden müssen. Für den Start sollte ein Pensum von zehn bis 20 Stel-lenprozent ausreichen. Das muss aber für jede Unternehmung in der Strategie individuell be-rechnet werden und kann sich für grössere Un-ternehmen mit mehreren Kanälen zur Bewirt-schaftung bis zu 100 oder mehr Stellenprozent belaufen. Die beauftragten Mitarbeiter wer-den im Rahmen der Strategieerarbeitung und Implementierung auch spezifisch geschult. Auch ist es wichtig, das Thema Monitoring zu thematisieren. Hier stecken wir in der Schweiz noch in den Kinderschuhen. Nur die wenigsten Unternehmen verfügen über ein professionel-les Social Media-Monitoringsystem.
Falsche Vorstellungswelten Ein Verzicht an einer aktiven Dialogteilnahme im Social Web ist heute fast immer die falsche Strategie. Es ist wie im richtigen Leben: Sie möchten mitreden und dabei sein, wenn über Sie und Ihr Unternehmen gesprochen wird, um sich über positive sowie auch kritische Fragen fachgerecht äussern zu können. Zudem bietet das Social Web auch für KMU-Verantwortliche Vorteile, wie die verstärkte Wahrnehmung des Unternehmens und der Personen wie auch Produkte, sowie eine erhöhte Kundenbindung und Loyalität. An dieser Stelle nur ein Beispiel: The Body Shop, ein Kunde unseres Hauses, betreibt regelmässig Verkaufsförderungsakti-onen exklusiv für die Facebook-Fans, indem

68 KMU LIFE · 05/2011
diese an einem bestimmten Tag mit dem Code-wort «Facebook» zehn Prozent Rabatt auf sämtliche Einkäufe erhalten.
Viele Unternehmungen fürchten sich vor der Kritik der Kunden und Anspruchsgruppen. Dabei ist doch gerade dies die grösste Chance für Unternehmen, dass sie dank Social Media erkennen, was Kunden wirklich wollen und somit Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitbe-werbern gewinnen können. Ein schöner Neben-effekt einer aktiven Social Media-Strategie ist zudem die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Eine Studie aus den USA belegt, dass bei der Eingabe von Suchbegriffen unter den Top Ten Google-Resultaten bereits sieben Social Media-Kanäle enthalten sind. Im Rahmen der folgenden Punkte finden Sie einige weitere Chancen und Mehrwerte einer aktiven Social Media-Strategie, welche auch für KMU span-nend sein könnten:
• Nutzung der Communitys zu Marktfor-schungszwecken (zum Beispiel Pretest einer Kampagne, aber auch Überblick über die Märkte, Kunden, Mitbewerber)
• weltweiteVerbreitung,hoheAktualitätundSchnelligkeit
• viraleMarketingeffekte,zumBeispieldurchweitergeleitete Tweets oder Webvideos
• neuePotentialezurGewinnungneuer,insbe-sondere auch jüngerer Mitarbeitender
• Online Verkäufe mit gezieltem Einsatz vonSocial Commerce
Risiken abklärenEin weiterer Stolperstein ist das Thema Sicher-heit. Es ist äusserst wichtig, die Unternehmun-gen auf mögliche Risiken und Gefahren beim
Eintritt ins Web 2.0 aufmerksam zu machen. Bereits in der Vorprojektphase gilt es, die möglichen Risiken abzuklären. Social Media Guidelines für die Mitarbeitenden sind eine Grundlage, damit alle Beteiligten klare Reakti-onsmuster im Hinterkopf haben.
Die grösste Gefahr für Unternehmensverant-wortliche besteht sicherlich darin, dass Marken heutzutage nicht mehr nach dem Siloprinzip von oben nach unten bearbeitet werden. Märk-te sind zu Gesprächen geworden und jeder kann mitreden. Das ist zunächst eine begrü-ssenswerte Entwicklung. Allerdings ist es auch eine spezielle Herausforderung für die Betroffe-nen. Nicht mehr die Unternehmung vermittelt das Image über eine Marke, sondern die breite Masse. Wenn die Kunden und Anspruchsgrup-pen mit dem Verhalten oder den Produkten eines Unternehmens nicht einverstanden sind, können sie dieses durch die Kraft der Social Media in die Knie zwingen. In der Fachsprache nennt man solche Vorkommnisse «Shitstorms». Wir kennen solche Vorfälle aus der jüngs-ten Zeit von der Schweizer Marke Mammut, welche sich mit Economiesuisse gegen das CO2-Gesetz, über das im Parlament diskutiert wurde, engagiert hatte. Die Facebook-Com-munity von Mammut reagierte mit Empörung auf diese Aktion und liess ihrem Unmut auf der Mammut-«Pinnwand» freien Lauf. Im Web gilt heute die Regel, dass David gegen Goliath immer gewinnt. Deshalb ist es als Unterneh-men wichtig, im Voraus solche Krisenszenarien durchzudenken. Auch soll eine Unternehmung authentisch sein und eine Persönlichkeit im Web entwickeln. Nachfolgend finden Sie einige weitere Stichworte, welche Sie beim Eintritt ins Web 2.0 beachten sollten:
• ROI(ReturnonInvestment): Erfolge sind schwer messbar• Ressourcenbedarfistnötig• Datenschutz/Kriminalismus
Sie müssen sich aber auch bewusst sein, dass es Risiken aufgrund des Verzichtes auf Social Media für Unternehmen gibt:
• Verlust an Relevanz sowie der Bedeutungdes Unternehmens
• schlechteresSuchmaschinenmarketing(SEO)• fehlendeInterventionsmöglichkeiten mit Kunden und Stakeholdern• KrisenoderImageproblemewerden zu spät erkannt
FazitSocial Media bietet viele Chancen und Mehr-werte für Unternehmen. Ein Verzicht ist heute fast immer keine Option mehr. Doch viele Un-ternehmen betrachten die Revolution des Kom-munikationsverhaltens immer noch mit sehr gemischten Gefühlen. Für sie stellt sich die Fra-ge, inwiefern sie auf diese Revolution reagieren können oder müssen, sowie welche Risiken und Gefahren mit einem Social Media-Engagement oder -Nicht-Engagement verbunden sind. Das Umfeld ist selbst für viele Kommunikations-fachleute neu, sehr vielschichtig und äusserst dynamisch. Vertrauen Sie daher Profis und starten Sie nicht ohne Strategie.
Anmerkung1) Weitere Informationen zu dieser Metho-
de finden Sie unter www.socialcom.ch /2011/05/social-media-pflichtdisziplin
www.socialcom.ch
Sandra Albisser ist Geschäftsführerin der SocialCom GmbH.
Weitere Informationen
Ein Kompass für strategisches Vorgehen ist beim Thema Social Media Pflicht.
HUMAN RESSOURCE

WWW.SICHERHEIT-MESSE.CH
011 SECURA 2011 SECURITY 2011 ITY 2011 SECURITE 2011 SECURASICHERHEIT 2011 SECURITE 2011
18. FACHMESSE FÜR SICHERHEITMIT FACHKONGRESS15.–18. NOVEMBER 2011
MESSE ZÜRICH
F I R E · S A F E T Y · S E C U R I T Y
2 0 1 1
SS I C H E R H E I T
… und über 200 weitere
renommierte Unternehmen
freuen sich über Ihren Besuch
an der SICHERHEIT 2011.
Ins_Sicherh11_koo_182x264d 18.8.2011 9:24 Uhr Seite 1

70 KMU LIFE · 05/2011
worauf kLeine unternehMen bauen können
Längst rüsten Grossunternehmen im Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte auf: hohe Gehälter, teure Werbung, tolle Karrieremöglichkeiten und Extra-So-zialleistungen. In direkter Konkurrenz dagegen können kleine Unternehmen kaum bestehen. Umso wichtiger ist es, sich auf die eigenen Stärken zu besin-nen. Was Grossunternehmen nämlich nicht bieten können sind Übersichtlich-keit, Vertrautheit und persönliche Nähe.
von Torsten Seelbach
Mitarbeiter finden
Es gibt Menschen, die ein überschau-bares Unternehmen einem Konzern vorziehen. Doch was zeichnet sie aus? Fachspezialisten, die weder rechts
noch links schauen, sind in Kleinunternehmen wenig hilfreich. Gefragt sind vielmehr Leute, die anpacken, mitdenken und sich nicht zu schade sind, auch einmal etwas zu tun, was unterhalb ihrer Qualifikation liegt.
Solche Mitarbeitende sind nicht darauf ange-wiesen, für alles und jedes eine Vorgabe zu bekommen. Dafür haben sie selbst ausreichend Vorstellungskraft. Oft handelt es sich um Men-schen mit ausgeprägtem «Wir»-Gefühl, die für
ihre Firma eine Stütze sein wollen. Deshalb brauchen sie eine verantwortungsvolle und für die Firma wichtige Aufgabe. Natürlich wollen sie auch leben und benötigen ein vernünftiges Gehalt. Aber die Bedeutung der Bezahlung tritt zurück, wenn die Mitarbeitenden, passend zu ihrer Persönlichkeit, Verantwortung und Frei-räume bekommen, menschliche Anerkennung erhalten und Sinn in ihrer Arbeit finden.
Aufwand mit viel NutzenFür den Arbeitgeber liegt die Kunst darin, die besonderen Fähigkeiten und Stärken eines Mit-arbeitenden zu erkennen, um ihn richtig einzu-setzen. Dies ist nicht ganz einfach, denn direkt
nach den eigenen Stärken befragt, versucht jeder, sich in einem möglichst guten Licht dar-zustellen. Dieser Weg führt oft in Sackgassen. Hilfreich dagegen sind Persönlichkeitsanaly-sen, von denen es inzwischen eine ganze Rei-he gibt. In kleinen Unternehmen ist ihr Einsatz eher unüblich. Der Aufwand relativiert sich je-doch, wenn man bedenkt, welche Bedeutung jedem einzelnen Mitarbeitenden in einem eher überschaubaren Kollegenkreis zukommt.
Im Flow-Zustand bleibenHat ein Mitarbeitender den richtigen Platz ge-funden, sind gute Voraussetzungen für einen Flow gegeben. Gemeint ist nicht etwa ein Ner-venkitzel oder Kick wie beim Bungee-Jumping. Von einem Flow spricht man dann, wenn ein Mitarbeitender in seiner Arbeit aufgeht, derart, dass er die Zeit vergisst. Dazu muss der Mitarbei-tende wissen, was man von ihm erwartet. Seine Aufgaben sollten seinen Fähigkeiten sowie sei-nen inneren Zielen und Wünschen entsprechen. Dann kann es dazu kommen, dass er seine ge-
HUMAN RESSOURCE

71KMU LIFE · 05/2011
samte Konzentration auf seine Tätigkeit richtet. Neurowissenschaftlich gesprochen heisst das: Unser Arbeitsgedächtnis verfügt über eine ge-ringe Speicherkapazität. Es kann nur sieben, plus/minus zwei Informationseinheiten gleich-zeitig verarbeiten. In einem Flow-Zustand wird die Speicherkapazität des Arbeitsgedächtnisses voll und ganz für eine Aufgabe genutzt. Es gibt keinerlei Ablenkung durch innere Konflikte oder Unsicherheit. Alles, was um den Mitarbeitenden herum geschieht, nimmt er nicht mehr wahr. Steigern lässt sich der Zustand nur noch, wenn die Anforderungen und Fähigkeiten nicht nur im Gleichgewicht sind, sondern wenn die Anforde-rungen um einen Tick erhöht werden.
In einem Flow-Zustand sind Menschen aus-serordentlich produktiv – und glücklich! DieArbeit ist keine Bürde, sondern eine befrie-digende Aufgabe. Damit wird deutlich, wie wichtig die Übergabe von Verantwortung ist. Handlangerdienste, auf die sonst keiner Lust hat, genügen nicht.
Den Mitarbeitenden den Sinn ihrer Arbeit verdeutlichenUm Mitarbeitende bei der Stange zu halten, müssen sie ausserdem den Sinn ihrer Arbeit er-kennen können. Diesen zu vermitteln, ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Vorgesetzten. Mitarbeitende wollen wissen, wofür sie arbei-ten und weshalb sie stolz auf ihr Unternehmen sein dürfen.
Die besondere Herausforderung unserer Tage besteht darin, sich den wandelnden Anforde-rungen des Marktes anzupassen und dabei den
Kern des Unternehmens zu bewahren. Anders ausgedrückt: Es geht um die Fähigkeit, Wan-del und Fortschritt mit Tradition in Einklang zu bringen. Deshalb sollten den Mitarbeitenden die Antworten auf drei zentrale Fragen geläu-fig sein:
• GrundwertedesUnternehmens: Für welche Werte steht das Unternehmen?• Unternehmensstrategie:Was sinddie lang-
fristigen Ziele, die es zu erreichen gilt?• Unternehmenszweck:Wieundwomitsollen
die Ziele erreicht werden?
Es sind diese drei Fragen, die eine unterneh-merische Vision kennzeichnen. Sie helfen den Mitarbeitenden, sich mit ihrem Arbeitgeber zu identifizieren, so dass die Arbeit als etwas er-scheint, was zum Menschen dazugehört.
Ein gutes Betriebsklima schaffenFür ein gutes Betriebsklima kommt es vor allem auf die Vorgesetzten an. Die Mitarbeitenden schauen sehr stark darauf, ob sie leben, was sie sagen, wie sie sich in schwierigen Situationen verhalten und welches Verhalten sie dulden oder sanktionieren.
Die Vorbildfunktion der Führungskräfte kann man kaum überschätzen: Sie ist eines der stärksten Instrumente, um das Verhalten der Mitarbeitenden zu beeinflussen. Durch An-schauen und Nachahmen lernen Menschen ihre gesamte Muttersprache. Durch das Verhal-ten der Eltern und Lehrer entwickeln sie in ihrer Kindheit das persönliche soziale und kulturelle Wertesystem. Im Berufsleben sind es die Füh- www.afnb.de
Torsten Seelbach ist Leiter der Akademie für neuro-wissenschaftliches Bildungsmanage-ment (AFNB). Aufgabe der Akademie ist es, das Wissen der Neurowissen-schaften für Management und Wei-terbildung nutzbar zu machen.
Weitere Informationen
rungskräfte, von denen die Mitarbeitenden am schnellstenundeffektivstenlernen–undzwarpositiv wie negativ. Wenn es also darum geht, Verhalten bei Mitarbeitenden zu ändern oder die Bereitschaft zu entwickeln, neue Wege zu gehen, dann ist die Vorbildfunktion eine unbe-dingte Voraussetzung. Eine Führungskraft, die selbst jeden Tag zu spät kommt, wird es nicht schaffen, den Mitarbeitenden ein Gespür für Pünktlichkeit zu vermitteln, falls sie selbst im-mer zu spät kommen. Das theoretische Wissen der Führungskraft über Zeitmanagement und Selbstorganisation kann da so gross sein, wie es will. Vorleben ist also unbedingtes Gebot.
Mit Geld hat all das nicht viel zu tun. Eine men-schenfreundliche Umgebung gibt es dennoch nicht umsonst. Sie kostet Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, die nötigen Dinge zu tun. Als Belohnung winkt ein schlagkräftiges Mitarbei-tendenteam und eine Umgebung, in der Men-schen gerne sein wollen. Das ist wichtig, denn Mitarbeitende sprechen dann positiv von ihrem Arbeitsplatz, wenn sie sich dort wohlfühlen.
Damit schliesst sich der Kreis: Die positive Mundpropaganda ist für kleine Unternehmen unabdingbar bei der Suche nach neuen Mitar-beitenden. Stellenanzeigen in den Stellenmärk-ten der grossen Zeitschriften erweisen sich meist als wenig wirkungsvoll. In der Regel sind kleine Unternehmen jedoch in ihrer direkten Umge-bung gut verankert und haben ein über Jahre gewachsenes, persönliches Netzwerk. Gleiches gilt für die Mitarbeitenden. Diese persönlichen Netzwerke zu nutzen, um neue Mitarbeitende zu gewinnen, erscheint als der sinnvollere Weg. Ergänzende PR schadet natürlich nicht. Eine Schüleraktion oder eine andere Massnahme mit anschliessendem Bericht in der lokalen Zeitung –damitistschonvielgewonnen.
HUMAN RESSOURCE

72 KMU LIFE · 05/2011
HUMAN RESSOURCE
Projektbasierte unternehMensberatung Von studenten
ETH juniors bildet seit 1997 erfolgreich eine Brücke zwischen Privatwirtschaft und Hochschule. Die Junior Enterprise der ETH Zürich, eine rein von Studenten geführte Unternehmensform, hat sich auf projektbasierte Unternehmensbera-tung und Recruiting Services spezialisiert. Mit ungefähr 40 Projekten pro Jahr ist sie heute die stärkste Junior Enterprise der Schweiz und hat sich zudem zum grössten Anbieter von Recruiting Services an der ETH Zürich entwickelt.
von Joel Bloch
Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis füllen
Sie möchten Ihr Produkt oder Ihre Pro-zesse optimieren, verfügen aber nicht über das nötige Know-how? Sie haben nicht genügend eigene Kapazitäten,
um den Markt zu analysieren? Sie wünschen eine passende IT-Lösung, aber Ihr Budget wächst nicht in den Himmel? Dann ist ETH juni-ors vielleicht eine Lösung.
Ein Projektteam von unabhängigen Beratern denkt sich in Ihr spezifisches Problem ein und präsentiert Ihnen eine überzeugende Lösung. Bei der Zusammenstellung des Teams kann auf das Wissenskapital von über 25’000 Studieren-den der ETH und der Universität Zürich zurück-gegriffen werden.
KompetenzbereicheGleichzeitig ist ETH juniors der grösste Anbie-ter von Recruiting Services an der ETH Zürich. In der Projektarbeit fokussiert sich die studen-tische Unternehmung auf folgende Kompe-tenzbereiche:
• Logistik und Prozessoptimierung (zum Bei-spiel ISO-Zertifizierungen, Prozessoptimie-rungen, Forecasting)
• Marketing(beispielsweiseMarktstudien, Erhebungen, Analysen)• IT(zumBeispielC++,Java,VBA, Wikis, iPhone und Android)• Innovation(beispielsweise Innovationsworkshops, Fokusgruppen)
Vielfältige Tätigkeiten für Grosse und KleineETH juniors bietet sowohl Global Players (wie ABB, Credit Suisse, Siemens, Swiss Re, Burck-hardt Compression) als auch KMU die Dienst-leistungen hoch qualifizierter, junger und motivierter Studierender an. Firmen erhalten so Zugang zu aktuellstem Hochschulwissen, falls gewünscht auch in Form eines Personal-verleihs.
Unter den Dächern der Zürcher Universitäten entstehen spannende und passende Businessideen.

73KMU LIFE · 05/2011
HUMAN RESSOURCE
Im Rahmen der Recruiting Services organisiert ETH juniors neben Workshops, Firmenpräsen-tationen und individuellen Events an der ETH Zürich auch die jährlich stattfindenden Recrui-ting-Anlässe Polyinterview, den grössten Inter-viewtag der Schweiz (www.polyinterview.ch), und das Polycocktail.
Die Geschäftsführung von ETH juniors besteht ausschliesslich aus Studierenden. Motiviert werden sie dadurch, dass sie schon während des Studiums unternehmerisch tätig sind, mit Geschäftsführern verhandeln, eine grosse Ver-antwortung tragen und schliesslich sehr span-nende Projekte leiten.
ReferenzbeispieleDie Vielfalt der Beispiele verdeutlicht, wie die Schnittstellen zwischen Hochschule und Wirt-schaft gefüllt werden können. Der Transfer von Technologien und Wissen von der Hochschule in Unternehmen hinein braucht keine Übersetzer.
Optimierung der LohnbuchhaltungsprozesseBei der Tempobrain AG, die Outsourcing-Lö-sungen für Unternehmen anbietet, hatte sich die Anzahl der Temporärmitarbeitenden innert weniger Jahre mehr als verdoppelt. Die interne Struktur der Lohnbuchhaltung war nicht auf dieses Wachstum ausgelegt und musste des-halb angepasst werden.
Der Mitarbeitenden von ETH juniors analysier-ten vor Ort sämtliche in der Lohnbuchhaltung anfallenden Vorgänge und dokumentierten diese in einer Prozesslandkarte. Mittels ver-schiedener Techniken wie Prozessablaufdia-grammen, Fehler-, Risiko- und Aufwandmatri-zen wurden die Prozesse daraufhin analysiert und Optimierungsvorschläge ausgearbeitet. Die Resultate dienten den Verantwortlichen der Tempobrain AG massgeblich als Entschei-dungsgrundlage für die Anpassungen im Lohn-buchhaltungswesen (Personentage: 13, Dauer: ein Monat).
Neukonzipierung des FrachtmanagementsLeica Geosystems bietet Produkte und Lösun-gen für die geodätische Vermessung an. Die
hohen Frachtkosten der hochsensiblen Vermes-sungsgeräte und undurchsichtige Distributi-onsprozesse sollten durch den Aufbau zentraler Kompetenzen im Frachtmanagement gesenkt beziehungsweise transparent gemacht werden.
ETH juniors analysierte die länderspezifischen Transportprozesse bezüglich Kosten und Liefer-zeiten und verglich diese mittels eigens defi-nierten Kennzahlen. Anschliessend wurden die Aufgaben einer zentralen Frachtmanagement-funktion definiert und ein Pflichtenheft für die Transporteure konnte erstellt werden. ETH juni-ors zeigte wichtiges Verbesserungspotential in der Logistik auf und trieb so die Standardisie-rung der Prozesse bei Leica Geosystems voran (Personentage: 120, Dauer: sechs Monate).
Entwicklung einer neuen MarketingstrategieIm Rahmen der Strommarktliberalisierung ist die Kontrolle elektrischer Installationen von Stromanbietern zu zertifizierten Unternehmen übergegangen. Als ein solches wollte die ew-zert AG eine Marketingstrategie entwickeln, um ihre Akquise vorantreiben zu können.
Durch Einbezug verschiedener öffentlicher Dienste wurde eine Marktsegmentierung er-stellt. Des Weiteren wurde eine Konkurrenz- sowie eine Kundenanalyse mittels Umfragen und Recherchearbeit durchgeführt. Mithilfe dieser Analysen konnten konkrete Marketing-massnahmen formuliert werden, welche in einem nächsten Schritt evaluiert und der ew-zert AG in einem umfassenden Massnahmen-katalog dargelegt wurden. ETH juniors konnte so die ewzert AG massgeblich bei der weiteren Kundenakquise unterstützen (Personentage: 15, Dauer: zwei Monate).
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001Die Phonak AG produziert weltweit führende Hörakustikgeräte. Neben Innovationskraft und hohen Qualitätsstandards ist auch der Schutz der Umwelt in der Firmenstrategie verankert. Die kontinuierlichen Anstrengungen, die im Umweltbereich geleistet werden, sind bis an-hin nicht systematisch erfasst worden. ETH juniors wurde damit beauftragt, ein zertifizie-
rungstaugliches Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 zu entwickeln, mit dem sich die Leistungen im betrieblichen Umweltschutz fokussieren und zielgerichtet ausbauen lassen. Bisher Erreichtes sollte aufgearbeitet und in-tern kommuniziert werden.
Im Rahmen zweier Workshops und mehrerer Interviews mit Mitarbeitenden von Phonak wurden Umweltaspekte in Bezug auf die be-stehenden Prozesse identifiziert und anschlie-ssend gemeinsam mit Phonak-Spezialisten abteilungsübergreifend weiterentwickelt. Die Konsolidierung der Resultate lieferte ein um-fassendes Umweltprogramm, bestehend aus Massnahmenkatalog, Messgrundlagen, Kenn-zahlen und Zielwerten. Nachfolgend galt es, das Programm in das vorhandene Qualitätsma-nagementsystem zu integrieren. Dazu wurden bestehende Prozesse und Standardvorgehens-verfahren um Umweltaspekte ergänzt oder neu geschaffen.
Im Verlauf der viermonatigen Projektarbeit konnte ein für Phonak massgeschneidertes und im Betrieb verankertes Umweltmanagement-system entwickelt werden, das die Normanfor-derungen vollständig erfüllt. Der eingesetzte Mitarbeitende von ETH juniors hat zudem ei-nen Bericht über Umweltmanagement bei Pho-nak zuhanden des Geschäftsberichts (Sonova Holding) verfasst. Zentrales Element dabei war die weltweite Erhebung von Umweltkennzah-len der Unternehmen von Sonova inklusive der Berechnung des Carbon Footprints (CO2-Bi-lanz) (Personentage: 76, Dauer: vier Monate).
www.ethjuniors.ch
Joel Bloch ist Projekt Manager und ETH juniors Vice President.
Weitere Informationen

74 KMU LIFE · 05/2011
beeinträChtigte Mitarbeitende dank unterstÜtzung gut integriert
Anfang 2012 tritt das erste Massnahmenpaket der sechsten Revision des Inva-lidenversicherungsgesetzes in Kraft. Was sind die wichtigsten Neuerungen für KMU? Die IV bietet den Arbeitgebern weitere Unterstützung an, damit Betrie-be gesundheitlich beeinträchtigte Personen beschäftigen können. So finan-ziert die IV etwa befristete Arbeitsversuche mit Begleitung von Job Coaches.
von Regula Stocker und Monika Trost
Berufliche Eingliederung in KMU
Die Botschaft ist eindeutig: «Ich wür-de sofort wieder einen Trainingsar-beitsplatz zur Verfügung stellen. Er dient dem Betroffenen zur Wieder-
eingliederung, nützt aber auch der Firma», sagt Daniel Troxler. Er ist Mitglied der Geschäftslei-tung des Berner Druckereiunternehmens Ast und Fischer. Troxler hat ausprobiert, was sich die Invalidenversicherung von vielen weiteren
Schweizer Betrieben erhofft: Nach einem vor-erst auf sechs Monate begrenzten, begleiteten Arbeitseinsatz arbeitet Herr S. heute in einem regulären Arbeitsverhältnis mit Führungsver-antwortung bei Ast und Fischer.
Herr S., ursprünglich Informatiker, dann Projekt-leiter in der Baubranche, suchte nach seinem zweiten Burnout einen geordneten Wiederein-
stieg ins Arbeitsleben. Der Trainingsarbeitsplatz bei Ast und Fischer wurde über die Invalidenver-sicherung finanziert. Zu diesem Arrangement gehörte auch ein Job Coach, der dem gesund-heitlich angeschlagenen Mitarbeiter, aber auch dem Vorgesetzten zur Seite stand. «Wir haben ihn nur einmal monatlich getroffen, da alles gut gelaufenist–abereswargut,zuwissen,dasser bei Fragen da wäre», resümiert Daniel Trox-ler. Auch nach der Festanstellung kann Ast und Fischer noch auf den Job Coach zurückgreifen, wenn Bedarf besteht.
Kooperation von Arbeitgebern und IV Die erste Tranche der sechsten IVG-Revision, die Anfang 2012 in Kraft tritt, leitet einen Pa-
HUMAN RESSOURCE

75KMU LIFE · 05/2011
radigmenwechselein.Statt«einmalIV-Rente–immer IV-Rente» soll nun gelten: «IV-Rente als Brücke zur Eingliederung». Personen mit einer Beeinträchtigung, die heute eine Rente bezie-hen, sollen wieder voll- oder teilzeitig in den Arbeitsprozess eingegliedert werden.
Die meisten Firmen haben aus wirtschaftlichen Überlegungen Vorbehalte gegenüber gesund-heitlich beeinträchtigten Arbeitnehmenden. Sie fürchten den zusätzlichen Betreuungsauf-wand, die anfallenden Kosten für spezifische Integrationsmassnahmen und vermuten, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs so ge-schwächt werden könnte.
Die Sanierung der hochverschuldeten Inva-lidenversicherung kann wiederum nur dann erreicht werden, wenn noch mehr Arbeitge-ber aktiv werden und auch Menschen mit ge-sundheitlichen Beeinträchtigungen in ihrem Unternehmen beschäftigen. Dies im Wissen, dass sich eine solche Eingliederung wirt-schaftlich durchaus lohnen kann; stehen den Betrieben doch zahlreiche Unterstützungsan-gebote von staatlichen und privaten Stellen zur Verfügung.
Einen guten Einblick in konkrete Eingliede-rungsabläufe und einen Überblick über die bestehenden Unterstützungsangebote und Anlaufstellen erhalten Arbeitgeber und Per-sonalverantwortliche auf dem Internetportal www.compasso.ch. Seit Juni 2009 bündelt die Plattform die entscheidenden Informationen und gibt Antworten auf Fragen wie:
• WiekönnenMitarbeitendenachKrankheitoder Unfall wieder erfolgreich integriert werden?
• Wie kann ich rasch und richtig handeln,wenn ein Mitarbeitender häufig krank ist? Welche Institutionen unterstützen mich als Unternehmer dabei?
• Wie lassen sich Risiken bei der Einstellungvon behinderten Menschen minimieren?
• WelchessinddieunternehmerischenVortei-le bei der Zusammenarbeit mit beeinträch-tigten Mitarbeitenden?
Invalidisierungen aktiv verhindern Die IV bietet den Arbeitgebern bereits seit der fünften Revision der IV, die 2008 in Kraft trat, neue Unterstützungsinstrumente für die beruf-
liche Eingliederung. Diese Massnahmen im Be-reich der Früherfassung und Frühintervention haben zum Ziel, die Weiterbeschäftigung eines kranken oder verunfallten Mitarbeitenden zu ermöglichen.
Dabei ist entscheidend, dass die Arbeitgeber bei längerer oder wiederholter Krankheit ei-nes Mitarbeitenden möglichst früh mit den involvierten Versicherungen Kontakt auf-nehmen. Neben der IV sind dies auch die Krankentaggeldversicherung oder die Pensi-onskasse. Meist beinhaltet deren Leistungs-paket ein sogenanntes Case-Management bei schwereren Krankheitsverläufen. Der Ca-se-Manager begleitet den betroffenen Mit-arbeitenden individuell und unterstützt den Arbeitgeber dabei, die richtigen Perspekti-ven zu schaffen und den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Er informiert auch darüber, ob und wie der Mitarbeitende bei einer bleibenden Beeinträchtigung dennoch im Betrieb eingegliedert und gemäss seiner Leistungsfähigkeit produktiv eingesetzt wer-den kann.
Dass es sich lohnt, frühzeitig zu handeln, hat auch Nicole Wenger festgestellt. Die Perso-nalverantwortliche beim Berner Oberländer Fensterbauunternehmen Wenger Fenster AG hat nicht gezögert, mit der Krankentaggeld-versicherung und der IV-Stelle Kontakt aufzu-nehmen, als es ihrem Mitarbeitenden Herrn R. aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung immer schlechter ging. Das Team der Wenger Fenster AG bekam die nötige Unterstützung, damit eine Reduktion des Arbeitspensums von Herrn R. von 90 auf 50 Prozent möglich war. Alain Linder, der Vorgesetzte von Herrn R., ist überzeugt, dass es für Betriebe ab 20 Mitarbeitenden gut möglich sei, jemanden mit einem Handicap anzustellen: «Diese Menschen brauchen in der Tat etwas mehr Aufmerksamkeit. Dafür hat der Betrieb in ih-nen aber auch sehr dankbare und besonders motivierte Mitarbeitende».
Erfolgreiche Beispiele zeigenDie Informationsplattform www.compasso.ch informiert, motiviert und orientiert Arbeitge-ber, selbst aktiv zu werden, wenn es um die Eingliederung beeinträchtigter Arbeitnehmen-der geht. Dies in deutscher, französischer und italienischer Sprache.
Fotogeschichten aus der ganzen Schweiz zei-gen dabei ganz konkret auf, aus welchen Über-legungen heraus Arbeitgeber sich für eine Ein-gliederung in ihrem Betrieb entschieden haben.
Unterstützungsangebote der IV, der SUVA und von Privatversicherern reduzieren die Risiken für den Arbeitgeber und finanzieren die Einar-beitungsphase in bestimmten Fällen. Manch-mal winkt sogar eine Erfolgsprämie.
Die Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer reduzieren sich dabei nicht nur auf finanzielle Aspekte. Weitere Gründe, sich auf den Prozess einer Eingliederung einzulassen, sind die hohe Loyalität eingegliederter Arbeitnehmender, die vertrauensbildenden Auswirkungen auf die ganze Belegschaft sowie die positive Wirkung als soziales Unternehmen gegen aussen.
Nehmen Sie Einblick in die konkreten Erfah-rungen aus der aktuellen Arbeitswelt: Neue Fallbeispiele zeigen, wie auch für Führungspo-sitionen Eingliederungen gelingen.
www.compasso.ch
Regula Stocker ist verantwortlich für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Plattform www.compasso.ch.
Monika Trost ist verantwortlich für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Plattform www.compasso.ch.
Weitere Informationen
HUMAN RESSOURCE

76 KMU LIFE · 05/2011
wie das bundesgeriCht eineM ganzen wirtsChaftszweig das rÜCkgrat braCh!
Die staatliche Regulierung des Glücksspiels ist wohl beinahe so alt wie das Glücksspiel selbst. Angetrieben durch überholte moralische Vorstellungen ei-nerseits und die behördliche Gier nach höheren Steuereinnahmen andererseits vereiteln hoheitliche Eingriffe seit menschengedenken eine gemeinnützige Entwicklung der Glücksspielindustrie. Zu welch volkswirtschaftlich schädlichen Auswüchsen dieses Verhalten führen kann zeigt der Autor anhand eines aktuel-len Beispiels aus der Praxis des Bundesgerichts.
von Robert Hess
Suck Out
Es muss an dieser Stelle wohl nicht darauf hingewiesen werden, dass die Unter-nehmen kleiner und mittlerer Grösse die tragende Säule unserer Wirtschaft sind
–darüberistmansichnichtnurinFachkreiseneinig. Der mit dem Mittelstand eng verbunde-
ne Unternehmergeist und die dazugehörige Be-reitschaft des Mittelständers zur Übernahme von Verantwortung für sich selbst, für seine Unterneh-mung, aber auch für seine Mitarbeitenden bildet seit je her das Fundament der positiven schweize-rischen Wirtschaftsentwicklung.
Vor diesem Hintergrund müsste sich der Staat eigentlich über den Umfang seines Auf-gabenspektrums im Klaren sein und sich die Förderung und Unterstützung der KMU auf seine Fahne schreiben. Das dem offensicht-lich nicht so ist, stellt er aber leider in er-schreckender Regelmässigkeit immer wieder unter Beweis. Entgegen der landläufigen An-sicht, dass der Staat stets zum Wohle und im Interesse der Allgemeinheit handelt, zeichnet sich der Staatsapparat in all seinen Variatio-nen leider oft vielmehr dadurch aus, dass er primär die Einzelinteressen weniger, einfluss-reicher und mächtiger Gruppierungen umzu-setzen sucht und dadurch einer nachhaltigen
RECHT

77KMU LIFE · 05/2011
und flächendeckenden Entwicklung der gesell-schaftlichen Wohlfahrt entgegensteht. Dies hat das Bundesgericht, mit seinem Entscheid zum Verbot des gewerblichen Pokerspiels ausser-halb konzessionierter Spielbanken einmal mehr auf das Eindrücklichste bewiesen. Das dies-bezügliche Bundesgerichtsurteil vom 20. Mai 2010 (Urteil 2C_694/2009), soll nachfolgend etwas genauer unter die Lupe genommen wer-den. Dabei stehen die Ursachen dieses umstrit-tenen Entscheids einerseits und die direkten Folgen für die betroffenen Gewerbetreibenden andererseits im Mittelpunkt.
Glück vs. GeschicklichkeitNachdem die Eidgenössische Spielbankenkom-mission 2007 in einem Grundsatzentscheid richtigerweise festgestellt hat, dass es sich beim Pokerspiel nicht um ein Glücks- sondern um ein Geschicklichkeitsspiel handelt, nutzten viele engagierte Bürger die Gunst der Stunde und eröffneten, unter zum Teil erheblichem finanziellem Einsatz, ein eigenes kleines Po-kercasino. Innert kürzester Zeit kam es so auf-grund der stetig steigenden Nachfrage durch die offensichtlich spielwillige Bevölkerung im ganzen Land zu einem weitverzweigten und prosperierenden Netz von KMU-Spielbanken. Diese Klein- und Kleinst-Casinos waren den grossen Casinos und traditionellen Spielban-ken natürlich ein Dorn im Auge. Diese mussten nämlich nun, trotz mühsam ergatterten staat-lichen Konzessionen, eine hartnäckige und vo-raussichtlich nachhaltige Konkurrenz fürchten, welche ihnen nicht nur die Kundschaft abspens-tig machte sondern auch ihre durch staatliche Eintrittsschranken geschützten Marktstruktu-ren aufzubrechen drohte.
Nachdem das Bundesverwaltungsgericht im Sommer 2009 eine Beschwerde des Schwei-zer Casino Verbands gegen den Entscheid der Spielbankenkommission abgewiesen hatte, zog dieser seine Beschwerde weiter an das Bundesgericht, wo der Beschwerde dann vor etwas mehr als einem Jahr stattgegeben und das gewerbliche Pokerspiel verboten wurde. Die Erklärung des Gerichts, dass es sich beim Pokerspiel um ein Glücks- und kein Geschick-lichkeitsspiel handelt, ist in vielerlei Hinsicht fraglich, verdienen sich doch unzählige Po-kerprofis seit Jahrzehnten ihren Lebensun-terhalt ausschliesslich mit pokern. Folgt man also der Argumentation des Bundesgerichts,
so müssen diese Damen und Herren wohl allesamt die längste Glückssträhne der Ge-schichte haben.
Während andere Beschneidungen der Wirt-schaftsfreiheit, wie zum Beispiel das nationale Rauchverbot, zumindest absehbar waren (in vielen Nachbarländern waren ähnliche Gesetze bereits in Kraft und entsprechende Bemühungen auch in der Schweiz seit längerem im Gange) und den Gastronomen wenigstens ein Minimum an Anpassungszeit gewährten, so brach das Urteil des Bundesgerichts völlig unvermittelt einem ganzen Wirtschaftszweig das Rückgrat.
Schwerwiegende FolgenEin prominentes Beispiel hierfür dürfte wohl das Swiss Poker Casino in Siebnen im Kanton Schwyz sein. Über CHF 500’000 wurden von der Eigentümerschaft in den Auf- und Ausbau des Casinos investiert. Dieser KMU-Betrieb bot innert kürzester Zeit 16 Arbeitnehmern eine Stelle. Als Folge des bundesgerichtli-chen Pokerverbots stehen diese Menschen nun auf der Strasse und die branchenbezoge-nen Investitionen mussten praktisch auf null abgeschrieben werden. Leider ist dieses zur Verdeutlichung herangezogene Beispiel kein Einzelfall. Unzählige andere Unternehmer er-litten nach dem Entscheid ein gleiches oder ähnliches Schicksal. Entsprechend zynisch wirkt da die Mitteilung des Bundesgerichts, dass solche Unternehmer schliesslich «auf ei-genes Risiko» gehandelt hätten. Diese Äusse-rung zeigt gleichzeitig aber auch, dass sich die Damen und Herren Bundesrichter der Folgen für die Betroffenen vollends bewusst waren und dennoch so entschieden haben. Fehlerhaftes SystemDen grossen Spielbanken und Casinos kann man beileibe keinen Vorwurf machen, dass sie sich unerwünschte Konkurrenz vom Leib halten wollen. Es liegt in der Natur der Sache dass sie ihre staatlichen Konzessionen mit allen Mitteln zu verteidigen suchen. Dies leuchtet umso mehr ein, wenn man sich erst einmal vor Augen führt, welch unverhältnismässige Abgaben (bis zu 80 Prozent des erwirtschafteten Ertrages) die Ca-sinobetreiber zu leisten haben.
Der Fehler ist vielmehr im System selbst zu su-chen, also in den staatlich verordneten Aufla-gen für das unternehmerische Agieren von Pri-
Robert Hess MLawdissertiert im Bereich des Wettbe-werbsrechts an der Rechtswissen-schaftlichen Fakultät der Universi-tät Fribourg
Weitere Informationen
vaten in einem potentiell so fruchtbaren Markt. Wie viele Arbeitsplätze und wie viel Mehrwert könnte für die Schweiz wohl generiert werden, wenn diese Branche einer gewissen Liberalisie-rung zugeführt würde?
Kritiker führen gegen eine solch freiheitli-che Gestaltung der «Glücksspielbranche» oft Schlagwörter wie «Öffentliches Interesse» und «Öffentliche Gesundheit» ins Feld. Es läge im öffentlichen Interesse, eine starke Regulierung durchzusetzen, und es schade der öffentli-chen Gesundheit, wenn der Staat den unein-geschränkten Betrieb von Casinos erlaube. Schaut man aber etwas genauer hin, ist schnell erkennbar, dass eine solche Argumentation ins Leere läuft. Es kann nämlich kaum im öffent-lichen Interesse liegen, bestehende Arbeits-plätze zu vernichten und darüber hinaus das unternehmerische Engagement der Bürgerin-nen und Bürger zu untergraben. Überdies hat ja genau diese Öffentlichkeit mit ihrer starken Nachfrage bewiesen, dass das Bedürfnis für eine solche Liberalisierung gegeben ist. Und was genau unter dem Begriff der öffentlichen Gesundheit zu verstehen ist, weiss bis heute kein Mensch. Wären diese Kritiker auch nur ein bisschen konsequent, dann müssten sie auch die Schliessung aller Fast Food-Ketten, aller Bierbrauereien und Autofabriken fordern –aberwerweiss,vielleichtsindwirjabaldallenur noch mit dem Trottinett unterwegs und er-nähren uns von Algen und Grüntee.
Es bleibt also nur zu hoffen, dass die staatli-chen Institutionen in Zukunft etwas mehr Rai-son walten lassen und dem mündigen Bürger nicht ständig weiszumachen versuchen, ihn vor sich selbst retten zu müssen. In diesem Sinne kann abschliessend festgehalten werden, dass dieHoffnungbekanntermassenzuletztstirbt–wobei sie in diesem Fall wohl schon aufgebläht und bäuchlings im Wasser treibt!
RECHT

78 KMU LIFE · 05/2011
GADGETS
Das ist der Dreiklang, der die Brücken zwischen Business und Freizeit schliesst. Wir haben wieder einige technische Spielzeuge für Sie ausgewählt.
Technik, Eleganz und Alltag
Treuer BegleiterDas ist Ihr Begleiter durch den ganzen Tag: Lassen Sie sich am Morgen mit Musik vom Cowon C2 wecken, hören Sie auf dem Weg zur Arbeit die aktuellen Nachrichten im Radio, ent-spannen Sie sich in der Mittagspause mit Ihrer Lieblingsmusik, zeigen Sie Ihren Arbeitskollegen in der Pause die neusten Ferienfotos und auf dem Heimweg verkürzt Ihnen ein auf dem Cowon C2 gespeichertes Video die Reisezeit. Auf dem Display erscheinen im Verlauf eines Tages verschie-dene Daily Life-Anzeigen, im automatischen Wechsel je nach Tageszeit.
Der Cowon C2 besitzt einen internen Flash-Speicher, welcher durch mic-roSD-Karten erweiterbar ist. Der kompakte Multimediaplayer unterstützt eine Vielzahl an Audio- und Videoformaten, hat ein FM Radio integriert und besitzt zudem einen Lautsprecher sowie ein Mikrofon. Die hervorra-gende Klangqualität kann mit vielen Equalizer-Einstellungen zusätzlich optimiert werden.
www.cowon.ch
Früher Zigarre, heute Lautsprecher Früher lagerten in diesen Kisten feinste Zigarren, nun sind tech-nische Highlights darin verbor-gen. Die Maduro Sonos Speaker, entwickelt von GoodDeedAudio, beherbergen einen kleinen, aber leistungsfähigen 2.5-Zoll-Laut-sprecher in einer alten Zigarren-kiste. Diese hat einen zusätzlichen Rahmen bekommen und wurde mit einem herkömmlichen USB-Ausgang versehen, um den Sound vom PC wiederzugeben. Die Maduro Sonos Speaker brauchen folglich keine Steckdose. Sie ziehen ihre Energie direkt aus der USB-Verbindung.
www.coolmaterial.com
Leuchtender Herbst und leuchtende Musik Die Mode zeigt sich in diesem Herbst in kräftigen Farben und lebendigen Mustern. Davon inspiriert bietet Logitech die beliebten Lautsprecherdocks Logitech PureFi Express Plus und Lo-gitech Rechargeable Speaker S315i in neuen leuchtenden Farben. Sie sorgen für ein intensives Musikerlebnis mit hervorragender Soundqualität. PureFi Express Plus von Logitech ist ein Lautsprecherdock mit Weckerfunktion, das Musik ab iPod und iPhone in einem ausgewogenen und sat-ten Sound abspielt. Neu ist es in den beiden modischen Farb-varianten «Sea Blue» und «Flame Orange» erhältlich. Das soundstarke Lautsprecherdock bietet einen Tragegriff und kann mit Batterien oder am Stromnetz betrieben werden.
www.logitech.com

79KMU LIFE · 05/2011
GADGETS
Walkman reloadedDer Walkman ist tot, es lebe der Walkman. Vor einigen Monaten nahm Sony den le-gendären Kassettenspieler vom Markt. Jetzt verpasste der Konzern seinen mobilen Mediaplayern eine Generalüberholung. Die war auch dringend notwendig; die Kon-kurrenz ist auf der Überholspur. Der Geist des Walkmans lebt schon seit einiger Zeit unter einem schicken Touchscreen weiter und glänzt nun auch mit Bluetooth-Konnektivität. Damit kann nicht nur Musik gestreamt werden, eine neue Funktion erlaubt auch das drahtlose Tauschen von ganzen Fotoalben.
www.sony.ch
Design und SoundDie BeoSound 8 zeichnet sich nicht nur durch ihre hervorragende Klangqualität, das charakteristische Design und ihre intuitive Be-nutzeroberfläche aus. Sie gehört auch zu den wenigen Dockingsta-tions auf dem Markt, die mit dem iPad genutzt werden können. Das Produkt wurde in zahlreichen Schlüsselmärkten von Bang &
Olufsen hervorragend aufgenommen.
www.bang-olufsen.com
Die Freiheit, Persönlichkeit auszudrückenDas neue Packard Bell Liberty Tab ist ein 10.1-Zoll-Tablet für die ganze Familie und bietet Unterhaltung, Spass, Multimedia und PC-Funktionen mit Top Komfort. Mit dem Packard Bell Liberty Tab entdecken Sie eine völlig neue Dimension der Benutzerfreundlichkeit und Unterhaltung ohne Grenzen.
Das Packard Bell Liberty Tab besticht sofort mit seiner beeindruckenden Linienführung, die pure Eleganz ausstrahlt. Es ist in den Farben Cherry Red und Pearl White erhältlich und hat den gewohnt eleganten PB-Stil, mit dem Sie Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Das Packard Bell Liberty Tab ist ein All-inclusive-Tablet, das keine Adapter benö-tigt: Bringen Sie sich selbst zum Ausdruck, einfach und perfekt! Mit dem neuen, speziell für Tablets optimierten Betriebssystem Google Android 3.0 «Honeycomb» wird die Touch-Navigation mit dem Packard Bell Liberty Tab zu einem wahren Erlebnis.
www.packardbell.ch

IMPRESSUM
ISSN: 1661-772XNachdruck nur unter genauer Quellenangabe und mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags gestattet. Na-mentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung der Autoren wieder, die sich nicht automatisch mit der des Verlags deckt. Der Verlag haftet nicht für unverlangt eingesandte Manuskripte.
AutorenBeat ImwinkelriedCarl Rosenast Christoph RichardHerbert BrändliJoel BlochMonika GieseRegula Stocker und Monika TrostSandra AlbisserThomas SkipwithTorsten SeelbachVanessa Kammermann-Gentile
Bilderwww.compasso.chwww.quovadis.chwww.solvaxis.comwww.weinhotel.ch
KundenverzeichnisEnergie-Agentur der Wirtschaft 17 / 60 - 61Jobs.ch AG / Topjobs 11Ford Motor Company (Switzerland) SA 45Solvaxis SA 14 - 17Henri Harsch HH SA 51Auto- Interleasing AG 48 - 50Aastra Telecom Schweiz AG 29Webland AG 41Victorinox 67Diametral P. Krebs 33GONDRAND LTD 13Sunrise Communications AG 30 - 31Oxymount AG 47KM-U AG 9Swiss International Air Lines Ltd. 4KESO AG 35Cyberlink AG 59MediaSec AG 69HP (Schweiz) GmbH 23Alphabet Fleetmanagement (Switzerland) Ltd 39Sigrist & Schaub SA 55Alcatel-Lucent AG 65SocialCom GmbH 66 - 68ETH juniors 72 - 73
Sage 2. UmschlagseiteSolvaxis SA 3. UmschlagseiteDie Schweizerische Post /PostLogistics 4. Umschlagseite
JahresaboKontaktieren Sie bitte
[email protected] / 2011
Neue Dimensionen ermöglichenPassende Unternehmenssoftware
•MehrWissenfürdenWettbewerb•FremdeMärkteinunsicherenZeiten
KMU LIFE – Sechste Ausgabe
Am 21. Dezember 2011 erscheint die nächste Ausgabe von KMU LIFE. Folgende Schwerpunkte stehen auf unserer Agenda:
Verzweifelt gesuchtFachkräftemangel angehen
In der WolkeCloudlösungen im Praxistest
Raus aus alten DenkmusternTheorie und Praxis beim Risikomanagement
Faszinieren statt Präsentieren Bei Auftritten Wirkung erzielen
Effizienzpotenziale ausschöpfenGrünes Rechenzentrum
HerausgeberLife Medien GmbH
BaselDreispitz ArealLeimgrubenweg 4CH-4053 BaselTel. +41 (0) 61 338 20 00Fax +41 (0) 61 338 20 22
VerlegerRolf Hess
VerlagsleiterHasan Dursun / [email protected]
ChefredaktorGeorg Lutz / [email protected]
Redaktion Valérie Ziegler / [email protected]
VerkaufVirginie Vincent / [email protected] Heinemann / [email protected]
Leitung ProduktionTobias Merz / [email protected]
Art DirectorTobias Merz / [email protected]
Korrektorat / LektoratHédi Róka
DruckKliemo Printing AG
80 KMU LIFE · 05/2011

BUSINESS SOLUTIONS,THE SWISS WAYSchweizer Hersteller von Business-Software für KMU
www.solvaxis.com

Grosses bewegen: Auch das ist Logistik.Ob rare Einzelstücke, eine oder mehrere Paletten, Teil- oder Ganzladungen: Die Post transportiert zuverlässig und umweltschonend. Ein Transportauftrag genügt, und wir holen die Ware bei Ihnen ab. Ausgeliefert wird innert kürzester Zeit, auf Wunsch innerhalb 12 Stunden. Was immer Sie wünschen, vertrauen Sie auf die Logistikerin mit dem umfassendsten Angebot: post.ch / logistik
Für die anspruchsvollsten Kunden der Welt.
Ins_Transport_205x275_ra_dt_RZ.indd 1 12.10.11 16:36