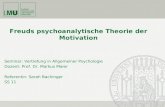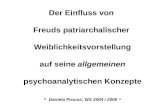Kritische Bemerkungen zum Unbewußten Freuds
-
Upload
siegfried-fischer -
Category
Documents
-
view
217 -
download
2
Transcript of Kritische Bemerkungen zum Unbewußten Freuds
(Aus der Psychiatrisehen und Nervenklinik der Universit~t Breslau [Direktor: Professor Dr. Johannes Lange].)
Kritische Bemerkungen zum Unbewuflten Freuds.
Von
Siegfried Fischer.
(Ei~jegangen am 24. September 1931.)
.
Die vorliegende Untersuchung ist eine psychologische bzw. psycho- pathologische; sie halt sich daher grunds~tzlich fern yon allen philo- sophischen oder metaphysisehen ErSrterungen. Eine Untersuchung fiber das Unbewu$te wird sich naturgem~B mit der Bestimmung dieses Begriffs besehi~ftigen miissen. Auch diese Aufgabe gehSrt nicht in das Gebiet der Philosophie, da jede Wissenschaft ihre Begriffe selbst bestimmt. Sofern also die Frage nach dem Wesen des UnbewuSten eine psycho- logische ist, mug der Begriff des UnbewuSten yon der Psycho]ogie bestimmt werden.
Die Frage nach der Existenz eines Unbewul~ten ist in den letzten Jahren, insbesondere mit Beziehung auf die Psyehoanalyse Freuds, vielfach diskutiert worden. Das Problem ist ffir die Psychoanalyse darum so wiehtig, weil mit der Anerkennung oder Verwerfung unbewul~ter seelischer Vorgii.nge eine der wichtigsten Stfitzen dieser Lehre steht und f~llt. Aber auch unabh~ngig vonder Freudsehen Lehre ist eine Kl~rung dieser Frage yon grundss Wichtigkeit fiir die Psychologie und Psychopathologie.
Eine Untersuchung fiber das UnbewuBte setzt notwendig eine klare und scharf umrissene Bestimmung dieses Begriffs voraus. Nun hat, wie zu zeigen sein ~drd, dieser Ausdruek mannigfache Bedeutungen. Werden diese Bedeutungen nicht sSreng auseinandergehalten, so gibt es unheilvolle Verwirrungen, wie der weitaus gr6$te Teil der psycho- logischen und psychopathologischen Literatur beweist. Es ist sogar nichts Seltenes, dab ein Autor den Ausdruck Bewu~tsein oder Unbewul3t- sein in einem Satz in zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Da also selbst der Einzelne seine eigene Sprache nieht versteht., gleichwohl aber diesen seinen Fehler nicht bemerkt, ist eine Verst~ndigung unter- einander um so weniger m6glich.
776 Siegfried Fischer:
Um eine K]arheit zu schaffen, wird es zweckm~Big sein, zun~ehst die verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks UnbewuBtes zu unter- suchen. Ffir dieses Vorgehen empfiehlt es sich, vorerst yon dem Aus- druck Bewufltsein in seinen verschiedenen Bedeutungen auszugehen und durch Entgegensetzung dann zu den verschiedenen Bedeu~ungen des Ausdrueks Unbewu[3tsein zu ge]angen. Die nun folgenden Begriffs- bestimmungen enthalten prinzipiell nichts Neues. Sie sind oder sollten bekannt sein seit dem Jahre 1900, dem Erseheinungsjahr der ,,Logischen Untersuchungen" yon Edmund Husserl. Eine leichter verst~ndliche Darstellung der Gedanken Husserls hat August Messer 1908 in seinem Buch ,,Empfindung und Denken" gegeben; eine kurze Zusammen- fassung findet sich in meinem Artikel ,,Bewul3tsein" des Birnbaumschen Handbuches der medizinischen Psychologie. An diesen Aufsatz sehlieBen sich aueh die folgenden Ausffihrungen an.
II.
1. Man kann BewuBtsein definieren als das Psychische. Alles, was den Charakter des Psychischen tri~gt, ist in dieser Bedeutung des Wortes ,,bewuBt", ,,unbewuflt" also alles Nichtpsychische, z. B. alle materiellen Dinge. Etwas Unbewui3t-Psychisches gibt es bier nicht, denn das hieBe etwas Nichtpsychisch-Psychisches. Spricht man in solchem Fa]le yon unbewul3ten Vorg~ngen, so ist man gen6tigt, diese Prozesse ins Bereich des Organischen, des K6rperlichen zu verlegen.
Natiirlich steht es im Belieben jedes einzelnen, einem Ausdruck eine Bedeutung beizulegen, die ihm zweckm~13ig erscheint. Es ist nur erforder- lich, dal3 man sich in jedem Fall die Tragweite solcher Definition vor Augen fiihr~. Mit der Begriffsbestimmung Bewul3tsein = das Psychische ist die psychologisehe Grenze iiberschritten; denn es ist damit die meta- physische Frage nach dem Wesen des Unbewul3ten, ob es psychisch oder physiseh ist, beantwortet. Damit ist die Erforschung des Unbe- wul3ten in das Gebie~ der Physiologie verlegt. Mit dieser Definition verbaut sieh also die Wissensehaft - - nicht die Psychologie, die als solche gar nicht so definieren kann - - den Weg zur psychologischen Erforschung des Unbewul3ten, und damit ist auch jeder Strei~ um die Existenz eines UnbewuBten in der Psychologie mfiBig. Da, wie eingangs bemerkt, diese Untersuchung eine psyehologische ist, is~ der Ausdruck BewuBt- sein in der Bedeutung gleich das Psychische ffir jede weitere psycho- logische Untersuchung des UnbewuBten unbrauchbar. Es wird deshalb diese Bedeutung des Ausdrucks BewuB~sein yon jetzt ab vernaehl~ssigt werden.
Ausdrficklich wird jedoch hervorgehoben, dab damit in keiner Weise unsere Stellungnahme zu der Frage der psychischen oder physischen Na~ur des Unbewul3ten festgelegt ist. Die Au[3erachtlassung der
Kritische Bemerkungen zum Unbewu~ten Freuds. 777
genannten Bedeutung yon BewuBtsein erfolgt nur deshalb, weil uns in diesem Falle jede weitere Untersuehung tiber das Unbewu~t~ tiber die Grenzen der Psychologic hinausftihrt, eine Grenze, die zu iiberschreiten weder in unserer Absieht noch in unserer Kompetenz liegt.
2. Unter BewuBtsein kann ferner das Ich oder das psychische Subjekt verstanden werden. UnbewuBt ist hier alles, was nieht psyehisches Subjekt, was nicht ein Ieh ist. Das Ich, yon dem bier die Rede ist, ist das unmittelbar erlebte Ich. Nieht damit gemeint sind die mannig- faehen sekund~ren Iche (Lipps) z. B. wenn ich sage ,,Ich" bin sehmutzig, womig natiirlich nichb das psychische Subjekt gemeint ist, sondern ,,mein" KSrper, den ieh als in bestimmter Weise mir zugehSrig und yon mir abh~ngig als meine unmittelbare Maehtsph~,re erlebe. ~hnlich wenn ich sage ,,Ich" baue mir ein Haus, wenn andere auf mein GeheiB es bauen. Dieses ,,Ieh" ist jedesmal ein sekund~res Ieh, das das prim~,re Ich, yon dem es abh~ngig ersehein~ oder als dessen Machtsph~re es erleb~ wird, voraussetzt. Von diesen sekund~ren Ichen ist hier nieht die Rede, sondern gemein~ ist bier das unmittelbar erlebte Ich.
Nun weil3 ieh unmittelbar nut von meinem eigenen Ich. Andererseits aber weil~ ieh auch von fremden Iehen, jedoch nieht als unmittelbar erlebt, sondern als mittelbar erlebt, und zwar wie wir mit Lipps und Volkelt meinen, nicht etwa durch einen AnalogiesehluS, sondern dureh Einfiihlung. Ist man mit Scheler der Ansieht, dab das fremde Ich und seine Erlebnisse unmittelbar wahrgenommen werden kSnnen, daft wir sowohl unsere Gedanken als die Gedanken anderer denken, unsere Gefiihle wie die anderer ffihlen kSnnen, so soll zu dieser Ansieht hier keine Stellung genommen werden 1; denn eine prinzipielle ~nderung der yon uns aus der hier vertretenen Ansieht gezogenen Schltisse wird dureh die Annahme der Ansicht Schelers nicht verursaeht. Soviel ist jedenfalls sieher, dab es au~er meinem eigenen individuellen Ieh noch eine Vielheit yon anderen Iehen gibt. Und dieses Vorhandensein yon anderen psychischen Subjekten ist mir durehaus evident.
Das UnbewuBtsein ist also al]es das, was nicht ein Ieh oder ein psyehisches Subjekt ist. Hierzu gehSr~ zun~ehst alles Physisehe. Weiterhin sind wir aber bereehtigt und gezwungen, als unbewuSt aueh das einzelne psyehische Erlebnis, wie eine Vorstellung, einen Denkakt, ein Gefiihl anzusehen; denn das einzelne Erlebnis ist selbstverst~ndlieh kein psychisehes Subjek~, obwohl ein Erlebnis nur existiert, wenn es yon einem Ieh erlebt wird. Das Ieh ist zwar eine no~wendige Voraus- setzung etwa fiir ein Geftihl, darum ist das Gefiihl aber noeh kein psychi- sehes Subjekt oder ein Ieh. Es mu~ jedoeh beriicksiehtigt werden, da~ ieh in den einzelnen Erlebnissen, Vorstellungen, Denkak~en usw. das Ieh meist mehr oder weniger deutlieh mit~rlebe. Trotzdem gibt
1 Vgl. hierzu unter anderen J. Folkelt: Das ~,sthetischo BewuBtsein. Miinchen 1920.
Z . f . d . g . Neur u. Psych. 137. 51
778 Siegfried Fischer:
es fraglos Erlebnisse, in denen dies nichb der Fall ist, wo also ein Erlebnis erleb~ wird, ohne dab notwendig das Ieh aktuell mitgedacht oder erlebt wird. Dutch die Gesamtheit der Erlebnisse andererseits konstituiert sieh das Ieh oder das psyehisehe Subjekt. Die Behauptung also, dab das Erlebnis in dem bier gemeinten Sinne unbewuBt ist, gilt deshalb nur fiir einzelne und hier auch nicht ffir alle F/~lle yon Erlebnissen.
Der Ausdruek BewuBtsein in der Bedeutung gleich Ieh bezeiohne~ demnach einen etwas engeren Begriff als in der ersten Bedeutung gleieh psychisch; demgegeniiber bezeichnet der Ausdruek UnbewuBtsein in der Bedeutung gleich Nieht-Ich, einen etwas weiteren Begriff als in der Bedeutung yon nicht-psychiseh. Da die Argumente fiir die Kom- petenzfibersehreitung, die bei der ErSrterung der ersten Bedeutung yon BewuBtsein besprochen wurden, demnaeh hier aueh gelten, kommen auch die Bedeutungen von BewuBtsein gleich Ich, UnbewuBtsein gleich Nicht-Ich fiir unsere Untersuehungen nieht in Betraeht.
Nunmehr folgen zwei Bedeutungen des Ausdrueks BewuBtsein, die fiir die Psychologie yon ganz besonderer Wichtigkeit sind.
3. Man kann mit Husserl das BewuBtsein definieren als den gesamten reellen phdinomenologischen Bestand des empirischen Ieh, als Verwebung der psychischen Erlebnisse in der Einheit des Erlebnisstromes; oder kiirzer als alle zu einem Ich gehSrigen psychischen Erlebnisse. BewuBt sind dann alle Wahrnehmungen und Vorstellungen, die Denkakt~ sowohl wie die Geffihle und Wollungen, also alle Erlebnisse, d. h. also BewuBt- seinsinhalte. Unter Erlebnis sind natiirlich hier nich$ Ereignisse oder Geschehnisse zu verstehen wie etwa der Weltkrieg oder ein Erdbeben, wenn ieh sage : ich habe den Weltkrieg oder ein Erdbeben erlebt. Gemeint sind hiermit vielmehr die psychischen Erlebnisse ; das, was ich in mir selbst reell vorfinde. NichtbewuBt oder unbewuBt ist dann alles, was nieht erlebt ist. Dazu gehSrt zun/~chst alles Physische. Der Himme], den ich wahrnehme oder vorstelle, das Bild, an dem ich mieh effreue, das GroBe Los, das ich erstrebe, sie sind s/~mtlich nicht psychisch, nich~ Erlebnisse, nicht BewuBtseinsinhaUe, sondern Gegenst~nde, auf die sich meine Wahrnehmungen, Vorstellungen, Strebungen usw. beziehen; sie sind niemals in meinem Erlebnisstrom, diesem seelischen Geschehen und kSnnen darin nie vorgefunden werden; sie sind darum unbewuBt. Erlebt und damit bewuBt is~ nur die Wahrnehmungs- oder Vorstellungs- erscheinung oder der Wahrnehmungs- (Vorstellungs-) inhalt des Rimmels, die Freude, die ich bei Betraehtung des Bildes fiihle, die Akte des Strebens und Wollens auf das GroBe Los, also nur seelische Vorg/~nge. Dabei isb es gleichgiiltig, ob die vorgestellten, erstrebten Objekte reell existieren oder nicht.
Aber noeh anderes ist als unbewuBt in diesem Sinne anzusehen, dessen Naturals psychiseh nicht feststeht, n~mlich alle Reproduktionsgrund-
Kritische Bemerkungen zum Unbewuftten Freuds. 779
lagen derjenigen Erlebnisse, die friiher einmal erlebt worden sind, jetzt abet nieht mehr erlebt werden; und zwar Erlebnisse sowohl anschaulicher Art (z. B. Vorstellungen) wie auch unansohaulieher Art (Wissens- komplexe); d .h . also alles das, was sowohl das mechanische wie das logische Gedis ,,aufbewahrt", das aber gerade jetzt nicht aktuali- siert ist, und daher jetzt nicht zu meinen Erlebnissen gehSrt. Dieser Wissensbes~and oder die Kenntnisse, das gesamte Vorstellungs- und Wissensmaterial, das aktualisiert werden kann, ist zwar erlebnisf/~hig, tats/~chlieh aber nicht erlebt und darum in dem hier gebrauehten Sinne yon BewuBtsein unbewuBt mit Ausnahme dessen, was gerade in diesem Augenblick erlebt wird.
Es ist behauptet worden, dab dieses UnbewuBte, also alle diese Reproduktionsgrundlagen, kSrperlicher Natur sei und nicht psyehi- scher. Ein Beweis ftir diese Behauptung lieg$ yon keiner Seite vor; andererseiBs ist die psychische Natur dieses UnbewuBten ebensowenig bewiesen. Die Psychologic wird deshalb keinen Fehler begehen, wenn sie zun/~ehst die Annahme mach$, daB dieses UnbewuBte psyehischer Art is$; sie wird an der Hand ihrer Erkenntnisse untersuchen mfissen, ob diese Annahme sich mit den Ergebnissen ihrer Forschung vereinbaren l~l~t, oder ob sieh unlSsbare Widersprtiche ergeben. Solange dies nieht der Fall ist, wird die Psychologie die Reproduktionsgrundlagen als Gegenstand ihrer Untersuchung ansehen diirfen.
Der Vorteil dieser Annahme liegt darin, dab es nur dalm m6glieh ist, einen Kausalzusammenhang innerhalb des Psyehischen herzustellen. Ich sehe etwa auf der Stra6e A und B zusammen. Nach einiger Zeit begegne ich A allein, und die Vorsh~llung yon B tr i t t auf. Aus diesem Tatbestand sehliege ich u. a., dab die Wahrnehmungsinhalte yon A und B, die Erlebnisse in mir Spuren zuriiekgelassen haben. Das sp/~tere Auf- ~reten der Vorstellung yon B setzt voraus, dab seit der Begegnung mit A und B in mir irgend etwas gewesen ist, was ich aber nicht erlebt babe, was also unbewuBt war. Ieh ersehlieBe dies nur; denn es ist erforderlich, dies als eine der Ursachen fiir das Auftreten der Vorstellung yon B anzunehmen. Nur dutch die Annakme solcher ,,unbewuBter", d .h . nieht erlebter Reproduk$ionsgrundlagen ist es mSglich, einen Kausalzusammenhang in der Psychologie herzustellen. Damit is~ es abet durchaus nieht denknotwendig, diese Reproduktionsgrundlagen als psyehisch anzunehmen. Macht man die Annahme, dab dieses Unbemfllte physischer Natur ist, so ist seine Erforschung allerdings nicht mehr Aufgabe der Psychologie, eine andere prinzipielle Bedeutung hat diese Annahme nicht. - -
Fiir die Behauptung eines Unbewugten in dem hier gemeinten Sinn sind yon anderer Seite noch maneherlei andere Argumentr angeffihrt worden. Diese sind teils nieh~ beweiskr/~ftig, teils beweisen sie das Vorhandensein eines ,,UnbewuBten", das aber etwas v611ig anderes
51"
780 Siegfried Fischer:
ist als das UnbewuBte, yon dem hier die Reda ist. Dariiber sell erst sp~ter gehandelt warden.
4. V o n d e r eben besprochenan Bedeumng des Ausdrucks BewuBt- sein ist nun aufs sgrengste zu unterscheiden eine waitere Bedeutung, fiir die im folgendan, um Schwierigkeiten des Versb/~ndnisses zu ver- maiden, immer Gegenstandbewufltsein gesagt werdan sell. I m Sprach- gebrauch und auch in der psychologisehen und psyohiatrischen Aus- drucksweise ist dieses Wort zwar nieht sehr gel/~ufig, es sell auch nur deswegen hier eingefiihrt werden, weil in der fo]genden Er6rtertmg noch zuweilen auf das ,,BewuBtsein" in der zuletzt dafinierten Bedeutung zuriiekgegriffen werden muB; dafiir sell der Ausdruek BewuBtsein reserviert bleiben. Es sollen also fiir die beiden verschiedenan Be- dautungen aueh verschiedene Ausdriieke Verwendung finden, damit hier nicht, wie vielfach in der Literatur, durch eine J~quivokation des Ausdrucks BewuBtsein MiBverst/~ndnisse entstehen. Jim AnschluB an Husserl kSnnen wir start GegenstandsbewuBgsein auch inSentionales Erlebnis sagen.
Wenn gesagg wird, etwas ist Gegensgand meines Gegenstands- bewuBtseins, so kann dafiir ebenso gesagt werden, ieh bin auf e~was gerichtet, ich ziele auf etwas ab, ich meine etwas; ich kann auch sagen, ieh beachte oder ich bemerke etwas 1. So is~ z .B. der KSlner Dora als reales Objekt Gegenstand meines GegensgandsbewuBtseins, wenn ich ihn wahrnahme, oder mir jetzg vorstelle, oder miah an seinem Bau erfreue. Das Erlebnis der Wahrnehmungserseheinung, das Vorstellungs- bild, die Freude, also die BewuBtseinsinhalte sind dagegen nichg Gegen- stand meines GegenstandsbewuBtseins, denn ich beachte nicht die Inhalte, sondern ich bin nur auf den Gegenstand, eben den KSlner Dom gerichtet. Anderarseits wird der KSlner Dom nieht erlebg und kann nie erlebg und BewuBtseinsinhalt werden, dies kSnnen nur die seelischen
1 Damit setze ich Aufmorksamkeit und GegenstandsbewuBtsein als identisch. Dies ist nicht ohne weiteres vSllig bereehtigt. Es sind zwar stets nur ,,intentionale (~egenst~nde irgendwelcher Akte, und nur intentionale Gegenst~nde, worauf wir j~mals aufmerksam sind und aufmerksam sein kSnnen" (Husserl), ,,es gibt aber auch Gefiihle und Willensakte, Akte des Gefallens, MiBfallens, des Begehrens und Verabseheuens, die nur eine mittelbare Beziehung zur Aufmerksamkeit haben. sofern sie stets einen fundiorenden Akt des GegenstandsbewuBtseins voraussetzen. auf dessen Objekt die Aufmerksamkeit gewShnlich geriehtet sein wird" (Messer). Me,set ist der Ansieht, dab das Verh~ltnis der Begriffe GegenstandsbewuBtsein und Aufmerksamkeit dahin bestimmt werden kann, dab durch Aufmerksamkeit oin besonders holler Grad des GegenstandsbewuBtsoins bezeichnet wird. Diese Ansicht mSchten wir bier nicht vertreten, da ein Gegenstand iiberhaupt fiir reich erst dann zum Gegenstand wird, wenn meine Aufmerksamkeit, sei aueh die Beachtungsstufe noch so goring, sieh auf den Gegenstand richter. Mit dieser Ansicht wissen wir uns im Einverst~ndnis mit Husserl. Aus diesem Grundo halten wir uns fiir berechtigt, die Begriffe Aufmerksamkeit und GegenstandsbewuBtsein als identiseh zu gebrauehen.
Kritisehe Bemerkungen zum Unbewullten Freuds. 781
Erlebnisse. Es ist also in diesem Beispiel der KSlner Dom gegenstands- bewuBt, mein Wahrnehmungs- oder Vorstellungsbild etwa oder die Freude an ihm dagegen gegenstandsunbewuBt; wiederum is$ das Vor- stellungsbild oder die Freude bewlfllt (erlebt), der KSlner Dom dagegen unbewull~.
])enke ich etwa den Pythaqoreischen Lehrsatz, so bin ich auf eben diesen Gegenstand gerichtet, auf das I)reieck, auf die Quadrate fiber den I)reieckseiten, auf die GrSl3e der Fli~cheninhalte und auf den Sach- verhalt, der in dem Lehrsatz ausgedrfickt ist; ich beachte aber nicht und auch nicht im mindesten meine Denkprozesse odor racine Wahr- nehmungs- oder Vorstellungsinhalte und ebensowenig racine Akte der Intention auf die geometrische Figur, also alle racine Erlebnisse oder Bewufltseinsinhalte. Diese sind s/imtlich gegenstandsunbewul]t 1
Die psychischen Vorg/s die Erlebnisse, die Inhalte meines BewuBt- seins sind also ffir gew5hnlich, w/~hrend ich sie erlebe, nicht gegenstands- bewuBt. BeSrachte ich die Sixtinische Madonna, stelle ich mir den Eiffelturm vor, bin ich in Sorge um die Genesung eines Kranken, begehre ich eine Reise zu machcn, so sind alle die Erlebnisse nicht beachtet, also gegenstandsunbewuBt. Sie kSnncn aber mit Hilfe der inneren Wahrnehmung oder Selbstbeobachtung zum Gegenstand meiner Beach- tung und damit gegenstandsbewuBt werden. In diesem Falle bin ich nicht mehr auf die Sixtinische Madonna, den Eiffelturm, den Kranken, die Reise gerichtet, sondern auf meine Erlebnisse. ])ann sind alle diese realen Gegenst/inde nicht mehr gegenstandsbewu$t, sondern dies sind die Erlebnisse oder Bewul~tseinsinhalte. In diesem Sinne sind ebenfalls nicht gegenstandsbewu[3t das Sprechen odor die wissenschaftliche oder kfinstlerische Bet~tigung; denu der Sprechende, der schaffende Kfinstler oder Wissenschaftler sind in ihrer Bet/~tigung auf den Gegenstand gerichtet, ohne auf den Ablauf der dabei sich in ihnen vollziehenden seelischen Vorg/~nge, ohne auf ihre seelischen Erlebnisse oder BewuBt- seinsinhalte gerichtet zu sein. Sic k5nnen aber diese Erlebnisse auch beachten, dann erst werden diese seclischen Vorg/~nge gegenstandsbewui~t.
i Es ist also aueh eine mfiBige Frage, ob ein Mensch zu denken vermag, ohne es w~hrend des Denkens zu wissen. W~hrend des Denkens ist die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand des Denkens gerichtet. Daher karm ich im Augenblick des Denkens meine Aufmerksamkeit nicht auf racine Denkprozesse richten. Die Denk- prozesse sind also gegenstandsunbewullt, ieh weil~ yon ihnen nieht. Andererseits kann ich nachtraglich, rfiekschauend, diese Denkprozesse, die, wie die Psychologie gezeigt hat, unmittelbar im AnsehluB an das Denken, ebenso wie andere BewuBtseins- inhalte noch in eigentfimlicher Weise vorhanden sind, in der Selbstbeobachtung mit Hilfe der inneren Wahrnehmun9 beobachten. Dann beobaehte ich die Denk- prozesso als Gegenstand und dann weiB ich yon ihnen; ich denke aber nieht mehr an den Gegenstand, der vorher in diesem Denkprozesse intendiert war. Jetzt also sind die Denkprozesse gegenstandsbewuBt, der Gegenstand, fiber den ich vorher nachgedacht habe, gegenstandsunbewu6t.
782 Siegfried Fischer:
Ob ich etwas beachte oder bemerke, ob also ein Gegenstand fiir mich gegenstandsbewuBt ist, h~ngt in keiner Weise davon ab, ob ich dieses Bemerken nun spraehlich formuliere oder nicht. Die Psychologic hat uns geleln%, dab es verschiedene Stufen der Beachtung gibt (West- phal). Es kann alles, was beachtet wird, mehr oder weniger deutlich beachtet werden. Westphal unterscheidet 4 solcher Beachtungsstufen 1. Diese Stufen soUen hier nicht wiedergegeben werden. Es wird nur darauf hingewiesen, dab auf der hSchsten, der 4. Beachtungsstufe das Erlebnis konstatier~ oder ,,festgenagelt" werden kann, etwa durch ein Nicken mit dem Kopf oder durch eine sprachliche Formulierung. Not- wendig ist also die sprachliche Formulierung selbst bei hSchster Be- achtungsstufe durchaus nicht. Und wie die yon der Wiirzburger Schule geschaffene Denkpsychologie gezeigt hat, bedaff es auch weder zum Denken, noch zur Konstatierung des Gedachten einer sprachliehen Formulierung.
Alle physischen Dingo und alle (psychisehen) Erlebnisse kSnnen gegenstandsbewuBt werden, sofern ich sie beacht~ oder bemerke. Solange sie nicht beachtet sind, solange ich nicht auf sie gerichtet bin, solaage sind sie nicht Gegenstand meines GegenstandsbewuBtseins. Die physi- schen Dinge nun kSnnen gegenstandsbewuBt werden, indem ich sic beachte etwa in der Wahrnehmung. Sic sind es aber auch dann, wean ich sic bloB vorstelle, denn auch dana bin ich auf sie gerichtet. Ebenso sind die Dinge, die reell gar nicht existieren, sondern die yon mir nur in meinen Phantasiegebilden gemeinb werden, oder die halluziniert werden, Gegensts meines GegenstandsbewuBtseins. Das gleiche gi[~ ftir Gegenst~nde, die vSllig absurd sind, sofern ich an sic denke und sie meine, z. B. einen eckigen Kreis.
Sprechen wit also yon Gegenstandsbewui~tsein, so ist damit gewisser- maBen ein Querschnitt gemeint und zwar durch alle Akte, die im Augen- blick auf den Gegenstand gerichtet sind, ein Querschnitt also, der nicht den ganzen Erlebnisstrom trifft. Das BewuBtsein dagegen ist ein flieBender Zusammenhang, die Einheit des zusammenh~ngenden Verlaufs der Erlebnisse.
III.
Beaehte ich einen Gegenstand yon verschiedenen Seiten, so sind die Empfindungsinhalte jedesmal versohieden. Trotzdem is~ es fiir mioh absolut evident, dab ioh jedesmal denselben Gegenstand wahr- nehme. Dieses Identit~sbewuBtsein beruht auf den intent, ionalen Akten oder den Auffassungsprozessen, die neben den Empfindungs- inhalten erst das Dasein des Gegenstandes fiir reich ausmachen. Ist ein Gegenstand tiberhaup$ fiir mich, wenn auoh noch so unbestimmt,
1 ~bor Haupt- and Nebenaufgaben bei Reaktionsvorsuehen. Arch. f. Psyehiatr. 1911.
Kritische Bemerkungen zum Unbewui~ten Freuds. 788
da, als irgend etwas, so ist er dies infolge dieser Akte. Je mehr ich einen Gegenstand beaehte, um so h6her wird die Beaehtungsstufe. Wird aber eia Gegenstand als ein so und so bestimmter erfa#t, geht also die ,,Auf- fassung" des Gegenstandes fiber das Beaehten hinaus, so spreehen wir besser yon erfassen 1. Alle diese Akte, alle diese Prozesse des Auffassens und des Erfassens sind ,,der 13berschufl, der in jedem Wahrnehmungs- erlebnis, in seinem deskriptiven Inhalt gegeniiber dem rohen Dasein der Empfindung" enthaRen ist; ,,es ist der Akteharakter, der die Empfindung gleiehsam beseelt und es seinem Wesen nach maeht, dab wir dieses oder jenes Gegenst~indliche wahrnehmen" (Husserl, S. 385). Die Empfindungen und die auffassenden oder erfassenden Akte werden dabei erlebt und sind deshalb bewuBt; sie erscheinen aber nicht gegen- standlieh, sie werden nicht beachtet, nicht bemerkt, sie sind also gegen- standsunbewuBt. Andererseits werden die Gegenstande, etwa diese Blume oder jener Tisch, wahrgenommen, beachtet, aufgefa2t und erfaBt ; sie sind also gegenstandsbewuBt, sie sind aber nieht erlebt und sind deshalb unbewuBt.
Dasselbe gilt, wie leicht einzusehen, ffir alle ,,Gegensti~nde", die mit Hilfe der inneren Wahrnehmung aufgefaBt werden. Dariiber wurde oben schon das Nahere gesagt.
IV.
Man hat zum Beweise dafiir, dab es ein Unt~rbewuBtsein gebe, mancherlei Tatsachen angefiihrt, yon denen nut einige besprochen werden sollen.
Es wird etwa zu mir gesprochen, und erst nach einer Weile kommt es mir ,,zu Bewul~tsein", dab zu mir gesprochen wurde, und ebenso der Sinn der Rede. Oder in meinem Zimmer sehl~gt eine Uhr. Ieh hSre die Schl~ge nieht; nachdem die Sehl/~ge aber objektiv nicht mehr da sind, hSre ich sie gewissermaBen nachtr/~glich irgendwie in der Erinnerung.
Nach den bisherigen Ausftthrungen wird die Erkl/irung soleher Vorg/~nge keine Schwierigkeiten bereiten. Die Rede, die ieh naehtr/~g- lieh wahrnehme, und deren Sinn ich erst einige Zeit sp/iter erfasse, habe ieh, w/i, hrend sie gesprochen wurde, nicht geniigend beachtet; sei es, dab ich auf einen anderen Gegenstand achtete, sei es, dab der Gegen- stand meiner Aufmerksamkeit ein Saohverhalt war, fiber den ich nach- dachte. Die Rede ist wohl auf einer niederen Stufe der Beachtung yon mir aufgefaBt worden, sie war also irgendwie Gegenstand meines Gegen- standsbewuBtseins, aber ganz abgesehen yon dem Effassen des Sinns der Rede, habe ich die Lautgebilde kaum soweit aufgefaBt, dab ich hatte konstatieren k6nnen, es sprache jemand. Die intentionalen Akte des
1 Vgl. hiorzu S. Fischer: tiber das Entstehen und Verstehen yon Namen. Arch. f. Psychol. 1922, 42, 43.
784 Siegfried Fischer:
Auffassens sind vielmehr erst vollst/mdig in Erseheinung ge~reten bei dem Erleben der sog. Sekund/irempfindung (Poppelreuter), jener eigen- tiimliehen Nachwirkung der Empfindungen, die in unmittelbarem Anschlull an jede Empfindung auftritt. Erst beim Erleben jener Sekund/~rempfindung richte ieh meine volle Aufmerksamkeit auf den Gegenstand. Es war also die Rede, w/~hrend sie gesproehen wurde, nur wenig gegenstandsbewuBt, naehtr/~glieh, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gesproehen wurde, wurde sie erst v611ig beaehtet. Ebenso verhiilt es sieh mit dem Sehlagen der Uhr.
Deutlicher noch wird es, wenn ieh das Ticken der Uhr pI6tzlieh bemerke, obwohl ich reich schon 1/~ngere Zeit in dem Zimmer aufgehalten habe. Bis zu diesem Zeitpunkt war meine Aufmerksamkeit yon anderen Dingen in Anspruch genommen und nun, da dies nieht mehr der Fall ist, richter sieh meine Aufmerksamkeib auf das Tieken. Vorher also is~ das Ticken der Uhr nicht gegenstandsbewuBt gewesen, es ist dies jetzt erst geworden. Und nur insofern ist es berechtig% yon unbewuBten Vorg/ingen dabei zu sprechen, a]s jetzt im Gegensatz zu vorher der Wahrnehmungsinhalt und die auffassenden Akte erlebt werden und darum bewuflt sind; davon aber, yon diesen Erlebnissen, weil3 ich nattir- lieh niehts, denn sie sind nieht gegenstandsbewuBt.
Zuweilen wird der ,,aubomatisehe" Ablauf geiibter Bewegungen ebenfalls als unbewullt bezeiehnet. Wir wissen, dab die einzelnen Glieder derartiger Bewegungen ebenso wie die Glieder yon gel/iufigen Reihen dureh dauerndes Wiederholen assoziativ immer fester miteinander ver- bunden und aueh zu Komplexen zusammengefaBt werden. Solange wir lernen, ist es erforderlich, dab wir unsere Aufmerksamkei~ mi~ Intensit/it auf diese Gegenst~nde richten. Sind sie eingepri~gt, so zieh~ ein Glied das andere assoziativ nach sieh oder aueh ein Komplext~il seine Ergii, nzung, ohne dal~ ich meine Aufmerksamkeit darauf intensiv zu riehten brauche. Eine noch so geiibte Bewegung allerdings wird in ihrem Ablauf immer, wenn auch geringer Beaehtung bediirfen; solehe Bewegungen werden also nur wenig beaehtet und stehen deshalb auf einer niederen Stufe des GegenstandsbewuBtseins. Von einem UnbewuBt- sein hier zu spreehen, ist naeh unseren bisherigen Ausfiihrungen v611ig unangebracht: Die wi~hrend des Ablaufs solcher Bewegungen vor- handenen Erlebnisse sind ebenso bewuSt oder erlebt wie die Erlebnisse, die beim Ablauf anderer Bewegungen erlebt werden. Denn es kann etwas nicht mehr oder weniger erlebt werden. Etwas ist BewuBtseins- inhalt oder ist es nieht. Es kann aber etwas nicht mehr oder weniger Bewul3tseinsinhalt sein. Kein BewuStseinsinhalt steht dem Niehterleben n/~her als der andere (Biihler). Es handelt sich dabei natiirlich nicht um die Intensit/it. Und dasjenige an den Bewegungen, das nicht Erlebnis ist, z. B. mancherlei Vorg~nge in den Nerven oder Muskeln, is~ ebenso unbewul~t wie bei allen anderen Bewegungen.
Kritische Bemerkungen zum UnbewuBten Freuds. 785
V~
Mit diesem Riistzeug sind wit nun in der Lage, einige yon der Psychoanalyse aufgestellte Behauptungen zu untersuehen. Wir w~hlen als erstes ein bekanntes Beispiel yon Verspreehen. Ein Professor sagt in seiner Antrittsvorlesung: ,,Ich bin nicht geneig~" start ,,Ich bin nicht geeignet" iiber die Verdienste meines sehr gesehs Vorg~ngers zu sprechen. Dieser Professor war sich vorher natiirlich dartiber im klaren, dab er die Verdienste seines Vorgs nicht sehr seh~ttzte. Im Augenbliek der Rede war seine Intention auf den Sachverhalt gerichtet, dab er nieht geeignet sei, die Verdienste des Vorg~ngers zu wiirdigen. Dieser Sachverhalt war also gegenstandsbewuBt. Mehr oder weniger beachtet, jedenfalls auf einer niederen Beachtungsstufe stand der Saehverhalt, dab er dieser Aufgabe nieht geneigt sei. Dieser Sachverhalt war friiher einmal Gegenstand seiner votlen Aufmerksamkeit gewesen, dann aber im Augenblick der Rede wollte er yon diesem Sachverhalt nichts wissen, weil dieser nicht zu der Situation paBte. Vollsts konnte die Aufmerksamkeit hiervon jedoeh nicht abgelenkt werden (wahrscheinlieh auf Grund affektiver Faktoren, was aber bier unberiicksichtigt bleiben soll); dieser Sachverhalt stand also auf einer niederen Beaehtungsstufe, und die Intention auf diesen Sachverhalt stSrte die Intention des auf h6herer Beaehtungsstufe stehenden Saehverhalts. Dieser Saehverhalt sollte kein intentionaler Gegenstand sein, solange der Professor als Redner auf dem Pult stand. Die Effiillung dieses Wunsehes gelang ibm jedoch nieht vollst~ndig.
Ein 2. Beispiel: Ein junger Mann trifft seine zukiinftige Braut zu- fi~llig in einem Eisenbahnabteil. Sie erz~hlt ihm, dab sie wegen ge- sch~ftlicher Angelegenheiten an einen anderen Ort fahren miisse; er selbst muB den Zug an einer friiheren Station verlassen. Spiiter stellte sich heraus, dab das M~dchen noch einmal mit ihrem frfiheren Lieb- haber zusammengekommen ist. Sparer, naehdem sie einander geheiratet hatten, weiB die junge Frau niehts mehr yon ihrer Reise; sie weiB nicht, dab sie ihren jetzigen Mann in der Eisenbahn getroffen hat, die Erinne- rung an die Reise ist v611ig ausgel6seht.
In diesem Falle liegt der psyehologische Tatbest~nd s wie im vorigen. Die junge Frau will von diesem Ereignis nichts mehr wissen, da sie ihren Ehemann liebt und das. Zusammentreffen mit dem ersten Geliebten ftir sie nicht vereinbar ist mit ihrer Liebe zu ihrem Mann, weft die Erinnerung daran fiir sie jetzt nicht ertr~glieh ist. Die Psycho- analyse sagt nun, diese Gedanken werden oder sind verdrs Dem ist aber nicht so; sondern die Intention auf diesen Gegenstand oder Saehverhalt ist nieht (oder wenigstens nur unter besonderen Umst~nden) mSglieh. Dieser Gegenstand oder dieses Ereignis kann nicht intentionaler Gegenstand oder Gegenstand der Auffassung oder des Gegenstands- bewuBtseins werden. Das Ereignis und nur dieses oder der Gegenstand
786 Siegfried Fischer:
ist deshalb gegenstandsunbewui3t. Es werden also keine Vorstellungen oder Wissenskomplexe verdr/ingt, sondern nur die den Gegenstand oder den Saehverhalt konstituierenden Akte. Nieht das Denken dieser Gedanken oder die Vorstellungsinhalte werden verdr/ingt. Von diesen weifl ieh ja aueh gar niehts, sondern die Intention dieses Ereignisses, das Dieses-Ereignis-Meinen. Diese intentionalen Akr sind im weitesten deskriptiven Sinne yon Erlebnissen auch BewuBtseinsinhalte oder Erlebnisse. Aber innerhalb des Erlebbaren iiberhaupt besteht ein evidenter Unterschied zwischen intentiona]en Erelebnissen, in weleIaen sich gegen~t~nd/iche Intentionen und zwar dutch immanen~ Charalctere des jeweiligen Erlebnisses konstituieren und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist, also Inha]ten, die nieht selbst Akte sind (Husserl, S. 383).
Der Vorgang der Verdr~ingung besteht also darin, daft - - aus zun~chst hier nicht zu er6rternden Ursaehen - - die Intention auf einen Gegenstand oder Sachverhalt nicht m6glich ist.
Vergleiehbar ist dieser Vorgang mit der Unm6gliehkeit eines hyste- rischen Blinden, etwas zu sehen oder den negativen Halluzinationen eines ttypnotisierten. Der Gegenstand kann hier nieh$ wahrgenommen werden, weil die Intention, d.h. die Auffassungsakte, nieht auf den Gegenstand geriehtet werden k6nnen, und damit ist aueh keine Wahr- nehmung vorhanden. Dutch das Fehlen des intentionalen Erlebnisses wird der Gegenstand nieht aufgefa6t, nieht bemerkt; er wird nieht Gegenstand des GegenstandsbewuDtseins. Die anschauliehen Emp- findtmgsinhalte kSnnen niemals a]lein einen Gegenstand fiir uns auf- bauen, solange nieht die Intention hinzukommt, die die Empfindungs- inhalte erst gewisserma0en beseeR, durch die fiir uns ein Gegenstand iiberhaupt erst zum Gegenstand wird. Es ist also durchaus m6glich - - und es sprieht, soviel ich sehe, weder etwas daftir noeh dagegen - dal~ Empfindungsinhalte, in unserem Falle also optischer Art, vorhanden sind oder erlebt werden - - das Sinnesorgan ist ja intakt -- , dab aber infolge der fehlenden intentionalen Akte ein Wissen yon dem Gegenstand oder eine Wahrnehmung des Gegenstandes nicht eintritt. Die Frage naeh dem Vorhandensein yon Empfindungsinhalten in diesen F/~llen wird nieht leioht zu entseheiden sein. Sind sie vorhanden, so wiirde dies unseren Beweis fiir das Fehlen intentionaler Akte als Ursache der ,,Seh"stSrung unterstiitzen.
Genau so liegt der psyehologisehe Tatbestand bei der Verdri~ngung der intentionalen Akte, die sieh auf ein Ereignis riehten. Aueh bier ist das Meinen, die Riehtung, die Intention auf das Ereignis nieht m6glioh. Die intentionalen Akte werden nieht erlebt. Die En~cheidung ob Vorstellungen, d. h. Reproduktionen von Empfindungen, erlebt werden, ist wie in dem ersten Beispiel nicht ohne weiteres zu entseheiden. Die M6gliehkeit, diese Frage mit Hilfe der Selbstbeobachtung zu beant-
Kritische Bemerkungen zum Unbewullten Freuds. 787
worten, dtirfte auf Schwierigkeit~n stol~en, da PersSnliehkeiten mit soleher Verdr~ngungsenergie ihrer Natur nach fiir derartige Versuehe wenig geeignet sein dtirften; auBerdem diirften die zu beobaehtenden BewuBtseinsinhalte der Selbstbeobachtung nut sehwer zug/~nglich sein Wie dem abet aueh sei, wit sehen, dab die Verdr/tngung nieht die Vorstellungs-oder Wissenskomplexe, also die Reproduktionsgrundlagen friiherer Wahrnehmungen oder Gedanken betrifft, sondern die inten- tionalen Akte, die Auffassungsvorgi~nge, das Aehten auf oder die Riehtung auf das Ereignis oder den Gegenstand oder das Dieses-Ereignis-l~Ieinen.
Psychologisch vSUig an@re VerhMSnisse liegen bei dem gew6hnhchen Vergessen vor, obwohl bei oberfl/~chlieher Beaehtung verdri~ngen und vergessen, in ihrem Effekt, dem Siehniehtent~innen, dem Siehnicht- erimmrnkSnnen, eine groBe Xhnlichkeit zeigen. Zur Darstellung des Vorganges des Vergessens wi~hlen wit folgendes Beispiel: Ieh babe an einem Tage eine 12 silbige sinnlose Silbenreihe naeh 20 I~sungen fehlerfrei hersagen kSnnen. Beim Versuch am n/tehsten Tage die Reihe zu wiederholen, gelingt es mir nicht, etwa die 3. Silbe zu finden. Nun ist bei dem Versuch die Reihe aufzusagen, fraglos die Intention auf eben diese Silbenreihe gerichtet. Beim Aufsagen treten die Vorstellungen der ersten beiden Silben in mein Bewu6tsein. Diese Vorstellungen werden also yon mir erlebt und sind bewu6t. Ebenso sind die Silben gegenstands- bewuSt. Ich riehte nun meine Intention auf die 3. Silbe ; dies ist durehaus m6glieh, obwohl diese 3. Silbe noch nieht als diese so bestimmt~, als dieses bestimmte Lautbild, intentionaler Gegenstand ist, sondern nut etwa als 3. Silbe in der Reihe, die an dieser bestimmten SteUe steht, die sich aus zwei Konsonanten und einem Vokal zusammensetzt usw. Die Intention auf diese 3. Silbe ist also vorhanden; die Silbe ist mir zwar nieht als so und so bestimmter Gegenstand gegenstandsbewu6t, aber trotzdem intentionaler Gegenstand. Die Vorstellung der 3. Silbe erlebe ieh abet nicht in dem Erlebnisstrom meines Bewul~tseins und zwar deswegen, well etwa die Reproduktionsgrundlagen verblaSt sind, infolge zu geringer Einpri~gung, oder well eine zu lange Zeit seit der Einpr/~gung verstrichen ist, oder infolge irgendwelcher anderer Ursaehen, die die experimentelle Psyehologie des Ged/~ehtnisses in groller Anzahl auf- gezeigt hat. Das intentionale Erlebnis dagegen ist vorhanden, nut der ansehauliehe Inhalt, der als Baustein des Akt, es furtgiert, aber nieht selbst Akt ist, kann nieht aktualisiert werden.
Demnaeh: kann etwas nicht erinnert werden, well es verdr~ingt worden is~, so beruh~ dies darauf, da6 die Intention auf diesen Gegenstand verdrfi, ng~ worden ist. Liegt ein gewShnliches Vergessen vor, so ist die Intention auf den Gegenstand vorhanden, abet die Reproduktions- grundlagen, Vorstellungen und Wissenskomplexe kSnnen nicht aktuali- siert werden.
788 Siegfried Fischer:
rio
Als Ursaehe fiir die Verdr/~ngung haben wir oben den Umstand in Ansprueh genommen, dab ein Saehverhal~ fiir mich nicht ertragbar er- .scheint, und dab datum das Ieh yon diesem Saehverhalt nichts wissen will. Es ist dabei, wie in den oben angefiibrten Beispielen, nicht immer erforderlieh, dab diese Wissenskomplexe expliziert gedacht werden, es geniigt vielmehr das flfichtige Auftreten eines Gedankens an etwas oder ein fliichtiges Begehren yon etwas. Die Ursaehe fiir das Verdr~ngen der Intention liegt darin, daft der Saehverhalt oder der Gegenstand oder besser die Intention auf diese unlustbetont is~, oder abet, dab sie im Zusammenhang mit den Ansehauungen dieses Mensehen eine Unlust- betonung erhi~lt, w/~hrend sie allein lustbetont sein kann. Die Un- ertragliehkeit oder das Niehtwissenwollen oder AbgestoBensein resultiert also aus der Unlustbetonung. Wird die Intention auf einen Gegenstand verdr/~ngt, so schwinde$ notwendig das intentionale GefiiJal, die Lust oder Unlust an dem Gegenstand oder Saehverhalt. (Aueh die Gefiihle sind, zumindest solange sie gegenstandsbezogen sind, aueh intentionale Erlebnisse.)
Jeder Wunsch und jedes Begehren ist, wie leicht zu ersehen, ebenfalls ein intentionales Erlebnis und zwar auch dann, wenn dieses Begehren sieh nur als dunkles ])r/~ngen auf ein unbestimmtes Endziel bezieht. Der Wunseh, das Begehren sind selbstverst/~ndlieh erlebte Bewul3tseins- inhalte, der Gegens~and des Begehrens dagegen nieht. Auch diese Ak~ kSnnen verdr/~ngt werden, und damit sehwindet der intentionale Gegen- stand aus dem Gegenstandsbewul3tsein. Hiermi~ sehwindet selbst- versti~ndlich auch das intentionale Gefiihl. Der Gegenstand wird dann weder begehrt, noeh ist er Gegenstand der Wahrnehmung oder Auf- fassung.
In gleieher Weise verhs es sich mi~ den Begehrungen, die dutch einen Trieb verursacht werden. Es ist fiir unsere Betraehtung nieht notwendig, das Wesen des Triebes hier n/~her zu besehreiben. Ohne uns zu den versehiedenen Auffassungen iiber das Wesen des Triebes in Gegensatz zu stellen, werden wit aagen kSnnen, dab der Trieb vergleichbar ist mit einer mehr oder weniger konstanten Kraft, die auf ein bestimmtes Endziel hindr/~ngt. Mi~ dem Erleben der Triebregung ist also ein Be- gehren eines bestimmten Zieles notwendig verbunden. Aueh solche Begehrungen k6nnen in derselben Weise wie die intentionalen Akte, die friiher besproehen wurden, verdr/~ngt werden, etwa deswegen, weil die Befriedigung des Triebbegehrens im Widerspruch steht zu den Ansehauungen der Pers6nliehkeit. Es wird also die Triebrich~ung yon ihrem Ziele abgedr~ngt. Damit kann aber nur selten die Kraft des Triebes gehemmt oder vSllig beseitigt werden. Diese kann sieh vielmehr an einem anderen Gegenstand auswirken. So kann die Kraft des
Kritisehe Bemerkungen zum Unbewuflten Freuds. 789
Sexualtriebes, auf dessen Erfiillung verziehtet wird oder verziehtet werden mu[3, umgewandelt werden, und Gegenstand des intentionalen Erlebnisses ist nieht mehr die ad/~quate Triebbefriedigung durch den Sexualakt sondern z. B. die intensive Arbeit. In diesem Falle sprieht die Psyehoanalyse von Sublimierung. Diese Verzichtf~higkeit ist jedoeh weehselnd und vor allem nieht unbegrenzt. Immer wieder wird die Intention auf den ad/iquaten Gegenstand des Triebbegehrens versuehen sieh durchzusetzen und besonders dann, wenn die Verdr/~ngungskraft nieht geniigend stark ist, so z. B. im Traum, wo ein Abws naeh den Lebensansehauungen der Pers6nliehkeit und ein Verdrs nicht in dem Mal3e m6glich ist, wie im wachen Zustand 1. Das Verdr/~ngen der Intentionen auf den nicht der Trieberfiillung ad/tquaten Gegenstand kann seelische StSrungen hervorrufen, die zu dem klinisehen Bilde der Neurose gerechnet werden.
Wahrscheinlich kann auch durch Verdr/mgung yon Wiinschen, die nieht triebbedingt sind, eine neurotische StSrung verursacht werden. In diesem Falle wird das intentionale Erlebnis verdr~ngt, und die dem Begehren innewohnende Kraf t kann auf einen anderen Gegenstand als gegenstandsbewutten geriehtet werden. Wie dies geschieht, darfiber kann aus der psychoanalytischen Lehre vielerlei entnomm~n werden; dab aber hierin eine besonders komplizierte Leistung zu finden ist, dies ist eine dureh nichts bewiesene Hypothese, die auch wenig Wahrschein- liehkeit hat. Von gro~er Bedeutung bleibt aber auf jeden Fall der Nachweis, da$ die verdri~ngten Wfinsche sich in ganz anderen intentio- nalen Erlebnissen /~ul3ern k6nnen, und dal3 damit ein vSllig anderer Gegenstand oder Sachverhalt Gegenstand des Gegenstandsbewul3tseins wird.
VII .
Freud behauptet, dab das Unbewul3te ein System sei, und dab die Vorg/~nge dieses Systems Eigenschaften aufweisen, die sich im Bewul3tsein nieht zeigen. Zu einer solchen Behauptung und zu einer derartigen Vorstellung vom Unbewul3ten konnte Freud nur dadurch kommen,
1 Es ist nach dem Gesagten eine verkohrte Ausdrucksweise, worm ich etwa sage, sin Lusttrieb wird in das UnbewuBte verdrangt. Eine solche Ausdrucksweise gibt auBerdem ein falsches Bild yon don tatsachlichen seehschen Vorg~ngen und bietet Vorschub fiir die Aufstellung nicht haltbaror psychologischer Theorien. Ein Trieb kann selbst dann, wenn wir ihn als psyd~ischen Reprase~tante~, der aus dem K6rper stammenden, in die Seele gelangenden Reize auffassen, also als seelisches Erlebnis, gar nicht verdr~ngt werden. Verdrangt wird das intentionale Erlebnis, auf alas das Dr~ngen des Triebes sich richtet, oder der Drang des Triebos. Der Trieb selbst, diese dem Menschen innewotmende Kraft, kann h6chstens geschwiLcht werdon. Das aber, was die Psychoanalyse unter Triebverdrangung versteht, ist ein Ablenken des durch den Trieb verursachten Begehrens yon dem Gegenstand, der zur Befrie- digung des Triebes dient, und damit auch haufig ein Verdrimgen dsr intontionalen Auffassungsakte des Gogonstandes.
790 Siegfried Fischer: Kritische Bemerkungen zum UnbewuBten Freuds.
da]~ er keine reinliche Scheidung zwischen den verschiedenen Bedeuttmgen des Ausdrueks BewuBtsein und dami~ des Ausdrucks Unbewui]tsein vornahm. Naeh den vorausgegangenen Ausfiihrungen liegt keinerlei Veranlassung vor, ein UnbewuBtes anzunehmen, das selbs~s seelische Leistungen vollbringt (der Ausdruck UnbewuBt wird bier in der 3. Bedeutung gebraucht gleich nicht erlebt oder nich$ zugehSrig zu dem gesamten rellen ph~nomenologischen Bestand des empirischen Ich). Es liegt aber auch keinerlei Veranlassung vor, ein selbst~ndig arbeitendes GegenstandsunbewuBtsein anzunehmen. Das ,,UnbewuI~te" Freuds deekt sieh im wesentlichen mit dem, was wir Gegens~andsunbewuBtsein nennen. Was Freud mit der Psychoanalyse aufzudeeken versueht, das sind die verdr~ngten intentionalen Er]ebnisse, das verdr~ngte Gegenstands- bewu6te, (das allerdings einen Teil des UnbewuBten bildet).
Die Lehre der Psyehoanalyse hat gezeigt, da~ es den Wiinsehen zugrunde liegende und durch die Triebe verursachte intentionale Akte gibt, die verdrs werden kSnnen. Diese maehen sieh im normalen Seelenleben in den Fehlleistungen oder in den Tr~umen bemerkbar, oder sie ffihren zu krankhaften StSrungen, die als Neurose bezeichnet werden, l~ber die Fehlleistungen wurde bereits oben gesproehen. Was den Traum betrifft, so sind wir mit Fr6bes der Ansicht, dab Freud in der Tat durch seine Lehre den Weg zum Verst~ndnis des Traumes erSffnet hat. Aber es geht zu weir aus dem Traumganzen eine iiberw~ltigend geistreiche Leistung zu maehen. Wir sind ebenso der Ansicht, "dal3 Freud den Weg zum Verst~ndnis der Neurose erSffnet hat. Die Thezrie des UnbewuBten aber, wie sic in den theoretischen Schriften Freuds zum Ausdruck kommt, kann nach unseren Ausffihrungen nicht aufreeht erhalten werden; deswegen nicht, weil sich darin logische Fehler finden, und weil sic sieh, zum Tell auf Grund dieser Fehler, auf eine meeha- nisehe Ansehauung stiitzt. Diese Kritik trifft nicht den Kern der psycho- analytisehen Lehre. Soweit diese Lehre sich nieht auf die Theorie des UnbewuBten stiitzt, wird sie hiervon nicht bertihrt; sie ist - - mit dieser Einschr~nkung - - mit der Kritik, die hier vertreten worden ist, vereinbar.