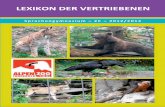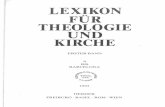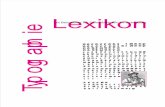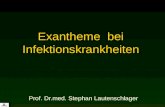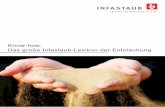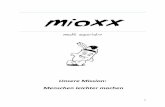Lexikon der Infektionskrankheiten des Menschen || Bartonella
Transcript of Lexikon der Infektionskrankheiten des Menschen || Bartonella

66 Balkan-Grippe
Balkan-Grippe
Coxiellen
Bancroft-Filarie
Wuchereria
Bang’sche Krankheit
Brucella
Bangui-Virus
Bunyaviren
Barmah-Forest-Infektion
Alphaviren
Bartholinischer Abszess
EubakterienNeisseria gonorrhoeae
Bartholinitis
BilophilaMycoplasma hominis
Bartonella
Mardjan ArvandErreger
Synonym(e)
B. henselae und B. quintana wurden früher als Rocha-limaea henselae und Rochlimaea bzw. Rickettsia quin-tana bezeichnet; einige Bartonella-Spezies als Graha-mella-Spezies.
Erregerspezies
B. bacilliformis, B. henselae, B. quintana, B. eliza-bethae, B. vinsonii, B. clarridgeiae etc.
Taxonomie
Familie: Bartonellaceae; einziger Genus Bartonella; zurzeit 19 Spezies.
Historie
Bartonella bacilliformis und B. quintana wurden erst-
malig in 1909 bzw.1917 entdeckt bzw. beschrieben. Die meisten anderen Bartonella-Spezies wurden je-doch nach 1990 durch Einsatz molekularbiologischer Methoden entdeckt. B. henselae ist das erste Bakteri-um, das durch Einsatz von Nukleinsäureamplifikation isoliert wurde.
MorphologieKleine und schlanke gramnegative Stäbchen, teilwei-se leicht gebogen. B. bacilliformis und B. clarridgeiae besitzen Flagellen und sind beweglich, B. henselae und B. quintana besitzen Pili und zeigen gleitende (taumelnde) Beweglichkeit.
GenomDie kompletten Genomsequenzen von B. henselae und B. quintana stehen in GenBank unter Acces sion-Nr. NC_005956 und NC_005955 zur Verfügung. Die 16S rRNA-Gensequenz von anderen Bartonella-Spe-zies ist in GenBank hinterlegt.
VermehrungBartonellen sind besonders anspruchsvolle Erreger. Sie wachsen sehr langsam auf Blut- oder Kochblutag-ar unter mikroaerophilen (5–10 % CO2) Bedingun-gen. Bei der Primärisolierung werden Kolonien von B. henselae oder B. quintana i. d. R. erst nach 10–14 Tagen sichtbar. Die Kolonien sind klein, ohne Hämo-lyse und graben sich teilweise in den Agar ein.
Pathogenität / Virulenz / AntigenvariabilitätDie wichtigsten human-pathogenen Erreger aus der Gattung Bartonella sind B. henselae, B. quintana und B. bacilliformis. B. elizabethae, B. vinsonii, B. grahamii sind vereinzelt als Erreger von Endokarditis bzw. Neuroretinitis beim Menschen isoliert worden. B. vin-sonii ist ein Erreger der Endokarditis beim Hund. Zu den Virulenzfaktoren von B. henselae und B. quintana zählt der TypIV-Sekretionssystem. Bei B. henselae ist das Adhäsin BadA ein potenzieller Virulenzfaktor.
Erkrankungen
1. Katzenkratzkrankheit
InkubationszeitIn der Regel 1–3 Wochen.
LeitsymptomeChronische, regionale Lymphadenitis.
SymptomeLymphknotenschwellung, Fieber, Abgeschlagenheit, Exanthem. In einigen Fällen treten Komplikationen wie Neuroretinitis, Meningitis, Osteomyelitis, chroni-sches Fieber, Mikroabszesse in Leber und Milz etc. auf.
PathophysiologieB. henselae ist der Erreger der Katzenkratzkrankheit, die überwiegend bei immuninkompetenten Individu-

67Bartonella
B
en auftritt. Der Erreger gelangt durch eine Katzen-kratz- oder Bissverletzung in die Haut. Es entsteht eine Primärläsion an der Eintrittspforte. In der Folge entwickelt sich eine abszedierende oder granulomatö-se Entzündung der drainierenden Lymphknoten.
ImmunantwortHumoral und T Zell vermittelt.
DifferenzialdiagnoseAndere infektiöse und nicht infektiöse Ursachen der Lymphadenitis.
2. Bazilläre Angiomatose, bazilläre Peliosis
hepatis, rezidivierende Bakteriämie
InkubationszeitUnbekannt.
LeitsymptomeBazilläre Angiomatose ist charakterisiert durch hä-mangiomartige Tumore in der Haut, in Subkutis bzw. inneren Organen. Leitsymptom der Peliosis hepatis sind blutgefüllte Hohlräume (Zysten) in der Leber.
SymptomeHautläsionen, Fieber, Abgeschlagenheit, Gewichtsab-nahme.
PathophysiologieBazilläre Angiomatose und Peliosis hepatis sind die Manifestation der Infektion von immunsupprimier-ten Personen mit B. henselae oder B. quintana. Die Erreger infizieren Endothelzellen, die in der Folge proliferieren und zur unkontrollierten Gefäßneubil-dung in der Haut und anderen Organen führen. Rezi-divierende Bakteriämien und Fieber treten häufig im Verlauf auf.
ImmunantwortBazilläre Angiomatose und Peliose sind opportunisti-sche Infektionen bei Patienten mit stark geschwächter zellulärer Immunabwehr, z. B. HIV-Infizierte im AIDS-Stadium. Bei diesen Personen ist das Immun-system i.d.R. nicht in der Lage, die Infektion zu kont-rollieren.
DifferenzialdiagnoseKaposi-Sarkom, Infektionen mit atypischen Myko-bakterien, CMV und andere Erreger.
3. Endokarditis
Synonym(e)Sogenannte kulturnegative Endokarditis, da routine-mäßig durchgeführte Kulturen i.d.R. keinen Erreger-nachweis erbringen.
InkubationszeitUnbekannt.
Leitsymptome
Fieber und neu aufgetretenes Herzgeräusch.
Symptome
Splenomegalie, Petechien, Hämaturie und andere Zeichen der Embolisation, Anämie.
Pathophysiologie
Endokarditis.
Immunantwort
Endokarditis.
Differenzialdiagnose
Andere Erreger der kulturnegativen Endokarditis.
4. Schützengrabenfieber
Synonym(e)
Fünftagefieber, Wolhynisches Fieber.
Inkubationszeit
3–38 Tage.
Leitsymptome
Rezidivierende Fieberschübe von ca. 5 Tage Dauer.
Symptome
Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, Abge-schlagenheit, Exanthem.
Pathophysiologie
Der Erreger ist B. quintana und wird über Insekten-stich (Kleiderlaus) übertragen. Nach der initialen Vermehrung kommt es zu rezidivierenden bakteriä-mischen Phasen, die ca. 5 Tage andauern und mit Fie-ber einhergehen.
Immunantwort
Keine Daten verfügbar.
Differenzialdiagnose
Rickettsiosen, Malaria, Dengue-Fieber, Grippe, Rück-fallfieber, Typhus etc.
5. Oroya Fieber und Verruga peruana
Synonym(e)
Bartonellose, Morbus Carrión.
Inkubationszeit
Circa 3–12 Wochen.
Leitsymptome
Fieber, Anämie, Hautläsionen.
Symptome
Oroya Fieber ist das akute Stadium der Infektion, das mit hohem Fieber und hämolytischer Anämie einher-geht. Nach einer Latenzzeit von einigen Wochen bis

68 Bartonella
Monaten kann sich das chronische Stadium, Verruga peruana, entwickeln, das durch pleomorphe Hautläsi-onen (Papel, Eruptionen, hämangiomartige Tumore) charakterisiert wird.
Pathophysiologie
Der Erreger der Bartonellose ist B. bacilliformis. Er gelangt durch einen Insektenstich in die Haut. Nach lokaler Vermehrung kommt es zur hämatogenen Aus-saat mit Befall der Erythrozyten. Es entsteht eine aku-te, z. T. schwere hämolytische Anämie. Nach einer Latenzzeit von einigen Wochen bis Monaten kommt es zur Ausbildung von tumorartigen Gefäßneubil-dungen in der Haut bzw. in Subkutis durch Endothel-zellproliferation.
Immunantwort
Humoral und möglicherweise T Zell vermittelt.
Differenzialdiagnose
Andere Ursachen einer hämolytischen Anämie, Hä-mangiom, Kaposi-Sarkom etc.
Diagnostik
Untersuchungsmaterial
Bei Katzenkratzkrankheit Lymphknotenpunktat bzw. -bioptat und Serum. Bei bazillärer Angiomatose Blut-kultur und Gewebeprobe von Haut, Leber, Milz etc. Bei chronischem und rezidivierendem Fieber und Endokarditis Blutkulturen und Serum. Bei Oroya Fie-ber Blutausstrich und -kultur.
Diagnostische Verfahren
Der direkte Erregernachweis im Blutausstrich ist ein Routineverfahren zur Diagnostik von Oroya Fieber. Mikroskopischer Nachweis von anderen Bartonella-Spezies in Gewebeproben ist nach einer Versilbe-rungsfärbung möglich, die Sensitivität ist jedoch ge-ring. Der kulturelle Nachweis von Bartonellen ist zeit-aufwändig und z. T. wenig sensitiv. Der Nachweis von Bartonella-DNA mittels Nukleinsäureamplifikation aus Gewebeproben (Lymphknoten, Haut, Herzklap-pengewebe etc.) ist i. d. R. sensitiver und wird bevor-zugt in der Diagnostik eingesetzt. Für die serologische Untersuchung steht ein Immunfluoreszenztest zum Nachweis von Antikörper gegen Bartonella-Spezies zur Verfügung.
Befund / Interpretation
Der kulturelle oder molekularbiologische Nachweis von Bartonella-Spezies in einer Patientenprobe spricht i. d .R. für die kausale Rolle des Erregers, da Bartonel-len nicht zur Standortflora des Menschen gehören.
Therapie
Therapeutische Maßnahmen
Bartonellen sind in vitro empfindlich gegen viele An-
tibiotika-Klassen. Für die Behandlung von Infektio-nen mit B. henselae oder B. quintana bei HIV-infizier-ten Patienten werden in erster Linie Makrolide (Ery-thromycin) oder Tetrazykline empfohlen. Die un-komplizierte Katzenkratzkrankheit gilt als nicht the-rapiebedürftig. Bei Komplikationen können Makroli-de, Tetrazykline, Rifampicin, Cotrimoxazol, Amino-glykoside oder Fluorochinolone eingesetzt werden. Das Oroya Fieber wurde in Vergangenheit mit Chlo-ramphenicol behandelt. Heute wird es i. d .R. mit Te-trazyklinen, Fluorochinolon, Cotrimoxazol oder Ri-fampicin behandelt.
ResistenzTrotz der guten in-vitro-Empfindlichkeit von Barto-nella-Spezies ist anzunehmen, dass einige Antibioti-ka-Klassen, z. B. Penicilline, in vivo nicht wirk sam sind.
Epidemiologie
VerbreitungBartonella bacilliformis kommt in den Andenregio-nen von Peru, Ecuador und Kolumbien vor. Das Ver-breitungsgebiet entspricht dem des Vektors. B. henselae und B. quintana kommen vermutlich weltweit vor.
Wirtsbereich / ReservoirDer Mensch ist der einzige Wirt für B. bacilliformis und B. quintana. Die Hauskatze ist der natürliche Wirt für B. henselae. Andere Bartonella-Spezies sind im Tierreich verbreitet und haben unterschiedliche Reservoire, z. B. Nagetiere, Vögel, Damm wild, Hunde etc.
RisikogruppenPersonen mit intensivem Kontakt zu Katzen haben ein erhöhtes Risiko für Infektionen durch B. henselae. Immunsupprimierte Personen (HIV-Infizierte, Trans-plantierte, Malignompatienten) sind prädestiniert für bazilläre Angiomatose, Perlisois hepatis und Mikro-abszessbildung in Leber oder Milz. Bewohner be-stimmter Andenregionen haben ein erhöhtes Risiko für eine Infektion durch B. bacilliformis.
Transmission / VektorenB. henselae wird durch Katzenkratz- oder Bissverlet-zungen auf Menschen übertragen. Die Übertragung zwischen Katzen erfolgt über den Katzenfloh. B. ba-cilliformis wird durch Stechmücken der Gattung Lutzomyia und B. quintana durch die Kleiderlaus übertragen. Andere Bartonella-Spezies können auch durch Zecken übertragen werden.
Prävention / ImpfstoffeKein Umgang mit infizierten bzw. potenziell infizier-ten Tieren (Katzen) bei abwehrgeschwächten Patien-ten. Bekämpfung des Flohbefalls bei Katzen

69Basidiobolus ranarum
B
(B. henselae). Verbesserung der hygienischen und so-zialen Bedingungen zur Bekämpfung des Lausbefalls (B. quintana). Expositionsprophylaxe für Mückensti-che in Ländern, in denen B. bacilliformis endemisch ist.
Ausbruchsmanagement
Keine Daten verfügbar.
Meldepflicht
Keine.
Weiterführende Informationen
Referenzzentren / Expertenlaboratorien Konsiliarlabor für Bartonellen: Institut für Medi zinische
Mikrobiologie und Hygiene, Universität Tübingen, Elfriede-Aulhorn-Str. 6, 72076 Tübingen
Web-Adressen http://www.cdc.gov/healthypets/diseases/catscratch.htm http://www.uni-duesseldorf.de/awmf/ll/023-024.htm
Schlüsselliteratur1. Arvand M (2005) Bartonella. In: Hahn H, Falke D, Kauf-
mann SHE, Ullmann U (Hrsg), Medizinische Mikrobio-logie und Infektiologie, 5. Aufl. Springer-Verlag, Heidel-berg
2. Welch DF, Slater LN (2003) Bartonella and Afipia. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken HY (eds), Manual of Clinical Microbiology, 8th edn. ASM Press, Washington DC
3. Welch DF, Slater LN (2005) Bartonella, including cat scratch disease. In: Mandell, Douglas and Bennett’s (eds) Principles and Practice of Infectious Diseases, 6th edn. Churchill Livingstone, New York
Basidiobolomykose
Basidiobolus ranarum
Basidiobolus ranarum
Reinhard Kappe, Dagmar RimekErreger
Erregerspezies
Basidiobolus ranarum
Taxonomie
Abteilung: Zygomycota; Klasse: Zygomycetes; Ord-nung: Entomophthorales; Familie: Basidiobolaceae; Gattung: Basidiobolus
Historie
Die Basidiobolomykose wurde erstmals 1956 von Lie-Kian-Joe bei drei indonesischen Kindern beschrie-ben. Die Kinder hatten flache, nicht verschiebliche, subkutane Granulome im Gesäßbereich.
MorphologieWirtsgewebe: Unseptiertes oder sehr selten septiertes Myzel, umgeben von eosinophilem hyalinem Materi-al innerhalb subkutaner Granulome (wie Conidiobo-lomykose). Die Hyphen sind im Allgemeinen kurz und haben einen Durchmesser von 3,5–10 μm. Ver-zweigungen kommen selten vor und sind rechtwink-lig. Im Gegensatz zu den Mucorales hat Basidiobolus keine Affinität zu Gefäßwänden; Infarzierungen und Nekrosen treten daher nicht auf.Kultur: Gutes Wachstum bei 25–30 °C, schwächeres bei 37 °C. Nach 2–5 Tagen Ausbildung gelblicher bis grauer, dünner, flacher, glabröser und wachsartiger Kolonien mit zahlreichen radiären Furchen.Mikroskopisch: Die Hyphen sind großkalibrig, 8–20 μm, mit gelegentlichen Septen in jungen Kultu-ren und häufiger werdender Septierung bei fortschrei-tender Sporulation. Nach 10 Tagen Ausbildung von kugeligen Zygosporen, 20–50 μm, mit glatten, leicht wellenförmigen Zellwänden. Die konidiogenen Zel-len unterscheiden sich nicht von den vegetativen Hy-phen. Sie haben ein basales Septum und produzieren apikal Konidien. Die Konidien sind sphärisch bis bir-nenförmig und werden aktiv in Richtung von Licht-quellen abgestoßen.
GenomB. ranarum ist ein eukaryonter Organismus, über dessen Genomgröße und Chromosomenzahl noch keine Daten vorliegen. Es sind bisher nur Teile des Genoms sequenziert. Für die taxonomische Einord-nung wichtige Sequenzen sind die des 18S ribosoma-len RNA-Gens und des 28S rRNA-Gens.
VermehrungB. ranarum ist homothallisch.
Pathogenität / Virulenz / AntigenvariabilitätEingeordnet in Risikogruppe 2. Aufgrund der gerin-gen Fallzahl an Erkrankungen weltweit wird eine niedrige Virulenz des Erregers angenommen. Die Thermotoleranz mit Wachstum bei 37 °C könnte ei-nen Virulenzfaktor darstellen. Es besteht eine Anti-gengemeinschaft mit Conidiobolus spp.
Erkrankung
Basidiobolomykose
InkubationszeitDie Inkubationszeit der humanen Basidiobolomyko-se ist unbekannt.
LeitsymptomeHarter subkutaner Knoten am Oberschenkel oder Gesäß.
SymptomeBeginn der Erkrankung zumeist mit einem singulä-ren, scharf umschriebenen, schmerzlosen, indurier-