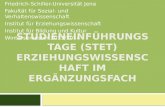Luhmann - Das Erziehungssystem der Gesellschaft (Auszug) - Zeitschrift für Erziehungswissenschaft -...
-
Upload
victorfarrago -
Category
Documents
-
view
15 -
download
7
Transcript of Luhmann - Das Erziehungssystem der Gesellschaft (Auszug) - Zeitschrift für Erziehungswissenschaft -...

Allgemeiner Teil
Niklas Luhmann
Das Erziehungssystemder Gesellschaft (Auszug)Kapitel 7: „Selbstbeschreibungen“1
Manche Pädagogen haben sich durch das Auftreten systemtheoretischer Analysen des Er-ziehungssystems und seiner Reflexionstheorien, eben der Pädagogik, bedroht gefühlt undsich zu defensiven Reaktionen motiviert gesehen.2 Die Diskussion ist unergiebig geblie-ben, weil unklar geblieben ist, worüber der Streit geht und ob er sich lohnt, oder ob essich einfach um verschiedene Beschreibungen desselben Gegenstandes handelt. Wir wol-len daher zum Abschluß einige Gesichtspunkte auseinanderziehen, um die Perspektiveeiner gesellschaftstheoretischen (und damit soziologischen) Behandlung des Erziehungs-systems und dessen Bemühungen um Reflexion des Sinns von Erziehung klarzustellen.
Es geht nicht, wie eine lange soziologische Obsession mit Gesellschaftskritik vermutenlassen könnte, um eine kritische Analyse. Es geht nicht darum, Voreingenommenheit derPädagogik zu entlarven und durch andere Vorurteile, etwa die der Systemtheorie, zu er-setzen. Aus der Sicht der Gesellschaftstheorie kann aber kein Zweifel daran bestehen, daßErziehung ein gesellschaftlicher Prozeß ist und damit in den Zuständigkeitsbereich derGesellschaftstheorie fällt. Eine Gesellschaftstheorie, die ihren Gegenstandsbereich voll-ständig erfassen will, kann Erziehung nicht einfach unbeachtet lassen mit der Begrün-dung, daß dafür eine andere akademische Disziplin zuständig sei. (Und dasselbe gilt fürWirtschaft, Recht, Kunst usw.) Gesellschaft ist zumindest eins: die Bedingung der Re-produktion des Glaubens an Erziehung und damit immer auch: des Glaubens an die Ver-besserungsfähigkeit der jeweils praktizierten Erziehung. Sie stellt damit die Möglichkeitbereit, Energien und Motive zu investieren. In dem Maße, als die Gesellschaftstheorietheoretische Ansprüche ambitioniert, und nicht einfach nur eine ideologische Position an-bietet, ergeben sich daraus gewisse Anforderungen an begriffliche Konsistenz, die nicht denMeinungen geopfert werden können, die in den einzelnen Gesellschaftsbereichen kursieren.Andererseits kann dies nicht heißen, daß die Gesellschaftstheorie diese Meinungen (etwader Gewerkschaften, der Theologen, die Entwicklungshelfer, der Pädagogen) entwertet undnur für sich selbst Wahrheit in Anspruch nimmt. Die vielleicht beste Darstellung dieseskomplexen Verhältnisses läßt sich mit dem Begriff des „redescription“ geben (vgl. HESSE
1966, S. 157ff.).3 Wir behalten das englische Wort bei, denn es bietet den Vorteil, daß mannicht zwischen Wiederbeschreibung und Neubeschreibung unterscheiden muß. Der Gewinndieses Begriffs liegt darin, daß er darauf aufmerksam macht, daß man es mit etwas schonBeschriebenem zu tun hat. Die Beschreibung des schon Beschriebenen muß also respektiert

602 N. Luhmann: Das Erziehungssystem der Gesellschaft (Auszug)
werden. Man muß nicht wiederholen, was ohnehin streng genommen unmöglich ist, dadie Wiederholung sich als Wiederholung zu erkennen gibt. Aber der Grad möglicher Va-riation in einer Neubeschreibung ist dadurch beschränkt, daß der Bezug auf das bereitsBeschriebene erkennbar bleiben muß.
In der traditionellen logisch-ontologischen Metaphysik ist dieser Begriff des rede-scription nicht unterzubringen. Unter der Annahme, es gebe nur ein Sein, nur eine Wahr-heit und nur eine sie kontrollierende Logik kann ein redescription nur als Korrekturver-such verstanden werden. Gibt man diese Prämisse auf oder behandelt man sie als eine Artvon Weltbeschreibung, neben der es andere geben kann, wird den redescriptions ihrescheinbare Aggressivität genommen. Jetzt sind sie einfach Angebote, deren sich dieAdressaten, hier die Pädagogen, bedienen können oder nicht. Freilich ist diese Entschei-dung nicht beliebig zu treffen und nicht ohne Folgen zu haben. Wir haben im ersten Ka-pitel dafür ein ausführlich behandeltes Beispiel gegeben.
Die Kontinuität in den Beschreibungen, die durch das redescription konstruiert wird,liegt in der Selbstreferenz, die dem Gegenstand der Erziehung unterstellt wird. Das unter-scheidet den direkten Weg von der Subjekttheorie zur Theorie selbstreferentieller Syste-me von den Umwegen, die man im 19. Jahrhundert bevorzugt hatte, nämlich von „philo-sophischen Anthropologien“ mehr oder weniger fragwürdiger Art. Gerade diese konzep-tuelle Schiene, die im Festhalten des Begriffs selbstreferentieller Individuen liegt, machtjedoch den Umfang der Änderungen und ihre Implikationen sichtbar, die mit dem vorge-schlagenen redescription verbunden sind.
Am deutlichsten erkennt man die Veränderung, wenn man sieht, daß der Begriff dertranszendental notwendigen, dem Bewußtsein als Tatsache zugänglichen Freiheit ersetztwird durch den Begriff der im System selbst erzeugten Unbestimmtheit, die als Unge-wißheit der Zukunft zur Erfahrung wird. Zugleich verändert sich die Behandlung vonKausalität. Es handelt sich nach wie vor um eine rein empirische Bedingung, aber dasProblem ist jetzt, daß nach dem Kenntnisstand der „system dynamics“ kausale Effektenicht prognostizierbar sind. Eine Auslösekausalität kann im System aufgenommen wer-den, dann aber ins Folgenlose versickern; oder sie kann über von Zufällen abhängigeAbweichungsverstärkungen Effekte erzeugen, die nicht sinnvoll auf die Ursache zuge-rechnet werden können (vor allem deshalb nicht, weil sie nicht wiederholt erzeugt werdenkönnen).
Mit einem solchen redescription konfrontiert, bevorzugt es die Pädagogik, beim neu-humanistischen Subjektbegriff zu bleiben – eventuell unter Weglassen der transzendenta-len Komponente. Aber man sieht, daß dies jetzt einer Entscheidung bedarf und nicht ein-fach durch die geisteswissenschaftliche Tradition gerechtfertigt werden kann.
Wir wollen hierfür den Begriff der Reflexionstheorie einsetzen. Wenn die Pädagogikals Reflexionstheorie des Erziehungssystems bezeichnet wird, so heißt das konkret, daßsie sich mit den Zielen und Institutionen des Erziehungssystems identifiziert und ihnennicht indifferent gegenübersteht. Das schließt eine kritische Einstellung zum Vorgefun-denen nicht aus. Im Gegenteil: in der Kritik zeigt sich gerade das Engagement. Aber einePädagogik könnte nicht zu arbeiten beginnen, wenn sie unterstellte, Erziehung sei sinn-und hoffnungslos oder sie sei kein Gegenstand lohnender wissenschaftlicher Beschäfti-gung. Und auch nicht, wenn sie Erziehung nur „erziehungswissenschaftlich“, nur als ei-nen der vielen, in der Gesellschaft vorkommenden Handlungsbereiche auffaßte, als Ge-genstandsfeld, in dem ein Wissenschaftler interessante Entdeckungen machen und ver-gleichende Analysen durchführen kann.

Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 4. Jahrg., Heft 4/2001, S. 601-604 603
Man kann den Begriff der Reflexionstheorie „wissenssoziologisch“ verstehen. Die So-ziologie stellt fest, daß sich solche Reflexionstheorien im Zuge des Übergangs zu einerfunktionalen Differenzierung des Gesellschaftssystems in allen wichtigen Funktionssy-stemen ausbilden. Das kann keine zufällige Koinzidenz sein. Es handelt sich offenbar umeine der vielen soziologisch bemerkenswerten Korrelationen von strukturellen und seman-tischen Veränderungen. Mit einer solchen Feststellung behauptet der, der sie trifft, hier alsoder Soziologe, keine eigene Überlegenheit, kein Besserwissen als neutraler externer Beob-achter. Vielmehr sieht er sich zu einem autologischen Schluß gezwungen. Der Begriff derReflexionstheorie, oder genauer: die Voraussetzung einer funktionssystemspezifischen Re-flexionstheorie gilt, wenn er Wissenschaft treibt, auch für ihn selber. Auch die Wissenschaftbildet eigene Reflexionstheorien aus. Sie wurden seit der Mitte des 19. Jahrhunderts unterakademischen Bezeichnungen wie „Erkenntnistheorie“ oder „Epistemologie“ diskutiert, wa-ren aber längst zuvor ausgearbeitet (vgl. LUHMANN 1990, passim, insbes. S. 469ff.). Auchdie Wissenschaft bejaht sich selbst und sucht dafür gute Gründe und akzeptable Formen derSelbstdarstellung (ohne dies notwendigerweise, wie es hier geschieht, mit Gesellschafts-theorie zu verbinden). Die Korrelation „funktionale Differenzierung“ (Struktur) und „Refle-xionstheorie“ (Semantik) gilt universell, das heißt: für alle Funktionssysteme. Sie löst älte-re Formen der Selbstbeschreibung, z.B. Adelstheorien vom „guten Leben“ ab.
Über diese wissenssoziologische Analyse führt ein systemtheoretisches Argument hin-aus. Man kann Reflexionstheorien als eine Komponente der Selbstorganisation des Erzie-hungssystems begreifen. Selbstorganisation setzt aber immer „Mikrodiversität“ voraus(vgl. NGO-MAI/RAYBAUT 1996, S. 223-239) – so die Reflexionstheorien des Wirtschafts-systems die wirtschaftlichen Transaktionen und die Reflexionstheorien des Rechtssy-stems die Vielzahl von Gerichtsprozessen. Im Erziehungssystem gründet sich die Refle-xion auf die Mikrodiversität der Unterrichtsinteraktionen. Das muß nicht heißen, daß dieReflexionstheorie den Unterricht praktisch hilfreich unterstützt. Typisch ist, im Gegen-teil, eine theoretisch begründete Distanz zu den spezifischen Notwendigkeiten der Praxis.Aber die Reflexionstheorie setzt den Unterricht als Realitätsausschnitt voraus, der zu-gleich einschränkt, was darüber zu sagen ist. Ob nun affirmativ oder kritisch – die Refle-xion baut immer auf der Mikrodiversität auf, zu der sie gehört. Sie erhält dadurch ihrThema, wenngleich ihr frei bleibt, die Form zu wählen, mit der sie ihr Thema behandelt.
Die geschilderte Distanz von Pädagogik und Gesellschaftstheorie und das Vorkommendes einen Fachs im anderen kann sich an die Disziplindifferenzierung des Wissenschafts-systems halten. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn man eine direkte kommunikativeBeziehung herstellt, wenn also die soziologische Gesellschaftstheorie kommunikativenKontakt mit den Pädagogen sucht, um sich ihnen vorzustellen (KRIPPENDORFF 1996, S.311-328). Dann kommt es zu der Frage, ob und wie die Partner einer solchen Beziehungeinander ernst nehmen und als jeweils Anderen anerkennen können. Das muß nicht alsAufdrängen der eigenen Meinung verstanden werden, wohl aber als Erwartung einerernsthaften Auseinandersetzung. Die Gesellschaftstheorie tritt dann in das ein, was siebeschreibt – in diesem Falle in die Selbstbeschreibung des Erziehungssystems. Dann fin-den Gesellschaftstheorie und Pädagogik einander im selben Kontext und daraus werdensich stärkere Einflußnahmen ergeben – sei es, daß die Gesellschaftstheorie ihr Verständ-nis der Pädagogik korrigieren oder anreichern muß, sei es, daß die Pädagogik das Selbst-beschreibungskonzept der Gesellschaftstheorie nicht länger beiseiteschieben kann.
Der Vorteil des Begriffs der Reflexionstheorie liegt in den Vergleichsmöglichkeiten,die er eröffnet. Er liegt auch in der auf Gesellschaft bezogenen Historisierung. Von „Päd-

604 N. Luhmann: Das Erziehungssystem der Gesellschaft (Auszug)
agogik“ wird, wenn man sie als Reflexionstheorie bezeichnet und als Selbstbejahung cha-rakterisiert, im Sinne einer Form gesprochen, die sich historisch als Korrelat funktionalerDifferenzierung durchgesetzt hat (also z.B. nicht unter dem Blickpunkt der Frage, ob siesich wissenschaftstheoretisch rechtfertigen läßt). Es handelt sich also keineswegs um einezweitrangige Wissenschaft, die Bindungen an ihr Objekt und damit unwissenschaftlicheEinschränkungen akzeptiert. Das trifft zwar zu, gilt aber auch für den, der diese Feststel-lung trifft. Wissenschaftliche Forschung ist, ebenso wie Erziehung, ein gesellschaftlichesUnternehmen und ist damit auf eine eigene Reflexionstheorie angewiesen.
Wenn Selbstbeschreibungen als „Theorien“ bezeichnet werden, sind damit gewisse An-sprüche verbunden. Es muß sich um durchdachte Formulierungen handeln, die Ansprüchenan Konsistenz zu genügen suchen. Sie dürfen dem Wunschdenken oder der Imaginationnicht freien Lauf lassen. Es sind nicht Theorien im Sinne von Forschungsprogrammendes Wissenschaftssystems, wohl aber Formulierungen, die auf strukturelle Kopplungenmit dem Wissenschaftssystem angewiesen sind und zwar wissenschaftlich Unbefriedi-gendes, nicht aber rasch Widerlegbares behaupten dürfen.
Selbstbeschreibungen konstituieren eine imaginäre Realität. Anders können sie die lo-gischen Probleme des Sich-selbst-Enthaltens nicht lösen. Aber das schließt nicht aus, daßihre Projektionen im System akzeptiert werden, zumal es keine anderen Möglichkeitender Selbstvergewisserung gibt.
Anmerkungen
1 LUHMANN, N. (2002): Das Erziehungssystem der Gesellschaft. Hrsg. v. D. LENZEN. – Frankfurt a.M.:Suhrkamp (im Druck). In Abweichung vom Manuskript wurden in diesem Ausdruck Zitierung undLiteraturangaben den Regeln der ZFE angeglichen. Die Rechtschreibung wurde belassen.
2 Siehe zu diesem Diskussionsstand das Nachwort in LUHMANN/SCHORR (1988, S. 363ff.).3 HESSE versteht theoretische Erklärungen als „metaphoric redescription“.
Literatur
LUHMANN N./SCHORR, K. E. (Hrsg.) (1988): Reflexionsprobleme im Erziehungssystem. – Neuausg. –Frankfurt a.M.
HESSE, M. B. (1966): Models and Analogies in Science. – Notre Dame.LUHMANN, N. (1990): Die Wissenschaft der Gesellschaft. – Frankfurt a.M.NGO-MAI, S./RAYBAUT, A. (1996): Microdiversity and Macro-Order: Toward a Self-Organization Ap-
proach. In: Revue internationale de Systémique, 10. Jg., S. 223-239.KRIPPENDORFF, K. (1996): A Second-order Cybernetics of Otherness. In: Systems Research, 13. Jg.
(Festschrift Heinz VON FOERSTER), S. 311-328.