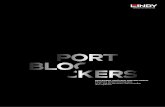marx21 No 17 Programmdebatte
-
Upload
marx21-magazin -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of marx21 No 17 Programmdebatte

21marxMagazin für internationalen SozialiSMuS
Nr. 17 | September / Oktober 2010 3,50 € | ISSN 1865-2557 www.marx21.de
Stuttgart 21 Kann der Protest gewinnen?
Erich Kästners »Konferenz der Tiere«: Revolte in 3D
Gesundheitsreform Operation Rasiermesser
Google Streetview Die Regie-rung ist die Datenkrake
Hetze gegen Muslime – die unterschätzte Gefahr.
Tadzio Müller & Wolfgang Ehmkediskutieren Perspektiven
für die Anti-AKW-Bewegung
Ilan Pappéberichtet über die verzweifelte
Lage im Gazastreifen
Elmar Altvatersetzt die Serie »Marx neu entdecken« fort

47 www.marx21.de | September/Oktober 2010 | Nr. 17 nAHoST
Zutreffend analysiert der Program-mentwurf der LINKEN den gegen-wärtigen Kapitalismus: »Das Ka-
pital treibt Produktivität, Erfindungsgeist und Innovation voran, wo immer es da-mit Profite machen kann. Zugleich werden Arbeitsplätze vernichtet, Wohlstand wird zerstört und an der Natur Raubbau betrie-ben. Auch blutige Kriege werden in Kauf ge-nommen, wenn auf diese Weise Profite gesteigert und gesichert werden können.« Die neoliberale Politik habe durch Deregu-lierung, Liberalisierung und Privatisierung die Wurzeln für die gegenwärtige Krise gelegt, die sich, wenn nicht politisch ge-gengesteuert werde, zur Katastrophe aus-wachsen könne. Der ideologische und po-litische Bankrott des Neoliberalismus sei offenkundig. Weiter heißt es: »Als erster Schritt ist ein grundlegender Richtungs-wechsel der ökonomischen und gesell-schaftlichen Entwicklung notwendig, ein sozialökologischer Umbau. Die nachhalti-ge Überwindung der wirtschaftlichen Kri-se und Massenarbeitslosigkeit, der sozia-len Krise und der Energie- und Klimakrise erfordert eine andere Wirtschaftsordnung, die nicht mehr vom Streben nach maxima-lem Profit beherrscht wird.« Ein solcher von den LINKEN angestrebter Perspektiven- und Strategiewechsel wird aber nur erreicht werden, wenn gewerk-schaftliche und soziale Kämpfe ein höhe-res Niveau erreichen. Das gilt für den Wes-ten und Osten Deutschlands in gleichem Maße. DIE LINKE ist in der Verantwor-tung, politisch mobilisierend und konkret solidarisch zu wirken und aktiv für eine
Im Osten was Neues
Regionale Standortpolitik löst Ostdeutschlands Strukturprobleme nicht. Stattdessen ist ein Abschied vom Konzept der »verlängerten
Werkbank« notwendig. Ein Beitrag zur Programmdebatte
Ausweitung der Tarif- und Sozialstandards zu mobilisieren.
Nicht alle Teile des Programmentwurfs werden dem gerecht, zum Beispiel der Abschnitt »Förderung strukturschwacher Regionen, Verantwortung in Ostdeutsch-land«. Leider beschränkt sich der Entwurf hier weitgehend auf eine Art regionaler Standortpolitik und nimmt einen Blick-winkel »von oben« ein, den der staatlichen und parlamentarischen Ebene. Zwar wer-den eingangs »gleichwertige Lebensbedin-gungen in allen Regionen der Bundesre-publik Deutschland und eine Angleichung der Lebensverhältnisse in der Europäi-schen Union« gefordert, ausgeführt wird dieser Punkt jedoch nur am Beispiel Ost-deutschlands. Hier reklamiert DIE LINKE eine besondere Verantwortung und Kom-petenz für sich, die in der Geschichte der Vorläuferpartei PDS ihre Grundlagen ha-ben. Die PDS kümmerte sich als ostdeut-sche Regionalpartei in den 1990er Jahren um die »Wendeverlierer«, insbesonde-re um ihre sozialen Probleme, und setz-te auf Mittelstandsförderung angesichts weitgehender Deindustralisierung in Ost-deutschland. Die gegenwärtigen Probleme werden im Programmentwurf als »Entwicklungsnach-teile Ostdeutschlands« charakterisiert. Ist das zutreffend? Zwanzig Jahre nach ih-rem Beitritt sind die ostdeutschen »neuen« Länder zu einem integralen Bestandteil der Bundesrepublik geworden. Kritisch zu prüfen ist, ob die in der dortigen LINKEN weit verbreitete Sicht zutreffend ist, dass Ostdeutschland auf längere Sicht ein spe-
VON KlAuS-DiETER HEiSER
Tausende Mitarbeiter der in Dresdner ansässigen Mikrochipfirma Qimonda demonstrierten im ver-gangenen Jahr gegen die drohende Schließung

48 Nr. 17 | September/Oktober 2010 | www.marx21.de
zifischer regionaler Raum Deutschlands bleiben wird und deshalb speziell die Pro-blematik der Regionalentwicklung dort im Parteiprogramm thematisiert werden muss. Die Deindustrialisierung im Osten und der Technologiewandel im Westen haben regional zu ähnlichen Ergebnis-sen geführt. Unterschiedlich waren Anlass und Verlauf. Unübersehbar ist, dass in den letzten 20 Jahren in Ostdeutschland ein grundlegender Wandel in den sozial-öko-nomischen Bedingungen herbeigeführt wurde. Im Osten wurde experimentiert mit Öffnungsklauseln für Tarifverträge, ver-einfachten Privatisierungen öffentlicher Betriebe bis zu Niedriglöhnen. Öffentliche Mittel wurden ohne wirksame Auflagen für den Erhalt bestehender und die Schaf-fung neuer Arbeitsplätze gezahlt. Steuer-gelder wurden ausgegeben, ohne auf die Eigentümerstruktur Einfluss zu nehmen und wirksame demokratische Kontrol-le und Mitbestimmung der Beschäftigten zu verankern. Das hätte auch dem neoli-
beralen Leitbild des Umbaus Ost wider-sprochen. Entstanden sind so im indust-riellen Bereich »verlängerte Werkbänke« der bundesdeutschen und internationa-len Konzerne. Sie sind extrem anfällig für konjunkturelle Schwankungen und verfü-gen kaum über eigene Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Das gilt auch für die sogenannten Leuchttürme, zum Bei-spiel für den Hightech-Standort Dresden, an dem konjunkturbedingt der Chipher-steller Qimonda abgewickelt wurde. So hat Wigand Cramer von der IG Metall errech-net, dass ein Drittel der Chipproduktion in Sachsen vom Steuerzahler finanziert wur-de. Zukunftsfragen sind so, wie die Erfah-rungen in Ostdeutschland beweisen, nicht zu lösen. Der im Programmentwurf als »Entwicklungsnachteil Ostdeutschlands« bezeichnete Zustand erweist sich also bei genauerer Betrachtung nicht als »aufzu-holender Nachteil«, sondern als Ergebnis einer mit eindeutiger Zielsetzung durch-geführten Entwicklung zum Nutzen des Kapitals. Diese Entwicklung ist zu been-den, sie bedarf einer »Wende«. Welche politischen Lösungen werden im Programmentwurf vorgeschlagen? Im Mit-telpunkt dieses Abschnittes stehen Lan-desentwicklungskonzepte zur Förderung strukturschwacher Regionen. Die Konzep-te im Programmentwurf folgen weitgehend den in den ostdeutschen Landesverbän-den der LINKEN entwickelten Leitbildern und Landesentwicklungskonzepten für eine »selbsttragende Entwicklung und zu-kunftsfähige Region, gegründet auf den so-zialökologischen Umbau der Gesellschaft«. Voraussetzung sei dafür, heißt es beispiels-weise im Leitbild »Ostdeutschland 2020«, neben einer starken Vertretung der LIN-KEN in allen ostdeutschen Parlamenten, »ihre wachsende Pflicht und Chance zu ge-stalterischer Verantwortung in der Exeku-tive«. Der Schlüssel wird also in den Lan-desregierungen gesucht. Unterstellt, der Partei DIE LINKE gelinge es, sehr gute Wahlergebnisse zu erzielen und Positionen in Landesregierungen zu besetzen, so wird trotzdem kein Euro mehr in der Landeskasse vorhanden sein. Was bleibt dann von den Landesentwick-lungskonzepten mit Vorschlägen wie »För-derung von Zukunftsbranchen und -un-ternehmen und von Zentren regionaler Wirtschaftsentwicklung durch Koope-ration von Wissenschaftseinrichtungen
Ein Drittel der Chipproduktion
in Sachsen wurde vom Steuerzahler
finanziert
Keine Angleichung
Als Beleg für das Aufholen des Ostens werden als Beispiele die Er-folge einzelner Unternehmen oder Wirtschafts-Cluster angeführt. Dabei bleibt jedoch außen vor, inwiefern diese Strahlkraft für eine tragfähige regionale Wirtschaftsentwicklung entfalten. Ein Blick auf verschiedene Tabelle zeigt, dass von einem erfolgreichen Aufholpro-zess keine Rede sein kann. So ist zum Beispiel in keiner einzigen der sogenannten Leuchtturmregionen Ostdeutschlands die Arbeitslosig-keit so niedrig wie im Durchschnitt Westdeutschlands. Quelle: ver.di Bundesverwaltung - Bereich Politik und Planung und Bereich Wirt-schaftspolitik, August 2009, Perspektiven für ostdeutschland
© In
fogr
afik
/ m
arx2
1
KonTrovErS

49 www.marx21.de | September/Oktober 2010 | Nr. 17
und Unternehmensnetzen«? Wird die-se Industriepolitik realisiert, bedeutet das Einschnitte in anderen Bereichen, zum Beispiel im öffentlichen Dienst und im So-zialbereich. So werden beispielsweise nach den jüngs-ten Zahlen der Steuerschätzung in Bran-denburg, wo DIE LINKE gemeinsam mit der SPD regiert, in den Jahren 2010 bis 2013 durch Steuern und Finanzausgleich 355 Millionen Euro weniger in die Kassen des Landes fließen als bislang angenommen. Finanzminister Helmuth Markov erklär-te dazu: »Die erneut gesunkenen Einnah-meerwartungen zwingen uns, die Notwen-digkeit von Ausgaben erneut zu prüfen. Einschnitte werden sich nicht vermeiden lassen, wenn wir die Schuldenbremse ein-halten und die Nettokreditaufnahme wei-ter zurückführen wollen.« Und das Loch in der Landeskasse wird nach 2013 noch größer werden. Zu fra-gen ist auch, wer den Nutzen haben wird, wenn Unternehmen gefördert werden, wenn Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmensnetze kooperieren. Tech-nologischer Wandel würde gefördert, um Kapitalinteressen zu bedienen. Auch das ist nicht originell: Alle Bundesregierungen seit 1990 haben hunderte Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln in den Umbau Ost gesteckt. Gestärkt wurde damit vor allem das kapitalistische Eigentum, auch im Zei-chen des technologischen Wandels.
Damit sind die Zukunftsfragen nicht zu lösen. Es geht 20 Jahre nach dem Scheitern des Staatssozialismus um die wirksame Mobilisierung zur Überwindung des Neo-liberalismus. Es geht um die Veränderung der gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnisse. Es ist zu bezweifeln, ob eine Beteiligung von Bürgerinnen und Bür-gern vor Ort an der Umsetzung von staat-lichen Regionalentwicklungsplänen und Bürgerhaushalten diese Dynamik entwi-ckeln kann. Klassenkämpfe in Ostdeutsch-land waren in der Vergangenheit eher ge-ring entwickelt. DIE LINKE trägt eine hohe Verantwortung dafür, dass sich das ändert. Statt Industriepolitik, die in den letzten 20 Jahren lediglich zu »verlängerten Werk-bänken« von nationalen oder internatio-nalen Konzernen geführt hat, oder statt der Förderung von Klein- und Mittelbetrieben sind Mobilisierungen in den Betrieben, auf der Straße, an Schulen und Hochschulen notwendig, damit gesellschaftlicher Druck
entsteht, um die Lebens- und Arbeitsbe-dingungen nachhaltig zu verbessern. Deshalb gehören zum Beispiel die For-derungen nach kostenloser Bildung, Ab-schaffung von Hartz IV, gesetzlicher Mindestlohn in Konzepte für Regional-entwicklungen. Sie sind mobilisierungsfä-hig. Erinnert sei an die Abwehrkämpfe in den 1990er Jahren, an den Kampf für die 35-Stunden-Woche in der Metallindustrie und die Montagsdemonstrationen 2004 gegen die Hartz-Gesetze. Sie blieben auf den Osten Deutschlands beschränkt und waren vor allem deshalb nicht erfolgreich. DGB-Chef Sommer hatte nach den Mon-tagsdemonstrationen erklärt, wenn sie auf den Westen ausgeweitet worden wä-ren, dann »hätte das diese Republik ver-ändert«.DIE LINKE steht bei der Erarbeitung des Parteiprogramms in Ost und West vor der-selben strategischen Aufgabe. Notwendig sind generelle Überlegungen und Schluss-folgerungen für Alternativen zum Kapi-talismus, auch für die Entwicklungen in den Regionen, damit der Profit nicht der Maßstab für ökonomische Entscheidun-gen bleibt. Die Konsequenzen aus dem gescheiterten Staatssozialismus sind zu berücksichtigen. Nicht Förderung des ka-pitalistischen Eigentums oder Staatsei-gentum kann für DIE LINKE die Perspek-tive sein, sondern reale Vergesellschaftung des Eigentums an Produktionsmitteln. Dazu gehört die Erweiterung des gesell-schaftlichen Eigentums in vielfältigen For-men, vor allem in den Schlüsselbereichen der Wirtschaft und in der öffentlichen Da-seinsvorsorge. Das bedeutet: keine öffentlichen Mit-tel ohne gesellschaftliche Kontrolle. Das heißt: Veränderung der Verfügung über das Eigentum an den Produktionsmitteln. DIE LINKE braucht als programmatische Leitlinie, dass sie eine Eigentumsordnung befürwortet, die das Eigentum denen zu-spricht, die es geschaffen haben. Das heißt Demokratie – vom Arbeitsplatz bis zur Ge-samtwirtschaft und auch auf internationa-ler Ebene.
KLAUS-DIETER HEISERist Mitglied im Bezirksvor-stand der LINKEN in Ber-lin-Neukölln.
★★★
In Brandenburg, wo DIE LINKE mitregiert,
werden in den kommenden drei Jahren
355 Millionen Euro weniger in die Kassen
des Landes fließen als angenommen
KonTrovErS