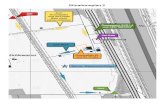Medienkompetenz – und Social Media in Kultur- und Non-Profi ... · gung der Technischen...
Transcript of Medienkompetenz – und Social Media in Kultur- und Non-Profi ... · gung der Technischen...

Management von Kultur- und Non-Profi t-Organisationen
Autoren
Prof. Dr. Günther Rager
Felix Mannheim
Katharina Schäder
Medienkompetenz – und Social Media in Kultur- und Non-Profi t-Organisationen
Studienbrief MKN0520
Fernstudiumpostgradual
Lese
probe

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nach-drucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf außerhalb der im Urheberrecht geregelten Erlaubnisse in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmi-gung der Technischen Universität Kaiserslautern, Distance & Independent Studies Cen-ter, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Kaiserslautern 2012 (3., aktualisierte und um den „Praxisteil Social Media“ ergänzte Auflage)
Lese
probe

Lese
probe

Inhaltsverzeichnis I
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis I
Abbildungsverzeichnis IV
Tabellenverzeichnis IV
Glossar V
Kurzinfo zu den Autoren XII
Literaturverzeichnis XIII
Lernziele XXVI
1 Bedeutung der Medien 1
1.1 Funktionen der Massenmedien 4
1.2 Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland 7
1.3 Printmedien (Zeitungen und Zeitschriften) – Doppelcharakter der Zeitung 8
1.3.1 Anzeigen-Probleme im Zeitungsmarkt 10
1.3.2 Noch immer großes Vertrauen in Zeitungen 11
1.4 Rundfunk 13
1.4.1 Konflikte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 16
1.5 Nachrichtenwerttheorien 17
1.6 Mediennutzung 20
1.6.1 Mediennutzertypen 23
1.7 Medienwirkungstheorien 26
1.7.1 Theorien zur Wirkung von Gewalt in den Medien 29
2 Konzepte der Medienpädagogik und Medienkompetenz 33
2.1 Entwicklungsphasen der Medienpädagogik 33
2.2 Medienkompetenzkonzept nach Dieter Baacke 38
2.3 Medienkompetenz nach Stefan Aufenanger 40
2.4 Medienkompetenz als Prozess: Norbert Groeben 43
2.5 Kritik am Begriff Medienkompetenz 51
2.6 Medienkompetenz im Handlungsfeld Kultur- und Non-Profit-Organisationen 53
Lese
probe

II Inhaltsverzeichnis
3 Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation 57
3.1 Der Begriff Schlüsselqualifikation 57
3.2 Verhältnis von Medienkompetenz und Schlüsselqualifikationen 58
4 Medienkompetenz in ausgewählten Lebens- und Arbeitsfeldern 61
4.1 Alltag und lebensbegleitendes Lernen 61
4.1.1 Facetten von Medienkompetenz im Alltag 61
4.1.2 Medienkompetenz und lebenslanges Lernen 63
4.2 Medienkompetenz und Schule 65
4.3 Berufliche Bildung 69
4.4 Medienkompetenz und Hochschulen 71
5 Medienkompetenz und Medienethik 75
5.1 Beispiele für ethisch problematische Medienformate 75
5.2 Die Verantwortung der Rezipienten 76
5.3 Grundsätze für journalistische Arbeit 77
5.4 Neue Medien laufen Recht und Ethik davon 78
6 Medienkompetenz und Jugendschutz 81
6.1 Rechtliche Grundlagen 81
6.2 Negativer Jugendmedienschutz 83
6.2.1 Jugendmedienschutz im Internet 87
6.3 Positiver Jugendschutz durch Förderung von Medienkompetenz 89
7 „Ich surfe, also bin ich“ – Zur Bedeutung von Social Media 93
7.1 Zahlen zur Nutzung neuer Medienangebote 94
7.2 Chancen für Kultur- und Non-Profit-Organisationen 95
8 Social Media: praxisbezogene Begriffserklärungen 99
9 Fragen vor der schnellen Nachricht 107
9.1 Aufmerksamkeit ist nicht immer alles 107
9.1.1 Praxisbeispiel: SPD sammelt für Steinbrück 107
9.1.2 Praxisbeispiel: Israelisches Apartheitsregime 109
9.1.3 Praxisbeispiel: Die Sex-Piratin 109
9.2 Medienkompetenz 2.0 111
Lese
probe

Inhaltsverzeichnis III
10 Chancen der Social-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien 113
10.1 Marketing in Social Media 114
10.1.1 „Regeln“ der Social-Media-Kommunikation 115
10.2 Es geht nicht nach „Schema F“ 116
10.2.1 Facebook-Überlegungen am Beispiel eines Theaters 116
10.3 Verschiedene Social-Media-Plattformen 118
10.3.1 Blogs 119
10.3.2 Facebook 120
10.3.3 Twitter 122
10.4 Du? – Und wie oft? 123
10.5 Rechtslage und Urheberrecht in Social Media 124
10.5.1 Richtlinien aufstellen 126
10.6 Beispiele für Social Media im Kultur- und Non-Profit-Bereich 127
10.6.1 neanderweb 2.0 127
10.6.2 Oper in sozialen Medien 128
10.6.3 Social Media für freie Künstler/innen und Projektemacher/innen 130
10.6.4 Fragen für „Einzelkämpfer“ – und E-Portfolios 133
11 Weitere Möglichkeiten im Überblick 135
11.1 Weitere Social-Media-Portale 135
11.2 Apps 136
11.3 E-Paper, iBooks – und digitale Bildungsangebote 137
11.4 Crowdfunding 137
12 Schon heute sind es noch mehr 141
Musterlösungen zu den Übungsaufgaben 143
Stichwortverzeichnis 164
Lese
probe

IV Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb.1: Der Aufbau einer Rundfunkanstalt am Beispiel des WDR 16
Abb.2: Mediennutzergruppen der MNT 2.0 24
Abb.3: So kann es kommen, wenn man als Person des öffentlichen Lebens in sozialen Netzwerke seine Posts nicht abwägt. 110
Abb.4: Wer mit Facebook arbeitet, sollte sich mit den Nutzungs- bedingungen und den Datenverwendungsrichtlinien auseinandersetzen 122
Abb.5: Der Neanderthaler führt durch das Social-Media-Angebot des Museums 127
Abb.6: So sehen „Social-Media-Hypes“ aus: Im Dezember 2012 wurde das offizielle Video von Cros „Easy“ bei Youtube bereits über 31 Millionen mal angeklickt. 131
Abb.7: Schon der Seitenkopf von Helga Berger macht deutlich, dass in diesem Facebook-Profil Kunst steckt. 132
Abb.8: Die Künstlerin nimmt Stimmungen auf – und setzt ihre Bilder in Bezug zu ihnen 132
Tabellenverzeichnis
Tab.1: Unterschiede zwischen Massen- und Individualkommunikation 3
Tab.2: Werbe-Marktanteile der Medien 2011 12
Tab.3: Vertrauen in verschiedene Medien 12
Tab.4: Entwicklung der Nutzungsdauer der Medien pro Tag 21
Tab.5: Beispiele begrifflicher Modelle der Medienkompetenz 50
Tab.6: Gegenüberstellung von Kompetenz und Qualifikation 58
Tab.7: Lokale/regionale Kompetenz verschiedener Medien 96
Lese
probe

Glossar V
Glossar
Weitere Social-Media-spezifische Begriffe werden praxisbezogen in Kapitel 8 dieses Studienbriefes erklärt.
Edutainment:
Ein Konzept der Wissensvermittlung, bei dem die Inhalte spielerisch und gleich-zeitig auch unterhaltsam z.B. durch Animationen und Simulationen vermittelt werden. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern education (Bildung) und entertainment (Unterhaltung) zusammen. Ziel des Edutainments ist es, die Lernbereitschaft des Rezipienten durch unterhaltende Anreize zu steigern. Der Spieltrieb dient dabei als Motivationsfaktor. Zwischen Edutainment und Info-tainment ist der Übergang fließend.
E-Learning:
Steht für "elektronisches Lernen". Dazu gehören die Wissensvermittlung und das Trainieren von Fertigkeiten mit Hilfe von modernen Informations- und Kommu-nikationstechnologien. Ursprünglich Sammelbegriff für alle Formen elektronisch unterstützten Lernens (z.B. internetgestütztes Lernen, Lernen per interaktivem TV, CD-ROM, Videobändern). Wird inzwischen fast ausschließlich für Internet- bzw. Intranet-basiertes Lernen verwendet. Nach einer Definition von Michael Kerres (2001) bezeichnet E-Learning alle Formen von Lernen, bei denen digitale Medien für die Präsentation und Distribution von Lernmaterialien und zur Unter-stützung zwischenmenschlicher Kommunikation eingesetzt werden.
Frankfurter Schule (Kritische Theorie):
Frankfurter Schule nennt man die sozialphilosophische Lehre, die von einem Kreis von Sozial- und Kulturwissenschaftlern um Max Horkheimer und Theodor W. Adorno begründet wurde. Sie ist aus dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main hervorgegangen. Die Vertreter dieser Schule versuchten die politische Ökonomie von Marx mit der Psychoanalyse von Freud zu einer kriti-schen Theorie über die kapitalistische Gesellschaft zu verbinden. Mit Kritik und Erkenntnis ist zugleich der Anspruch verbunden, die gesellschaftlichen Verhält-nisse in ihrer Veränderbarkeit und der Notwendigkeit ihrer Veränderung begriff-lich zu durchdringen. Jürgen Habermas zählt zu den Vertretern der zweiten Gene-ration dieser Schule. Bekanntestes Werk der Frankfurter Schule ist die „Dialektik der Aufklärung“ von Horkheimer und Adorno. Literatur: Rolf Wiggershaus: Die Frankfurter Schule. Geschichte, theoretische Entwicklung, politische Bedeutung (München: 2001).
Individualkommunikation:
Bezeichnet in der Kommunikationswissenschaft eine Kommunikationsform, bei der einzelne Individuen miteinander kommunizieren. Bei Medien der Individual-
Lese
probe

VI Glossar
kommunikation läuft der Informationsfluss in beide Richtungen, also bidirektio-nal. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer der Kommunikation zugleich Sender und Empfänger sein können. Individualkommunikation richtet sich an einen begrenz-ten Personenkreis. Zu den Medien der Individualkommunikation zählen Briefe, Telefaxe, Telefongespräche, aber teilweise auch E-Mails, sofern sie nicht als Mas-sen-E-Mail (oder auch Spam-Mail) an eine Vielzahl unbekannter Empfänger ver-sendet werden. Das Gegenteil der Individualkommunikation ist die Massenkom-munikation.
Infotainment:
Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern information (Information) und entertainment (Unterhaltung) zusammen. Die Darstellung von Fakten wird dabei durch unterhaltende Elemente aufgelockert, um eingängiger zu wirken. Gängige Ausprägungen von Infotainment sind Fernsehnachrichten, in denen Fakten von politischer und/oder ökonomischer Bedeutung gemeinsam mit Unterhaltungsge-schichten dargeboten werden, oder auch unterhaltsam aufbereitete Dokumentatio-nen und Wissenssendungen wie beispielsweise „Galileo“.
Journalistische Sorgfaltspflicht:
In den meisten Landespressegesetzen steht: „Die Presse hat alle Nachrichten vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit, Inhalt und Herkunft zu prüfen.“
Lernmanagementsystem:
Diese Systeme werden auch Lernplattform genannt. Sie bilden in der Regel den technischen Kern einer komplexen webbasierten E-Learning-Infrastruktur. Es handelt sich dabei um auf einem Webserver installierte Software, die das Bereit-stellen und die Nutzung von Lerninhalten unterstützt und Instrumente für das ko-operative Arbeiten und eine Nutzerverwaltung bereitstellt. Zu den Grundfunktio-nalitäten eines Lernmanagementsystems zählen Diskussionsforen, Chat und die Möglichkeit, digitale Informationsmedien, etwa Texte, Bilder, Video- und Audio-dokumente, bereitzustellen. Darüber hinaus bieten Lernmanagementsysteme er-weiterte Funktionalitäten im Bereich der Administration, angefangen von Teil-nehmerverwaltung bis hin zu Multiple-Choice-Tests.
Mantel-Teil:
Die ersten Seiten einer Tageszeitung (meist Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur), die in ihrer Berichterstattung über den örtlichen Bereich hinausreichen und über Ereignisse auf Landes- und Bundesebene sowie im Ausland berichten. Nicht im-mer werden Mantel- (bzw. Politik- oder überregionale Seiten) und Lokalteil von ein und derselben Vollredaktion produziert.
Lese
probe

Glossar VII
Massenkommunikation
Bezeichnet in der Kommunikationswissenschaft die Kommunikationsform, die der öffentlichen Kommunikation zuzurechnen ist und „bei der Aussagen öffent-lich (also ohne begrenzte und personell definierte Empfängerschaft), durch techni-sche Verbreitungsmittel (Massenmedien), indirekt (also bei räumlicher, zeitlicher oder raumzeitlicher Distanz der Kommunikationspartner) und einseitig (also ohne Rollenwechsel zwischen Aussagenden und Aufnehmenden) an ein disperses Pub-likum […] gegeben werden“ (Maletzke 1963). Zu den Massenmedien zählen ne-ben den periodisch erscheinenden Massenmedien Zeitung, Hörfunk und Fernse-hen, Bücher, Filme, CDs und andere Tonträger etc. Das Internet wird in seinen allgemein zugänglichen Teilen als Massenmedium gesehen (vgl. Kapitel 1).
Mediensystem:
Beschreibt die politischen, ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen, in die eine Produktion massenmedialer Inhalte eingebettet ist.
Nachrichtenwert/Nachrichtenfaktoren:
Die Auswahl von Nachrichten aus der Fülle täglich anfallender Informationen richtet sich nach dem „Wert“ einer Nachricht. Dieser „Wert“ wird bestimmt durch Anhaltspunkte („Nachrichtenfaktoren“) wie: Aktualität, Nähe zur Leserschaft, Prominenz (bekannte Politiker, Sportler, Schauspieler), Bedeutung eines Ereignis-ses (großer Kreis von Betroffenen), menschlich-emotionale Aspekte wie Streit, Kriminalität, Überraschung, Ungewöhnliches, Spannung, etc. (vgl. Kapitel 1).
Nachrichtenagentur:
Unternehmen, das NACHRICHTEN sammelt, sichtet, vorsortiert und gegen Bezah-lung weitergibt. Die bekannteste und größte Nachrichtenagentur in Deutschland ist die Deutsche Presse-Agentur (dpa), daneben begegnet einem auch ddp (Deut-scher Depeschendienst) häufig. Bekannte ausländische Agenturen sind z.B. AP (Associated Press/USA), Reuters (rtr/Großbritannien), AFP (Agence France-Press, Frankreich).
Objektivität:
Unter objektiver Berichterstattung versteht man, etwas wiederzugeben, wie es wirklich ist oder wie es sich wirklich zugetragen hat. Nicht gleichzusetzen mit Ausgewogenheit. Letztere bedeutet, unterschiedliche Positionen zu einem Sach-verhalt oder Thema darzustellen. Absolute Objektivität ist nicht möglich. Jede Darstellung ist bereits durch Wahrnehmung und Auswahl der Informationen sub-jektiv geprägt.
Paparazzo (plural Paparazzi): Abwertende Bezeichnung für Pressefotografen, die Prominenten nachstellen und dabei häufig die Privatsphäre missachten. Paparazzi arbeiten meist für Boule-vardmedien.
Lese
probe

VIII Glossar
Peer-Group:
Englisch für Referenzgruppe. Dies ist eine Bezugsgruppe, an der das eigene Ver-halten ausgerichtet wird. Die Peer-Group bietet oft die Möglichkeit einer erweiter-ten sozialen Orientierung. Wie bei jeder Gruppe kann ein erhöhter Druck auf die einzelnen Mitglieder die innere Freiheit einschränken. Unter Umständen unter-wirft die Gruppe den Einzelnen einer spezifischen Subkultur. Die entwicklungs-psychologische Sicht ergänzt, dass die Peer-Group für die Entwicklung der Identi-tät wesentlich ist.
Pisa-Studie:
PISA steht für "Programme for International Student Assessment" und bezeichnet die umfassendste internationale Bildungsstudie, die bisher auf internationaler Ebene durchgeführt wurde. Die Studie wurde im Auftrag der OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) konzipiert. Vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2006 wurden in einem Drei-Jahres-Turnus die Kenntnisse und Fähigkeiten von Schülern in den Bereichen Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissen-schaften gegen Ende der Pflichtschulzeit getestet. Zu den Ergebnissen von PISA zählen auch Befunde hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den genannten Kompetenzen und Merkmalen der sozialen und kulturellen Herkunft, sowie des schulischen Lernumfelds. Die Nationale Projektleitung für die Erhebungen 2003 und 2006 in Deutschland lag beim Leibniz-Institut für die Pädagogik der Natur-wissenschaften (IPN) in Kiel. Vgl. Link: www.pisa.ipn.uni-kiel.de.
Podcast:
Setzt sich aus den beiden Wörtern iPod und broadcasting zusammen. Ein einzel-ner Podcast (deutsch: ein Audio- oder Bildbeitrag, genauer, eine Audio- oder Be-wegtbilddatei) ist eine Serie von Medienbeiträgen (Episoden), die über einen Feed (meistens RSS) automatisch bezogen werden können. Podcasts werden sowohl von Privatleuten, als auch von Zeitungen, Fernseh- und Radiosendern, aber auch von der Bundeskanzlerin im Internet bereitgestellt.
Pressekonzentration:
In Deutschland ist die Pressekonzentration weit fortgeschritten. Sie wird in publi-zistischen Einheiten (Vollredaktionen) gemessen, die auch einen eigenen Mantel herausgeben. Derzeit gibt es in Deutschland nur noch 134 Vollredaktionen, 1954 waren es allein in der alten Bundesrepublik noch 225. Zusammenschlüsse von Presseunternehmen werden häufig vom Bundeskartellamt geprüft, um unter ande-rem dem ökonomischen Wettbewerb zu erhalten. Im Bereich der Medien ist Wettbewerb mit der Hoffnung auf publizistische Vielfalt verbunden. Durch sie sollen die Bürger vor einseitiger Meinungsmacht geschützt werden.
Lese
probe

Glossar IX
Pressemitteilung:
Schriftliche Mitteilung von Politikern, Behörden, Vereinen, Institutionen, Agentu-ren, Pressestellen etc. mit der Intention zur Veröffentlichung in einem Medium. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung, aber viele Pressemitteilungen bil-den den Ausgangsstoff für Meldungen etc. in den Medien.
Publizistische Einheit:
Vollredaktionen, die auch den überregionalen Teil der Zeitung, also die Mantel-seiten Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur, aber auch Beilagen wie das Wochen-endmagazin, selbst herstellen. In der Bundesrepublik gibt es derzeit 134 publizis-tische Einheiten.
Sinus-Typologie:
Beschreibt die Milieus verschiedener Gruppen von Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähneln. Die grundlegende Wertorientierung geht dabei ebenso in die Analyse ein wie Alltagseinstellungen zur Arbeit, zur Fa-milie, zur Freizeit sowie zu Geld und Konsum. Zwischen den unterschiedlichen Milieus gibt es Berührungspunkte und Übergänge. Die Sinus-Typologie wurde von der Sinus Sociovision entwickelt. Einen Überblick über die Gruppierungen gibt es unter dem Link: http://www.sinus-institut.de/loesungen/sinus-milieus.html.
Spiegel-Affäre:
Im Oktober 1962 durchsuchte die Polizei auf Anordnung der Bundesanwaltschaft die Redaktionsräume des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ in Hamburg und Bonn. Mehrere leitende Redakteure wurden wegen Verdacht auf Landesverrat festgenommen. Der Herausgeber Rudolf Augstein stellte sich zwei Tage später selbst der Polizei. Anlass der Polizeiaktion war ein Artikel über das NATO-Manöver "Fallex 62". In ihm berichtete der „Der Spiegel“ über atomare Planun-gen der Bundeswehr. Angeordnet hatte diese Maßnahmen die Bundesan-waltschaft, da der Artikel geheim zu haltende Tatsachen veröffentlicht habe, die er durch Verrat von Angehörigen des Bundesverteidigungsministeriums erhalten ha-be. Die Begründungen für die Haftbefehle lauteten auf Tatverdacht des Landes-verrats und der aktiven Bestechung.
Das Vorgehen gegen den Spiegel nährte den Verdacht, dass der dehnbare Begriff des „Staatsgeheimnisses“ benutzt werden sollte, um ein regierungskritisches Nachrichtenmagazin einzuschüchtern. Es kam zu Protesten unter dem Motto: „Spiegel tot – Freiheit tot“. Der Protest richtete sich gegen die Bundesregierung wegen ihrer vermeintlich massiven Eingriffe in die Presse- und Meinungsfreiheit und führte zu einer Regierungskrise, die Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) letztlich zum Rücktritt zwang.
Im August 1966 wies das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde des Spiegels gegen die Haft- und Durchsuchungsbefehle zurück: Militärische Ge-heimhaltung im Interesse der Staatssicherheit und die Pressefreiheit seien einander
Lese
probe

X Glossar
zugeordnet. Im Konfliktfalle müsse jedoch abgewogen werden. Die Verfassungs-beschwerde wurde bei Stimmengleichheit abgewiesen. Die Verfassungsrichter, die die Begründung nicht mittragen wollten, hatten die Pressefreiheit höher be-wertet.
Stimulus-Response-Modell:
Theorie über die Wirkung von Massenmedien auf deren Nutzer. Grundannahme ist, dass die Medien bzw. ihre Inhalte einen Reiz darstellen, der bei den Rezipien-ten eine Reaktion auslöst. Das Modell geht davon aus, dass die Inhalte von allen Rezipienten gleich aufgenommen werden und folglich identische Reaktionen her-vorrufen. Das Stimulus-Response-Modell ist eines der frühesten Modelle zur Me-dienwirkung und gilt inzwischen als überholt.
Stimulus-Organism-Response-Modell:
Weiterentwicklung des Stimulus-Response-Modells. Anders als in dem S-R-Modell werden hier auch Vorgänge bei der individuellen Verarbeitung in den Wirkungsprozess einbezogen. Es wird davon ausgegangen, dass Medieninhalte bei unterschiedlichen Rezipienten unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Ne-ben dem Medieninhalt als Reiz können Faktoren wie Alter, Geschlecht, sozialer und kultureller Hintergrund die Reaktion beeinflussen.
Telemedien:
Telemedien sind nach dem 9. Rundfunkänderungsstaatsvertrag alle elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste. Soweit sie nicht der Individualkom-munikation dienen (z.B. E-Mails), sondern an die Allgemeinheit gerichtet sind (bisher: Mediendienst), ist auch eine Einordnung als Rundfunk zu prüfen. Haupt-kriterium ist dabei die Bedeutung für die individuelle und öffentliche Meinungs-bildung. Ist diese gering – wie beispielsweise beim Teleshopping (z.B. HSE24, QVC und Sonnenklar TV), bei Fernseh- und Radiotext, Mess- und Datendiensten oder auch bei Abrufdiensten wie "video-on-demand" – so bleibt es bei der Ein-ordnung als Telemedium. Es gelten dann nach dem Rundfunkstaatsvertrag weni-ger strenge Regelungen als für Rundfunkangebote.
Televorlesung:
Eine Vorlesung an einer Universität oder Schule über Videokonferenz-Technologie, bei der sich der Dozent nicht im selben Raum wie die Zuhörer be-findet (vgl. E-Learning).
Unlautere Recherchemethoden:
Methoden der Informationsbeschaffung, die nicht mit dem Pressekodex überein-stimmen. Darin heißt es unter Ziffer 4: „Journalisten geben sich grundsätzlich zu erkennen. Unwahre Angaben des recherchierenden Journalisten über seine Identi-tät und darüber, welches Organ er vertritt, sind grundsätzlich mit dem Ansehen und der Funktion der Presse nicht vereinbar. Verdeckte Recherche ist im Einzel-
Lese
probe

Glossar XI
fall gerechtfertigt, wenn damit Informationen von besonderem öffentlichem Inte-resse beschafft werden, die auf andere Weise nicht zugänglich sind. Bei Un-glücksfällen und Katastrophen beachtet die Presse, dass Rettungsmaßnahmen für Opfer und Gefährdete Vorrang vor dem Informationsanspruch der Öffentlichkeit haben.“
Unschuldsvermutung:
Im Grundgesetz kommt dieser zentrale Pfeiler des Strafrechts in Art. 20 zum Aus-druck. Die Europäische Menschenrechtskonvention beinhaltet ihn in Art. 6 Abs. 2: „Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig." Auch darf in den (Massen-) Medien keine Vorverur-teilung stattfinden. Deshalb wird beispielsweise bei der Berichterstattung über Straftaten vor einem Urteil vom „mutmaßlichen Täter“ und nicht vom „Täter“ ge-sprochen.
Uses and Gratifications-Ansatz:
Der Uses-and-Gratifications-Ansatz geht davon aus, dass die Rezipienten aus ih-rer Interessens- oder Bedürfnislage heraus entscheiden, ob und welches Medien-angebot sie nutzen. Der Ansatz stellt insofern einen Paradigmenwechsel (d. h. ei-nen Wechsel in der wissenschaftlichen Denkweise und Lehrmeinung) in der Me-dien- und Kommunikationsforschung dar, als er nach Beweggründen zur Nutzung von Rezipienten fragt und den Rezipienten eine aktive Rolle im Umgang mit Massenmedien zuweist (vgl. dagegen –> Stimulus-Response-Modell).
Überregionale Zeitung:
Zeitung, die nicht nur in einer bestimmten Region, sondern im ganzen Land (nati-onal) vertrieben wird, und die sich von den Regionalzeitungen auch durch den größeren Umfang an Informationen, vor allem aus Politik, Wirtschaft und Kultur, unterscheidet. Auch überregionale Zeitungen können einen Lokalteil haben. In der national verbreiteten Ausgabe erscheint dieser jedoch verkürzt oder gar nicht. Es gibt nur wenige überregionale Tageszeitungen in Deutschland: Frankfurter All-gemeine Zeitung (FAZ), Frankfurter Rundschau (FR), Süddeutsche Zeitung (SZ), tageszeitung (taz), Welt, Bild, Neues Deutschland.
Zensur:
Kontrolle und Beeinflussung von Texten und Bildern vor Veröffentlichung durch hoheitliche (z.B. staatliche) Gewalt. In Deutschland findet eine Zensur nicht statt (Artikel 5, Absatz 1, Satz 3 des Grundgesetzes).
Lese
probe

XII Kurzinfo zu den Autoren
Kurzinfo zu den Autoren
Prof. Dr. rer. soc. Günther Rager
Prof. Dr. rer. soc. Günther Rager, geb. 1943, emeritierter Professor für Journalis-tik an der Universität Dortmund und Gesellschafter der mct media consulting team Dortmund GmbH. Studium der Germanistik, Geschichte und der Empiri-schen Kulturwissenschaft in München und Tübingen. Promotion. Fernsehjourna-list, Schwerpunkt Kultur. Zahlreiche Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen. Ab 1973 Aufbau des Studiengangs Kommunikationswissenschaft an der Universi-tät Stuttgart-Hohenheim. Mitarbeit dort bis zur Berufung an das Institut für Jour-nalistik in Dortmund 1984.
Forschungsschwerpunkte von Professor Rager sind Publikumsforschung; jugend-liche Leser/Nichtleser von Tageszeitungen. Leiter des DFG-Forschungprojektes „Lesesozialisation: Zeitunglesen lernen.“ Weitere Schwerpunkte: Redaktions-forschung; journalistische Qualität; Leiter des DFG-Forschungsprojektes: „Theat-ralität und Argumentativität in der Mediengesellschaft“. Langjähriges Mitglied der Grimme-Preis-Jury. Wissenschaftlicher Beirat des Freien Russisch-Deutschen Instituts für Publizistik (FRDIP) und Prof. h.c. an der Lomonossow Universität Moskau.
Dipl.-Journ. Katharina Schäder
Dipl.-Journ. Katharina Schäder, geb. 1979. Studium der Journalistik und Ge-schichte in Leipzig und Rom. Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk. 2007 gemeinsam mit Professor Rager Leitung der Begleitforschung zum Projekt „Zei-tungsZeit“ im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW und des BDZV NRW. Projektleiterin beim mct media consulting team in Dortmund und freie Journalis-tin u.a. für „Die Welt“.
Dipl.-Journ. Felix Mannheim
Dipl.-Journ. Felix Mannheim, geb. 1981. Studium der Journalistik und der Poli-tikwissenschaft an der Universität Dortmund. Volontariat bei der Thüringer All-gemeine, freie Mitarbeit u.a. für Süddeutsche Zeitung, WDR und NRZ. Dozent und Kommunikationstrainer. Von 2006 bis 2010 Dramaturg am Schauspiel Dort-mund, von 2010 bis 2012 leitender Dramaturg am Schlosstheater Moers. Dort auch für Öffentlichkeitsarbeit und die Konzeption der Online-Medien zuständig. Seit Mitte 2012 wieder frei tätig, v.a. für das mct media consulting team Dort-mund und den WDR. Felix Mannheim hat den Studienbrief von Günther Rager und Katharina Schäder Ende 2012 aktualisiert und um den „Praxisteil Social Me-dia“ erweitert.
Lese
probe

Literaturverzeichnis XIII
Literaturverzeichnis
Einführende Literatur
Aufenanger, Stefan (1997): Medienpädagogik und Medienkompetenz – Eine Bestandsaufnahme. In: Medienkompetenz im Informationszeitalter. Hsrg. Enquete-Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft; Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“. Deutscher Bundestag. Bonn. S. 15ff.
Baacke, Dieter (1996): Medienkompetenz – Begrifflichkeit und sozialer Wandel. In: Medienkompetenz als Schlüsselbegriff Hrsg. A. v. Rein. Bad Heilbrunn, S. 112ff.
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV) (2012): Zeitungen 2012/2013. Berlin.
Branahl, Udo (2006): Medienrecht. Eine Einführung. Wiesbaden.
Gapski, Harald (2001): Medienkompetenz. Eine Bestandsaufnahme und Vor-überlegungen zu einem systemtheoretischen Rahmenkonzept. Wiesbaden.
Groeben, Norbert (2002): Dimensionen der Medienkompetenz: Deskriptive und normative Aspekte. In: Medienkompetenz. Voraussetzungen, Dimensio-nen, Funktionen. Hrsg. N. Groeben / B. Hurrelmann. Weinheim, München, S. 160ff.
Heinrich, Jürgen (2001): Medienökonomie Band 1+2. Wiesbaden.
Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hg.) (2011): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.
Kübler, Hans-Dieter (2003): Kommunikation und Medien: Eine Einführung. Münster.
Meyn, Hermann (2004): Massenmedien in Deutschland. Konstanz.
Scheurer, Hans / Spiller, Ralf (Hg.) (2010): Kultur 2.0. Neue Web-Strategien für das Kulturmanagement im Zeitalter von Social Media. Bielefeld.
Weinberg, Tamar (2011): Social Media Marketing. Strategien für Twitter, Facebook & Co. Köln.
Weiterführende Literatur
Altenhain, Karsten (2001): Die Sicht des Jugendschutzrechts. In: Allianz von Medienrecht und Informationstechnik? Hrsg. A. Rossnagel. Baden-Baden.
Altmeppen, Klaus-Dieter (2006): Journalismus und Medien als Organisation:
Lese
probe

XIV Literaturverzeichnis
Leistungen, Strukturen und Management. Wiesbaden.
ARD/ZDF-Onlinestudie 2012 unter: www.ard-zdf-onlinestudie.de (Dez. 2012)
Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten in der Bundesrepublik Deutschland (2007): Jahrbuch 2006 – Landesmedienanstalten und privater Rundfunk in Deutschland. Berlin.
Arnold, Rolf (1997): Von der Weiterbildung zur Kompetenzentwicklung. Neue Denkmodelle und Gestaltungsansätze in einem sich verändernden Handlungsfeld. In: Kompetenzentwicklung ´97. Berufliche Weiterbil-dung in der Transformation – Fakten und Visionen. Hrsg. Arbeitsgemein-schaft Qualifikations-Entwicklungs-Management. Münster, New York, München, Berlin. S. 253ff.
Aufenanger, Stefan (2003): Medienkompetenz und Medienbildung. In: ajs-Informationen 1/2003, S. 4ff.
Baacke, Dieter (1973): Kommunikation und Kompetenz. Grundlagen einer Didaktik der Kommunikation und ihrer Medien. München.
Bachmair, Ben (2007): Medienerziehung im Kindergarten – 10 Antworten.
Barsch, Achim (1988): Jugendmedienschutz und Literatur. Siegen.
Bartsch, Paul Detlev (1999): Förderung von Medienkompetenz im Handlungsfeld Schule. In: Medienkompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 258ff.
BDZV (2007): Die deutschen Zeitungen in Zahlen und Daten. Berlin.
Beierwaltes, Andreas (2000): Demokratie und Medien. Der Begriff der Öffentlichkeit und seine Bedeutung für die Demokratie in Europa. Baden-Baden.
Bett, Katja / Rinn, Ulrike / Wedekind, Joachim (2000): Förderung von Medien-kompetenz im Bereich der Hochschulen. In: Medienkompetenz in der Informationsgesellschaft. Perspektiven in Baden-Württemberg. Hrsg. A. Zerfaß / C. Hoffmann / W. Wunden / W. Klingler. Stuttgart . S. 17ff.
Bett, Katja / Wedekind, Joachim / Zentel, Peter (2004): Medienkompetenz für die Hochschullehre. Münster.
Bildungskommission NRW (1995): Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft. Denkschrift der Kommission „Zukunft der Bildung – Schule der Zu-kunft“ beim Ministerpräsidenten des Landes NRW. Neuwied.
BITKOM-Pressemeldungen unter: http://www.bitkom.org/de/presse/2885.aspx (Dez. 2012)
BLK Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (2004): Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland. Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsför-derung. Bonn. http://www.blk-bonn.de/papers/heft115.pdf; zuletzt
Lese
probe

Literaturverzeichnis XV
aufgerufen am 18.07.2011.
Blödorn, Sascha / Gerhards, Maria / Klingler, Walter (2006): Informationsnutzung und Medienauswahl 2006. Ergebnisse einer Repräsentativbefragung zum Informationsverhalten der Deutschen. In: Media Perspektiven 12/2006, S. 630ff.
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung (1998): Abschlussbericht zum „Bildungs-Delphi“. Delphi-Befragung 1996/1998. Potentiale und Dimensionen der Wissensgesellschaft – Auswirkungen auf Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen. Verfasser: Helmut Kuwan / Eva Waschbüsch. München.
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung (1999): Berichtssystem Weiterbildung VII. Erste Ergebnisse der Repräsentativbefragung zur Weiterbildungssituation in den alten und neuen Bundesländern.
Borger, Adriane (1999): Was ist Medienkompetenz? Eine Umfrage unter denen, die es wissen müssen. In: connex. Infomagazin für Bürgermedien. 03/1999, 01/2000. S. 6.
Bosshart, Louis (1994): Überlegungen zu einer Theorie der Unterhaltung. In: Medienlust und Medienfrust. Unterhaltung als öffentliche Kommuni-kation. Hrsg. L. Bosshart / W. Hoffmann-Riem. Konstanz 1994.
BPjM (2008): Wegweiser Jugendmedienschutz. Ein Überblick über Aufgaben und Zuständigkeiten der Jugendmedienschutzinstitutionen in Deutschland. Unter: http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/ wegweiser-jugendmedienschutz.html; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Brater, Michael / Büchele, Ute / Fucke, Erhard / Herz, Gerhard (1988): Berufs-bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Stuttgart.
Brock, Adolf (2002): Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen – und ihre Grundlegung in der ersten „Bildungs-Katastrophe“. Zur heutigen Bedeutung von Begriffen und Inhalten, die ihren Ursprung in der Lehrlingsausbildung und in der Arbeiterbildung haben. In: Frankfurter Rundschau / Berufsrundschau, 16.02.2002, S.2.
Bullinger, Hans-Jörg (1997): Wirtschaft 21 – Perspektiven, Prognosen, Visionen. In: Zur Ökonomie der Informationsgesellschaft. Perspektiven Prognosen Visionen. Hrsg. Enquete Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft - Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“ / Deutscher Bundestag. Bonn. S. 69ff.
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV) (2007): Die deutschen Zeitungen in Zahlen und Daten. Berlin.
Chomsky, Noam (1972): Aspekte der Sytax-Theorie. Frankfurt am Main.
Deutscher Presserat (2006): Publizistische Grundsätze (Pressekodex). Richtlinien für die Publizistische Arbeit nach den Empfehlungen des Deutschen
Lese
probe

XVI Literaturverzeichnis
Presserates. http://www.presserat.de/uploads/media/Pressekodex.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Deutscher Presserat (2007): Leser sollen sich ein korrektes Bild von der öffentli-chen Rüge gegen BILD machen können. Pressemitteilung vom 30.11.2007. [2011 nicht mehr online verfügbar]
Deimer, Josef (1999): Kommunalverwaltung im Wandel. In: Multimedia-Ver-waltung. Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft, Bd. 7. Hrsg. H. Kubicek u.a. Heidelberg. S. 88ff.
Dewe, Bernd / Sander, Uwe (1996): Medienkompetenz und Erwachsenenbildung. In: Medienkompetenz als Schlüsselbegriff Hrsg. A. v. Rein. Bad Heilbrunn. S.125ff.
Dichanz, Horst (1999): Medienkompetenz der Multiplikatorinnen und Multipli-katoren im System Schule. In: Medienkompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 289ff.
DJV (2003): http://www.djv.de/fileadmin/DJV/schwerpunkte/Medienrecht/ Stell ungnahme_vom_12._November_2003.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Egger, Andreas / Windgasse, Thomas (2007): Radionutzung und MNT 2.0. In: Media Perspektiven, Mai 2007, S. 255ff.
Eggert, Christian / Keller, Dieter (2012): Ein starkes Medium – Zur wirtschaft-lichen Lage der deutschen Zeitungen. In: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (Hg.): Zeitungen 2012/2013. Berlin. S. 41ff.
Eimeren van, Birgit / Ridder, Christa-Maria (2005): Trends in der Nutzung und Bewertung der Medien 1970 bis 2005. In: Media Perspektiven 10/2005, S. 490ff.
Ellers, Meinolf (2012): Wo bleiben die Fans? – Lokale Konzepte für junge Zielgruppen. In: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (Hg.): Zeitungen 2012/2013. Berlin. S. 195ff.
Encarnacao, José L. (2001): Virtuelle Bildung und Neuer Bildungsmarkt. In: Medienkompetenz. Wirtschaft. Wissen. Wandel. Hrsg. I. Hamm. Gütersloh 2001, S. 112ff.
Enquete-Kommission (1998): Kinder- und Jugendschutz im Multimediazeitalter. Dritter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Zukunft der Medien Wirtschaft und Gesellschaft – Deutschlands Weg in die Informations-gesellschaft. Bonn.
Euler, Dieter (2004): Einfach, aber nicht leicht – Kompetenzentwicklung im Rahmen der Implementierung von E-Learning an Hochschulen. In: Medienkompetenz für die Hochschullehre. Hrsg. K. Bett / J. Wedekind / P. Zentel. Münster, S. 55ff.
Lese
probe

Literaturverzeichnis XVII
Feierabend, Sabine / Klingler, Walter (2007): Kinder und Medien: Ergebnisse der KIM-Studie 2006. In: Media Perspektiven 10/2007, S. 492ff.
Fischer, Till (2012): Verlage im Testlabor – Zeitungen auf dem Tablet. In: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (Hg.): Zeitungen 2012/2013. Berlin. S. 183ff.
Fox, Dirk (2001): Jugendschutz und Filtersysteme. Technische Systeme zur Gewährleistung von Jugendschutz im Internet. In: Allianz von Medienrecht und Informationstechnik? Hrsg. A. Rossnagel. Baden-Baden 2001.
Funiok, Rüdiger (2005): Medienethik. In: Grundbegriffe Medienpädagogik. 4. Auflage. Hrsg. J. Hüther / B. Schorb. München, S. 243. http://www. mediaculture-online.de; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
FSF Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e.V. (2006): Jahresbericht 2006. http://www.fsf.de/fsf2/ueber_uns/bild/download/FSF_Jahresbericht_2006.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Früh, Werner / Schönbach, Klaus (1982): Der dynamisch-transaktionale Ansatz. Ein neues Paradigma der Medienwirkungen. Publizistik, 27, 74ff. Abge-druckt in Früh, Werner (1991): Medienwirkungen. Das dynamisch-transaktionale Modell. Opladen, S. 23ff.
Früh, Werner (2001): Der dynamisch-transaktionale Ansatz. Ein integratives Paradigma der Medienwirkungen. In: Theoretische Perspektiven der Rezeptionsforschung. Hrsg. P. Rössler / U. Hasebrink / M. Jäckel. München, S. 11ff.
Galtung, Johan / Ruge, Mari Holmboe (1965): The Structure of Foreign News. The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crisis in Four Nor-wegian Newspapers. In: Journal of Peace Research 2, 1965, S. 64ff.
Gerhards, Maria / Mende, Annette (2007): Offliner 2007: Zunehmend distan-zierter, aber gelassener Blick aufs Internet. In: Media Perspektiven 08/2007, S. 379ff.
Gleich, Uli (2007): Nutzung und Funktion neuer Medien bei Kindern und Jugendlichen. In: Media Perspektiven 10/2007, S. 529ff.
Glotz, Peter (2001): Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation. In: Medienkompetenz. Wirtschaft. Wissen. Wandel. Hrsg. I. Hamm. Gütersloh 2001 S. 16-37.
Gorny, Peter (2004): Dozentenweiterbildung – Multimedia in der Lehre. Ein Kon-zept zur Verbesserung des E-Teaching: Flutlicht statt Leuchttürme. In: Medienkompetenz für die Hochschullehre. Hrsg. K. Bett. / J. Wedekind / P. Zentel. Münster, S. 85ff.
Graf-Szczuka, Karola (2006): Der kleine Unterschied. Eine Typologie jugendli-cher ZeitungsleserInnen und – NichtleserInnen. Dortmund.
Lese
probe

XVIII Literaturverzeichnis
Grimm, Rüdiger (2005): Digitale Kommunikation. München.
Gscheidle, Christoph / Fisch, Martin (2007): Onliner 2007: Das „Mitmach-Netz“ im Breitbandzeitalter. In: Media Perspektiven 08/2007, S. 393ff.
Gumpelmaier, Wolfgang (2011): Warum Crowdfunding kein schnelles Geld verspricht – Voraussetzungen für gelungenes Online-Fundraising. In: Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hg.) (2011): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.
Hamm, Ingrid (2001): Schule im Netz. In: Medienkompetenz. Wirtschaft. Wissen. Wandel. Hrsg. I. Hamm. Gütersloh 2001, S. 146ff.
Hartmann, Peter H. / Neuwöhner, Ulrich (1999): Lebensstilforschung und Publikumssegmentierung. Eine Darstellung der MedienNutzer Typologien (MNT). In: Media Perspektiven 10/1999, S. 531ff.
Hartmann, Sebastian (2011): neanderweb 2.0 – „Evolution“ als Konzept für das Neanderthal Museum im Social Web. In: Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hg.) (2011): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.
Heinrich, Jürgen / Schütte, Jan (2012): Medienwirtschaft. Studienbrief zu Pflichtmodul 200. Kaiserslautern.
Holtkamp, Lars (2002): E-Democracy in deutschen Kommunen – eine kritische Bestandsaufnahme. In: Technikfolgenabschätzung. Theorie und Praxis. Nr.3/4, 11. Jahrgang, S. 48ff. http://www.itas.fzk.de/tatup/023/holt02 a.htm; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Hüther, Jürgen / Podehl, Bernd (2005): Geschichte der Medienpädagogik. In: Grundbegriffe Medienpädagogik. 4. Auflage. Hrsg. J. Hüther / B. Schorb, München, S. 116ff. http://www.mediaculture-online.de; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Hunkirchen, Peter (2007): World Usability Day in Bonn. Artikel vom 16.10. 2007. [2011 nicht mehr online verfügbar]
Janner, Karin (2010): Kulturmarketing 2.0. In: Scheurer, Hans / Spiller, Ralf (Hg.) (2010): Kultur 2.0. Neue Web-Strategien für das Kulturmanagement im Zeitalter von Social Media. Bielefeld.
Janner, Karin (2011): Blog, Facebook, Twitter, YouTube – was soll ich nutzen? Orientierung im Dschungel der Tools. In: Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hg.) (2011): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.
Jöckel, Peter (1996): Medienkompetenz – was ist das? Notwendige Arbeit an einem Begriff In: Neue Deutsche Schule (NDS) 12/96. S. 16ff.
Lese
probe

Literaturverzeichnis XIX
JMStV: Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. http://www.bag-jugendschutz.de/ gesetze/ JMStV_April2005.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Jones, Tamara (2008): A Deadly Web of Deceit. A Teen’s Online ‚Friend‘ Proved False, And Cyber-Vigilantes Are Avenging Her. Washington Post, 10.01.2008. [2011 nicht mehr online verfügbar]
JuSchG: Jugendschutzgesetz. http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Kepplinger, Hans Mathias (1994): Wirkung von Gewaltdarstellungen in den Massenmedien. In: Fischer Lexikon Publizistik Massenkommunikation. Hrsg. E. Noelle-Neumann / W. Schulz / J. Wilke. Frankfurt. S. 571ff.
Kerres, M. / Jechle, Thomas (2000): Betreuung des mediengestützten Lernens in telemedialen Lernumgebungen. In: Unterrichtswissenschaft. Zeitschrift für Lehr-Lernforschung.
Kerres, Michael (2001): Multimediale und telemediale Lernumgebungen. Konzeption und Entwicklung. München.
KJM (2008): http://www.kjm-online.de/; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Klatt, Rüdiger / Gavriilidis, Konstantin / Kleinsimlinghaus, Kirsten / Feldman, Maresa u.a.(2001): Nutzung elektronischer wissenschaftlicher Informa-tion in der Hochschulausbildung. Barrieren und Potenziale der innova-tiven Mediennutzung im Lernalltag der Hochschulen. Kurzfassung. Dortmund. http://stefi.de/download/kurzfas.pdf; zuletzt aufgerufen am 09.02.2008.
Kleimann, Bernd / Weber, Steffen / Willige, Janka (2005): E-Learning aus Sicht der Studierenden. Hannover. https://hisbus.his.de/hisbus/docs/ HISBUS_E-Learning28.02.2005.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Kopf, Christine (o.J.): Der Schein der Neutralität. Institutionelle Filmzensur in der Weimarer Republik. http://www.deutsches-filminstitut.de/news/dt2n13.ht m; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Kopp, Axel (2011a): Ein Streifzug durch das Internet und dieses Buch. In: Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hg.) (2011): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.
Kopp, Axel (2011b): Facebook für Kulturbetriebe: From Zero to Hero. In: Ebenda.
Kreßner, Tino (2011): Finanzierung durch viele gemeinsam – Crowdfunding im Bereich Kunst und Kultur. In: Ebenda.
Kübler, Hans Dieter (1999): Medienkompetenz – Dimensionen eines Schlag-wortes. In: Medienkompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 25ff.
Lese
probe

XX Literaturverzeichnis
Kühlwetter, Karin (1998): Multimedia. Qualifikationen und Kompetenzen (= Graue Reihe – Neue Folge 143). Hans-Böckler-Stiftung. Düsseldorf.
Kunczik, Michael / Zipfel, Astrid (2004) : Medien und Gewalt. Befunde der Forschung seit 1998. Kurzfassung. www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/ redaktionbmfjfs/abteilung5/pdf-anlagen/kurzfassung-medien-und-gewalt; zuletzt aufgerufen am 10.03.2008.
Künzli, Arnold (1992): Vom Können des Sollens. Wie die Ethik unter den Zwängen der Ökonomie zur Narrenfreiheit verkommt. In: Medien-Ethik. Beschreibungen, Analysen, Konzepte für den deutschsprachigen Journalismus. Hrsg. M. Haller / H. Holzhey. Opladen.
Lachermeier, Johannes (2011): Zielsetzungen, Maßnahmen und Erfolgsmessung-en im Web 2.0: Strategisches Vorgehen am Beispiel der Bayerischen Staatsoper. In: Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hg.) (2011): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.
Lehmkuhl, Kirsten (1994): Das Konzept der Schlüsselqualifikationen in der Berufspädagogik. Eine ausreichende Antwort auf die Qualifizierungs-anforderungen der Massenproduktion? Alsbach / Bergstraße.
Luca, Renate / Aufenanger, Stefan (2007): Geschlechtersensible Medienkom-petenzförderung. Mediennutzung und Medienkompetenz von Mädchen und Jungen sowie medienpädagogische Handlungsmöglichkeiten. Schriftenreihe Medienforschung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf.
Lucht, Jens (2004): Der öffentlich-rechtliche Rundfunk: ein Auslaufmodell? Grundlagen, Analysen, Perspektiven. Freiburg (Breisgau).
Lütke-Entrup, Monika / Dusch, Christiane (2004): Die Qualifizierungsinitiative e-teaching@university: Maßgeschneiderte Medienberatung für Lehrende an Hochschulen. In: Medienkompetenz für die Hochschullehre. Hrsg. K. Bett / J. Wedekind / P. Zentel. Münster, S. 93ff.
Mai, Manfred (2002): Medienethik in der modernen Gesellschaft. Zum Verhältnis zwischen gesellschaftlicher Integration, Medienethik und Medien-kompetenz. In: Medienkompetenz – Kritik einer populären Universalkonstruktion. Forum Medienethik 01/2002.
Maletzke Gerhard (1998): Kommunikationswissenschaft im Überblick. Grund-lagen, Probleme, Perspektiven. Bonn.
Mandl, Heinz / Reinmann-Rothmeier, Gabi (1997): Medienpädagogik und –kompetenz: Was bedeutet das in einer Wissensgesellschaft und welche Lernkultur brauchen wir dafür? In: Medienkompetenz im Informations-zeitalter. Hrsg. Enquete-Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft; Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“/
Lese
probe

Literaturverzeichnis XXI
Deutscher Bundestag. Bonn. S. 77ff.
Mathes, Reiner / Donsbach, Wolfgang (2002): Runfunk. In: Fischer Lexikon Publizistik – Massenkommunikation. Hrsg. E. Noelle-Neumann / W. Schulz / J. Wilke. Franfurt am Main.
Media Perspektiven (2012): Basisdaten 2011. Daten zur Mediensituation in Deutschland. Frankfurt am Main.
Meier, Christian (2012): Am Scheideweg – Neue Strategien für das Verlagsgeschäft. In: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (Hg.): Zeitungen 2012/2013. Berlin. S. 27ff.
Mertens, Dieter (1974): Schlüsselqualifikationen. Thesen zur Schulung für eine moderne Gesellschaft. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Nr.1, Jg.7; S. 36ff.
Meyen, Michael (2001): Hauptsache Unterhaltung. Mediennutzung und Medienbewertung in Deutschland in den 50er Jahren. Münster.
Neuwöhner, Ulrich / Schäfer, Carmen (2007): Fernsehnutzung und MNT 2.0. In: Media Perspektiven, 05/2007, S. 242ff.
Noelle-Neumann, Elisabeth (1994): Wirkung der Massenmedien auf die Mei-nungsbildung. In: Fischer Lexikon Publizistik Massenkommunikation. Hrsg. E. Noelle-Neumann / W. Schulz / J. Wilke. Frankfurt. S. 518ff.
Nuissl, Ekkehard (1996): Vorbemerkungen. In: Medienkompetenz als Schlüs-selbegriff Hrsg. A. v. Rein. Bad Heilbrunn. S. 8.
Oehmichen, Ekkehardt (2007): Die neue MedienNutzerTypologie MNT 2.0. In: Media Perspektiven, 05/2007, S. 226ff.
Oehmichen, Ekkehardt / Schröter, Christian (2004): Die OnlineNutzerTypologie (ONT). In. Media Perspektiven, 08/ 2004. S. 386ff.
Oehmichen, Ekkehardt / Schröter, Christian (2007): Zur typologischen Struktur medienübergreifender Nutzungsmuster. In. Media Perspektiven, 08/2007. S. 406ff.
Palme, Hans-Jürgen / Basic, Natasa (2000): Medienkompetenz und Jugendschutz. In: Politische Studien. Zweimonatszeitschrift für Politik und Zeitge-schehen, Nr. 371, Jg. 51, 05/06/2000.
Pätzold, Ulrich / Röper, Horst (1992): Probleme des intermedialen Wettbewerbs im Lokalen. In: Media Perspektiven, 10/1992, S. 641ff.
Patalong, Frank (2006): You Tube: Nur falsch ist wirklich echt. Spiegel Online. http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,druck-436070,00.html; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Paus-Haase, Ingrid (1999): Medienrezeption und Medienaneignung von drei- bis zehnjährigen Kindern und daraus resultierende Ansatzpunkte für die För-derung von Medienkompetenz. In: Medienkompetenz: Grundlagen und
Lese
probe

XXII Literaturverzeichnis
pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 81ff.
Postman, Neil (1985): Wir amüsieren uns zu Tode. Amusing ourselves to death. Frankfurt/Main.
Prenzel, Manfred / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Blum, Werner / Hammann, Marcus / Klieme, Eckard / Pekrun, Reinhard (Hrsg.) (2007): Pisa Konsortium Deutschland. Die Ergebnisse der dritten internationalen Ver-gleichsstudie. http://pisa.ipn.uni-kiel.de/zusammenfassung_PISA2006.p df; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Puppis, Manuel (2007): Einführung in die Medienpolitik. Konstanz.
Pürer, Heinz (2003): Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Ein Hand-buch. Konstanz.
Pürer Heinz / Raabe, Johannes (2007): Presse in Deutschland. Konstanz.
Rager, Günther (1982): Publizistische Vielfalt im Lokalen. Tübingen.
Rager, Günther / Weber, Bernd (1992): Publizistische Vielfalt zwischen Markt und Politik. Eine Einführung. In: Publizistische Vielfalt zwischen Markt und Politik: Mehr Medien – Mehr Inhalte? Hrsg. G. Rager / B. Weber. Düsseldorf.
Rager, Günther / Werner, Petra (2004): Entwicklung und Struktur der Medien-gesellschaft. In: Lesesozialisation in der Mediengesellschaft. Ein For-schungsüberblick. Hrsg: N. Groeben / B. Hurrelmann. Weinhe im München, S. 351ff.
Ridder, Christa-Maria / Engel, Bernhard (2005): Massenkommunikation 2005: Images und Funktionen der Massenmedien im Vergleich. In: Media Perspektiven, 09/2005, S. 422ff.
Rosenstock, Roland (2005): Jugendschutz und Menschenwürde. Von der öffent-lichen Funktion der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF). In: Baum, Achim (Hrsg.) Handbuch Medienselbstkontrolle. Wiesbaden.
Scheele, Brigitte (1999). Theoriehistorische Kontinuität: Lernen von Aggression oder Möglichkeiten zur Katharsis?! In: N. Groeben (Hrsg.), Zur Programmatik einer sozialwissenschaftlichen Psychologie. Band I: Metatheoretische Perspektiven. 2. Halbband: Theoriehistorie, Praxisre-levanz, Interdisziplinarität, Methodenintegration. Münster: Aschendorff, S. 1-83.
Schell, Fred / Warkus Hartmut (1999): Medienkompetenz der Lehrerinnen und Lehrer: Schulische Bedingungen an Aus- und Fortbildung. In: Medien-kompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 282ff.
Schell Jugendstudie 2010 unter: http://www.shell.de/home/content/deu/aboutshell/
Lese
probe

Literaturverzeichnis XXIII
our_commitment/shell_youth_study/2010/ (Dez. 2012)
Schorb, Bernd (1999): Die Lernorte und die erwerbbaren Fähigkeiten, mit Medien kompetent umzugehen. In: Medienkompetenz: Grundlagen und päda-gogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. Mün-chen, S. 390ff.
Schreier, Magrit (2002): Verfahren der Rezeptions- und Wirkungsanalyse. In: Einführung in die Medienwissenschaft. Konzeption, Theorien, Methoden, Anwendungen. Hrsg. G. Rusch. Wiesbaden.
Schreier, Margrit / Rupp, Gerhard (2002): Ziele/Funktionen der Lesekompetenz im medialen Umbruch. In: Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen. Hrsg. N. Groeben / B. Hurrelmann. Weinheim, München, S. 251ff.
Schulen ans Netz e.V. (2006): Nach zehn Jahren Schulen ans Netz ist Internet im Klassenzimmer Standard. Pressemitteilung vom 16.10.2006; www.schulen-ans-netz.de/presse/pressemitteilungen/379.php; zuletzt aufgerufen am 06.01.2008.
Schulz, Winfried (2002): Nachrichten. In: Fischer Lexikon Publizistik – Mas-senkommunikation. Hrsg. E. Noelle-Neumann / W. Schulz / J. Wilke. Franfurt am Main.
Schütz, Walter J. (2002): Pressewirtschaft. In: Fischer Lexikon Publizistik – Massenkommunikation. Hrsg. E. Noelle-Neumann / W. Schulz / J. Wilke. Franfurt am Main.
Schwenke, Thomas (2012): Erlaubt/Verboten – Social-Media-Recht für Verlage. In: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (Hg.): Zeitungen 2012/2013. Berlin. S. 217ff.
Schwiesau, Dietz / Ohler, Josef (2003): Die Nachricht in Presse, Radio, Fernsehen und Internet. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis.
Scott, David Meerman (2012): Die neuen Marketing- und PR-Regeln im Social Web. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.
Seefeldt, Katja (2001): Abhauen können Sie woanders: Der deutsche Strafvollzug und das Internet. In: Telepolis 31. Mai 2001.
Sinus Sociovision (2007): Die Sinus-Millieus in Deutschland 2007. www.sinus-sociovision.de; zuletzt aufgerufen am 07.03.2008.
Sohn, Melanie (2005): Erfolgsfaktor Medienkompetenz: Ein modularisiertes Rahmenmodell von Medienkompetenz für Unternehmenspraxis und Theorie. Unveröffentlichte Dissertation, Universität Bielefeld. www.bieson.ub.uni-bielefeld.de/volltexte/2005/750/html/ dissertation.pdf; zuletzt aufgerufen am 09.02.2008.
Spanhel, Dieter (1999): Förderung von Medienkompetenz im Handlungsfeld
Lese
probe

XXIV Literaturverzeichnis
Schule – Bedingungen, Möglichkeiten, konkrete Beiträge. In: Medien-kompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 159ff.
Stapf, Ingrid (2005): Medienselbstkontrolle. Eine Einführung. In: Handbuch Medienselbstkontrolle. Hrsg. A. Baum. Wiesbaden.
Stapf, Ingrid (2006): Medien-Selbstkontrolle. Ethik und Institutionalisierung. Konstanz.
Stuiber, Heinz-Werner (1998): Medien in Deutschland. Rundfunk, Teil 2. Konstanz..
Surfen ohne Risiko (2007): Publikation des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Unter: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kin der-und-jugend,did=167740.html; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Taubert, Jan-Hendrik (2004): Bundeskompetenz für Jugendschutz? Verfassungsrechtliche Rechtfertigung und rechtspolitischer Sinn der Zuordnung. Berlin.
Theunert, Helga (1996): Perspektiven der Medienpädagogik in der Multimedia-Welt. In: Medienkompetenz als Schlüsselbegriff Hrsg. A. v. Rein. Bad Heilbrunn, S. 60ff.
Theunert, Helga / Lenssen, Margrit (1999): Medienkompetenz im Vor- und Grundschulalter: Altersspezifische Voraussetzungen, Ansatzpunkte und Handlungsoptionen. In: Medienkompetenz: Grundlagen und pädago-gisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 60ff.
Thomas, Hans (1994): Was scheidet Unterhaltung von Information. In: Medienlust und Mediennutz. Unterhaltung als öffentliche Kommunika-tion. Hrsg. L. Bosshart / W. Hoffmann-Riem. München.
Thomaß, Barbara (2007): Mediensysteme vergleichen. In: Mediensystem im internationalen Vergleich. Hrsg. B. Thomaß. Konstanz.
Trénel, Matthias/ Märker, Oliver / Hagedorn, Hans (2001): Bürgerbeteiligung im Internet. Das Esslinger Fallbeispiel. WZB discussion papers, FS II 01-3008, http://bibliothek.wzb.eu/pdf/2001/ii01-308.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Tulodziecki, Gerhard (1998): Medienkompetenz als Ziel schulischer Medien-kompetenz. In: Arbeiten + Lernen. 7, Heft 30. S. 13ff.
Tulodziecki, Gerhard (2005): Medienpädagogik in der Krise? In: Perspektiven der Medienpädagogik in Wissenschaft und Bildungspraxis. Hrsg. H. Keller. München, S. 22ff. http://www.mediaculture-online.de/fileadmin/ bibliothek/tulodziecki_krise/tulodziecki_krise.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Lese
probe

Literaturverzeichnis XXV
Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ): Der deutsche Zeitschriftenmarkt. Branchendaten 2006; http://www.vdz.de/branchendaten-digitale-medien/; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.
Vogelgesang, Waldemar (1999): Kompetentes und selbstbestimmtes Medien-handeln in Jugendszenen. In: Medienkompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S.237ff.
Vorderer, Peter / Schramm, Holger (2002): Medienrezeption. In: Einführung in die Medienwissenschaft. Konzeption, Theorien, Methoden, Anwen-dungen. Hrsg. G. Rusch. Wiesbaden.
Weischenberg, Siegfried (1992): Journalistik. Medienkommunikation: Theorie und Praxis. Opladen.
Weischenberg, Siegfried (2001): Nachrichten-Journalismus. Anleitung und Qualitäts-Standards für die Medien-Praxis. Wiesbaden.
Zarrella, Dan (2012): Das Social Media Marketing Buch. Köln.
Zillmann, Dolf (1994): Über behagende Unterhaltung in unbehagender Medien-kultur. In: Medienlust und Mediennutz. Unterhaltung als öffentliche Kommunikation. Hrsg. L. Bosshart / W. Hoffmann-Riem. München.
Lese
probe

XXVI Lernziele
Lernziele
Dieser Studienbrief gliedert sich in zwei Teile:
Im ersten Teil geht es um die wissenschaftliche Herleitung und die Bedeutung von Medienkompetenz.
Es folgt ein Praxisteil, der „Social Media“ als Handlungsfeld für Kultur- und Non-Profit-Organisationen darstellt – und deutlich macht, welche zusätzlichen Aspekte der Medienkompetenz nötig sind, um sich effektiv in sozialen Netzwerken zu bewegen.
Medienkompetenz ist ein viel benutzter und facettenreicher Begriff. Daher ist ein wichtiger Teil des Studienbriefes unterschiedlichen Interpretationen dieses Be-griffs und dessen historischer Entwicklung gewidmet. Gemeinsam ist den vonei-nander abweichenden Vorstellungen von Medienkompetenz, dass Sachwissen über das Mediensystem vorausgesetzt wird. Der Studienbrief beginnt deshalb mit einer knappen Darstellung des Mediensystems der Bundesrepublik.
Verschiedene Sichtweisen, welche Bedeutung die Medienkompetenz für die indi-viduelle Entwicklung und die gesellschaftliche Teilhabe hat, werden vorgestellt. Die Autoren dieses Studienbriefs betrachten Medienkompetenz als eine Schlüs-selqualifikation, ohne die beruflicher und gesellschaftlicher Erfolg kaum noch vorstellbar ist. Daher wird die grundsätzliche Bedeutung der Medienkompetenz in unterschiedlichen Arbeitsfeldern und Entwicklungsphasen dargestellt.
Das Kapitel Medienkompetenz und Ethik bietet Ansatzpunkte, um sich mit Fra-gen von Medienethik und ihrer praktischen Umsetzung zu beschäftigen. Ebenfalls zum Grundwissen über Medienkompetenz gehört die Beschreibung des Einflusses der rechtlichen Grundlagen des Jugendschutzes auf die Produktion und Rezeption von Medien.
Im „Praxisteil Social Media“ wird zunächst die wachsende Bedeutung sozialer Netzwerke für Kultur- und Non-Profit-Organisationen dargestellt. Anschließend werden Gefahren und Chancen bei der Nutzung der Netzwerke aufgezeigt. Ein-zelne Portale werden beschrieben und Ansätze für Social-Media-Strategien entwi-ckelt. Anhand positiver und negativer Beispiele wird verdeutlicht, welche Fragen sich stellen muss, wer heute online erfolgreich sein will. Außerdem werden die neuen Möglichkeiten beschrieben, die durch technische Entwicklungen, wie die zunehmende Verbreitung von Smartphones, entstehen.
Studierende sollen nach der Beschäftigung mit dem Studienbrief über ein umfas-sendes Medienkompetenz-Grundwissen verfügen und befähigt sein, eigenständig Ideen und Konzepte für Kultur- und Non-Profit-Organisationen im Web 2.0 zu entwickeln. Sie sollen „Medienkompetenz 2.0“ entwickeln und für die Notwen-digkeit lebenslänglichen Lernens in diesem Bereich sensibilisiert sein.
Lese
probe

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 1
1 Bedeutung der Medien
Lerninhalte
Kenntnisse über den Medienbegriff
gesellschaftliche Funktion von Medien
Überblick über Massenmedien und ihre Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik
Verständnis dafür, wie etwas zur Nachricht wird
Übersicht über die Mediennutzung, speziell von kulturorientierten Gruppen
wichtige Wirkungstheorien
Medien begegnen uns täglich und zunehmend ununterbrochen: die Zeitung auf dem Frühstückstisch, der Infoscreen an der U-Bahn-Haltestelle, die E-Mail im Büro oder das Radio als Hintergrundgedudel. Auch das Buch, der Kinofilm und die mp3-Datei zählen zu den Medien. Selbstverständlich genauso Internet und Fernseher. Für Plattformen wie Facebook entstand eigens der Begriff „Social Me-dia“, um sie wird es im zweiten Teil dieses Studienbriefes gehen. Die Vielzahl der Medien und ihre Inhalte gemäß den eigenen Zielen und Bedürfnissen effektiv nut-zen zu können, macht für den Erziehungswissenschaftler Dieter Baacke Medien-kompetenz aus (Vgl. Kapitel 2 Medienkompetenzkonzepte). Aber bleiben wir zu-nächst beim ersten Teil des Wortes, bei den Medien.
Dem Lateinischen entnommen, bedeutet „medium“ zunächst nichts weiter als „Mitte“ oder auch „Vermittler“. In seinem heutigen Verständnis ist der Begriff Medien noch recht jung. Erst seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts verzeich-nen einzelne Lexika den Medienbegriff im Sinne von Kommunikationsmedien (vgl. Kübler 2003: 78). Der Begründer der Systemtheorie, Talcott Parsons, spricht Mitte des 20. Jahrhunderts noch recht allgemein von einem „generellen Aus-tauschmittel“. Nach dieser Definition konnte auch das Telefonkabel als Übertra-gungsmittel zu den Medien gezählt werden.
Hans J. Kleinsteuber wird präziser: Nach seiner Definition bezeichnen Medien den Teil technischer Verbreitungsmittel für Informationen, der sich mit seinen Aussagen an eine breite Öffentlichkeit richtet, also an eine Empfängerschaft, die prinzipiell nicht begrenzt oder personell definiert ist. Seine an der Kommu-nikationstechnik orientierte Definition umfasst demnach neben Fernsehapparaten, Radiogeräten und Zeitungen beispielsweise auch CDs, Bücher, Plakate und Flyer (vgl. Beierwaltes 2000: 10). Er kommt damit dem später geprägten Begriff Mas-senmedien recht nahe, beschränkt sich jedoch auf die Technik und das Medium der Verbreitung und klammert mediale Inhalte aus.
Ursprung des Medienbegriffs
Ziel: eine breite Öffentlichkeit
Lese
probe

2 Kapitel 1: Bedeutung der Medien
Bislang wurde noch keine ausreichend theoriefähige Definition eines universalen Medienbegriffs gefunden, unter dem sich die Wissenschaft vereinen kann (vgl. Altmeppen 2006: 135f.).
„Wenn von Medien die Rede ist, scheint (jedoch) im öffentlichen Bewusstsein eine selbstverständliche Einvernehmlichkeit zu herrschen. In erster Linie werden Mas-senmedien assoziiert, Zeitungen und Zeitschriften, Hörfunk und Fernsehen“ (ebd.).
Der Begriff Massenmedien beschreibt nicht nur die Geräte, die für die Übermitt-lung benötigt werden, sondern auch die Inhalte, die sie übermitteln und die Orga-nisationen, die als Produzent und Übermittler auftreten (vgl. Kübler 2003: 107; Thomaß 2007: 17). Er leitet sich von dem Begriff der Massenkommunikation ab, der 1963 von Gerhard Maletzke definiert wurde.
Ein wichtiges Merkmal für die Abgrenzung von Massen- und Individualkommu-nikation ist die Anzahl der Empfänger. Während sich die Massenkommunikation in der Regel einseitig an eine Vielzahl (Masse) von Empfängern richtet (z.B. mit-tels Fernsehen, Hörfunk oder Büchern), ist die Individualkommunikation für ei-nen eng begrenzten Personenkreis bestimmt und verläuft nicht einseitig. Sender und Empfänger wechseln ihre Position (z.B. beim Telefonieren, beim E-Mail- und Briefverkehr). Allerdings sind Konvergenzen zwischen den beiden Kommunikati-onsformen erkennbar:
„Die Massenmedien aktivieren Teilnehmer in zunehmendem Maße, etwa über Le-serbriefe, Telefonabfragen und in Live-Beteiligungen […] die Individualkommu-nikation wird umgekehrt mehr und mehr zur Versendung von Massenpost verwen-det, im Internet auch als Spam-Pest erlitten“ (Grimm 2005: 85).
Gerade im sogenannten „Web 2.0“, das im zweiten Teil dieses Studienbriefes aus-führlicher behandelt wird, mischen sich Massen- und Individualkommunikation immer stärker. Eine Plattform wie „Facebook“ kann Medium der Individualkom-munikation sein – bei einer entsprechend großen Anhängerschaft aber auch zum Forum der Massenkommunikation werden. Empfänger können zu Sendern wer-den, die ursprünglichen Sender dann zu Empfängern. Auch klassische Medien re-agieren auf diese Entwicklungen, in dem sie versuchen, sich immer stärker für die offene Online-Kommunikation zwischen Sendern und Empfängern zu öffnen (vgl. Ellers 2012: 195ff.).
Die Annäherung der Kommunikationsarten macht es erforderlich, Massenkom-munikation durch öffentliche Zugänglichkeit von Individualkommunikation abzu-grenzen. Letztere unterliegt grundsätzlich der Beschränkung, sich an explizit adressierte Teilnehmer zu richten. Produkte der Massenkommunikation hingegen sind potenziell jedem zugänglich (vgl. ebd. 86f.). Massenkommunikation ist nach Maletzke eine Art der Kommunikation, „bei der Aussagen öffentlich, durch tech-
Massenmedien
Individual- und Massenkom-munikation
„Mischkommunika-tion“ im Web 2.0 Le
sepro
be

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 3
nische Verbreitungsmittel, indirekt und einseitig an ein disperses Publikum ver-mittelt werden“ (vgl. Maletzke 1998: 46).
Massenkommunikation Individualkommunikation
öffentlich:
keine begrenzte und personell defi-nierte Empfängerschaft; „für jeden be-stimmt“
nicht-öffentlich:
begrenzte und personell definierte Empfängerschaft
technische Verbreitungsmittel:
Kommunikation über beliebige techni-sche Medien, Geräte und Zubehör
technische Verbreitungsmittel:
nicht notwendig
einseitig:
ohne Rollenwechsel zwischen Sender und Empfänger; Verbreitung der Aus-sage nur in eine Richtung: vom Sender zum Empfänger
zweiseitig:
Rollenwechsel zwischen Sender und Empfänger; Möglichkeit der „Rede und Gegenrede“
disperses Publikum:
gemeinsame Zuwendung mehrerer / vieler Menschen zu der Aussage
personell definierte Rezipienten:
Zuwendung des personell definierten Rezipienten
Tab. 1: Unterschiede zwischen Massen- und Individualkommunikation (nach Maletzke 1998)
Im Folgenden gehen wir zunächst nur auf die periodisch erscheinenden Massen-medien Zeitungen und Zeitschriften, sowie auf die elektronischen Medien Hör-funk, Fernsehen und Internet ein.
Einen Überblick über die unterschiedlichen Definitionsansätze des Medienbegriffs geben beispielsweise Gerhard Maletzke 1998: 50ff., Hans-Dieter Kübler 2003: 102ff. und Klaus-Dieter Altmeppen 2006: 135ff.
Die Printmedien und der Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen) sind traditionell sehr stark in den Alltag der Menschen eingebunden. In einer Studie aus dem Jahr 2006 beispielsweise gaben 95 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren an, mehrmals wö-chentlich das Fernsehen zu nutzen, gefolgt vom Hörfunk mit 86 Prozent und der Tageszeitung mit 75 Prozent (vgl. Blödorn / Gerhards / Klingler 2006: 631). Auch heute sind Printmedien und Rundfunk noch immer stark in den Alltag eingebun-den, sie verlieren aber zunehmend an Relevanz gegenüber dem Internet. Oder an-dersherum formuliert: Ihnen erwächst im Internet ein immer stärkerer Aufmerk-samkeitskonkurrent, der Rezeptionsgewohnheiten ändert. Eine ausführliche Zu-sammenstellung aktueller Zahlen bieten Heinrich/Schütte in dem Studienbrief MKN0230 „Medienwirtschaft“ (2012: 109ff), sie sollen deshalb in diesem Studi-enbrief nicht ausführlich wiederholt werden.
Printmedien und Rundfunk traditionell sehr im Alltag eingebunden
Lese
probe

4 Kapitel 1: Bedeutung der Medien
Wichtig ist: Die traditionellen Medien bleiben relevant und in der gesellschaft-lichen, politischen und kulturellen Auseinandersetzung bedeutend. Vielfach machen sie jedoch Transformationsprozesse durch – hin zu Kommunikationsun-ternehmen die neben einem Print-Angebot auch online, in sozialen Netzwerken und mit Apps auf Tablet-Computern und Smartphones präsent sind (vgl. Meier 2012: 27ff.). Medienkompetenz und effektive Medienarbeit ohne Social-Media-Kenntnisse sind heute nicht mehr denkbar – weshalb der Praxisteil dieses Studienbriefs sich den sozialen Netzwerken widmet. Dort werden auch die aktuellen Internet-Nutzungszahlen genauer behandelt. Sie sind in den vergangenen Jahren explodiert: Laut ARD/ZDF-Onlinestudie sind 2012 schon 75,9 Prozent der Deutschen (53,4 Millionen) online. Das bedeutet nahezu eine Verdreifachung in den vergangenen zwölf Jahren. Mittlerweile sind auch immer mehr Menschen über 50 Jahren online – die Quote wächst dort mit dem Alter der ans Internet gewöhnten User. Junge Menschen haben ohnehin zu nahezu 100 Prozent einen eigenen Internetanschluss (vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2012).
Medienwissenschaftlich handelt es sich, wie erwähnt, bei der Internetkommu-nikation um eine Hybridform zwischen Massen- und Individualkommunika-tion. Ein Video-Blog auf Youtube richtet sich beispielsweise an einen nicht personell definierten Personenkreis und kann als Massenkommunikation bezeichnet werden. Die E-Mail hingegen ist in der Regel lediglich für die Augen eines bestimmten Empfängers bestimmt. Hierbei handelt es sich also um Individualkommunikation.
1.1 Funktionen der Massenmedien
Was motiviert einen Großteil der Bevölkerung nahezu täglich die klassischen Massenmedien zu nutzen und zusätzlich einen großen Teil des Tages über online zu sein? Sicherlich geht es um Informationen, um das Wissen, was auf der Welt, im Land oder in der eigenen Stadt passiert. Mehr noch geht es aber um Unterhal-tung, um Ausspannen und Erholen.
„Tendenziell nimmt die Information ab, macht der Unterhaltung Platz und findet schließlich in ihr Unterschlupf: Information bleibt interessant, soweit sie unter-haltsam ist“ (Thomas 1994: 61).
Thomas äußert hier eine eher kritische Position gegenüber Unterhaltung in den Massenmedien. Diese Grundskepsis findet sich heute vielfach auch in der Kritik an sozialen Medien wie Facebook und Twitter wieder. Sie begründet sich in der traditionellen Auffassung dessen, was die Aufgaben und Funktionen der Massen-medien sind. Diese werden unterschiedlich differenziert dargestellt, stets wird ihnen jedoch eine große Bedeutung für die gesellschaftliche und persönliche Ent-wicklung beigemessen. Und dabei geht es nicht primär um Unterhaltung.
Transformationsprozesse hin zu Kommuni-kationsunternehmen
Hybridform Internet
Gründe der Mediennutzung
Funktionen der Massenmedien
Lese
probe

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 5
Der Publizist Hermann Meyn schreibt den Massenmedien fünf Funktionen zu. Entscheidend sind für ihn die so genannten politischen oder auch gesellschaftli-chen Aufgaben der Massenmedien: Information, Mitwirkung an der Meinungsbil-dung sowie Kontrolle und Kritik. Darüber hinaus nennt er die Funktionen Unter-haltung und Bildung (vgl. Meyn 2004: 24). Hans-Dieter Kübler fügt seiner etwas längeren Liste von Funktionen beispielsweise das Vermitteln der Wirklichkeit und die soziale und kulturelle Integration, aber auch die Sozialisation des Individuums hinzu (vgl. Kübler 2003: 136).
Die Information, also die Ver- und Übermittlung meist aktueller und gesellschaft-lich relevanter Ereignisse, gilt in der Medienwissenschaft als die wichtigste Auf-gabe der Massenmedien. „Sie ist ein unverzichtbares Instrument, um unabhängig von staatlichen Einflüssen Öffentlichkeit über alle bedeutenden Vorgänge in Poli-tik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur herzustellen“ (Pürer / Raabe 2007: 332) und bildet die Grundlage aller übrigen gesellschaftspolitischen Funktionen. Auf-grund dieser fundamentalen Bedeutung lassen sich an die Art der Informationen gewisse Qualitätsansprüche stellen, die als Orientierungsrahmen dienen sollen. Dabei handelt es sich um Vollständigkeit, Objektivität und Verständlichkeit. Nur unter Berücksichtigung dieser Standards lassen sich die politischen Aufgabenbe-reiche nach Hermann Meyn verwirklichen: Die Mitwirkung an der Willensbildung sowie die Kontrolle und Kritik. Mitwirkung an der Willensbildung bedeutet für die Massenmedien, einen Beitrag zur Fähigkeit des Einzelnen zu leisten, politi-sche Informationen aufzunehmen und zu verstehen, die ihn zur eigenen politi-schen Meinungs- und Urteilsbildung befähigen (vgl. Pürer / Raabe 2007: 378f.). Sie sollen der Legislative, der Exekutive sowie der Judikative auf die Finger schauen, ihr Handeln kontrollieren und gegebenenfalls Kritik an Missständen üben. Dabei ist das Öffentlichmachen wichtiger als die reine Verbreitung von Kri-tik- und Kontrollbeiträgen Dritter (vgl. Kübler 2007, 152f; Branahl 2002).
Gerade in diesem Bereich hat das Internet und haben soziale Medien, bei aller häufig geäußerten Kritik am Unterhaltungsfokus, große neue Möglichkeiten ge-schaffen. Portale wie etwa Wikileaks fördern Transparenz, aber auch jeder einzel-ne hat mehr Möglichkeiten, auf Probleme und Missstände hinzuweisen, als je zu-vor. Dies macht das Internet tatsächlich zu einem potenziellen Medium der De-mokratisierung, wie es z.B. aktuell in China zu beobachten ist, wo die herrschende Partei sich immer schwerer gegen Informationen im Netz verteidigen kann. „Ist China auf dem Weg zu einer Cyberdemokratie?“ fragte beispielsweise die „Zeit“ (www.zeit.de/digital/internet/2011-08/china-internet-demokratie im Dez. 2012).
Neben den Erwartungen einer Gesellschaft an die Massenmedien benennt Denis McQuail auch Bedürfnisse des Einzelnen gegenüber selbigen. Dazu zählen das Bedürfnis nach Information und das Bedürfnis nach persönlicher Identität, nach Integration und – zwar zuletzt genannt, aber von nicht zu unterschätzender Bedeu-tung – das Bedürfnis nach Unterhaltung (vgl. Pürer / Raabe 2007: 379). Neuere Studien bestätigen, dass die Deutschen sich zwar mit Hilfe der Massenmedien in-
Information
Neue Chancen durch neue Medien
Bedürfnisse Einzelner gegenüber Massenme-dien
Lese
probe

6 Kapitel 1: Bedeutung der Medien
formieren möchten, gleichzeitig aber gerade die elektronischen Medien nutzen, um dabei zu entspannen oder den Alltag zu vergessen (vgl. Ridder / Engel 2005: 422; siehe auch Kapitel 1.3 Mediennutzung). Doch je mehr die Massenmedien dieses Bedürfnis befriedigen, desto kritischer werden sie betrachtet:
„Je mehr Medien sich verbreiten, ihre Angebote diversifizieren und insgesamt den Alltag durchsetzen, je mehr Kommerz und Werbung Resonanz und Inhalte be-stimmen, je mehr Tätigkeiten und Entspannungen medial geprägt […] werden, je mehr Online-Medien die traditionellen Massenmedien substituieren, […] desto mehr scheinen die unterhaltenden Funktionen und Ausrichtungen der Medien überhand zu nehmen; desto mehr verbreiten und verdichten sich die Eindrücke und Urteile, Medien dienen nur noch der puren, mehr oder weniger einfallslosen Unterhaltung und übertönen buchstäblich alle anderen Funktionen […]“ (Kübler 2003: 157).
Der amerikanische Medienkritiker Neil Postman veröffentlichte bereits 1985 sein Buch mit dem provozierenden Titel „Wir amüsieren uns zu Tode“, da war das In-ternet noch kaum erfunden. Auch andere Medienwissenschaftler kritisieren, dass selbst Nachrichten mittlerweile ein gefälligeres, leicht verdauliches Outfit be-kommen. Seriöse Meldungen werden mit nebensächlichen und unterhaltsamen Begebenheiten vermischt. Postman bezeichnet dies als „Infotainment“ (vgl. Küb-ler 2003; Postman 1985). Dolf Zillmann zeigt die Schranken derartiger Medien-kritik auf und verweist auf eine mitunter schizophren anmutende Argumentation: Einerseits werde den unterhaltenden Massenmedien vorgeworfen, ästhetisch man-gelhafte Ware zu produzieren, andererseits solle die Wahlfreiheit des Rezipienten unangetastet bleiben. Dieser könne beispielsweise beim Fernsehen mit einem ein-fachen Knopfdruck auf der Fernbedienung das Programm wechseln – egal ob er sich nun schlecht informiert oder schlecht unterhalten fühle (vgl. Zillmann 1994: 42).
Wenn die Medien bei den Rezipienten sowohl kognitive als auch affektive Be-dürfnisse bedienen, können sie diese auch auf beiden Ebenen beeinflussen. Mo-dernen Medienwirkungstheorien zufolge (vgl. Kapitel 1.4 Medienwirkungstheo-rien) sind es aber nicht nur die Medien, die Einfluss auf ihre Nutzer nehmen. Auch die Rezipienten können, etwa durch ihr Nutzungsverhalten, Einfluss auf die Macher und die Inhalte von Medien nehmen und sie langfristig verändern. Diese Möglichkeit ist durch neue interaktive Medien und soziale Netzwerke mehr denn je gegeben.
Die Kenntnis dieser Möglichkeiten, ebenso wie Wissen über Entstehungsprozesse von Medieninhalten und -angeboten sowie die rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen von Medien werden in allen Medienkompetenz-konzepten als wichtige Voraussetzung gesehen. Groeben nennt Medienwissen so-gar an erster Stelle bei der Entwicklung von Medienkompetenz (s. Kapitel 2 Me-
Unterhaltung
Rezipienten können Einfluss nehmen Le
sepro
be

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 7
dienkompetenzkonzepte). Im Folgenden soll ein Abriss über das System der Mas-senmedien und ihre Nutzung gegeben werden.
Erklärungen zu den Aufgaben der Massenmedien geben beispielsweise Hans-Dieter Kübler 2003: 135ff. und Heinz Pürer / Johannes Raabe 2007: 376ff.
1.2 Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland
Die Massenmedien sind nicht nur technische Artefakte zur Übermittlung von In-formationen und Unterhaltung, sondern gleichfalls Organisationen, „die auf viel-fältige Weise in ökonomische, politische, soziale und kulturelle Gegebenheiten eingebunden sind und auch auf diese einwirken“ (Thomaß 2007: 17). Bei der Be-trachtung des Zusammenspiels und der Organisation der Massenmedien in Deutschland wird in der Literatur häufig vom „Mediensystem“ gesprochen, wobei die Autoren in ihren Betrachtungen den Begriff unterschiedlich weit ausdehnen (vgl. Pürer / Rabe 2007; Thomaß 2007; Heinrich 2001; Weischenberg 1992). Die ökonomischen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Massenme-dien in Deutschland werden im Folgenden dargestellt.
Die Pressefreiheit ist ein wichtiges Grundrecht unseres Landes. Nach Artikel 5 des Grundgesetzes hat jeder „das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen un-gehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ Jeder Bürger könnte demnach eine Zeitung oder eine Zeitschrift herausgeben oder Radio- und Fernsehprogramme produzieren. In der Realität gestaltet sich das komplizierter. Sowohl auf dem Zeitungs- als auch auf dem Rundfunkmarkt gibt es erhebliche Marktzutrittsbarrieren, die sich in erster Linie durch hohe Investitions-kosten und im Rundfunkbereich auch durch mangelnde Frequenzen äußern (vgl. Heinrich 2001: 59ff.).
Mit den Möglichkeiten des Web 2.0 sind jedoch tatsächlich immer mehr von Nut-zern erstellte Medien-Angebote im Internet entstanden. Die Blogs, Videos, Homepages, freien Internet-Radiosender, Facebook- und Twitter-Seiten machen das Medienangebot unübersichtlicher – bereichern es aber auch um neue Themen und Facetten. Blogs und Co. erleichtern es Bürgern ungemein, tatsächlich von ih-rem Grundrecht auf Meinungsäußerung in Wort und Bild gebrauch zu machen – und wer dabei originelle Wege geht und relevante Themen wählt, hat sogar die Chance, tatsächlich Leser zu finden.
Trotz der oftmals als „Zeitungskrise“ beschriebenen Umwandlungsprozesse hin zu digitalen Medien, hat die Bundesrepublik auf den ersten Blick weiterhin auch bei den traditionellen Medien ein vielfältiges Angebot. 2012 gab es, wie schon in den Jahren zuvor, weiter knapp über 1500 Zeitungstitel. Diese Zahl ist seit der Jahrtausendwende nahezu konstant (vgl. BDZV 2012: 409). Dazu kommen 55 öf-
Pressefreiheit
Vielfalt des Medien-angebots
Lese
probe

8 Kapitel 1: Bedeutung der Medien
fentlich-rechtliche und 241 private Radio-Programme sowie 16 öffentlich-rechtliche und 129 private Fernseh-Programm (Stand 2011, vgl. Heinrich/Schütte 2012: 122 u. 126). Auch online werden die traditionellen Medienmarken immer aktiver, so stieg beispielsweise die E-Paper-Auflage der deutschen Zeitungsverla-ge insgesamt von 21.121 im Jahr 2005 auf 196.740 im Jahr 2012 (BDZV 2012: 416). Zahlen allein reichen aber nicht aus, um das Mediensystem zu verstehen. Werfen wir zuerst einen Blick auf den Markt der Printmedien.
1.3 Printmedien (Zeitungen und Zeitschriften) – Doppelcharakter der Zeitung
Der Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt ist in Deutschland privatwirtschaftlich or-ganisiert, das heißt Zeitungen und Zeitschriften werden von einem oder mehreren Verlagen oder großen Medienkonzernen herausgegeben. Sie zielen auf Gewinne bzw. Rentabilität ab (vgl. Pürer / Raabe 2007: 271). Hermann Meyn erkennt darin einen Doppelcharakter der Zeitung. Sie hat – wie die periodisch erscheinenden Massenmedien im Allgemeinen – eine gesellschafts-politische Aufgabe, die in den Pressegesetzen verankert ist. Das Unternehmen (der Verlag) verfolgt mit ihr jedoch gleichzeitig wirtschaftliche Ziele (vgl. Meyn 2004: 76). Das Produkt Zei-tung oder Zeitschrift wird (wie die übrigen Massenmedien auch) für zwei Märkte produziert – den Markt der Leser und den der Anzeigenkunden. Beide Märkte ste-hen in einer engen Wechselbeziehung zueinander.
„Eine große Zahl von Lesern bzw. ein spezifischer Leserkreis ist Voraussetzung für hohe Anzeigenerlöse, da der Anzeigenpreis weitgehend von der allgemeinen oder spezifischen Reichweite des Presseorgans abhängig ist; ein großes Anzei-genaufkommen ermöglicht niedrige Bezugspreise bzw. ein verbessertes redaktio-nelles Angebot, so dass dadurch wiederum zusätzliche Leser angezogen werden können“ (Schütz 2002: 493 und vgl. Heinrich 2007: 43f. u. 129f.).
In diesem Zusammenhang wird von der Anzeigen-Auflagen-Spirale gesprochen (vgl. Pürer / Raabe 2007: 296).
Zahlreiche Zeitungen produzieren nur den Lokalteil selbst und übernehmen den überregionalen Teil, den so genannten Mantel einer Zeitung, also die ersten Sei-ten, meist Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport, aber auch Beilagen und Themen-seiten, von einer Verlagsgemeinschaft oder einem anderen Anbieter. Dieser Ver-zicht auf eine eigene, für alle Sparten arbeitende Redaktion ist die wichtigste und häufigste Maßnahme, die redaktionellen Kosten zu senken. Der Vorteil einer Ver-lagsgemeinschaft: Nicht ein Verlag allein trägt die wirtschaftliche Verantwortung für die überregionale Berichterstattung, z.B. die Kosten für Nachrichtenagenturen und Korrespondenten. Verlagsgemeinschaften oder der Kauf eines fremden Man-telteils verringern darüber hinaus (vorerst) nicht das örtliche Zeitungsangebot (Zeitungsdichte). Daneben können Verlage weitere wirtschaftliche Kooperationen
Doppelcharakter der Zeitung
Verlagsgemein-schaften
Lese
probe

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 9
eingehen, z.B. durch ein gemeinsames Druckhaus und/oder einen gemeinsamen Vertrieb und/oder den gemeinsamen Anzeigenverkauf (vgl. Schütz 2002: 512f.).
Zur Beschreibung des Zeitungsmarkts benützt man den Begriff publizistische Einheiten. Als publizistische Einheiten bezeichnet man Zeitungen mit Vollredak-tion, die also auch den Mantelteil selbst produzieren. Ein Verlag kann mehrere publizistische Einheiten produzieren, also mehrere Zeitungen mit einem eigenen Mantelteil herausbringen. Mehrere Verlage können aber auch nur eine publizisti-sche Einheit bilden, indem sie sich eine Vollredaktion teilen, sich zu einer Ver-lagsgemeinschaft zusammenschließen, oder indem ein Verlag den Mantelteil von einem anderen kauft. Deutschlandweit gibt es derzeit 133 publizistische Einheiten, die gemeinsam 1509 Zeitungen herausgeben. Diese Zahlen sind in den vergange-nen Jahren leicht gesunken (vgl. Media Perspektiven, Basisdaten 2011).
Während sich die Deutschen bei Themen von nationaler Bedeutung sowohl aus überregionalen Zeitungen (Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeut-sche Zeitung, Tageszeitung, Neues Deutschland, aber auch BILD) als auch aus ih-rer Heimatzeitung informieren können, steht ihnen für lokale Information nicht selten nur eine Zeitung zur Verfügung. Medienökonomen sprechen dann von lo-kalen Monopolen oder auch von so genannten Ein-Zeitungs-Kreisen. Deren Zahl hat in den vergangenen 50 Jahren deutlich zugenommen. Hatten 1954 nur 15 Pro-zent aller Gebiete lediglich eine regionale oder lokale Abonnementzeitung, stieg der Anteil der Ein-Zeitungs-Kreise bis 2004 auf 58 Prozent. Der Anteil der Gebie-te mit zwei Lokalzeitungen ist dagegen nur leicht, von 29 auf 33 Prozent, gestie-gen. Inzwischen gibt es nur noch wenige Kreise und kreisfreie Städte mit drei o-der mehr lokalen Abonnementzeitungen (vgl. Media Perspektiven-Basisdaten 2004). Diese Trends dauern wie die oben zitierte Abnahme publizistischer Einhei-ten an (vgl. Heinrich/Schütte 2012: 45ff).
Angesichts der zunehmenden Konzentration auf dem Zeitungsmarkt wird von Journalistenverbänden, aber auch teilweise in der wissenschaftlichen Literatur, seit mehreren Jahren vor einem Verlust an publizistischer Vielfalt gewarnt (vgl. DJV 2003; Schütz 2002). Diese Warnungen basieren auf der Annahme, dass pub-lizistische Vielfalt wünschenswert ist und zu einer qualitativen Konkurrenz führt.
Man „geht selbstverständlich davon aus, dass z.B. viele Zeitungen auch viele Meinungen bieten müssten. Doch allein schon durch die Tatsache, dass immer mehr Berichte auf Agenturmaterial basieren – und auch Agenturen gibt es im Verhältnis zu den Zeitungen nur wenige – wurde offenbar, dass diese Annahme nicht unbedingt stimmen muss“ (Rager 1982: 3).
Der Medienökonom Jürgen Heinrich schreibt:
„Die Zusammenhänge von Konzentration und Qualität sind reichlich spekulativ und ambivalent. Einerseits ist die horizontale Medienkonzentration auch in erheb-
Konzentration und Qualität Le
sepro
be

10 Kapitel 1: Bedeutung der Medien
lichen Effizienzvorteilen begründet, die dazu führen können, dass die größeren Einnahmen in die Produktion publizistischer Qualität investiert werden. […] An-dererseits bietet die horizontale Konzentration die Möglichkeit, Meinungsvielfalt zu verringern und Einheitlichkeit der Berichterstattung zu betreiben“ (Heinrich 2001: 144).
Bisher wurde empirisch lediglich belegt, dass der Umfang des Lokalteils in Ein-Zeitungs-Kreisen abnimmt (vgl. Pätzold / Röper 1992: 644).
Konkurrenz bekommen die lokalen Tageszeitungen durch Anzeigenblätter, die häufig aus demselben Verlagshaus kommen, und zunehmend auch durch lokale Informationen im Internet. Zudem bieten inzwischen viele Radiosender lokale Programme an. Das kann sich positiv auf die publizistische Vielfalt auswirken.
Neben den Zeitungen können die Deutschen auf ein breit gefächertes Zeit-schriftenangebot mit bis zu 20.000 verschiedenen Titel zurückgreifen (vgl. VDZ 2006; Heinrich/Schütte 2012: 116 ff).
Eine jüngst aktualisierte Einführung: Meyn, Hermann / Tonnemacher, Jan (2012): Massenmedien in Deutschland. Konstanz.
1.3.1 Anzeigen-Probleme im Zeitungsmarkt
Die oben beschriebene Anzeigen-Auflagen-Spirale macht den Zeitungsverlagen seit mehreren Jahren zu schaffen. Dies hat verschiedene Gründe: In wirtschaftlich schwierigen Zeiten geben Unternehmen weniger Geld für Werbeanzeigen aus – zuletzt strichen etwa mehrere Lebensmittel-Discounter ihre großformatigen Zei-tungsanzeigen, insgesamt schrumpfte der für viele Verlage lebensnotwendige Be-reich der Geschäftsanzeigen 2011 um weitere 9,1 Prozent (Eggert/Keller 2012: 54). Zudem sind immer mehr Klein-Anzeigen und Inserate im Internet statt in den lokalen Zeitungen zu finden: neue Autos, Wohnungen oder auch Partnerschaften suchen heute viele eher in speziellen Online-Börsen als in der Zeitung, „eBay Kleinanzeigen“ ersetzt weitere Inserate. Eggert und Keller fassen zusammen:
„Wie schwierig das Anzeigengeschäft für die Regionalzeitungen war, zeigt die Entwicklung der Umfänge der Inserate: Sie schrumpften 2011 um 4,2 Prozent. Damit hält die Negativentwicklung an, die schon seit dem Jahr 2001 zu beobach-ten ist: Die Anzeigenteile werden immer dünner, auch wenn die Verluste in den einzelnen Jahren sehr unterschiedlich ausfielen. Seit 2009 nahmen die Umfänge um 18 Prozent ab, und diese Entwicklung kehrte sich auch im kräftigen Wirt-schaftsaufschwung nicht um. Gegenüber dem Ausnahmejahr 2000 haben die Ver-lage 45 Prozent weniger Anzeigenseiten verkauft.“ (ebenda)
Zugleich sinken die Auflagen der Tageszeitungen seit mehreren Jahren – immer nur leicht, aber bedrohlich stetig. 2012 lag die Gesamtauflage der Tages-. Sonn-
Konkurrenz
Seit Jahren sinkende Anzeigen-Erlöse
Sinkende Auflagen
Lese
probe

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 11
tags- und Wochenzeitungen bei 18,4 Millionen, 2001 waren es noch 23,8 Millio-nen (BDZV 2012: 408). Die traditionelle Print-Presse steht also seit mehreren Jah-ren und v.a. durch die zunehmende Bedeutung des Internets unter immensem Druck. Vor diesem Hintergrund sind die Entwicklungen im Print-Markt der ver-gangenen Jahre zu lesen:
Die oben angedeutete Tendenz zur Konzentration.
Der (bisher zumeist erfolglose) Versuch der Verlage, auch im Internet und mit Angeboten für mobile Endgeräte Geld zu verdienen.
Oftmals tendenziell eher unternehmerisch als journalistisch dominierte Ver-lagsentscheidungen, wie etwa die Schließung einzelner Redaktionen oder die Einstellung von aufwändigen Beilagen.
Die Tendenz zum Stellenabbau.
Das Ende mancher renommierter Zeitungstitel.
Ende 2012 führte insbesondere die Insolvenz der traditionsreichen „Frankfurter Rundschau“ und die Einstellung der renommierten „Financial Times Deutsch-land“ zu aufgeregten Diskussionen um die Zukunft der Qualitätspresse. Das Ende beider Zeitungstitel war Ausdruck von Schwierigkeiten der Branche und zeitungs-individuellen Problemen zugleich. „Im Sturm“ übertitelte das Wochenmagazin „Die Zeit“ seine Beschäftigung mit der Medienkrise (Ausgabe vom 22.11.2012). Klar ist: Es besteht weiter und mehr denn je die Notwendigkeit journalistisch klu-ger Beobachtungen und Berichterstattung, die Zeitungsredaktionen bleiben wich-tige Institutionen bei der Beobachtung und Vermittlung des politischen und ge-sellschaftlichen Geschehens. Zugleich muss die Zeitungsbranche aber weiter nach Antworten auf die grundlegend veränderte Medien-Situation finden. Sie sucht nach Geschäftsmodellen, um die Verluste im Anzeigenmarkt auszugleichen – und nach Möglichkeiten, mit Internet-Angeboten Geld zu verdienen. Bisher verursa-chen die Online-Ausgaben bei den allermeisten Verlagen hohe Kosten, ohne über Anzeigen oder Abonnements gegenfinanziert zu werden. Viele Verlags-Protagonisten betrachten es mittlerweile als großen Fehler, im Internet von Beginn an eine „Gratis-Kultur“ mitetabliert und ihre journalistischen Inhalte kostenlos angeboten zu haben (vgl. z.B. die verschiedenen Stellungnahmen in der zitierten Ausgabe von „Die Zeit“).
1.3.2 Noch immer großes Vertrauen in Zeitungen
Wer heute, etwa für Kultur- oder Non-Profit-Unternehmen, Pressearbeit betreibt, muss sich deshalb bewusst sein, dass Tageszeitungen nach wie vor wichtig sind, dass sie aber zum einen mittlerweile wesentlich größere Konkurrenz durch alternative Medien haben – und dass sie zum anderen immer öfter unter großem Kostendruck arbeiten.
Entwicklungen Ende 2012
Zeitungen bleiben zentrale Medien der Pressearbeit
Lese
probe

12 Kapitel 1: Bedeutung der Medien
Die folgenden zwei Tabellen zeigen:
wie zersplittert der deutsche Werbemarkt mittlerweile ist und
das das wichtigste Kapital der Tageszeitungen noch immer das große Ver-trauen ist, das Leser ihnen entgegen bringen. Keinem anderen Medium ver-trauen die Bundesbürger so sehr, wie „ihrer Zeitung“. Das ist ein großes Kapi-tal der Verlage und zeigt zugleich, dass sie weiterhin zentrale Bedeutung für effektive Öffentlichkeitsarbeit haben.
Werbeaufwendungen in Deutschland 2011 - Marktanteile der Medien in Prozent
12,4
5,4
16,3
3,8
21,8
11,3
7,9
0,5
1,1
19,5
0 5 10 15 20 25
Übrige Medien
Online-Angebote
Direktwerbung
Hörfunk
TV
Anzeigenblätter
Publikumszeitschriften
Zeitungssupplements
Wochen- u. Sonntagszeitungen
Tageszeitungen
Tab. 2: Werbe-Marktanteile der Medien 2011 (Quelle: ZAW/BDZV zit. n. BDZV 2012: Zei-tungen 2012/2013, S. 50)
Vertrauen in vermittelte Informationen
0 10 20 30 40 50 60 70
Internet
Privates Fernsehen
Privater Hörfunk
Zeitschriften
Öffentlich-rechtliches Fernsehen
Öffentlich-rechtlicher Hörfunk
Lokalzeitungen
Med
ien
Vertrauen in Prozent
Tab. 3: Vertrauen in verschiedene Medien, Basis: 1.048 Bundesbürger über 14 Jahren (Mehr-fachnennungen), Angaben in Prozent (Quelle: TNS Emnid 2007 zit. n. BDZV 2012: Zahlen – Daten – Fakten, S. 420)
Lese
probe

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 13
1.4 Rundfunk
Anders als Zeitungen und Zeitschriften ist der Rundfunk zumindest teilweise in öf-fentlicher Hand. Im so genannten dualen Rundfunksystem existieren öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunk nebeneinander. Während die privaten Sender sich ausschließlich über Werbeeinnahmen (bei Pay-TV auch über Abonnements) finanzieren, können die öffentlich-rechtlichen Sender auf Gebühren bauen. Die Höhe der Rundfunkgebühren wird alle zwei Jahre von den Rundfunkanstalten be-antragt, von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkan-stalten (KEF) geprüft und von den Landesparlamenten in einem Staatsvertrag be-schlossen (vgl. Stuiber 1998: 703ff.). Das Bundesverfassungsgericht hat in mehre-ren Urteilen die duale Rundfunkordnung, also das Nebeneinander von privatem und öffentlich-rechtlichem Rundfunk, bestätigt und festgelegt, dass der Rundfunk nicht „dem freien Spiel der Kräfte überlassen“ werden darf.
Der Gesetzgeber, so steht es im dritten Fernsehurteil aus dem Jahr 1981, muss „sicherstellen, dass der Rundfunk nicht einer oder einzelnen gesellschaftlichen Gruppen ausgeliefert wird, dass die in Betracht kommenden gesellschaftlichen Kräfte im Gesamtprogramm zu Wort kommen und dass die Freiheit der Berichter-stattung unangetastet bleibt“ (Meyn 2004: 136).
Dieser besondere Schutz des Rundfunks lässt sich sowohl aus technischer als auch aus gesellschaftspolitischer Sicht begründen. Technisch kann im analogen Rund-funk nur eine begrenzte Anzahl an Programmen übermittelt werden. In diesem Zusammenhang wird auch von Frequenzknappheit gesprochen. Zwar haben sich diese Verbreitungsengpässe mit der technischen Entwicklung teilweise erledigt. Die Digitalisierung der Übertragungswege hat die Zahl der übertragbaren Pro-gramme deutlich erhöht, dennoch bleibt sie beschränkt (vgl. Puppis 2007: 65f.). Außerdem ist die flächendeckende Einführung des Digitalradios bisher geschei-tert.
Zusätzlich zu den technischen Schranken war Rundfunk zumindest in der Ver-gangenheit ein teures Unterfangen. Die hohen Anschaffungskosten für Studio- und Sendetechnik fungierten als Marktzutrittsbarriere. Diese Kosten sind Dank digitaler Technik deutlich gesunken. So gibt es heute bereits eine Vielzahl von In-ternetradiosendern, die ohne großen finanziellen Aufwand von Privatpersonen be-reitgestellt werden. Ebenso gibt es eine Reihe von Fernsehsendungen, die mit ge-ringen Kosten für das Internet produziert werden, z.B. die Satire-Sendung „Eh-rensenf“. Betrachtet man das Internet als legitimen Übertragungsweg des Rund-funks, so kann nicht mehr ohne Einschränkung von Verbreitungsengpässen ge-sprochen werden. Die technische Begründung der Rundfunk-Regulierung wird vor diesem Hintergrund bereits seit Jahren neu diskutiert (vgl. Lucht 2004: 100f.).
Massenmedien sind aber nicht nur Wirtschaftsgüter, sondern haben, wie bereits beschrieben, eine öffentliche Aufgabe. Hier kommt die gesellschaftspolitische Begründung ins Spiel: Im rein kommerziell orientierten System der Marktfreiheit,
Duales Rundfunk-system
Lese
probe

14 Kapitel 1: Bedeutung der Medien
so die Annahme, bestünde die Gefahr, dass Medieninhalte nur den kommerziellen Zielen dienen und nicht den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger entspre-chen (vgl. Puppis 2007: 83). Das Bundesverfassungsgericht spricht in seinem vierten Fernsehurteil (1986) den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten klar die Aufgabe der Grundversorgung der Gesellschaft zu, weil
„deren Programme dank ihrer Teilfinanzierung durch Gebühren nicht in gleicher Weise wie private Veranstalter auf Einschaltquoten angewiesen seien. Weil es da-her nur dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk möglich sei, dem klassischen Pro-grammauftrag (gleichgewichtige Darstellung von Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung) nachzukommen“ (Lucht 2004: 100).
Als Grundversorgung sieht das Gericht keine Mindestversorgung, die sich nur auf den informierenden und bildenden Teil des Programms beschränkt, sondern die flächendeckende Verbreitung eines inhaltlich umfassenden Programmangebots.
Privatfunkanbieter sind verständlicherweise anderer Auffassung. Sie sehen durch das Aufkommen zahlreicher privater Voll- und Spartenprogramme eine ausrei-chende Meinungsvielfalt gewährleistet und halten eine staatlich garantierte und kostspielige Grundversorgung für nicht mehr zeitgemäß. Privaten Unternehmun-gen entgingen dadurch Entfaltungschancen (vgl. Lucht 2004: 101). In seiner Rechtsprechung zum dualen Rundfunksystem ist das Bundesverfassungsgericht dieser Sichtweise bisher nicht gefolgt.
Nach dem öffentlich-rechtlichen Prinzip sind in Deutschland die neun Landes-rundfunkanstalten, das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF), der Deutschlandfunk und die Deutsche Welle organisiert. Rundfunk ist als Kulturgut Ländersache, so-mit bilden Landesgesetze und Staatsverträge zwischen den Bundesländern die Rechtsgrundlage für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Einzige Ausnahme bil-det die Deutsche Welle. Ihre Aufgabe besteht darin, Programme für das Ausland zu senden. Sie wurde daher von dem Grundsatz, dass Rundfunk ausschließlich Sache der Länder ist, ausgenommen und hat als Rechtsgrundlage ein Bundesge-setz (vgl. Mathes / Donsbach 2002: 558f.).
Alle öffentlich-rechtlichen Sender sind Anstalten des öffentlichen Rechts mit dem Privileg der Selbstverwaltung. Sie müssen jedoch dem Gebot der Pluralität Rech-nung tragen. Dies zu überwachen obliegt dem Rundfunkrat (beim ZDF: Fernseh-rat), in dem gesellschaftlich relevante Gruppen wie Kirchen, Parteien, Sportver-bände oder Gewerkschaften vertreten sind. Diese pluralistische Zusammensetzung soll eine einseitige Programmgestaltung verhindern. Der Rundfunkrat wählt in der Regel (es gibt Abweichungen bei den einzelnen Landesgesetzen) den Verwal-tungsrat, der für Finanz- und Entwicklungsplanung der Anstalten verantwortlich ist, sowie den Intendanten, der die Verantwortung für den gesamten Betrieb und die Programmgestaltung trägt. Die Anzahl der Mitglieder des Rundfunkrates ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Aber immer werden die Mitglieder als Repräsentanten der Allgemeinheit und nicht als Interessenvertreter einer be-
Öffentlichrechtliche Sender
Lese
probe

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 15
stimmten Gruppe betrachtet. Die Organisation spezieller Arbeitsfelder, beispiels-weise des Schulfunks, wird zudem an entsprechende Ausschüsse delegiert (vgl. Mathes / Donsbach 2002: 560f.). Es gilt der Grundsatz des Binnenpluralismus, das heißt, ein Sender in sich soll den Pluralitäts-, also den Vielfaltsansprüchen, gerecht werden. Trotzdem sind auch klar definierte Positionen erlaubt. In den ZDF-Fernsehrichtlinien heißt es:
„Die Ausgewogenheit des Gesamtprogramms bedingt jedoch nicht Überpartei-lichkeit in jeder Einzelsendung. Sendungen, in denen bei strittigen Fragen ein Standpunkt allein oder überwiegend zur Geltung kommt, bedürfen eines entspre-chenden Ausgleichs.“ (Meyn 2004:156)
Dem Binnenpluralismus steht das Prinzip des Außenpluralismus gegenüber, das für den privaten Rundfunk gilt. Hier soll die Vielfalt der Anbieter ein ausgewoge-nes Gesamtprogramm liefern. Mit dem Kabelpilotprojekt in Ludwigshafen ging am 1. Januar 1984 das erste private Programm auf Sendung. Anders als der öf-fentlich-rechtliche Rundfunk müssen sich die Privatsender ausschließlich über Werbung finanzieren (mit Ausnahme einiger Pay-TV-Angebote, z.B. Premiere). Das Programm ist allerdings trotzdem nicht umsonst, „denn die Ausgaben der werbenden Wirtschaft sind in den Preisen enthalten, die alle für Waren bezahlen“ (Meyn 2004: 167).
Auch der Privatfunk wird nicht ganz dem Spiel der ökonomischen Kräfte überlas-sen. Für alle Bundesländer (einige Länder haben sich zusammengeschlossen) re-geln so genannte Landesmedienanstalten die Zulassung privater Hörfunk- und Fernsehveranstalter und üben die Aufsicht über sie aus. Ähnlich wie bei den öf-fentlich-rechtlichen Sendern sind auch in den Gremien der Landesmedienanstalten die gesellschaftlich relevanten Gruppen repräsentiert. Die Vergabe der Lizenzen erfolgt nach den Gesichtspunkten der Vielfalt und der Wirtschaftlichkeit. Ein Sender der Arbeitsplätze schafft, hat größere Chancen eine Lizenz zu bekommen, als ein Ein-Mann-Betrieb.
„Die Programmkontrolle der Landesmedienanstalten ist auf die Überwachung der gesetzlichen Vorschriften beschränkt und darf nicht in die Programmautono-mie der Veranstalter eingreifen“ (Mathes/Donsbach 2002: 575).
Inhaltlich ahnden die Landesmedienanstalten beispielsweise Verstöße gegen den Jugendschutz oder rechtsradikale Inhalte. Zudem kontrollieren sie die Lizenzver-einbarungen (z.B. ob der Sender den vereinbarten Wortanteil im Programm ein-hält) und die Einhaltung der Werberichtlinien. Die Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen reichen bis hin zum Lizenzentzug (vgl. Stuiber 1998: 799f.).
Private Sende-anstalten
Landesmedien-anstalten
Lese
probe

16 Kapitel 1: Bedeutung der Medien
Abb.1: Der Aufbau einer Rundfunkanstalt am Beispiel des WDR
Die duale Rundfunkordnung ausführlich: Heinz-Werner Stuiber 1998; Hermann Meyn 2004; Jens Lucht 2004.
1.4.1 Konflikte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Dem Rundfunk, insbesondere dem Fernsehen, entstanden weniger große Proble-me durch die wachsende Bedeutung des Internets, als den Tageszeitungen. Das Fernsehen verteidigte seine Spitzenposition bei der Mediennutzung – und baute sie sogar weiter aus. 220 Minuten pro Tag läuft der Fernseher beim durchschnitt-lichen Bundesdeutschen, wie die Tabelle in Kapitel 1.6 zeigt.
Debatten bis hin zu Rechtsstreits gibt es jedoch weiterhin um die gebührenfinan-zierten öffentlich-rechtlichen Sender. Ab 2013 gilt eine novellierte Rundfunkab-gabe, sie wird „Rundfunkbeitrag“ genannt und pauschal pro Haushalt abgerech-net. Unternehmen mit vielen Mitarbeitern und Filialen fürchten nach der Novelle hohe Zusatzkosten und erwägen Klagen (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 11.01.2013: Unmut über die neue Rundfunkgebühr). Weiter schwelt auch der Konflikt zwischen Zeitungsverlegern und den Verantwortlichen von ARD und ZDF: Sie werfen den Sendern vor, sich stärker im Internet zu engagieren, als es ihrem öffentlich alimentierten Programmauftrag entspricht – und so die Verlage um Online-Verdienstmöglichkeiten zu bringen.
Lese
probe

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 17
1.5 Nachrichtenwerttheorien
Staatliche Eingriffe in den Inhalt der Massenmedien verbietet das Grundgesetz. „Eine Zensur findet nicht statt“, heißt es in Artikel 5. Doch was wird uns – ausge-hend vom informierenden Gesichtspunkt – durch die Massenmedien vermittelt? Nicht alles, was auf der Welt geschieht, spiegelt sich in Zeitungen, Radio- und Fernsehnachrichten wider. Und nicht jedes Thema, das uns persönlich bewegt, wird von den Medien beachtet. Es wird angenommen, dass die Nachrichtenpro-duktion einem bestimmten vorgegebenen Raster unterliegt, welches sich am Nachrichtenwert von Ereignissen orientiert.
Bereits 1922 formulierte Walter Lippmann den Grundgedanken der heutigen Nachrichtenwerttheorie und stellte fest, dass es aufgrund der Komplexität des Weltgeschehens unmöglich sei, die Wirklichkeit abzubilden. Vielmehr sei eine Reduktion der Informationskomplexität nötig (vgl. Weischenberg 2001: 23f.).
Die Frage, welche Faktoren sich auf den Nachrichtenfluss auswirken, hat zahlrei-che Kommunikationsforscher beschäftigt. Einar Östgaard (1965) unterscheidet zwischen endogenen und exogenen Einflüssen. Zu den exogenen Faktoren gehö-ren Einflüsse, die von außerhalb wirken, d.h. politische und rechtliche Maßnah-men, Zensurvorschriften oder ökonomische Beschränkungen und Begünstigun-gen. Die endogenen Einflüsse sind hingegen im Nachrichtensystem selbst ange-legt – sie spiegeln also die Rolle des Journalisten als gatekeeper wider, der ent-scheidet, was zur Nachricht wird und was nicht.
„Dabei wird vermutet, dass sich die Individualität des Journalisten, seine persön-lichen Vorlieben und Abneigungen, Interessen und Einstellungen, in seiner Nach-richtenauswahl manifestiert“ (Schulz 2002: 328).
Carl Warren definierte 1934 folgende zehn Elemente, die ein Ereignis berichtens-wert machen: Neuigkeit, Nähe, Tragweite, Prominenz, Dramatik, Kuriosität, Kon-flikt, Sex, Gefühle, Fortschritt.
Johan Galtung und Mari Holmboe Ruge veröffentlichten 1965 eine Liste von zwölf Faktoren, die ein Ereignis für Journalisten berichtenswert machen. Diese Faktoren wirken nach Galtung / Ruge additiv, d.h. je mehr Faktoren auf ein Er-eignis zutreffen, so die Theorie, desto wahrscheinlicher wird darüber berichtet (vgl. Galtung / Ruge 1965: 64ff.):
Frequenz
Je mehr der Zeitlauf eines Ereignisses der Erscheinungsperiodik des Mediums entspricht, desto wahrscheinlicher wird es zur Nachricht.
(Bsp.: Ein Konzert, das am Montag stattfindet, wird im örtlichen Sonntagsblatt evtl. nicht wahrgenommen, da zwischen Ereignis und Erscheinung eine ganze Woche liegen.)
Nachrichtenwert-theorie
Nachrichtenfaktoren nach Galtung und Ruge
Lese
probe

18 Kapitel 1: Bedeutung der Medien
Schwellenfaktor (absolute Intensität, Intensitätszunahme)
Erst ab einer bestimmten Auffälligkeit wird ein Ereignis registriert.
(Bsp.: Dass ein ungesichertes Fahrrad entwendet wurde, hat so gut wie gar kei-nen Nachrichtenwert.)
Eindeutigkeit
Eindeutige und überschaubare Ereignisse haben es leichter als komplexe Sach-verhalte.
(Bsp.: Komplexe Sachverhalte, etwa zur Sterbehilfe in Deutschland, finden nur selten in Nachrichten statt, weil sie schwierig zu erklären sind.)
Bedeutsamkeit (kulturelle Nähe, Betroffenheit, Relevanz)
Je größer die Tragweite ist, je mehr Betroffene es gibt und je näher das Ereig-nis am Verbreitungsgebiet des Mediums liegt, desto eher wird es zur Nach-richt.
(Bsp.: Die Überschwemmung mit einem Toten in Frankfurt kommt eher ins Blatt als die Sturmflut mit fünf Toten im Inselkönigreich Tuvalu.)
Konsonanz (Erwartung, Wünschbarkeit)
Der Nachrichtenwert steigt, wenn ein Ereignis den vorhandenen Vorstellungen und Erwartungen entspricht.
(Bsp.: Skandale um Steuerverschwendungen werden dankbar aufgegriffen, weil der „Durchschnitts-Bundesbürger“ grundsätzlich das Gefühl hat, zu viele Steuern zu zahlen.)
Überraschung (Unvorhersehbarkeit, Seltenheit)
Überraschendes wird eher zur Nachricht.
(Bsp.: Kind beißt Hund!)
Kontinuität
Was einmal als Nachricht definiert wurde, hat hohe Chancen, weiter von den Medien beachtet zu werden.
(Bsp.: Die Arbeitslosenzahlen werden inzwischen regelmäßig in Zeitungen und im Rundfunk veröffentlicht und analysiert.)
Variation
Trägt ein Ereignis zur Variation des gesamten Nachrichtenbildes bei, ist der Schwellenwert für die Beachtung niedriger.
(Bsp.: In einer Konflikt beladenen politischen Debatte wechselt einer der Ak-teure plötzlich seinen Standpunkt und vertritt die Position seiner Gegner.)
Lese
probe

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 19
Bezug auf Elite-Nationen
Themen, die wirtschaftlich oder militärisch mächtige Nationen betreffen, haben einen hohen Nachrichtenwert.
(Bsp.: Politische Entscheidungen der USA interessieren auch in Deutschland.)
Bezug auf Elite-Personen
Prominente und einflussreiche Personen haben einen hohen Nachrichtenwert.
(Bsp.: Über die Queen wird immer wieder berichtet, ob zum Geburtstag, zum Dienstjubiläum oder zur diamantenen Hochzeit.)
Personalisierung
Lässt sich ein Ereignis gut personalisieren, sich am Schicksal einer oder weni-ger Personen darstellen, wird es eher zur Nachricht.
(Bsp.: Eine Geschichte über die Not von Obdachlosen wird erst interessant, wenn ein persönlich Betroffener vom Leben auf der Straße erzählt.)
Negativismus
Je mehr ein Ereignis auf Konflikte, Kontroversen oder Tod bezogen ist, desto stärker wird es beachtet.
(Bsp.: Krieg, Mord und Polizeimeldungen gibt es in jeder Zeitung. Dieser Nachrichtenfaktor ist in der Wendung „Only bad news are good news!“ sprichwörtlich geworden.)
Schulz (1975) entwickelt die Nachrichtenwerttheorie von Galtung / Ruge weiter und gibt ihr eine neue Grundlage. Anders als bei Galtung / Ruge sind es nach sei-ner Theorie nicht die objektiven Merkmale von Ereignissen, die quasi automatisch dazu führen, dass über ein Ereignis berichtet wird (passive Redakteure). Entschei-dend ist, welche Eigenschaften der Redakteur dem Ereignis zuschreibt, d.h. wel-chen Nachrichtenwert er ihm (aktiv) gibt. Auf dieser Basis unterscheidet Schulz 18 Nachrichtenfaktoren, die er den sechs Dimensionen Zeit, Nähe, Status, Dyna-mik, Valenz und Identifikation unterordnet. Nach Ansicht von Joachim Friedrich Staab setzen Journalisten Nachrichtenfaktoren ein, um Selektionsentscheidungen zu begründen, indem sie Merkmale von Ereignissen überhöhen bzw. gezielt aus-wählen (Finalmodell).
Kritisiert wird an den bisher genannten Untersuchungen, dass sie zwei unter-schiedliche Determinanten der Nachrichtenauswahl (Ereignismerkmale und jour-nalistische Selektionskriterien) vermischen, weil immer nur die Medieninhalte, nicht aber die Ereignisse selbst analysiert wurden. Hans Mathias Kepplinger (1989) schlägt deshalb ein Zwei-Komponenten-Modell vor, das sowohl die Merk-male von Ereignissen berücksichtigt als auch journalistische Selektionskriterien, die den Merkmalen erst Bedeutung geben. Jede Auswahlentscheidung ist bei-spielsweise auch von dem Medium abhängig, für das sie getroffen wird. Der Fak-
Welche Eigenschaften misst der Redakteur einem Ereignis bei?
Zwei-Komponenten-Modell
Lese
probe

20 Kapitel 1: Bedeutung der Medien
tor Prominenz spielt für ein Boulevard-Magazin vermutlich eine größere Rolle als für „Die Zeit“.
Die Kriterien der Nachrichtenselektion haben sich auch mit der Ausweitung der verfügbaren Informationen und der individualisierten Möglichkeit der Informati-onsbeschaffung durch das Internet nicht grundlegend geändert. Neu ist jedoch, dass vor allem im Internet auch Informationen abseits der klassischen Nachrich-tenfaktoren nach Galtung / Ruge zu finden sind, z.B. in Blogs oder auf privaten Internetseiten. In Reaktion darauf werden diese „neuen Themen“ jenseits der klas-sischen Nachrichtenfaktoren immer öfter auch von traditionellen Medien aufge-griffen.
Wer Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit betreibt, muss wissen, welche Nachrichten-faktoren bestimmen, ob eine Information zur Meldung oder sogar zur Reportage wird. Medienkompetenz, das Wissen darum, welche Logik hinter Auswahlprozes-sen in Redaktionen steckt, ist notwendig, um Themen so anbieten zu können, dass sie aufgegriffen werden. Für Kultur- und Non-Profit-Organisationen kann das heißen, etwa bei abstrakten Themen gleich lokale Protagonisten oder ungewöhnli-che Sichtweisen mitzuliefern, um Redaktionen für die Berichterstattung zu ge-winnen.
1.6 Mediennutzung
Ist die Zeitung altmodisch? Haben Radio und Fernsehen gegen das Internet keine Chance?
„Die Fusion der klassischen Massenmedien mit dem weltweiten Datennetz lässt Visionen aufkommen, die Fernsehen, Hörfunk und Tageszeitung wie Auslaufpro-dukte eines vordigitalen Zeitalters aussehen lassen“ (Eimeren / Ridder 2005: 490).
Tatsächlich ist die Ausstattung mit moderner Technik in deutschen Haushalten in-zwischen beeindruckend. Eine weit überwiegende Zahl der Haushalte verfügt über schnelle Internetanschlüsse, fast 40 Prozent der Erwachsenen haben mittlerweile bereits ein Smartphone (BITKOM 2012). Per Handy sind viele heute schneller im Internet unterwegs als noch vor einigen Jahren vom Computer aus. Diese Ent-wicklungen haben natürlich auch die Mediennutzung verändert. So ist die durch-schnittliche tägliche Nutzungsdauer von Tageszeitungen deutlich zurückgegan-gen, während die des Internets stark angestiegen ist. An der Spitze mit sogar wei-ter gestiegener Zahl liegt jedoch wie beschrieben weiter das Fernsehen: Es läuft im Schnitt über dreieinhalb Stunden am Tag. Auf Platz zwei liegt, wie die folgen-de Tabelle zeigt, das Radio – wobei dieses häufig lediglich als „Nebenbei-Medium“ genutzt, also während anderer Beschäftigungen gehört, wird.
Technische Entwicklung hat Mediennutzung verändert
Lese
probe

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 21
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Hörfunk 135 154 170 162 206 221 187
Fernsehen 125 121 135 158 185 220 220
CD/MC/LP 15 14 14 13 36 45 35
Tageszeitung 38 33 28 29 30 28 23
Bücher 22 17 18 15 18 25 22
Internet – – – – 13 44 83
Zeitschriften 11 10 11 11 10 12 6
Video/DVD – – 4 3 4 5 5
Gesamt 346 351 380 391 502 600 583
Tab. 4: Entwicklung der Nutzungsdauer der Medien pro Tag (Montag bis Sonntag, in Minuten pro Tag, seit 1995 BRD gesamt; ein geringer Anteil Parallelnutzung ist enthalten (brut-to), gilt für Erwachsene ab 14 Jahren. Quelle: ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkom-munikation 2010)
Bei jungen Menschen ist die Internet-Zeit und insbesondere die Verweildauer in sozialen Netzwerken noch wesentlich höher, dies wird im Praxisteil Social Media behandelt. Doch schon die Übersicht in dieser Tabelle ist bemerkenswert: Das Medium Internet, das es 1995 so noch gar nicht gab, ist mittlerweile über alle Al-tersgruppen zusammengenommen schon so stark wie Bücher, Tageszeitungen und CD/MC/LP zusammen.
Warum aber wird insgesamt so ungeheuer viel Zeit mit Medien verbracht?
„Mediennutzung muss irgendeinen Nutzen haben, auch wenn dieser nicht immer bewusst ist und vielleicht nur darin besteht, den Tagesablauf zu strukturieren oder eine Geräuschkulisse zu haben“ (Meyn 2001: 25).
Henk Prakke definiert 1968 Information, Kommentierung und Unterhaltung als die „drei Erwartungen der Rezipienten“. Denis McQuail nennt 1972 fünf „Beloh-nungen“: Information, persönliche Identität, Integration, soziale Interaktion und Unterhaltung. Bradley Greenberg sieht 1973 acht Nutzungsmotive: Entspannung, Geselligkeit, Information, Gewohnheit, Zeitfüller, Selbstfindung, Spannung und Eskapismus. Der Kommunikationsforscher Michael Schenk weist darauf hin, dass sich die meisten dieser Motive überlappen. Es gebe aber zwei Nutzungsmuster mit deutlichen Unterschieden: Information und Unterhaltung (vgl. Meyen 2001: 27).
Information und Unterhaltung locken also vor den Fernseher, ans Radio, ins In-ternet oder lassen zur Zeitung greifen. Jedoch ist die Gewichtung der Nut-zungsmotive innerhalb der Medien verschieden.
„Spaß ist ein Motiv für die Internetnutzung. Spaß spielt aber für die Nutzung an-derer Medien eine noch wichtigere Rolle“ (Ridder / Engel 2005: 430).
Erwartungen der Rezipienten
Information und Unterhaltung
Lese
probe

22 Kapitel 1: Bedeutung der Medien
Bei den Unterhaltungsmotiven dominieren weiterhin die traditionellen Medien Fernsehen und Hörfunk. Unterschiede gibt es hier jedoch innerhalb der Alters-gruppen. Vor allem für die über 50-Jährigen steht auch beim Fernsehen die Infor-mation im Vordergrund, während die Zuschauer zwischen 14 und 29 Jahren in erster Linie Spaß und Entspannung suchen. Das Radio wird außerdem zunehmend aus Gewohnheit angeschaltet. Bei den informationsorientierten Nutzungsgründen bleibt die Tageszeitung trotz Verlusten in der Reichweite weiterhin das wichtigste Medium. 98 Prozent nutzen sie, um sich zu informieren, 79 Prozent um mitreden zu können. Auch das Internet dient in erster Linie der Informationssuche (91%), gefolgt von der Suche nach Unterhaltung (78%) und der Suche nach Denkanstö-ßen (63%). In punkto Spaß hat das Internet in den Umfragen bereits vor ca. zehn Jahren die Tageszeitung überholt (vgl. Ridder / Engel 2005: 426ff.), mit Video-Kanälen wie Youtube, Musik-Diensten wie Spotify und sozialen Netzwerken wie Facebook wächst der „Spaß-Faktor“ im Internet immer weiter. Es ist zu erwarten, dass die „Neuen Medien“ bei der Nutzung aus Unterhaltungsmotiven in den kommenden Jahren weiter zum Fernsehen aufschließen werden.
Unterhaltung bzw. Spaß ist hier nicht als negativ behafteter Begriff oder als Ge-genteil von Kunst und Hochkultur zu verstehen. Denn was als unterhaltsam emp-funden wird, ist von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich, hängt von seinem Alltag und den persönlichen Voraussetzungen ab. Der Schweizer Kommunikations-wissenschaftler Louis Bosshart hat Unterhaltung als „Selbstdarstellung und als animierte Selbsterfahrung“ definiert. Er stellt die These auf, dass in modernen, materiell abgesicherten Gesellschaften Anregung durch Unterhaltung die Norm sei (vgl. Bosshart 1994: 39ff.).
Seit 1999 untersucht die Studienreihe KIM – Kinder und Medien – auch den Me-dienumgang der 6- bis 13-Jährigen und fragt in diesem Zusammenhang, welche Rolle die verschiedenen Medien im Alltag der Kinder spielen. Deutlich wird, dass die sozio-ökonomischen Bedingungen ein wichtiger Faktor dafür sind, wie sich die gesamte Mediennutzung der Kinder auf die unterschiedlichen Medien verteilt. Während beispielsweise das Fernsehen durch alle Schichten, besonders aber in den statusniedrigen Bevölkerungsgruppen, eine zentrale Rolle spielt, war die ver-stärkte Nutzung von digitalen Medien lange eher in statushöheren Gruppen zu be-obachten. Das Fernsehen dient in erster Linie als Zeitvertreib bei Langeweile oder als Überbrückung eines Einsamkeitsgefühls, wird aber gleichzeitig auch häufig gemeinsam in der Familie genutzt. Sobald Kinder jedoch mit gleichaltrigen Freunden zusammen sind, spielen Medien nur noch eine untergeordnete Rolle. Lediglich das gemeinsame Spielen am Computer ist hier von Bedeutung (vgl. Gleich 2007: 529ff.).
Aktuelle Daten zur Mediennutzung publiziert regelmäßig die Fachzeitschrift Me-dia Perspektiven. Die Texte stehen online als pdf-Datei zur Verfügung: www.media-perspektiven.de.
Internet holt beim „Spaß-Faktor“ auf
Mediennutzung von Kindern
Lese
probe

Kapitel 7: „Ich surfe, also bin ich“ – Zur Bedeutung von Social Media 93
Praxisteil: Social Media in Kultur- und Non-Profit-Organisationen
7 „Ich surfe, also bin ich“ – Zur Bedeutung von Social Media
Lerninhalte
Zahlen, Daten und Entwicklungstendenzen im Bereich Social Media
Egal welche Daten oder Untersuchungen man heranzieht: Die Bedeutung von Social Media wächst seit Jahren. Immer mehr Menschen nutzen Facebook, Twit-ter, Youtube, Wikis und Co. – nicht nur Jugendliche, „Netz-Nurds“ und „Dauer-Chatter“, sondern Menschen aus allen Altersgruppen und Bildungsklassen. Diese Entwicklung ist unumkehrbar. Wer heute Menschen erreichen will, muss deshalb neben den herkömmlichen Instrumenten der Marketing- oder Presse- und Öffent-lichkeitsarbeit auch Strategien für soziale Netzwerke und modernes Online-Marketing entwickeln. Dabei bleibt die Entwicklung dynamisch – wer sich heute mit einem Facebook-Auftritt modern fühlt, kann morgen schon von anderen Or-ganisationen mit eigenen Apps überholt worden sein. Selbst frühere Vorreiter der Kommunikation können den Kontakt zu „digitalen“, oftmals jungen, Zielgruppen verlieren, wenn Sie nicht mit der Entwicklung Schritt halten. Selbst mit Tageszei-tungen etwa, historisch und für viele noch immer das zentrale tägliche Medium, kann man heute an bestimmten Zielgruppen „vorbeikommunizieren“. Für den Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV) konstatiert Meinolf El-lers:
„Glaubt man den Ergebnissen der Sinus-Forschung, dann gehören mittlerweile 41 Prozent der Deutschen zur Gruppe der ‚Digital Natives’. Für diese rund 28 Millionen Menschen ist das Internet ein so selbstverständlicher Bestandteil ihres täglichen Lebens wie Trinkwasser oder der Strom aus der Steckdose. Das Deut-sche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) und das SINUS-Institut fassten in ihrer Anfang 2012 veröffentlichten Milieustudie über die Deut-schen und das Web die Grundhaltung dieser immer größeren Bevölkerungsgruppe in dem Motto zusammen: ‚Ich surfe, also bin ich.’ Für die traditionellen Medien sind die mit dem Internet sozialisierten Digital Natives immer schwieriger zu er-reichen. Vor allem der Wert der regionalen Tageszeitung wird von ihnen mehr oder weniger offen in Frage gestellt. ‚Das gedruckte Wort hat einen Gegner – und das ist der junge Mensch’, hat Verleger Alfred Neven DuMont schon vor Jahren warnend festgestellt. (...) Auch mit den digitalen Angeboten schaffen es viele Zei-tungen noch nicht, die jungen Zielgruppen dauerhaft für die Zeitungsmarke zu be-geistern“ (Ellers 2012: 196).
Immer mehr Men-schen aller Alters-gruppen nutzen Social Media
Bedeutungsverlust des gedruckten Wortes Le
sepro
be

94 Kapitel 7: „Ich surfe, also bin ich“ – Zur Bedeutung von Social Media
Dies ist zuerst einmal ein Problem für die Zeitungs-Branche, wie in Teil I dieses Studienbriefs angedeutet, sucht sie noch immer nach den richtigen „Rezepten“ für das Web 2.0. Es ist aber auch Problem und Chance zugleich für Kultur- und Non-Profit-Organisationen: Über traditionelle Wege der zeitungsvermittelten Öffent-lichkeitsarbeit sind manche Zielgruppen kaum noch zu erreichen. Dafür haben Organisationen, die sich klug im Internet engagieren, die Chance, ihre Zielgrup-pen direkt anzusprechen und sich mit ihnen auszutauschen – ohne Zeitungen oder andere Medien als Multiplikatoren „zwischenschalten“ zu müssen.
7.1 Zahlen zur Nutzung neuer Medienangebote
Viele junge Menschen kennen den aktuellen Untersuchungen zu Folge nur noch zwei „Betriebsarten“: online oder schlafen. Laut der ARD-ZDF-Onlinestudie von 2011 nutzen 100 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren das Inter-net, 98,2 Prozent der 20 bis 29-Jährigen, 94,4 Prozent der 30 bis 39-Jährigen – und noch 34,5 Prozent der über 60-Jährigen. Die Zahlen zeigen: Online-Nutzung und Internet sind heute selbstverständlich. Die Nutzung in höheren Altersgruppen steigt von Jahr zu Jahr, wer schon mit dem Internet aufgewachsen ist, hört nicht auf einmal auf, online unterwegs zu sein. Das „neue Medium“ Internet gehört mittlerweile zum Leben wie Radio oder Fernsehen – und ist für die Kommunika-tion vielfach sogar bedeutsamer.
Die große Relevanz des Internets für die alltägliche Kommunikation zeigen die Daten zur Nutzung sozialer Medien. BITKOM, der Bundesverband Informati-onswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V., meldete am 17. Mai 2012 (vgl. http://www.bitkom.org/de/presse/8477_72245.aspx, zuletzt geprüft im Januar 2013): Fast drei Viertel (74 Prozent) aller Internetnutzer in Deutschland sind in einem sozialen Netzwerk angemeldet, zwei Drittel nutzen soziale Netz-werke aktiv. Zwar gibt es starke Unterschiede je nach Alter – aber es sind keines-falls nur Jugendliche „sozial online“. 85 Prozent der Internetnutzer zwischen 14 und 29 Jahren nutzen die Netzwerke aktiv, 65 Prozent der 30 bis 49-Jährigen und immer noch 46 Prozent in der Generation 50-plus. Das Fazit der Meldung: „Sozia-le Online-Netzwerke wie Facebook, Google+, Xing oder die VZ-Netze sind in den vergangenen Jahren fester Bestandteil des Alltags vieler Menschen geworden. Die Netzwerke ermöglichen es, auf einfache Weise zu kommunizieren und eigene Inhalte im Web zu verbreiten.“
Das am häufigsten genutzte soziale Netzwerk ist dabei Facebook. 45 Prozent der Internetnutzer in Deutschland sind dort aktiv. Wobei die Bedeutung nach dem Marktführer-Prinzip immer weiter wächst: Alle Nutzer sozialer Netzwerke „müs-sen“ nach und nach zu Facebook – eben weil „alle“ da sind. Es folgen, laut BITKOM, „Stayfriends“ mit 17 Prozent, „Wer-kennt-wen“ mit 12 Prozent und „StudiVZ“ mit 6 Prozent.
Neue Chance: Zielgruppen direkt erreichen
100 Prozent der Jugendlichen online
¾ der Internetnutzer in sozialen Netzwer-ken angemeldet
Facebook ist mit Abstand Marktführer
Lese
probe

Kapitel 7: „Ich surfe, also bin ich“ – Zur Bedeutung von Social Media 95
Laut einer Erhebung der Marktforschungsfirma comScore für BITKOM Ende 2011 verbringen deutsche Internetnutzer inzwischen 16 Prozent ihrer Onlinezeit bei Facebook. Ein Jahr zuvor waren es erst 4 Prozent. Auf Rang zwei liegt Google mit einem Anteil von 12 Prozent der Onlinezeit. Neben der Suchmaschine wurde dabei auch der Aufenthalt bei weiteren Google-Diensten wie E-Mail, YouTube und Google+ erfasst. Microsoft liegt auf dem dritten Platz und kommt mit seinen Internetangeboten (Bing, MSN, Hotmail u.a.) auf einen Anteil von 5 Prozent an der Onlinezeit. Zusammengenommen verbringen deutsche Internetnutzer fast ein Viertel ihrer Internetzeit in sozialen Netzwerken. Sie nutzen diese dabei zuneh-mend als Hauptmedium der Online-Kommunikation. Bereits 44 Prozent der 12- bis 25-Jährigen sagen: E-Mails nutze ich unregelmäßig oder nie; mit Bekannten kommuniziere ich über soziale Netzwerke (vgl. BITKOM/comScore 2012; 16. Schell Jugendstudie 2010: 104). Menschen transportieren ihre Mediennutzung mit ins Erwachsenen- und ins Berufsleben. So wie früher ein Zeitungsabonnement selbstverständlich war, bleibt es heute der Online-Austausch und das stete Einge-loggt-Sein. Wer also Internetnutzer und gerade junge Menschen erreichen will – für den ist der klassische Mail-Newsletter schon ein anachronistisches Instrument. Der muss vielmehr versuchen, die Internetnutzer dort abzuholen, wo sie ihre Zeit verbringen und kommunizieren: in sozialen Netzwerken.
Aber auch dies ist noch nicht der Endpunkt der Entwicklung. Ein kurzer Streifzug durch die Meldungen des BITKOM zum Jahresende 2012 hin: „Zweistelliges Wachstum bei mobilen Datendiensten“, „Deutschland ist Vorreiter beim mobilen Breitband“, „UMTS-Boom setzt sich fort“, „Fast 40 Prozent haben ein Smartpho-ne“ und „Tablet Computer im Dauerboom“. Diese Überschriften machen deutlich, dass man sich als Organisation auch auf gut gemachten Social-Media-Angeboten nicht „ausruhen“ darf. Schon wird die mobile Online- und App-Nutzung per Han-dy und Tablet nahezu ebenso so selbstverständlich, wie die Internetnutzung am Computer. Schon gilt es also, auch dafür spezielle Ideen zu entwickeln, sich der mobilen Nutzung anzupassen – und möglicherweise etwa eigene Apps oder E-Paper zu konzipieren, um die Organisation Smartphone-tauglich zu machen.
Alle zitierten BITKOM-Meldungen (und die aktuellen, die nach Druck dieses Studienbriefs bereits höhere Zahlen enthalten werden) sind unter www.bitkom.org Presse zu finden.
7.2 Chancen für Kultur- und Non-Profit-Organisationen
Die zitierten Zahlen machen deutlich, dass, wer in die Öffentlichkeit hineinwirken will, soziale Netzwerke nicht ignorieren kann. Es ist ein neuer „Markt“ für Auf-merksamkeit entstanden. Besonders im Nah- und Kultur-Bereich nutzen sehr viele Menschen das Internet, um sich zu informieren. Die folgende Tabelle macht deut-lich, dass das Internet die traditionellen Medien „Anzeigenblätter“ und „Hörfunk“ bei Informationen im Nah-Bereich bereits überholt hat – und immer weiter zu den
E-Mails sind unter jungen Menschen schon wieder veraltet
Starkes Wachstum bei mobilen Datendiensten
Besonders im Nah- und Kultur-Bereich ist das Internet eine zen-trale Informations-quelle
Lese
probe

96 Kapitel 7: „Ich surfe, also bin ich“ – Zur Bedeutung von Social Media
in diesem Bereich führenden Regionalzeitungen aufschließt. Die Zahlen sind von 2008, mittlerweile dürfte der Abstand noch kürzer sein. Das Internet ist für viele Menschen, vor allem für jüngere Zielgruppen, das zentrale Medium für lokale In-formationen zu Veranstaltungen, Angeboten, Konflikten und Initiativen. Organi-sationen, die regional wirken wollen, müssen das Potenzial des Internets nutzen.
Welche Medien sind unverzichtbar/sinnvoll um über das Geschehen im Ort und der näheren Umgebung auf dem Laufenden zu sein?
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Zeitungen
Internet
lokaler Hörfunk
kostenlose Anzeigenblätter
Med
ien
Angaben in Prozent
unverzichtbar sinnvoll, aber nicht unbedingt notwendig
Tab. 7: Lokale/regionale Kompetenz verschiedener Medien, Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren (Mehrfachnennungen), Angaben in Prozent (Quelle: ZMG-Bevölkerungsumfrage 2008 zit. n. BDZV 2012: 427)
Auch im Kultur-Bereich wird das Internet zu einem immer zentraleren Medium: 2005 befragte TNS Emnid Politiker, Wirtschaftsmanager, Journalisten und Füh-rungskräfte, mit welchen Medien sie sich morgens im Bereich Kultur informieren. Bereits damals sagten in allen vier Gruppen 40 bis 50 Prozent der Befragten u.a. „im Internet“ (vgl. BDZV 2012: 424). Dies macht deutlich, dass gerade auch Ent-scheider und Multiplikatoren mit guten Internetangeboten zu erreichen sind. Wird ihre Neugier geweckt, können sie bei der weiteren Verbreitung von Informationen und Angeboten mitarbeiten.
Die wachsende Bedeutung des Internets stellt Unternehmen, Behörden und auch Kultur- und Non-Profit-Organisationen vor große Herausforderungen. Denn die „neuen Medien“ müssen „anders gedacht“ werden, als herkömmliche Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit. Wer einfach seine Pressemeldungen bei Facebook zweit-verwertet, wird dort keinen Erfolg haben. Man muss sich genau mit dem Medium auseinandersetzen, in dem man kommuniziert – und passgenaue und zielgruppen-gerechte Angebote entwickeln. Da kommt die Medienkompetenz ins Spiel: Wer nicht weiß, wo er unterwegs ist, wird den richtigen Weg nicht finden. Wer sich aber mit dem Medium auseinandersetzt und es geschickt zu nutzen weiß – hat eine große Chance, Öffentlichkeit für die Anliegen seiner Organisation zu generieren.
In den folgenden Kapiteln gehen wir deshalb der Frage nach, wie Medienkompe-tenz zu entwickeln ist, die dabei hilft, zielführend soziale Netzwerke zu nutzen.
„Neue Medien“ müssen anders gedacht werden, als herkömmliche Pressearbeit
Lese
probe

Kapitel 7: „Ich surfe, also bin ich“ – Zur Bedeutung von Social Media 97
Übungsaufgabe 30:
Recherchieren Sie die aktuellen Zahlen zur Nutzung von Social Media und Smartphones in Deutschland. Wie viele Menschen aus welchen Altersgruppen sind online, wie viele in sozialen Netzwerken angemeldet? In welchen? Wie viele Menschen haben Smartphones?
Übungsaufgabe 31:
Fragen Sie sich selbst: Wie viel Zeit verbringen Sie täglich online? Davon wie lange mit welchen Geräten? Wie lange sind Sie in sozialen Netzwerken einge-loggt? Wie kommunizieren Sie bevorzugt per Internet?
Übungsaufgaben
Lese
probe

98 Kapitel 7: „Ich surfe, also bin ich“ – Zur Bedeutung von Social Media
Lese
probe

Kapitel 8: Sozial Media: praxisbezogene Begriffserklärungen 99
8 Social Media: praxisbezogene Begriffserklärungen
Lerninhalte
Verständnis typischer Begriffe der Social-Media-Kommunikation
Abgrenzung verschiedener Tools, Programme und Plattformen voneinander
Erster Schritt zum Verständnis sozialer Netzwerke ist es, die Online- und Social-Media-„Sprache“ zu kennen. In Chats, Foren und Co. wurden über die Jahre be-sondere Begriffe geprägt, verschiedene Programme und Plattformen stehen für verschiedene Wege der Online-Kommunikation. Die Tools und die Begriffe zu kennen, ist Grundvoraussetzung, um sie zu nutzen und für ein gemeinsames Ver-ständnis. Deshalb folgen hier Begriffsklärungen für die wichtigsten Neue-Medien-/Social-Media-Begriffe – jeweils mit Bezügen zu möglichen Handlungsfeldern im Kultur- und Non-Profit-Bereich. Quellen für die Definitionen und Beschreibungen sind der Aufsatz „Ein Streifzug durch das Internet und dieses Buch“ von Axel Kopp (2011: 15ff) und das Online-Lexikon Wikipedia. Dieses enthält zwar, wie bekannt, nicht immer „geprüfte Wahrheiten“, eignet sich aber als Forum der en-gagierten Web-Community sehr gut, um sich über aktuelle Entwicklungen im In-ternet zu informieren.
Die Begriffe und Inhalte werden überwiegend in den folgenden Kapiteln noch ausführlicher behandelt – hier soll jedoch ein erstes gemeinsames Verständnis hergestellt werden. Zudem werden erste Problem- und Handlungsfelder angedeu-tet. Auf die Erklärung schon hinlänglich bekannter Begriffe wie „E-Mail“ oder „Computer“ wird verzichtet.
Apps („application“, dt. Anwendung):
Mit „App“ ist zumeist ein Programm für Smartphones oder Tablet-Computer wie etwa das iPad gemeint. Apps zeichnen sich, wenn sie gut gemacht sind, durch eine spezielle Anpassung an die Zielplattform und große Benutzerfreundlichkeit aus. Dabei reichen die Möglichkeiten von Anwendungen wie Textprogrammen über „Werkzeuge“ wie Taschenrechner oder Wasserwaagen bis hin zu Spielen oder re-duzierten Websites. Apps werden i.d.R. über in das jeweilige Betriebssystem inte-grierte Online-Shops bezogen und kosten – wenn überhaupt – nur wenige Euro. Apps müssen für verschiedene Betriebssysteme unterschiedlich programmiert werden, was mit dem Google-Betriebssystem „Android“ kompatibel ist, funktio-niert nicht zwingend auch auf Apple-Endgeräten.
Viele Apps werden von Verbraucherschützern kritisiert, weil sie ohne das Wissen des Benutzers oder dessen Zustimmung Daten versenden, die für die Funktion der App nicht erforderlich wären. Ein Problem, das bei Social Media und neuen Me-
Lese
probe

100 Kapitel 8: Sozial Media: praxisbezogene Begriffserklärungen
dien immer wieder auftaucht: Vieles scheint kostenlos, doch die Anbieter sind kommerzielle Unternehmen, die Geld verdienen müssen. Ein Weg dazu ist Daten-handel.
Bewertungsplattformen:
Welches Restaurant bietet das beste Essen, welcher Reiseanbieter die günstigsten Zimmer? Aber auch: Lohnt der Besuch der Sonderausstellung im Museum, hat die Inszenierung im Stadttheater ein spannendes Konzept? Bewertungsplattformen gewinnen im Internet an Einfluss, bisher aber stärker im Shopping-, Essen- und Urlaubs-, als im Kulturbereich. Beispiele für Bewertungsplattformen sind „Yelp“, „Qype“, „Foodspotting“ und „HolidayCheck“. Es kann, auch wenn es fragwürdig ist, Sinn machen, von Seiten einer Organisation aus „steuernd“ in Berichterstat-tung über eigene Angebote auf Bewertungsportalen einzugreifen. Dies sollte aber, wenn überhaupt, nur zurückhaltend geschehen.
Blogs:
Ein Blog ist eine Art „Web-Tagebuch“, die Beiträge von einer oder mehreren Per-sonen werden chronologisch angezeigt – die aktuellsten jeweils zuoberst. Blog ist die Kurzform von Weblog, das sich aus den englischen Wörtern web (für das World Wide Web) und log (Logbuch) zusammensetzt. Blogs können sowohl für einen geschlossenen Personenkreis als auch für die Allgemeinheit zugänglich sein. Die Inhalte sind typischerweise persönlicher und stärker meinungsorientiert als auf „offiziellen Homepages“. Die meist vorhandene Kommentarfunktion dient der Kommunikation zwischen dem Herausgeber (Blogger) und dem Leser. Blogs können für Kultur- und Non-Profit-Organisationen ein Sammelpunkt für Web 2.0-Inhalte sein.
Community:
Wenn sich Internetnutzer auf einer Online-Plattform treffen, um sich über be-stimmte Themen oder Interessengebiete auszutauschen, spricht man von einer On-line-Community. Für Kultur- und Non-Profit-Organisationen kann es ein sinnvol-les Ziel sein, Anreize für eine Community zu schaffen, die Social-Media-Seiten der Organisation zum Treffpunkt und Austauschort zu machen. Zugleich kann der eigene Austausch mit der Community Ziel der Social-Media-Bemühungen sein. Wenn die Community die eigene Seite schätzt und nutzt, erfährt die Organisation schnell, was gerade in der Peer-Group Thema ist. Besonders große Communitys entstehen rund um Online-Spiele, die größte versammelt das Online-Rollenspiel „World of Warcraft“.
Content:
Der Inhalt einer Seite, eines Blogs oder auch von Social-Media-Posts. Eine viel-beschworene Internet-Weisheit sagt: Content is King! Das heißt zum einen: Es kommt auf den Inhalt der Seite an, ob sie genutzt wird. Es meint aber auch: Man
Lese
probe

Kapitel 8: Sozial Media: praxisbezogene Begriffserklärungen 101
muss regelmäßig und in relativ hoher Frequenz auf seinen Social-Media-Seiten Inhalt produzieren, um wahrgenommen zu werden.
Crowdfunding:
Eine durch Social Media und Internet-Communitys verstärkt zu beobachtende Fi-nanzierungsform für Projekte: Man stellt ein Projekt, eine Filmidee oder ähnliches vor und sammelt dafür viele kleine Spenden einer an dem Projekt interessierten Online-Community. Oftmals sind die Spenden anonym – aus der im besten Fall großen Zahl von Spendern, erhält man am Ende die angestrebte Summe zur Reali-sierung des Projekts. Manchmal sind Spenden aber auch mit Gegenleistungen verbunden, etwa Einfluss bei den Inhalten oder einer kleinen Rolle in einem Film. Im Kulturbereich wird Crowdfunding bisher vor allem von Musikern und Filme-machern genutzt. Viele Crowdfunding-Projekte scheitern, weil die Projektema-cher nicht das Interesse einer ausreichenden Zahl von potenziellen Spendern we-cken. Wo das Interesse zur Massenbewegung wird, können jedoch große Summen eingeworben werden. Ein prominentes Beispiel ist der überwiegend durch Crowd-funding finanzierte Kinofilm „Iron Sky“. Regisseur Timo Vuorensola warb dafür eine Millionen Euro über Crowdfunding ein (vgl. http://www.sueddeutsche.de/di gital/kinofilm-iron-sky-crowdfunding-fuer-weltraumnazis-1.1325798, zuletzt ge-prüft im Januar 2013). Dies war ihm v.a. möglich, weil er der Internet-Community zuvor schon aus zahlreichen Online-Szene-Filmen bekannt war.
Design:
Im Internet suchen die Nutzer aktiv nach Inhalten – ein gutes Design hilft ihnen, sie auf der eigenen Seite schnell zu finden. „Google“ z.B. ist nicht nur zur meist-genutzten Suchmaschine avanciert, weil sie die besten Treffer liefert – sondern auch, weil die Website auf ein einfaches Eingabefeld reduziert ist. Google ist vom Design her absolut nicht originell, aufwändig oder besonders attraktiv – aber radi-kal zweckdienlich. Was man davon für Kultur- und Non-Profit-Organisationen lernen kann? Seiten benutzerfreundlich zu designen – so, dass auf den ersten Blick klar ist, worum es auf der Seite geht und was man auf ihr machen kann.
Facebook:
Facebook ist das aktuell und mutmaßlich auf absehbare Zeit relevanteste soziale Netzwerk. Das belegen die im vorigen Kapitel genannten Zahlen. In Facebook „postet“ man Texte, Bilder, Videos – und hofft, dass diese eine große Verbreitung dadurch finden, dass andere Nutzer sie teilen. Auch Kultur- und Non-Profit-Betriebe nutzen immer häufiger Facebook um Ideen, Inhalte oder Termine zu ver-öffentlichen. Oftmals fehlt jedoch eine Portal-gerechte Strategie. Wie Kultur- und Non-Profit-Organisationen bei Facebook erfolgreich sein können, ist eines der Hauptthemen der folgenden Kapitel.
Lese
probe

102 Kapitel 8: Sozial Media: praxisbezogene Begriffserklärungen
Instant-Messaging (dt. sofortige Nachrichtenübermittlung):
Dabei kann über eine bestimmte Software („Instant Messenger“) nahezu in Echt-zeit mit anderen Internetnutzern kommuniziert werden. Schreibt man eine Nach-richt an einen anderen Teilnehmer, kann dieser sie sofort lesen und darauf antwor-ten. Es ist möglich, private Unterhaltungen zu führen oder auch an Gruppendis-kussionen teilzunehmen. Die bekanntesten Instant-Messaging-Programme sind Skype, ICQ oder der MSN-Messenger. Die Dienste sind z.T. auch auf Smartpho-nes nutzbar – zusätzlich gibt es dort „WhatsApp“, die verbreitetste Instant-Messaging-App. Über Gruppen in dieser werden mittlerweile an manchen Univer-sitäten ganze Seminarabläufe organisiert. Soziale Netzwerke haben oftmals eigene Instant-Messaging-Funktionen, mit denen man innerhalb des Netzwerks mit Freunden „chatten“ (sich austauschen und z.B. auch Dateien hin und her senden) kann.
Location-based Services (dt. standortbezogene Dienste):
Smartphones, Tablets und z.T. auch Notebooks können über GPS oder auch WLAN den aktuellen Standort ermitteln. Wenn entsprechende Apps installiert sind und die GPS-Nutzung zugelassen wird, können Location-based Services zum jeweiligen Aufenthaltsort passende Tipps und Hinweise geben – oder/und anderen Nutzern anzeigen, wo man sich gerade aufhält. Mit diesen Funktionen können beispielsweise auch Stadtführer oder digitale Schnitzeljagden programmiert wer-den – selbst Medien-Kunstprojekte sind denkbar, bei denen jeweils auf einen be-stimmten Ort bezogen Lieder, Bilder oder Videos abgespielt werden.
Mikroblogging:
Ermöglicht es Nutzern kurze, SMS-ähnliche Textnachrichten zu veröffentlichen. Mit großem Abstand Marktführer im Bereich Mikroblogging ist „Twitter“, wo Textlängen bis 140 Zeichen möglich sind. Diese Mini-Texte können durch Links zu längeren Inhalten (etwa zu einem Blogeintrag) ergänzt werden. Um Zeichen zu sparen, kürzen Nutzer die Links meist ab, dabei helfen Kurz-URL-Dienste wie TinyURL oder bit.ly. Die einzelnen Postings („Tweets“) sind meist öffentlich zu-gänglich und chronologisch geordnet. Eine große Verbreitung erreicht man mit seinen Meldungen, wenn sie von möglichst vielen anderen Nutzern weiterverbrei-tet („Retweetet“) werden.
Netiquette:
Gewissermaßen der „Knigge“ im Internet und auch in Intranets. Der Sammelbe-griff fasst Vorschläge zum Verhalten und verantwortungsvollen Umgang zwi-schen Netzteilnehmern zusammen. Von einem allgemein anerkannten oder auch nur bekannten Regelwerk kann jedoch keine Rede sein. Die Universität Leipzig hat unter www.uni-leipzig.de/netz/netikett.htm (zuletzt geprüft im Januar 2013) Empfehlungen zum Publizieren von Beiträgen im Internet gesammelt. Punkt 1:
Lese
probe

Kapitel 8: Sozial Media: praxisbezogene Begriffserklärungen 103
Vergiss niemals, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt. Punkt 2: Erst lesen, dann denken, dann erst posten. Usw.. Es gehört zur Medienkompetenz, sich die Regeln der Internetkommunikation bewusst zu halten – und sich selbst einen Standard für die Onlinekommunikation zu stecken.
Social Media/Soziale Medien
Der Begriff „Social Media“/„Soziale Medien“ hat im Sprachgebrauch die Be-zeichnung „Web 2.0“ abgelöst – als Sammelbegriff für die neuen Möglichkeiten der Online-Kommunikation. Dabei betont „Social Media“ stärker die soziale Sei-te, den gesellschaftlichen Austauschcharakter, die Vernetzung der Nutzer. Im Un-terschied zum Web 1.0 geht es im Web 2.0 und in Social Media nicht mehr da-rum, einfach nur Informationen ins Netz zu stellen – sondern darum, in Dialoge zu treten, Communitys zu bilden, gemeinsam Inhalte zu kreieren. Das ist eine Her-ausforderung für Kultur- und Non-Profit-Organisationen: Wer einfach nur Infor-mationen „von oben nach unten“ ins Netz stellt, läuft Gefahr, ignoriert zu werden. Ziel muss es mittlerweile sein, Vermittler, Vernetzer, Kommunikator, Initiator, Ideenstifter und Kommunikationspartner für die Peer-Group zu sein.
Social Networks/Soziale Netzwerke
„Soziale Netzwerke“ sind Webdienste bzw. Plattformen wie Facebook, Xing oder MySpace, in denen sich Netzgemeinschaften versammeln. Nutzer können i.d.R. ein persönliches Profil erstellen, eigene Inhalte veröffentlichen, andere Nutzer kontaktieren und sich in Gruppen vernetzen. Wichtig für das Verständnis der Netzwerke ist, dass „Sozial“ sich auf die Art der Netzwerke bezieht, also darauf, dass Menschen untereinander „sozial“ in Kontakt treten. Die Bezeichnung bedeu-tet nicht, dass die Anbieter der Netzwerke besonders „sozial“ sind. Hinter den großen Netzwerken, insbesondere hinter Facebook, stecken unternehmerische In-teressen. Wenn der Zugang kostenlos ist, muss anders Geld verdient werden. Etwa durch Werbung oder den Verkauf von Benutzerdaten.
Suchmaschine
Eine Suchmaschine ist ein Programm zur Recherche von Dokumenten, Texten und Seiten, die in einem Computer oder Computernetzwerk gespeichert sind. Ge-meint sind meist Suchmaschinen, die das World Wide Web durchforschen und ei-nem so ermöglichen, Informationen und Seiten zu bestimmten Suchanfragen zu finden. Die mit Abstand meistgenutzte Suchmaschine ist Google (in Deutschland www.google.de). Google und andere Suchmaschinen erstellen Schlüsselwort-Indizes um Suchanfragen über Schlüsselwörter mit einer nach Relevanz geordne-ten Trefferliste zu beantworten. Zuoberst angezeigt werden neben bezahlten Tref-fern (auch Google finanziert sich über Werbung), die Seiten, die am genauesten zu den Suchbegriffen passen – und die nach Internet-Maßstäben am relevantesten sind. Dies wird u.a. nach Klickzahlen und der Zahl der Verlinkungen berechnet. Wer eigene Seiten erstellt, die von Suchmaschinen mit hohem Rang angezeigt
Lese
probe

104 Kapitel 8: Sozial Media: praxisbezogene Begriffserklärungen
werden sollen, muss seine Inhalte deshalb für Suchmaschinen optimieren. Er muss also passende Schlagworte hinterlegen, für Verlinkungen sorgen usw. Ein erster Überblick zur Suchmaschinenoptimierung ist unter http://de.wiki pedia.org/wiki/Suchmaschinenoptimierung zu finden (zuletzt geprüft im Januar 2013).
Google bietet über die üblicherweise genutzten Suchbefehle hinaus zahlreiche Möglichkeiten, um das Netz effektiver nach Informationen zu durchforsten. Mit dem Befehl „site:“ z.B. kann man bestimmte Seiten durchsuchen, eine Funktion die oftmals besser funktioniert als seiteneigene Archive. Einen Überblick über die Google-Zusatzbefehle gibt es unter: http://support.google.com/websearch/ (zuletzt geprüft im Januar 2013).
Twitter ist Marktführer im Bereich Mikroblogging. Nach firmeneigenen Angaben nutzten Ende 2011 rund 100 Millionen Personen, Unternehmen und Nichtregie-rungsorganisationen mindestens einmal im Monat das Angebot. Angemeldet sind noch wesentlich mehr Nutzer, sie „twittern“ z.T. nicht selbst sondern empfangen nur als „Follower“ („Anhänger“/„Verfolger“) Nachrichten von Menschen, die sie interessieren. Die meisten Follower haben Prominente, den Rekord hielt 2012 die Sängerin Lady Gaga mit 27,2 Millionen Followern. Aber man kann auch Politi-kern, Wissenschaftlern oder Institutionen „folgen“ – Twitter bietet ihnen die Mög-lichkeit, mit kurzen Nachrichten schnell große Gruppen zu erreichen. Das ist Chance und Risiko zugleich für Kultur- und Non-Profit-Organisationen, darauf wird in den weiteren Kapiteln dieses Studienbriefs genauer eingegangen. Ein wichtiger Begriff in der Twitter-Welt ist „Hashtag“: Ein Hashtag ist ein Stichwort in Form eines „Tags“. Die Bezeichnung stammt vom Doppelkreuz „#“ (engl. „hash“), mit dem das betreffende Wort markiert wird, Beispiel: „#DISC“. Im Gegensatz zu anderen Tag-Konzepten werden Hashtags direkt in die eigentli-che Nachricht eingefügt; jedes Wort, vor dem ohne Leerzeichen ein Doppelkreuz steht, funktioniert als Tag. Die „Tweets“ genannten Twitter-Nachrichten sehen durch die vielen Hashtags oft seltsam aus, die Tags dienen aber der internen Suchmaschinen-Optimierung und der gegenseitigen Bezugnahme unter verschie-denen Tweets. Hashtags dienen z.T. auch als ironische Form des Kommentierens eines Tweets, indem man ihn in einen Zusammenhang stellt, der unerwartet ist und dem Tweet eine neue Konnotation gibt. Das ist für weniger Twitter-affine Nutzer oft schwer verständlich und kann zu Missverständnissen führen.
Web 1.0
Die Vergangenheit im Internet. Für technisch wenig versierte Nutzer gab es kaum Möglichkeiten, sich aktiv im Internet einzubringen. Die größtenteils statischen In-halte wurden von wenigen „Produzenten“ erstellt und von zahlreichen „Konsu-menten“ abgerufen. Das Web 2.0 setzt viel stärker auf Austausch und gemeinsam entstehende Inhalte, s.o.. Dennoch kann es auch heute noch richtig sein, sich bei
Lese
probe

Kapitel 8: Sozial Media: praxisbezogene Begriffserklärungen 105
bestimmten Seiten oder Inhalten zu entscheiden, eher der Web 1.0-Logik zu fol-gen. So muss die offizielle Homepage einer Organisation noch nicht alle Mög-lichkeiten des Web 2.0 beinhalten, sie kann durchaus bewusst erst einmal Inhalte sammeln und setzen – die dann eben ggf. auf zusätzlichen Social-Media-Seiten diskutiert und erweitert werden können.
Web 2.0
Technische Fortschritte im Internet ermöglichen seit Mitte der Nullerjahre, dass auch Laien Informationen und Inhalte online stellen können. Immer mehr Inhalte im Internet entstehen als „user generated content“ („nutzergenerierte Inhalte“) al-so als (Gemeinschafts)Produktion von Bloggern, Communitys und Co.. Die Inhal-te unterscheiden sich in Struktur und Inhalt deutlich von den klassischen von einer Institution X gesetzten Inhalten. Im Idealfall gelingt es Unternehmen und auch Kultur- oder Non-Profit-Organisationen heute, sowohl im Sinne des Web 1.0 zu informieren – als auch die Chancen des Web 2.0 für sich zu nutzen.
Wiki
Ein Wiki (hawaiisch für „schnell“), ist ein Hypertext-System für Webseiten, deren Inhalte von den Benutzern nicht nur gelesen, sondern auch online direkt im Webbrowser geändert werden können. Diese Eigenschaft wird durch ein verein-fachtes Content-Management-System, die sogenannte Wiki-Software oder Wiki-Engine, bereitgestellt. Die Grundidee bei Wikis ist das gemeinschaftliche Arbeiten an Texten, ggf. ergänzt durch Fotos oder andere Medien. Das Ziel ist häufig, die Erfahrung und den Wissensschatz der Autoren kollaborativ auszudrücken (Kol-lektive Intelligenz). Die Änderbarkeit der Seiten durch jedermann setzt zudem ei-ne ursprüngliche Idee des World Wide Web konsequent um. Die bekannteste An-wendung ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia, kleinere Wikis werden aber auch von Organisationen zu bestimmten Themen gegründet. „Wikipedia“ ist als Wissensquelle umstritten, da auch fehlerhafte Texte vorkommen – solange die Fehler nicht gefunden und korrigiert werden. Insbesondere zu Online-Fragen und Social-Media-Entwicklungen ist das dynamische Lexikon aber eine sehr gute Quelle – wird es doch von denselben Leuten gepflegt, die auch Trends und Platt-formen im Internet fortlaufend weiterentwickeln.
Neben „Wikipedia“ gibt es zahlreiche weitere Wikis, das mct media consulting team aus Dortmund z.B. hat ein Zeitungs-Wiki für Schulprojekte eingerichtet: www.zeitungswiki.de (zuletzt geprüft im Januar 2013).
World Wide Web (engl. für „Weltweites Netz“)
Das World Wide Web (kurz Web oder WWW) ist technisch formuliert ein über das Internet abrufbares System von elektronischen Hypertext-Dokumenten, die durch Hyperlinks miteinander verknüpft sind und über die Protokolle HTTP bzw.
Lese
probe

106 Kapitel 8: Sozial Media: praxisbezogene Begriffserklärungen
HTTPS übertragen werden. Zur Nutzung des World Wide Web wird ein Webbrowser benötigt, der die Daten vom Webserver holt und auf dem Bildschirm anzeigt. Der Benutzer kann den Hyperlinks im Dokument folgen, die auf andere Dokumente verweisen, gleichgültig ob sie auf demselben Webserver oder einem anderen gespeichert sind. Dadurch ergibt sich ein weltweites Netz aus Webseiten. Das Verfolgen der Hyperlinks wird oft als Internetsurfen bezeichnet. Das WWW wird im allgemeinen Sprachgebrauch oft mit dem Internet gleichgesetzt, obwohl es jünger ist als das Internet insgesamt und nur eine von mehreren möglichen Nut-zungen des Internets darstellt. Dennoch: Auch wenn die Strukturen aus Netzwer-ken, Servern, Datenkabeln, Schnittstellen und Co. im Hintergrund ungemein komplex sind – die normale Nutzung des Internets, das „Surfen“ ist für die aller-meisten Menschen heute selbstverständlich. Das Web ist der global vernetzte Ort, an dem Organisationen mit ihren Online-Angeboten unterwegs sind. Es ist ein un-überblickbarer Riesen-Marktplatz für Informationen – nirgendwo sonst lassen sich Inhalte so leicht weltweit zugänglich machen.
Übungsaufgabe 32:
Was unterscheidet das Web 1.0 vom Web 2.0?
Übungsaufgabe 33:
Welche Begriffe fehlen in diesem Kapitel? Wo haben Sie noch Verständnis-schwierigkeiten? Recherchieren Sie online die Antworten.
Übungsaufgaben
Lese
probe

Kapitel 9: Fragen vor der schnellen Nachricht 107
9 Fragen vor der schnellen Nachricht
Lerninhalte
Medienkompetenz im Web 2.0
Risiken bei der Kommunikation in sozialen Medien
Auseinandersetzung mit Beispielen der Social-Media-Kommunikation
9.1 Aufmerksamkeit ist nicht immer alles
Die Kommunikation in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter zielt zu-meist in erster Linie darauf, möglichst viele Anhänger bzw. Follower zu finden – und eine möglichst große Verbreitung der eigenen Inhalte, dadurch dass diese Follower die eigenen Posts teilen oder Tweets retweeten. Allerdings widerspricht die Logik der sozialen Netzwerke oftmals der Logik und den Interessen von Kul-tur- oder Non-Profit-Organisationen. Besonders effektiv machen oftmals Provoka-tionen, Polemiken oder Peinlichkeiten die digitale Runde – aber genau diese möchte man den Nutzern im Normalfall lieber nicht bieten. Der erste Schritt, um sich sicher und effektiv in sozialen Netzwerken zu bewegen, ist deshalb, sich ge-nau zu fragen, was man dort erreichen will – und auf welchem Weg dies möglich sein kann. Dieses und die nächsten Kapitel zeigen anhand von Praxisbeispielen, was Chancen und was Risiken in sozialen Netzwerken sind – und welche Fragen man sich auch online stellen sollte, bevor man auf „veröffentlichen“ klickt. Denn gerade für Kultur- und Non-Profit-Organisationen, die oftmals von ihrem guten Image und ihrer Reputation leben, gilt: Aufmerksamkeit ist nicht immer alles!
9.1.1 Praxisbeispiel: SPD sammelt für Steinbrück
Im Oktober und November 2012 startete Peer Steinbrück offiziell als Kanzlerkan-didat der SPD. Das ausgerufene Ziel: Bei der nächsten Bundestagswahl will er als Kanzler an der Spitze einer rot-grünen Regierung Angela Merkel und ihre Koali-tion aus Union und FDP ablösen. Die öffentliche und von SPD und Grünen veröf-fentlichte Meinung ist, dass Steinbrück der beste Kandidat sei und es mit ihm die Chance geben könnte, in einem Bündnis von SPD und Grünen zu regieren. FDP und CDU/CSU reagieren auf die Ernennung des Kanzlerkandidaten indem sie versuchen, Steinbrück persönlich zu diskreditieren. Sie werfen ihm seine zahlrei-chen hochdotierten Vorträge vor, insbesondere um einen mit 25.000 Euro dotier-ten Talk bei den Bochumer Stadtwerken entsteht politische Aufregung. Peer Steinbrück versucht, stattdessen wieder politisch Akzente zu setzen und kündigt eine Rede im Bundestag bei der Diskussion zum umstrittenen Betreuungsgeld an. Daraufhin twittert die Vize-Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Ekin De-
1. Ziel zumeist: möglichst viele Anhänger, möglichst große Verbreitung
Wichtig ist aber: Image und Reputation beachten
Lese
probe

108 Kapitel 9: Fragen vor der schnellen Nachricht
ligöz: „Habe gehört, in der SPD wird gesammelt, am Freitag soll Steinbrück re-den.“
Der Tweet wird vielfach retweetet und verbreitet sich schnell, Ekin Deligöz wird in zahlreichen Medien zitiert, z.B. auch überregional in der Süddeutschen Zeitung. Ihr Bonmot, schnell über Twitter verbreitet, wird zum politischen Witz der Woche in Berlin, vielfach zitiert, variiert und nacherzählt.
War dieser Tweet also ein Erfolg?
In jedem Fall, wenn es um die größtmögliche Aufmerksamkeit geht. Auf einmal kennt man Ekin Deligöz, findet sie geistreich, witzig, vielleicht sympathisch. Bei der Live-Übertragung der Debatte im Bundestag zeigt der TV-Sender Phoenix immer wieder, wie sie in den Reihen der Grünen sitzt. Der Tweet hat Ekin De-ligöz bekannter gemacht, möglicherweise auch ihr Profil geschärft.
Aber was sind die „Kosten“? Die Überschrift über dem Artikel in der Süddeut-schen Zeitung ist „Grüne gehen auf Distanz zu Steinbrück“ (09.11.2012), in der Bundestags-Debatte zitieren genüsslich die Politiker von CDU/CSU und FDP den Witz, halten den Fokus so auf Steinbrücks Nebengeschäften statt bei seinem Dis-kussionsbeitrag zum Betreuungsgeld. Auch die Medien berichten weiter vornehm-lich über Steinbrücks Nebeneinkünfte – und beginnen parallel zu spekulieren, ob es nach der Wahl auch eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen geben könnte. Die Grünen bestreiten dies öffentlich auf allen Ebenen.
Deshalb noch einmal die Frage: War der Tweet ein Erfolg?
Nein – wenn man nicht unterstellt, dass Ekin Deligöz bewusst die Chancen für ei-nen Regierungswechsel hin zu Rot-Grün senken wollte. Ihr Tweet nutzt politisch nur den Gegnern, der CDU/CSU und der FDP – für sie ist es ein Glücksfall, dass Steinbrück auch aus den „eigenen Reihen“ auf diese Weise verspottet wird. Stein-brück gelingt es nicht, das Nebeneinkünfte-Thema abzustreifen, Ende November 2012 ist es soweit, dass erste Kommentatoren fragen, ob er nicht von dem Kandi-daten-Amt zurücktreten müsste. Aber: Es ist kein anderer Kandidat bereit, SPD und Grüne als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf führen.
Ekin Deligöz ist vielleicht etwas bekannter als vorher, erntet mehr Lächeln auf den Fluren des Bundestags – aber hat sich und ihrer Partei den Wahlkampf we-sentlich erschwert.
An diesem Fall wird beispielhaft deutlich, dass man sich auch vor jedem noch so kleinen Tweet oder Post in sozialen Netzwerken fragen sollte:
Was ist mein Ziel?
Zu welcher Reaktion bei wem wird mein Post/Tweet führen?
Wen beschädige ich möglicherweise mit meinem Post/Tweet?
Licht- und Schatten-seiten eines Tweets
Fragen vor der Veröffentlichung
Lese
probe

Kapitel 9: Fragen vor der schnellen Nachricht 109
Passt der Post/Tweet zu dem was ich/was meine Institution vermitteln möchte?
Sollte ich vielleicht gerade besser schweigen?
9.1.2 Praxisbeispiel: Israelisches Apartheitsregime
Noch ein zweites Beispiel macht die Risiken der schnellen, unreflektierten politi-schen Kommunikation per Social Network deutlich: Im März 2012 besuchte SPD-Parteichef Sigmar Gabriel auf einer Nahost-Reise das Westjordanland. „Live“ von dort postete er auf seiner Facebook-Seite: „Ich war gerade in Hebron. Das ist für Palästinenser ein rechtsfreier Raum. Das ist ein Apartheid-Regime, für das es kei-nerlei Rechtfertigung gibt.“
Der Vorsitzende einer deutschen Volkspartei nennt Israel ein Apartheid-Regime – natürlich folgte darauf ein großer Aufschrei. Mehrere Hundert kritische Facebook-Kommentare, „Skandal!“-Rufe bei der CDU, Rügen aus Israel. Gabriel rechtfer-tigte sich später, er habe unter dem Eindruck der bedrückenden Situation gestan-den und nur widergegeben, was er und die Begleiter im Angesicht eines offen-kundigen Unrechts empfunden hätten (vgl. z.B. Die Welt, 15.3.2012).
Hier sind die Fragen an den Post etwas andere als beim Beispiel Deligöz:
Ist die radikale Verknappung, zu der Facebook zwingt, eine angemessene Form des Umgangs mit Themen solcher Tragweite?
Sollte ein Spitzenpolitiker seine persönliche Betroffenheit so ungefiltert in die Welt senden?
Rechtfertigt der Wille, modern und bürgernah zu wirken, eine solche Art von Selbstdarstellung und politischer Verknappung?
Wie viel Provokation, wie viel Zuspitzung ist „erlaubt“ bzw. sinnvoll?
Personen und Organisation des öffentlichen Lebens muss stets bewusst sein, dass ihre Meinungs-Veröffentlichungen nie nur als privat verstanden werden – sondern auf ihre öffentliche Rolle und ihre Organisation bezogen werden. Deshalb muss gerade vor Meinungsäußerungen genau geprüft werden, wer sie wie interpretieren wird, zu welchen Zuspitzungen und Polemiken sie einladen – und ob sie tatsächlich im Sinne der Organisation bzw. der behandelten Sache sind.
9.1.3 Praxisbeispiel: Die Sex-Piratin
Im Düsseldorfer Landtag twittert Birgit Rydlewski, 42, Landesvorsitzende der Pi-ratenpartei, kurz nach der Wahl über ihr Sexleben und beschreibt ihre HIV-Sorgen nach einem Akt mit gerissenem Kondom. Die Folge ist große Aufregung, Kritik an den Piraten, Spott – und Sorge um die Würde des Landtags. Im November 2012 legt die Landtagsabgeordnete nach: Zum einen zwitschert sie über den vor
Meinungsäußerungen und Äußerungen persönlicher Betroffenheit sind besonders gefährlich
Lese
probe

110 Kapitel 9: Fragen vor der schnellen Nachricht
ihr sitzenden Fraktionskollegen Michele Marsching: „Ich darf nicht an @mmarsching lecken“ – und klagt zum anderen über Langeweile: „Das mit den langen Plenarsitzungen wäre nicht so schlimm, wenn es morgen nicht genauso wäre ...“
Die BILD-Zeitung macht daraus erwartungsgemäß eine Story über das „Twitter-Luder der Piraten“ und nennt Rydlewski fortan die „Sex-Piratin“ (BILD 13.11.2012), andere Medien und Politiker kritisieren, wie wenig ernst die für ihr Mandat gut alimentierte Abgeordnete ihre politische Arbeit offenbar nehme. Und der Piraten-Fraktions-Chef kritisiert Rydlewski als „reichlich naiv“. Die Piraten-partei kämpft zu der Zeit um ihr politisches Überleben, will mit Inhalten ernst ge-nommen werden – da sind Schlagzeilen wie die zu Rydlewski Gift. Sie hat offen-kundig nicht verstanden, dass ihre Tweets als Abgeordnete und Person des öffent-lichen politischen Lebens anders verfolgt und bewertet werden, als „Privat-Tweets“. Von einer Abgeordneten der „Internet-Partei“ hätte man mehr Medien-kompetenz erwarten können.
Abb.3: So kann es kommen, wenn man als Person des öffentlichen Lebens in sozialen Netz-werke seine Posts nicht abwägt. (Quelle: www.bild.de)
Traditionelle Medien nehmen Social-Media-„Skandale“ dankbar auf
Lese
probe

Kapitel 9: Fragen vor der schnellen Nachricht 111
9.2 Medienkompetenz 2.0
Zur Medienkompetenz in Social Media, man könnte sagen, zur Medienkompetenz 2.0, gehört es, genau solche Fragen wie anhand der drei Beispiele skizziert, zu stellen – bevor ein Post oder Tweet veröffentlicht wird. Es gilt für Institutionen und letztlich auch für jeden Privatmenschen, sich vor jeder Veröffentlichung be-wusst zu machen, wozu sie führen könnte. Und sich dann zu fragen, ob die Veröf-fentlichung wirklich sein soll. Twitter und Facebook senken die Hemmschwelle für Kommunikation ungemein – trotzdem ist nicht jeder Gedanke ungefiltert für die Öffentlichkeit geeignet. Was einmal abgesandt ist, ist nicht mehr einfangbar. Selbst Löschen hilft wenig, wenn Posts oder Tweets schon geteilt und zitiert wur-den.
Die drei Praxisbeispiele wurden bewusst aus dem Bereich der Politik gewählt, weil hier Reaktionen und Folgen besonders charakteristisch zu zeigen sind. Aber auch „im Kleinen“, für sich persönlich oder für die eigene Organisation, muss man sich bei jedem Post oder Tweet fragen, was für ein Bild man mit ihm vermit-telt – und ob man dieses Bild vermitteln will. Denn, auch wenn dafür manchmal das Bewusstsein fehlt: Jeder Tweet oder Post ist eine Veröffentlichung, die auf das Image zurückwirkt.
Übungsaufgabe 34:
Was könnte aus Sigmar Gabriels Sicht der „Gewinn“ mit seinem Post gewesen sein? Wiegt der Gewinn möglicherweise die beschriebenen „Schäden“ auf?
Übungsaufgabe 35:
Erinnern Sie sich an ein aktuelles Beispiel eines umstrittenen Posts oder Tweets und überlegen Sie, welche Fragen sich der Absender/die Absenderin vorab hätte stellen sollen?
Was einmal abgesandt ist, ist nicht mehr einfangbar
Jeder Tweet oder Post wirkt auf das Image
Übungsaufgaben
Lese
probe

112 Kapitel 9: Fragen vor der schnellen Nachricht
Lese
probe

Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien 113
10 Chancen der Social-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien
Lerninhalte
Medienkompetenz im Web 2.0
Chancen bei der Kommunikation in sozialen Netzwerken
Strategieentwicklung für die Kommunikation in sozialen Netzwerken
Kennenlernen der wichtigsten Tools und Plattformen
Beschäftigung mit Beispielen aus dem Kultur- und Non-Profit-Bereich
An verschiedenen Beispielen wurden Risiken der Social-Media-Kommunikation beschrieben. Der Schluss daraus soll jedoch nicht sein, nicht in sozialen Netzwer-ken zu kommunizieren – sondern es besser und bedachter zu machen. Social Me-dia bietet große Chancen, gerade auch für Kultur- und Non-Profit-Organisationen. In diesem Kapitel werden die positiven Möglichkeiten beschrieben und beispiel-haft mögliche Plattformen für verschiedene Kommunikationsarten charakterisiert. Zudem wird beschrieben, wie eine kongruente Online-Strategie entwickelt werden kann – und wo dies beispielhaft gelungen ist.
Die Chancen für Kultur- und Non-Profit-Organisationen in Social Media sind Ka-rin Janners Aufsatz „Kulturmarketing 2.0“ folgend (2010: 119ff):
Steigerung des Bekanntheitsgrades,
Aufbau eines bestimmten Images,
Ansprache neuer Zielgruppen,
direkte Rückkopplung mit der Peer-Group.
Das sind sehr große Chancen, wenn man bedenkt, dass man sie mit Plattformen angehen kann, deren Nutzung kostenlos ist. Die Chance bestimmte Gruppen ziel-genau anzusprechen, ist in Facebook wesentlich größer, als bei klassischeren Werbemethoden, wie etwa Plakatwerbung oder dem Verteilen von Postkarten. Gerade der direkte Dialog mit der Zielgruppe ist wertvoll – so sind Stimmungen und Haltungsänderungen zu erfahren, die man früher teuer in Befragungen hätte erforschen müssen. Wenn „Marketing“ in sozialen Netzwerken gut funktioniert, macht es eine Organisation zum Zentrum oder zumindest zum wichtigen Mit-Kommunikatoren für bestimmte Gruppen oder Bewegungen. Was z.B. könnte ei-nem Theater besseres passieren, als wenn Theaterinteressierte die Links, Trailer, Ankündigungen des Theaters aufgreifen und selbst weiter verbreiten? Was einer politischen Organisation besseres, als wenn sich ihre Thesen oder Ergebnisse von
Chancen für Kultur- und Non-Profit-Organisationen in Social Media
Organisationen als Zentrum der Kommunikation
Lese
probe

114 Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien
Forschungen eigenständig von Interessiertem zu Interessiertem in sozialen Medi-en weiterverbreiten?
Die besondere Qualität im Web 2.0 ist gerade für Kultur- und Non-Profit-Organisationen, dass mit den richtigen Ideen auch mit kleinen Budgets große Wirkung erzielt werden kann. Denn die Organisationen müssen „nur“ den Inhalt, den Content liefern – wenn er gut ist, übernehmen die anderen Internet-Nutzer ei-genständig das, was in der Vertriebssprache Distribution heißt. Und selbst Journa-listen sind nicht mehr zwingend als „Tor zur Öffentlichkeit“ nötig. Die klassische Öffentlichkeitsarbeit lief so, dass Meldungen verschickt oder Geschichten kreiert wurden – in der Hoffnung, dass Journalisten über sie berichten. Wenn sie das nicht taten, wurde manches schlicht nicht öffentlich, oder nur in sehr begrenztem Rahmen wahrgenommen. Im Web 2.0 können Kultur- und Non-Profit-Organisationen ihre Meldungen, Botschaften und Geschichten direkt und ungefil-tert kommunizieren (vgl. Janner 2010: 119).
Damit man für diese direkte und ungefilterte Kommunikation aber auch Em-pfänger hat, muss man sich genau mit den Möglichkeiten und Regeln sozialer Medien vertraut machen.
10.1 Marketing in Social Media
„Bevor Sie nun eine Social-Media-Marketingkampagne starten, sollten Sie klar sagen und genau erkennen, was Sie erreichen möchten. Worauf hoffen Sie? (...) Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Social Media ohne eine konkrete Zielsetzung nach hinten losgehen kann.“ (Weinberg 2011: 23).
Für eine politische Organisation könnte es z.B. das Ziel sein, die eigene Bekannt-heit möglichst stark zu steigern. Dann könnte eine Strategie mit niedrigschwelli-gen Angeboten, zugespitzten Botschaften, provokanten Themen, scheinbaren Ta-bu-Brüchen und einer prägnanten Bild-Sprache effektiv sein.
Wenn das Ziel eher ist, bei einer kleinen aber an den Themen der Organisation stark interessierten Peer-Group zum relevanten Mit-Kommunikator zu werden, wäre die Strategie gänzlich anders. Die Organisation müsste eher auf exklusive Informationen und ungewöhnliche Thesen bauen, könnte und müsste komplexer kommunizieren, ggf. auch in längeren Texten – und sie müsste sich viel stärker auf Dialoge einlassen, Impulse aufnehmen und in die Peer-Group geben.
Auch für Kulturinstitutionen sind gänzlich unterschiedliche Strategien des Social-Media-Marketings möglich – es gibt gerade online sehr unterschiedliche Ziel-gruppen mit divergierenden Interessen und Sprach-Codes. Es erfordert andere Mittel, ein avanciertes Kunst-Publikum zu erreichen, als etwa für ein Jugendstück zu werben.
Große Wirkung mit kleinen Budgets möglich
Genaue Ziele definieren
Gänzlich unterschied-liche Strategien möglich
Lese
probe

Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien 115
Aber egal welche Zielgruppe erreicht werden soll und was das Kommunikations-ziel ist: Beides muss vorher genau überlegt und zum Mittelpunkt der Kommunika-tionsstrategie gemacht werden.
Und einige „Regeln“ gilt es für alle Zielgruppen bei der Social-Media-Kommu-nikation zu beachten.
10.1.1 „Regeln“ der Social-Media-Kommunikation
„Im Social-Media-Marketing geht es um echte, persönliche Beziehungen. Sie müssen also zuhören und angemessen antworten. Recherche und sorgfältige Pla-nung sind notwendig, um herauszufinden, auf welche Weise Sie die Mitglieder der Community am besten ansprechen. Wenn Sie einfach ohne Rücksicht auf Ihre Umgebung und Ihren sozialen Raum ins Spiel einsteigen, kann das katastrophale Folgen haben.“ (Weinberg 2011: 23)
Zentral bei allen Formen von Social-Media-Kommunikation ist: Man muss dem Medium, der jeweiligen Plattform entsprechend kommunizieren. Twitter etwa er-laubt gar keine langen Texte – aber auch in Facebook stoßen lange Nachrichten eher auf Unverständnis. Das Geschriebene muss pointiert und schnell zu erfassen sein, sonst hat der Tweet oder Post keine Chance. Das macht schon deutlich: Ein-fach die Pressemeldung oder andere News einer Organisation in sozialen Medien „zweitzuverwerten“ wird nicht gut funktionieren. Es ist natürlich machbar – wird aber nicht auf großes Interesse der Social-Media-Gemeinde stoßen. Zentral für die Kommunikation in sozialen Medien sind Authentizität und Transparenz. Die Menschen bei Facebook, Twitter oder in einem Blog interessieren sich überwie-gend nicht für reine Informationen oder Nachrichten – sondern für die Institution und insbesondere die Menschen dahinter. Sie wollen das Gefühl haben, hinter die Kulissen zu gucken, besonderen Einblick zu haben, möglicherweise auch jemand Berühmtem oder einer bekannten Organisation nahe zu sein. Tweets und Posts in sozialen Netzwerken müssen diese emotionale Ebene der Kommunikation mitbe-dienen – und persönlich sein oder zumindest einen persönlichen Anstrich haben. Karin Janner fasst die wichtigsten Kommunikationsregeln im Web 2.0 für Kultur-Organisationen so zusammen (2010: 120):
Es geht um direkte Kommunikation und Beziehungsaufbau und nicht um Un-terbrecherwerbung.
Bespielen Sie Social Networks nicht nur mit Ihren Botschaften und Infor-mationen – es geht um Austausch. Nehmen Sie den Rückkanal ernst, hören Sie zu und reagieren Sie auf Feedback.
Authentizität: Im Web 2.0 geht es nicht um perfekte Formulierungen, sondern um eine persönliche und „echte“ Darstellung Ihrer Einrichtung und der Perso-nen, die dahinterstehen. Damit Ihre Botschaften glaubwürdig sind, müssen die Personen, die kommunizieren, selbst daran glauben!
Gepflogenheiten der Plattformen kennen und annehmen
Übersicht über die wichtigsten Kommu-nikationsregeln
Lese
probe

116 Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien
Transparenz: Wer sind die Personen hinter Ihrer Einrichtung, welche Ziele und Visionen verfolgen Sie? Liefern Sie Hintergrundberichte und lassen Sie Perso-nen zu Wort kommen, die in Ihren Pressemitteilungen nicht zu Wort kommen.
Im Web 2.0 werden Ihre Fans zu Ihren Markenbotschaftern, Sie haben dabei aber nicht immer die volle Kontrolle über die Botschaften.
Diese Übersicht macht vieles deutlich – auch, dass die sinnvolle Nutzung von Social Media zwar keine materiellen Ressourcen kosten muss, aber viel Zeit. Das ist einer der Hauptgründe, warum viele Kultur- und Non-Profit-Organisationen im Web 2.0 noch nicht so gut aufgestellt sind, wie sie es sein könnten. Manche lehnen ein eigenes Engagement in sozialen Plattformen ab – und vergeben dadurch Chancen. Viele andere sind bei Facebook oder auch bei Twitter online, bespielen ihre Accounts aber ohne Strategie und oft v.a. mit puren Informationen, die auch auf der normalen Homepage zu finden wären. Auch diese Organisationen vergeben eine Chance. Das ist gut für pfiffige Social-Media-Manager: Noch immer ist es möglich, sich durch gute Konzepte und eine kongruente Strategie schnell positiv von Konkurrenten zu unterscheiden.
10.2 Es geht nicht nach „Schema F“
Für jede Organisation, für jede Social-Media-Seite muss eine individuell passende Strategie entwickelt werden. Arbeit nach einem „Baukasten-Prinzip“ oder „Sche-ma F“ ist nicht sinnvoll möglich und soll deshalb durch diesen Studienbrief auch nicht vermittelt werden. An jede Internetpräsenz müssen neu individuelle, auf die jeweilige Organisation, ihr Image und ihre Zielgruppe bezogene Fragen gestellt – und individuelle Antworten gefunden werden. Damit dies möglich ist und effekti-ve Social-Media-Konzepte entwickelt werden können, ist Medienkompetenz 2.0 nötig, die genaue Kenntnis von Plattformen, Kommunikationsformen, Chancen und Risiken. Dieser Studienbrief soll zur Entwicklung dieser Social-Media-Medienkompetenz beitragen und helfen, die richtigen Fragen und Antworten für ganz unterschiedliche Online-Veröffentlichungen zu finden. Eine ganze Reihe von Problemen und Aufgaben in der Social-Media-Kommunikation wurden bereits genannt. Um die strategischen Kern-Überlegungen noch einmal konkreter durch-zuspielen, folgt hier die skizzenhafte Beschreibung möglicher Facebook-Ideen für ein Theater.
10.2.1 Facebook-Überlegungen am Beispiel eines Theaters
Stellen wir uns vor, ein kleines Stadttheater plant eine neue Facebook-Präsenz.
Die erste Frage ist: Was möchten wir erreichen? Mehr Publikum in der Regel, aber auch einen Imagegewinn, die Profilierung als Kommunikator in einem be-stimmten gesellschaftlichen Feld, z.B. als politisch engagierte Kulturschaffende.
Noch immer ist es möglich, sich positiv von Konkurrenten zu unterscheiden
Für jede Internetprä-senz müssen neue Antworten gefunden werden
Was soll erreicht werden?
Lese
probe

Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien 117
Diese erste Frage hängt eng mit der zweiten zusammen, was in diesen beiden Fra-gen entschieden wird, bestimmt alle späteren Überlegungen.
Die zweite Frage ist: Wer ist die Zielgruppe? Meist ist an Theatern (und auch in anderen Kulturinstitutionen) die Antwort indifferent: Unser Publikum, aber es sol-len auch gerne noch mehr Menschen aus der Stadt und darüber hinaus auf uns aufmerksam werden... Hier müsste man nachfragen und versuchen, die Zielgruppe enger zu fassen. Denkbar wäre eine Seite, die sich stark auf die Stadt und ihre Bürger bezieht, die Diskussionsthemen „von der Straße“ aufgreift und so selbst zum Forum wird. Das Theater und sein Facebook-Auftritt als Diskursort in der Stadt. Das könnte lokal Interesse wecken – würde ein überregionales Publikum aber eher ausschließen. Wenn eher ein überregionales Kunstpublikum angespro-chen werden soll, müsste die Seite auf eine besondere Kunst-Facette, avanciertes Theater, Unterschiede zu anderen Bühnen setzen. So könnte sie Interesse bei ei-nem Fachpublikum wecken, würde u.U. aber in der Stadt nicht auf große Reso-nanz über das Stammpublikum hinaus stoßen.
Man merkt es gleich: Erste Fragen – erste Probleme – erste Chancen.
Wenn Ziel und Zielgruppe entschieden sind, kommt als nächstes die Frage: Was möchten wir veröffentlichen? Die Antwort muss sich am Ziel und an der Ziel-gruppe ausrichten – und an den oben zitierten „Regeln“. Persönlich, authentisch, transparent. Reine Veranstaltungstipps werden in sozialen Netzwerken kaum Re-sonanz finden. Hintergrundberichte, Videos, Einblicke in die Probenarbeit, Ma-king-of-Bilder, exklusive Fotos oder Videos von Stadtaktionen, persönliche Kommentare von Beteiligten, Impulse zu echten Diskussionen – die Klickzahlen und Weiterleitungen gehen nach oben!
Das klingt banal, kann in der Praxis aber schwer sein. Woher die exklusiven In-halte nehmen, wenn niemand extra dafür zuständig ist? Und welche Interna will man veröffentlichen? Zugespitzt gesprochen: Es wäre sicher ein potenzieller Klick-Hit, ein Probenvideo auf die Seite zu stellen, in dem sich ein in der Stadt bekannter Schauspieler gerade aufs peinlichste blamiert. Aber will man das? Im Theater, wie auch in anderen Institutionen, gibt es oftmals eine Konfliktlinie zwi-schen den eigenen Ansprüchen an Veröffentlichungen – z.B. auch manchem Aberglauben, etwa vor der Premiere nicht das Bühnenbild zu „verraten“ – und der Sehnsucht der Netz-Gemeinde nach exklusiven Einblicken und totaler Transpa-renz. Wer sich in diesem Feld sinnvoll bewegen will, muss dennoch eigene Ant-worten finden, die über das reine Meldungs-Abladen auf Facebook hinausgehen. Er muss Videoblogs entwerfen, kleine Serien erfinden, ungewöhnliche Einblicke zugänglich machen – und dabei noch selbst im Forum präsent, offen und sympa-thisch sein.
Im Falle des Theater-Beispiels könnten beispielsweise diese Serien oder Nach-richtenformate Interesse finden:
Wer ist die Zielgruppe?
Was soll veröffent-licht werden?
Konfliktlinie zwi-schen Anspruch an Veröffentlichungen und Logik der Plattformen
Beispiele für Serien und Nachrichten-formate
Lese
probe

118 Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien
Probentagebücher von Schauspieler/innen oder Regisseur/innen mit Fotos,
eine vom Jugendclub des Theaters selbst gedrehte möglicherweise provokante Video-Serie über lichte und dunkle Ecken der Stadt,
„Making of“-Bildergalerien oder -Videos, die Einblicke über die üblichen Inszenierungsbilder hinaus gewähren,
die Vorstellung von Theater-Mitarbeiter/innen, die sonst nicht im Rampenlicht stehen,
oder, wenn es so weit gehen soll: interaktive Möglichkeiten der Beteiligung am Spielplan oder einzelnen Stücken. Welcher Text soll in einer Lesung präsentiert werden? Findet die Netzgemeinde einen passenden Satz für die Situation X einer bestimmten Inszenierung?
Diese skizzenhaften Überlegungen machen bereits deutlich: Es ist sehr viel möglich, Social-Media-Marketing kann sehr viel Aufwand bedeuten. Deshalb gehört zu den strategischen Überlegungen auch immer die Frage: Was können wir leisten? Jede einzelne „Serie“, jede Idee sollte so originell – und so simpel wie möglich gedacht werden. Originelle Einfälle, witzige Situationen und der Eindruck persönlicher Beteiligung der Akteure sind wichtiger als technisch perfekte Umsetzungen. Videos oder Video-Blogs z.B. können, wenn die Situation und die Idee prägnant sind, u.U. mit dem Smartphone aufgenommen und sofort hochgeladen werden. Foto-Schnappschüsse können gerade dadurch interessant werden, dass sie nicht nach „Standard-Profi-Bild“, sondern nach ungewöhnlichem Einblick aussehen. Genauso verhält es sich mit „Veranstaltungsinformationen“: Die Netzgemeinde wird eher reagieren, wenn sie nicht nur die „technischen Informationen“ (Premiere am Xten) enthalten – sondern wenn sie persönlich gefärbt sind, etwa wenn ein Schauspieler von seiner Aufregung in den letzten Probentagen berichtet.
10.3 Verschiedene Social-Media-Plattformen
Die Herausforderung im Web 2.0 ist nicht mehr die Technik – sondern der Inhalt. Blogs, Facebook und Twitter-Seiten liegen gewissermaßen im Internet bereit, sie müssen nur sinnvoll gefüllt werden. Wenn Social-Media-Kommunikation auf mehreren Kanälen angestrebt wird, empfiehlt es sich, einen zentralen Knoten-punkt, einen Ausgangspunkt dafür zu schaffen. Dies kann eine „normale“ Home-page sein – oder ein Blog (vgl. Janner 2011: 52). Wer auf sinnvolle Weise einen Blog, eine Facebook-Seite und einen Twitter-Account betreibt, ist in Sachen Soci-al Media schon sehr weit. Deshalb werden diese drei Plattformen mit ihren Ein-satzfeldern und Möglichkeiten hier genauer vorgestellt.
Was kann geleistet werden?
Nicht mehr die Technik ist die Herausforderung – sondern der Inhalt
Lese
probe

Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien 119
10.3.1 Blogs
Ein Blog oder Weblog ist, wie bei den Begriffsklärungen erwähnt, eine Website, deren Inhalt aus einzelnen Beiträgen in Nachrichtenform bzw. oftmals einer per-sönlich gefärbten Nachrichtenform besteht. Die Beiträge werden in umgekehrt chronologischer Reihenfolge angezeigt, der aktuellste zuoberst. Blogs machen nur Sinn, wenn regelmäßig Beiträge verfasst werden. Das muss nicht täglich sein, aber wöchentlich sollte im Normalfall schon ein neuer Text auf der Seite erschei-nen.
Blogs bieten die Chance „aktuell, authentisch und persönlich aus Ihrer Einrich-tung zu berichten und auch Beiträge zu bringen, die thematisch oder stilistisch nicht auf Ihre offizielle Website passen – oder dort zu wenig wahrgenommen würden“, so Karin Janner (2011: 27). Gegenstand der Blog-Berichte sind typi-scherweise Aktionen der Organisation oder Vorgänge in dieser – gebloggt werden kann über Ausstellungen, Maltechniken, Proben, Arbeiten im Hintergrund, Stu-dien, neue Projekte, Ideen, neue Mitarbeiter, Reisen und vieles mehr. Auch Hin-tergrundgeschichten und Interviews sind möglich, da im Blog auch längere Texte gut darstellbar sind. Die Texte können zudem mit Bildern und Videos kombiniert werden. Wie grundsätzlich beim Marketing in sozialen Medien gilt: Die Beiträge sollten persönlich und individuell aufbereitet sein, einen eigenen Ton haben, nicht einfach zweitverwertete Pressemitteilungen sein. Im Idealfall bloggt ein Mitarbei-ter oder ein Team fest – und baut eine Beziehung zum Leserkreis auf.
Der Schreibstil in Blogs ist, wie generell in Social Media, der gesprochenen Spra-che näher als der Sprachebene, in der üblicherweise Pressemitteilungen oder offi-zielle Schreiben von Organisationen verfasst sind. „Originaltöne“ von Mitarbei-ter/innen sind gefragt, lebendige, authentische Sprache, das Erzählen von Ge-schichten, Meinungen. Dazu gehört auch, Beiträge namentlich und nicht anonym zu verfassen. Am Anfang gehört zu dieser freieren uns persönlicheren Textform Mut – aber Blogs, die Individualität entwickeln, finden wesentlich mehr Leser (vgl. Janner 2011: 29).
Ein Vorteil von Blogs gegenüber offiziellen Webseiten sind die bessere Vernetz-barkeit, die Kommentarfunktionen und die RSS-Feeds, über die Interessierte den Blog abonnieren können. Denn auch Blogs sind schon ein Medium des Web 2.0 und zielen auf Austausch, auch hier sollte schon der Dialog gesucht werden. Zu-gleich sind Blogs eine gute Basis – in ihnen können die längeren Texte stehen, außerdem Videos und Bilder, auf die von Facebook oder Twitter aus verwiesen werden kann.
Blogs sind zudem eine verhältnismäßig einfach zu handhabende Möglichkeit, ei-gene Internetpräsenzen zu erstellen. „WordPress“, die verbreitetste Blog-Software, gibt es frei erhältlich in der deutschsprachigen Variante unter www.wpde.org. Bei Youtube finden sich zahlreiche Video-Anleitungen zur Schritt-für-Schritt-Erstellung von WordPress-Blogs.
Aktuell, authentisch und persönlich aus der Organisation berichten
Orientierung beim Sprachstil: gesprochene Sprache
Tipps zur Erstellung von Blogs
Lese
probe

120 Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien
Unter www.de.wordpress.com ist das begleitete aber von den Möglichkeiten her eingeschränktere Erstellen von WordPress-Blogs möglich. Zudem gibt es natür-lich auch zahlreiche andere Anbieter, etwa das Google-Angebot www.blog ger.com.
Neben technischen Hilfestellungen und Tutorials lassen sich im Internet auch zahlreiche Tipps zum inhaltlichen Erstellen und zur strategischen Ausrichtung von Blogs finden.
Lohnenswert ist z.B. diese Tippliste samt weiterführender Links: http://www.blog projekt.de/2009/02/25/blog-start/22-wichtige-tipps-fuer-blog-anfa enger/ Sie rich-tet sich in erster Linie an private Blogger, vieles lässt sich aber auf Organisations-Blogs übertragen.
Technische Tipps gibt u.a. der User „zuschauer99“ bei Youtube, er begleitet Neu-linge in mehreren Tutorials sehr verständlich bei der Erstellung eines WordPress-Blogs. Der Link zu seinem Youtube-Kanal ist: http://www.youtube.com/user/zusc hauer99 (Links zuletzt geprüft im Januar 2013.)
10.3.2 Facebook
„Nein, man muss Facebook nicht mögen. Die mangelhaften Vertrags- und Daten-schutzbestimmungen oder die Speicherung und kommerzielle Verwertung von Nutzerdaten lassen sich durchaus kritisieren. Man wird aber nicht leugnen kön-nen, dass Facebook das mit Abstand größte soziale Netzwerk ist“, schreibt Axel Kopp (2011b: 57). Zum Zeitpunkt seines Aufsatzes, Anfang 2011, hatten weltweit über 600 Millionen Nutzer ein Facebook-Profi, in Deutschland über 14 Millionen. Im Oktober 2012 waren es nach Unternehmensangaben weltweit bereits eine Mil-liarde monatlich aktive Nutzer. Auch in Deutschland verbringen Internetnutzer am meisten Zeit bei Facebook, s.o.. Facebook ist mittlerweile zu dem sozialen Netz-werk schlechthin avanciert. Es ist so groß und vereint so viele Menschen (und so viel Zeit von so vielen Menschen), dass es immer größer wird. Denn wer nicht dabei ist, ist zunehmend wirklich außen vor. Insbesondere Jugendliche und Stu-dierende organisieren ihren Alltag mittlerweile zunehmend über Facebook, wer nicht in den relevanten Gruppen ist, verpasst schon einmal ein Referat o.ä.. Selbst Skeptiker fühlen sich so zunehmend gezwungen, sich anzumelden.
Was das für Kultur- und Non-Profit-Organisationen heißt? Wer noch nicht bei Fa-cebook ist und einige Arbeit darauf verwendet, dort einen guten Auftritt zu haben, braucht sehr gute Gründe – oder hat schlicht etwas verpasst (vgl. Kopp 2011b: 57f.).
Um bei Facebook eine Gemeinde von „Anhängern“ zu finden, die per „Like“-Button die Neuigkeiten der Organisations-Seite abonnieren, muss man, wie be-schrieben, den Gepflogenheiten des Netzwerks entgegenkommen. Kurze, witzige
Man muss Facebook nicht mögen – kann es aber nicht ignorieren
‚Anhänger’ finden
Lese
probe

Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien 121
Informationen, besondere Einblicke, Hintergründe, Aktionen, Anregungen zu Kreativität im Forum u.ä. können Leben auf die Seite bringen. Richtig erfolgreich ist erst, wessen Nachrichten von vielen kommentiert und geteilt werden. Die Sprache kann hier noch direkter und formloser als im Blog sein, die persönliche Ansprache ist noch wichtiger. Auch Fotos sind ratsam, das Team, das postet, soll-te ein Gesicht zeigen im „Gesichtsbuch“ (vgl. Kopp 2011b: 71).
Zusätzlich können Trailer und Bildergalerien in Facebook eingestellt oder verlinkt werden, sowie Einladungen zu Veranstaltungsterminen automatisiert verschickt werden. Sollte die Organisation auch ein Blog betreiben, lassen sich neue Mel-dungen dort per RSS-Feed direkt in Facebook übernehmen. Die Plattform Face-book bietet vielfältige Möglichkeiten und vereint als potenzielle Adressaten eine Masse von Menschen, wie (mit weitem Abstand!) kein anderes soziales Netzwerk im Internet. Wer in seiner Organisation Social Media nutzen will, sollte also in Facebook dabei sein, seine Seite regelmäßig pflegen – und beim Betreiben der Seite die oben beschriebenen Hinweise für erfolgreiche Social-Media-Kommuni-kation beachten.
Zur Facebook betreffenden Medienkompetenz gehört aber auch das Wissen, dass hinter dem sozialen Netzwerk ein börsennotiertes Großunternehmen mit handfes-ten Geschäftsinteressen steckt. Die Währung mit der man als Nutzer die kostenlo-se Online-Plattform bezahlt, sind Daten. Die Profile und Kontaktdaten der Nutzer lassen sich aus Facebook umfassend herausarbeiten, inklusive Fotos. Es ist ja alles freiwillig hinterlegt. Mit diesen Daten und zielgruppenspezifischer Werbung han-delt Facebook.
Die Einbettung des „Like-Buttons“ auf der eigenen offiziellen Homepage oder etwa in einem Blog, zumeist ein Standardvorgang, um die eigene Facebook-Präsenz zu bewerben, ermöglicht es Facebook, auch auf diesen Seiten Nutzerda-ten zu sammeln. Deshalb ist der Button bei manchen internetkundigen Zielgrup-pen sehr umstritten. Ob es überhaupt erlaubt ist, den „Like“-Button in offizielle Seiten einzubetten, stand 2012 sogar juristisch in Frage:
„Das Problem ist, dass der Button keine einfache Grafik ist, sondern durch einen Code erzeugt wird, der beim Aufruf der Website weitere Daten von Facebook lädt und zugleich Nutzerdaten an das Netzwerk sendet. Dabei werden zum Beispiel pseudonyme Nutzerprofile auch von Usern erstellt, die keine Facebookmitglieder sind. Das wäre nach dem deutschen Telemediengesetz (§ 15 Abs. 3) nur zulässig, wenn die Nutzer ein Recht zum Widerspruch hätten, was Facebook nicht bietet.“ (Schwenke 2012: 226)
Der Stand von Rechtsstreitigkeiten mit Facebook und die aktuellen Hauptproble-me in Sachen Datenschutz sind immer wieder Gegenstand aktueller Berichterstat-tung und lassen sich zudem stets aktuell auf der Wikipedia-Seite über Facebook nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Facebook. Wer Facebook nutzt, sollte hier
Facebook ist ein Unternehmen mit eigenen Geschäfts-interessen
Umstrittener ‚Like’-Button
Lese
probe

122 Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien
auf dem Laufenden sein und auch jeweils die aktuellen Facebook-Nutzungsbe-dingungen kennen.
Abb.4: Wer mit Facebook arbeitet, sollte sich mit den Nutzungsbedingungen und den Daten-verwendungsrichtlinien auseinandersetzen (Zu finden unter: www.facebook.com/poli cies/?ref=pf)
Neben der ungeheuer großen Zahl der Facebook-Mitglieder und –Fans gibt es we-gen der beschriebenen Datenschutz-Konflikte auch Gruppen, die Facebook radikal ablehnend gegenüber stehen. Wenn eine dieser Gruppen (etwa kundige Internet-nutzer mit Datenschutz-Interesse) zu den Zielgruppen einer Organisation gehört, könnte das einer der stechenden Gründe sein, keine eigene Seite auf der Plattform anzulegen.
10.3.3 Twitter
Twitter ist ein sogenannter „Mikroblog“ – letztlich eine Blogmöglichkeit mit sehr kurzen Texten. Wie beschrieben sind maximal 140 Zeichen pro Tweet möglich. Diese Nachrichten sind zumeist schnelle, persönliche Eindrücke oder Infos, wie etwa: „Noch drei Minuten bis zur Premiere, Herzklopfen!“ Sie zielen darauf, be-antwortet („Toi Toi Toi!“) oder weitergeleitet („retweetet“) zu werden. Tweets werden, wie zunehmend auch Facebook-Posts, vielfach mobil von Smartphones aus versendet, so können sie einen noch unmittelbareren und authentischeren Ein-druck erwecken. In Twitter können auch jeweils die Links zu neuen Blog-Einträgen (automatisch über den RSS-Feed) oder Facebook-Posts veröffentlicht werden. Twitter ist die schnellste Kommunikationsplattform mit den kürzesten Texten, hier geht es darum, Interesse für die anderen Seiten zu wecken – oder mit kurzen, prägnanten Statements Aufmerksamkeit zu erregen.
Tweets werden zunehmend mobil versendet Le
sepro
be

Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien 123
10.4 Du? – Und wie oft?
Bei allen Tools und Plattformen im Social-Media-Bereich gibt es drei Fragen, die immer wieder diskutiert werden:
Soll man seine Leser Duzen oder Siezen?
Das hängt von der Zielgruppe ab. Wenn sich eine Organisation in ihren Web 2.0-Aktivitäten an eher hochrangige Mitglieder der Gesellschaft richtet bzw. an Men-schen, die einen formaleren Umgang wünschen, kann das „Sie“ die richtige und in jedem Fall „sicherere“ Wahl sein. Im Normalfall läuft die Kommunikation in so-zialen Netzwerken jedoch per „du“ (vgl. z.B. Netiquette der Universität Leipzig, Link s.o.). In Zweifelsfällen versuchen Organisationen oftmals, die direkte An-sprache zu vermeiden – wichtig ist dann, darauf zu achten, dass die Texte dennoch der Alltagssprache entsprechen und nicht „hölzern“ werden.
Is Content King?
Die oft vertretene Lehre „Content is King“ besagte in ihrer klassischen Auslegung zugespitzt: Wenn man einen guten Inhalt hat und einfach immer weiter schreibt, werden die Besucher irgendwann kommen. Mittlerweile gibt es aber eine so un-glaubliche Fülle von Angeboten im Internet, dass diese Regel allein nicht mehr gilt. Zum guten Inhalt muss das Marketing kommen (vgl. Weinberg 2011: 18), oder, wie ein US-TV-Moderator formulierte: „Wenn Content König ist, ist Marke-ting die Königin (und die Königin herrscht im Hause).“ (zit. n. ebenda). Die in diesem Studienbrief beschrieben Methoden der Online-Kommunikation sollen helfen, Inhalte auch zu verbreiten. Zusätzlich ist bei thematisch spezialisierten Blogs oder anderen Texten sinnvoll, mit suchmaschinengerechten Verschlagwor-tungen zu arbeiten. Gerade wenn Social-Media-Präsenzen neu eingerichtet wer-den, müssen sie auch beworben werden. Interessenten an der Organisation sollten auf die neuen Angebote hingewiesen, Verlinkungen eingefügt und Anreize zum Besuch der neuen Seiten geschaffen werden.
Wie oft soll man etwas posten oder tweeten
Hier hängt die Antwort sehr vom angestrebten Ziel und dem Publikum ab. Um in sozialen Medien präsent zu sein, brauchen die Veröffentlichungen eine Regelmä-ßigkeit, bei Twitter und in Facebook sollte die Frequenz höher sein, als im Blog. Es gibt aber keine seriöse Regel die sagt, alle X Stunden oder Tage muss etwas kommen. Die einzig sinnvolle Regel ist: Organisationen bzw. ihre Internet-Teams sollten texten, posten und tweeten wann immer sie einen Inhalt oder eine Idee ha-ben, die das sinnvoll möglich macht. Zusätzlich ist es wichtig, Serien o.ä. zu ent-wickeln, die auch jenseits von „News“ für stetige Veröffentlichungen sorgen. Es geht nicht darum, Follower mit andauernden Nachrichten ohne Neuigkeit zu ner-ven – aber umso öfter ein Post oder Tweet mit Pfiff möglich ist, umso präsenter ist die Organisation.
Die richtige Ansprache finden
Gilt die Regel ‚Content is King’?
Häufigkeit von Posts/Tweets
Lese
probe

124 Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien
10.5 Rechtslage und Urheberrecht in Social Media
Zur Medienkompetenz in Social Media gehört das Wissen, dass Kunstwerke, Mu-sik u.ä. natürlich auch online dem Urheberrecht unterliegen. Sie dürfen deshalb nicht einfach genutzt, weitergeleitet oder zum Teil von Posts gemacht werden – es sei denn, der Urheber ist länger als 70 Jahre Tod und das Urheberrecht damit ver-fallen. Kurze Zitate anderer Autoren dürfen als Zitat gekennzeichnet widergege-ben werden – lange Textstrecken einfach zu übernehmen ist ebenso verboten wie die unabgesprochene Nutzung von Bildern oder Musik die nicht rechtefrei sind. Das Urheberrecht, wie es im Studienbrief MKN0620 von Verena L. Lewinski-Reuter beschrieben wird, gilt selbstverständlich auch im Internet und auch in sozi-alen Netzwerken.
Und zugleich sind bei der Betreuung von Social-Media-Inhalten weitere Rechts-fragen zu beachten:
„Social-Media-Manager sind aus rechtlicher Sicht nicht zu beneiden. Neben aus-gezeichneten Fähigkeiten im Marketing und PR müssen sie nicht nur umfangrei-ches Wissen über die Gepflogenheiten der sozialen Netze besitzen, sondern auch noch die rechtlicheren Aspekte kennen. Während die erstgenannten Eigenschaften selbstverständlich sind, wird die Kenntnis der juristischen Rahmenbedingungen in Social Media unterschätzt. Dabei sind die Anforderungen weitaus höher als im klassischen Marketing- und PR-Business. Das klassische Marketing hatte recht-lich viele Vorteile: Werbemaßnahmen wurden von langer Hand vorbereitet, oft durch mehrere Personen kontrolliert oder vom Hausjuristen geprüft. Auch die Kommunikation mit dem Kunden fand in der Regel von Angesicht zu Angesicht statt, so dass wettbewerbswidrige Aussagen selten auffielen“ (Schwenke 2012: 218).
Was Thomas Schwenke hier im „Zeitungen 2012/2013“-Jahrbuch des Bundesver-band Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV) für Social-Media-Manager von Verlagen problematisiert, gilt letztlich in allen Social-Media-Handlungsfeldern. Das erwartete Tempo, die Unmittelbarkeit der Kommunikation schaffen rechtliche und organisationsinterne Schwierigkeiten. Wer jeden Post, jede Antwort, jeden Tweet oder Retweet erst aufwändig abstimmen und absichern muss, hat in sozia-len Netzwerken kaum ein Chance. Wer die Kommunikation aber eigenständig, verantwortlich und im besten Fall auch noch mit persönlicher Note in die Hand nimmt, muss wissen, was er darf und was er nicht darf. Von der Rechtslage her – vor allem aber auch durch genaue organisationsinterne Leitlinien.
Einige Beispiele:
Wie geht man mit „Konkurrenten“ oder „Gegnern“ um? Auch im Internet gilt das Wettbewerbsrecht, das heißt unlauterer Wettbewerb kann genauso juris-tisch abgemahnt werden, wie in der „gedruckten Welt“. Die Behauptung „Wir sind die Besten“ kann deshalb problematisch sein, unwahre Qualitätsbehaup-
Auch online gilt das Urheberrecht
Das hohe Tempo schafft rechtliche und organisationsinterne Schwierigkeiten
Umgang mit Konkurrenten
Lese
probe

Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien 125
tungen auf die eigene Organisation bezogen ebenso. Wie auch bei Print-Anzeigen muss genau abgewogen werden, welche Form der Eigenwerbung zu-lässig ist (vgl. Schwenke 2012: 218). Außerdem gilt natürlich: Auch im Inter-net ist „Schmähkritik“, sind also herabwürdigende Angriffe und persönliche Beleidigungen, verboten.
Wie geht man mit Kritik um? Die sozialen Plattformen heißen Netzwerke, weil sie vom Dialog leben. Wichtiges Element ist der Austausch mit Interessenten. Dabei werden sich immer wieder auch Kritiker zu Wort melden. Auch ihnen sollte geantwortet werden – aber wie? Natürlich dürfen sie auch in Social-Media-Plattformen nicht geschmäht oder beleidigt werden – dies könnten sie ebenso zur Anzeige bringen, wie in der analogen Welt. Aber wie weit kommt man ihnen entgegen, wie weit beharrt man auf seiner Position, was ignoriert (oder löscht) man möglicherweise? Dafür sind genaue interne Vorgaben nötig. Auch wie mit fremden rechtlich problematischen Posts auf der eigenen Seite umzugehen ist, muss geklärt werden. Diese sollten erkannt und gelöscht werden. Denn auch für fremdgenerierte Inhalte kann eine Organisation haftbar gemacht werden, wenn sie zu deren Verbreitung beiträgt (vgl. Schwenke 2012: 227).
Wie kann man Fotos online veröffentlichen? Dieses Problemfeld wurde oben schon angedeutet, natürlich gilt auch online das Urheberrecht. Das müssen sich Organisationen und Unternehmen stets bewusst halten – selbst wenn um sie herum von Privatpersonen etliche Bilder „geteilt“ werden. Für juristische Personen wie Organisationen können Urheberrechtsverletzungen wesentlich teurer werden, als für Privatleute (vgl. Schwenke 2012: 220). Foto-Veröffentlichungen müssen in jedem Fall mit dem Fotografen abgestimmt, Fotografen genannt werden. Ein guter Weg kann es zudem sein, Fotos in so geringer Auflösung (etwa 72 dpi) ins Internet zu stellen, dass sie am Bildschirm attraktiv – aber nicht nachdruckbar sind.
Was sind die Nutzungsbedingungen einer bestimmten Plattform? So wenig freudvoll dies sein mag: Da hilft nur lesen. Die Nutzungsbedingungen mancher Plattformen gleichen eigenen Gesetzeswerken, sie können sehr unterschiedlich sein und ändern sich von Zeit zu Zeit. Wer verantwortlich soziale Netzwerke betreut, sollte hier stets auf dem aktuellen Stand sein. Zentrale Fragen dabei sind u.a.: Ist bei der Plattform eine Anmeldung zu Werbe-Zwecken erlaubt? Welche Rechte (an den Inhalten, etwa an Bildern) räumt man dem Anbieter der Plattform ein? Gibt es Einschränkungen für Inhalte (vgl. Schwenke 2012: 221)?
Umgang mit Kritik
Umgang mit Fotos
Nutzungsbedingungen kennen
Lese
probe

126 Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien
10.5.1 Richtlinien aufstellen
Ein weiteres Problemfeld in Social Media ist die Verknüpfung von beruflich und privat. Oftmals betreuen Mitarbeiter von ihrem „Privataccount“ aus als Adminis-tratoren die offizielle Seite – und sind von Nutzern auch als solche erkennbar und zu ihrem Privatprofil zurückzuverfolgen. Wer schreibt bei einer bestimmten Gele-genheit also, der Privatmensch oder die Organisation? Hier gilt es, intern klare Regeln aufzustellen oder Accounts so einzurichten, dass sie klar von privaten ge-trennt sind. Auch zur Frage wie viel Organisations-Kommunikation der Betreuer während seiner Freizeit mitleisten soll, muss es genaue Abstimmungen und im besten Fall Vertretungskonzepte geben. Denn lebendige soziale Netzwerke erfor-dern schnelle Kommunikation – dürfen aber, auch arbeitsrechtlich, nicht dazu füh-ren, dass Freizeit für die Zuständigen quasi abgeschafft wird.
Für diesen Bereich der Mitarbeiterführung aber auch, um rechtliche Schwierigkei-ten mit Social-Media-Inhalten auszuschließen, ist es wichtig, organisationsintern genaue Richtlinien zur Betreuung der sozialen Netzwerke aufzustellen – und den Zuständigen ein Grundwissen zu den Problemfeldern zu vermitteln. Die Richtli-nien sollten genau beschreiben, wie in welchen Situationen mit welchen mögli-chen Problemen umgegangen, was geteilt, was veröffentlicht, was gelöscht wird. Sie müssen nicht arbeitsrechtliche Vorgaben im Sinne von strikten Anweisungen und Verboten sein – sondern sollten eher als aufklärende Tipps gestaltet sein, die zugleich die gewünschte Online-Identität der Organisation beschreiben. Sie müs-sen über rechtliche Schwierigkeiten aufklären und für Problemfelder sensibilisie-ren – denn am Ende haftet die Organisation für das, was Mitarbeiter/innen in ih-rem Auftrag veröffentlichen. Das Fazit von Thomas Schwenke:
„Social Media bringt keine neuen gesetzlichen Regeln mit sich. Allerdings müssen die bestehenden beachtet werden, was in dem eher ‚lockeren’ Marketingumfeld oft vergessen wird. Da die verantwortlichen Social-Media-Manager kaum Zeit ha-ben, vor jedem Posting den Justiziar zu kontaktierenm müssen sie ein Grundver-ständnis für rechtliche Problemfälle haben. Daher ist es unabdingbar, Mitarbeiter sorgfältig auszuwählen, zu unterrichten und ihnen Richtlinien zum gewünschten Verhalten an die Hand zu geben. Dadurch sinken die Risiken für Rechtsverstöße erheblich und Angestellte erhalten Anhaltspunkte, mit deren Hilfe sie selbstsicher und erfolgreich Social-Media-Marketing betreiben können“ (Schwenke 2012: 232).
SCHWENKE: Erlaubt/Verboten – Social-Media-Recht für Verlage. In: Bundes-verband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (Hg.): Zeitungen 2012/13. Berlin 2012.
Problematische Ver-knüpfung von beruf-licher und privater Kommunikation
Organisationsinterne Richtlinien aufstellen
Juristisches Grund-verständnis nötig
Lese
probe

Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien 127
10.6 Beispiele für Social Media im Kultur- und Non-Profit-Bereich
10.6.1 neanderweb 2.0
Das Neanderthal Museum in Mettmann ist ein Museum für Steinzeit, Archäologie und Menschheitsgeschichte – klingt erst einmal wenig nach Web 2.0. 2010 wollte das Museum dennoch seine Online-Aktivitäten ausbauen und fand ein Thema als Klammer: Evolution. Um Evolution geht es bei dem Neanderthaler, im Moment ist rasend schnelle Evolution im Internet zu beobachten – und die eigenen sozialen Medien sollten eine Evolution durchmachen, sich gewissermaßen von klein auf organisch entwickeln. Als Thema und Prinzip „Evolution“ zu wählen, war die ers-te Entscheidung – die zweite, einen starken Protagonisten zu wählen: den Nean-derthaler. „Um ihn herum galt es nun, die einzelnen Bausteine der Social Net-works und Social Media für die entsprechenden Zielgruppen und Medien konzep-tionell zu entwickeln. Soll heißen: Wie lässt sich das Thema ‚Neanderthaler’ bei Facebook, Twitter und Co. gestalten? Wie werden Doppelungen an Informationen vermieden und wie bekommt der ‚Neanderthaler’ in den verschiedenen Medien ein individuelles Gesicht? Wie kann sich der ‚Neanderthaler’ am besten im Web 2.0 positionieren und vernetzen?“ Das waren die Fragen in dem Projektteam, wie Sebastian Hartmann beschreibt (2011: 283). Das Team hat für sich Antworten ge-funden, mittlerweile hat der Neanderthaler ein Blog, postet bei Facebook, zwit-schert bei Twitter und veröffentlicht Bilder bei Flickr. Alle diese Seiten sind von der Seite „neanderweb 2.0“ auf der offiziellen Homepage aus zu erreichen: www.neanderthal.de/presse-bilder/neanderweb-20/index.html (zuletzt geprüft im Januar 2013).
Abb.5: Der Neanderthaler führt durch das Social-Media-Angebot des Museums
Leitthema ‚Evolution’
Protagonist: der Neanderthaler
Lese
probe

128 Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien
10.6.2 Oper in sozialen Medien
Wenn man „Staatsoper“ hört denkt man ebenfalls nicht als erstes an moderne so-ziale Medien. Die Bayerische Staatsoper ist ihre Präsenz in verschiedenen Platt-formen des Web 2.0 strategisch angegangen – und mittlerweile vielfältig vernetzt. Johannes Lachermeier, Leiter der Online-Kommunikation an der Staatsoper, schreibt: „Das Thema Web 2.0 aus der Online-Kommunikation eines Unterneh-mens oder eines Kulturbetriebes auch nur gedanklich auszuklammern, ist in den vergangenen Jahren schlichtweg unmöglich geworden.“ (2011: 290) Die Staats-oper ging ihren Weg in die sozialen Netzwerke Ende 2009 mit klaren Zielen an: Im Mittelpunkt stand die Erschließung neuer, jüngerer Zuschauerschichten. Zu-gleich sollten bestehende Zuschauerbindungen verstärkt und Besuchshäufigkeiten gesteigert werden. „Doch zunächst kam es uns in erster Linie darauf an, mit Besu-chern und Interessenten in Kontakt zu treten, und das jenseits der ausgetretenen Marketingpfade. Eine möglichst direkte, persönliche Form der Kommunikation war hier erwünscht, ganz im Gegensatz zu den eher vertriebsorientierten (oder teils auch dramaturgisch-programmatischen) Texten, mit denen wir auf der offizi-ellen Website www.staatsoper.de und in unseren Newslettern arbeiten.“ (ebenda) Wichtig ist das genau definierte Ziel, wie kommuniziert werden soll – und die Un-terscheidung zu den vorherigen Medien.
Die Staatsoper begann, ihre Inszenierungs-Trailer und ein 10-minütiges selbstpro-duziertes regelmäßiges Opern-Magazin auch in Youtube einzustellen – und zu-gleich Profile bei Facebook und Twitter einzurichten, dabei ließ sich die Staats-oper von externen Spezialisten coachen. Die Betreuung der Web 2.0-Inhalte über-nahm dauerhaft Lachermeier, so dass eine persönliche und durchgehende Note entstehen konnte.
Die offizielle Homepage dient seitdem als „seriöse Basis“, Youtube als vielfältig verlinkbares Videoportal. Twitter nutzt die Staatsoper um Meldungen zu tweeten, vor allem aber als „sehr direktes und persönliches Kommunikationsmedium mit den Zuschauern. Fragen, Kommentare und Kritik werden hier gepostet – und von uns möglichst immer sofort beantwortet“ (ebenda: 293). Zuschauer fühlen sich so ernst genommen und beteiligt – und wer Luft ablassen kann, ist schon nur noch weniger sauer über eine Inszenierung, die ihm nicht gefiel. Wenn es ein Anlass anbietet, nutzt Lachermeier Twitter zudem für „Live-Berichte“ – und zwitschert etwa per Smartphone Live-Ticker von bedeutenden Pressekonferenzen. Auch Probeneindrücke werden per Tweet geteilt: Sänger mailen dem Online-Verantwortlichen kleine Proben-Tagebücher und er verarbeitet diese in Twitter-gerechte Häppchen.
Auf Facebook veröffentlicht die Staatsoper im Normalfall einen Post pro Tag, wobei sie die Themen mischt. Fotogalerien, Videos, Hintergrund-Berichte, An-kündigungen, Hinweise auf Twitter-Aktionen oder Blog-Einträge – die Staatsoper versucht auf vielfältige Weise Neugier zu wecken. Ihr Erfolgsrezept ist dabei, nie
Ziel: Besucherkon-takte jenseits üblicher Marketingpfade
Homepage als Basis, flankiert von Social Networks Le
sepro
be

Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien 129
mit der Hochkultur zu winken oder abgehoben zu wirken, sondern sehr publi-kums- und plattformnah zu kommunizieren. So hat die Bayerische Staatsoper Stand Ende 2012 rund 10.000 Facebook-Anhänger gesammelt, die Beiträge auf der Seite werden intensiv geteilt, diskutiert und „geliket“.
Zur Verdeutlichung des unverkrampften Tons auf der Facebook-Seite hier zwei Varianten einer Meldung:
Homepage: Neuer Podcast zur Premiere Rusalka: Ab dem 23. Oktober ist Antonin Dvoáks Oper im Nationaltheater zu sehen, unter der musikalischen Leitung von Toma Hanus und inszeniert von Martin Kusej. Der Autor Florian Heurich gibt in diesem Podcast eine Einführung in Werk, Handlung und Entstehung.
Facebook: Eine Art Mini-Programmbuch zum Hören: Ab sofort gibt’s zu jeder Neuproduktion einen Audiopodcast, hier gleich mal der zu RUSALKA: www.staatsoper.de
Lachermaier versucht konsequent, auf Facebook eher einen persönlichen, der Alltagssprache nahen „Plauderton“ zu wählen – wer sich locken lässt, bekommt die Hintergrundinformationen dann unter dem Link auf der Homepage (vgl. ebenda: 294f).
Zugleich fällt natürlich auf, dass in der Bayerischen Staatsoper eine Institution ins Web 2.0 vordringt, die auch die finanziellen Mittel und personellen Ressourcen hat, es professionell zu bespielen. Es ist ein sehr wünschenswerter Luxus, wenn man von bild- und tongewaltigen Dingen, die man zu bieten hat, eben etwa Opern-Inszenierungen, aus eigenen Mitteln Video-Trailer, Podcasts und ganze Online-Magazine produzieren kann. Dennoch: Noch wichtiger als diese Ressour-cen ist die Idee dahinter. Die Staatsoper hätte nicht 10.000 Facebook-Freunde, wenn sie ihre aufwändig produzierten Trailer auf der Plattform stets mit einem „Hiermit möchten wir Sie auf einen neuen Inszenierungs-Mitschnitt hinweisen“ ankündigen würde.
Seit Mitte 2010 ergänzt auch ein Blog die Web 2.0-Tätigkeiten der Staatsoper, in ihm wird aufwändig und multimedial vom Geschehen auf und hinter der Bühne berichtet – von Probenvideos über Berichte über die Damenfußballmannschaft des Orchesters bis zu Jugendprojekten. Die Berichte entstehen, weil viele Angestellte im Haus den Blog mögen und daran mitdenken, selbst Themen vorschlagen. Da-bei beobachtet die Staatsoper, dass sie mit überraschenden und eher skurrilen Themen am meisten Blog-Leser erreicht, die Damenfußballmannschaft ist unter den Top-geklickten Einträgen, ebenso eine Reportage über eine Bühnen-Flutung für eine Inszenierung. Aber auch „Liebhaberthemen“ haben Wirkung, Spezialis-tenberichte über bestimmte Notenblätter hatten weniger Leser – haben die Interes-senten dafür aber besonders begeistert und gebunden (vgl. ebenda: 299).
Der Facebook-Ton: zwei Varianten einer Meldung
Skurrile Themen sind die erfolgreichsten
Lese
probe

130 Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien
Das vorläufige Fazit von Online-Leiter Lachermeier:
„Auch, wenn eine konkrete Erfolgsmessung in Bezug auf bloße Verkaufszahlen kaum machbar erscheint, so zeigt der Zuspruch der Nutzer, dass die sehr unmit-telbare Kommunikation gewünscht ist. Die Bayerische Staatsoper rückt näher an ihre Zuschauer und nimmt jeden einzelnen von ihnen ernst. Sie ist keine monoli-thische Institution mehr, die sich hinter Säuleneingängen und großen Portalen verschanzt. Und wenn wir es durch unsere Arbeit schaffen, dass die Bayerische Staatsoper ein Stück weit das Opernhaus eines jeden einzelnen Fans, Followers, Lesers oder Kommentators wird, dann ist sehr viel erreicht“ (ebenda: 301).
Die Web 2.0-Aktivitäten der Bayerischen Staatsoper sind von diesem Link aus zu erreichen: http://www.bayerische.staatsoper.de/1139--~kosmosoper~web 2.0.html (Zuletzt geprüft im Januar 2013)
10.6.3 Social Media für freie Künstler/innen und Projektemacher/innen
Die verschiedenen Social-Media-Plattformen sind durch den einfachen Zugang und die kostenfreien Nutzungsmöglichkeiten auch hervorragende Foren für freie Künstler/innen oder Projektemacher/innen, die auf sich aufmerksam machen möchten. Musiker/innen, Schauspieler/innen, bildende Künstler/innen und Co. sind vielfach online unterwegs, werben bei Facebook für sich und kündigen neue Arbeiten über Twitter an. Zusätzlich gibt es Netzwerke speziell für Künstler, etwa www.kuenstlerdatei.com oder www.artisdb.de. Auch für freie Künstler/innen und Projektemacher/innen gilt: Wer im Netz erfolgreich sein will, muss sich von den anderen, von der „durchschnittlichen Künstlerseite“ unterscheiden. Er muss Ein-blicke in seine Kunst bieten, besonders und interessant wirken, seinen „Anhä-ngern“ Informationen bieten, die sie sonst nicht bekommen würden. Und vor al-lem: Er muss online mit seiner Kunst oder seinen Ideen überzeugen. Wenn das ge-lingt, können „Karrieren“ in sozialen Netzwerken beginnen oder hier zusätzlichen Schwung bekommen. Für Filmemacher/innen sind „Youtube“ und „Vimeo“ Por-tale des Austauschs – und Foren um Fans zu finden. Maler/innen können in Face-book Bilder zeigen, Ausstellungen präsentieren, Einblicke in Entstehungsprozesse gewähren. Musiker/innen können online berühmt werden – wenn sie einen Nerv treffen und freie Lieder, die sie ins Internet stellen, tausendfach geteilt werden. Ein spektakuläres Beispiel dafür war 2011/2012 der Musiker „Cro“:
Im November 2011 feierte das Video zu Cros Lied „Easy“ als Vorbote zu seinem gleichnamigen Download-Mixtape auf dem Internetfernsehsender tape.tv Premie-re. Einige Tage später wurde „Easy“ auch auf YouTube veröffentlicht. Dort er-zielte das Lied in den ersten zwei Wochen 500.000 Aufrufe, bis Anfang 2012 stieg die Anzahl auf 1,7 Millionen Aufrufe, Mitte Mai 2012 waren es bereits über 16 Millionen. Auf verschiedenen internationalen Plattformen wurde über Cro be-richtet und das Video verlinkt, deutsche Szene-Größen wiesen ebenfalls auf den
Staatsoper ist durch Social Media näher an die Zuschauer/innen gerückt
Foren für freie Künstler/innen und Projektemacher/innen
Beispiel: der Musiker Cro
Lese
probe

Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien 131
jungen Rapper hin. Jan Delay, weit über die Grenzen des Rap-Genres hinaus be-kannt, etwa verlinkte das Video auf seiner Facebook-Seite und schrieb dazu, Cro sei „die Zukunft von Deutschrap“. Cro selbst befeuerte zusammen mit einem klei-nen Independent-Musiklabel in seinem Rücken das öffentliche Interesse – indem er sehr rege seine Facebook-Seite betrieb und immer wieder neue Umsonst-Lieder zum Download anbot. So entstand um ihn und seine Musik ein regelrechter „Hype“ – sein erstes reguläres Album wurde sehnsüchtig erwartet. Seine nur durch Cros Online-Präsenz schon sehr zahlreichen Fans warteten förmlich darauf, endlich für ein Album von ihm Geld ausgeben zu können. Sein Album „Raop“, Mitte 2012 mit Unterstützung seines kleinen und nun auch bereits eines großen kooperierenden Musik-Labels herausgebracht, stieg prompt auf Platz eins der deutschen und österreichischen Album-Charts ein, Cro trat bei „Wetten dass...?“ auf und wurde mit dem Bambi in der Kategorie Pop national ausgezeichnet.
Der junge Mann hatte mit seiner Musik einen Nerv getroffen – und auf kreative Weise schon vor seinem eigentlichen Debüt in sozialen Netzwerken für großes In-teresse gesorgt. Mit viel Geschick lancierte er seine Lieder in sozialen Netzwer-ken, sorgte mit immer neuen Meldungen für Aufmerksamkeit – und bewegte wichtige Szene-Größen dazu, auf ihn aufmerksam zu machen. Vom Social-Network-Phänomen hat er es so zum Massenphänomen geschafft (vgl. u.a.: http://de.wikipedia.org/wiki/Cro_(Rapper)).
Abb.6: So sehen „Social-Media-Hypes“ aus: Im Dezember 2012 wurde das offizielle Video
von Cros „Easy“ bei Youtube bereits über 31 Millionen mal angeklickt.
Doch auch weniger prominente Beispiele zeigen, dass soziale Netzwerke auch für Einzelpersonen oder kleine Gruppen große Potenziale bieten. So zeigt etwa die österreichische Künstlerin Helga Berger auf ihrer Facebook-Seite ihre Werke –
Vom Social-Network- zum Massenphäno-men
Beispiel: die Künstlerin Helga Berger
Lese
probe

132 Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien
und kommentiert immer wieder mit Bildern aktuelle Stimmungen, etwa Jahreszei-ten. Im größtmöglichen Facebook-Format zeigt sie ihre Bilder so in recht hoher Frequenz mittlerweile 3000 Anhängern, die sich dafür immer wieder sehr dankbar äußern, die die Bilder teilen und über sie sprechen. Es gibt kein herkömmliches Kommunikationsmittel, mit dem für die Künstlerin so kostengünstig eine so ef-fektive Selbstvermarktung möglich wäre.
Abb.7: Schon der Seitenkopf von Helga Berger macht deutlich, dass in diesem Facebook-Profil Kunst steckt.
Abb.8: Die Künstlerin nimmt Stimmungen auf – und setzt ihre Bilder in Bezug zu ihnen
Lese
probe

Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien 133
10.6.4 Fragen für „Einzelkämpfer“ – und E-Portfolios
Diese und die zahlreichen weiteren positiven Beispiele, die sich für kreative Soci-al-Media-Selbstvermarktung finden lassen, sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich auch für „Einzelkämpfer/innen“ immer zuerst die Fragen stellen:
Was will ich erreichen?
Welches Medium ist dafür passend?
Steht der Aufwand in einem vertretbaren Verhältnis zu dem erwartbaren „Ertrag“?
Musiker/innen können Zeit effektiver nutzen, als bei Youtube ihre eigenen Lieder immer wieder anzuklicken um den Schein einer Fan-Gemeinde zu suggerieren. Auch für Einzelpersonen gehört zur effektiven Nutzung von sozialen Medien eine Strategie – die ähnlich entwickelt werden sollte, wie es in diesem Studienbrief für Organisationen vorgestellt wird.
Eine vor allem für freie Künstler/innen und Projektemacher/innen interessante zu-sätzliche Form der Online-Präsenz sind sogenannte E-Portfolios. In E-Portfolios können eigene Dateien (Bilder, Texte, Videos, Musik) gesammelt und strukturiert werden. Dies kann der Selbstorganisation sowie als Archiv und Selbstreflexions-raum dienen – und nach Belieben können Inhalte (die in E-Portfolios zumeist „Ar-tefakte“ genannt werden) bestimmten Menschen oder auch der www-Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. So können aus der Sammlung und dem Archiv heraus Präsentationen entstehen, die einen Überblick über das eigene künstlerische Schaffen erlauben – oder auch als Bewerbungsbögen oder Lebens-lauf fungieren. Zugleich können E-Portfolios wegen ihrer offenen Sammel-Möglichkeit und den zumeist eingebetteten Blog-Funktionen auch als Ausgangs-punkt für weitere Social-Media-Tätigkeiten genutzt werden. „Mahara“, vom DISC seit 2012 in MKN1000 in diesen Studiengang integriert, ist eine der sehr funktio-nalen E-Portfolio-Plattformen.
Wie am DISC werden weltweit zunehmend E-Portfolios als E-Learning-Plattformen genutzt. Sie ermöglichen eine starke Vernetzung von Lehrinhalten und einen fundierten Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden. Außer-dem ermöglichen sie Studierenden eine fundierte Selbstreflexion über große Zeit-räume hinweg – da in ihnen die verschiedenen Arbeitsschritte und Ansätze ge-sammelt und einsehbar bleiben. Diese Selbstreflexionsmöglichkeiten sind natür-lich auch für freie Künstler/innen und Projektemacher/innen wertvoll.
Ein Überblick über die Möglichkeiten von E-Portfolios sowie Links zu verschie-denen Plattformen sind im Online-Lexikon Wikipedia zu finden: http://de.wikipedia.org/wiki/EPortfolio
Fragen für Einzelkämpfer
E-Portfolios
E-Portfolios als E-Learning-Plattformen
Lese
probe

134 Kapitel 10: Chancen der Sozial-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien
Übungsaufgabe 36:
Sehen Sie sich die Social-Media-Seiten des Neanderthal Museums an. Finden Sie sie ansprechend? Passen die verschiedenen Seiten zueinander? Erfüllen sie die von den Machern genannten Ansprüche?
Übungsaufgabe 37:
Sehen Sie sich die Social-Media-Seiten der Bayerischen Staatsoper an. Finden Sie sie ansprechend? Passen die verschiedenen Seiten zueinander? Erfüllen sie die von den Machern genannten Ansprüche?
Übungsaufgabe 38:
Kennen Sie ein Social-Media-Angebot einer Kultur- oder Non-Profit-Organisation, das Ihnen gut gefällt? Von welcher Organisation ist es – und wa-rum finden Sie es gut? Was, meinen Sie, ist der Grund, dass Sie sich bei der Frage an genau dieses Angebot erinnert haben?
Übungsaufgabe 39:
Skizzieren Sie eine Social-Media-Strategie für eine Kultur- oder Non-Profit-Organisation Ihrer Wahl. Was wollen Sie erreichen, wer ist Ihre Zielgruppe, welche Plattformen nutzen Sie, welche Inhalte wollen Sie teilen?
Übungsaufgaben
Lese
probe

Kapitel 11: Weitere Möglichkeiten im Überblick 135
11 Weitere Möglichkeiten im Überblick
Lerninhalte
Streifzug durch weitere Online-Portale
Crowdfunding
Apps, E-Paper und digitale Bildungsangebote
11.1 Weitere Social-Media-Portale
Facebook, Twitter und die verschiedenen Blogmöglichkeiten (z.B. Blogspot und WordPress) sind zur Zeit sicher die relevantesten Social-Media-Plattformen für Aktivitäten im Kultur- und Non-Profit-Bereich. Die Vorherrschaft von Twitter und Facebook ist so groß, dass schwer vorstellbar ist, dass sie in naher Zukunft von anderen Portalen gebrochen wird. Sollte dies dennoch passieren, gälte es die Angebote der Organisationen auch in die neuen Portale aufzunehmen. Die „Re-geln“ und Tipps dafür wären weiter die in diesem Studienbrief beschriebenen. Die VZ-Portale (schülerVZ, studiVZ) und auch Myspace haben gegenüber Facebook so sehr an Bedeutung verloren, dass sie heute im Normalfall zu ignorieren sind. Wer dort nicht eine spezielle Zielgruppe vermutet, muss diese Portale nicht mehr mitbespielen. Da macht es mehr Sinn, sich auf die Marktführer zu konzentrieren, als sich zu verzetteln. Verbreitet ist noch Xing als Business-Netzwerk – hier kön-nen Organisationen und Privatleute geschäftliche Kontakte knüpfen. Als Marke-ting-Forum ist es weniger nutzbar.
Verbreitete Video-Portale sind Youtube und Vimeo. Vimeo wird viel von Filme-machern und Medien-Spezialisten benutzt, da die Videos qualitativ noch hoch-wertiger einstellbar sind – und die Gemeinde stärker aus Spezialisten besteht. Y-outube hat den Vorteil, dass ein Großteil des Publikums eher dort als bei Vimeo nach Videos suchen wird. Wichtig ist in beiden Fällen eine aussagekräftige und suchmaschinenoptimierte Verschlagwortung der Videos. Die Links von beiden Portalen lassen sich in anderen Homepages, Blogs und Co. einbetten. Bei Youtube entsteht zudem oft ein eigener Austausch, die Gemeinde ist groß, Videos werden diskutiert. Es kann Sinn machen, hier einen eigenen Videokanal im Namen der Organisation einzurichten, ihn regelmäßig zu füttern und zu pflegen.
Flickr zuletzt ist ein Web-Dienstleistungsportal mit Community-Elementen, das es Benutzern erlaubt, Bilder sowie kurze Videos mit Kommentaren und Notizen auf die Website zu laden und sie mit anderen Nutzern zu teilen. Neben dem her-kömmlichen Hochladen über die Website können die Bilder auch per E-Mail oder vom Mobiltelefon aus übertragen und später von anderen Webauftritten aus ver-linkt werden (vgl. zu diesem Streifzug z.B. Weinberg 2011: 167ff.).
Vorherrschaft von Facebook und Twitter
Video-Portale: Youtube und Vimeo
Flickr
Lese
probe

136 Kapitel 11: Weitere Möglichkeiten im Überblick
11.2 Apps
Soziale Netzwerke, bedient vom Computer aus, sind noch lange nicht das Ende technischer Entwicklungen. Immer mehr Menschen sind mit Smartphones nahezu permanent und überall online, die Zahlen wurden zitiert. Das Praktische: Auch auf ihren Smartphones nutzen sie sehr stark Twitter und Facebook, die sozialen Netzwerke also, deren Bespielung in diesem Studienbrief thematisiert und geraten wird. Auch ohne spezielle eigene Apps sind Interessierte also auf ihren Smartpho-nes erreichbar.
Zusätzlich möglich ist die Programmierung eigener Apps und der Vertrieb über die verschiedenen App-Stores. Als erstes deutsches Theater veröffentlichte das Theater Erfurt im Sommer 2010 eine kostenlose App für iPhones. Darin enthalten sind u.a. der Spielplan, Fakten zu den hauseigenen Festspielen und die Möglich-keit, Theatertickets zu bestellen. Es ist also eine App für das Stammpublikum des Theater Erfurt, die zu verstärkter Bindung und vereinfachtem Ticketkauf führen soll. „Seien Sie App-to-Date“ wirbt das Theater auf seiner Homepage (www.theater-erfurt.de im Dez. 2012).
Bereits verbreiteter sind Apps bei Museen, oft bieten diese bebilderte Audio- und Multimedia-Guides per App an. Einen Überblick, Informationen und Anregungen dazu bietet Dorian Ines Gütt auf ihrer Website www.museums-app.de, sie hat sich in ihrer Bachelor-Arbeit mit Museums-Apps beschäftigt.
Für Stiftungen oder politische Organisationen kann es reizvoll sein, starke thema-tisch orientierte Apps anzubieten – und so zu einer Haupt-Informationsquelle oder auch zu einem Informations-Knotenpunkt in einem relevanten Themengebiet zu werden. Solche Apps gehen weit über Termin-Ankündigungen oder virtuelle Mu-seumsführungen hinaus, sie müssen so benutzerfreundlich und informativ aufge-baut sein, dass Menschen sie des Themas wegen installieren. Ein Beispiel dafür ist der „WWF-Fischratgeber“ (www.fischratgeber.wwf.de) – es gibt ihn online und mit identischen Funktionen auch als App. Der Fischratgeber zeigt, welche Fische man aus Umweltschutz-Sicht bedenkenlos kaufen kann, welche man um des Ar-tenschutzes willen lieber vermeiden sollte. Zusätzlich enthält er sehr fundierte In-formationen zu den verschiedenen Fischen. Die App ermöglicht es, im Super-markt „live“ zu prüfen, ob man die Dorade im Angebot bedenkenlos mitnehmen kann. WWF gelingt es so, sich bei einer für die Naturschutzorganisation relevan-ten Fragestellung sehr präsent zu machen.
Technisch ist zu beachten, dass Apps für die verschiedenen Endgeräte (Android, Windows, Apple) z.T. unterschiedlich programmiert werden müssen – und über unterschiedliche App-Stores angeboten werden.
(Links zuletzt geprüft im Januar 2013.)
Programmierung eigener Apps
Informations-Knotenpunkt werden
Lese
probe

Kapitel 11: Weitere Möglichkeiten im Überblick 137
11.3 E-Paper, iBooks – und digitale Bildungsangebote
Zunehmend wichtig für die Verbreitung von Inhalten werden auch E-Paper und iBooks. Dabei handelt es sich um digitale Varianten von Zeitungen, Magazinen oder Büchern. „E-Paper“ sind auf allen Smartphones und Tablets lesbar, „iBooks“ sind eine Sonderform für Endgeräte von Apple. Der große Vorteil von „iBooks“ ist, dass verschiedene Medien in die digitalen „Bücher“ eingebettet werden kön-nen, etwa Filme, Links, Musik und Bilder. So entstehen multimediale Sammlun-gen in Buch-Anmutung, die einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Druck-werken schaffen können. Für Kultur- und Non-Profit-Organisationen kann es inte-ressant sein, ihre Themen, Thesen und Medien in E-Papern oder iBooks zu bün-deln. Die Distribution ist einfach: Man braucht keinen Verlag, sondern kann die „Bücher“ über App-Stores anbieten. V.a. für Bildungsinstitutionen gibt es zudem „iTunes U“ – eine Plattform von Apple zur Verbreitung von Unterrichts- und Lehrmaterialien. Wenn eine Organisation zu einem relevanten Thema Medien er-stellt, kann sie versuchen, diese über das Portal direkt an Schulen, Universitäten oder andere Interessenten zu verbreiten. Auch das Videoportal Youtube bietet eine Extra-Seite für Bildungsinhalte an: www.youtube.com/education.
Wie wichtig E-Paper und auch Apps mittlerweile geworden sind, ist gut daran er-kennbar, dass Zeitungsverlage sie mittlerweile als Geschäftsfeld der Zukunft se-hen. Laut einer Studie des Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. gab es im Juni 2012 bereits über 120 deutsche Zeitungsapps für das iPad von Apple und rund 65 für Android-Tablets. Die „Bevorzugung“ von Apple-Endgeräten rührt da-her, dass laut Studien im Auftrag des Zeitungsverbands die Nutzer von iPads und iPhones tendenziell zeitungsaffiner sind und die mobilen Endgeräte häufiger nut-zen. 84 Prozent der iPad-Besitzer nutzen es mehrmals täglich. Wer ein solches Endgerät hat, erledigt einen großen Teil seiner Kommunikation darüber – und ist somit auch über das Tablet zu erreichen (vgl. Fischer 2012: 184-192). Es ist also auch für Kultur- und Non-Profit-Organisationen eine gute Idee, zu überlegen, wie man Menschen auf ihren Smartphones und Tablets erreichen kann. Das kann zu neuen Medien führen, etwa zu E-Papern, iBooks oder Apps. Aber auch über Fa-cebook, Twitter und Co. sind Tablet-/Smartphone-Nutzer zu erreichen, da viele von ihnen mobil auf soziale Netzwerke zugreifen.
11.4 Crowdfunding
„Crowdfunding“ ist ein Begriff, der sehr gut klingt – und die Möglichkeit sugge-riert, Projekte ohne zentralen Geldgeber aus der Masse (der „Crowd“) heraus zu finanzieren.
„Beim Crowdfunding finanzieren Fans, Freunde, Firmen, Mäzene gemeinsam ei-ne Idee und bekommen dafür zum Beispiel das fertige Werk (Vorfinanzierung), in-dividuelle Geschenke (Dankeschön), Medialeistungen (Sponsoring), die Möglich-
Digitale Bücher samt Filmen, Bildern und Musik
Plattformen für Bildungsangebote
Tablets als Haupt-Kommunikations-geräte
Gegenleistungen beim Crowdfunding
Lese
probe

138 Kapitel 11: Weitere Möglichkeiten im Überblick
keit der Kulturförderung (Corporate Social Responsibility, CSR), eine Spenden-quittung oder eine Gewinnbeteiligung. Unterstützer erhalten darüber hinaus eine emotionale Beteiligung am Projekt, Unterhaltung und Entertainment durch den Projektverlauf und einen Wissensvorsprung durch interne Informationen, die nur für die Unterstützer bereit gestellt werden“ (Kreßner 2011: 349).
Am Anfang steht beim Crowdfunding eine Idee, für deren Realisierung der Pro-jektemacher oder das Team Geld braucht, das es nicht zur Verfügung hat. Um die-ses Geld von einer möglichst breiten Community einzuwerben, werden die Pro-jekte in Crowdfunding-Portalen (etwa www.indiegogo.com) multimedial vorge-stellt und beworben. Hier kommen auch die sozialen Medien ins Spiel – in ihnen werden die Projekte verlinkt, erfolgreiches Crowdfunding läuft wesentlich über eine starke Bewerbung in sozialen Netzwerken. Hier muss eine Idee Interesse fin-den, sich verbreiten, im besten Fall zu einer Bewegung werden. Das Ziel ist, dass sehr viele Menschen, Einzelpersonen aber auch Unternehmen oder ggf. Stiftun-gen, Interesse an dem Projekt entwickeln, die Umsetzung befördern wollen – und dafür einen Geldbetrag zur Verfügung stellen. Wenn sehr viele mitmachen, kann aus vielen Einzelspenden ein Betrag werden, der ausreicht, einen Film zu produ-zieren, eine CD aufzunehmen, eine Ausstellung zu realisieren o.ä.. Wenn das ein-geworbene Geld nicht für das Projekt ausreicht, wird es den Spendern zurückge-zahlt. Wenn das Projekt realisiert werden kann, bekommen die Spender ein vorher avisiertes Dankeschön. Das können, wie in Kreßners Zitat angedeutet, Informati-onen, Einladungen, inhaltliche Beteiligungen, Treffen u.ä. sein. Wichtig ist: Wer spendet, will sich beteiligt fühlen. Crowdfunding funktioniert nicht einfach als „Geldeinsammeln“, man muss sich darauf einstellen, intensiv mit der Spender-Community zu kommunizieren. Schließlich ist sie Finanzier des Projekts (vgl. Gumpelmaier 2011: 371ff). Beim bereits erwähnten Beispiel „Iron Sky“ flossen z.B. Ideen der Spender-Community in den Film ein. Manche Kritiker vermuteten darin einen der Gründe für eine gewisse Sprunghaftigkeit und Zerfahrenheit – an-dere lobten gerade die unkonventionelle Erzählweise.
Crowdfunding ist eine interessante neue Möglichkeit, Projekte zu finanzieren – sollte aber nicht Anlass zu übertriebenen Hoffnungen geben. Es haben nur Projek-te eine Chance, die sehr außergewöhnlich sind und bei einer ausreichend großen Zahl von Menschen auf so großes Interesse stoßen, dass diese es finanzieren wol-len. Dazu gehört auch eine sehr kreative und intensive Bewerbung online und v.a. in verschiedenen sozialen Netzwerken. Das erfordert viel Arbeit – ist also eine große und letztlich auch teure „Vorleistung“ von Seiten der Projektmacher. Bevor man eine Crowdfunding-Kampagne startet, gilt es deshalb genau zu prüfen, wie die Chancen einzuschätzen sind und ob eine massengestützte Finanzierung realis-tisch ist. Viele Crowdfunding-Projekte scheitern, weil sie falsch eingeschätzt oder nicht strategisch geplant wurden. In solchen Fällen entsteht aus viel Arbeit – kein Ertrag. Wo Crowdfunding aber gelingt, ist es eine sehr gute von Groß-Institutionen unabhängige Finanzierungsweise, die zugleich schon für eine große und real beteiligte Internet-Community an dem Projekt sorgt.
Crowdfunding-Portale
Wer spendet, will sich beteiligt fühlen
Kreative und intensive Online-Werbung not-wendig
Lese
probe

Kapitel 11: Weitere Möglichkeiten im Überblick 139
Übungsaufgabe 40:
Kennen Sie Apps von Apps von Non-Profit- oder Kultur-Organisationen? Su-chen Sie online oder in App-Stores nach Apps zu Themengebieten, die Sie inte-ressieren. Was ist das besondere an diesen Apps, was macht sie aus, wo wäre noch mehr Potenzial?
Übungsaufgabe 41:
Machen Sie sich mit dem Crowdfunding-Portal www.indiegogo.com vertraut und klicken Sie sich durch aktuelle Kampagnen. Welche Projekte fallen Ihnen auf, was macht diese besonders?
Übungsaufgaben
Lese
probe

Musterlösungen zu den Übungsaufgaben 153
dürfnissen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Sie bezieht Schlüsselqualifikationen also auf alle Lebensbereiche.
Übungsaufgabe 21:
Welche Funktion hat Medienkompetenz für politische Partizipation?
Lösungsvorschlag:
Information:
Politische Berichterstattung nutzen
Informationsquellen einschätzen
Meinungsbildung auf Basis von Berichterstattung in den Medien
wissen, wo man zusätzliche Informationen über Parteien findet (z.B. Wahlpro-gramme)
korrekte Handhabung von Wahlautomaten
Teilnahme an Diskussionsforen und Co.
Nutzung der Medien, um politische Anliegen zu kommunizieren
Übungsaufgabe 22:
Erklären Sie den Begriff „barrierefrei“. Welche gesellschaftliche Bedeutung hat die Barrierefreiheit von Medien?
Lösungsvorschlag:
„Barrierefrei“ heißt im Zusammenhang mit Medien, dass diese ohne Einschrän-kung auch von Menschen mit Behinderungen genutzt werden können. Für Inter-netseiten bedeutet das, es müssen Alternativen zu Video- und Audio-Elementen angeboten werden. Darüber hinaus sollten Texte so angelegt sein, dass die Schriftgröße vom Nutzer verändert werden kann und der Text von Vorlese-Soft-ware erkannt wird.
Generell ist eine Barrierefreiheit von Medien wichtig, weil eine uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft ohne Nutzung von Medien nicht möglich ist.
Übungsaufgabe 23:
Welche Rolle spielen die unterschiedlichen Herkunftsmilieus für die Entwick-lung von Medienkompetenz bei Kindern?
Lese
probe

154 Musterlösungen zu den Übungsaufgaben
Lösungsvorschlag:
Hauptort der Mediennutzung ist der Haushalt der Eltern bzw. der aufziehenden Erziehungsberechtigten. Hier findet in der Regel auch der erste Kontakt mit Me-dien statt. Bei Kindern im Vor- und Grundschulalter muss daher je nach Her-kunftsmilieu mit sehr unterschiedlichen medialen Erfahrungen gerechnet werden, die dementsprechend unterschiedlich aufzuarbeiten sind. Auch im weiteren Ver-lauf des Heranwachsens werden die Weichen der Bildungs- und damit Lebens-chancen im Elternhaus gestellt.
Während einige, vorwiegend aus einkommens- und bildungsstarken Milieus stammende Jugendliche sich im gesamten Spektrum von der Literatur bis zu den digitalen Medien unbefangen bedienen, fallen andere, sozial schwächere bzw. bil-dungsferne Haushalte, immer mehr auf den reinen Fernsehkonsum zurück (vgl. Schreier / Rupp 2002: 260).
Übungsaufgabe 24:
Welche Chancen und Schwierigkeiten sind mit dem zunehmenden Einsatz von Medien an Hochschulen verbunden?
Lösungsvorschlag:
Chancen:
E-Learning, d.h. Erweiterung der Lehre in den virtuellen Raum
Vernetzung von Hochschulen und Forschergruppen
erleichterte Recherche auch in nicht gedruckten Werken (Aufsätze, Vorträge, Diplomarbeiten)
Schwierigkeiten:
kompletter Ersatz von Präsenz-Veranstaltungen durch distance-learning
die Gefahr, dass Studenten Werke aus dem Internet als eigene Arbeiten ausge-ben
z.T. mangelnde „akademische Medienkompetenz“ bei Lehrenden und Studie-renden
Übungsaufgabe 25:
Warum wurden Institutionen wie die freiwillige Selbstkontrolle oder der Presse-rat eingeführt?
Lese
probe

Musterlösungen zu den Übungsaufgaben 155
Lösungsvorschlag:
Staatliche Eingriffe in Form von Zensur sind rechtlich nicht erlaubt. Das Grund-gesetz schließt Zensur aus. Trotzdem kann, z.B. aus ethischen Gründen, nicht al-les für jeden zugänglich gemacht werden. Die freiwillige Selbstkontrolle ver-pflichtet sich selbst dafür zu sorgen, dass ethische und Jugend schützende Krite-rien erfüllt werden, um somit eine staatliche Kontrolle unnötig zu machen. Der deutsche Presserat sorgt durch seinen Pressekodex dafür, dass Journalistinnen und Journalisten eine Leitlinie für ihr Handeln haben.
Übungsaufgabe 26:
Der Deutsche Presserat wird auch als „zahnloser Tiger“ bezeichnet. Warum?
Lösungsvorschlag:
Beim „Pressekodex“ des Presserats handelt sich um ethische Grundsätze, aber nicht um Gesetze. Bei Verstößen gegen diese Grundsätze kann der Presserat öf-fentliche Rügen aussprechen, die, das ist die letzte Verpflichtung des Pressekodex, von den betroffenen Organen abgedruckt werden sollen (vgl. Deutscher Presserat 2006: 4-9). Der Abdruck ist aber freiwillig, und wie das im Text zitierte Beispiel zeigt, kann der Presserat nicht beeinflussen, ob und in welchem Rahmen die Rüge kommuniziert wird.
Übungsaufgabe 27:
Wo und wie werden die besonderen Notwendigkeiten des Jugendschutzes im Umgang mit Medien begründet?
Lösungsvorschlag:
Der Jugendschutz hat Verfassungsrang und dient dem Rechtsgut der Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen. Der Staat darf zu diesem Schutz nicht nur in die Grundrechte Dritter eingreifen, sondern ist nach Einschätzung des Bundesverfassungsgerichtes dazu sogar verpflichtet, und zwar nicht nur gegenüber den Eltern, sondern auch gegenüber Dritten, die jugendgefährdende Inhalte oder Produkte herstellen oder verbreiten. Der Jugendschutz soll die ungestörte Entwicklung der Jugendlichen gewährleisten.
Das Jugendschutzgesetz verbietet die Weitergabe jugendgefährdender Träger-medien wie Videos, CDs, CD-ROMs, Bücher etc.
Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag regelt den Schutz vor jugendgefährden-den Inhalten der elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien.
Lese
probe

156 Musterlösungen zu den Übungsaufgaben
Einzelne Sendungen dürfen nur zu bestimmten Uhrzeiten ausgestrahlt werden, und es werden Regeln für Werbung und Teleshopping definiert.
Übungsaufgabe 28:
Welche Inhalte gelten als schwer jugendgefährdend?
Lösungsvorschlag:
Propagandamittel verfassungswidriger Organisationen, Volkverhetzung, Anlei-tung zu Straftaten, strafbare Gewaltdarstellungen, den Krieg verherrlichende und die Menschenwürde verletzende Inhalte, Darstellungen von Kindern in unnatür-lich geschlechtsbetonter Körperhaltung und Inhalte, die offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu ei-ner eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit schwer ge-fährden.
Übungsaufgabe 29:
Nennen Sie die relevanten Institutionen des Jugendmedienschutzes. Wann wer-den sie tätig?
Lösungsvorschlag:
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPJM): Ihre Hauptaufgabe ist, Schriften-, Ton und Bildträger, sowie Internetseiten zu identifizieren und zu indizieren, d.h. in die Liste jugendgefährdender Schriften aufzunehmen. Sie handelt auf Antrag oder von Amts wegen.
Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM): Sie übt die Aufsicht über den privaten Rundfunk und gemeinsam mit der Bundesprüfstelle über die Telemedien aus. Sie gehört als Organ zu den Landesmedienanstalten. Sie handelt ebenfalls auf Antrag oder von Amts wegen.
Die öffentlich-rechtlichen Sender verwalten sich selbst und haben für den Jugendschutz einen Jugendschutzbeauftragten in den eigenen Reihen.
Die Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle werden von der Wirtschaft getragen und von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und der Kommission für Jugendmedienschutz anerkannt. Sie sollen vorab tätig werden und mediale Inhalte unter Jugendschutzgesichtspunkten beurteilen und Einschränkungen (z.B. zum Ausstrahlungszeitraum) aussprechen. Sofern die Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle tätig geworden sind, haben BPJM und KJM keine Handhabe mehr, sofern die rechtlichen Grenzen der Beurteilungsspielräume nicht überschritten wurden.
Lese
probe

Musterlösungen zu den Übungsaufgaben 157
Übungsaufgabe 30:
Recherchieren Sie die aktuellen Zahlen zur Nutzung von Social Media und Smartphones in Deutschland. Wie viele Menschen aus welchen Altersgruppen sind online, wie viele in sozialen Netzwerken angemeldet? In welchen? Wie viele Menschen haben Smartphones?
Lösungshilfe: In aller Regel sind die jeweils aktuellsten Zahlen für Deutschland beim Bundes-verband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V., kurz BITKOM, zu finden. Der Verband pflegt einen sehr guten Online-Auftritt samt umfassendem Archiv der Pressemeldungen. Dieses ist unter www.bitkom.org über den Reiter „Presse“ zu finden. Suchen Sie dort per Such-wort-Eingabe oder klicken Sie sich unter „Presseinformationen“ (links anwählbar) durch die aktuellsten Meldungen. Hier können Sie sich gut einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Zahlen verschaffen. Sollte Ihnen hier eine Zahl oder Information fehlen, probieren Sie, bei Wikipedia oder per Google-Suche Anhalts-punkte zu finden.
Übungsaufgabe 31:
Fragen Sie sich selbst: Wie viel Zeit verbringen Sie täglich online? Davon wie lange mit welchen Geräten? Wie lange sind Sie in sozialen Netzwerken einge-loggt? Wie kommunizieren Sie bevorzugt per Internet?
Lösungshilfe:
Ziel dieser Aufgabe ist, dass Sie sich über Ihre eigene Mediennutzung bewusst werden. Fragen Sie sich, wie Sie kommunizieren, woher Sie die für Sie relevanten Informationen bekommen, wie Sie ggf. online Hobbys nachgehen oder sich zu Nischenthemen austauschen. Wie wären Sie am besten von Kultur- oder Non-Profit-Organisationen online zu erreichen? Wenn Sie dies fundiert für sich beantworten, haben Sie u.U. schon gute Hinweise, wie Sie mögliche Zielgruppen erreichen können. Denn möglicherweise verhalten sich diese ganz ähnlich und erwarten ähnliches von Online-Kommunikation.
Übungsaufgabe 32:
Was unterscheidet das Web 1.0 vom Web 2.0?
Lese
probe

158 Musterlösungen zu den Übungsaufgaben
Lösungshilfe:
Der ganz zentrale Unterschied ist, dass im Web 1.0 der ersten Internet-Jahre In-halte tendenziell eher von einzelnen produziert und von zahlreichen konsumiert wurden. Verlage, Firmen und Organisationen stellten „starre“ Seiten ins Internet und so per Homepage zumeist Informationen online. Die große Masse der Inter-netnutzer sah sich diese an, hatte aber kaum die Möglichkeit, eigene Inhalte zu kreieren. Das hat sich im Web 2.0 grundlegend geändert. Über Blogs, Social-Media-Plattformen und Co. kann nun gewissermaßen jeder der will, Inhalte erstel-len und verbreiten. Diese Tatsache hat die Kommunikationsstrukturen im Internet radikal verändert: Denn die Nutzer erwarten nun auch gegenüber Organisationen, Kommunikatoren und Teilhaber an Online-Inhalten zu sein – nicht mehr bloße „Empfänger“.
Eine knappe Wissenssammlung zum Web 2.0 samt weiterführender Links ist im Online-Lexikon Wikipedia zu finden: http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
Übungsaufgabe 33:
Welche Begriffe fehlen in diesem Kapitel? Wo haben Sie noch Verständnis-schwierigkeiten? Recherchieren Sie online die Antworten.
Lösungshilfe:
Hier überlegen Sie einfach, wo Ihnen Informationen noch nicht reichen, beim Verständnis welcher Begriffe Sie noch Lücken haben. Möchten Sie etwa noch ei-ne genauere Erklärung von „Hashtags“? Fehlen Ihnen Informationen zu einem be-stimmten Forum? Ist möglicherweise seit Drucklegung des Studienbriefs bereits wieder eine neue Plattform in der Diskussion? Ausgangspunkt für Ihre Online-Recherchen kann gut das Online-Lexikon Wikipedia sein, es bündelt viel Web 2.0-Wissen, da es vielfach von den Protagonisten des Web 2.0 selbst gepflegt wird. Darüber hinaus „googlen“ Sie Begriffe – und lesen sich auf Plattformen o.ä. selbst in die Beschreibungen ein.
Übungsaufgabe 34:
Was könnte aus Sigmar Gabriels Sicht der „Gewinn“ mit seinem Post gewesen sein? Wiegt der Gewinn möglicherweise die beschriebenen „Schäden“ auf?
Lösungshilfe:
Viele Menschen schätzen glaubhafte persönliche Betroffenheit bei Politikern – wenn diese Sigmar Gabriel seine Betroffenheit abgenommen haben, könnte er bei
Lese
probe

Musterlösungen zu den Übungsaufgaben 159
ihnen Sympathien gewonnen haben. Zudem gibt es in manchen gesellschaftlichen Gruppen immer wieder den Vorwurf, es sei in Deutschland tabuisiert, kritisch über Israel zu sprechen. Menschen, die dies so empfinden, könnte Gabriel gerade durch den „Tabubruch“ positiv für sich eingenommen haben. Auch, dass er nicht jede Twitter-Äußerung lange abwägt und gegenprüfen lässt, könnte ihm Sympa-thien eingebracht haben. Der mögliche „Gewinn“ für Gabriel läge also im Bereich seines Images, bei manchen Menschen hat er durch den Tweet möglicherweise an Sympathie gewonnen. Dies dürfte allerdings – wenn man streng strategisch die Gewinne und Verluste durch die Äußerung betrachtet – den entstandenen politi-schen Schaden, wie er in Kapitel 9.1.2 skizziert wurde, kaum aufwiegen.
Übungsaufgabe 35:
Erinnern Sie sich an ein aktuelles Beispiel eines umstrittenen Posts oder Tweets und überlegen Sie, welche Fragen sich der Absender/die Absenderin vorab hätte stellen sollen?
Lösungshilfe:
Gab es in den vergangenen Wochen einen Fall, bei dem Medien über Tweets oder Posts berichteten? Dann rufen Sie sich diesen oder diese in Erinnerung, spüren ihnen in den Archiven von Zeitungen und per Google nach – und machen sich ein Meinungsbild. Wenn Ihnen kein Fall präsent ist: Wenn Sie bei www.spiegel.de und bei www.bild.de jeweils nach „Twitter Skandal“ und „Facebook Skandal“ su-chen, sollten Sie einen Überblick über aktuelle Fälle erhalten. Immer wieder ma-chen zum Beispiel auch Sportler in sozialen Netzwerken unangenehm auf sich aufmerksam – etwa Fußballer, die ihre Trainer verunglimpfen, weil sie nicht auf-gestellt wurden. Zumeist helfen sie so ihrer Karriere eher nicht weiter... Ein weiteres Beispiel aus dem politischen Bereich lässt sich per Suche nach „Ulf Dunkel“ finden. Der niedersächsische Grünen-Landtagskandidaten beendete seine politische Laufbahn rund um den Jahreswechsel 2012/2013 selbst, indem er in ei-ner Facebook-Gruppe Gedichte postete, die als antisemitisch zu interpretieren wa-ren. Wenn Sie ein Beispiel gefunden haben, stellen Sie die in Kapitel 9 aufgeworfenen Fragen. V.a.: Wer sind die Adressaten? Was will der Absender erreichen, welche Botschaft will er vermitteln? Wozu könnte die Nachricht führen? Dient sie seinen Zielen – oder ist sie kontraproduktiv? (Wenn z.B. ein Fußballer auf mehr Einsatz-zeit hofft, hilft es ihm in aller Regel wenig, sich bei seinem Trainer unbeliebt zu machen. Fluchen muss ein jeder manchmal – aber Flüche auf Facebook oder Twitter sind sofort www-öffentlich. Sie werden natürlich von der Presse und eben z.B. auch Vorgesetzten bemerkt. Es ist immer wichtig sich klar zu machen: Als öffentliche Person oder auch Organisation sind Äußerungen in sozialen Netzwer-
Lese
probe

160 Musterlösungen zu den Übungsaufgaben
ken nicht „privat“ – sondern etwas, das ich potenziell weltweit und für nahezu je-den einsehbar veröffentliche.)
Übungsaufgabe 36:
Sehen Sie sich die Social-Media-Seiten des Neanderthal Museums an. Finden Sie sie ansprechend? Passen die verschiedenen Seiten zueinander? Erfüllen sie die von den Machern genannten Ansprüche?
Lösungshilfe:
Eine „Musterlösung“ ist auch hier nicht formulierbar, denn zwischen dem Zeit-punkt der Drucklegung und Ihrer Beschäftigung mit der Aufgabe können sich die Seiten bereits wieder grundlegend verändert haben. Wichtig sind u.a. folgende Fragen:
Finden Sie sich gut auf den Seiten zurecht? Fühlen Sie sich eindeutig „ge-leitet“, sind die Seiten benutzerfreundlich?
Glauben Sie, dass auch weniger Internet-affine Menschen mit den Seiten zurechtkommen? Die Zielgruppe des Museums setzt sich aus allen Alters-gruppen zusammen.
Zieht sich der Leitgedanke „Evaluation“ durch die verschiedenen Plattformen? Erkennen Sie einen stimmigen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Veröffentlichungen? Ergänzen diese sich – oder stoßen Sie auf viele reine Wiederholungen?
Ist der Neanderthaler Leitfigur? Führt er Sie durch die verschiedenen Plattformen und Informationen? Taucht er überall auf – und entwickelt er für Sie „Persönlichkeit“?
Machen die verschiedenen Plattformen und Informationen Sie im Zusammen-spiel neugierig auf das Neanderthal Museum?
Übungsaufgabe 37:
Sehen Sie sich die Social-Media-Seiten der Bayerischen Staatsoper an. Finden Sie sie ansprechend? Passen die verschiedenen Seiten zueinander? Erfüllen sie die von den Machern genannten Ansprüche?
Lösungshilfe:
Hier gilt das gleiche wie bei der vorigen Übungsaufgabe. Verfahren Sie ähnlich: Sehen Sie sich die verschiedenen Seiten an und prüfen Sie, ob die Informationen sich ansprechend ergänzen oder ob es sich um reine Wiederholungen handelt.
Lese
probe

Musterlösungen zu den Übungsaufgaben 161
Schafft es die Staatsoper, über ihre Social-Media-Seiten eine bestimmte Identität zu vermitteln? Macht sie neugierig? Ist das Angebot so übersichtlich gestaltet, dass es auch für Neulinge in sozialen Netzwerken zugänglich ist? Prüfen Sie das Internetangebot der Staatsoper nach den hier, im Kapitel 10 und in der vorigen Lösungshilfe beschriebenen Ansprüchen an gutes Social-Media-Marketing. Über-legen Sie am Ende, was Ihnen bei der Staatsoper und was Ihnen beim Neanderthal Museum besonders gut gefällt – und wo Sie noch Potenzial für Verbesserungen sehen. Ziehen Sie daraus Rückschlüsse für eigene Social-Media-Überlegungen.
Übungsaufgabe 38:
Kennen Sie ein Social-Media-Angebot einer Kultur- oder Non-Profit-Organisation, das Ihnen gut gefällt? Von welcher Organisation ist es – und wa-rum finden Sie es gut? Was, meinen Sie, ist der Grund, dass Sie sich bei der Frage an genau dieses Angebot erinnert haben?
Lösungshilfe:
Ziel dieser Aufgabe ist, dass Sie reflektieren, warum eine bestimmte Seite Sie an-spricht. Was ist das besondere an ihr? Wieso ist die Ansprache offenbar für Sie genau zielgruppengerecht? Was machen die Betreiber anders, als andere Seiten? Lässt sich benennen, wie die Themenwahl ist, welche Sprachebene genutzt wird? Können Sie einschätzen, welchen Zielen und welcher Strategie die Betreiber der Seite folgen? Mit diesen Fragen – die Sie künftig immer wieder an Online- und auch sonstige Marketingangebote, die Ihnen gefallen, stellen sollten – können Sie den Schritt vom „gefällt mir“ zum analytischen Blick machen. Wenn Sie gute Beispiele analysieren, können Sie viele Rückschlüsse für eigene Social-Media-Arbeit ziehen.
Übungsaufgabe 39:
Skizzieren Sie eine Social-Media-Strategie für eine Kultur- oder Non-Profit-Organisation Ihrer Wahl. Was wollen Sie erreichen, wer ist Ihre Zielgruppe, welche Plattformen nutzen Sie, welche Inhalte wollen Sie teilen?
Lösungshilfe:
Zuerst müssen Sie entscheiden, für welche Organisation Sie diese Aufgabe durch-spielen wollen. Es kann sich ebenso um ein kleines Theater handeln, wie um eine große politische Organisation. Gut ist, wenn Sie eine Organisation wählen, die Sie gut kennen und die sie konkret durchdenken können. Dann beantworten Sie stich-punktartig folgende Fragen:
Lese
probe

162 Musterlösungen zu den Übungsaufgaben
Was will die Organisation in sozialen Netzwerken erreichen? Antworten können z.B. sein: einen Imagegewinn, steigende Bekanntheit, Dialogforum werden, als kritische Stimme wahrgenommen werden, über bestimmte Themen informieren, Öffentlichkeit für Problemfelder schaffen.
Wer ist die Zielgruppe? Wie in Kapitel 10 beschrieben, ist es ein großer Unterschied, ob Sie z.B. eine lokale oder eine überregionale möglicherweise sogar internationale Öffentlichkeit erreichen wollen. Für manche Ziele ist eine eingeschränkte „Spezialisten-Zielgruppe“ gut, andere erfordern eine breitere Zielsetzung.
Welche Plattformen passen zum Ziel und der Zielgruppe? Wo halten sich die Menschen, die ich erreichen möchte, online auf? Lassen sich die angestrebten Inhalte in der Kürze von Twitter oder Facebook vermitteln? Ist ein Blog passender? Oder ein Mix aus verschiedenen Plattformen?
Welche Inhalte sollen auf der Plattform / den Plattformen veröffentlicht werden? Mit welchen Informationen und Medienformen kann ich am stärksten Neugier bei meiner Zielgruppe wecken und ihre Meinung im Sinne meiner Ziele beeinflussen? Lassen sich diese Inhalte auf ungewöhnliche Weise transportieren? Etwa in Videos, Bildern, Musik? Wie kann ich ungewöhnliche Einblicke, Hintergründe und Dialoganreize bieten?
Welche Ansprache wähle ich? Ist die Zielgruppe international, sollte die gewählte Sprache i.d.R. englisch sein, sonst deutsch. Duze oder sieze ich? Wie „flapsig“ formuliere ich? Beides hängt von der Zielgruppe und den gewählten Inhalten ab.
Wann und wie lege ich los? Bevor die Seite online geht, sollte das Konzept stehen. Zum Konzept gehört auch die Antwort auf die Frage: Wie erreiche ich möglichst gleich zu Beginn Aufmerksamkeit? Kann die Seite mit einem „Knall“ starten, mit einer Information oder Aktion, die sich sofort in sozialen Medien herumspricht? Kann der Start der Seite mit einer Werbe-Aktion verbunden werden? Wie weiße ich Anhänger meiner Organisation auf die neue(n) Seite(n) hin?
Skizzieren Sie einen ersten Post. Entspricht dieser Ihren Zielen, der Zielgruppe und den angestrebten Inhalten?
Übungsaufgabe 40:
Kennen Sie Apps von Apps von Non-Profit- oder Kultur-Organisationen? Su-chen Sie online oder in App-Stores nach Apps zu Themengebieten, die Sie inte-ressieren. Was ist das besondere an diesen Apps, was macht sie aus, wo wäre noch mehr Potenzial?
Lese
probe

Musterlösungen zu den Übungsaufgaben 163
Lösungshilfe:
Wenn Sie ein Smartphone besitzen, geben Sie einfach in Ihrem App-Store Such-begriffe zu Themenfeldern ein, die Sie interessieren. Auf was für Apps stoßen Sie? Sind Apps von Kultur- und/oder Non-Profit-Organisationen darunter? Falls ja: Installieren Sie eine oder mehrere der Apps und testen Sie:
Wer ist die Zielgruppe der Apps? Sind sie für diese benutzerfreundlich?
Bietet die App Anreize zum Umgang mit Themen der Organisation? Macht Sie neugierig? Lädt Sie zum häufigen Nutzen ein?
Gibt es Dialogmöglichkeiten oder andere dynamische Elemente? Entwickelt sich die App weiter, liefert sie regelmäßig neue Inhalte? Oder bleibt sie statisch?
Mit welchen zusätzlichen Funktionen könnte die App relevanter und für eine größere Zielgruppe interessant werden?
Übungsaufgabe 41:
Machen Sie sich mit dem Crowdfunding-Portal www.indiegogo.com vertraut und klicken Sie sich durch aktuelle Kampagnen. Welche Projekte fallen Ihnen auf, was macht diese besonders?
Lösungshilfe:
Die Seite lohnt sehr – schon weil sie sehr viele und sehr verschiedene kreative Projekte aus ganz unterschiedlichen Richtungen und Ländern vorstellt. Klicken Sie einfach etwas in dem Portal herum, folgen Sie Ihren Interessen. Bei den ein-zelnen vorgestellten Crowdfunding-Kampagnen wird jeweils auch angezeigt, wie viel für sie schon gespendet wurde. So sehen Sie, welche Projekte besonders er-folgreich im Einsammeln von Mitteln sind. Gucken Sie sich einige erfolgreiche genauer an: Was hebt diese Projekte von anderen ab? Wie sind sie dargestellt? Was macht die Kampagnen besonders? Dies ist die letzte Übungsaufgabe dieses Studienbriefs. Verweilen Sie eine Zeit lang bei www.indiegogo.com und lassen sich inspirieren. Hier finden Sie sowohl kreative Ideen aus sehr unterschiedlichen Projektbereichen – als auch sehr gute Beispiele für die kreative kommunikative Aufbereitung von Inhalten.
Lese
probe

164 Stichwortverzeichnis
Stichwortverzeichnis
A
affektive Dimension 42
Alltagskonsument 51, 52, 55, 151
Anhänger 2
Anschlusskommunikation 44, 48, 49, 151
Anzeigen-Auflagen-Spirale 8
App 95, 99, 102, 136, 137, 139, 162, 163
Arbeitsmarktforschung 57
ästhetische Dimension 42
B
Baacke 38
Barrierefreiheit 65, 74, 153
Bewahrpädagogik 33, 34, 149
Bewältigung des Alltags 61
Bewertungsplattform 100
bildungstechnologisch-funktionale
Medienpädagogik 36, 149
Blog XVIII, 4, 43, 44, 100, 115, 118, 119, 121,
122, 123, 127, 128, 129, 133, 143, 162
Bundesministerium für Bildung und Forschung 71
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
81, 84, 85, 156
C
Casting-Shows 76
Community 99, 100, 101, 115, 135, 138
competence 37
Content 100, 105, 114, 123
Crowdfunding III, XVIII, XIX, 101, 135, 137,
138, 139, 163
D
Design 65, 73, 101
Doppelcharakter der Zeitung 8
Dschungelcamp 41
Dynamik 19, 28, 88, 148
E
Eigenbewahrung 35, 149
E-learning 154
E-Learning V, VI, X, XVI, XIX, 133
E-Paper III, 8, 95, 135, 137, 141
E-Portfolio 57, 133
F
Facebook III, IV, XIII, XVIII, XIX, 1, 2, 4, 7, 22,
41, 42, 93, 94, 95, 96, 101, 103, 107, 109,
111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135,
136, 137, 141, 159, 162
Fachqualifikationen 57
Flickr 48, 127, 135
Follower 104, 107, 123, 141
Frankfurter Schule V, 36
freiwillige Selbstkontrolle 80, 154, 155
Freiwillige Selbstkontrolle 34, 76, 77, 85
Fremdbewahrung 35, 149
G
gatekeeper 17
Google 94, 95, 99, 101, 103, 104, 120, 157, 159
Grimme-Preis XII, 35
Grundversorgung 14, 146
H
Habitualisierungsthese 31
Handlungsdimension 40, 43, 50
Hashtag 104
Hype 131
I
iBook 137
Individualkommunikation X, 2, 4, 90, 143
Informationspflicht 75
Infotainment V, VI, 6, 46
Inhibitions- und Umkehr-These 31
Instant-Messaging 102
J
jugendgefährdende Träger- und Telemedien 83
Lese
probe

Stichwortverzeichnis 165
Jugendmedienschutz Staatsvertrag 82
Jugendschutzgesetz 81, 85, 155
K
Katharsis-These 30
kognitive Dimension 40
kommunikative Kompetenz 37, 38
Kontext 28, 29, 148
kritische Theorie 36
Kritische Theorie V
kritisch-rezeptive Distanz 35, 150
kritisch-rezeptive und emanzipatorisch-politische
Medienpädagogik 36, 149
Kultivierungshypothese 31
L
lebensbegleitendes Lernen 61
lebenslanges Lernen 53, 63
Lesekompetenz VIII
Linguistik 37, 152
Location-based Services 102
M
Massenkommunikation VI, VII, 2
Massenmedien VII, 38, 49, 51, 59, 65, 82, 88, 90,
143
Medialitätsbewusstsein 43, 44, 50
medienbezogene Genussfähigkeit 44, 47, 50
medienbezogene Kritikfähigkeit 44
Mediengestaltung 50, 150
Medienkompetenz 150, 152
Medienkompetenzvermittlung 51, 73
Medienkritik 6, 38, 40, 50, 150
Medienkunde 38, 39, 40, 50, 64, 69, 150
Mediennutzung21, 22, 23, 28, 30, 38, 39, 42, 151,
154
Medienpädagogik 33, 34, 35
medienspezifische Rezeptionsmuster 43
Medienspezifische Rezeptionsmuster 45
Medienwirkungstheorien 6
Medienwissen 44, 45, 46, 47, 50, 62
Meinungsführer 27
Mikroblog 122
MySpace 103
N
Nachrichtenfaktoren VII, 19, 20, 147
Nachrichtenwerttheorie 17, 19, 147
Negativer Jugendmedienschutz 83, 87
Netiquette 79, 102, 123
O
Online-Marketing 93
P
Paparazzi VII, 75
Partizipationsmuster 48, 49, 50
Peer-Group VIII, 26, 100, 103, 113, 114
performance 37
personale Fähigkeiten 59
Plattform 2, 42, 46, 100, 115, 121, 122, 125, 129,
137, 141, 158, 162
Podcast VIII, 39, 62
politische Teilhabe 62
Positiver Jugendmedienschutz 90
Post XIX, 108, 109, 111, 115, 123, 124, 128, 158,
162
präventiv-normative Bewahrpädagogik 33
Pressefreiheit IX, 7, 144
Pressekonzentration VIII, 35
propagandistisch-indoktrinäre Medienpolitik 34,
149
publizistische Einheit 9, 145
Publizistische Einheit IX
R
Realitätsflucht 34
reflexiv-praktische Medienpädagogik 36, 54, 149
Reichweite 8, 22
Rundfunkrat 14, 146
Rundfunk-Regulierung 13
S
Schlüsselqualifikationen 57, 59, 152, 153
Schulen ans Netz 66
Selektion und Kombination von Mediennutzung
44
Smartphone 20, 25, 49, 95, 118, 128, 137, 163
Lese
probe

166 Stichwortverzeichnis
Social Media I, II, III, XII, XIII, XVIII, XIX, XX,
XXV, XXVI, 1, 21, 25, 54, 93, 97, 99, 101,
103, 107, 111, 113, 114, 116, 118, 119, 121,
124, 126, 127, 130, 135, 141, 157
Social Networks 103, 115, 127, 128
Social-Media-Angebote 95
soziale Dimension 42
soziale Fähigkeiten 59
soziale Medien 5, 128
soziale Netzwerke 6, 61, 93, 94, 95, 96, 125, 126,
131, 137
Spiegel-Affäre IX, 35
Stimulus-Organismus-Modell 27
Stimulus-Response-Modell X, 26, 147
Studienreihe KIM – Kinder und Medien 22
Suchmaschine 42, 89, 95, 101, 103
Suggestionsthese 30
T
Tablet XVII, 4, 95, 99, 137
Transaktion 29
Tweet 104, 108, 109, 111, 115, 122, 123, 124,
128, 159
Twitter III, XIII, XVIII, 4, 7, 93, 102, 104, 107,
108, 110, 111, 115, 116, 118, 119, 122, 123,
127, 128, 130, 135, 136, 137, 141, 159, 162
U
Urheberrecht I, III, 124, 125
Uses-and-Gratifications-Ansatz XI, 27, 36, 149
V
Verstärker-Effekt 27
Vimeo 130, 135
W
Wahlautomaten 62, 63, 153
Web XIII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXVI, 2, 7,
39, 43, 70, 89, 93, 94, 99, 100, 103, 104, 105,
106, 107, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 123,
127, 128, 129, 130, 135, 141, 157, 158
Web 1.0 103, 105
Web 2.0 100, 103, 105, 106, 114, 127, 128, 157,
158
wiki 104, 121, 131, 133, 158
Wikipedia 43, 48
Wirkung von Gewalt in den Medien 30
X
Xing 94, 103, 135
Y
Youtube IV, 4, 22, 93, 119, 120, 128, 130, 131,
133, 135, 137
Z
Zensur 77, 144, 149, 155
Zwei-Stufen-Fluss der Kommunikation 27
Lese
probe