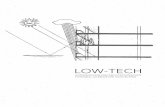Stimmenhören - michael-h62 - Zusam._Fassung.pdf - member michael-h62
Michael Turnheim - Lacans Sinthome
Transcript of Michael Turnheim - Lacans Sinthome

Ereignis. Lacan kehrt zu Freuds Texten zurück, was damals nicht wirklich üblich war. Sein Freud ist aber gleichzeitig auch eine Art Stilisierung, die unter anderem zur Funktion hat, Lacans eigene wichtige Neuerungen zu legitimieren.' Daher die Frage, ob die Loslösung von Freud beim letzten Lacan den wirklichen oder den zuvor stilisierten Freud betrifft. Lassen wir das offen, es ist vielleicht beides zugleich.
5 Vgl. den ersten Teil des Buches.
54
1.
Lacans sinthome
Nach diesen Vorbemerkungen komme ich jetzt zum Seminar Le sinthome (1975/76), zu dem es inzwischen sehr gewissenhafte Kommentare gibt.^ Der Titel entspricht einer altertümlichen Schreibweise des Wortes »Symptom«, die erst von Rabelais in das Wort »sympto-mate« umgewandelt worden ist, aus dem dann »Symptom« wird. In diesem Seminar geht Lacan, wie gesagt, vom »Fall« Joyce aus, der eigentlich kein klinischer Fall ist. Dass es kein Fall ist - Joyce war nie in Analyse und seine Bemerkungen über die Analyse sind eher abfällig - , ist wichtig, weil es, wie wir sehen werden, bei Joyce um etwas geht, das nicht analysierbar ist und dieses nicht Analysierbare gleichzeitig etwas entspricht, das Lacan bezüglich des Endes der Analyse interessiert. Es würde also etwas nicht Analytisches in der Analyse geben, etwas also, das sich jenseits der Analysierbarkeit der Bildungen des Unbewussten ansiedelt.^
Lacans Überlegungen beruhen auf Ausdrücken, die sehr früh in seiner Arbeit auftreten, im Laufe der Zeit allerdings etwas ihre Bedeutung ändern. Wesenthch ist die Triade R, S, I . S ist das Symbolische, die Sprache als Ort des Anderen, die Lacan jetzt als Parasit und aufgezwungene Rede definiert. I ist das Imaginäre, das Illusorische körperlicher Ganzheit, ein altes Thema Lacans seit seinem Aufsatz über das Spiegelstadium. R meint nicht irgendeine zur Bezeichnung schon bereit stehende Realität, sondern das Unmögliche, letztlich die »Unmöglichkeit des sexuellen Verhältnisses«. Ich füge noch hinzu, dass diese drei Terme dann auch in Paaren funktionieren: S und I gemeinsam (ihre Überschneidung oder, mengentheoretisch ausgedrückt, ihr »Durchschnitt«) charakterisiert z.B. den Sinn, in der jetzigen Sichtweise eine mittels der Sprache hergestellte Kohärenz, die insofern als illusorisch (d.h. imaginär) angesehen wird, als sie ihre eigenen
1 Jacques-Alain Miller, »Pieces detachees«, I - I I , in: La Cause freudienne, 60 (2005), S. 153-172; III-V, in: La Cause freudienne, 61 (2005), S. 131-153; VI, in: La Cause freudienne, 62 (2006), S. 75-83; VII-VIII, in : La Cause freudienne, 63 (2006), S. 119-145; und Genevieve Morel, La loi de la mere, Paris 2008. 2 Vgl. das Kapitel I I I . l über die »nicht-analytische« Funktion der Telepathie bei Freud.
55

Gegenstände erzeugt und dem Realen als Unmöglichem nicht Rechnung trägt.
Lacan behandelt das alles jetzt mittels der Knotentheorie - R, S und I werden durch wnds de ficelle dargestellt, Schnurringe, die miteinander verkettet sind oder nicht. Nachdem er zum ersten Mal im Seminar ... ou pire' auftaucht, hat sich Lacan in Encore näher für den sogenannten borromäischen Knoten interessiert, Siegel der Fa-mihe Borromini, das den Zusammenhalt der drei Famihenbranchen symbolisieren sollte. Es handelt sich dabei um eine Kette aus drei Ringen, die zusammenhäh, ohne dass zwei Ringe untereinander verkettet wären. Man könnte sagen: eine Art Zusammenhalten zwischen einander fremden oder nicht miteinander verklebten Elementen. Diese Sicht wird in Le sinthome wieder aufgenommen und modifiziert.
Der borromäische Knoten und Lacans Interpretation, auf die ich hier nur teilweise eingehen werde, sieht so aus:
Borromäischer Knoten RSI (vgl. XXIII, 55)
Sagen wir: mit diesen drei Termen hat jeder notwendigerweise zu tun - wir sind {oder: haben) Körper (I), die sprechen (S), und es gibt Unmögliches, d.h. etwas an der Rechnung, das nicht aufgeht (R). Das Bild des borromäischen Knotens darf uns nicht übersehen lassen, dass die Grundtatsache, von der dieses Seminar ausgeht, darin
3 Jacques Lacan, Le seminaire XIX :... ou pire, unveröffentlicht, Sitzung vom 9.2.1972.
56
besteht, dass die drei Ringe ursprünglich nichts miteinander zu tun haben.
Ursprünghche Zusammenhanglosigkeit der drei Ringe
Die Verknüpfung ist anzustreben, aber es gibt verschiedene Arten, sie zu erreichen, und dieses Vielfache der Möglichkeiten ist das eigentliche Thema des Seminars. Man kann natürlich rückblickend sagen, dass es immer schon darum gegangen ist bei Lacan - die Theorie der Vatermetapher und der dazugehörigen Bedeutung des Phallus sollte ja zeigen, wie sich das Verhältnis von Imaginärem und Symbolischen normalerweise regelt und was passiert, wenn es nicht so ist. Obwohl sich in den letzten Seminaren auch sehr »konservative« Bemerkungen finden,* geht es insgesamt darauf hinaus, die alte Normalität jetzt als einen Sonderfall darzustellen, für den es Alternativen gibt.
4 So zum Beispiel wenn Lacan von einem »Niedergang des Namens-des-Vaters« spricht, der dazu führt, dass man (wohl im Sinn von Bürokratie) »zu etwas ernannt« wird, und diesen Niedergang als »Zeichen einer katastrophalen Degeneration« qualifiziert (Jacques Lacan, Le seminaire XXI: Les non-dupes errent, unveröffentlicht, Sitzung vom 19.3.1974).
57

Was Lacan in seinem Seminar sagt, setzt gewisse Wandlungen der Theorie voraus. Das Symptom, haben wir gesehen, war zunächst eine restlos entzifferbare Botschaft. Später wird darüber hinaus - im Sinn von Freuds »sekundärem Krankheitsgewinn« - betont, dass das Subjekt an seinem Symptom hängt, was heißt, dass das Symptom Genießen enthält. Im Seminar R.S.I. sagt Lacan: »Das Symptom kann man nicht anders definieren als durch die Art, wie jeder im Genuss seines Unbewussten steht insofern es ihn bestimmt.« (Le Symptome n'est pas definissable autrement qae par la faQon dont chacun jouit de son inconscient en tant que l'inconscient le determine.]^ Lacan spricht in diesem Sinn in Television von jouis-sens, d.h. von einem Zusammentreffen von Sinn und Genießen^ und gelangt dadurch zu einem »Theorem der allgemeinen Äquivalenz zwischen Genießen und Signifikant«,' d.h. zur Idee einer Art hermeneutischen Genusses durch allgemeines Chiffrieren.
In Le sinthome wird dann eigentlich bis zu einem gewissen Grad die ganze frühere Signifikantentheorie zerstört, zumindest relativiert. Denn das sinthome ist im Gegensatz zum früheren Symptom wesentlich sinnlos, es verbirgt keine entzifferbare Botschaft. Zu dieser Hinwegbewegung vom Sinn gehört auch, dass Lacan die Knoten der Schrift und dem Buchstaben zuordnet (XXIII, 144),* die er von der früheren Auffassung des Signifikanten unterscheidet. Schrift und das sinthome als Element von Schrift haben keine verborgene Bedeutung, kommunizieren nichts. Vorausgreifend sage ich, dass dieses Fehlen eines verborgenen Sinns auch für Joyces Spätwerk gilt, und dass Lacan sich eben deshalb damit beschäftigt.
5 Jacques Lacan, Le seminaire XXII: R.S.L, unveröffentlicht, Sitzung vom 18.2.1975. - Sehr erhellend ist hier Genevieve Morels Kommentar von Freuds Fall Dora. Sie betont, dass Dora nicht nur mit dem zweideutigen väterlichen Signifikanten »unvermögend« (gleichzeitig: »kein Geld« und »impotent«) umgeht (der Vater kann umso besser lieben als ihm etwas fehlt), sondern das Unvermögen durch ihren nervösen Husten in etwas verwandelt, worin der Signifikant sich wiederholt und gleichzeitig mit dem Körper, d.h. mit Genießen verbunden ist (Morel, La loi de la mere, a.a.O., S. 74). 6 Jacques Lacan, »Television«, in: Autres ecrits, Paris 2001, S. 509-564, hier: S. 517 / Radiophonie/ Television, übers, v. Hans-Joachim Metzger, Jutta Prasse u. Hinrich Lühmann, Weinheim / Berlin 1988, S. 55-89, hier: S. 68. 7 Miller, »Pieces detachees VII«, a.a.O., S. 128. 8 Vgl. Miller, »Pieces detachees VI«, a.a.O., S. 78ff.
58
Die Frage ist, wie man jetzt mit dem Symptom umgeht. Während früher die deutenden Anspielungen des Analytikers den verborgenen Sinn freilegen sollten, wäre das Ziel jetzt eher, dasjenige herauszukri-staUisieren, was außerhalb des Sinns liegt - das Reale. Im Gegensatz zu Freuds Vorgehensweise, geht es nicht darum, etwas zu konstruieren, das erlauben soll, das Reale im Symbolischen zu resorbieren,' sondern darum, die »symbolische Ordnung« als letztlich illusorisches Oberflächenphänomen darzustellen, jenseits dessen eine neue Umgangsweise mit dem Realen gesucht werden soll.
Ein anderer neuer Aspekt besteht darin, dass es durch den Bezug auf die Knotentheorie zu einem Übergang vom Mangel zum Loch kommt, das sich in den Ringen verkörpert. Was heißt das? Die ganze frühere Theorie beruht auf der Annahme der Notwendigkeit, in das Symbolische einen leeren Platz, eben einen Mangel, einzuführen. Während die imaginären Identifizierungen sich durch ihre Trägheit auszeichnen, gelangt das Subjekt durch die Anerkennung der Kastration dazu, einen Platz freizulegen, der es »ist« und der es ihm erlaubt, jeweils dasjenige zu »werden«, was die signifikanten Artikulationen an Neuem bringen. Das Subjekt ist ein Mangelwesen, und aufgrund dieses Mangels begehrt es immer anderes. Bereits auf dieser Stufe der Entwicklung der Theorie interessiert sich Lacan für Ringe. Es geht um zwei ineinander verkettete Tori als Repräsentation der für die Neurose charakteristischen Vorstellung, jeweils dasjenige auszufüllen, was dem anderen fehlt: Verkennung des Mangels als Pathologie der InterSubjektivität.
Das Loch ist nicht etwas ganz anderes, führt aber doch eine Änderung ein.'" Es ist für Lacan dasjenige, was es erlaubt, einen Ring mit einem anderen zu verknoten, d.h. etwas, wodurch man eine Schnur durchgehen lassen kann. Wie schon bei den Überlegungen über die
9 Vgl. Morel, La loi de la mere, a.a.O., S. 76. 10 Morel, La loi de la mere, a.a.O., S. 70f. - Man findet beim früheren Lacan bereits den Ausdruck »reales Loch«. Er bezeichnet dort die dem Begriff »Privation« zugeordnete Konstellation, innerhalb welcher eine als allmächtig vorgestellte reale Mutter imstande ist, das zur symbolischen Gabe gewordene, ursprünglich imaginäre Objekt zu verweigern. Im Gegensatz zu seiner Funktion in der Knotentheorie handelt es sich jedoch bei diesen frühen Überlegungen über das reale Loch für Lacan lediglich um ein archaisches Stadium, welches durch die mittels des Kastrationskomplexes eingeführte symboUsche Ordnung aufgehoben wird (Lacan, La relation d'objet, a.a.O., S. 68ff. / Die Objektbeziehung, a.a.O., S. 75ff.).
59

Funktion des Mangels wird jetzt weiterhin das Symbolische mit dem Loch des Rings gleichgesetzt, aber es geht weniger um das »schlechte« Ausfüllen des Mangels als um die »gute« Möglichkeit des Verkettens. Die These ist jetzt, dass die Sprache »ein Loch ins Reale macht«. (XXIll, 31) Lacan bringt das mit seiner (dem Sinn nach ahen) Formel in Zusammenhang, dass es keine sexuelle Beziehung gibt.̂ ^ R, S und I haben bei dem verirrten, instinktarmen Menschenwesen ursprünglich nichts miteinander zu tun, und die Frage ist, wie man sie verknüpfen kann. Dazu braucht es das Loch. Würde man sie nicht verknüpfen, gäbe es jeweüs voneinander unabhängige Terme - das Sprechen und der Körper hätten nichts miteinander zu tun. Insofern das Loch dem Realen als Unmöglichem entspricht, kann man sagen, dass es jenseits des Rings des Realen auch in den beiden anderen Ringen als jeweils unabhängigen und gleichzeitig verknüpfbaren Elementen zur Wirkung kommt. Bezüglich der Weise, wie es zur Verknüpfung kommt, gibt es aber keine allgemeine Antwort - selbst wenn die Möglichkeiten begrenzt sind.
Was interessiert Lacan bei Joyce? Ganz grob gesagt dreierlei. Erstens gibt es einige Hinweise darauf, dass Joyce hinsichtlich dessen, was man als kUnische Struktur bezeichnet, psychotisch gewesen sein könnte oder zumindest mit irgendetwas in diese Richtung Gehendem behaftet war. Richtig oder nicht, ist das Voraussetzung dessen, worum es bei Lacan geht. Zweitens ist diese angenommene Psychose niemals zu dem gelangt, was man als Auslösung bezeichnet. Sie wäre latent gebheben, während Joyces Tochter Lucia manifest schizophren war.'^ Drittens gibt es in Joyces Werk so etwas wie eine zunehmende sprachliche Radikalisierung, die in seinem letzten Werk, dem berühmte Finnegans Wake, gipfelt - ein Werk, in dem, meint Lacan, eine bestimmte Grenze innerhalb der Literatur überschritten wird. Das Wesentliche an diesen drei Punkten ist die Annahme, dass das Ausbleiben der Auslösung irgendwie mit der Eigenart des Werks und der Rolle, die es in Joyces Leben spielt, zusammenhängen muss.
11 Jacques Lacan, »Preface ä L'Eveil du printemps«, in: Autres ecrits, S. 561-664, hier: S. 562. 12 Jung, der erfolglos versuchte, Lucia zu behandeln, betonte das tiefe Verständnis zwischen Joyce und seiner Tochter, die seine femme inspiratrice gewesen sei (Deirdre Bair, C. G. Jung. Eine Biographie, München 2007, S. 577; und Carol Shloss, Lucia Joyce: To Dance in the Wafce, New York 2005, S. 277-299).
60
Bezüglich dieses Ausbleibens der Auslösung der Psychose geht Lacan von der Annahme aus, dass Joyce sich durch sein Werk einen Namen gemacht hat, und zwar dort, wo sein Vater ihm nichts übermitteln konnte. In seiner etwas kruden Ausdrucksweise sagt Lacan über Joyce: il avait la queue un peu lache (XXIII, 15), was wörtlich heißt, dass er ein Schlappschwanz war, genauer: dass die Funktion des Phallus bei ihm unzureichend ausgebildet gewesen ist - nicht im Sinn von Impotenz, sondern im Sinn eines Ausbleibens der Übertragung des männhchen Symbols von Vater zu Sohn. Deshalb die Panik jedes Mal, wenn Joyces Frau schwanger ist und er mit dieser symbolischen Funktion konfrontiert wird (XXIII, 84). Das ist eigentlich die »klassische« Lacansche Theorie der Psychose: Verwerfung des Namens-des-Vaters und als Folge davon Lücke auf der Ebene der phallischen Bedeutung, selbst wenn es Lacan in diesem Seminar nicht so ausdrückt. Durch den Phallus soU sich das Wort mit dem Fleisch verbinden, soll das Fleisch am Symbolischen »angebunden« werden und dadurch, wie sich Lacan früher ausgedrückt hätte, den »Gesetzen des Symbolischen« folgen können. Obwohl da etwas nicht funktioniert hat, hat sich Joyce, das ist der zweite Punkt, durch sein Werk ganz alleine einen Namen gemacht, was Lacan mit dem Ausdruck ego in Zusammenhang bringt. »Seine Kunst hat der phallischen Haltung Abhilfe verschafft (oder sie ersetzt: son art a supplee a sa tennephallique)<( (XXIII, 15). Joyce wolle the artist sein, der Künstler schlechthin, der einzige und singuläre (XXIII, 17). Wichtig ist, dass Lacan sagt, dass es kein »Privileg« ist verrückt zu sein. Selbst wenn bei Joyce etwas radikal Eigenartiges vorliegt, ist das Verhältnis zwischen R, S und I bei der »Mehrzahl« der Menschen irgendwie unklar, man könnte sagen: schlampig. Das eine geht ins andere über, die Trennung ist nicht scharf, wie es beim »idealen« borromäischen Knoten der Fall sein sollte (XXIII, 87). Man gelangt also letztlich eher zur Annahme einer Art von allgemeinem oder zumindest weit verbreitetem »Grundfehler«, auf den jeder auf seine Art reagiert, wobei Joyces Art besonders lehrreich ist. Interessant ist, dass Lacan hier wie schon in seinen Jugendschriften, in denen er über den »Sinn« der Familie spricht, von einem Ideal ausgeht, das nicht erfüllt wird.
Die dritte Eigenart bei Joyce, die Lacan interessiert, ist die Sprachstruktur des Werks, speziell von Finnegans Wake. Es geht also nicht
13 Vgl. Kapitel 1.2
61

nur darum, dass sich Joyce einen Namen gemacht (was nicht weiter außergewöhnhch ist), sondern vor allem darum, womit er sich seinen Namen gemacht hat. Lacan sagt hier zwei Sachen, die zusammengehören. Er meint, dass aus dem Fall Joyce ersichtlich wird, dass das »Symptom das Symbol abschafft«; und weiter sagt er, dass Joyce nicht aufs Unbewusste »abonniert« war, was heißt, dass sein Werk nicht nach dem Schema des Unbewussten analysierbar ist''' - eine These, die übrigens schon früher CG. Jung aufgestellt hatte.'' Das Studium von Joyce dient Lacan eigentüch dazu, etwas fortzusetzen, das sich in seinem Seminar schon zuvor ankündigt. Bereits in R.S.I. hatte Lacan gesagt, dass das Symptom dem Realen angehört, welches das »aus dem Sinn Ausgetriebene« ist."'
Was heißt das? Es gibt einerseits die Struktur des »alten« Symptoms. Man hat ein manifestes Phänomen, das unsinnig erscheint, und dann gibt es ein Verfahren, das es erlaubt, das Manifeste zu entschlüsseln und zum verborgenen Sinn einer Botschaft vorzudringen. Solange die Botschaft nicht entschlüsselt ist, bleibt sie fremdartig, sie »spaltet« das Subjekt. Aber sie lässt sich entschlüsseln. Die »Bildungen des Unbewussten« und folglich auch das »klassische« neurotische Symptom würden auf dieser Struktur beruhen. Die Fehlleistung will etwas »ausdrücken«, sagt Lacan, und zwar nicht nur das, was das Subjekt weiß, was bewirkt, dass es ein Unbewusstes und gleichzeitig ein gespaltenes Subjekt gibt (XXIII, 148). Das Symptom »will etwas sagen«: die Hand, haben wir gesehen, ist hysterisch gelähmt, weil das Subjekt, ohne es sich einzugestehen, etwas Furchtbares tun wil l . Durch Analyse gelangt das Subjekt dazu, den unbewussten Sinn anzuerkennen, und dadurch verschwindet auch das Symptom.
Die Möglichkeit solcher Entschlüsselungen beruht letztlich auf der Redundanz der Sprache. Jemand sagt: »Das ist ja großartig«, und der Kontext erlaubt zu erkennen, dass es ironisch gemeint war, d.h. dass es das Gegenteil dessen, was gesagt wurde, bedeutet - »das ist wirk-
14 Lacan, »Joyce le Symptome«, in: ders., Le sinthome, a.a.O., S. 161- 169, hier S. 164. - Es handelt sich um einen am 16.6.1975 am V. Internationalen James Joyce Symposium gehaltenen Vortrag, dessen Transkription in die hier zitierte Ausgabe des Seminars Le sinthome als Anhang aufgenommen wurde. 15 Jung über Ulysses: »jeder Satz ist eine Pointe«, »es ist kein Traum und keine Offenbarung des Unbewussten« (Carl Gustav Jung, »Ulysses«, in: Wirklichkeit der Seele, Zürich 1934, S. 132-169, hier: S. 136 u. 156). 16 Lacan, R.S.I., Sitzungen vom 19.1. und 11.3.1975.
62
lieh nicht großartig«. Sagen wir, dass das auch für die »Bildungen des Unbewussten« gilt - Traum, Witz, Fehlleistung, klassisches Symptom. Formaler ausgedrückt: Es gibt z.B. eine Zahlenreihe, in der ein Element zensuriert wurde, das jetzt fehlt: 2, 4, X, 8, 10. Man kann aufgrund der Länge der Reihe zumindest vermuten, dass an der Stelle des X die 6 fehlt (vgl. die Struktur der Metonymie), oder, wo das der Fall ist, dass sie im Sinn der Metapher durch ein anderes Element ersetzt worden ist: 2, 4, 97, 8, 10. Das Eigenartige von Joyces Spätwerk besteht nun darin, dass er so viele Witze und Wortspiele macht, die noch dazu zwischen mehreren Sprachen spielen, dass man dahinter nichts mehr Präzises, keine verborgene Botschaft bestimmen kann.''' Alles verweist auf etwas, aber wir wissen nicht mehr genau worauf. Und insofern das klassische Unbewusste als entschlüsselbar aufge-fasst wird, kann Lacan eben sagen, dass Joyce nicht aufs Unbewusste »abonniert« war, dass er es abbestellt hat, und deshalb auch unser (neurotisches) Unbewusstes beim Lesen von Joyces Texten nicht in Bewegung versetzt wird - Abschaffung des Symbols. Das sind keine richtigen Freudschen Witze mehr, und Lacan meint, dass der einzige, der da etwas genossen hat, Joyce selbst war. Das Ungewöhnhche am Text wäre, dass er auf der Seite des Genießens angesiedelt ist,'* zu unterscheiden von der Lust des Lustprinzips. Der Sinn »im üblichen Sinn« geht verloren. Durch die Einzigartigkeit seines Vorgehens und die zunächst gar nicht plausible Publikation seines Texts hätte sich Joyce einen Namen gemacht und dadurch der symbolischen Entwurzelung abgeholfen."
Sagen wir vorläufig: Das Genießen ist das Regellose. Es ist das, was keinem Gesetz gehorcht. Entsprechend Lacans klassischer Sichtweise ist es möglich, dieses Regellose zu resorbieren, um es in das geordnete Funktionieren des Symbolischen einzugliedern, wie ein Löschblatt Flüssigkeit aufsaugt: Konzentration des Genießens durch den Signifikanten Phallus. Nach der späteren Konzeption Lacans geht diese Resorption mit einem Rest einher, dem Objekt a, das genau umschrie-
17 Diese Vervielfachung, schreibt Ezra Pound, gilt schon für das frühere Werk: »Where Cervantes satirized one manner of folly and one sort of highfaultin' ex-pression, Joyce satirizes at least seventy, and includes a whole history of Eng-lish prose, by implication.« (Ezra Pound, »Ulysses«, in: ders., Literary Essays of Ezra Pound, London 1954, S. 403-409, hier: S. 403). 18 Lacan, »Joyce le Symptome«, a.a.O., S. 167. 19 Vgl. ebd., S. 165.
63

ben bleibt und innerhalb des Diskurses funktioniert. Die sogenannte Normalität würde darauf beruhen, dass das Genießen dem Gesetz unterworfen wird. Es wird lokalisiert in Inseln oder in Oasen (»ero-genen Zonen«) innerhalb eines Körpers, der außerhalb dieser kleinen Zonen »Wüste« von Genießen ist. Sowohl die Sprache als auch der Körper gehorchen Regeln, in welche sich das Genießen im besten Fall nicht einmischt. Das Spätwerk von Joyce ist aber ein Sprachgebilde, in dem eine gewisse Regellosigkeit bewahrt, sogar gesucht wird. Und gleichzeitig wird Joyce dadurch berühmt, er verschafft sich eine soziale Stellung. Er kann sich mit seinem Werk identifizieren, und das würde, meint Lacan, einer neuartigen Verknotung entsprechen.
Die Sache ist aber komplizierter. Vom Werk auf den Autor zurückgehend, interessiert sich Lacan dafür, was die Sprache für Joyce gewesen ist, und was eine »normale« Sprache wäre. Und dafür, was sein Körper für Joyce gewesen ist, und was ein »normaler« Körper wäre. Wobei man das Wort normal aber unter Anführungszeichen stellen muss, weil das Normale jetzt eher ein Sonderfall, sogar etwas Trügerisches wäre, worauf aber die ganze konventionelle Psychoanalyse beruht, die Lacan [zu Recht oder zu Unrecht) mit Freud in Zusammenhang bringt.
Zur Sprache. Hier muss man aufs Französische zurückkommen, wo Sprache le langage oder la langue heißt. Lacan prägt hier einen Neologismus: lalangue und sagt schon in Encore:^° »Die Sprache ist ein Wissenselaborat [elucubration de savoir] über lalangue.« Lalangue wird definiert als »Gesamtheit der Zweideutigkeiten [integrale des eqnivoques)«}^ was heißt, dass es bei Sprache zunächst weniger um Kommunikation als um Genießen als etwas Ungeregeltem geht. Gemeint ist damit, dass dasjenige, was die Linguistik an Ordnung bezüglich Sprache festzumachen versucht und worin Lacan im Großen und Ganzen lange Zeit größtes Vertrauen gesetzt hat, bereits einer Ideahsierung e n t s p r i c h t . I n Wirkhchkeit haben wir es ursprünglich mit einer Art mehr oder weniger formloser Sprachsuppe namens lalangue zu tun, die von Zweideutigkeiten wimmelt.
20 Lacan, Encore, a.a.O., S. 127 / Encore, a.a.O., S. 151 (Übersetzung modifiziert). 21 Jacques Lacan, »L'etourdit«, in: Autres ecnts, S. 449-497, hier: S. 490. 22 Man könnte sagen: das Maß an Redundanz, welches die Entzifferbarkeit der unbewussten rhetorischen Figuren erlaubt, besteht ursprünglich nicht.
64
Alles, was man klassischerweise als Unbewusstes und als Symptom bezeichnet, beruht also schon auf einer Idealisierung - was nicht unbedingt heißt, dass es nicht irgendetwas tatsächhch Bestehendem und Funktionierendem entspricht. Man kann sogar sagen, dass die »gewöhnliche« analytische Arbeit auf dieser Eingrenzung der Sprache beruht. Aber die These lautet jetzt, dass die Idee, dass es ein Sagen-Wollen, einen entzifferbaren Sinn gebe, letztHch doch als Illusion anzusehen ist. Man könnte auch sagen, dass dieser Sinn nur innerhalb eines Rahmens gilt, der in Frage gestellt werden kann. Deshalb ordnet Lacan den Sinn als Illusion einer Überschneidung zwischen Symbolischem und Imaginärem zu (XXIII, 56) - Sinn als Sprachträumerei ohne stabile Grundlage. Es gibt zunächst ein wildes sprachartiges Gebilde, und die Erzeugung von Sinn beruht auf einer zusätzlichen Operation, einer Art niemals erreichbaren Zähmung der ursprünglichen unbezähmten Sprache, die uns durch ihre Fremdheit und Ungeordnetheit zunächst ganz körperlich affiziert.
Lacan macht einen weiteren Schritt, indem er die unordentliche Sprachsuppe der Frau und der Mutter zuordnet (XXIII, 118).^' Selbst wenn in der biblischen Erzählung Adam der erste ist, der den Tieren Namen verleiht, so hat er das nur in der Muttersprache, in der Sprache »Evies« (»Eyie« enthält vie, was auf Französisch »Leben« heißt) tun können, die gleich nach der Benennung der Tiere mit der Schlange und somit mit der Sünde in Verbindung steht (XXIII, 13). Das widerspricht der Vorstellung, wonach von einem quasi göttlichen Symbolischen ausgehend das Reale ex nihilo erschaffen werden würde.Tatsächlich hat Lacan lange Zeit die Psychoanalyse als »kreationistisches« Denken aufgefasst, für welches das Nichts den Ursprung jeglicher Schöpfung darstellt^' - ein väterlicher Gott formt das Reale entsprechend den Gesetzen des Symbolischen. Nach der jetzigen Auffassung ist dagegen die ursprüngliche Sprache, lalangue,
23 Vgl. bereits Lacan, Encore, a.a.O., S. 126 / Encore, a.a.O., S. 150. 24 In »Joyce le Symptome« heißt es dagegen: »Der Vater als Name und der Vater als jener, der benennt, ist nicht das gleiche.« (a.a.O., S. 167). 25 Vgl. Jacques Lacan, »Remarque sur le rapport de Daniel Lagache: >Psycha-nalyse et structure de la personalite<«, in: Ecrits, S. 647-684, hier: S. 667. Auch noch in Encore [a.a.O., S. 41 / Encore, a.a.O., S. 46) spricht Lacan von einer »Schöpfung ausgehend von nichts, und also aus dem Signifikanten«, wobei der Signifikant jetzt allerdings nicht mehr der symbolischen Ordnung, sondern dem Kontingenten zugeordnet wird.
65

die Sprache der Mutter. Eine dunkle zweideutige Sprache, deren Rätselhaftigkeit traumatisch wirkt.
Die Mutter war immer schon für Lacan ein furchtbares krokodilartiges Ungeheuer, und das bleibt so bis zum Schluss.^' Aber dieses Furchtbare steht jetzt durch den neuen Benennungsmythus nicht nur ganz allein am Anfang, sondern Lacan glaubt auch nicht mehr ganz oder nicht mehr ausschließlich an die schöne Möglichkeit, das Ungeheuer durch den Vater zu zivilisieren. Es gibt andere, jeweils singuläre Möglichkeiten, die aber alle der sekundären Verknotung mittels des sinthomes entsprechen, welches den Urzustand bezähmen soll. Alles beginnt mit etwas Fehlerhaftem, das korrigiert werden muss. Das sinthome wird notwendig gemacht durch die Sünde (Wortspiel Lacans über das englische Wort sin: sin-thome). Die ganze Auffassung läuft darauf hinaus, dass die Sprache der Mutter nicht als solche fortbestehen kann, ohne das Subjekt verrückt zu machen. Bei Joyce hat sich lalangue eigentlich nie in langage verwandelt, und daher gibt es auch kein Unbewusstes. Aber trotz des Hängenbleibens an der traumatisierenden Ursprache, hat Joyce eine neue Art gefunden, mit dem Sprachparasiten umzugehen, ohne verrückt zu werden.
Das »normale« Unbewusste hat mit einem »normalen« Körper zu tun. Der klassische Körper ist anscheinend zumindest das, was man »ist« - das narzisstisch besetzte Spiegelbild, das man anbetet und welches dialektisch im Symbolischen aufgehoben, d.h. abgeschafft wird und gleichzeitig erhalten bleibt. Das Sein (»Narzissmus«) und das Nichtsein (»Kastration«: Nichtsein des Objekts des Begehrens des Anderen) gehören in der Neurose zusammen. Jetzt aber sagt Lacan, dass der Körper für jeden zunächst einmal das ist, was man hat, eigentlich ein Fremdkörper. Und diese normalerweise verborgene Situation wird am Fall Joyce indirekt deutlich, gerade weil sich bei ihm das hinter der Illusion des »Seins« bestehende »Haben« nicht herge-stelh hat.
Lacan beruft sich hier auf eine Stelle aus dem autobiographischen Text A Portrait of the Artist as a Young Man, an der es um einen l i terarischen Streit zwischen Schulkameraden geht, der damit endet, dass der Held Stephen verprügelt wird. Nach dieser Szene fragt sich
26 Vgl. Morel, La loi de la mere, a.a.O., S. 88f. 27 »Ein großes Krokodil, in dessen Maul Sie sind - genau das ist sie, die Mutter.« (Lacan, L'envers de lapsychanalyse, a.a.O., S. 129].
66
Stephen, »warum er seinen Peinigern gegenüber keinen Groll empfände«. Und Joyce schreibt dann, »dass irgendeine Macht jenen jähgewirkten Zorn so mühelos von ihm ablöste wie eine weiche reife Schale von einer Frucht«.^* Lacan meint, dass die Mühelosigkeit dieser Ablösung auf einem »Fehler« [faute, was auch moralischen Fehltritt und Schuld bedeutet; XXIII, 148f.) beruht; einem Fehler in der Struktur, der aber eigentlich etwas normalerweise Verborgenes zutage treten lässt - die grundsätzMche Fremdheit des Körpers. Zunächst verflüchtigt sich alles, und dann »metaphorisiert« Joyce das Geschehene in seinem autobiographischen Text. Joyce lebt nicht in der I l lusion, sein Körper zu »sein«, »hat« aber seinen Körper auch nicht (verkannte Grundlage des »Normalfalls«), und verspürt deshalb auch keinen Affekt im Augenblick des Verprügeins, höchstens Ekel oder Abscheu [degoüt]. Er kann seinen Körper »liegenlassen« - Lacan verwendet hier einen Ausdruck aus Schrebers Denkwürdigkeiten?'^
In der Sprache der Knotentheorie formuliert (XXIII, 151), heißt das, dass die drei Ringe aufgrund eines einzigen Fehlers (der Ring S sollte an der angezeigten Stelle (Pfeil) unter und nicht über dem Ring R verlaufen) nicht zu einer borromäischen Struktur gelangen. Daraus ergibt sich einerseits, dass S (von Lacan hier mit dem Unbewussten gleichgesetzt (XXIII, 154)) und R direkt miteinander verkettet sind, was nicht sein sollte: Einbruch der Regellosigkeit des Realen ins Symbolische, was, wie man sehen wird, die befremdende Sinnlosigkeit der sogenannten Epiphanien charakterisiert. Andererseits sieht man, dass I , das eigene Körperbild, frei gleitet und sich »jederzeit aus dem Staub machen [foutre le camp]« kann. Das von Schreber dramatisch erlebte »Liegenlassen«, das auf demselben freien Gleiten beruhen würde, erscheint bei Joyce eigentlich fast wie eine ungewöhnliche Fähigkeit, seinem eigenen Körper gegenüber Gleichgültigkeit zu empfinden.
28 James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, London 1982, S. 77 (»[...] as easily as a fruit is divested of its soft ripe peel«), / Ein Porträt des Künstlers als junger Mann, in: Stephen der Held und Ein Porträt des Künstlers als junger Mann, übers, v. Klaus Reichert, Frankfurt a.M. 1987, S. 338. - In der früheren deutschen Übersetzung {Jugendbildnis des Dichters, Frankfurt a.M. 1960, S. 65) fehlt der entsprechende Satz ganz einfach. 29 Daniel Paul Schreber, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, Leipzig 1903, S. 129.
67

Verfehlter Knoten bei Joyce als Ausgangssituation (XXIII, S. 151)
Das ego, dessen normale Erfahrungsweise Lacan mit dem Gewicht oder der Wichtigkeit (poids) des Körpers in Zusammenhang bringt, funktioniert nicht im Augenblick des Verprügeins. Es funktioniert gleich nachher, aber anders als normalerweise, und zwar durch eine »Korrektur« des Knotens, dessen Möglichkeit sich dadurch ankündigt, dass Joyce denen, die ihn verprügelt haben, keinerlei Anerkennung zollt. Längerfristig hängt aber das neue ego damit zusammen, dass Joyce eine buchstäblich unerhörte Schreibweise erfindet, durch die er sich einen Namen macht.
Unerhört ist an Joyces Schreiben, dass es als nicht regelmäßig entzifferbar mit dem Realen des Genießens zu tun hat. Der phaUische Apparat, der regehoses Genießen in das SymboMsche integriert und dadurch jenseits aller besonderen Bedeutungen eine Art »Grundbedeutung« fixiert (»ich bin nicht, was dem anderen fehlt«, »ich bin ein leerer Platz«), funktioniert nicht, und stattdessen wird mit dem Genießen anders umgegangen. Das Versagen der Herstellung der phallischen Bedeutung bewirkt, dass Joyce zunächst und dann vielleicht auch sein ganzes Leben lang in quasi psychotischer Weise mit »aufgezwungenen Worten« (XXIII, 95) zu tun gehabt hat. In Bezug auf den Umgang mit dieser letztüch traumatischen Erfahrung der Al-terität von Sprache, die sein ursprüngliches Symptom darstellt, hat Joyce jedoch einen neuen Weg gefunden. Er hat ein neues Symptom, eben sein sinthome, kreiert. Und dabei kommt er ohne den Phallus aus.
68
Bezüglich der Auswirkungen dieses Symptoms erwägt Lacan interessanterweise zwei Möglichkeiten. Er sagt, dass man eigentlich nicht entscheiden kann, ob nach Herstellung des sinthomes dieses Aufgezwungene gemildert ist, oder ob sich Joyce im Gegenteil umso mehr diesem befremdenden Sprachgenießen hingibt (XXIII, 97). Wesentlich ist auf jeden Fall, dass dieses ursprünghche Genießen jetzt eine Funktion im Knoten ausübt. Während der klassische Neurotiker als leeres Subjekt der negativierte Phallus, d.h. »nichts« ist und seinen Körper hat, ist Joyce das sinthome als durch einen Knoten verankertes reales, nicht an eine bestimmte Bedeutung geknüpftes Genießen, das sekundär verknüpft wird und dadurch auch irgendwie seinen Körper, den er niemals gehabt hat, anbindet.
Die Epiphanien, so wie sie Lacan interpretiert, entsprechen einem anderen Aspekt (XXIII, 154), eigenthch dem Ausgangspunkt der späteren Lösung. Es sind Szenen, die der junge Joyce in ein Notizbuch einträgt und die Lacan einem anderen Aspekt des schon erwähnten »Knotenirrtums« zuordnet. Die ihnen zugrunde liegende Struktur wäre dadurch charakterisiert, dass das Unbewusste, hier von Lacan dem Symbolischen zugeordnet, »irrtümlich« unmittelbar an das Reale gebunden erscheint. Im borromäischen Knoten dagegen ist ja kein Ring direkt mit dem anderen verkettet. Gleichzeitig ist I , das Imaginäre, wie gesagt, bei Joyce ganz frei, ungebunden, weshalb der Körper als Fremdkörper erscheint.
Die Epiphanien sind sehr verschiedenartig, und ich beschränke mich hier darauf, jene zu zitieren, auf welche sich die Kommentatoren Lacans immer wieder beziehen, und die Joyce in Stephen Hero aufgenommen hat. Joyce schreibt in Stephen Hero, dass es die erste Epiphanie war, die er notiert hat.
»Die junge Dame - (diskret und schleifend im Ton) . . . O ja . . . ich war . . . in der . . . Kir . . . ehe . . .
Der junge Mann - (unhörbar) . . . Ich . . . (wieder unhörbar) . . . ich
Die junge Dame - (weich, leise) . . . O .. . Sie sind m i r . . . ein sehr . . . schlim .. . mer ...«^°
30 James Joyce, Stephen Hero, London 1982, S. 188 / Stephen der Held, in: Stephen der Held und Ein Porträt des Künstlers als junger Mann, a.a.O., S. 224.
69

Im darauf folgenden Paragraphen schreibt Joyce: »Unter einer Epiphanie verstand er eine jähe geistige Manifestation, entweder in der Vulgarität von Rede oder Geste, oder in einer denkwürdigen Phase des Geistes selbst. Er glaubte, dass es Aufgabe des Schriftstellers sei, diese Epiphanien mit äußerster Sorgfalt aufzuzeichnen, da sie selbst die zerbrechlichsten und flüchtigsten aller Momente seien.«
Durch die Bindestriche und Auslassungszeichen ahnt man da zwar etwas, letztlich etwas Wollüstiges, aber das Wesentliche wäre eher, dass man eigentlich nicht weiß, was dahinter steht. Joyce spricht in Stephen Hero kurz zuvor^' von der Unaufrichtigkeit und Stupidität der Frauen. Die Sache ist irgendwie »roh«, unverarbeitet - aber nicht im Sinn der Pornographie, die ja gerade darauf beruht, das Unaussprechliche auszusprechen (vgl. Joyces Briefe an seine Frau Nora, von denen manche eindeutig pornographisch sind). Es handelt sich auch nicht um die sekundäre poetische Umschrift von ekstatischen Erlebnissen, wie es manche Mysüker versucht haben.Joyce beschreibt in Stephen Hero gleich danach, um die Funktion der Epiphanie zu erläutern, wie Stephen eine Uhr anschaut, und wie er sie plötzlich »als solche« sieht und weiß, was sie ist.^^ Im Sinn Lacans ist die Epiphanie mit demjenigen in Verbindung zu bringen, was er als das Reale bezeichnet, das von Joyce sekundär sprachlich, d.h. im Symbolischen aufgezeichnet wird. Die Szenen bleiben rätselhaft, sie werden nicht metaphorisch verarbeitet, was heißt, dass der Sinn als Imaginäres, genauer: als Resultat der Überschneidung von Symbolischem und Imaginären, fehlt. Es handelt sich also wiederum um den Joyceschen »Grundfehler«: Paarung R-S mit frei schwebendem I . Lacan sagt hier über Joyce eigentlich etwas ähnliches wie Deleuze, der bezüglich Artaud von einem »Denken ohne Bild [pensee sans image)« und von einer »Abschaffung des Bildes« spricht.^* Das Gesamtwerk bis hin zu Finnegans Wake würde auf dieser Struktur beruhen, nur hat sich Joyce inzwischen sein ego geschaffen, welches die Bildung eines neuen Knotens und damit auch die Korrektur des ursprünglichen Fehlers erlaubt. Finnegans Wake ist für Lacan eine An-
31 Ebd., S. 187/S. 223. 32 Catherine Millot, »Epiphanies«, in: Jacques Aubert u. Jacques-Alain Miller (Hg.), Joyce avec Lacan, Paris 1987, S. 87-95, hier: S. 88f. 33 Joyce, Stephen Hero, a.a.O., S. 189 / Stephen der Held, a.a.O., S. 225. 34 Gilles Deleuze, Difference et repetition, Paris 1968, S. 192 / Differenz und Wiederholung, übers, v. Joseph Vogl, München 2007, S. 191f.
70
Sammlung bloßer private jokes, die durch das Fehlen des imaginären Faktors des Sinns wie schon die Epiphanien »unser« Unbewusstes nicht ansprechen, und gleichzeitig ist es eines der meistdiskutierten Bücher aller Zeiten. Das ist aber nur möglich durch eine eigenartige Verknüpfung von Privatem und Öffentlichem.
Damit kommt man zum durch das ego korrigierten Knoten. Ich erwähne kurz, dass die Überlegungen über Knoten in Lacans letzten Seminaren in ständiger Entwicklung begriffen sind. Zunächst gibt es das Ideal des borromäischen Knotens als perfekter Lösung. Die Idee ist, dass Freud für die Bildung eines Knotens ein viertes Element (Vater, psychische Realität, letztlich etwas Religiöses) gebraucht hat, während man mit drei hätte auskommen können. In Le sinthome heißt es dann (und das ist das Neue, wesentlich für das Verständnis dieses Seminars), dass R, S, und I ursprünglich völlig zusammenhanglos sind und man auf jeden Fall ein viertes Zusatzelement braucht, eben das sinthome, das entweder dem Vater entspricht oder etwas Neuem wie zum Beispiel bei Joyce. Man muss im Laufe einer Analyse auf jeden Fall etwas erfinden, ein Werk erzeugen, das allerdings keineswegs ein Kunstwerk sein muss.
Während entsprechend der »klassischen« Theorie Symptome vorhanden sind, weil der symbolische Vater unzureichend gewirkt hat und dadurch die Abdeckung des Realen durch das Symbolische nicht erreicht wurde, behauptet die letzte Theorie, dass es notwendigerweise eine symptomatische Antwort auf einen »Grundfehler« geben muss, und dass der Vater nur eines unter den möglichen Symptomen darstellt. Der Vater wäre die »klassische« Variante des Symptoms, was nicht unbedingt die Notwendigkeit, darüber hinaus ein sinthome auszubUden, ausschließt.
Weil er nicht dem klassischen Weg folgt, verwandelt sich bei Joyce lalangue nicht in langage. Die unmittelbare Verknüpfung des Symbolischen und des Realen (als »Fehler«) zeigt an, dass die ursprüngliche vieldeutige Sprache bestehen bleibt. Joyce ist das »reine Symptom dessen, was es mit dem Verhältnis zur Sprache auf sich hat«, »rein« insofern er ohne die Zwischeninstanz des Unbewussten auskommt und sein Werk deshalb nicht analysierbar ist im gängigen Sinn.^' Man könnte hier einwenden, dass Joyce doch im Alltag »normal« gesprochen habe. Lacan meint aber, dass Joyces Verständnis
35 Lacan, »Joyce le Symptome«, a.a.O., S. 166.
71

für die »telepathischen« Fähigkeiten seiner manifest psychotischen Tochter Lucia darauf hinweist, dass er auch im alhäglichen Leben Sprache immer als traumatischen Fremdkörper erfahren hat und sich aus demselben Grund seinen Körper nicht aneignen konnte. Sein Verhältnis zur Sprache und zum eigenen Körper wäre also das ursprüngliche »Symptom« gewesen, mit welchem er durch das von ihm geschaffene sinthome umzugehen vermochte. Denn im Gegensatz zu seiner verrückten Tochter hat Joyce durch das ego (die Anerkennung des Eigennamens als etwas allgemein Gültigem) eine neue Verknüpfung hergestellt, die bewirkt, dass er nicht wirklich verrückt ist, und dass der ursprünglich sinnlose und fallen gelassene Körper (»I«) sich nicht einfach aus dem Staub macht: Nicht die Überschneidung S-I als Voraussetzung des letztlich illusorischen Sinns des gängigen Körperlichen, sondern vom Unsinn S-R ausgehend eine symptomatische Lösung. Der vierte Ring entspricht der Korrektur durch das ego.
Joyce: Korrektur durchs ego (XXIII, 152)
Die Eigenart des Falles Joyce beruht also auf der Gleichzeitigkeit einer falschen Verknüpfung (R-S), eines Fehlens von Verknüpfung (frei schwebendes I) und einer späteren Korrektur - wobei die falsche Verknüpfung nach der Korrektur fortbesteht. Künstler zu sein, sagt Lacan durchaus in Einklang mit seiner »klassischen« Theorie, ist für Joyce Kompensation genau dafür, dass sein Vater niemals für ihn ein Vater gewesen ist (was heißt, dass sich die borromäische Verknüpfung S-I ursprünglich nicht ausbildet). Lacan meint, dass Joyce
72
seinen Eigennamen auf Kosten des Vaters aufgewertet hat (XXIII, 87ff.). Seine Kunst, exemplarisch Finnegans Wake, hat die Funktion eines nicht analysierbaren sinthomes, das den ursprünglichen symptomatischen Fehler (einerseits Sprachparasit, andererseits fallen gelassener Körper) ohne Rückgriff auf die klassische phaUisch-väter-liche Funktion zu korrigieren vermag. Dabei wird der Sprachparasit als »Fehler« nicht abgeschafft, sondern im Werk, welches eine neue Verknüpfung hersteht, wiederhoh. Es geht nicht mehr darum, das Symptom aufgrund seiner Analysierbarkeit zu beseitigen, sondern für das nicht analysierbare sinthome eine Funktion zu finden. Was lässt sich damit anfangen? Wozu könnte es dienen? Wie kann man dahin gelangen, dass es gut oder besser funktioniert?
Interessant ist, dass Lacan - wie ich schon erwähnt habe - sagt, dass verrückt zu sein kein Privileg ist. Der Fall Joyce zeigt, von einem spezifischen »Fehler« ausgehend, dass es Alternativen zum klassischen Modell gibt - Arten, angesichts einer Entknotung des Knotens Abhilfe zu schaffen. Die Grundsituation (oder der »normale«, nicht spezifisch Joycesche »Fehler«) besteht darin, dass es keine ursprünghche Verknüpfung zwischen R, S und I gibt. Und ein sinthome bewirkt dann, dass die Ringe - ohne zunächst miteinander in Verbindung gestanden zu sein - doch nicht auseinander fallen. Der Vater kann die Funktion des sinthomes ausüben, es ist aber nicht die einzige Möglichkeit.
Borromäisches sinthome [XXIII, 94)
73

Man könnte Lacans Art, Werk und Leben zu verknüpfen, problematisch finden. Aber man könnte auch sagen, dass die These, wonach das Werk nur dazu da ist, das Leben auszuhalten, der Kunst eine interessante politische Funktion verleiht. Wozu Kunst, wenn sie nicht das Leben verändert? Aber das ist nicht, was Lacan interessiert. Das in der Analyse zustande kommende Werk ist kein Kunstwerk, und es geht auch nicht darum, Lacan sagt es explizit, sich einen Namen zu verschaffen. Es geht darum, etwas mit demjenigen anzufangen, was sich diesseits der Joyceschen Lösung befindet, mit dem »Singulären«.^^ Letztlich ist es eine sehr therapeutische Sichtweise, die nicht einmal mehr den Durchgang durch die früher wesentliche Anerkennung der Wahrheit fordert, sondern eher einen Weg sucht, vom jeweilig einem Zustoßenden ausgehend, sich irgendwie im Leben zurechtzufinden. Während die frühere Auffassung letztlich auf eine Aufhebung des Besonderen im Allgemeinen der symbolischen Ordnung abzielte, wird jetzt ein neuer Umgang mit dem sich jeweils in seiner Einzelheit Anbietenden angestrebt.
Allgemeiner gesehen geht es darum, wie ich es auch für Freud bezüglich der Telepathie-Affäre zu zeigen versuche,^'' die Psychoanalyse gewissermaßen von außen anzuschauen. Die ganze Frage ist aber, wie man das Verhältnis von Psychoanalyse und von außen angeschauter Psychoanalyse bestimmt. In meiner Sichtweise gehört beides zusammen, was impliziert, dass eine Art »Logik«, letztlich eine aporetische Artikulation, des Verhältnisses zwischen Analyse und immer gleichzeitig wirkender Nicht-Analyse zu entwickeln ist. Lacan dagegen, scheint es mir, sucht eher eine letztlich stabilisierend wirkende Lösung hinsichtlich des möglichen Umgangs mit dem Nicht-Analytischen. Er ist in seinen klassischen Texten zunächst ganz auf der Seite der Rhetorik des Unbewussten sowie der dazu gehörenden ödipalen Aufliebung und lässt diese Sichtweise dann in Le sinthome fast fallen, um einen neuen Weg zu finden. Jenseits aller Unterschiede geht es aber in beiden Fällen um das Auffinden einer Lösung in Bezug auf die problematischen Auswirkungen einer ursprünglichen Situation. In sehr konstanter Weise ist Lacan immer
36 Vgl. Jacques Lacan, »Intervention a la suite de l'expose d'Andre Albert«, in; Lettres del'EFP, 24 (1978), S. 22-24. 37 Vgl. Kapitel I I I . l
74
auf der Suche nach möglichen Umwandlungen von etwas von ihm als ursprünglich-krisenhaft Angesehenem. Er mag nicht das »Beides-Zugleich«. Darauf werde ich später zurückkommen.
75