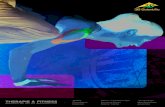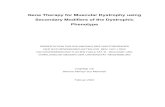RESEARCH Open Access Combination therapy with ampicillin ...
Myomtherapie und Fertilität; Myoma therapy and fertility;
Transcript of Myomtherapie und Fertilität; Myoma therapy and fertility;

Gynäkologe 2014 · 47:26–30DOI 10.1007/s00129-013-3203-1Online publiziert: 21. Januar 2014© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
J.B. Engel · O. OrtmannKlinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Caritas-Krankenhaus
St. Josef, Universität Regensburg , Regensburg
Myomtherapie und Fertilität
Myome sind gutartige Tumoren des Uterus, die mit Beschwerden wie Unterbauchschmerzen, Dysmenor-rhö, Blutungsstörungen sowie Steri-lität und Infertilität vergesellschaftet sein können. Zwischen 35 und 77% aller Frauen im reproduktiven Alter können von Uterusmyomen betrof-fen sein. Die Prävalenz von Uterus-myomen bei Sterilitätspatientinnen beträgt 5–10%; bei 1–2,4% können diese als alleiniger Grund für die un-gewollte Kinderlosigkeit identifiziert werden [1, 2]. Der Hauptfaktor hier-für scheint die Beeinträchtigung der endometrialen Rezeptivität durch Impression und Verformung des Uteruscavums zu sein. Allerdings kommen Myome auch als Ursache eines tubaren Faktors der Sterilität durch mechanische Kompression in Frage (. Tab. 1).
Die Evidenzlage, in welchem Maße My-ome die Fertilität beeinträchtigen, bzw. ob und welche Therapieansätze sinnvoll sind, ist leider dürftig. Zur Klärung dieser Fra-ge wurden wenige prospektive, randomi-sierte Studien durchgeführt. Die durch-geführten Studien sind häufig klein und lassen daher keine konklusiven Aussa-gen zu.
Im Folgenden soll ein Überblick dar-über gegeben werden, welche Diagnostik und Therapie bei Patientinnen mit Uterus myomatosus sinnvoll ist.
Myome und Sterilität
In einer größeren Fall-Kontroll-Studie untersuchten Buletti et al. [3] 318 Patien-
tinnen mit unerfülltem Kinderwunsch. 212 hatten Uterusmyome, 106 keine er-kennbare Sterilitätsursache. Von den Pa-tientinnen mit Uterus myomatosus er-folgte bei der Hälfte eine Myomenuklea-tion per laparoscopiam. Bei der anderen Hälfte erfolgte keine Intervention. Bei den Patientinnen wurde eine natürliche Kon-zeption angestrebt. Die Lebendgeburtsra-te war mit 11% am niedrigsten in der Pa-tientengruppe mit unbehandelten Uterus-myomen und mit 44% am höchsten in der Gruppe mit laparoskopisch resezierten Uterusmyomen. In der Gruppe der Pa-tientinnen mit idiopathischer Sterilität lag die Schwangerschaftsrate bei 27%. Die-se Fall-Kontroll-Studie suggeriert, wenn auch auf niedrigem Evidenzniveau, dass Uterusmyome für eine ungewollte Kin-derlosigkeit verantwortlich sein können und legt die Wirksamkeit einer laparo- skopischen Myomenukleation nahe.
Eine 2012 publizierte Metaanalyse der Cochrane Collaboration Group [4] hat die Wirksamkeit einer chirurgischen Therapie von Myomen bei Sterilität unter-sucht; 266 Studien wurden auf ihre Qua-lität überprüft. Lediglich drei waren nach den Kriterien der Cochrane Collabaorati-on Group von ausreichender Qualität, um in die Metaanalyse aufgenommen zu wer-den. Diese drei Arbeiten werden im Fol-genden näher besprochen. Eine Arbeit [5] untersucht den Effekt einer Myomenukle-ation auf die Fertilität in Abhängigkeit von der Lage des Myoms; zwei weitere [6, 7] vergleichen laparoskopische und offene Myomenukleationen hinsichtlich Effekti-vität und Nebenwirkungen.
Bei der Arbeit von Casini et al. [5] han-delt es sich um eine prospektive, kontrol-
lierte Studie, die durchgeführt wurde um zu evaluieren, ob die Lage der Myome im Uterus (submukös, intramural, subserös, submukös/intramural, subserös/intramu-ral) Einfluss auf die reproduktive Funk-tion hat und ob die Myomentfernung Ein-fluss auf die Schwangerschafts- und die Fehlgeburtsrate hat. In dieser Studie wur-den 181 Patientinnen mit Uterus myoma-tosus, die seit einem Jahr ungewollt kin-derlos waren, eingeschlossen. Die Ergeb-nisse sind in . Tab. 2 zusammengefasst. Die Autoren beobachteten eine statistisch signifikante Verbesserung der Schwan-gerschaftsrate durch Myomenukleation in der Patientinnengruppe mit submukö-sen Unterusmyomen und in der Patien-tinnengruppe mit submukös/intramura-len Uterusmyomen. In den anderen Pa-tientinnengruppen war der Effekt statis-tisch nicht signifikant. In der Arbeit von Casini et al. [5] wurde der relativ vor-raussetzungsfreie, nichtparametrische χ2-Test zur Analyse der Daten verwendet. In der Arbeit der Cochrane Collaborati-on Group wurden die Daten von Casini et al. [5] reanalysiert. Hier wurde jeweils die Odds Ratio für eine Schwangerschaft nach chirurgischer Intervention in den verschiedenen Gruppen analysiert. Die-
RedaktionW. Janni, Ulm O. Ortmann, Regensburg
Tab. 1 Mögliche Ursachen der Fertilitäts-minderung durch Myome
Deformierung des Cavum uteri
Obstruktion der proximalen Tuben
Veränderte örtliche Beziehung zwischen Tube und Eileiter
Gestörte uterine bzw. tubare Kontraktilität
Verminderte Trophik des Endometriums
Endometriale Inflammationsreaktion
26 | Der Gynäkologe 1 · 2014
Leitthema

ses statistische Verfahren erbrachte eben-falls Odds Ratios von jeweils 2,04 und 3,24 für die Intervention in der Gruppe der Pa-tientinnen mit submukösen und intramu-ral/submukösen Myomen. Allerdings war das Resultat statistisch nicht signifikant. Die Divergenz der Ergebnisse verschie-dener statistischer Tests, die beide formal korrekt verwendet wurden, legt folgen-den Schluss nahe: Aufgrund zu niedriger Patientenzahlen liefert diese Arbeit zwar einen Hinweis, aber keinen Beweis da-für, dass die Enukleation von Uterusmyo-men, die in Beziehung zum Cavum ute-ri stehen (submukös, submukös/intramu-ral), die Wahrscheinlichkeit einer sponta-nen Konzeption positiv beeinflusst.
Zwei randomisierte Studien [6, 7] vergleichen offene und laparoskopische Myomenukleationen bei Patientinnen mit Kinderwunsch hinsichtlich der Effektivi-tät und der Komplikation. Die erste Stu-die von Seracchioli et al. [6] ist eine rando-misierte unizentrische Studie mit 131 Pa-tientinnen mit wenigstens einem >5 cm durchmessenden Myom. Die Patientin-nen wurden randomisiert zur offenen oder laparoskopischen Myomenukleati-on. Beide Gruppen waren homogen be-züglich Anzahl, Größe und Lage der gro-ßen Myome. Signifikante Unterschiede
ergaben sich hinsichtlich der postoperati-ven Morbidität. In der Laparotomiegrup-pe kam es häufiger zu Fieber über 38°C und auch zu einem höheren intraopera-tiven Blutverlust. Des Weiteren war die Hospitalisierung der per laparotomiam behandelten Patientinnen signifikant län-ger. Dagegen waren sowohl die Schwan-gerschaftsrate (55,9% nach Laparotomie vs. 53,6% nach Laparoskopie), die Abort- rate (21 vs. 20%), die Frühgeburtsrate (7,4 vs. 5%) und der Geburtsmodus (Sectio 77,8 vs. 75%) in beiden Gruppen gleich. In dieser Untersuchung kam es bei keiner der Gruppen zu einer Uterusruptur wäh-rend der Schwangerschaft oder bei der Entbindung.
» Die Effektivität des laparoskopischen ist mit dem des offenen Procedere vergleichbar
Bei der zweiten Studie, einer multizentri-schen, randomisierten, kontrollierten Stu-die von Palomba et al. [7] wurden 136 Ste-rilitätspatientinnen mit Uterus myoma-tosus untersucht. In dieser Studie waren die kumulative Schwangerschaftsrate, die Lebendgeburtsrate und die Abortrate in der offen und der laparoskopisch behan-
delten Patientengruppe gleich. Allerdings war die Zeit bis zum Auftreten der ersten Schwangerschaft bzw. der ersten Lebend-geburt signifikant kürzer in der per lapa-roscopiam behandelten Gruppe. Damit sind beide Methoden hinsichtlich ihrer Effektivität vergleichbar, das laparoskopi-sche Vorgehen scheint patientenfreundli-cher zu sein.
Zu ähnlichen Aussagen kommt eine Metaanalyse von Jin et al. [8], welche die offene mit der laparoskopischen Myom-ektomie verglich. Hier war das laparosko-pische Vorgehen mit weniger Blutverlust, kürzerer Hospitalisierung, weniger posto-perativen Schmerzen und schnellerer Re-konvaleszenz assoziiert. Allerdings waren die Komplikations- und die Schwanger-schaftsraten für beide Verfahren gleich.
Myome und assistierte Reproduktion
Eine Studie von Bulletti et al. [9] verglich 84 Frauen mit intramuralen Myomen >5 cm, die sich vor einer IVF-Behand-lung operieren ließen, mit 84 Frauen ohne operative Therapie der Uterusmyome. In der Gruppe der operierten Patientinnen betrugen die Schwangerschaftsrate 33% und die Lebendgeburtenrate 25%, wäh-rend sie 15 und 12% in der Patientengrup-pe ohne operative Intervention betrugen. Diese Studie suggeriert, dass auch vor ei-ner geplanten IVF-Behandlung intramu-rale Myome, die >5 cm sind, entfernt wer-den sollten.
Myome in der Schwangerschaft
Myome in der Schwangerschaft treten mit einer Inzidenz zwischen 0,1 und 10,7% auf.
Tab. 2 Effekt der Myomlage und Behandlung auf die Schwangerschaftsrate. (Mod. nach [4, 5])
Gruppe Behandlung Patientinnen (n) Schwanger- schaften (n)
Schwanger-schaftsrate (%)
p-Wert Odds Ratio
SM (n=52) Mit operativer TherapieOhne operative Therapie
3022
136
43,327,2
<0,05 2,04 (0,62, 6,66)NS
IM (n=45) Mit operativer TherapieOhne operative Therapie
2322
139
56,540,9
NS 1,88 (0,57, 6,14)NS
SS (n=11) Ohne operative Therapie 11 7 63,6
IM-SS (n=31) Mit operativer TherapieOhne operative Therapie
1714
63
35,321,4
NS 2,00 (0,40, 10,09) NS
SM-IM (n=42) Mit operativer TherapieOhne operative Therapie
2220
83
36,415,0
<0,05 3,24 (0,72, 14,57) NS
SM submukös, IM intramural, SS subserös, IM-SS intramural/subserös, SM-IM submukös/intramural, NS nicht signifikant.
Tab. 3 Schwangerschaftskomplikationen bei Uterus myomatosus
Komplikationen Risiko (Odds Ratio)
Vorzeitige Wehentätigkeit 1,0–4,0
Fetale Lageanomalie 1,5–4,0
Placenta praevia 1,8–3,9
Vorzeitige Plazentalösung 0,5–16,5
Sectio 1,1–6,7
Postpartale Nachblutung 1,6–4,0
Plazentaretention 2,0–2,7
27Der Gynäkologe 1 · 2014 |

Zusammenfassung · Abstract
Während der Schwangerschaft können Myome vor allem in den ersten beiden Trimestern schnell wachsen und durch die Größenzunahme Beschwerden ver-ursachen [1]. Andererseits ist eine post-partale Größenabnahme der Myome um mehr als 50% in etwa 72% der Fälle be-schrieben [10]. Komplikationen treten in 10–40% der Schwangerschaften auf [11]. Myome können das Risiko erhöhen für Fehlgeburten, vorzeitige Wehentätigkeit, fetalen Lageanomalien sowie für post-partale Nachblutungen (erhöhte Risiken für Myompatientinnen sind für die häu-figsten Schwangerschaftskomplikationen in . Tab. 3 angegeben). In seltenen Fäl-len kann es auch in der Schwangerschaft zu sehr schmerzhaften Myomnekrosen kommen oder auch zu kompressionsbe-dingten fetalen Gliedmaßenanomalien. Das Risiko von myombedingten Kompli-kationen während der Schwangerschaft steigt an, wenn Myome >3 cm sind. An-dererseits ist bekannt, dass auch Patientin-nen, deren Myome >10 cm sind, in 70% der Fälle vaginal entbunden werden kön-nen [12]. Myome sind ebenfalls mit Lage-anomalien des Feten vergesellschaftet. So ist die Odds Ratio für eine Beckenendlage für Patientinnen mit Uterusmyomen 3,98 [13]. Einige Studien ergaben ein mit Myo-men assoziiertes Risiko für eine vorzeitige Wehentätigkeit. Andererseits könnte eine Metaanalyse von Olive u. Pritts [14] zei-gen, dass es im Vergleich zu Kontrollen bei Myompatientinnen nicht häufiger zu Frühgeburtlichkeit kam.
Eine japanische Studie verglich retro-spektiv die Komplikationsrate bei Ent-bindungen von Patientinnen nach Myo-menukleation mit Patientinnen mit nicht operierten Uterusmyomen [15]. In die-ser Studie waren die Frühgeburtsrate, der peripartale Blutverlust und die Sectiora-te in der Patientengruppe ohne vorheri-ge Myomektomie signifikant erniedrigt.
Myomembolisation
Die Uterusarterienembolisation (UAE) zur Myomtherapie wird immer wieder als ebenfalls minimal-invasive Therapiemög-lichkeit bei Uterus myomatosus und Kin-derwunsch diskutiert. Für Patientinnen mit potenziellem Kinderwunsch ist die Rolle der UAE als Behandlungsoption bis-
Gynäkologe 2014 · 47:26–30 DOI 10.1007/s00129-013-3203-1© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
J.B. Engel · O. Ortmann
Myomtherapie und Fertilität
Zusammenfassung
Uterusmyome können ein Konzeptionshin-dernis darstellen und auch in einer bestehen-den Schwangerschaft zu Komplikationen führen. Die Arbeit gibt eine Übersicht des ak-tuellen Kenntnisstandes zu Ätiologie und Therapiemöglichkeiten. Das Evidenzniveau, auf dessen Basis Therapieempfehlungen ge-geben werden können, ist aufgrund der un-zureichenden Datenlage niedrig. Patientin-nen mit unerfülltem Kinderwunsch und sub-mukösen oder intramural/submukösen Myo-men scheinen von einer Myomenukleati-on hinsichtlich der Schwangerschaftsrate zu profitieren. Allerdings sollte diese erst nach Durchführung einer generellen Sterilitätsdia-gnostik des Paares erfolgen. Offene und lapa-roskopische Myomenukleationen scheinen hinsichtlich der Schwangerschaftsrate gleich-wertige Verfahren darzustellen. Ein laparos-
kopisches Vorgehen ist mit weniger periope-rativem Blutverlust und Schmerzen sowie schnellerer Rekonvaleszenz assoziiert. Ob sich eine Patientin mit Kinderwunsch, jedoch ohne Sterilitätsanamnese und bekanntem Uterusmyom vor Anstreben der Schwan- gerschaft einer operativen Therapie unter-ziehen sollte oder nicht ist unklar. Aufgrund der insgesamt unzureichenden Datenlage scheint sowohl nach hysteroskopischer Myomenukleation als auch nach offener oder laparoskopischer Myomentfernung unter entsprechender Überwachung ein vaginaler Entbindungsversuch möglich.
SchlüsselwörterMyom · Sterilität · Schwangerschaft · Myom- enukleation · Laparoskopie
Myoma therapy and fertility
AbstractUterine myoma can be associated with in-fertility and complications during pregnan-cy. The current review article summarizes the current state of the art with respect to the eti-ology and therapeutic modalities. The level of evidence of most recommendations is rel-atively low due to the lack of prospective ran-domized trials. In patients with infertility and submucous or intramural/submucous my-oma, myomectomy seems to increase the pregnancy rate. However, a general sterility assessment should be performed prior to un-dertaking surgical measures. Open and lap-aroscopic myomectomy are similar with re-spect to pregnancy rates; however, a laparo-
scopic approach is associated with less blood loss and perioperative pain as well as short-er hospitalization. Whether a patient with-out any history of sterility, who presents with uterine myoma should undergo surgery pri-or to an intended pregnancy, is unclear. Af-ter myomectomy by hysteroscopy, laparos-copy or laparotomy, vaginal delivery is usual-ly safe; however this observation is based on-ly on few retrospective studies.
Keywords
Fibroid · Sterility · Pregnancy · Uterine myo-mectomy · Laparoscopy
her jedoch noch nicht ausreichend geklärt [16]. Es gibt dazu bisher nur sehr wenige prospektive Studien, deren Ergebnisse nicht mit der erforderlichen Evidenz ei-ner Aussage über den Einfluss der UAE-Therapie auf Fertilitätsrate und Schwan-gerschaftsausgang zulassen. Fallserien zei-gen, dass eine UAE zumindest das Abort-risiko deutlich erhöht.
» Bei Kinderwunsch ist eine UAE keine Alternative zur operativen Option
Weitere Untersuchungen müssen die Ursachen der beobachteten erhöhten Ra-ten postpartaler Blutungen und der erhöh- ten Sectiofrequenz bei Frauen nach Myom- embolisation klären. Als Konsequenz er-gibt sich, dass die UAE bei Kinderwunsch-patientinnen zurzeit keine Alternative zur operativen Myomektomie darstellt, sodass eine UAE nur in Frage kommt, wenn eine Patientin chirurgische Maßnahmen strikt ablehnt bzw. eine chirurgische Intervention kontraindiziert ist [16]. Eine adäquate Auf-klärung und Hinweis auf die insuffiziente Evidenzlage ist hier obligat.
28 | Der Gynäkologe 1 · 2014

Entbindungsmodus nach Myomenukleation
In vielen gynäkologischen Kliniken in Deutschland hat es sich als „good clini-cal practice“ etabliert, nach Myomenuk-leation ohne Eröffnung des Uteruscavums sowie nach hysteroskopischer Myom- enukleation einen Spontanpartus anzu-streben. Im Falle der intraoperativen Er-öffnung des Uteruscavums ist es üblich, eine primäre Sectio am wehenlosen Ute-rus durchzuführen. Dieses Procedere ist allerdings nicht evidenzbasiert.
Die Frage nach dem Entbindungsmo-dus nach Myomenukleation ist auf einem hohen Evidenzlevel zurzeit nicht zu be-antworten, da lediglich retrospektive Stu-dien vorliegen. Eine größere retrospektive Datenanalyse von Gyamfi-Bannerman et al. [17] beschrieb in einer Serie von 167 Pa-tientinnen mit vorangegangener Myom-ektomie im Verlauf der Schwangerschaft keine spontane Uterusruptur. Allerdings waren alle Patientinnen in diesem Kollek- tiv mit primärer Sectio am wehenlosen Uterus entbunden worden. Eine retro- spektive Studie von Kelly et al. [18] ana-lysierte 112 Schwangerschaften und Ent-bindungen nach Myomenukleation, wo-bei es bei 81 Patientinnen zu 92 Entbin-dungen nach Myomenukleation per lapa-rotomiam, einer per laparoscopiam und 19 per hysteroscopiam kam. Bei 72 Pa-tientinnen wurde eine spontane Entbin-dung angestrebt, 22 davon erfolgte die Geburtseinleitung bzw. bei 33 die Oxy-tocinunterstützung. Von diesen 72 vagi-nalen Entbindungsversuchen wurden 10 aufgrund von mangelndem Geburtsfort-schritt durch Sectio beendet. Kumakiri et al. [19] berichten über einen vaginalen Entbindungsversuch bei 71,9% der Pa-tientinnen nach laparoskopischer Myom- enukleation. Hier betrug die Erfolgsra-te 82,6%. Dubuisson et al. [20] schildern vergleichbare Ergebnisse nach laparos-kopischer Myomenukleation. Hier wur-de bei 72% der Patientinnen ein vagina-ler Entbindungsversuch gemacht, der in 80,6% der Fälle gelang. In dieser Fallserie, die 100 Entbindungen einschloss, kam es zu keiner Uterusruptur unter Wehen, je-doch zu einer spontanen Uterusruptur im Bereich der Myomektomienarbe.
Roy et al. [21] untersuchten retro- spektiv 186 Patientinnen, die eine hyste-roskopische Myomektomie bei Infertilität durchführen ließen. Hier betrugen die Ba-by-take-home-Rate 74% und die Sectiora-te 35,6%. Eine Uterusruptur wurde nicht beschrieben.
» Unter entsprechenden Sicher-heitsvorkehrungen kann oft ein vaginaler Partus versucht werden
Zusammenfassend muss bei einer sehr unzureichenden Datenlage festgehal-ten werden, dass nach hysteroskopischer Myomenukleation ein vaginaler Entbin-dungsversuch in der Regel angestrebt werden kann. Nach Myomenukleation per laparoscopiam oder per laparotomi-am scheint das Uterusrupturrisiko insge-samt gering zu sein, sodass unter entspre-chenden Sicherheitsvorkehrungen häufig ein vaginaler Entbindungsversuch unter-nommen werden kann.
Fazit für die Praxis
F Patientinnen mit unerfülltem Kinder-wunsch und submukösem oder intra-mural/submukösen Myomen profitie-ren aller Wahrscheinlichkeit nach von einer Myomenukleation.
F Allerdings sollte diese erst nach Ab-schluss einer generellen Sterilitäts- diagnostik des Paares erfolgen.
F Im Hinblick auf die Schwanger-schaftsraten sind offene vs. laparo- skopische Myomenukleationen gleichwertig.
F Die laparoskopische Myomektomie ist mit geringerem perioperativen Blutverlust und weniger Schmerzen sowie schnellerer Rekonvaleszenz as-soziiert.
F Nach wie vor nur im Einzelfall zu be-antworten ist die Frage, ob eine Pati-entin mit Kinderwunsch, jedoch ohne Sterilitätsanamnese und bekanntem Uterusmyom sich vor Anstreben der Schwangerschaft einer operativen Therapie unterziehen sollte oder nicht.
F Trotz unzureichender Datenlage scheint unabhängig vom Verfahren
ein vaginaler Entbindungsversuch vertretbar zu sein.
Korrespondenzadresse
PD Dr. J.B. EngelKlinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Caritas-Krankenhaus St. Josef, Universität Regensburg Landshuter Str. 65, 93053 [email protected]
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt. J.B. Engel und O. Ortmann geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Literatur
1. Guo XC, Segars JH (2012) The impact and manage-ment of fibroids for fertility: an evidence-based approach. Obstet Gynecol Clin North Am 39:521–533
2. o A (2008) Myomas and reproductive function. Fertil Steril 90:S125–S130
3. Bulletti C, De Ziegler D, Polli V, Flamigni C (1999) The role of leiomyomas in infertility. J Am Assoc Gynecol Laparosc 6:441–445
4. Metwally M, Cheong YC, Horne AW (2012) Surgical treatment of fibroids for subfertility. Cochrane Da-tabase Syst Rev 11:CD003857
5. Casini ML, Rossi F, Agostini R, Unfer V (2006) Effects of the position of fibroids on fertility. Gynecol En-docrinol 22:106–109
6. Seracchioli R, Rossi S, Govoni F et al (2000) Fertili-ty and obstetric outcome after laparoscopic myo-mectomy of large myomata: a randomized com-parison with abdominal myomectomy. Hum Re-prod 15:2663–2668
7. Palomba S, Zupi E, Russo T et al (2007) A multicen-ter randomized, controlled study comparing lapa-roscopic versus minilaparotomic myomectomy: short-term outcomes. Fertil Steril 88:942–951
8. Jin C, Hu Y, Chen XC et al (2009) Laparoscopic ver-sus open myomectomy–a meta-analysis of rando-mized controlled trials. Eur J Obstet Gynecol Re-prod Biol 145:14–21
9. Bulletti C, DE Ziegler D, Levi Setti P et al (2004) My-omas, pregnancy outcome, and in vitro fertiliza-tion. Ann N Y Acad Sci 1034:84–92
10. Laughlin SK, Hartmann KE, Baird DD (2011) Post-partum factors and natural fibroid regression. Am J Obstet Gynecol 204:496 e491–e496
11. Ouyang DW, Economy KE, Norwitz ER (2006) Obst-etric complications of fibroids. Obstet Gynecol Clin North Am 33:153–169
12. Qidwai GI, Caughey AB, Jacoby AF (2006) Obs-tetric outcomes in women with sonographical-ly identified uterine leiomyomata. Obstet Gynecol 107:376–382
13. Coronado GD, Marshall LM, Schwartz SM (2000) Complications in pregnancy, labor, and delivery with uterine leiomyomas: a population-based stu-dy. Obstet Gynecol 95:764–769
14. Pritts EA, Parker WH, Olive DL (2009) Fibroids and infertility: an updated systematic review of the evi-dence. Fertil Steril 91:1215–1223
29Der Gynäkologe 1 · 2014 |

15. Kinugasa-Taniguchi Y, Ueda Y, Hara-Ohyagi C et al (2011) Impaired delivery outcomes in pregnan-cies following myomectomy compared to myoma-complicated pregnancies. J Reprod Med 56:142–148
16. David M, Kröncke T (2013) Uterine fibroid emboli-sation- ptential impact on fertility and pregnancy outcome. Geburtshilfe Frauenheilkd 73:247–255
17. Gyamfi-Bannerman C, Gilbert S, Landon MB et al (2012) Risk of uterine rupture and placenta accre-ta with prior uterine surgery outside of the lower segment. Obstet Gynecol 120:1332–1337
18. Kelly BA, Bright P, Mackenzie IZ (2008) Does the surgical approach used for myomectomy influence the morbidity in subsequent pregnancy? J Obstet Gynaecol 28:77–81
19. Kumakiri J, Takeuchi H, Kitade M et al (2005) Preg-nancy and delivery after laparoscopic myomecto-my. J Minim Invasive Gynecol 12:241–246
20. Dubuisson JB, Fauconnier A, Deffarges JV et al (2000) Pregnancy outcome and deliveries fol-lowing laparoscopic myomectomy. Hum Reprod 15:869–873
21. Roy KK, Singla S, Baruah J et al (2010) Reproduc-tive outcome following hysteroscopic myomecto-my in patients with infertility and recurrent abor-tions. Arch Gynecol Obstet 282:553–560
Der Begriff der Atherosklerose fasst arteriel-le Gefäßerkrankungen zusammen, die durch fib röse Umbauprozesse in der Gefäßwand ge-kennzeichnet sind und als chronische entzünd-liche Reaktion der Gefäßwand auf Dyslipid-ämie und Endothelstress gedeutet wird. Der chronische Prozess induziert eine multifokale Plaquebildung. Die Mehrzahl dieser Plaques bleibt klinisch stumm, einige verursachen Obs-truktion, Thrombose und Embolie und damit atherothrombotische Ereignisse wie Herzin-farkt, Schlaganfall oder die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK). Die Prävalenz der pAVK ist in den letzten 10 Jahren dramatisch angestiegen, in Ländern mit hohem Einkommen wie Deutschland um 13,1%. Es wird geschätzt, dass bei uns ca. 3 Millionen Menschen von dieser Erkrankung betroffen sind. Dies hat erhebliche Auswirkun-gen auf unser Gesundheitssystem: die Rück-vergütungskosten für stationäre Behandlung der pAVK stiegen von 2,14 Milliarden Euro im Jahr 2007 auf 2,56 Milliarden Euro im Jahr 2009 an und machten damit 4,84% aller Kranken-hauskosten aus.
Über 50% der Patienten mit pAVK sterben am Herzinfarkt, ca. 15% am Schlaganfall.
Die AWMF-Leitlinien betonen:F Die Bedeutung der pAVK wird von Ärzten
und Patienten unterschätzt.F Patienten mit pAVK sind
hinsicht lich ihrer Risikofaktoren und Begleiterkrankungen unterbehandelt.
Begründet wird diese Feststellung mit Studien, die belegen konnten, dass zwar 2 von 3 Patien-ten mit koronarer Herzkrankheit (KHK) einen Thrombozytenfunktionshemmer erhielten, aber nur etwa jeder zweite Patient mit pAVK. Bei der Lipidsenkung mit Statinen sieht es ähnlich aus: 46% der Patienten mit KHK, aber nur 23% der Pa-tienten mit symptomatischer pAVK werden mit einem Statin versorgt. Hinzu kommt: Nur wenige Patienten wissen, was eine pAVK ist. Von denen, die den Begriff kennen, ist etwa der Hälfte nicht bewusst, dass ein Diabetes mellitus und Rau-chen das Risiko für eine pAVK erhöhen.
Fachnachrichten
Die Deutsche Gesellschaft für Gefäß chir urgie und Gefäßmedizin (DGG)empfiehlt in Anlehnung an die aktuellen WHO-Empfehlungen und europäischen Leitlinien,F das Rauchen aufzugeben oder nicht damit
zu beginnen,F sich gesund zu ernähren,F körperlich aktiv zu sein (wenigstens 30
Minuten an den meisten Tagen der Woche bzw. wenigstens 1 Stunde an den meisten Tagen der Woche),
F Übergewicht und Adipositas zu vermeiden,F den Blutdruck zu reduzieren
(< 140/90 mmHg),F Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterin
zu senken. Dabei wird empfohlen, bei Er-wachsenen über 40 Jahre mit persistierend hohem Gesamtcholesterin (> 5 mmol/L) und/oder LDL-Cholesterin > 3,0 mmol/L (trotz Lipid-senkender Diät) ein Statin zu verordnen.
F den Blutzucker regelmäßig überprüfen zu lassen und wenn erforderlich einzustellen,
F Thrombozytenaggregationshemmer falls erforderlich einzunehmen sowie
F bei der Ernährung gesättigte Fettsäuren durch vielfach ungesättigte Fettsäuren zu ersetzen,
F Trans-ungesättigte Fettsäuren so wenig als möglich aufzunehmen (möglichst kein Konsum von industriell hergestellten Produkten) und < 1% der Gesamt-energieaufnahme aus natürlichen Quellen zu beziehen sowie die Zufuhr von
F < 5 g Salz/Tag,F 30-45 g Fasern (Ballaststoffe)/Tag, von Voll-
kornprodukten, Früchten und Gemüse,F 200 g Früchte am Tag (2-3 Portionen),F 200 g Gemüse am Tag (2-3 Portionen) undF Fisch wenigstens 2-mal die Woche, 1-mal
davon öliger Fisch.F Der Konsum alkoholhaltiger Getränke
sollte möglichst maximal auf 2 Gläser pro Tag (20 g Alkohol/Tag) bei Männern und 1 Glas (10 g Alkohol/Tag) bei Frauen limitiert werden.
Mit der ACTION (Arteriosklerose – Circulation und Training InformatiOns Netzwerk)-Kampag ne trägt die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin zur Aufklärung, Information und Prävention über Arteriosklerose bei.
Arteriosklerose und periphere arterielle Verschlusskrankheit
30 | Der Gynäkologe 1 · 2014