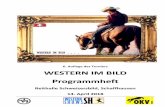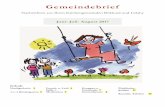Nachruf auf Heinz Bethge/Nachruf auf Peter Andresen
Transcript of Nachruf auf Heinz Bethge/Nachruf auf Peter Andresen

Nachruf auf Heinz Bethge
Am 9. Mai 2001 verstarb in Halle(Saale) Prof. Dr. Dr. h. c. HeinzBethge in seinem 81. Lebensjahr.Die Gemeinschaft der Physiker ver-liert mit ihm einen auf dem Gebieteder Oberflächenphysik, der Kristall-physik und der Elektronenmikros-kopie weltweit anerkannten Wis-senschaftler, der anlässlich seines80. Geburtstages zum Ehrenmit-glied der Deutschen PhysikalischenGesellschaft ernannt wurde. Alslangjähriger Direktor (1960–1985)des früheren Instituts für Festkör-perphysik und Elektronenmikros-kopie der Akademie der Wissen-schaften der DDR und als Präsident(1974–1990) der Deutschen Akade-mie für Naturforscher LEOPOLDI-NA war er weithin bekannt undgeachtet. Mit ihm ist einer derGroßen unter den Wissenschaftlernvon uns gegangen, um den wir tiefund aufrichtig trauern.
Heinz Bethge wurde 1919 inMagdeburg geboren, studierte –unterbrochen durch den Kriegs-dienst – an der Technischen Hoch-schule Berlin-Charlottenburg undan der Martin-Luther-UniversitätHalle-Wittenberg. Seinem Diplomin Physik an der Universität Hallefolgten die Promotion im Jahre1954, die Habilitation 1959 und die Ernennung zum Professor 1960.Im gleichen Jahr wurde auf seineAnregung hin die Arbeitsstelle fürElektronenmikroskopie in Hallegegründet, das spätere Institut fürFestkörperphysik und Elektronen-mikroskopie der Akademie derWissenschaften der DDR. Mit gro-ßem persönlichen Einsatz hat er in echter Pionierarbeit das Institutaufgebaut, bis zu seiner Emeritie-rung geleitet und zu Ansehen ge-bracht. In der Tradition dieses In-stituts – das dürfte Heinz Bethgebesonders gefreut haben – wurdenach der politischen Wende dasMax-Planck-Institut für Mikro-strukturphysik als erstes Max-Planck-Institut in den neuen Bun-desländern gegründet, dem er nochbis kurz vor seinem Tod mit Ratund Tat zur Seite stand.
In seiner wissenschaftlichen Ar-beit hat sich Heinz Bethge der Er-forschung molekularer Prozesse aufFestkörperoberflächen gewidmet.Mit der von ihm meisterhaft ge-
handhabten elektronenmikroskopi-schen Dekorationstechnik konnteer erfolgreich zur Aufklärung derRealstruktur kristalliner Materiali-en beitragen und so ein besseresVerständnis der wirkenden Ober-flächenprozesse erzielen. Kritischeoberflächenphysikalische Größen,wie die Beweglichkeit atomarerStufen oder Diffusionslängen ato-marer bzw. molekularer Ober-flächenbausteine, wurden von ihmexperimentell erfasst. WesentlicheBeiträge zur Aufklärung von Fragendes Kristallwachstums konnten soerbracht werden. Heinz BethgesGrundlagenuntersuchungen auf denGebieten der Grenzflächen undDünnen Schichten, vor allem zuFragen der Adsorption und der Epi-taxie, sind auch in die angewandteForschung, z. B. zur Klärung vonFragen der Festkörperelektronik,eingeflossen. Nicht minder erfolg-reich waren Heinz Bethge und sei-ne Mitarbeiter bei ihren Arbeitenzur Aufklärung des Zusammen-hangs zwischen Realstruktur undmechanischen Eigenschaften (Fes-tigkeit, Plastizität, Bruchverhalten)kristalliner Materialien.
Wesentlicher Bestandteil seinerfestkörperphysikalischen Untersu-chungen war für Heinz Bethge dieEntwicklung neuer Forschungsme-thoden. Bereits in den fünfzigerJahren hat er mit dem Eigenbauvon Elektronenmikroskopen begon-nen, ehe danach kommerzielleHochleistungs-Geräte (Hochauflö-sungs-Elektronenmikroskope, 1000-kV-Höchstspannungs-Elektronen-mikroskop, analytische Elektronen-mikroskope) zur Verfügungstanden. Die bereits erwähnte De-korationstechnik – konsequent vonihm eingesetzt – ist eng mit seinemNamen verbunden. In der Ober-flächen-Elektronenmikroskopie(Emissions-Elektronenmikroskopie,Spiegel-Elektronenmikroskopie) –ein weiteres Forschungsgebiet vonHeinz Bethge – hat er als Krönungseiner gerätetechnischen Entwick-lungen ein ultrahochvakuumtüchti-ges Photoemissions-Elektronen-mikroskop entwickelt. Dieses auchin Kombination für Beugungsunter-suchungen mit langsamen Elektro-nen (LEED) und für die Auger-Spektroskopie (AES) einsetzbareGerät erlaubte vielseitige ober-flächenphysikalische Untersuchun-
gen (z. B. die lokale Bestimmungvon Austrittsarbeiten). Der vonHeinz Bethge im Zusammenhangmit seinen gerätetechnischen Ent-wicklungen eingeführte Terminusder „Abbildenden Oberflächenana-lytik“ ist inzwischen allenthalbenakzeptiert.
Heinz Bethge war mit seinemwissenschaftlichen Werk und seinerpersönlichen Ausstrahlung weithinbekannt und in Leitungsgremienwissenschaftlicher Vereinigungenund in Beratergremien wissen-schaftlicher Zeitschriften gefragt.Neben der bereits erwähnten Eh-renmitgliedschaft in der DeutschenPhysikalischen Gesellschaft war erschon seit 1989 Ehrenmitglied derDeutschen Gesellschaft für Elektro-nenmikroskopie. Sein Ehrendokto-rat erhielt er 1984 an der Techni-schen Hochschule Karl-Marx-Stadt.Viele Auszeichnungen – sowohl inder Vorwende- wie auch in derNachwendezeit – sind ihm zuteilgeworden. Nur einige sollen ge-nannt werden: Nationalpreis II.Klasse (1967), Gustav-Hertz-Me-daille der Physikalischen Gesell-schaft der DDR (1987), GroßesBundesverdienstkreuz mit Stern(1992), Ehrenmedaille der Alexan-der-von-Humboldt-Stiftung (1999),Nationalpreis der Deutschen Natio-nalstiftung (1999), Ehrenbecher derStadt Halle (2000).
Als langjähriger Präsident derDeutschen Akademie der Naturfor-scher LEOPOLDINA hat HeinzBethge in entscheidender Weise zurFörderung der Wissenschaften bei-getragen und sich einsatzfreudig imgesamtdeutschen Rahmen enga-giert. Er war Mitglied mehrerer in-und ausländischer Akademien, un-ter anderem Ehrenmitglied der Ber-lin-Brandenburgischen Akademieder Wissenschaften. Das Zusam-menwachsen der Wissenschaftleraus Ost und West – sowohl im uni-versitären wie auch im außeruni-versitären Bereich – lag ihm beson-ders am Herzen, und er hat sichhierfür mit all seiner Kraft, auch in-nerhalb der Deutschen Physikali-schen Gesellschaft, eingesetzt.
Heinz Bethge war ein hilfsberei-ter, vor Ideen sprühender Ratgeber,der seinen Kollegen und Mitmen-schen stets mit humorvoller Frischebegegnete. Seinen Mitarbeitern warer ein väterlicher Freund, der im-mer ein offenes Ohr für ihre Nöteund Sorgen hatte. Wer ihn kannte,wird ihn nie vergessen.
Wir trauern schmerzlich um
Heinz Bethge
Prof. Dr. JohannesHeydenreich, MPIfür Mikrostruktur-physik, Halle/Saale
Menschen
Menschen
Physikalische Blätter57 (2001) Nr. 964

Menschen
Physikalische Blätter57 (2001) Nr. 9 65
Heinz Bethge und werden sein An-denken in Ehren bewahren. In Ver-ehrung und Dankbarkeit verneigenwir uns vor ihm.
Johannes Heydenreich
Nachruf auf Peter Andresen
Am 24. Februar 2001 verstarb imAlter von nur 55 Jahren Peter An-dresen an den Folgen eines Herzin-farkts. Er war Professor für Ange-wandte Laserphysik an der Univer-sität Bielefeld sowie der Gründerzweier Firmen, die Messinstrumen-te, basierend auf laserdiagnosti-schen Verfahren, entwickeln undweltweit vermarkten.
Er studierte Physik an der Uni-versität Göttingen und schloß 1972das Studium mit dem Diplom ab.Nach einem kurzen Abstecher indie Industrie kehrte er zur akade-mischen Laufbahn zurück und pro-movierte 1978 mit einer Arbeit überatomare Stoßprozesse am Max-Planck-Institut für Strömungsfor-schung in der Abteilung von Profes-sor Hans Pauly. Während eines ein-einhalbjährigen Aufenthaltes amIBM Forschungsinstitut in San José(Kalifornien) machte er sich mit la-sergestützten Messverfahren ver-traut, die er nach seiner Rückkehr,1979, als Assistent von Pauly in ei-ner neuen Forschungsrichtung ein-setzte: die Photodissoziation vonkleinen, in der Atmosphärenchemiewichtigen Molekülen. Diese Studi-en kulminierten 1987 in einem Ex-periment, in dem drei Laser gleich-zeitig zum Einsatz kamen: Zu-standsselektierte Wassermolekülewurden photodissoziiert, und dieOH-Fragmente wurden nach allenQuantenzahlen (Vibration, Rota-tion und Orientierung im Raum)analysiert. Seine Pionierarbeit zurPhotolyse von Wasser wurde in derFolge zum Maßstab vieler experi-menteller Untersuchungen auf die-sem Gebiet. Herauszustreichenbleibt sein Bestreben, möglichst engmit der Theorie zusammenzuarbei-ten; schon früh erkannte er, dassder größtmögliche wissenschaft-liche Erkenntnisgewinn nur imWechselspiel von Experiment undTheorie erzielt werden kann. Indieser Zeit war er zusätzlich Gast-professor an der Universität vonNijmegen.
Während seiner Studien von ele-mentaren molekularen Reaktions-prozessen erkannte er das große Po-
tenzial bildgebender lasergestützterMessverfahren (Stichwort: zweidi-mensionale Bildverarbeitung) zurDiagnose von Verbrennungs- undStrömungsabläufen. Die Analysevon Verbrennungsprozessen in Au-tomotoren wurde bald die Haupt-richtung dieses anwendungsorien-tierten Zweiges seiner Forschungs-arbeiten. Zusätzlich zu seiner Arbeitam MPI baute Peter Andresen eineArbeitsgruppe am Laserlabor inGöttingen auf, die sich mit ver-wandten Fragestellungen beschäftig-te. Gleichzeitig schuf er zahlreicheVerbindungen mit Industriefirmenwie VW, Daimler, Bosch, Phillipsund Viessmann, wobei das gemein-same Ziel die Optimierung von Ver-brennungsabläufen war.
Überzeugt, dass sich Grundla-genforschung und Anwendungennicht ausschließen, gründete er1989 zusammen mit mehreren ehe-maligen Studenten des MPI fürStrömungsforschung – nahezu ohneGrundkapital und ohne betriebs-wirtschaftliches Wissen – die FirmaLaVision in Göttingen. Am Anfangsicherlich von den meisten Beob-achtern belächelt, entwickelte sichLaVision zu einer erfolgreichenHigh-Tech-Firma, die optischeMesssysteme für Forschung und In-dustrie entwickelt, fertigt und welt-weit vermarktet. Viele Ideen, diedie Arbeitsgruppen von Peter An-dresen am MPI, im Laserlabor undspäter an der Universität Bielefeldentwickelten, wurden so zu Pro-dukten weiterentwickelt.
1988 wurde er zum auswärtigenProfessor an der Universität Nijme-gen berufen. 1989 gewann er denPhilip-Morris-Preis für seine inno-vativen Methoden zur Untersu-chung von Verbrennungsprozessenund im Jahre 1990 erhielt er einenMax-Planck-Forschungspreis derAlexander von Humboldt-Stiftung.Seine bahnbrechenden Arbeiten so-wohl in der Grundlagen- als auchder angewandten Forschung führ-ten zu einem Ruf an die UniversitätBielefeld (Nachfolge Prof. Welge),den er 1991 annahm. Diese Periodewar sicherlich die ereignisreichste,aber auch die anstrengenste Zeitseines wissenschaftlichen Lebens.Viele seiner Freunde, Kollegen undMitarbeiter haben sich immer wie-der gefragt, woher Peter Andresendie Kraft nahm, die vielen unter-schiedlichen Aktivitäten zu meis-tern und dennoch Vitalität und Le-bensfreude zu behalten.
In Bielefeld führte er die praxis-
orientierten Arbeiten zum Ver-ständnis von Verbrennungsprozes-sen weiter, ohne jedoch Fragen derGrundlagenforschung aufzugeben.So beschäftigte sich ein Teil derArbeitsgruppe mit der Realisierungeines OH-Masers im Labor, ein„Hobby“ aus der Zeit der Photodis-soziation von Wasser und der damitverbundenen Fragen zur Erklärungvon OH-Masern im interstellarenRaum. In den letzten Jahren hat Pe-ter Andresen einen weiteren drasti-schen Richtungswechsel vorgenom-men und sich auf die Anwendungvon Lasermethoden in der Biotech-nologie, pharmazeutischen Chemieund Medizin konzentriert. DieseFähigkeit, radikal die Richtung zuändern – von Atom-Atom-Stößenzur Zeit seiner Promotion bis zubiologischen und medizinischenFragestellungen kurz vor seinemTod – war eines der herausragendenMerkmale von Peter Andresen undhat ihm große Anerkennung bei sei-nen Kollegen eingebracht. Auf dieFrage, ob er denn keine Bedenkenhabe, sich auf ein für ihn so neuesArbeitsgebiet einzulassen, verwieser ohne Zögern auf das Biologie-buch seiner Tochter, mit dem ersich eingearbeitet habe. DieseRandnotiz offenbart einen weiterenwesentlichen Charakterzug von Pe-ter Andresen: ohne Scheu zuzuge-ben, was man (noch) nicht weiß.Schnell wurde er zu einem Exper-ten von Laserdiagnostik-Verfahrenin der Biotechnologie und zum Ko-ordinator eines vom BMBF geför-derten Verbandes „Laserbiodyna-mik“ bestellt. Im Jahr 2000 war erwiederum maßgeblich an der Grün-dung einer Firma beteiligt: LaVisi-on-Biotec mit Sitz in Bielefeld.
Peter Andresen war ein heraus-ragender weltweit hoch geschätzterWissenschaftler, voller neuer, un-konventioneller Ideen. Er war je-derzeit offen für Diskussionen undimmer ansprechbar für seine Mit-arbeiter. Während seiner runddreißigjährigen wissenschaftlichenKarriere hat er viele Studenten,Postdocs und Gäste mit seinemElan angesteckt und geprägt.Freunde schätzten seine Lebenslust,sein unkompliziertes Auftreten undseinen Witz. Peter Andresen ent-sprach nicht dem typischen Bildeines deutschen Professors – undgerade dies machte ihn für viele,Wissenschaftler wie auch Nicht-wissenschaftler, so liebenswürdig.
Erhard W. RotheReinhard Schinke
Peter Andresen
Prof. Dr. Erhard W.Rothe, Wayne StateUniversity, Detroit;Dr.-habil. ReinhardSchinke, MPI fürStrömungsfor-schung, Göttingen