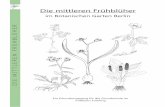Neue Politik für den Mittleren Osten: Wie kann der Stillstand in der Iranpolitik überwunden...
Transcript of Neue Politik für den Mittleren Osten: Wie kann der Stillstand in der Iranpolitik überwunden...
Bericht
Z Außen Sicherheitspolit (2014) 7:75–81DOI 10.1007/s12399-013-0388-2
Online publiziert: 19.12.2013 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2013
Dr. M. Schaper ()Evangelische Akademie Loccum, Münchehäger Str. 6, 31547 Loccum, DeutschlandE-Mail: [email protected]
Neue Politik für den Mittleren Osten: Wie kann der Stillstand in der Iranpolitik überwunden werden?
Marcus Schaper
1 Einleitung
Im Iran standen im Juni Wahlen und damit die Ablösung von Präsident Ahmadinedschad an. Irans schärfste Kontrahenten im Atomstreit, die USA und Israel, hatten selbst gerade neue Regierungen in ihre Ämter gewählt. Diese neue Konstellation führte schon im Frühjahr 2013 zu einer weniger aggressiven Rhetorik gegenüber dem Iran, als das noch während der Wahlkämpfe im Herbst 2012 der Fall war. Fortschritte in den Atomver-handlungen, die sich inzwischen bestätigt haben, wurden für die Zeit nach den iranischen Wahlen erwartet.
Im Kontext dieser Entwicklungen stellte sich die Frage, inwiefern die um 2009 vitalen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen im Iran (grüne Protestbewegung) wieder ein stär-keres politisches Gewicht gewinnen könnten. Könnte eine Entspannungspolitik gegen-über dem Iran nun sowohl eine neue Verhandlungsdynamik in den Atomgesprächen entfachen als auch die Demokratiebewegung im Iran stärken?
Im Vorfeld der iranischen Präsidentschaftswahlen sollte die Tagung an der Evange-lischen Akademie Loccum vom 17. bis 19. April 2013 herausarbeiten, wie die deutsche Iranpolitik neu ausgerichtet werden müsste, um Impulse zur Demokratisierung des Iran und zur Beilegung des Atomstreits liefern zu können. In den Tagungsdiskussionen stellte sich heraus, dass der inzwischen auch öffentlich aufgenommene direkte diplomatische Dialog zwischen den USA und dem Iran schon seit einigen Jahren vorbereitet wurde und dass direkte Gespräche zwischen den beiden Regierungen auch schon deutlich vor den iranischen Wahlen geführt wurden. Dabei zeigten die Tagungsgespräche auch den Weg für weitere produktive Verhandlungen mit dem Iran auf: eine ernsthafte Begegnung auf Augenhöhe, die den Iran als Regionalmacht im Mittleren Osten akzeptiert. Insgesamt lieferte die Tagung vier inhaltliche Kernaussagen:
76 M. Schaper
1. Eine Förderung der iranischen Zivilgesellschaft von außen kann nicht funktionieren, weil es keine unabhängige, den Staat herausfordernde Zivilgesellschaft im westlichen Sinn gibt. Das Staatssystem ist überall und lässt sich nicht von Wirtschaft oder Ge-sellschaft trennen. Einzig die Frauenbewegung fordert die staatliche und religiöse Autorität heraus. Das kann sie aber nur, weil sie Distanz zum Westen wahrt. Dennoch gibt es innerhalb des hoch komplexen und verwobenen Systems reichlich Dissens und unterschiedliche Lager.
2. Die Verengung westlicher Iranpolitik auf die mögliche nukleare Aufrüstung des Iran ist kontraproduktiv. In dieser Einengung ist keine Lösung, sondern allenfalls weite-re Zuspitzung zu erwarten. Vielmehr muss ein geostrategischer Austausch über die Rolle des Iran als Regionalmacht her. Dann wird auch die Atomfrage lösbar.
3. Die dafür erforderlichen direkten amerikanisch-iranischen Gespräche gab es schon, sie wurden nur noch nicht öffentlich gemacht. Ziel der USA ist eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen, sie erwägen die Einrichtung eines Liaison-Büros in Teheran. Die Regime Change-Agenda findet in den USA keine Unterstützung mehr.
4. Deutschland und die EU können besonders im Kontext der Atomgespräche zu einer Deeskalation beitragen, da die europäischen Sanktionen – natürlich in Verbindung mit entsprechenden iranischen Schritten – einfacher zurückzunehmen sind, als ameri-kanische, die die Zustimmung des Kongresses erfordern.
2 Politische Entwicklung im Iran
Kamran Safiarian, der beim ZDF das Forum am Freitag moderiert und im Auslands-journal über den Mittleren Osten berichtet, beschrieb die iranische Bevölkerung als sehr jung und gebildet. Über 50 % der Studierenden seien Frauen. Die Internetrevolution sei im Iran auf reichen Nährboden gefallen. Zugleich gäbe es mit rund 100 Tageszeitungen und 6000–7000 Nichtregierungsorganisationen (NGOs) eine lebendige Zivilgesellschaft. Walter Posch aus der Forschungsgruppe Naher/Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik verdeutlichte, dass unter den Zeitungen reiche Meinungsvielfalt herrsche, ein-schließlich reformorientierter Zeitungen, wenngleich diese leiser seien.
Adnan Tabatabai von der Humboldt Universität machte klar, dass man die iranische Zivilgesellschaft nicht mit der westlichen verwechseln dürfe. Die iranische Revolution sei ursprünglich sozial und von der Zivilgesellschaft angetrieben gewesen. Später sei es dann zu einer Verwebung von Staat und Religion und damit zur Ideologisierung gekom-men. Der Golfkrieg und besonders ihre Verdienste beim Aufbau danach habe die Revo-lutionsgarden gestärkt. Das Ergebnis sei eine Einbeziehung der Gesellschaft in den Staat im post-revolutionären Iran, moderiert u. a. durch religiöse Stiftungen und die Basidsch- Miliz. So sei die Gesellschaft nun durch viele teilautonome Gruppen strukturiert. Eine solchermaßen strukturierte Zivilgesellschaft muss nicht zwangsläufig zur Demokrati-sierung beitragen. Nabi Sonboli von der iranischen Botschaft unterstütze diese Sicht. Die Regierung kontrolliere alles; es gäbe nur einen kleinen Privatsektor und somit keine Grundlage für Parteien westlicher Prägung. Die Opposition sei Teil des Systems.
Zur Machtabsicherung habe das Regime den Basidsch-Apparat in Richtung kommu-nistischer Großparteien ausgebaut, erläuterte Posch. Ursprünglich angelegt als Miliz
Neue Politik für den Mittleren Osten: Wie kann der Stillstand … 77
von Kindersoldaten zur Minenräumung im Golfkrieg böten die Basidsch heute für viele Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg. Zwar hätten die Miliz und ihre Schlägertrupps als Hilfspolizei grandios versagt, aber sie lieferten ganz nach Manier von Blockwarten einen effektiven Aufklärungsdienst. Safiarian sieht den Iran mit der zunehmenden Kontrolle der Revolutionsgarden, denen auch die Basidsch zugeordnet sind, auf dem Weg in eine Militärdiktatur. Für Posch halten sich im Iran hingegen drei verschiedene Militärapparate gegenseitig unter Kontrolle.
Lediglich der Frauenbewegung billigt Posch Demokratisierungspotenzial zu; aber diese wolle bewusst keine westliche Unterstützung. Die grüne Bewegung hätte ein Trans-formationsschritt des Reformlagers, der islamischen Linken sein können, aber es sei frag-lich, ob die Protestierer das wollten. So würde er bei der 2009er Bewegung nicht von einem Aufstand reden wollen und erwarte auch für die Wahlen im Sommer 2013 keinen. Es gäbe im Iran keine nennenswerte demokratische Kultur. Im Mainstream seien zwar säkulare Kräfte vorhanden, die 1982 den Bürgerkrieg verloren hätten, aber sie bildeten keine eigenständige politische Kraft. Insgesamt hätten bürgerliche Kreise nur wenig zur Demokratie beigetragen.
Trotz einer Reihe von sozialen Verwerfungen (inner-iranische Migration, Arbeiter-streiks, Arbeiterbewegung) sieht Tabatabai zwischen den unterschiedlichen Protestbewe-gungen kaum Schulterschlüsse. Zwar herrsche eine große Frustration vor, sagte Posch, aber die Flexibilität des Sicherheitsapparats sei groß genug, um sich an neue Gegeben-heiten anpassen zu können. Der Organisationsgrad der Opposition reiche nicht aus, um etwas zu bewegen.
Mit der Frage, wie man ein Rentiersystem privatisiere, stände der Iran vor einem typi-schen Entwicklungsproblem für Länder mit Bodenschätzen. Die Proteste seien auf Basis von Enttäuschung über gescheiterte Privatisierung entstanden, aber im Westen leicht missverstanden worden, gab Posch zu bedenken. Der Journalist Ulrich Tilgner ordnet die sozialen Proteste ähnlich ein: Das Anwachsen der Stadtbevölkerung habe zu einer Verschiebung der Koordinaten geführt und die Staatsführung bemühe sich, potenzielle Opposition durch Umverteilung ruhig zu stellen. Posch bezeichnete politischen Dissens als den Kitt, der die Islamische Republik zusammenhalte; selbst Tabuthemen wie Föde-ralismus würden diskutiert. Letztlich ginge es in vielen Konflikten um den kulturellen Habitus: westlich vs. islamisch-traditionell.
3 Demokratie/Menschenrechte/Regime Change
Es ist klar, dass demokratische Reformen im Iran noch erarbeitet werden müssen, wie Posch anmahnte, als er den Iran als zwischen Demokratie und Diktatur stehend beschrieb. Auch für Safiarian ist klar, dass der Wandel von innen kommen müsse und auch er gab zu bedenken, wie es um die demokratische Praxis und Institutionen stehe.
Der westliche Reflex ist es, zur externen Unterstützung von Demokratisierungsprozes-sen die Zivilgesellschaft zu unterstützen und zu mobilisieren. Neben dem oben skizzierten Fehlen einer Zivilgesellschaft westlicher Prägung dürfte ein solches Vorhaben aber auch an der eigenen Revolutionserfahrung der Staatsführung scheitern. Wie Posch feststellte, würde im Iran nicht nur die Bedeutung von Internet und Kommunikation bestens ver-
78 M. Schaper
standen, sondern das Regime wäre mit den Strategien Gene Sharps aus eigener Erfahrung bestens vertraut. Das Projekt „weicher Krieg“ fuße also auf einer westlichen Naivität und Verantwortungslosigkeit. Nicht ohne Grund seien alle für das Regime gefährlichen Parteien aufgelöst. Helfen könne nur ein offener Dialog mit denen, die radikale Positio-nen vertreten. Für einen solchen Menschenrechtsdialog traten fast alle Referenten ein. Der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ehemalige Botschafter in Teheran, Paul Freiherr von Maltzahn, beschrieb das als eine Aufgabe für Wissenschaft und Politik. Tabatabai machte klar, dass dieser Dialog auf leisen Socken geführt werden müsse, es gelte auf Medienwirksamkeit zu verzichten.
4 Nukleare Ambitionen
Der Streit über das iranische Atomprogramm, insbesondere darüber, ob der Iran Uran-anreicherung nur für zivile Zwecke oder möglicherweise auch für ein militärisches Pro-gramm betreibt, steht derzeit an vorderster Front westlicher Iranpolitik. Andere Aspekte westlicher Iranpolitik wie Demokratie, Menschenrechte oder Geostrategie, werden in der Regel mit dieser Thematik in der öffentlichen Diskussion in einer Weise verwoben, dass unklar wird, welche Politiken welchen Zielen dienen, wie sie sich untereinander bedin-gen und wie Fortschritte über weitere Politikfelder zu realisieren sind. Eine realistische Position dürfte allerdings sein, dass die Lösung der Atomfrage nicht zur Vorbedingung für Gespräche in anderen Bereichen gemacht werden darf. Vielmehr scheint der Schlüssel zur Lösung des Atomstreits gerade in der offenen Thematisierung anderer geostrategi-scher Fragen zu liegen.
Seitens iranischer Regierungsstellen wird auf eine Fatwa, also ein islamisches Rechts-gutachten, verwiesen, dass Massenvernichtungswaffen und somit auch Atomwaffen unislamisch seien. So bezeichnete auch der iranische Botschafter Ali Reza Scheikh Attar die Fatwa als ein gutes Signal, dass der Iran alle westlichen Werte der Ablehnung von Massenvernichtungswaffen anerkenne. Kamran Safiarian vom ZDF gab zu beden-ken, dass auch eine Fatwa umgehbar sei, wenn die Existenz der islamischen Republik bedroht sei. Von Maltzahn schlug vor, die Fatwa zu säkularisieren, indem der Iran sie als UN-Dokument deponiere.
Aufgrund der Unklarheit über den Status einer atomaren Aufrüstung des Iran, richtet sich viel Aufmerksamkeit auf die Transparenz im gesamten iranischen Atomprogramm, um Misstrauen abzubauen. Dass ein atomares Iran als Gefahr gesehen würde, dürfe dabei nicht überraschen, meinte Safiarian. Schließlich habe der Iran die Kontrolleure der Interna-tionalen Atomenergieorganisation (IAEO) hintergangen, es gäbe weiterhin Hinweise auf ein militärisches Programm und es gäbe geheime Anlagen, wahrscheinlich einschließlich einer zweiten Plutoniumfabrik. Götz Neuneck vom Hamburger Institut für Friedensfor-schung und Sicherheitspolitik nannte als Lösung die dauerhafte Umsetzung des Zusatz-protokolls zum Nichtverbreitungsvertrag, das u. a. unangemeldete Kontrollen gestattet. Zudem sollte der Iran in Planung und Bau befindliche nukleare Anlagen melden und Pro-jekte mit einer möglichen militärischen Dimension offenlegen. Im Sinne von Transparenz schlägt der Atomexperte des Bonner Konversionszentrums, Jerry Sommer, als Bestandteil einer Zwischenlösung die 24-Stunden Anwesenheit von IAEO-Personal vor.
Neue Politik für den Mittleren Osten: Wie kann der Stillstand … 79
Bei alledem sei zu beachten, dass das Atomprogramm im Iran als nationale Angele-genheit gelte, gab Safiarian zu bedenken. Kazem Sadjadpour, der in der Akademie für internationale Beziehungen des iranischen Außenministeriums lehrt, betonte die symbo-lischen Aspekte des Atomprogramms; es sei eine große Errungenschaft für die iranische Revolution. Daher spreche man bei der Kontrolle und Beschränkung des Programms nicht über eine einfache Sache. Solche Symbole spielten eine wichtige Rolle. Folglich sei in der Atomfrage neben den internationalen und regionalen Kontexten auch der nationale zu bedenken.
5 Urananreicherung
Lange herrschte die Maximalforderung vor, dass der Iran auf Urananreicherung völlig verzichten möge, um jegliches Waffenpotenzial auszuschließen. Jerry Sommer unter-strich, dass diese Forderung nicht durchsetzbar und auch nicht notwendig sei, wenn man sich auf strengere Kontrollen einigen und das Zusatzprotokoll anwenden würde. Da mit Blick auf eine dauerhafte Lösung auch eine Veränderung der regionalen Sicherheitsarchi-tektur erforderlich sei, solle man als Zwischenlösung die Anreicherung zunächst auf 20 % beschränken. Auch der Vorschlag des britischen Botschafters Jenkins, aus dem im Iran angereicherten Uran im Ausland Brennelemente herzustellen, könnte Teil einer solchen Zwischenlösung sein. Bei alledem gelte es, das prinzipielle Recht des Iran auf Anreiche-rung anzuerkennen. Voraussetzung sei natürlich, dass man eine echte Lösung wolle und den Streit über das Atomprogramm nicht nur als Vorwand nutze.
Die verfahrene Situation in den 5 + 1-Verhandlungen wurde im Austausch zwischen Sadjadpour und dem ehemaligen BND-Chef und Staatssekretär August Hanning, der jetzt das Institute for Strategic Dialogue und die Initiative United Against Nuclear Iran berät, klar. Hanning forderte konkrete Schritte seitens des Iran ein, die belegen, dass sich der Iran nicht nuklear bewaffnen wolle. Dazu zählte er die Begrenzung der Anreicherung, den Verzicht auf den Schwerwasserreaktor in Arak, den auch Neuneck als überdimensioniert bezeichnete, sowie Transparenz durch Inspektionen und die Umsetzung des Zusatzproto-kolls. Die Aufgabe der Anreicherung in Fordo wäre für den Iran kein Opfer, da das keine substanziellen Einbußen bedeuten würde, aber ein starkes Signal.
Sadjadpour hingegen bemängelte die Reduzierung westlich-iranischer Verhandlun-gen auf die militärische Dimension des iranischen Nuklear-Dossiers. Dadurch würde in der westlichen Wahrnehmung ein sehr verzerrtes Iran-Bild geschaffen. Der Iran sei eine regionale Macht, deren Legitimität durch die Revolution bestätigt sei. Als solche wolle man auch anerkannt werden. Zu Transparenz sei man bereit, wenn auch der Westen Transparenz zeige. Die iranische Erfahrung sei, dass man vieles getan habe, um das Pro-gramm offenzulegen. Je mehr man aber gegeben habe, desto mehr sei verlangt worden. Folglich habe man das Vertrauen in den Verhandlungsprozess verloren. Eine Lösung sei die Anerkennung der iranischen Rechte unter dem Nichtverbreitungsvertrag verbunden mit der Aufhebung der Sanktionen und der Rückverlagerung der Verhandlungen in den Kontext der IAEO.
80 M. Schaper
6 Geostrategie auf Augenhöhe
Neben dem Atomstreit und der Einforderung von Demokratie und Menschenrechten sind die westlichen – und insbesondere die amerikanischen – Beziehungen zum Iran geprägt von einer Konkurrenz um den Einfluss im Nahen Osten. In der öffentlichen Darstellung treten dabei die geostrategischen Aspekte in den Hintergrund. Es entsteht dann leicht der Eindruck, dass es lediglich um atomare Nichtverbreitung und Menschen-rechte und damit um die Einforderung international respektierter Standards ginge. Fort-schritt in diesen Bereichen kann aber nur dann gelingen, wenn sie nicht als Deckmantel geostrategischer Erwägungen benutzt werden, sondern die strategischen Fragen ebenso offen und voneinander unabhängig bearbeitet werden.
Für Safiarian bedeutet eine solche westlich-iranische Begegnung auf Augenhöhe, dass auf Drohungen verzichtet, das zivile Atomprogramm anerkannt und Sanktionen gelo-ckert werden müssten. Ein solcher Paradigmenwechsel würde es erlauben, Verhand- lungen ohne Vorbedingungen zu führen, Sicherheitsgarantien zu entwickeln und den Iran als Stabilitätsfaktor zu gewinnen. Zugleich gelte es, beim Menschenrechtsdialog trotz-dem hart zu bleiben und die Zivilgesellschaft zu stärken, die schließlich die am weitesten entwickelte in der islamischen Welt sei.
Am 18. April wurde der neue Bericht des Iran Project „Strategic Options for Iran: Balancing Pressure with Diplomacy“1 zeitgleich in Loccum und Washington vorgestellt, der strategische Optionen für die amerikanische Iran-Diplomatie aufzeigt. Die Vorschläge des Reports deckten sich weitgehend mit den Überlegungen des deutsch-amerikanisch-iranischen Strategenpodiums der Loccumer Tagung, in das Freiherr von Maltzahn (ehe-maliger deutscher Botschafter in Teheran), der Direktor des Berliner Aspen Instituts, Charles King Mallory IV und der iranische Botschafter Attar ihre Gedanken einbrachten.
Eine Begegnung auf Augenhöhe erfordere eine grundsätzliche neue Perspektive auf die Verhandlungen. Beide Seiten müssten schlechte Erfahrungen hinter sich lassen und die Gründe für die Verbitterung auf beiden Seiten akzeptieren, so Mallory. Das bedeute auch, die islamische Republik und deren Regierung anzuerkennen. Politisch sei das weni-ger ambitioniert, als es zunächst erscheine, da sich die meisten Amerikaner nicht für den Iran interessierten und auch die Regime Change-Agenda nur von einer Minderheit unter-stützt würde. Insgesamt müsse die Zielsetzung bilateraler Verhandlungen die Normalisie-rung der amerikanisch-iranischen Verhältnisse sein.
Botschafter Attar beschrieb die Schritte, die Verhandlungen aus iranischer Sicht nach-einander nehmen sollten. Zunächst erwarte der Iran Anerkennung – sowohl mit Blick auf die Nichteinmischung in seine inneren Angelegenheiten als auch mit Bezug auf seine Rolle als Regionalmacht. Dabei solle besonders im Kontext der Sanktionen auf Diskrimi-nierung und Doppelmoral verzichtet werden. Für Attar gehört dazu auch eine Anerken-nung der iranischen Ablehnung von Massenvernichtungswaffen. Die Fatwa sei ein vom Westen unterschätztes gutes Signal.
Mallory hingegen hielt es für hilfreicher, auf einer höheren Ebene des Dialogs anzu-setzen: die USA müssten klar machen, dass sie keinen regime change im Iran wollten.
1 Online unter: http://www.cfr.org/iran/iran-project-strategic-options-iran-balancing-pressure-di-plomacy/p30487.
Neue Politik für den Mittleren Osten: Wie kann der Stillstand … 81
Aber natürlich gäbe es auch für die USA eine Reihe grundlegender Positionen: das Exis-tenzrecht Israels sei für die USA zentral; die USA wollten eine konstruktive Rolle des Iran im Nahost-Friedensprozess, was Waffenlieferungen an die Hisbollah ausschließe; die Pasadaran dürften sich nicht destabilisierend in den Golf-Anrainerstaaten einmischen; und schließlich müsse das Atomprogramm verifizierbar gemacht werden.
Attar und Mallory unterstrichen, dass die Türen für den Dialog offen seien und Gesprä-che auf den unterschiedlichsten Kanälen geführt würden. In den Atomverhandlungen liegt eine Lösung mit der Begrenzung der Anreicherung auf 20 % im Gegenzug zur Auf-hebung von Sanktionen auf dem Tisch. Bei der Rücknahme von Sanktionen könnte die EU eine führende Rolle übernehmen, da dieses einfacher sei, als die dafür im US-Kon-gress erforderliche Mehrheit zu erreichen, schlug von Maltzahn vor. Mallory meinte, dass mit Begründung des Nationalen Interesses Sanktionen auch schrittweise im Kongress aufgehoben werden könnten.
Die in Loccum skizzierte Verhandlungsagenda verspricht wirklichen Fortschritt in den Beziehungen mit dem Iran. Die große Herausforderung wird es sein, die Gespräche auf geostrategischer Augenhöhe zu halten und nicht wieder in die alte Dynamik einseitiger Forderungen abgleiten zu lassen. Die jüngste Einbeziehung der Außenminister in die 5 + 1-Gespräche sollte ein starkes Signal sein, dass die Verhandlungen unter dem neuen Präsidenten Rohani dank der Vorbereitungen der letzten Jahre die allseits gewünschte neue Dynamik entfalten können.