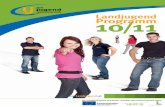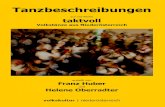Optimierung der Sammlung und Behandlung von Grün- und Bioabfällen aus der kommunalen Sammlung in...
-
Upload
christiane -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
Transcript of Optimierung der Sammlung und Behandlung von Grün- und Bioabfällen aus der kommunalen Sammlung in...

Praxisthema
126 Optimierung der Sammlung und Behandlung von Grün- und Bioabfällen aus der kommunalen Sammlung in Niederösterreich
Zusammenfassung In Niederösterreich wurden im Jahr 2010 123.000 t biogene Abfälle in der Biotonne und 104.000 t Grünschnitt gesammelt. Aus den jeweils größten Sammelmengen in städtischem bzw. ländlichem Gebiet wurden nieder-österreichweit die Steigerungspotenziale berechnet. In Abhängigkeit von ausge-wählten Charakteristika der Verbände entstand aus diesen Berechnungen das 3-Optionen-Modell zur optimierten Sammlung biogener Abfälle in NÖ.
Im 3-Optionen-Modell werden die Ab-fallwirtschaftsverbände nach bestimmten Schlüsselkriterien in 3 Gruppen einge-teilt. In der ersten Gruppe liegt die Opti-mierung in der Qualitätsverbesserung der Eigenkompostierung sowie im Ausbau der Qualitätskontrolle und der Beratungs-tätigkeit. In der zweiten Gruppe wird die Sammelinfrastruktur so ausgebaut, dass die Sammelmengen entsprechend den in ähnlich strukturierten Gebieten größten Sammelmengen gesteigert werden. In der dritten Gruppe soll durch starken Aus-bau der Infrastruktur der Anschlussgrad an die Biotonne im Vergleich zum Status quo um 20 % gesteigert, das Abholinter-vall auf 41 Abholungen pro Jahr erhöht und das Mindestvolumen der Biotonnen mit 120 Litern festgelegt werden.
Die Behandlung der Bioabfälle und des Grünschnitts soll nach stofflichen Kriterien erfolgen. An einer kostengüns-tigen Vergärung von Bioabfällen aus Haushalten wird eifrig geforscht. Funk-tioniert diese, dann könnte – nach der Schätzung der Autoren der Studie – nach
Aufbereitung der Bioabfälle aus etwa 40 % der gesammelten Menge vor der Kompostierung Energie gewonnen wer-den. Die Kompostierung erfolgt in Nie-derösterreich in erster Linie in kleinen bis mittelgroßen Kompostanlagen.
Die Studie zeigt: z Eine Steigerung der Sammelmenge ist
niederösterreichweit um 100 % mög-lich.
z Bei der Kompostierung und insbeson-dere bei der Biogasgewinnung sind an-lagentechnische Veränderungen nötig.
z Bei einer Steigerung der Sammelmen-gen und zielgerichteten Stoffströmen kommt es zu einer Win-win-Situation für alle Anlagenbetreiber.
Die Studie wurde von wpa Beraten-de Ingenieure erstellt (Autoren: DI Ilja Messner, DI Florian Amlinger und DI Dr. Michael Pollak), sie steht unter www.noe.gv.at/Umwelt/Abfall/StudienTrends.html zum Download zur Verfügung.
1. Einleitung
Bioabfälle und Grünschnitt sind wert-volle Rohstoffe. Und zwar insbesondere als Dünger und Strukturmaterial für die Böden: Mit hochwertigem Kompost wer-den dem Boden alle für das gute Wachs-tum der Pflanzen benötigten Nähr- und Mineralstoffe zugeführt. Gleichzeitig wird der Boden mit Humus angereichert, der die Nährstoffe im Boden hält bzw. nach und nach für die Pflanzen verfüg-bar macht sowie den Wurzeln optimales Umfeld gewährleistet.
Gewisse Bioabfälle aus Haushalten eignen sich zur Energiegewinnung durch Vergärung, andere durch Verbrennung. Zur Vergärung bedarf es bestimmter Technik, welche derzeit im Vergleich zur gegenwärtigen Bioabfallverwertung in Niederösterreich sehr kostspielig ist. Zur Verbrennung dürfen nur biogene Abfälle mit weniger als 10 % Aschegehalt – bezo-gen auf die Trockenmasse – und weniger
als 10 % Masseanteil kleiner als 8 mm ge-langen. Grundsätzlich ist entsprechend der Abfallhierarchie die stoffliche der energetischen Verwertung vorzuziehen.
Bioabfälle müssen laut Bioabfallver-ordnung, BGBl. Nr. 68/1992 idF BGBl. Nr. 456/1994, getrennt gesammelt wer-den, es sei denn, sie werden ordnungs-gemäß kompostiert. Ordnungsgemäße Eigenkompostierung belastet die Um-welt minimal – durch die Verwendung des gewonnenen Kompostes im eigenen Bereich ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass nur wirklich kompostierbares Material auf den Komposthaufen gelangt, motorisierte Transporte sowohl des Bio-abfalls als auch des gewonnenen Substra-tes entfallen. Wenn Eigenkompostierung nicht möglich ist, belastet ordnungsge-mäße Kompostierung in Kleinanlagen nahe dem Anfallsort der Bioabfälle mit Ausbringung des erzeugten Substrates vor Ort am wenigsten. Darum lautet die niederösterreichische Kompoststrategie:
z so viel Eigenkompostierung wie mög-lich,
z Bioabfallsammlung, wenn keine Eigenkompostierung möglich,
z so viel landwirtschaftliche Kompostie-rung wie möglich,
z so viele dezentrale Kleinanlagen wie möglich,
z so wenig regionale Anlagen wie nötig.
Laut Abfallwirtschaftsplan 2010–2015 sol-len sowohl möglichst viele Nährstoffe als auch möglichst viel Energie aus Bioabfäl-len genutzt werden. Um dies zu erreichen, wurde die Studie „Optimierung der Samm-lung und Behandlung biogener Abfälle in Niederösterreich zur Entwicklung von optimierten Szenarien mit dem Status quo als Grundlage“ in Auftrag gegeben.
2. Status quo 2010
Zur Darstellung der Entwicklung der kommunalen Sammlung biogener Abfälle in Niederösterreich dienten die Daten der
Österr Wasser- und Abfallw (2014) 66:126–130DOI 10.1007/s00506-014-0147-1
Optimierung der Sammlung und Behandlung von Grün- und Bioabfällen aus der kommunalen Sammlung in NiederösterreichChristiane Hannauer
DI C. Hannauer ()Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr, Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft, Sachgebiet Abfallwirtschaft und Ressourcenschonung,Landhausplatz 1, Haus 16, Zi. 518a,3109 St. Pölten, ÖsterreichE-Mail: [email protected]
Online publiziert: 3. April 2014© Springer-Verlag Wien 2014

Praxisthema
Optimierung der Sammlung und Behandlung von Grün- und Bioabfällen aus der kommunalen Sammlung in Niederösterreich 127
Abfallwirtschaftsberichte der Jahre 2004 bis 2009 sowie eine Erhebung für das Jahr 2010. Für die Darstellung des biogenen Abfallaufkommens und die Hochrech-nungen kam das BOKU-Schichtenmodell, entwickelt im Rahmen der Restmüllsor-tieranalyse NÖ 2005, zum Einsatz. Die Zuordnung der Gemeinden zu Schichten erfolgt anhand folgender Indikatoren:
z Kaufkraftkennziffer je Einwohner/in, z Siedlungsdichte, z Haushaltsgröße, z Anteil Beschäftigte im primären Sektor
(Land- und Forstwirtschaft) (Tab. 1).
In Niederösterreich werden biogene Küchenabfälle sowie Laub und Gras-schnitt im Holsystem Biotonne gesam-melt. Während das Angebot der Biotonne nahezu flächendeckend eingeführt ist, beträgt der mittlere Anschlussgrad nur etwa 36 %. Der Anschlussgrad der Haus-halte an die Biotonne unterscheidet sich signifikant nach Schicht und beträgt in der Stadt im Mittel etwa 53 %, im Dorf 36 % und in Streulage nur etwa 25 %.
Die Sammlung von Laub und Gras-schnitt sowie Baum- und Strauchschnitt erfolgt im Bring- und Holsystem. Dabei kommt dem Bringsystem eine überge-ordnete Rolle zu. Etwa 84 % der Gemein-den verfügen über ein Bringsystem, in 67 % der Gemeinden ist ausschließlich das Bringsystem verfügbar. Der Anteil der Gemeinden, die ausschließlich über ein Holsystem für die Sammlung von Grün-schnitt verfügen, beträgt 5 %. In 17 % der Gemeinden sind Hol- und Bringsyste-me verfügbar. Im Bringsystem erfassen Altstoffsammelzentren etwa 81 % der Massen des gesammelten Grünschnitts.
Das erfasste Aufkommen im System „Biotonne“ betrug im Jahr 2010 123.300 t, jenes aus der Grünschnittsammlung 104.000 t. Davon gingen 195.700 t in die Kompostierung, 21.600 t in Biomas-se(heiz)kraftwerke und etwa 10.000 t in Biogasanlagen (siehe Abb. 1).
Abb. 2 Zusammenhang zwischen Anschlussgrad und Sammelmenge in der Bio-tonne (Abb. 7-2 der Studie)
Abb. 1 Stoffströme kommunal gesammelter biogener Abfälle in Niederösterreich 2010 (Abb. 5-16 der Studie)
Tab. 1 Schichtenmodell BOKU 2005 (Tab. 3-3 der Studie)
Bezeichnung
(BOKU)
Charakteristika Kurzbeze-
ichnung
Schicht 1 Städtisches Gebiet (suburban bis urban)
Stadt
Schicht 2 Ländliches Gebiet (Streusiedlung mit Zentrum)
Dorf
Schicht 3 Ländliches Gebiet in Streulage; stark landwirtschaftlich geprägt
Streulage

Praxisthema
128 Optimierung der Sammlung und Behandlung von Grün- und Bioabfällen aus der kommunalen Sammlung in Niederösterreich
Einige Zusammenhänge zwischen Logistik, Struktur, Aufkommen und Verwertung:
Je höher der Anschlussgrad an die Bio-tonne, desto höher die Sammelmenge je
Einwohner/in gesamt [kg/EW_gesamt] (Abb. 2).
Je höher der Anschlussgrad, desto ge-ringer die Sammelmengen je angeschlos-senem/-er Einwohner/in [kg/EW_ang.] (Abb. 3).
Je höher der Anschlussgrad an die Bio-tonne, desto höher die Sammelmenge an Grünschnitt [kg/EW_gesamt] (Abb. 4).
Je mehr Sammelbehälter-Volumen zur Verfügung gestellt wird, umso höhere Sammelmengen können erzielt werden (Abb. 5).
Je höher die Sammeleffizienz in der Biotonne, umso weniger Grünschnitt-mengen werden im Bringsystem gesam-melt (Abb. 6).
Je höher der Anschlussgrad an die Biotonne, umso weniger Eigenkompos-tierung findet statt. Damit verbunden ist auch eine Erhöhung des Baum- und Strauchschnittaufkommens auf den Grünschnittsammelplätzen.
Interessanterweise bringt ein Holsys-tem für Grünschnitt keine größeren Sam-melmengen als ein Bringsystem (Abb. 7).
3. Ermittlung der „High Performance“
Für die Ermittlung der „High Perfor-mance“ wurde eine Analyse nach Schich-ten und Verbänden vorgenommen. Dabei wurden die Sammelmengen je Einwohner/in gesamt verbandsweise für jede Schicht getrennt betrachtet. Als „High Performance“ wurde schließlich jene Sammelmenge bezeichnet, die ein Verband in einer Schicht im Jahre 2010 erreichen konnte (höchster Median bei geringster Streuung).
Das Sammelpotenzial in der Biotonne betrug bei Ermittlung der Steigerungs-potenziale anhand von „High Perfor-mance“-Verbänden 176.500 t. Bei einem tatsächlichen Sammelaufkommen von 123.300 t entspricht das einem Steige-rungspotenzial von etwa 53.200 t bzw. 43 %.
Geht man von einer Optimierung der Sammelinfrastruktur hinsichtlich An-schlussgrad und dem bereitgestellten Volumen aus, so beträgt das Sammel-potenzial 271.000 t. Das entspricht einem Steigerungspotenzial von etwa 147.700 t bzw. 120 %.
Abgeleitet aus den höchsten erzielba-ren Sammelmengen für Grünschnitt er-gibt sich ein Sammelpotenzial über das Bringsystem von 292.800 t. Damit beträgt das Steigerungspotenzial für die Samm-lung des Grünschnitts im Bringsystem etwa 188.800 t oder 182 %.
4. Szenario 3-Optionen-Modell
Das Szenario 3-Optionen-Modell geht von einer differenzierten Weiterentwick-lung der Sammlung und Behandlung
Abb. 3 Zusammenhang zwischen Anschlussgrad und Sammelmenge je an die Bio-tonne angeschlossenem EW (Abb. 7-4 der Studie)
Abb. 4 Zusammenhang zwischen Anschlussgrad und Sammelmengen an Grün-schnitt (Abb. 7-5 der Studie)

Praxisthema
Optimierung der Sammlung und Behandlung von Grün- und Bioabfällen aus der kommunalen Sammlung in Niederösterreich 129
biogener Abfälle in Abhängigkeit von aus-gewählten Charakteristika der Verbände aus. Die Verbände werden dazu nach drei Schlüsselkriterien in drei Gruppen einge-teilt (siehe Tab. 2). Als wichtigstes Krite-rium wird der Anteil der biogenen Abfälle
im Restmüll definiert: Je mehr biogene Abfälle im Restmüll landen, umso höher ist der Handlungsbedarf für eine ver-stärkte Getrenntsammlung der biogenen Abfälle. Als weiteres Kriterium fungieren der Handlungs- und Investitionsbedarf
zur Steigerung der Sammelmengen in der Biotonne im Vergleich zur fiktiven Modellregion. Dieser Bedarf wird anhand der Differenz zwischen der aktuellen spe-zifischen Sammelmenge und der in der Modellregion erzielbaren Sammelmenge (Δ Biotonne) bewertet. War eine eindeu-tige Zuordnung eines Verbands zu einer Gruppe anhand dieser beiden Kriterien nicht möglich, wurde ergänzend die noch nicht genutzte vorhandene Anlagenkapa-zität herangezogen.
Im 3-Optionen-Modell ergibt sich für die Verbände jeder Gruppe ein anderer Handlungsbedarf hinsichtlich der Gestal-tung der Sammelinfrastruktur, beschrie-ben in der Tab. 3.
Bei einer Entwicklung ganz Niederös-terreichs nach dem 3-Optionen-Modell beträgt das Sammelpotenzial für die bio-genen Abfälle in der Biotonne 228.112 t, jenes für die Sammlung des Grünschnitts im Bringsystem 245.433 t. Gegenüber den Sammelmengen des Jahres 2010 bedeutet dies ein Steigerungspotenzial von 85 % für die Sammlung in der Biotonne und 136 % in der Grünschnittsammlung (sie-he Tab. 4).
5. Stoffströme im 3-Optionen-Modell
Bei entsprechender Aufbereitung eignen sich nach Schätzung der Studienautoren 40 % der biogenen Abfälle aus der Bio-tonne für die Vergärung in Biogasanla-gen, wobei in NÖ erst eine entsprechende Anlage mit einem akzeptablen Übernah-mepreis gebaut werden müsste. Laub und Grasschnitt werden ausschließlich der Kompostierung zugeführt. Etwa 30 % des getrennt erfassten Baum- und Strauch-schnitts taugen zur thermischen Verwer-tung in Biomasse-HKW. Die Stoffströme
Abb. 6 Zusammenhang zwischen der Sammelmenge an Grünschnitt und der Sam-meleffizienz bei der Biotonne (Abb. 7-8 der Studie)
Abb. 5 Zusammenhang zwischen verfügbarem Volumen und Sammelmenge je an-geschlossenem EW (Abb. 7-6 der Studie)
Abb. 7 Sammelmengen an Grünschnitt in Abhängigkeit vom Sammelsystem (Abb. 7-9 der Studie)

Praxisthema
130 Optimierung der Sammlung und Behandlung von Grün- und Bioabfällen aus der kommunalen Sammlung in Niederösterreich
für das Szenario 3-Optionen-Modell sind in Abb. 8 dargestellt.
6. Fazit
Abschließend kann zur Optimierung der Sammlung und Behandlung kommuna-ler biogener Abfälle in Niederösterreich festgehalten werden:
z Die Sammelmengen im 3-Optionen-Modell sind aus gegenwärtig in NÖ mancherorts erreichten Sammelmen-gen errechnet und daher realistisch.
z Zur Verwertung nach stofflichen Krite-rien müssen Grün- und Bioabfälle auf-bereitet werden – es ist noch zu klären, wer den Aufwand trägt bzw. ob er sich rechnet.
z Um eine gute Kompostqualität sicher-zustellen, muss gewährleistet sein, dass genügend Strukturmaterial in die Kompostanlagen gelangt. (Tendenz derzeit: Auch nicht gut brennbarer Baum- und Strauchschnitt wird ver-brannt, der im Kompost fehlt und für die Verbrennungsanlage schlecht ist!)
z Die Einsatzmöglichkeit von Abfällen aus der Biotonne in derzeit in NÖ be-triebenen Biogasanlagen muss geprüft und ggf. die Technik angepasst wer-den.
z Die Technik der dezentralen Kompost-anlagen kann vielerorts optimiert wer-den.
Informationen:DI Christiane HannauerAmt der NÖ LandesregierungGruppe Raumordnung, Umwelt und VerkehrAbteilung Umwelt- und EnergiewirtschaftSachgebiet Abfallwirtschaft und RessourcenschonungLandhausplatz 1, Haus 16, Zi. 518a, 3109 St.PöltenTel.: +43-2742-9005-14323, Fax [email protected]
Tab. 2 Kriterien zur Einteilung der Verbände in Gruppen (Tab. 12-7 der Studie)
Gruppe
Kein Infrastrukturausbau Infrastrukturausbau Modellregion Infrastrukturausbau ModellregionPLUS
Biogene Abfälle im Restmüll < 15 [kg/EW_gesamt]
Biogene Abfälle im Restmüll15–20 [kg/EW_gesamt]
Biogene Abfälle im Restmüll > 20 [kg/EW_gesamt]
∆ Biotonne zu Modellregion > 50 [kg/EW_gesamt]
∆ Biotonne zu Modellregion25–50 [kg/EW_gesamt]
∆ Biotonne zu Modellregion < 25 [kg/EW_gesamt]
Vorhandene freie Behandlungskapazitäten< 3.000 [t/a]
Vorhandene freie Behandlungskapazitäten< 3.000 [t/a]
Vorhandene freie Behandlungskapazitäten> 3.000 [t/a]
Qualitätsverbesserungder Eigenkompostierung
Entwicklung zur Modellregion
Entwicklung zur Modellregion plus
3-Optionen-Modell
Ausbau derQualitätskontrolle und
Beratungstätigkeit Moderater Ausbau der Sammelinfrastruktur
Starker Ausbau der Sammelinfrastruktur
Tab. 4 Sammel- und Steigerungs-potenzial im Szenario „3-Optionen-Modell“ (Tab. 12-10 der Studie)
Biotonne Grün-
schnitt
gesamt
Sammel-potenzial [t]
228.112 245.433 473.545
aktuelle Sammelmen-ge [t]
123.283 104.000 227.283
Steigerungs-potenzial [t]l
104.829 141.433 246.262
Steigerungs-potenzial [%]
85 136 108 Tab. 3 3-Optionen-Modell (Tab. 12-9 der Studie)
Abb. 8 Stoffströme im Szenario 3-Optionen-Modell (Abb. 12-3 der Studie)