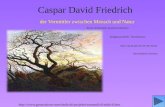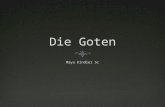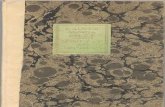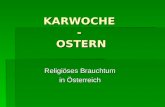Orpheus in der Spätantike (Studien und Kommentar zu den Argonautika des Orpheus: Ein literarisches,...
Transcript of Orpheus in der Spätantike (Studien und Kommentar zu den Argonautika des Orpheus: Ein literarisches,...

210 Die Vorgeschichte der Fahrt
des Neuen, das Orpheus seinem Adressaten mit der Erzählung der Argo-nautenfahrt mitteilen möchte und das er „niemals zuvor im Munde führte“(AO 8f.: µ« ,. " % Κ | 3’), wird demRezipienten der AO gegen Ende des Proöms noch einmal deutlich vor Au-gen geführt: .9 $ ’ π"« ,« !²" λ 3. Damitmacht der Verfasser der AO, wie Luiselli (1993), S. 299–301 richtig beobach-tet hat, unmissverständlich klar, dass sich die folgende Dichtung deutlichvon anderer (orphischer) Dichtung unterscheiden soll. Gleichzeitig verdeut-licht das Motiv des Neuen, bisher Verborgenen wie kein anderes den An-spruch unseres Dichters, in der Tradition seines hellenistischen VorgängersApollonios wie dieser anspruchsvoll zu dichten und dem alexandrinischenIdeal der „unbetretenen Pfade“ (prägnant bei Kallimachos, Aitien-Prolog25–28) gerecht zu werden. Wichtig ist drittens auch, dass der alte Orpheusnicht nur bislang Unbekanntes, Neues berichten wird, sondern dass auchsein eigener Zustand nicht mehr der desjenigen ist, der all das vollbrachte,was in den Versen 12–46 thematisiert wurde, sondern ein neuer. Dieser Zu-stand ist gekennzeichnet vom Fehlen des Elements, das bislang sein Wirkendominiert bzw. gelenkt zu haben scheint: des *« ρ«, des verderb-lichen, verzehrenden Stachels [des Wahns] (s.o. S. 190f. sowie die Kommen-tare zu AO 7–11).
AO 50–109: Die Vorgeschichte der Fahrt: Bevor die Erzählinstanz Orpheusauf die Versammlung aller Fahrtteilnehmer und den eigentlichen Beginn derArgonautenfahrt zu sprechen kommt, lässt der Verfasser der AO Orpheusvon der Vorgeschichte der Fahrt berichten. In dieser ist davon die Rede, wieIason Orpheus in dessen Heimat besucht und ihn um Teilnahme an der Ar-gonautenfahrt bittet. Auf diese Weise wird eine in den AO im Vergleich zuallen anderen (überlieferten) Argonautenepen geschlossenere Kreisstrukturder Fahrtschilderung ermöglicht, da der Verfasser der AO die Heimat desOrpheus, seine Höhle, zum Ausgangs- und Endpunkt des Fahrtberichts,d.h. der Verse AO 50–1376, macht, in die Orpheus nach der Rückkehr ausKolchis zurückkehrt.
Gleichzeitig erfüllt die Einfügung dieser Vorgeschichte in den Gang desMythos die Funktion einer Exposition in mehrfacher Hinsicht: 1) Die zubewältigende Aufgabe wird benannt und beschrieben. Der Gang der Vor-geschichte wird präsentiert, die zeitlich gesehen noch vor dem Besuch desIason bei Orpheus liegt und die eigentliche Motivation der Fahrt enthält.2) Die Erzähltechnik, die der Verfasser der AO für seine SprechinstanzOrpheus für die gesamte Erzählung der Verse AO 50–1376 vorsieht, wird inihren möglichen Perspektivenwechseln eingeführt. Orpheus als Erzählerwird zwischen einer auktorialen, d.h. mit dem Wissen des Erzählenden un-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

Die Vorgeschichte der Fahrt 211
termauerten (in Hinsicht auf die Vorgeschichte des Iason), und einer drama-tischen Erzählweise wechseln (dazu s.o. S. 95 Anm. 98). 3) Dem Rezipientender AO wird bereits durch die Vorgeschichte der Fahrt die im Vergleich zurVersion des Mythos bei Apollonios (die den Erwartungshorizont eines Le-sers maßgeblich bestimmt haben dürfte) veränderte Konstellation an Bordder Argo vor Augen geführt: Iason kommt als ein Bittender zu Orpheus.Auch wenn zu beachten ist, dass Orpheus durchaus nicht die alles dominie-rende Figur an Bord der Argo sein wird (anders etwa Venzke [1941], S. 26),ist damit seine besondere Position und Relevanz in kultisch-religiöser, hym-nischer und wegweisender Hinsicht (s.o. S. 40), die sich im Verlauf der Fahrtbzw. Erzählung immer wieder zeigt, vorbereitet.
50–51 —« P L+ ’ Ν | π6 λ π « :: Pierien, Landschaft am Olymp, galt in der Antike alsHeimat der Musen (Hesiod, Th. 53), wo ihnen, wie am Helikon, besondereVerehrung entgegengebracht wurde. Leibethra, eine Stadt in Pierien amFuß des Olymp, galt als (ein) Geburtsort und Aufenthaltsort des Orpheus(siehe etwa AR 1, 34). Plutarch nennt ein geschnitztes Bildnis des Orpheusin Leibethra (Plut., Alex. 14, 5), wo er auch gestorben und begraben sein soll.Die Leibethrer werden in AO 1374 erneut erwähnt, allerdings nicht mehr inVerbindung mit Pierien, sondern Thrakien, das gemeinhin ebenfalls als Hei-mat des Orpheus galt (frr. 919–922 Bernabé). Zum Phänomen der in alex-andrinischer Tradition stehenden ,enzyklopädischen‘ Technik in den AOund der Angabe von weiteren Heimats- und Geburtstorten des Orpheus,die in den AO genannt werden, s.o. S. 48f. Dass zunächst Pierien als die Hei-mat (auch) der Musen erwähnt wird und so ihre und des Orpheus gemein-same Herkunft betont wird, unterstreicht den dichterischen Anspruch, dender Verfasser der AO für sein Werk erhebt. Dazu siehe den Kommentar zuAO 6.
Da im Falle Leibethras als einer Stadt am Fuß des Olymp keine nen-nenswerten Höhen konstatiert werden können, ist die Angabe Ν %auffällig: Die in den AO dezidiert angelegte Kreisstruktur (s.o. S. 18f.) wirddurch die Betonung der Höhe, in der sich die Höhle des Orpheus als Aus-gangs- und Endpunkt der erzählten Handlung befindet, gleichzeitig zu einemAb- und wieder Aufstieg. Zur allegorischen Deutung der AO in Hinsicht aufdas neuplatonische Modell von *-«-,* s.o. S. 105–108.Der Besuch des Iason bei Orpheus in dessen Heimat dürfte eine Erfindungdes Verfassers der AO sein (siehe Venzke 1941, S. 26). Eine interessanteParallele findet sich in der separaten ‚Einladung‘ des Acastus durch Iason beiValerius Flaccus (VF 1, 164–173). Zur Erwähnung der exquisiten Abstam-mung der Argonauten siehe auch AR 2, 1222f.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

212 Die Vorgeschichte der Fahrt
52–53a « ’ % . ) | ) #λ: Die Bedeutung, die Orpheus in den AO zukommt, findet ihren Aus-druck auch in der Wahl des häufig in religiösen Kontexten gebrauchten« und der damit ausgedrückten Haltung Iasons seinem Gastgebergegenüber. Mit « wird der Wortgebrauch bei Apollonios (AR 1, 17)aufgenommen. Zugleich wird auf die gerade für die Rückfahrt der Argonau-ten bedeutende Rolle des Orpheus hingewiesen, der die rituelle Reinigungder Argonauten von ihrer Blutschuld durchführen und ihnen so die Heim-kehr ermöglichen wird (AO 1230–1233). Anders Vian (1987), S. 78 ad loc.,der « im Sinne von ‚Expedition‘ versteht. Zur Implikation des Epithe-tons « siehe den Kommentar zu AO 68f.
53b–55 µ« Ν .’ $6 , | 0« %« $µ λ $ )0 ( | A:+«, ¹µ« #H: Obwohl sich keine ver-gleichbaren Epitheta für die Kolcher bei Apollonios von Rhodos finden(siehe aber AR 1, 17: Der Wunsch des Pelias, dass Iason bei den Kolchernumkomme), beschreiben die Formulierungen Ν ’ $# und3« $ recht präzise das Bild der Kolcher, das beim Alexandrinergezeichnet wird bzw. das in dessen Argonautika angelegt ist. So ist bei diesemdavon die Rede, dass die Söhne des Phrixos (gewissermaßen als Kolcher) imBegriff sind, die unendlichen Reichtümer ihres Vaters nach Griechenland zuholen (AR 2, 1095f.), während die Kolcher selbst beim Alexandriner (passim)handlungsbedingt immer wieder als Feinde bezeichnet und erwähnt werden.Dass sie in den AO als 3« $% bezeichnet werden, geht aber überdie Komposition bei Apollonios hinaus und verweist im voraus auf zwei fürdie AO wichtige Aspekte: 1) Aus Kolchis stammt Medea, die (auch) in denAO explizit als die ‚Urheberin‘ für die Ermordung des Apsyrtos genanntwird (AO 1029f.: , ’ ,! « µ« λ « $λ | M«’ 3#« , #AU.). Damit ist sie indirekt auch für das Miasmader Argonauten, die den Mord ausführen, verantwortlich. 2) In Hinsicht aufden erwähnten Mord an Apsyrtos stellt der Aufenthalt der Argonauten beiden Kolchern den Ort des begangenen Miasmas dar. Für die Möglichkeiteiner allegorischen Lesart der AO in Hinsicht auf das neuplatonische Kon-zept von *-«-,* und einer Deutung des Kolcherlan-des als des Ortes der ‚intensivsten‘ materiellen Verwicklung der Argonautenim ‚Unreinen-Materieverhafteten‘ sowie – in Analogie zur hochgelegenenHöhle des Orpheus als des Ausgangsortes der Erzählung – des ‚Tiefpunk-tes‘ der Fahrt s.o. S. 106f. sowie den Kommentar zu AO 50. Kaum zu ent-scheiden dürfte sein, ob im $% auch auf die (Baum-) Bestattung desPhrixos in Kolchis angespielt wird. Diese kolchische ‚Unsitte‘ wird verschie-dentlich als wesentliche Motivation für die Fahrt der Argonauten dargestellt.Die Fahrt der Argonauten dient nach einer solchen Deutung nicht zuletzt
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

Die Vorgeschichte der Fahrt 213
der Heimholung des Phrixos bzw. seiner Seele zum Zwecke einer ordnungs-gemäßen griechischen Bestattung, siehe Dräger (1993), S. 205–215 sowieoben, S. 69f.
Aietes gilt seit jeher als König der Kolcher und Sohn des Helios (Hes.,Th. 958). Diese mythische Tradition wiegt offensichtlich stärker als möglicheBedenken, die sich durch die explizite Nennung der Abstammung des Herr-schers vom Sonnengott und den beschriebenen negativen Eigenschaftender Kolcher ergeben (zur notwendigen Achtung des Göttlichen und Einhal-tung der platonischen Idealkriterien für Dichtung in den AO s.o. S. 94). Diebesondere Wertschätzung, der sich Helios von Seiten der Neuplatonikererfreute (Fauth [1995], S. 121–164), mag bei dem neuplatonischen Hin-tergrund der AO die entstandene Inkonsequenz von gottentsprungenemKönig und frevelhaftem Volk erklären helfen. Die Faszination, die die Ab-stammung von Helios offensichtlich ausübt, ist auch in der imposantenSchilderung Kirkes, der Schwester des Aietes und ebenfalls Heliostochter,spürbar, siehe die Kommentare zu den Versen 1214–1225.
56–57 G )> P« + ¹ , | µ« "’ A:9 + $+: Pelias, dem Halbbruder des Aison (des Vaters desIason), war geweissagt worden, dass er sich einst vor einem ‚Einschuhigen‘in acht nehmen müsse, der seine Herrschaft bedrohe. Zur Vorgeschichteder Argonautenfahrt und den Warnungen an Pelias vor einem Einschuhigensiehe AR 1, 5–14 sowie Pindar, Pyth. 4, 71–78 (" V). Zur Bezeich-nung der Herrschaft als „Königsherrschaft“ (* $$*) und mög-licher Implikationen siehe den Kommentar zu AO 70f.
Das Subjekt zu "9 ist " (so bereits Vian [1987], S. 78 ad loc.);A) zu verstehen als sogenannter pindarischer Genitiv.
58–60a K ¹ "µ α | )> %K « - %( | G %- : Zur List des Pelias,Iason in der Hoffnung auf dessen Scheitern auf eine scheinbar unmöglicheMission zu schicken, siehe auch AR 1, 15–17; bei Pindar, Pyth. 4, 93–165 istebenfalls vom Auftrag des Peleus an Iason die Rede, nicht aber von einerList.
Zur seltenen Konstruktion von .# (statt ) siehe Vian(1987), S. 78 ad loc. Auch der Gebrauch von µ (im Dativ) istuntypisch (siehe etwa Il. 11, 579 u. ö.: µ #).
60b–65 <O ’, ³« - 0 *+, | (« %« % 6Hα | + )> % 6 . | <H ’Ν * 9 % α | 0 )> )Q λ | b , µ AS« c: Davon, dass Iason den
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

214 Die Vorgeschichte der Fahrt
Auftrag seines Onkels Pelias, als er ihn vernimmt, als gesetz- oder zumindest„sittenwidrig“ (3) empfindet, ist weder bei Pindar noch bei Apollo-nios oder Apollodor die Rede und stellt im Rahmen der Exposition der Vor-geschichte der Argonautenfahrt einen ersten Hinweis auf die problema-tische Natur der gesamten Fahrt dar. Vor diesem Hintergrund ist auch dieprinzipiell unwillige Haltung des Orpheus zu sehen, der sich in sein Schick-sal fügt (AO 97–109).
Das gegenseitige besondere Verhältnis zwischen Iason und Hera – aufdie knapp drei Verse 60 bis 62, in denen von der Hinwendung und Vereh-rung der Hera durch Iason die Rede ist, folgen die drei Verse 63 bis 65, in de-nen die Zuneigung der Hera für Iason zum Ausdruck kommt – findet sichbereits in der Odyssee (Od. 12, 72); siehe auch AR 3, 61–75. Ebenfalls expo-sitorischen Charakter (s.o. S. 210f.) hat das Opfer Iasons an Hera: Die Be-achtung der Pflichten den Göttern gegenüber wird während der gesamtenErzählung der AO zu beobachten sein. Zudem bleibt das Gebet Iasons, dassich in dieser Form und an diesem Zeitpunkt nicht bei Apollonios findet,nicht unbeantwortet: Die Zuneigung und Sympathie der angerufenen Gott-heit wird prompt zum Ausdruck gebracht.
66–69 K < % T)9α | ¹ ) - + , | T λ "’ :« %(« 4 | 6", « ’ d «: Von einem Auftrag Heras anAthene zum Bau der Argo ist weder bei Pindar noch bei Apollonios oderApollodor die Rede. Durch dessen Einführung in den AO wird beim Rezi-pienten zunächst der Eindruck hervorgerufen, Athene (Tritogeneia) sei diealleinige Architektin der Argo, ohne dass Argos (d.h. entweder der Phrixos-Sohn Argos [vgl. Pherekydes FGrH 3 F 106 sowie Apollodor 1, 110] oderArgos, der Sohn des Arestor/Alektor [AR 1, 112]) am Bau beteiligt gewesenwäre. Eine solche Mythosvariante ist seit Pseudo-Hygin und damit vermut-lich dem 2. Jh. n. Chr. überliefert (Hygin 14, 33: Haec est navis Argo quam Mi-nerva in sideralem circulum retulit ob hoc quod ab se esset aedificata). Hierzu sieheauch Venzke (1941), S. 29. Die Parallelität zur Mythosgestaltung in den AOist allerdings eine nur scheinbare. Argos wird in AO 267 nachträglich als der-jenige, der den Bau der Argo ausführt, genannt. Obwohl der Verfasser derAO damit letzlich dem Modell bei Apollonios folgt, wird zunächst der gött-liche Charakter der Argo betont, ein Detail, welches bei der Kompositionder Rückfahrt in den AO durchaus von Belang ist: Denn die Heimkehr derArgonauten kann erst durch den Rat der (göttlichen) Argo zur Reinigungvon der Blutschuld und Befleckung (AO 1159–1169) zur Vollendung kom-men. Dass die Argo darüberhinaus aus Eichenholz gebaut ist ("),spielt insofern eine Rolle, als ihre Fähigkeit zu sprechen (jedenfalls bei Apol-lonios Rhodios) darauf zurückgeht, dass in ihrem Kiel ein Stück von der do-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

Die Vorgeschichte der Fahrt 215
donischen Eiche eingefügt ist (AR 1, 526f). Zum Bild des Schiffbaus undinsbesondere des Kiels für das Bestehen in den ‚Stürmen des Lebens‘ sieheauch Platon, Nom. 803a-b sowie oben S. 102f.
Ein gutes Beispiel für die dem Verfasser der AO eigene Technik, vorallem aus Apollonios bekannte Episoden durch z.T. sehr kurze Anspielun-gen anzudeuten, findet sich in der Verwendung von ": Da in denAO die aus der Version bei Apollonios bekannte Beratungsszene zwischenHera und Athene (später noch mit Aphrodite, siehe AR 3, 7ff.), wie den Ar-gonauten und Iason bei der Eroberung des Vlieses in Kolchis zu helfen sei,fehlt, kann die durch " evozierte Begegnung von Hera undAthene in den AO durchaus als Anklang an die Göttinnen-Szene bei Apol-lonios gelten. Dazu, dass Athene auf Veranlassung Heras handelt, siehe auchAO 694f.
Zur Vorstellung der Argo als des ersten Schiffes und dem (logischen)Pseudo-Problem des Vorhandenseins einer kolchischen und einer phaiaki-schen Flotte sowie literarischen Parallelen siehe Vian (1987), S. 79 ad 69. Diegedankliche Inkonzinnität (auch das in der griechischen Literatur weitver-breitete Bild der « (…) %« setzt eigentlich das Vorhandenseinanderer Schiffe voraus) verliert zudem an Schärfe durch die Annahme, dassdie Betonung auf dem Aspekt des ‚meerbefahrenden‘ Fahrzeugs liegt (im Un-terschied etwa zu nur die Küsten entlangfahrenden Schiffen), denn sowohlim vorliegenden Vers (4" ") als auch später (siehe etwa AO 236)wird auf die ‚Hochseetüchtigkeit‘ der Argo hingewiesen (4 «).
70–71 #A’ Ρ κ ) $)#« «, | G9+ :«%- %) (« #I+ : Weder bei Apollonios Rhodios noch bei Pin-dar, d.h. in der maßgeblichen (überlieferten) griechischsprachigen Argonau-tendichtung, ist die Bezeichnung der Argonauten als ‚Könige‘ üblich. Nureinmal lässt Pindar den Aietes Iason indirekt als König anreden (Pindar,Pyth. 4, 229), während bei Apollonios Rhodios nur von dem ArgonautenAugeias gesagt wird, dass er in seiner Heimat als König herrscht (AR 1, 173).Ansonsten werden bei Apollonios nur Pelias, fremde Herrscher und Aietesals Könige bezeichnet und angeredet. Umso bemerkenswerter ist es, dassdie Argonauten in den lateinischen Argonautica des Valerius Flaccus regelmä-ßig (etwa 1, 342f.: … video nostro tot in aequore reges | teque ducem ….) als Königebezeichnet werden.
Vor dem neuplatonischen Hintergrund der AO muss zudem damit ge-rechnet werden, dass die Bezeichnung der Argonautengruppe als ‚Könige‘auch eine intelligente Anspielung auf die besondere Verbindung Iasons unddamit der Argonauten zu ‚Hera‘ beinhaltet (siehe AO 60–65 und den Kom-mentar dort). Hera wird in (neu-)platonischen Kontexten immer wieder miteiner ‚königlichen Lebensweise‘ assoziiert (vgl. Proklos, In Remp. I, 108 [mit
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

216 Die Vorgeschichte der Fahrt
Bezug auf Plat., Phdr. 252e-265b]; II, 263). Siehe auch AO 57, wo explizitvon der ‚Königsherrschaft‘ (*) die Rede ist, obwohl Pelias – etwa beiPindar – nur ein Usurpator ist. Die Herrschaft gebührt eigentlich Iason,dem Liebling Heras.
72 ’ % %-: Die Vorstellung, dassOrpheus durch sein Leierspiel Tiere, Bäume und Steine verzaubert, ent-wickelte sich zu einem der wirkmächtigsten Bilder desselben in bildlicherwie literarischer Darstellung (siehe etwa AR 1, 26–31.570–579; Ovid, Met.10, 86–144) und wird auch in den AO immer wieder entfaltet (siehe AO431–439).
In den AO werden verschiedene Instrumente des Orpheus genannt($"« [AO 72, vgl. HH in Merc. 25. 153, aber auch Valerius Flaccus: testudo!,z.B. 1, 277], % [AO 42, 265 u. ö.], [AO 111], und « [AO6]), ohne dass ein Unterschied in der Verwendung bzw. Intention erkennbarist. Zu den genannten Instrumenten hinzu kommt noch die . (AO 398),die als Instrument des kleinen Achill angeführt wird, wohl in Anspielung aufIl. 9, 186 (dort allerdings Phorminx statt Lyra).
Wie bei Apollonios ist die Lyra damit interessanterweise nicht explizitals Instrument des Orpheus genannt. Zur Identität von Lyra und Pektissiehe aber den Kommentar zu AO 6.
73–74 , ) $+, | + «:’ > λ : Vians Übersetzung des „en ton honneur“ wirftdas Problem der Adressatenproblematik (dazu siehe den Kommentarzu AO 7f. sowie ausführlich oben S. 27f.) erneut auf, obwohl dies unnötigsein dürfte: Nachdem die Anrede in Vers 7 (‚"‘) offenließ, ob Apol-lon oder Musaios angeredet ist, die Verse 33, 40, 46 und 49 aber für eine An-rede an Musaios sprachen und Musaios in Vers 308 auch namentlich ange-redet werden wird, spricht auf den ersten Blick alles dafür, dass dieser auchim vorliegenden Fall die angeredete Person ist. Allerdings erforderte dieseAnnahme notwendigerweise die Anwesenheit des Musaios in der Höhledes Orpheus bereits auf der Ebene der Erzählung, was den späteren Berichtder Begebenheiten durch Orpheus (d.h. die AO selbst) unnötig erscheinenließe. Musaios als hinter „en ton honeur“ stehende Person scheidet damitaus.
Eine Anrede an Apollon (als dezente Fortführung der DoppeladresseApollon-Musaios in AO 7) ist vor den oben angeführten Gründen (AO 33,40, 46, 49 und 308 als Anrede an Musaios) ebenfalls unplausibel. Vielmehrdient die Partikel (nicht das Personalpronomen) lediglich der Bekräf-tigung dessen, was Orpheus betonen will: die Süße und Schönheit seinesGesangs. Zur Konstruktion von siehe Denniston (1954), S. 537: „(…) As
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

Die Vorgeschichte der Fahrt 217
a natural corollary emplies, briefly speaking, an audience, and prefera-bly (…) an audience of one.“
Zu $* siehe AO 5: .# $*.Für Parallelen zu diesem Orpheus, der seine Umwelt verzaubert, siehe
den Kommentar zu AO 72. Zum Bild des Orpheus, der die Tiere (und nichtdie Bäume oder Steine) um sich sammelt, siehe auch Eur., Bakch. 561f.
75–76 <H ’ :« Ν + : | % $ +: Die bereits angedeutete Ankunftsszenerie, wieIason bei Orpheus eintrifft (siehe AO 51: )"), wird im vorliegendenVers durch das Element der Höhle erweitert. Dies stellt eine Eigentümlich-keit der AO dar, die dennoch geschickt aus der Formulierung bei ApolloniosRhodios entnommen und weiterentwickelt sein könnte, wenn es dort heißt(AR 1,23–25): P(% #O« , 8% ’ -κ | K>* ' -! | O)%)# « P« Ν$ ".Die Wortwahl (Ν) dürfte vor dem neuplatonischen Hintergrund derAO (siehe Od. 9, 216 sowie Porphyrios, De antro passim) Signal-Charakterhaben. Zum Motiv der Höhle in den AO, die den Ausgangs- und Endpunkt(AO 1375) der Fahrtteilnahme des Orpheus darstellt, und dem potentiellenphilosophischen Gehalt einer solchen Verortung von Ausgangs- und End-punkt der Handlung siehe oben ausführlich S. 112–115.
77–80 „#O., K« λ O:) ., | B9K + $ | (’, %λ A¹« &>« 6¹ , | R« <>« <e« ’ :> µ« Ν): Indem derVerfasser der AO Orpheus in der Iason-Rede nicht von Kalliope und Apol-lon, sondern von erstgenannter und Oiagros abstammen lässt, nimmt erdie traditionelle epische Genealogie auf, die auch bei Apollonios Rhodios(AR 1, 23–25) und Valerius Flaccus (VF 4, 348) bezeugt ist (beide Abstam-mungen des Orpheus etwa bei Apollodor 1, 14). Neben der Anlehnung anepische Konvention mag für die Wahl der menschlichen statt der göttlichenVaterfigur des Orpheus auch der neuplatonische Hintergrund der AO unddamit die Angemessenheit der literarischen Darstellung relevant gewesensein: Denn obwohl Orpheus gegen Ende der Fahrt die Reinigung derArgonauten von ihrer Blutschuld vollziehen wird und somit eine wichtigesoteriologische Funktion innehat, ist er doch auch Teil der Argonauten-gruppe und wird – jedenfalls nicht explizit – von einer Mitschuld am Morddes Apsyrtos nicht ausgenommen. Eine ‚rein göttliche‘ Herkunft stündedazu in einem gewissen Konflikt. Zur poietischen Grundlage und derOrientierung des Verfasser der AO an platonischen Literaturidealen s.o.S. 95f. Kalliope als einhellig bezeugte Mutter des Orpheus gilt dagegennicht nur als älteste und würdigste Muse, sondern auch in besonderem
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

218 Die Vorgeschichte der Fahrt
Maße der Philosophie verbunden, siehe Platon, Phdr. 259d; Hermeias, InPhaedr. 217 Couvreur.
Bistonien, die Heimat eines thrakischen Stammes, wird als das Herr-schaftsgebiet des Orpheus auch bei Apollonios (AR 1, 34) genannt. DieKikoner, ebenfalls ein thrakischer Stamm (siehe Hdt. 7, 59 und Strabon 7,330f.), werden in der Odyssee als die erste Station des Odysseus genannt(Od. 9, 39ff.) und bewohnen wie die Leibethrer die Gegend am Fuße desOlymp. Die beiden wesentlichen mit Orpheus verbundenen Regionen(Pierien/Olymp und Thrakien) sind damit genannt. Aus dem Kontext (Bis-tonien, Kikoner, Rhodope, Strymon) geht hervor, dass die „haimonischenGrotten“ als Synonym eher für Thrakien als für Thessalien zu verstehensein dürften (zur Bezeichnung des thrakischen Gebirges Haimos statt Hai-moniens, das z.T. synonym für Thessalien stehen kann). Der Strymonwiederum bildete in früher Zeit die Grenze zwischen Thrakien und Make-donien. Die erwähnte Rhodope war (von Apollon) die Mutter des Kikon,des Stammvaters der (thrakischen) Kikonier (siehe den Kommentar zu AO78) sowie Vian [1987], S. 79f. ad 78.79) und ist gleichzeitig der Name einesGebirges ()9 µ« Ν) in Thrakien. Die beschriebene Geographiedürfte vor allem darauf angelegt sein, die mit dem Namen des Orpheus as-soziierten Berge und Landschaften zu nennen, ohne sich im geographischenDetail zu verlieren. Zu geographischen Ungenauigkeiten siehe Vian (a.a.O.).
81–82 E:λ ’ %)Ω M- c )6«, | Gµ« A:-«α (« Κ ρ: Zur Erwähnung des ‚Blutes‘ zum Belegder Abstammung siehe AR 1, 230–232. Während allerdings beim Alexandri-ner das Blut bzw. die Abstammung von den Töchtern des Minyas (deshalbMinyer) für eine Gemeinsamkeit der Argonauten steht, ist an unserer Stelle al-lein vom Blut bzw. der Abstammung des Iason die Rede. Voß’ Übersetzung:„vom Blute der Minyer“ ist deshalb bei aller Notwendigkeit einer freienÜbertragung ins Metrum irreführend. Der Verfasser der AO intendiert viel-mehr eine herausgehobene Stellung des Iason selbst im erlauchten Kreis derArgonauten, was wiederum die Bedeutung des Orpheus als desjenigen, zudem Iason als Bittender (AO 52.84) kommt, erhöht (siehe den Kommentarzu AO 52).
E) … $« im Sinne von L$.Κ$ ρ im Sinne von ‚bitte ich zu sein‘, nicht von ‚bekenne ich zu
sein‘ (anders Vian [1987], S. 80 ad 82). Neben der Tatsache, dass von einerschon vorher oder durch Vorväter bestehenden ‚Gastfreundschaft‘ nichtsbekannt ist, spricht auch die Tatsache, dass Iason sich erst vorstellt, gegendie Annahme einer bereits bestehenden (Gast-)Freundschaft (vgl. auchAO 79: sowie AO 839), was dem üblichen Gebrauch der home-rischen Formel entspräche. Eine solche abweichende Deutung wird unter-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

Die Vorgeschichte der Fahrt 219
stützt durch die erneute Verwendung der Formel im Kontext der Iason-Rede an Aietes (AO 839, siehe den Kommentar dort).
83–87a #A, «, ’ " λ - . | «$(« λ ) ", | #A #« λ =»%µ | λ # #A)6)9 ( « | «$-«: Mit $« wird vornehmlich Gesprochenes bezeichnet (vgl.die Bezeichnung der Stimme des Iason als $« in AO 76). Im vorliegen-den Fall dürfte daher eher ‚Rede in sanfter Erzählung‘ als ‚bon accueil‘ (Vian)gemeint sein. Geschickt – da die verschiedenen Bedeutungsnuancen harmo-nisierend – ist deshalb die Übersetzung bei Voß, der $« $!« ‚mitgünstigem Ohr‘ übersetzt (für $* im Sinne von ‚Gehörtem‘, ‚Erzählung‘siehe etwa Platon, Tim. 21a7: 9 κ ?#« $*): Hinter %mehr als die Bitte zum Zuhören zu verstehen, erscheint bei seiner Stellungneben ")# (AO 52) fraglich. Die folgenden Infinitive (AO 86f.) impli-zieren aber in der Tat einen iussiven Aspekt: „Leiste mir Folge“ (s.u.).
Der Phasis, ein Fluss, der ins östliche Schwarze Meer ( #A )mündet, wird im vorliegenden Vers in einer Einheit mit Kolchis zum Zielund zur Route der Argonautenfahrt zugleich erwähnt. In der Iason-Formu-lierung ! %« | « $.« ist eine Übertreibung desVerfassers der AO in der Anlage der Orpheus-Figur gesehen worden, daallein Tiphys und Ankaios, nicht Orpheus, im Verlauf der Erzählung alseigentliche Schiffsführer in Erscheinung träten (Venzke [1941], S. 6). Nebenden beiden wichtigen Auftritten des Orpheus in den AO, die auch Venzkenennt (AO 690ff. die Passage der Symplegaden mithilfe des Orpheus undAO 1197–1202 der Rat des Orpheus, die Insel der Demeter nicht anzulau-fen), wird man allerdings noch berücksichtigen müssen, dass durch die Wahlvon ! geschickt auf die Argonautika des Apollonios angespielt wird: Istdort von der Wegweiserfunktion des Apollon die Rede (AR 1, 360f.: …#A#«, Ρ $# " | " « 4« …),wird diese Fähigkeit der Wegweisung in den AO für Orpheus in Anspruchgenommen. Hinzu kommt, daß in ! keine Feststellung des Iason bzw.des Verfassers der AO bezüglich der späteren tatsächlichen Funktion desOrpheus enthalten ist, sondern lediglich die (berechtigte) Erwartung des Ia-son, Orpheus werde (als derjenige, der bereits den Weg selbst in die Unter-welt und wieder heraus gefunden hat, siehe AO 91–93) auch wegweisendhelfen können.
Der Gebrauch der Infinitive in den Versen AO 86–95 verdient einigeAufmerksamkeit. Vian (1987), S. 61, VIII1 deutet auf einige Besonderheitender Infinitivverwendung in den AO insbesondere im Kontext von Fragenhin und verweist – im Einklang etwa mit der Position Gesners (siehe Her-mann [1806] ad loc.) – auf einen imperativischen Sinn, den der Verfasser der
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

220 Die Vorgeschichte der Fahrt
AO manchem Infinitiv gegeben haben mag: „Rapprocher les inf. de style in-direct des v. 85–86, 91–96 (au v. 94, $" peut être un inf. à valeur d’im-peratif) ….“ Ein solcher imperativischer Sinn liegt im Fall des Infinitivs$" (AO 94) gewiss vor. Die Infinitive % und ! (AO 86), dieVian beide ebenfalls imperativisch wiedergibt (montre-nous; sers de guide),dürften dagegen schlicht von ")# (AO 84) abhängig sein; eine impe-rativische Wiedergabe überdeckt unnötigerweise den bittenden Charakterder Iason-Worte. Die beiden Infinitive % und $! in AO 93 er-klärt Vian durch den Frage-Charakter der Verse AO 91–93 und übersetztsie entsprechend als (rhetorische) Frage. Womöglich ist aber auch eine ellip-tische Konstruktion anzunehmen, d.h. dass ein verbum dicendi oder sapiendimit den anderen Argonauten als Subjekt zu ergänzen ist (‚sie sagen nämlich,dass‘ / ‚sie wissen nämlich, dass‘). Das % in AO 91 ergibt auch in diesemFall guten Sinn: Wie nämlich AO 90f. (- 9 … ") die Begründung fürdas in AO 85–89 Gesagte gibt, d.h. die Bitte des Iason, fungieren die VerseAO 91–93 (λ 9 … $!) als Begründung für die Weigerung der Ar-gonauten, ohne Orpheus die Fahrt anzutreten (AO 90f.).
"$ von (poet./selten) "$.Zur „Jungfräulichkeit“ des Meeres siehe den Kommentar zu AO 67.
87b–91a %+ π6 | f < κ λ &+, | % ) %) – | * )> κ - µ« . | : Vians Hinweis darauf(Vian [1987], S. 80 ad AO 87), dass sich die Bedeutung von ,*« imSinne von ‚angenehm‘, ‚lieb‘ bei Homer später zu ‚abwehrend‘ gewandelt hat(L&S s.v. II 3), erscheint im vorliegenden Fall irreführend. Es liegt kein er-sichtlicher Grund vor, hier nicht von der homerischen Bedeutung des Wor-tes ‚ersehnt‘ auszugehen, zumal im nächsten Vers von den musischen Qua-litäten des Orpheus die Rede ist. Dass die Argonauten auf „Leier“ und„wunderbare Stimme“ des Orpheus warten, ist vor dem Hintergrund, dassOrpheus für seine musischen Fertigkeiten offensichtlich bereits vor seinerTeilnahme am Argonautenzug bekannt und berühmt war, nachvollziehbar.Dass es zudem wohlbegründet ist, wird sich u.a. in dem Wettstreit mit Chi-ron (AO 369–454), dem Herbeirufen des Hypnos (AO 1001–1005) und derSirenenepisode (AO 1274–1290) zeigen. Im Hintergrund des Wunsches derArgonauten, Orpheus als Teilnehmer der Fahrt zu gewinnen, steht ja u.a.sein Abstieg in den Hades (vgl. AO 91–93), eine Episode, von der sein Ge-sang zur Rückgewinnung Eurydikes kaum zu trennen ist. Dass die anderenFahrtteilnehmer sich weigern, ohne Orpheus am Abenteuer teilzunehmen,ist nirgends sonst belegt, betont aber noch einmal die herausragende Bedeu-tung des Orpheus in den AO.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

Die Vorgeschichte der Fahrt 221
91b–95 λ ) < λ Q , | :« , « :« )«, | . $’ $6 λ $( –α |` g + - M- $ | λ «, $6 %- .“ Zur unklaren Bedeutung von « (Vian [1987], S. 80ad 92: „Son sens est inconnu.“) siehe Hesych Nr. 1147 Latte [s.v. κ$]α $µ !, λ ..
Die Formulierung $’ $# ist hier (trotz der analogenKonstruktion in AO 183) nicht zu verstehen als ‚als einziger der Menschen‘(siehe aber Vian: „le seul homme au monde“), sondern als ‚ohne Beglei-tung‘, wie Eschenbach (Hermann [1806] ad loc.) mit Verweis auf andere Un-terweltsbesucher wie Herakles oder Theseus klarstellt. Zur Konstruktionder Infinitive siehe den Kommentar zu den Versen AO 83–87a. Zur vorlie-genden Bezeichnung der Argonauten als ‚Minyer‘ siehe den Kommentar zuAO 111. Zum epischen "«-Motiv als Motivation auch für die Erzählungder Fahrt durch der Sprechinstanz Orpheus s.o. S. 190 sowie den Kommen-tar zu AO 3.
96–99 Tµ 8 %)Ω - $« α | „A:, . « %«, | , %« K« M-« %+«0 , | λ # *) -« %λ S : Anders als Acastus beiValerius Flaccus, der in dessen Argonautica (VF I, 161–181) von Iason zurTeilnahme am Argonautenzug überredet wird und auf die Anfrage seinesVetters sogleich freudig eingeht, ist Orpheus dem Ansinnen des Iason ge-genüber skeptisch eingestellt. Ähnlich ist die Reaktion Medeas bei Apollo-nios (AR 4, 355): „A), * . κ | $ ’,;“. Eine solche Zurückhaltung kann vor dem Bild von *--«-,*, mit dem in den AO allegorisierend gearbeitet wird (s.o.S. 105–108), als eine Ahnung des Orpheus um die Risiken einer solchenFahrt gesehen werden, s.o. S. 106f.
Zur Bedeutung von ,*« siehe den Kommentar zu AO 87.
100–102 5H ) Ϊ« , Ϊ« 0 , | ³« ¹ %λ)( $ 8 «, | A:)- ) L-9 (« $> : Wenn Orpheus sein bisheriges Leben als mühselig beschreibt (Ϊ«%#, Ϊ« 3 $#), ist damit offensichtlich nicht (allein) seinLeid durch den Tod der Eurydike gemeint: Wie die folgenden Verse nahe le-gen, ist das gesamte Leben und das Umherziehen auf Erden (AO 40–45) bisnach Ägypten und Libyen als mühselig und mit Plagen verbunden beschrie-ben. Das Dasein des Orpheus in seiner Höhle erscheint im Kontrast dazunotwendigerweise als ruhig und erstrebenswert.
Vor dem Hintergrund der vermuteten Allegorese-Möglichkeit der AOund dem damit anzunehmenden Verweischarakter der Orpheus-Höhle auf
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

222 Die Vorgeschichte der Fahrt
den Zustand der * im ‚Kreislauf‘ von *, « und ,*dürfte eine solche Charakterisierung der Höhle kein Zufall sein (s.o. S. 18 so-wie S. 106f.). Für analoge Auffassungen vom ‚ermüdenden Charakter desLebens‘ vgl. etwa Proklos’ 6. Hymnos, Vers 11f.: , , $!, λ" $*« Ρ ,« -« % .
Nimmt man die Chronologie der AO ernst, kann mit einem Aufenthaltin Libyen nicht der bei Apollonios erwähnte (AR 4, 1223–1622, v.a. 1409ff.)spätere Aufenthalt der Argonauten in Libyen gemeint sein; die genaueImplikation der Nennung Libyens bleibt unklar. Es kann nur auf die beson-dere Verbindung des Orpheus und ‚seiner‘ Anhänger mit dem Moment desReisens in literarischen wie archäologischen Kontexten verwiesen werden,vgl. etwa Platon, Pol. 364e–365a, sowie zuletzt Graf/Johnston (2007),S. 144–148.
Zur Funktion des Orpheus als Verkünder von ‚heiligem Wort‘ siehe denKommentar zu den Versen 43–45.
3 von ", siehe aber die Diskussion dazu im Kommentar zuAO 233.
103–105 Kλ ’ !$’" $« λ % S % | + π, <’ :« d)) 4, | , « > )+=)): Dass Orpheus seinen früheren Lebensabschnitt als unter dem Ein-fluss eines Wahns (L«) bezeichnet (siehe auch die Formulierung in AO10: ")# ,«), von dem ihn seine Mutter, die Muse Kalliope(dazu siehe den Kommentar zu AO 77), befreit, ist für die Anlage der AO alseines potentiell allegorisch zu lesenden Werks wichtig, s.o. S. 108–112. Dieerneute Nennung des L« ist dabei insofern von Bedeutung, als dessenZuweisung zur Vergangenheit so auch für die Orpheusfigur innerhalb derErzählung geltend gemacht wird und nicht allein für den Narrator Orpheusgilt. Der ‚neue‘ Orpheus, der in der Rahmenhandlung von einem ‚alten‘ Or-pheus unterschieden wird, ist auch der Handlungsträger der Fahrterzählung.Zu den verschiedenen Formen des Wahns einer neben dem L« existie-renden , die in den AO von Bedeutung sind, sowie seiner Bedeutungfür ein platonisches Dichtungsverständnis s.o. S. 108ff.
Die Aussage des Orpheus, er werde in seinem ‚Haus‘ einst sterben(1 "« % $# 9 *= )(), setzt den Assoziationsreich-tum voraus, der mit dem Wort « einhergeht. Mit diesem hier zur Be-zeichnung der Orpheus-Höhle gewählten Begriff wird auch das Haus desHades bezeichnet, siehe etwa Proklos, Inremp. II, 339, 22 Kroll und passim inden orphischen Goldplättchen. Zur örtlichen wie mythenchronologischenVerortung sowie zum Alter des Orpheus zum Zeitpunkt des Iasonbesuchswie der Erzählung der Fahrt, d.h. in der Rahmenhandlung, s.o. S. 17f.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

Die Vorgeschichte der Fahrt 223
106–109 #A’ * 0’ "- ψ κ (α | M %-9 %), * )> Ν | <I Zµ« . L. 6Id | ²« . λ π« %«.“ Der Gedankeeines unausweichlichen Schicksals zieht sich durch das gesamte Werk,siehe Vian (1987), S. 14 Anm. 5 mit einer Übersicht über alle Belegstellen:So ist in den AO insgesamt 14 mal vom Schicksal die Rede, davon fünfmalvon den Moiren bzw. der Moira (AO 107, 142, 711, 1311, 1362) und dreimalvon #" o.ä. (106, 656, 1110). Die Kombination dieser beidenSchicksalsbezeichnungen in den vorliegenden Versen AO 106f. betont dieMacht des Schicksals, der sich Orpheus bei seinem Auszug aus der Höhlebeugt.
Sprachlich gesehen dürfte die Formulierung #" ! v.a. epi-sche Formulierungen aufgreifen, vgl. etwa Il. 3, 308f.: Z:« " ρ λ $% λ Ν | ²"#) % "« #" ,.Ob über die literarische Konvention hinaus eine philosophisch geprägteSchicksalskonzeption (in bezug auf die vorliegende Passage wie für die AOinsgesamt) vorliegt, muss offen bleiben. Die Formulierung #" !-, die dem in platonischen Kontexten tendentiell üblichen Gebrauch von¹" entgegenzustehen scheint, wird jedenfalls mit metrischen Zwän-gen zu erklären sein (¹" kann im Hexameter nicht verwendet wer-den; metrisch verwendbare Formen wie ¹% o.ä. sind im Epos nichtbezeugt). Darüberhinaus stellen die in den AO erwähnten Instanzen‚Ananke‘ und ‚Moiren‘ in der Tradition von Politeia und Timaios durchaus ge-läufige Ausdrucksweisen auch bei Neuplatonikern dar (siehe z.B. Proklos,Theologia Platonica 6, 23; zur Bedeutung von Ananke und Moiren siehe auchCürsgen [2002], S. 157–160). Darüberhinaus erfolgt in der Darlegung desProklos auch der Kreislauf von *, « und ,* ‚aus Notwen-digkeit‘ (Proklos, Inst. Theol. 33, 17). Räumt man die Möglichkeit einer alle-gorischen Lesart der AO ein, markiert der Aufbruch des Orpheus aus seinerHöhle den Übergang von der * zur «. Diesem entzieht sich Or-pheus nicht, sondern er erfolgt – im vorliegenden Bild des Mythos – im Ein-verständnis bzw. nach dem Willen der Moiren.
Eine Erwähnung der ‚Bitten‘ (), der Töchter des Zeus, begegnetbereits Il. 9, 499–504: Vor dem homerischen Hintergrund der Rede des altenPhoinix an Achill kann die Erwähnung der ‚Litai‘ durch den SprecherOrpheus nur als kluge Erkenntnis und nachgerade als Gegenstück zum Ver-halten des iliadischen Achill verstanden werden. Orpheus gibt den Bittendes Iason schließlich nach, Achill denen der griechischen Bittgesandtschaftnicht. In Hinblick auf die bereits konstatierte Komposition der AO nach(neu-) platonischen Dichtungskriterien (s.o. S. 95–115) mag diese Zeich-nung der Orpheus-Figur kein Zufall sein: Denn die Bewertung des Phoinixwie Achills durch Sokrates (Platon, Pol. 390e4–391a1) ist explizit negativ.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM

224 Ankunft des Orpheus in der Versammlung der Fahrtteilnehmer
Zum Alter des Orpheus s.o. S. 17f. Zur göttlichen bzw. halbgöttlichenAbstammung der Argonauten siehe den Kommentar zu AO 50. Zur Be-zeichnung der Argonauten als ‚Könige‘ siehe den Kommentar zu AO 70f.
AO 110–231: Ankunft des Orpheus in der Versammlung der Fahrtteil-nehmer und Katalog derselben: Der Katalog von 50 Argonauten, der inden Versen 118–229 gegeben wird, steht in der langen Tradition literarischgestalteter Katalogpartien, die im Schiffskatalog der Ilias ihren Ausgangnimmt. Er stellt innerhalb der weitgefassten Gruppe anderer Argonauten-kataloge hinsichtlich seiner relativen Länge von 111 Versen bei einer Werk-länge von 1376 Versen eine bemerkenswert ausführliche Aufzählung derFahrtteilnehmer dar (50 Argonauten, dazu Orpheus und Iason).
Von den 50 im Rahmen des Argonautenkatalogs der AO aufgeführtenFahrtteilnehmern sind 49 auch bei Apollonios Rhodios genannt (Aus-nahme: der textkritisch umstrittene Eneios in AO 170). Da die erhaltenenArgonautenkataloge in ihrer Auswahl teilweise deutlich voneinander abwei-chen, ist dies ein Faktum, das auf die besondere Nähe zum Katalog des Ale-xandriners hindeutet. Wenn Scherer (2006), S. 48 deshalb formuliert, dassder Katalog der AO „inhaltlich wie formal hochgradig vom Katalog beiApollonios abhängig“ sei, ist diese Charakterisierung zunächst zutreffend.Andererseits darf eine solche Betrachtungsweise nicht den Blick für diezahlreichen Modifikationen verstellen, die der Verfasser der AO bei derKomposition seines Katalogs in bezug auf Apollonios einflicht, sowie –dem alexandrinischen Charakter der AO ihrerseits entsprechend – für diezahlreichen weiteren literarischen Bezugsgrößen, die für ein umfassendesVerständnis der Komplexität des Argonautenkatalogs auch der AO in dieBetrachtung einbezogen werden sollten. Homer, Hesiod, Pindar und Vale-rius Flaccus stehen offensichtlich ebenso im Hintergrund wie prosaischeMythologieabhandlungen etwa des Apollodor. Es sei daher auf Vians Cha-rakterisierung verwiesen, die die wesentlichen literarischen Qualitäten desKatalogs der AO nennt (vgl. Vian [1987], S. 19): „Bref, le catalogue révèletour à tour un plagiaire, un inventeur à l’imagination courte, parfois aussi,néanmoins, un auteur capable d’érudition. Ces trois aspects caractérisentl’ensemble de lœuvre du poète.“
In narratologischer Hinsicht, d.h. in bezug auf eine sehr viel dynami-schere Einarbeitung des Katalogs in den Handlungsverlauf der Erzählung,orientiert sich der Verfasser deutlich erkennbar nicht an Apollonios und des-sen seinerseits am Schiffskatalog der Ilias orientierter ‚statischer‘ Darstel-lungsweise der Argonauten, sondern eher an Katalogmodellen, wie sie auchbei Valerius Flaccus (VF 1, 350–486) oder der Aufzählung der latinischenVölker bei Vergil (Aen. 7, 641–817) greifbar sind (dazu siehe auch Gummert
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 134.99.128.41
Download Date | 12/17/13 10:02 AM