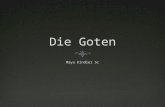Orpheus in der Spätantike (Studien und Kommentar zu den Argonautika des Orpheus: Ein literarisches,...
Transcript of Orpheus in der Spätantike (Studien und Kommentar zu den Argonautika des Orpheus: Ein literarisches,...

Die Fahrt 67
4. Orphisches und Neuplatonisches
Als größte hermeneutische Hürde in der Interpretation der AO erweist sichdie Frage, inwiefern diese allegorisch gelesen werden können. Im bisherigenGang der Untersuchung wurde die Errichtung eines vor allem deskriptivenund daher belastbaren und tragfähigen Gerüsts zur Interpretation der AOangestrebt. Aus diesem Grund wurde nach Möglichkeit vermieden, auf denkomplexen und methodisch mit besonderer Sorgfalt zu behandelnden Sach-verhalt einer möglichen Allegorese vorzugreifen. Es zeigte sich jedochbereits, dass eine Berücksichtigung der Bildhaftigkeit und ihres potentiellenSymbolwerts bei einer ernsthaften Beschäftigung mit den AO neue herme-neutische Ebenen erschließt. Allein die zuletzt erfolgte Behandlung desExokeanismos wie die erwähnten Parallelen zum Phänomen der Philoso-phenreise in den AO lassen eine entsprechende Untersuchung notwendigund sinnvoll erscheinen.
Mit der Frage einer möglichen Allegorese eng verbunden ist die, ob undinwieweit es möglich ist, die AO (auch) im Kontext religiöser oder philo-sophischer Literatur bzw. als solche zu lesen und zu interpretieren. Ihr sollim folgenden nachgegangen werden. Unter ‚religiös‘ wird dabei vor allem‚orphisch‘ verstanden1, unter ‚philosophisch‘ vor allem ‚neuplatonisch‘. DieGrundlage eines solchen Untersuchungsgangs bildet die bekannte enge Ver-bindung von Religion und Philosophie im Neuplatonismus.2
1 Für weitere Ausführungen siehe unten S. 71–76.2 Als weiterhin grundlegende Arbeiten sei hier auf die von Dörrie (v.a. [1963] und
[1975], v.a. S. 271–281) und Beierwaltes (v.a. [1965] und [2007]) verwiesen. Sieheetwa Beierwaltes (1965), v.a. S. 313–322, hier S. 315: „So zeigt sich gerade im Den-ken des Ursprung die notwendige Einheit von Philosophie und Religion im prokli-schen Denken.“ Zuletzt Beierwaltes (2007), S. 49: „Anähnlichung an Gott istgerade durch ihre philosophische Struktur die religiöse oder theologische Tätigkeit desPhilosophierenden, die Frömmigkeit des Denkens …“. Siehe auch unten S. 86Anm. 54.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

68 Orphisches und Neuplatonisches
4.1 Die AO im Kontext der Orphik
4.1.1 Argonautenmythos und Orphik
Im Rahmen der Übersicht über die ‚Vorgeschichte‘ des Argonautenmythosin der griechischen Literatur3 war bereits von Pindars 4. Pythischer Ode alseinem der ältesten literarischen Zeugnisse für die Teilnahme des Orpheus ander Argonautenfahrt die Rede. Für die vorliegende Untersuchung ist dies dieAusgangslage. Das Verhältnis Pindars zur Orphik ist seinerseits seit gerau-mer Zeit Gegenstand der Forschung. Die Befürworter einer Sicht, die vomVorhandensein bestimmter orphischer Vorstellungen im Werk des Theba-ners ausgeht, stellen wohl die Mehrheit. Die Forschungsdiskussion im ein-zelnen nachzuzeichnen, ist nicht Aufgabe der vorliegenden Arbeit. Auch dieFrage, inwiefern es sich bei den fraglichen Stellen im Œuvre des Thebanersum genuine Auffassungen Pindars oder aber ‚nur‘ um Referenzen an Adres-saten einzelner Oden (vor allem an Theron von Akragas im Fall der 2. Olym-pie4) handelt, ist für den vorliegenden Kontext irrelevant. Lloyd-Jones5 hat –mit Bezug vor allem auf die 2. Olympische Ode – darauf hingewiesen, dass einesolche Frage möglicherweise schlicht falsch gestellt sei.6 Zu einiger Skepsis,
3 S.o. S. 31.4 Für den anzunehmenden Hintergrund, dass Theron von Akragas selbst und seine
Familie mit einem (orphischen?) Mysterienkult in Verbindung standen, verweistLloyd-Jones (1985) auf die 3. Olympische Ode (Vers 41), wo es heißt, dass dieEmmenidai, d.h. die Familie Therons, Schützer bzw. Schutzherren von Mysteriengewesen seien. Lloyd-Jones kommt zu folgendem Schluß (a.a.O., S. 277): „Pindardescribes with sympathy the easy life in Hades of those who have been goodthroughout a single life (…). But his special interest is reserved for the inhabitantsof the Islands of the Blest, dwelling in their island in Okeanos with its golden flow-ers, with Kronos and with Radamanthys. The Orphic or Pythagorean scheme withits moral element has so influenced Pindar that he admits those who have lived outthree lives on earth without injustice; but he prefers to think in terms of the Islandsof the Blest known from Homer and Hesiod, where one could find the great heroeswhose deeds he loves to celebrate (…).
5 Lloyd-Jones (1985), S. 245–279. Zur Bedeutung gerade Pindars für die Rekonstruk-tion orphischer Unterweltsvorstellungen und seine Affinität zu orphischem Ge-dankengut siehe auch Graf/Johnston (2007), S. 100ff.
6 Lloyd-Jones (1985), S. 278: „Let us return to the question mentioned at the start; didPindar ‚believe‘ in this doctrine of an after-life, or did he merely work into his poemallusions to a belief cherished by his patron Theron? It is a question calculatedto perplex Christians and persons whose outlook is conditioned by Romanticism.Wilamowitz was not a Christian, but it has justly been remarked that the very title ofhis great book on Greek religion indicates that its author has been brought up as aLutheran. However, in dealing with Greek religion, the question as to what peoplebelieved is not always the right question to ask.“
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext der Orphik 69
was zumindest die Nachweisbarkeit einer eindeutig orphischen Prägung von(Jenseits-) Vorstellungen bei Pindar angeht, geben auch die AusführungenHolzhausens Anlass.7
Von Interesse für den Kontext der vorliegenden Untersuchung ist in-des die Tatsache, dass Vorstellungen und Formulierungen, die offenbardem Mysterienwesen bzw. der Mysteriensprache zuzuordnen sind, ihrenNiederschlag bereits im pindarischen Werk finden.8 Eine spezifisch orphi-sche Prägung ist damit zwar nicht notwendigerweise gegegeben, und zwarweder für Pindar (s.o.) noch für eine entsprechende Einordnung des Argo-nautenmythos beim Thebaner. Nicht zu bestreiten ist gleichwohl die Tatsa-che, dass der Argonautenmythos in seiner frühesten uns greifbaren Form,die über die bloße Nennung der Kernbegebenheiten des Mythos hinaus-geht (d.h. eben bei Pindar in der 4. Pythie), bei einem Autor begegnet, beidem das Mysterienwesen und mit diesem einhergehende Vorstellungenetwa soteriologischer Art eine Rolle spielen. Darüberhinaus ist festzuhal-ten, dass sich in der Erwähnung der Argonautenfahrt in der 4. Pythie einewesentliche Neuerung hinsichtlich der Motivation für die Fahrt findet: BeiPindar tritt – zumindest zum ersten Mal literarisch nachweisbar – über ei-nen recht unspezifisch konstatierten göttlichen Willen hinaus, wie er beiHesiod9 beschrieben wird, ein Traum des Pelias als Motivation für die Fahrtdes Iason und seiner Gefährten zutage: Pindar lässt diesen berichten10, dassihm der in Kolchis verstorbene Phrixos erschienen sei und aufgeforderthabe, seine Seele wieder heim nach Griechenland zu holen. Die unortho-doxe Art der kolchischen (Baum-)Bestattung, von der unter anderem beiApollonios die Rede sein wird (vgl. AR 3, 203ff.), wird von Pindar zwarnicht erwähnt, als Hintergrund für das Erscheinen des Traumbildes magaber der Wunsch des Phrixos nach einem Begräbnis nach griechischemBrauch, das für das Heil der Seele nach dem Tod essentiell wichtig ist, zu-
7 Siehe Holzhausen (2004), S. 20–36. Zu den pindarischen Jenseitsvorstellungen ins-gesamt siehe auch Graf (1974), S. 83–85, der in Hinsicht auf die Provenienz dersel-ben ebenfalls vorsichtig urteilt: „Die Herkunft der Pindarischen Bilder ist nicht völ-lig geklärt.“ (S. 86).
8 Lloyd-Jones (1985), S. 279: „It would appear that Theron was an initiate of a mys-tery cult; the Third Olympian (line 41) refers to the Emmenidai as „guarding the!�(�!�" of the blessed ones with pious purpose“. Even if Pindar had no part in sucha cult and did not share its special interests- and in Greek religion it was hard to ho-nour all gods in equal measure – one can understand that while he was composing apoem in honour of a family that subscribed to it, a family, moreover with which heseems to have had a specially close personal connection; this like the Eleusinian cultmay have kindled his imagination.“
9 Hes., Th. 992ff.10 Pind., Pyth. 4, 159ff.
Die AO im Kontext der Orphik
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

70 Orphisches und Neuplatonisches
grunde liegen.11 Welches (religionsgeschichtliche) Motiv hier auch immer imHintergrund der bei Pindar zu findenden Mythosversion gestanden habenmag, spätestens seit der 4. Pythie ist die Fahrt der Argonauten (zumindest la-tent) mit der Rückholung und ‚Erlösung‘ der Seele des Phrixos verbunden.12
Dies bedeutet gleichzeitig, dass der Argonautenmythos neben seinem Cha-rakter als Abenteuer- und Eroberungsfahrt in genannter Hinsicht (auch)über eine religiöse Dimension verfügt. Wenn diese – wie etwa bei Apollo-nios und Valerius Flaccus – im Vergleich zu anderen Aspekten (etwa derdichterisch kunstvollen, alexandrinischen Gestaltung bei Apollonios oderder römisch-teleologischen bei Valerius) in den Hintergrund tritt bzw. weitweniger relevant zu sein scheint als bei Pindar angedeutet, so bedeutet diesnicht, dass das grundsätzlich im Argonautenmythos angelegte religiösePotential nicht weiterhin vorhanden war und als solches erkannt werdenkonnte.13 D.h. auch wenn uns komplexere Funktionalisierungen dieses reli-
11 Eine solche Auffassung vertritt dezidiert Dräger (1993), S. 361: „Jedoch machte dasVlies dadurch, dass es den Angehörigen in Hellas im Traum erschien, auf die fürgriechisches Empfinden anstößige Bestattung aufmerksam und forderte seineRückführung nach Griechenland zu einer zumindest rituellen Beisetzung gemäßheimischer Sitte.“ Für die antike Auffassung der Notwendigkeit einer ordnungsge-mäßen Bestattung siehe auch de Coulanges (1961), S. 9: „Auf diese sonderbare An-sicht der Alten deutet ein Vers Pindars hin. Phryxos hatte Griechenland verlassenmüssen und war bis nach Colchis geflohen. Hier starb er; aber selbst nach demTode sehnte er sich, nach Griechenland zurückzukehren. Er erschien nun dem Pe-lias, hieß ihn nach Colchis gehen, um von dort seine Seele in die Heimat zu führen.Zweifellos hatte diese Seele nach dem Vaterlande, nach dem Grabe der FamilieSehnsucht; aber an die körperlichen Reste gebannt, konnte sie ohne diese Colchisnicht verlassen.“
12 Für die Annahme, dass das Motiv der Heimholung der Seele auf Pindar zurückgeht,siehe auch Radermacher (1938), S. 165. Dieses Motiv tritt in der Ausformung desMythos bei Apollonios Rhodios später in den Hintergrund, auch wenn Dräger(1993), S. 305ff. und 366 vehement betont, dass auch hier die Argonautenfahrtin Wirklichkeit nur um des Zornes des Zeus willen erfolgt, der die durch die fremd-artige Bestattung des Phrixos hervorgerufene „Befleckung“ nicht duldet. Hierzu istzu sagen, dass in AR 2, 1192ff., 3, 200ff. und 3, 336ff. zwar von Phrixos, der kol-chischen Sitte der Baumbestattung, ‚Befleckung‘ und dem Zorn des Zeus die Redeist, doch Drägers Schlussfolgerungen, was die Kausalitäten angeht, scheinen in die-sem Punkt nicht zwingend. Wenn man den Zorn des Zeus im Werk des Apollonioswirklich so stark hervorheben möchte, wie Dräger es tut, könnte man die genann-ten Stellen m.E. viel eher dahingehend interpretieren, dass der Zorn sich auf dasUnrecht bezieht, das dem Phrixos noch in Griechenland geschah, d.h. dass er über-haupt erst nach Kolchis fliehen musste. Der Wunsch des Phrixos, dass man seineSeele heimhole, wie es bei Pindar heißt, bleibt davon nichtsdestotrotz unberührt.
13 Inwieweit dieser religiöse Aspekt dem Mythos bereits in seinen frühesten Formeninhärent ist, ist aufgrund der Überlieferungslage nur schwer einzuschätzen. Bemer-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext der Orphik 71
giösen Grundtenors in literarischer Form nicht bekannt sind, so ist doch of-fensichtlich, welche Möglichkeiten der Argonautenmythos für Vereinnah-mungen durch soteriologische und damit auch orphische Vorstellungen bot.Das pindarische Exemplum (Heimholung der Phrixos-Seele) lässt sie in An-sätzen erkennen. Um zu untersuchen, inwiefern die AO diesen bei Pindarangelegten Faden aufnehmen und in der Verwendung (nun dezidiert) orphi-scher Motive und Vorstellungen eventuell über den Thebaner hinausgehen,erscheint es angebracht, den genauen Inhalt dessen, was im folgenden mit‚Orphik‘ und ‚orphisch‘ bezeichnet wird, zu umreißen.
4.1.2 Was ist ‚orphisch‘ und inwiefern lässt sich der Begriff‚orphisch‘ auf die AO anwenden?
Dass der Komplex, der weithin mit dem Begriff Orphik bezeichnet wird, inden AO eine Rolle spielt, wurde bereits im Kontext der Untersuchung zur,enzyklopädischen‘ Technik in den AO für die Lemmata ‚Orpheus‘ und‚Theogonie‘ herausgearbeitet.14 Gleichzeitig sind die Schwierigkeiten, diein der Vergangenheit damit einhergingen, eine präzise und zufriedenstel-lende Definition für die Begriffe ‚orphisch‘ oder ‚Orphik‘ zu finden, hin-länglich bekannt. Den wohl wichtigsten Schritt, sich dem Problem ‚Orphik‘zu nähern und es neuzeitlichem Verständnis zugänglich zu machen, unter-nahm Walter Burkert, indem er das bekannte Venn-Schema der sich teil-weise überlappenden Kreise zur Darstellung für verschiedene Mysterien-„Systeme“ verwendete.15 Vor allem die problematischen Komplexe, die mitden Begriffen bzw. Namen Pythagoras, Dionysos, Orpheus und Eleusis inVerbindung stehen, konnte Burkert so zueinander in Beziehung setzen mitdem Ergebnis, dass der Begriff ‚orphisch‘ im Zentrum dieser Komplexesteht und sich jeweils Überschneidungen zwischen dem Orphischen unddem Bakchischen, dem Orphischen und Pythagoras sowie zwischen demOrphischen und Eleusis ergeben (siehe Abbildung S. 73). Wie sehr geradefür den Bereich des Orphischen mit Überschneidungen zu rechnen ist – zunennen wären auch die Parallelen von Ägyptischem und Orphischem (s.u.S. 74f. Anm. 25) – und wie unpassend die Annahme von ‚Exklusivität‘ ist,wird durch ein solches Schema deutlich.
Über die Frage, mit welchem Inhalt der Begriff ‚orphisch‘ zu füllen ist,sagt ein solches Schema allein freilich noch nichts aus. Bei Burkert steht der
kenswert ist in jedem Fall, dass auch bei Hesiod (Th. 993) der Wille der Götter alsHintergrund für die Fahrt genannt wird.
14 S.o. S. 46 und 49.15 Siehe Burkert (1977), S. 6f. (=Burkert KS III [2006], S. 43f.)
Die AO im Kontext der Orphik
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

72 Orphisches und Neuplatonisches
Bereich des Mysterienwesens im Zentrum der Betrachtung. Im Ergebnis be-deutet dies, dass sich hinter dem Begriff des ‚Orphischen‘ ein durchausernstzunehmendes, wenn auch schwerlich klar von anderen abzugrenzendesreligiöses Phänomen verbirgt.16 Zusammenstellungen wie etwa die bei Alde-rink, was alles mit dem Namen ‚orphisch‘ bezeichnet werden kann, machenallerdings deutlich, dass das Begriffsfeld ‚orphisch‘ weit über den Bereichder Mysterien, ja sogar über den Bereich des Religiösen hinaus gehen kann.17
Vor allem der Bereich der Literatur, die unter dem Namen des Orpheus um-lief bzw. mit ihm in Verbindung gebracht wird, stellt hier einen bedeutendenund nicht unproblematischen Punkt dar. Die Frage, was eigentlich dazu be-rechtigt, so verschiedenartige literarische Werke wie etwa das Corpus der or-phischen Hymnen, die diversen unter seinem Namen umlaufenden Theogonien,die (uns ganz oder zum Teil verlorenen) Werke über Eide, das Netz oder denRaub der Persephone18 und schließlich die AO selbst als orphisch zu bezeich-nen, führten etwa West dazu, daran zu erinnern, dass als orphische Literaturschlicht solche bezeichnet wurde und werden kann, als deren Verfasser Or-pheus gilt.19 Eine solche Auffassung Wests von der ‚Konzeption‘ orphischerLiteratur, aber auch die Zusammenstellung der mit dem Adjektiv ‚orphisch‘bezeichneten Dinge und Phänomene bei Alderink finden ihre Bestätigigungin dem, was oben zur ,enzyklopädischen‘ Technik in den AO gesagt wordenist.20 Die AO stellen deshalb ein wichtiges literarisches Zeugnis für genau diebeiden Thesen dar, die hier unter den Namen Wests und Alderinks ange-führt wurden.
Wenn im folgenden die Möglichkeit der Einarbeitung orphischer Vor-stellungen und Konzepte in die Konzeption AO untersucht werden soll,wird es im Unterschied zu dem, was im Kontext der ,enzyklopädischen‘Technik an orphischen Details im West’schen oder Alderink’schen Sinneaufgeführt wurde, um orphische „Elemente“ in einem durchaus religiös-
16 Zum Nebeneinander von Bakchischem, Orphischem und Pythagoreischem siehejetzt auch Burkert (20112), S. 446.
17 Siehe Alderink (1981), S. 17f., der den Versuch unternimmt, eine Liste von zwölfPositionen zu entwerfen, was alles mit dem Begriff ‚orphisch‘ bezeichnet werdenkann und konnte. Wichtig ist auch Alderinks Problematisierung der Orphismus-Definitionen Guthries und Linforths, vgl. a.a.O., S. 18: „Guthrie’s definition appliesto Orphism, but what is said to be characteristic of Orphism is true but not of allOrphism. Linforth’s definition applies to vastly more than what was Orphic, and itis no wonder that „Orphic“ becomes a category designating members with virtuallynothing in common; it the term describes Orphism, it describes more thanOrphism.“
18 Für einen vollständigen Überblick siehe jetzt frr. 1–863 Bernabé.19 West (1983), S. 3.20 S.o. S. 50f.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext der Orphik 73
kultischen, d.h. Burkert’schen, Sinne gehen. Die angesprochene Problema-tik der regelmäßigen Überschneidung von orphischen mit anderen Vorstel-lungen ist stets zu berücksichtigen.
Die Probleme, die mit einem solchen Unterfangen einhergehen, wurdenbereits skizziert, und Vians ambivalentes Ergebnis, was die Existenz zahl-reicher orphischer Details und Elemente in den AO bei gleichzeitig konsta-tiertem Fehlen einer tiefergehenden orphischen Prägung angeht, ist be-kannt.21 Es werden daher grundsätzlich andere, von Vian nicht in Betrachtgezogene Quellen heranzuziehen sein, um die AO in ihrem Verhältnis zurBurkert’schen Orphismus-Auffassung im beschriebenen Sinne genauer ein-ordnen zu können. Die vor allem fragmentarisch erhaltenen bzw. verstreu-ten Zeugnisse orphischer Theogonien und anderer orphischer Dichtung,auch wenn ihre Präsenz in den AO deutlich ist, führen offensichtlich zu kei-nem befriedigenden Ergebnis.22
Als (primäre) Quellen orphischer Religiösität kommen vor allem zweiBereiche in Frage: Die orphischen Hymnen im literarischen sowie die soge-nannten orphischen Goldplättchen oder Täfelchen im subliterarischen bzw.archäologischen Bereich. Die Hymnen lassen dabei – ihrer Struktur und Na-tur entsprechend – weniger Rückschlüsse auf tiefergreifende Gemeinsam-keiten mit den AO zu, obgleich ihr religiöser und kultischer Charakter dercommunis opinio gemäß kaum anzuzweifeln sein wird und – auf strukturellerwie lexikalischer Ebene – durchaus Parallelen zu den AO bzw. einzelnenTeilpassagen zu erkennen sind. Auf die hymnische Struktur des Auftakts der
21 S.o. S. 9f.22 Zur ,enzyklopädischen‘ Funktion der AO s.o. S. 42ff.
Eleusis bakchisch
orphisch
Pythagoras
Die AO im Kontext der Orphik
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

74 Orphisches und Neuplatonisches
AO sowie die Nähe seiner Diktion gerade zu den orphischen Hymnenwurde bereits hingewiesen.23
Für den Zweck der vorliegenden Untersuchung ergiebiger sind dieGoldplättchen und die in diesen sich abzeichnenden Vorstellungen sowohlüber die anzustrebende Lebensführung im Diesseits wie die Beschaffenheitdes Jenseits. Diese sollen deshalb als Ausgangspunkt der folgenden Ausfüh-rungen dienen. In methodischer Hinsicht ist vorauszuschicken, dass es nichtdarum geht – und nicht darum gehen kann – zu zeigen, dass dem Verfasserdas Phänomen der Goldplättchen notwendigerweise vertraut gewesen seinmuss oder sich diese selbst in den AO wiederspiegeln. Allein vor dem Hin-tergrund, dass das Phänomen der Plättchen und die zu vermutende Abfas-sungszeit der AO nach bisherigem Kenntnisstand nicht korrelieren, ist hierVorsicht geboten (siehe unten).24 Es soll vielmehr darum gehen, auf einigebemerkenswerte und bislang nicht berücksichtigte Parallelen hinsichtlichbestimmter struktureller wie motivischer Elemente zwischen den AO undder Vorstellungswelt der Plättchen hinzuweisen.
Obwohl in der Forschung bis heute die Skepsis überwiegt, ob metho-disch gesicherte Rückschlüsse von den genannten Plättchen auf die Exis-tenz einer (wenn auch nicht notwendigerweise homogenen) ‚Orphik‘ ge-wonnen werden können25, so ist doch deutlich, dass sich in den Plättchen
23 Zu den hymnischen Elementen in den AO s.o. S. 25ff. Vgl. außerdem Vian (1987),S. 46: „Le poète lisait les Hymnes orphiques, ce qui ne surprend pas.“
24 So ist zu bedenken, dass das jüngste der (bislang gefundenen) Goldplättchen ins 3.Jh. n. Chr. datiert wird, also deutlich vor der anzunehmenden Abfassungszeit derAO. Die Tatsache, dass die einzelnen Funde der Plättchen aber einigermaßen dis-parat hinsichtlich ihrer zeitlichen wie örtlichen Verortungen sind, schränkt einensolchen Einwand wiederum ein.
25 Das Grundproblem im Umgang mit orphischen ‚Quellen‘ und Vorstellungen for-muliert West (1983), S. 3: „We must never say that ‚the Orphics‘ believed this or didthat, and anyone who does say it must be asked sharply ‚Which Orphics?‘ A recentdiscovery at the site of Olbia has made it probable that there existed a sect there inthe fifth century BC who may properly be called Orphics. Evidence from art pointsto the existence of an Orphic group at Tarentum in the second half of the fourthcentury. It is legitimate to talk about these Olbian or Tarentine Orphics, or anyother specific group of Orphics that we can identify, but not to talk about ‚theOrphics‘ in general.“ Dagegen Merkelbach (1999), S. 6f.: „Der orphische Mythosbildet den Hintergrund zu den Texten auf den Goldblättchen. Dies ist oft vermutet,aber immer wieder bestritten worden. Ein jeden Zweifel ausschließender Beweis istauch heute nicht möglich; der Name des Orpheus kommt auf den Goldblättchennicht vor. Aber die Übereinstimmungen mit dem orphischen Mythos sind durchneugefundene Texte so zahlreich geworden, dass man an dem orphischen Hinter-grund kaum zweifeln kann, zumal wenn man an Herodots Zeugnis für den Zusam-menhang der ägyptischen und bakchischen mit den orphischen Riten denkt.“ Mer-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext der Orphik 75
eine über Jahrhunderte und weite Entfernungen einigermaßen konstanteVorstellungswelt niederschlägt.26 So hat die inzwischen intensive Beschäfti-gung mit den Goldplättchen gezeigt, dass zwar die eschatologischen Vor-stellungen einzelner Goldplättchen voneinander abweichen können.27 Den-noch sind – und dies muss entschieden betont werden – drei Motive bzw.Aspekte durchgehend in allen Täfelchen, die nicht nur den Namen des oderder Verstorbenen trugen, von Bedeutung. Dies sind die Motive Reinheit,Wissen und Reise/Unterweltsgeographie: Reinheit in dem Sinne, dass sichder Tote durch seine Initiierung in einen Mysterienkult zu Lebzeiten von dermenschlichen ‚Urbefleckung‘, die aus der Herkunft aller Menschen aus demtitanischen Geschlecht resultiert28, sowie von persönlichen, individuellenMiasmata reingewaschen hat.29 Wissen insofern, als der Tote durch sein Da-sein als Myste zu Lebzeiten erstens das nötige Wissen für eine kultisch-ritu-elle Reinigung (die Grundbedingung für eine positive Aufnahme im Toten-reich) sowie zweitens die entscheidenden Hinweise erhalten hat, wie sich dieSeele nach dem Tode im Totenreich zu verhalten hat.30 Mit dem letztge-
kelbach ist es auch, der auf die erheblichen Parallelen, die zwischen der Vorstel-lungswelt der Goldplättchen und ägyptischen Totenbüchern bestehen, hinweist.Eine solche Beziehung von orphischen und ägyptischen Vorstellungen war in derAntike präsent: Herodot (2, 81) wird hierfür als einer der prominentesten Belegegelten können, doch auch in den AO selbst stellt die Erwähnung der Ägyptenauf-enthaltes durch Orpheus (vgl. AO 43–45) ein Echo auf diese Verbindung dar.
26 Der geographische wie zeitliche Rahmen, aus dem uns die erwähnten Plättchen be-kannt sind, umfasst ein Verbreitungsgebiet vom Schwarzen Meer über das griechi-sche Festland und Kreta bis nach Süditalien und Sizilien, und das mindestens von400 v. Chr. bis zum 2./3. Jahrhundert n. Chr. Zum Beleg siehe die Zuordnungen der39 bei Graf/Johnston (2007) aufgeführten Täfelchen, a.a.O., S. 4–49.
27 Graf/Johnston (2007), S. 108: „It once again underscores how open to modifica-tion both the words of the tablets and the ideas that underlay them could be in a sys-tem that perpetuated itself through itinerant, independent initiators“; siehe aucha.a.O., S. 119.
28 Proklos, In Remp. II, 74, 30 Kroll; Damaskios, In Phaed. 8 Westerink.29 Siehe etwa die Goldplättchen frr. 5, 6, 7 und 9 Graf/Johnston [=frr. 482, 490, 489,
491 Bernabé], in denen es regelmäßig heißt: G �����/G ��!�� �� ��*� 7� ��*� '[sc. J%�+].
30 Eine sehr knappe Unterweisung enthält etwa fr. 1, 10–12 Graf/Johnston, die exem-pli gratia gegeben sei:�ρ���α „6µ« �»« ��� ��λ #O ��Λ� $!� ���!�«.$"J�� $’ ��’ �σ�« ��λ $��((%���α $(B $�!’ 7�[��J%� µ� C$� ������ !Λ�« M�������« $�µ ("���[«].“Sprich: „Ich bin ein Sohn der Erde und des bestirnten Himmels.Ich komme um vor Durst: Aber gib mir schnellkaltes Wasser zu trinken vom See der ‚Erinnerung‘.“Andere Darstellungen sind z.T. sehr viel ausführlicher.
Die AO im Kontext der Orphik
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

76 Orphisches und Neuplatonisches
nannten Punkt eng verbunden schließlich der Aspekt eines Ganges odereiner Reise durch die Unterwelt, die die Seele nach ihrem Tod zu absolvierenhat,31 samt deren ‚Geographie‘.
4.1.3 Das Motiv der Unterweltsreise und -geographiein den orphischen Goldplättchen und in den AO
In den AO findet sich in den Versen 1128–1144 eine Passage, in der be-schrieben wird, wie die Argonauten im Zuge ihrer Rück- bzw. Irrfahrt einendeutlich als Jenseits gekennzeichneten Ort erreichen, dessen jenseitigerCharakter nicht zuletzt durch seine Lokalisation am Okeanos hervorgeho-ben wird.32 Zuvor hat die Fahrt die Argonauten unter anderem zu denHyperboreern (AO 1077.1082), den Makrobiern33 (AO 1107) und den Kim-meriern (AO 1120) geführt, deutliches Signal dafür, dass man in den Gegen-den dieser Völker die Gefilde der realen Welt zu verlassen beginnt bzw.bereits verlassen hat. Am Ufer des Okeanos (AO 1129) stößt man dann aufdie Quelle des Acheron (AO 1130–1132), der in einen „weiter innen liegen-den See“ mündet (AO 1132f.) und an dessen Ufer sich „blühende Bäume“befinden (AO 1133–1135). Außerdem sehen die Argonauten, ebenfalls inder Nähe des Sees, eine rätselhafte Stadt, in der das „Geschlecht der gerech-testen Menschen“ wohnt (AO 1136–1139), wohlgefügte Wege sowie die„unzerbrechlichen Tore des Hades“ (AO 1141f.).
Dabei handelt es sich um eine Szenerie, die „plus ou moins homériqueet, somme toute, traditionelle“ ist.34 Die Analogie zu den entsprechendenUnterweltsschilderungen in der Odyssee im 10. und 11. Gesang ist evident.In Ergänzung zur homerischen Parallele führt Vian außerdem vor allem inHinblick auf die in den AO erwähnte Stadt Hermioneia (AO 1136–1141) dieExistenz der Stadt Hermione in der Argolis an, von der Pausanias berichtet,dass es in ihrer Nähe erstens einen Eingang in die Unterwelt gebe, zweitensihre Einwohner der Abgabe des Fährgeldes beim Übersetzen ins Totenreichenthoben seien und sich drittens in der Nähe der Stadt ein Fluss befinde,der – wie häufig auch der Acheron – als goldführend bezeichnet werde, so-wie ein als „acherousischer See“ bezeichnetes Gewässer.35 Vian gelingt es,
31 Siehe fr. 1, 1–7 Graf/Johnston. Siehe auch unten S. 78.32 Zur Vorstellung des Okeanos als einer Grenzscheide zwischen Diesseitigem und
Jenseitigem s.o. S. 55ff.33 Das Attribut ‚Makrobier‘ erhalten interessanterweise auch Inder oder Äthiopier,
Völker, die als am Rande der Welt lebend gedacht wurden, s.o. S. 63 Anm. 121.34 Vian (1987), S. 40.35 Siehe Pausanias 2, 31, 10; 2, 35, 10; außerdem Strabon 8, 6, 12.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext der Orphik 77
eine nahezu vollständige Parallelität der einzelnen Elemente der Unterwelts-szenerie in den AO zu anderen literarischen Unterweltsschilderungen bzw.in diesem Kontext relevanten Darlegungen aufzuzeigen. Eine solche Fest-stellung von Parallelität kann aber keinen Anspruch auf alleinige oder aus-schließliche Geltung erheben. Alle griechischen Unterweltsschilderungenund Hadesfahrten erweisen sich letztlich als am Modell der odysseischenNekyia orientiert.36 Hinsichtlich der Schilderung in den AO könnte auch aufdie Parallelität zum platonischen Phaidon verwiesen werden, die bislang er-staunlicherweise überhaupt keinen Eingang in die Interpretation der Pas-sage gefunden hat.37 Auch dort ist von Okeanos und Acheron als Unter-weltsflüssen (unter anderen) die Rede sowie von einem acherousischen See.In der vergilischen Aeneis38 ist von den Träumen, die als unter Blättern hän-gend beschrieben werden (wodurch wie in den AO die Existenz von Bäu-men in der Unterwelt impliziert wird), die Rede, und die Reihe von weiterenparallelen Schilderungen und Vorstellungen ließe sich fortsetzen.
Offensichtlich kann es nicht darum gehen, einzelne Jenseits- oder Un-terweltsdarstellungen gegeneinander auszuspielen. Den genauen Grad, indem diese in die Komposition der AO eingegangen sind, ist nicht bestimm-bar. Dass womöglich ein weites Spektrum an entsprechenden Darstellungendurchaus heterogener Provenienz im Hintergrund der Schilderung in denAO zu vermuten ist, sollte als wahrscheinlich angenommen werden. ImKontext der vorliegenden Untersuchung soll der Blick dennoch darauf ge-lenkt werden, dass Parallelen auch zwischen der Schilderung der AO undden halbliterarischen Darstellungen der bereits erwähnten Goldplättchen zukonstatieren sind, deren Parallelen im Detail frappierend sind und die nichtohne weiteres auf Gemeinsamkeiten rein literarischer Natur zurückzufüh-ren sind.
In verschiedenen Plättchen wird beschrieben, wie die Seele nach demTode einen Gang bzw. eine Reise durch das Totenreich zu absolvieren hat,verbunden mit diversen Hinweisen, worauf sie auf ihrem Weg zu achtenbzw. wovor sich sich in Acht zu nehmen hat. Für die ‚Rekonstruktion‘ derentsprechenden Unterweltsgeographie lassen sich dabei mehrere Elemente
36 Der homerische Einfluss erstreckt sich sogar auf Szenen und Szenerien, die selbstgar nicht mehr explizit Unterweltsschilderungen enthalten bzw. darstellen, aber vonden homerischen Nekyia-Darstellungen dennoch literarisch abhängig sind wie dieSchilderung des Aufenthalts der Argonauten bei den Mariandynern bei Apollonios(AR 2, 720ff.). Dazu Poulheria (1995).
37 Platon, Phd. 112e-113c. Im Phaidon werden mit Phasis und den Säulen des Herakles(109b1) übrigens die beiden Enden der Welt genannt, die auch in den AO als diebeiden äußersten Punkte der Argonautenfahrt in östlicher und westlicher Hinsichtangesehen werden können, siehe auch Vians Karte (1987).
38 Vergil, Aen. 6, 283f.
Die AO im Kontext der Orphik
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

78 Orphisches und Neuplatonisches
als mehr oder weniger konstitutiv erkennen. In der beschriebenen Unterweltgibt es Wege, ein Haus bzw. mehrere Häuser, eine Quelle, Bäume und einenSee. So heißt es z.B. im Plättchen fr.1, 1–7 Graf/Johnston (= fr. 474 Ber-nabé), in dem eine der ausführlichsten Beschreibungen der Unterweltsgeo-graphie in Form eines Goldplättchens vorliegt, wie folgt:
Eine Nähe auch dieser Unterweltsgeographie zur Schilderung der AO istevident. Vor allem die Aspekte, für die die homerische Parallele angeführtwird, finden ihre Entsprechung größtenteils auch in der Vorstellungsweltder Goldplättchen: So ist zwar nicht von einer Stadt wie in den AO und beiHomer die Rede, aber doch vom Haus des Hades. Außerdem ist von einerQuelle die Rede, die – im Unterschied zur odysseischen Schilderung – auchin den AO gegeben scheint, wenn man das $��(�@�� (AO 1130) in diesemSinne versteht. Die interessantesten Übereinstimmungen zur Vorstellungs-welt der Goldplättchen, die sich in dieser Parallelität nicht bei Homer (undPlaton) finden, stellen in der Schilderung der AO aber wohl die Beschrei-bung der Bäume (AO 1134: $��$ �� !�(�*'��!�) sowie die nähere Qualifi-zierung der Acheron-Umgebung als ‚eiskalt‘ (AO 1131: � %� �1 $�B �8 �%)dar, die mit der Erwähnung der ‚weißen Zypresse‘ ((�%�B �%�' ��«) unddem ‚kalten Wasser‘ (J%� µ� C$� ) in den Goldplättchen korrespondieren.Von einer Beschreibung des Acheron als kalt ist bei Homer und im Phaidonnicht die Rede, und wenn auch in der Odyssee von Bäumen (Pappeln undWeiden) an dessen Ufer die Rede ist (Od. 10, 510), so ist in der Wortwahl derAO (!�(�*'�: AO 1134) eine interessante Parallele zur Ausdrucksweise derPlättchen enthalten, wenn man das Wort, mit dem die Bäume näher be-schrieben werden, im eigentlichen Sinn seiner Wortbestandteile begreift undsich von der in den einschlägigen Wörterbüchern gegebenen Bedeutung
M�������« !�$� G ���, ���λ `���((��� *��Λ�*��
Dies ist das Werk der ‚Erinnerung‘,da du im Begriff bist zu sterben
�,« #Aa$�� $���« �/� ��«. G!’ ��λ$!�")�B � ���,
in das wohlgefügte Haus des Hades.Zur rechten gibt es eine Quelle,
�B $’ �/!B� <!��1� (�%�B�%�' ��«α
bei der steht eine leuchtend weißeZypresse.
G�*� ��!� ������� J%��λ ������J����!��.
Dort hinunter kommen die Seelen derToten und erfrischen sich.
!��!�« !»« � '��« ��$; ��$µ�����*�� G(*��«.
Diesen Quellen nähere dich ja nicht!
� �*�� $; h�% ���« !»«M�������« $�µ ("���«
Weiter vorn wirst du kaltes Wasser ausdem See
J%� µ� C$� � � ���α �(���« $;����� *�� G��.
der ‚Erinnerung‘ finden: Wächterbefinden sich darüber (davor?).
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext der Orphik 79
„blühen“ löst: Der Wendung wohnt dann interessanterweise der Aspekt des‚weithin sichtbaren Blühens‘ inne, eine Eigenschaft, die auch hinter der For-mulierung der ‚weißen‘ bzw. eben ‚weithin sichtbaren‘ Zypresse an dem See,der in der Geographie der Goldplättchen erwähnt wird, stehen dürfte.39
Man könnte einwenden, dass die erwähnten Bäume auch in der Odyssee als‚groß‘ bezeichnet werden und somit ebenfalls als Parallele für den Aspektdes ‚weithin sichtbaren Blühens‘ in den AO infrage kommen. Allerdingsscheint in der Fortführung des Gedankens in den AO deutlich der Aspektdes Leuchtens bzw. Strahlens und damit eben der in den Plättchen ausge-drückte Aspekt angelegt zu sein, wenn in den AO davon die Rede ist, dassdie Bäume sowohl bei Tag wie auch bei Nacht ‚weithin blühen‘ (AO 1135:���!�« !� ��λ b��!�). Sie sind also nicht als groß (wie in der Odyssee), sondernals leuchtend (wie in den Plättchen) vorzustellen. Zumindest dieses Detailkönnte ein Indiz sein, für die AO-Szene neben literarisch überformten Un-terweltsvorstellungen die Verarbeitung originär religiöser Vorstellungen, wiesie etwa in den Plättchen ihren subliterarischen Ausdruck finden, annehmenzu können.40
Die geschilderte Episode einer ‚Unterweltsschau‘ wirft aber weitere Fra-gen auf, etwa die, inwieweit die Fahrt der Argonauten insgesamt im Rahmenjener Vorstellungen gesehen werden kann oder sollte, die den religiösenHintergrund für das Phänomen der Plättchen als Grabbeigabe bilden, d.h.jenseits von Parallelen im Detail. Einer allgemeinen Vergleichbarkeit desReise-Motivs in den Plättchen und in den AO scheint zunächt entgegenzu-
39 Eine Übersicht über die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten bieten Graf/Johns-ton (2007), S. 109: „Marcello Gigante conjectured that the tree’s color [d.h. dasWeiß der in den Goldplättchen erwähnten Zypresse am See des Vergessens] mightbe connected with the white clothing worn by initiates into some mysteries; Ber-nabé and Jiménez Cristóbal have pointed to the use of white cloth in burials. Anot-her train of thought has understood the tree’s whiteness to signal the inverted na-ture of the Underworld – trees are not white in the upper world. Most persuasive tomy mind, however, is Zuntz’s observation that leukos can mean not merely white,but brilliantly white or shining. The tree’s color, therefore, makes it stand out betterin the gloom of the Underworld – a gloom that is explicitly mentioned in several ofthe tablets. (…)“
40 Zum Problem der (oft) fehlenden Exklusivität solcher Vorstellungen s.o. S. 71. Soist vom Vorhandensein eines Baumes in der Nähe eines Gewässers auch in denägyptischen Totenbüchern die Rede, siehe Merkelbach (1999), S. 3. Dass diese je-doch leuchten, begegnet m.W. nur im orphischen Kontext der Plättchen. Ein ähn-liches Bild findet sich zwar auch bei Pindar in der Formulierung der „goldenen Blü-ten“ (Ν�*��� � %�1) und „schimmernden Bäume“ ($�(�7� $��$ ���, 2. Ol. 72f.),doch spielt wiederum bei Pindar und insbesondere in der 2. olympischen Ode geradeder Aspekt einer orphischen Prägung womöglich eine entscheidende Rolle, s.o.S. 68–71.
Die AO im Kontext der Orphik
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

80 Orphisches und Neuplatonisches
stehen, dass die in den Versen 1128–1144 dargestellte Szenerie ein gewisser-maßen statisches Gebilde darstellt (die Argonauten betreten die Stadt janicht, noch durchschreiten sie die Tore des Hades), während in den Gold-plättchen von einer Reise der Seele durch die beschriebene Unterweltsland-schaft die Rede ist. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass auch in derSchilderung der Plättchen nicht die eigentliche Wanderung der Seele be-schrieben wird, sondern nur ihr potentieller Weg bzw. die ‚Landschaft‘,durch die sie ihren Weg nach dem Tod wird nehmen müssen. Eine solche‚Landschaft‘ wiederum ist eben auch in den AO beschrieben. Die Parallelitätzwischen der Vorstellungswelt der Goldplättchen und der Anlage der AO istdarüberhinaus vor allem in einem weiteren Rahmen zu sehen: In Analogiedazu, wie die Seele in der Vorstellung der Plättchen ihre Reise im Kontextder Unterweltsgeographie nur aufgrund von Wissen zu meistern in der Lageist, das in Mysterienkontexten gewonnen wurde, überstehen die Argonautenihre Fahrt, die sie bis in den Okeanos und damit in die Grenzregion zwi-schen Diesseits und Jenseits führt, nicht zuletzt deshalb, weil sie bereits wäh-rend der Hinfahrt durch Orpheus in die Mysterien von Samothrake einge-weiht worden sind (AO 466–469). Eine solche Kausalität wird im Epos zwarnicht explizit hergestellt, doch die Mysterien von Samothrake waren in derAntike für ihre schützende Funktion in Seefahrtangelegenheiten berühmt.41
Die Initiation durch Orpheus, wenngleich sie bereits bei Apollonios bezeugtist, besäße in den AO, wenn man dieser Deutung folgen will, einiges Ge-wicht und wäre im vorliegenden Kontext insofern von Bedeutung, als dieEinweihung bereits im voraus erfolgt ist: Nicht erst während der eindring-lichen Gefahr des Okeanos- bzw. Jenseits-Aufenthalts, sondern bereits imVorfeld hätte so die Einweihung in Mysterien durch Orpheus die Argonau-ten vor ihrem Verderben bewahrt. In ein solches Bild fügte sich die eher zu-rückhaltende Rolle des Orpheus während der Okeanos-Befahrung gut ein.Innerhalb des Bereiches des Okeanos ist es mit Ausnahme der Orpheus-Warnung, gegen Ende des Exokeanismos die Insel der Demeter anzulaufen(AO 1197–1205), göttliches Eingreifen selbst, das den Argonauten in Formvon Warnungen und Weisungen aus dem Munde Argos (AO 1159–1169)und Kirkes (AO 1226–1237) zu einem glücklichen Ende der Fahrt verhilft.Orpheus erfüllt während der Okeanosbefahrung eher die Funktion eines‚Geleiters‘, der die Argonauten auf ihrer Fahrt in den Bereich des Okeanos-Jenseits hinein und auch wieder hinausführt, ohne dort eine aktive Füh-rungsposition innezuhaben. Analog erfolgt im Leben des Mysten die Weihevor dem Jenseitsaufenthalt, auf das ihn Orpheotelesten und andere Myste-rienkundige vorbereiten. Im Jenseits erscheint die Orpheus-Figur oder gar
41 Siehe AR 1, 916–918.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext der Orphik 81
der Orpheotelest nicht selbst, um im Bereich der Unterweltsgeographie ak-tiv zu führen.42
Doch zurück zur Erwähnung der Mysterien von Samothrake, in die Or-pheus die Argonauten einweihte. Mit ihrer Nennung werden – neben demeben behandelten Aspekt der ‚Unterweltsgeographie‘ – zwei Begriffe undVorstellungen impliziert, die für die Vorstellungswelt der Goldplättchen wieauch für die Konzeption der AO von zentraler Bedeutung sind. Wie dieMysten, in deren Gräbern sich die Goldplättchen fanden, vor ihrem Toddurch Reinigungen und Wissenserwerb für ihr Wohlergehen nach dem Todzu sorgen haben, so stellen beide Begriffe auch in der epischen Darstellungder AO bedeutende Motive dar.
4.1.4 Die Motive ‚Reinheit‘ und ‚Wissen‘ in den AO
Wie die hervorgehobene Rolle des Orpheus in den AO auch bei Apolloniosvon Rhodos angelegt ist43, so gilt Gleiches für das Motiv der Schuld der Ar-gonauten bzw. ihrer Befleckung durch den an Apsyrtos begangenen Mord.Apollonios (AR 4, 557ff.) lässt Zeus verkünden, dass die Argonauten nachdem erwähnten Mord erst nach einer rituellen Reinigung und vielerlei Lei-den wieder in ihre Heimat zurückkehren werden. Kirke (AR 4, 698ff.) voll-führt dann an Iason und Medea ein Reinigungsopfer für die schuldbelade-nen Schutzflehenden, weist sie im Anschluss aber aus ihrem Haus, da sie dieTaten und Pläne Medeas, ihrer Verwandten, nicht dulden kann. Das Motiveiner rituellen Verunreinigung der Argonauten bzw. zumindest Iasons undMedeas ist bei Apollonios also durchaus präsent. Dennoch bleibt es einebloße Episode: Man kann sich als Rezipient nicht des Eindrucks erwehren,dass das erwähnte Sühnopfer bzw. die Reinigung zwar stattfindet und in sei-ner rituellen Bedeutung auch gewürdigt wird, aber die Tatsache, dass „Iasonund Medea von Kirke entsühnt werden (…), für den Gang der Ereignisseganz unerheblich zu sein“44 scheint.
Eine gänzlich andere Gewichtung lässt sich für die AO feststellen: Spä-testens seit der Ankündigung der Argo in den Gewässern des Okeanos, dassden Argonauten durch ihre Blutschuld und Befleckung tödliches Unheildrohe (AO 1159–1169), vor allem aber seit der Landung der Argo auf derInsel Kirkes (ebenfalls im Okeanos) und ihren mahnenden Worten steht dieFahrt ganz im Zeichen der zu erlangenden Entsühnung vom Miasma der
42 Zum Motiv der Geleitfunktion, die dem Orpheus auch in den AO zukommenkann, s.u. den Kommentar zu den Versen AO 576–593.
43 S.o. S. 33.44 So Radermacher (1938), S. 207.
Die AO im Kontext der Orphik
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

82 Orphisches und Neuplatonisches
Blutschuld. Neben der Heimkehr der Argonauten um Iason und der Über-bringung des Vlieses nach Iolkos wird die von Kirke im Okeanos angeord-nete Reinigung zu einem zweiten Ziel der Fahrt, auf das die Erzählung derAO von nun an als ihrem eigentlichen !�(�« zustrebt.
Die explizit betonte Notwendigkeit der wiederzuerlangenden Rein-heit wird von Kirke nicht nur in vagen Zügen verordnet, sondern es werdenkonkrete Anweisungen gegeben, auf welche Weise die Reinigung vonstattenzu gehen habe: nach dem ‚Wissen‘ des Orpheus (AO 1233 #O ��«,$�����9�). Nicht sie selbst will also die rituelle Reinigung vornehmen, wiedies bei Apollonios der Fall war (s.o.), sondern an Orpheus deligiert dieTochter des Sonnengottes diese Aufgabe. Einzig dessen Wissen und darausresultierend die Reinigung (AO 1366: ¹� B (�! � ��*� �7�) vermögen einMiasma dieser Schwere, das in den AO als ein so massiv verstandenes Un-recht geschildert wird, dass Kirke die Verunreinigten im Gegensatz zurSchilderung bei Apollonios nicht einmal in ihr Haus bittet, zu sühnen unddie Delinquenten wieder rein zu machen.
Durch die Mythosvariation, dass sich in den AO die Reinigung der Ar-gonauten von Kirke auf Orpheus verlagert, wird diesem sowie seinem Wis-sen und seiner reinigenden Kraft also eine epos-interne Funktion beigemes-sen, die nicht nur über die Schilderung bei Apollonios hinausgeht, sonderndie mit der Vorstellungswelt der Goldplättchen vor ihrem anzunehmendenMysterienhintergrund hinsichtlich der Aspekte Reinheit und Wissen korre-liert. Die orphischen Goldplättchen bezeugen diese Aspekte ausdrücklich inihrer Bedeutung für das Wohlergehen der Seele(n) im Totenreich: Erstensmuss der Besitzer der Seele noch zu Lebzeiten Wissen erlangt haben, wie sichdie Seele nach seinem Tod im Totenreich zu verhalten hat. Ausdruck dieseroffensichtlich empfundenen Notwendigkeit ist die Tatsache, dass auf meh-reren Goldplättchen explizite Anweisungen festgehalten sind, etwa in welcheRichtung sich die Seele zu wenden habe, welchen Unterwegspfad sie einzu-schlagen habe, dass sie nicht von dem in mehreren Goldplättchen erwähntenersten See, an den sie gelangen werde, trinken dürfe (denn dies sei der See desVergessens), sondern diesen passieren müsse, woraufhin sie an einen zweitenSee bzw. eine zweite Quelle gelangen werde, aus der zu trinken gestattet sei,nämlich die Quelle bzw. der See der Erinnerung. Darüber hinaus wird inmanchen Plättchen von Unterweltswächtern gesprochen, denen Auskunftzu erteilen und denen auch ‚Passwörter‘ zu nennen seien. Ohne dieses zuLebzeiten erworbene Wissen, so muss man schließen, stünde die Seele nachdem Tod ihres leiblichen Körpers in der nicht zu unterschätzenden Gefahr,sich im Totenreich falsch zu verhalten. Das Erlangen dieses zu Lebzeiten zuerwerbenden Wissens erhält auf diese Weise einen wichtigen Stellenwert.
Zweitens tritt in den bereits erwähnten Formeln und Passwörtern, diedie Seele, wenn sie von Unerweltswächtern nach ihrer Herkunft und ihrem
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext der Orphik 83
Tun in der Unterwelt gefragt wird, das bereits erwähnte Motiv der Reinheithinzu.45 Woher diese Reinheit stammt, steht außer Frage, nämlich aus derEinweihung in einen oder mehrere Mysterienkulte noch zu Lebzeiten. Dasses sich dabei nicht notwendigerweise um einen einmaligen Vorgang des Wis-senserwerbs und der Reinigung handelt, belegt etwa Plättchen Nr. 28 Graf/Johnston, das interessanterweise die Beteuerung der Seele des Verstorbenenenthält, sich zu Lebzeiten nicht nur in einen Mysterienkult eingeweiht zuhaben, sondern in mehrere, was mit der Bitte einhergeht, sie, die Seele, zuden Festgelagen der (anderen) Eingeweihten zu entsenden bzw. vorzulassen:����� �� � µ« �%!7!�" *�'�%«α G�� F ��� [B'���%] | U+��! �« X*��"�«!� !!�"(� ��λ M�! µ« LO �"[�«]. Dass die Idee einer gewissermaßen „kumu-lativen Sicherheit“, die uns in diesem Plättchen begegnet, keinen Einzelfalldarstellte, darf vermutet werden.
In Analogie dazu zeigt sich auch im Lauf der epischen Erzählung derAO, dass das Wissen des Orpheus für das Gelingen der Fahrt immer wiedervonnöten ist und es sich nicht um ein einmaliges Eingreifen des Orpheushandelt, sondern der Gedanke einer kumulativen Sicherheit durch kumula-tiven Wissenserwerb und wiederholte Reinigungen auch in der Konzeptionder AO angelegt ist. Dass ein Wissen des Orpheus, das nicht allgemein zu-gänglich ist, in den AO an zahlreichen Punkten eine bedeutsame Rolle spielt,war bereits mehrfach angeklungen: Sowohl bei der Passage der KyanischenFelsen wie auch bei der der Demeterinsel fungiert Orpheus aufgrund seinesWissenvorsprungs als Wegweiser. Die Motive Wissen und Reinheit zusam-men klingen außerdem in den bereits mehrfach erwähnten Episoden derInitiation in die Mysterien von Samothrake (AO 466–469) sowie der Reini-gung der Argonauten gemäß dem Wissen des Orpheus (AO 1366–1369) an.
Nimmt man zu dem bis hierhin Ausgeführten die literarischen Nach-richten über die kathartische Funktion von Schriften hinzu, die in der Antikeunter dem Namen des Orpheus verbreitet wurden, sowie über die Existenzvon umherziehenden ‚Wanderpredigern‘, die ihren Zeitgenossen durchReinigungen und Initiierungen in Mysterienkulte den Weg zu einem ‚geläu-terten‘ Leben (auch nach dem Tod) weisen und bezeichnenderweise als#O ��!�(�!�" bezeichnet werden konnten46, so ergibt sich der bemerkens-werte Effekt, dass Orpheus in der Komposition der AO die Funktion einessolchen Orpheotelesten übernimmt und – in der Fiktion des mythenhisto-
45 S.o. S. 75 Anm. 29.46 Siehe etwa Platon, Pol. 364c–365a; Theophrast, Charakt. 16, 11 (=fr. 654 T Ber-
nabé); Plut., mor. 224e3 (Apophthegmata Lac [= fr. 653 T Bernabé]); Philodem, Depoem. P.Herc. 1074 fr. 30 (= fr. 655 T Bernabé). Für eine Übersicht über die verschie-denen Bezeichnungen derjenigen, die mit orphischen oder dionysischen Kulten inVerbindung standen oder diese ausführten, siehe Bernabé II, 2 (2005), S. 222.
Die AO im Kontext der Orphik
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

84 Orphisches und Neuplatonisches
risch in ferner Vorzeit angeordneten Geschehens der Argonautenfahrt – ge-wissermaßen als Proto-Orpheotelest inszeniert wird.
4.1.5 Die Adaption orphischer Vorstellungen in den AO:Versuch eines Zwischenfazits
Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen ergibt sich das Bild,dass in einzelnen motivischen wie strukturellen Elementen der AO bemer-kenswerte, bislang unbeachtete Parallelen zur Vorstellungswelt der Gold-plättchen auszumachen sind. Über die Zuschreibung der AO an ihren „Ver-fasser“ Orpheus hinaus, die nach Wests Definition allein bereits genügte, dieAO als orphisch zu bezeichnen, lässt sich so feststellen, dass die Verarbei-tung orphischer Motive nicht auf die Ebene einer Verfasserzuschreibungbeschränkt bleibt. Durch die inhaltliche Nähe zur Vorstellungswelt derGoldplättchen in der Darstellung der AO ist eine durchaus tiefgreifendeRezeption und Einarbeitung solcher Vorstellungen zu beobachten, die auchdem Mysterienhintergrund der Goldplättchen zugrunde liegt. Dass diesePlättchen – in welchem Grade auch immer – mit dem Phänomen der Or-phik in Zusammenhang stehen, ist heute kaum noch zu bestreiten. DiesesFaktum sowie die besondere Stellung des Orpheus in der Erzählung der AOlassen deshalb das Urteil zu, dass auch die AO als ein ernstzunehmendesEcho auf orphische Vorstellungen gelten können, wie sie archäologisch inForm der Goldplättchen, hinsichtlich der Aspekte ‚Wissen‘ und ‚Reinigung‘aber auch in literarischen Zeugnissen greifbar sind.47
Luisellis Auffassung, dass der Verfasser der AO diese als einen bewuss-ten Bruch mit anderer unter dem Namen des Orpheus umlaufender Litera-tur konzipierte48, wird durch das hier gewonnene Ergebnis nicht widerlegt,sollte aber modifiziert werden: Richtig ist, dass die Verarbeitung auch sol-cher Vorstellungen, die unbestreitbar einem Mysterienkontext entnommenbzw. verwandt sind, keinen Anlass bietet, den AO eine kultische Funktionbeizumessen. Ein den orphischen Hymnen vergleichbarer Rahmen ist imFall der AO als eines Epos schwer vorstellbar. Andererseits wirkt die Vehe-menz, mit der Luiselli den rein literarischen Charakter der AO verficht, vordem Hintergrund offensichtlich urreligiöser und nur bedingt literarisch fass-barer Vorstellungen, die in den AO verarbeitet wurden, unangebracht. IhrVerfasser dürfte nach dem Zeugnis seines Werks über erhebliches Wissenorphischer sowie womöglich allgemein einem Mysterienkontext zuzuord-nender Vorstellungen gehabt haben.
47 Es sei an die entsprechenden Formulierungen in der Politeia (364e2–365a3) erinnert.48 Luiselli (1993), S. 299f.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 85
Die sich daraus ergebende Diskrepanz findet eine Lösung nur darin, fürdie Komposition der AO ein Umfeld anzunehmen, in dem zwischen derVerarbeitung urreligiöser Vorstellungen und Inhalte sowie einer fehlendenkultisch-mysterienhaften Funktion kein Widerspruch gesehen wurde.
4.2 Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Das bedeutendste Denksystem, in dem die Orpheus-Figur in der Spätantikegesehen werden kann, stellt der Neuplatonismus dar. Wie zu zeigen seinwird, weisen die AO z.B. interessante Parallelen zu verschiedenen neuplato-nischen Philosophenviten (etwa der Proklos-Vita des Marinos) auf. Vor allemdie Konzeption der Orpheus-Figur in den AO gewinnt vor diesem Hinter-grund neue Konturen. Sie wird deshalb in ihrer Bedeutung im Neuplatonis-mus erneut zu betrachten sein.
4.2.1 Die Figur des Orpheus im Neuplatonismus
Wenngleich ein Großteil der neuplatonischen Werke, die sich dezidiert mitder Auslegung ‚seiner‘ Schriften befassten, nicht überliefert ist, ist der Um-fang und die Intensität, mit der sich einzelne, vor allem spätere Neuplatoni-ker diesbezüglich betätigten, noch erkennbar.
Grundlegend in bezug auf dieses Beziehungsgeflecht von Neuplatonis-mus und Orphik bzw. Orpheus-Figur sind die Untersuchungen Brissons,der die Bedeutung der Orphik und der Orpheus-Figur vor allem für dasŒuvre des Proklos und von Neuplatonikern in dessen Umfeld herausgear-beitet hat.49 Dörrie spricht in einem ähnlichen Kontext sogar von einer„Hinwendung [sc. des Neuplatonismus] zu Orpheus“ und deutet denKampf an50, der auf geistiger und literarischer Ebene um die Deutungsho-
49 Siehe Brisson (1990) sowie zuvor bereits (1987), S. 43–104. Brisson konzentriertsich im zweiten Teil der letztgenannten Arbeit vor allem auf die sogenannten orphi-schen Theogonien, namentlich die Rhapsodische, und deren Bedeutung für dasWerk des Proklos. Eine umfassende Arbeit, die auch andere unter dem Namen desOrpheus umlaufende Schiften und deren Bedeutung für Proklos sowie andere Neu-platoniker umfassend berücksichtigt, stellt weiterhin und insbesondere vor demHintergrund der folgenden Ausführungen ein Desiderat dar.Dass sich bereits bei Platon selbst, trotz einiger kritischer Äußerungen aus demMunde des Adeimantos in der Politeia (363c-d; 364b-e) ein durchaus positives Ver-hältnis zur Orphik ergebe, arbeitet zudem Frede (2003) heraus, v.a. S. 237–241.
50 Dörrie (1975), hier S. 271–276.
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

86 Orphisches und Neuplatonisches
heit über die Orpheus-Figur vor allem zwischen Neuplatonismus und Chris-tentum geführt wurde.
Aus der Proklos-Biographie des Marinos ist die Anekdote bekannt,dass Syrian gegen Ende seines Lebens seinen beiden langjährigen SchülernProklos und Domninos die Wahl überließ, ob sie lieber die Schriften desOrpheus oder die Oracula Chaldaica erklärt zu haben wünschten. Proklosentschied sich für die Auslegung der letzteren, Domninos für die des erstge-nannten.51 Obwohl Proklos also keine (sofortige) Auslegung der Orpheus-Schriften wünschte, wird allein das Bestehen der Wahlmöglichkeit sowie dieTatsache, dass die Beschäftigung mit beiden Themenbereichen offensicht-lich erst nach dem Abschluss des obligatorischen schulischen Lehrkanonserfolgte, als ein Indiz für die Hochschätzung und Einordnung beider Kom-plexe als anspruchsvoll und bedeutsam angesehen werden können – zu-nächst von Seiten Syrians, später, wie sich zeigen sollte, auch des Proklos.52
Insbesondere im Umfeld der athenischen Akademie, aber auch in Ale-xandria fand in der Spätantike eine intensive Auseinandersetzung mitder Orpheus-Figur und den unter dem Namen des Thrakers überliefertenSchriften statt. Dass es zu einer solchen Entwicklung – nach der Überlie-ferung zu urteilen vor allem seit Iamblich53 – kommen konnte, hat nichtzuletzt mit dem religiösen Charakter des Neuplatonismus zu tun54, der einInteresse an Orpheus und seinen Lehren, aber auch an anderen religiös-phi-losophischen Archegeten (etwa Pythagoras) und entsprechenden Textcor-
51 Marinos, Vita Procli 26.52 Siehe Dörrie (1975), S. 272f. Die Auffassung, dass die Beschäftigung mit orphi-
schen Schriften nicht erst gegen Ende des Unterrichtszyklusses erfolgte, vertrittBrisson (1987), S. 51: „En outre, comme le montre bien le Commentaire sur le Phè-dre de Platon, qui reproduit l’enseignement oral de Syrianus – puisqu’il reposesur des notes prises par Hermias à des cours de Syrianus sur le Phèdre, auxquelsassistait aussi Proclus – Syrianus ne réservait pas on exégèse des poèmes orphiquesà la dernière étape de son programme d’enseignement, mais devait y recourir danssa lecture commentée des dialogues de Platon, tout comme le fera d’ailleurs Pro-clus.“
53 So ist etwa bei Plotin an keiner Stelle von ‚Orpheus‘ oder ‚Orphischem‘ (d.h. orphi-schen Schriften, Lehren u.ä.) die Rede, bei Porphyrios insgesamt nur sechs mal;bei Iamblich dagegen zwölf mal, bei Syrian neun mal und bei Proklos 178 mal! Dazuauch Dörrie (1975), S. 264: „Damit wird zugleich legitimiert, dass die Tradition, diePlutarch von Athen, Syrian und Proklos verkörpern, vorzugsweise auf Iamblich,nicht auf Porphyrios gegründet ist.“
54 Ausdruck eines solchen philosophisch-religiösen Interesses ist etwa die große Be-deutung der Kathartik wie der Theurgie im Neuplatonismus. Hierzu siehe Zintzen(1965/1977), Sheppard (1982) sowie Pichler (2006), v.a. S. 48 Anm. 103 sowieS. 252f. Siehe auch oben S. 67 Anm. 2.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 87
pora (v.a. den Oracula Chaldaica) befördert hat.55 Zugrunde liegt ein Ver-ständnis, nach dem die gesamte griechische ‚Theologie‘ auf Orpheuszurückzuführen ist, mit Aglaophamos, Pythagoras und Platon als weiteren,wichtigen Gliedern derjenigen Überlieferungskette, die bei Orpheus ihrenAusgang nehme.56 Bei Proklos heißt es (Theol. Plat. 1, 5, 25f.): U�� $; >��!�!7� $���'!�� !��« P(�!������« $ ���« $���"���� ����� ��λ !��« !7�*��(���� �%!����« �� �$����α Ϊ��� �B π �� ’ 5E((�� *��(��"� !&«#O ��&« �!λ �%!����"�« G�����«, � 8!�% �;� P%*��� �% �� B #A�(�-�+��% !B �� λ *�7� F ��� $�$��*��!�«, $�%!� �% $; P('!���« 6��$�-)�����% !κ� ���!�(& �� λ !��!�� ���!+��� G� !� !7� P%*��� �"�� ��λ !7�#O ��7� � ���'!��. So kommt es, dass Orpheus bei verschiedenen neu-platonischen Autoren – nicht zuletzt bei Proklos – immer wieder als dergriechische ‚Theologos‘ schlechthin bezeichnet werden kann.57
Das neuplatonische Interesse an der Person des Orpheus basiert alsonicht zuletzt auf seinem hohen mythenchronologischen Alter. Dieses mar-kiert eine wichtige Voraussetzung für seine Stellung als in besonderem Maßekommentierungsrelevant: Orpheus gilt (wie Musaios, Homer und Hesiod)als ‚göttlich‘58. Die Orpheus-Figur erfüllt aus neuplatonischer Sicht diewichtige Funktion des Archegeten der LE((����κ *��(��"�, durchaus imKontrast und in Konkurrenz zur �' �� �« *��(��"�, als die sich auch daserstarkende Christentum ins Spiel brachte.59 In einer gewissen Analogie zur(‚geographisch-räumlichen‘) Verankerung und Verkettung der griechischenPhilosophie, der LE((����κ �(��"�, mit der Weisheit des Ostens, der�' �� �« �(��"�, von der weiter oben im Kontext der Philosophenreise
55 Wir wissen von einem Werk Syrians mit dem Titel „Über die Übereinstimmung desOrpheus, des Pythagoras und Platons mit den Orakeln“, das wohl die Grundlagefür eine eigene Schrift bzw. Kommentare des Proklos zur Theologie des Orpheusdarstellte (Marinos, Vita Procli 27). Zur Form dieser Schrift, d.h. ob es sich um eineneigentlichen Kommentar oder um Randnotizen des Syrian handelte, siehe Brisson(1987), S. 50: „Tout porte à croire (…), que Proclus a fait dans les marges des com-mentaires de Syrianus à Orphée des remarques si longues qu’elles pouvaient êtrequalifiées de ‚notes‘ et des ‚commentaires‘.“
56 Das Phänomen der ‚Überlieferungskette‘ und seine literarische Adaption in denAO war weiter oben bereits im Kontext der Philosophenreise zur Sprache gekom-men, s.o. S. 63f. Hierzu siehe auch Brisson (2002).
57 Proklos, In Remp. II, 74, 26 Kroll; Theol. Plat. 5, 33, 22f.; In Parm. 959, 16 usw.;Damascios, De princ. 1, 291, 18 Ruelle.
58 Damaskios, De princ. 1, 285, 8 Ruelle: *���« #O ��«. Nicht nur vom ‚göttlichen‘,sondern sogar von Orpheus ‚als Gott‘ ist die Rede bei Cicero, De nat. 3, 45; Tertul-lian, De an. 2, p. 301, 7; hierzu siehe insgesamt fr. 1087 T Bernabé.
59 Zur intensiven Auseinandersetzung mit der Orpheus-Figur aus christlicher Sichtsiehe jetzt Jourdan (2011).
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

88 Orphisches und Neuplatonisches
bereits die Rede war60, erfolgt in der Person des Orpheus eine (‚chronologi-sche‘) Verankerung der LE((����κ *��(��"� in der fernen Vergangenheit.61
Mit einem solchermaßen ausgeprägten Interesse am Phänomen des Al-ters62 geht das Bestreben nach Harmonisierung von als alt empfundenen li-terarischen und philosophischen Schriften einher. Der Wunsch, Philosophieund Literatur zueinander in Bezug zu setzen und Möglichkeiten auszuloten,sie in Einklang zu bringen, ist für einen Großteil insbesondere des späterenNeuplatonismus charakteristisch, gründet aber – nach Lage der Überliefe-rung – bereits im Mittelplatonismus.63 Er findet seinen Niederschlag in einerVielzahl von Schriften (soweit die Quellenlage hier ein Urteil zulässt): Ne-ben dem Werk des Syrian Über die Übereinstimmung des Orpheus, des Pythagorasund Platons mit den Orakeln existierte eine ganze Reihe von ähnlichen Schrif-ten, unter denen etwa die Abhandlung P� λ �¹�� ����« des Hierokles zunennen ist. In dieser versucht er recht ausführlich zu zeigen, „qu’ Orphée etHomère étaient les précurseurs de Platon“.64 Porphyrios’ neuplatonischeAbhandlung über die Nymphengrotte in der Odyssee sowie verschiedene wei-tere allegorische Deutungen auch in seinen Quaestiones Homericae führen der-artige Bestrebungen fort.65 Einen wichtigen Beitrag leisten in diesem Kon-text auch Proklos’ Allegoresen diverser homerischer, vor allem iliadischerSzenen in seinem Politeia-Kommentar sowie die theoretische Fundierungder Möglichkeit, verschiedene ‚Stufen‘ von Dichtung zu unterscheiden bzw.Dichtung auf verschiedenen Ebenen zu lesen und zu interpretieren. Dassein wesentliches Modell neuplatonischer Dichtungs-Exegese deshalb in derallegorischen Interpretation von Texten besteht, ist im gleichen Maße kon-sequent wie bekannt.66 Über die Schriften hinaus, die als von Orpheus ver-
60 S.o. S. 63f.61 Auf die genaue terminologische Differenzierung zwischen ‚Philosophie‘ und
‚Theologie‘ bei den Neuplatonikern und insbesondere Proklos kann im Rahmender vorliegenden Arbeit nicht weiter eingegangen werden. Ich hoffe, auf dieses Pro-blem in einem separaten Aufsatz demnächst zurückkommen zu können.
62 Zur Bedeutung dieses Motivs in den AO s.o. S. 17f.63 Hierzu siehe Dörrie-Baltes-Pietsch (2008), *185.1 (Plutarch von Chaironeia) und
*185.2 (Maximos von Tyros).64 Brisson (1987), S. 51. Zugrunde liegt Photios, Bibl., cod. 214, 173a: LO $; �# �,«
#O �� ��λ 6O�� ��, ��λ Ρ�� Ν((�� � µ !&« P('!���« ������"�« ���� "@��!�, !κ��(�!����κ� �� λ !7� � ��������� �(��"�� $�'�!��.
65 Einen aktuellen Überblick über die „Quellen der neuplatonischen Allegorese“ bie-tet Marzillo (2010), S. XX–XXII.
66 Ein höchst interessantes Werk ist in diesem Kontext auch der Phaidros-Kommentardes Hermeias, eines Kommilitonen des Proklos. Dieser bietet ein Beispiel für mehr-stufige Interpretationen und allegorisierende Deutungen auch für einen plato-nischen Dialog. Auf seine Ausführungen wird deshalb an verschiedenen Stellen zu-rückzukommen sein. Wenngleich zu beachten ist, dass sich Hermeias nicht auf
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 89
fasst galten, ist es folglich lohnend, sich mit der neuplatonischen Konzep-tion von Allegorie und allegorischer Deutung zu befassen.
4.2.2 Allegorische Interpretationen im Neuplatonismus:Optionen für die Lektüre der AO?
Proklos stellt im Kontext der neuplatonischen Allegorese aufgrund seinerzeitgenössischen Bedeutung wie des verhältnismäßig guten Überlieferungs-zustandes seines Werks eine wesentliche Bezugsgröße dar. Er erläutert dieGrundlinien seines Allegorese-Verständnisses vor allem in seinem Kom-mentar zur platonischen Politeia. Dabei führt er die Analogie der Politeia inHinsicht auf die Dreigeteiltheit von Seele und Polis fort und überträgt sie aufden Bereich der Literatur. Er unterscheidet drei ���� von Dichtung, dieer ihrem unterschiedlichen Rang gemäß und ohne feste Terminologie als‚inspiriert‘ (��*��!��κ ��λ � �!"!� [sc. ����!��+])67, ‚epistemisch-noerisch‘bzw. ‚anamnetisch‘ (���!+���� ��λ ��� B� >)�� G(���� bzw. $�'������� �������)68 und ‚mimetisch‘ (π $�)��« ��λ ��!�"��« %�����%����bzw. ����!��+)69 bezeichnet.70 Eine solche Spezifizierung ermöglicht es, inHinsicht auf die platonische Dichtungskritik der Politeia zumindest im Falle
einen Dichtungstext bezieht, lässt sich dennoch die Gründlichkeit, die in Syriansund Proklos’ Umfeld literarischen Texten entgegengebracht wurde, exemplarischgut nachvollziehen. Sie dürfte insbesondere auch für den Umgang mit Dichtunggelten. Beachtenswert ist z.B., welche Bedeutung Hermeias der Gestaltung derRahmenhandlung des Phaidros zumisst und mit welcher Akribie auch unscheinbareund für den Fortgang des Gesprächs zwischen Sokrates und Phaidros irrelevanterscheinende Details auf ihren jeweiligen allegorischen Gehalt hin untersucht underklärt werden. Oft genug werden dabei aber Alternativen gelassen bzw. mehrereDeutungsmöglichkeiten explizit zugelassen, vgl. Hermeias, In Phaedr. 14, 1–16Couvreur.
67 Proklos, In Remp. I, 179, 3 Kroll.68 Proklos, In Remp. I, 179, 5f. Kroll; I, 179, 13.69 Proklos, In Remp. I, 179, 16f. Kroll.70 Siehe Erler (1987), S. 188: „Zu diesem Zweck entwickelt Proklos seine Lehre von
den drei Dichtungsgattungen (In Remp. I, 177, 7 – 196, 13), denen er jeweils einenanderen Rang zuteilt. Von einer ‚inspirierten‘ Dichtung (��*��!��+), welche in all-gemeiner Form Wahrheit über die Götter aussagen kann (In Remp. I, 178, 10 –179, 3), unterscheidet er eine didaktische Dichtung, welche über die physische Weltoder ethische Vorschriften belehrt (In Remp. I, 177, 15 – 178, 5). Im niedersten Rangsiedelt er die mimetische Dichtung an, die unter Bezug auf Platons ‚Sophistes‘(235d ff.) in eine eikastische und eine phantastische Untergruppe gegliedert wird(In Remp. I, 192, 28 – 193, 4) und sich allein an das ��*�!���� der Seele wendet (InRemp. I, 179, 15ff.).“
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

90 Orphisches und Neuplatonisches
Homers (wie Hesiods) auszuführen, dass in dessen Werken alle drei ����vereint seien. Die Homerkritik in der Politeia beziehe sich nur auf die mime-tische Ebene.71 Sowohl bei Proklos als auch bereits bei Porphyrios in De an-tro Nympharum ist deshalb in bezug auf die Allegorese problematischer Texte(d.h. vor allem homerischer Passagen) immer wieder vom ‚Reden in Rät-seln‘, �,�"!!�*��, die Rede, das es eben durch allegorische Deutung zu ent-schlüsseln gelte.72 Dem Dechiffrierenden sei es auf seinem Weg der Epistro-phe und dem Aufstieg der Seele behilflich, wenn er das hinter derOberfläche verborgene göttliche Wissen entschlüsselt und so für sich ge-wonnen habe.73
Sowohl bei Proklos wie bei Porphyrios steht mit Homer ein bereits exis-tierendes Textcorpus im Vordergrund, das man allegorischer Deutung un-terzieht.74 Vor allem das Œuvre des Proklos verweist aber auf eine weiter-führende Fragestellung. Für sein Gesamtwerk ergibt sich die besondereKonstellation, dass sowohl die eben erwähnten Theorien zur Auseinander-setzung mit Dichtung und der Art und Weise überliefert sind, wie diese phi-losophisch relevant interpretiert werden kann, als auch eigene poetischeWerke in Form seiner Hymnen. Dies führt zu der interessanten Frage, aufwelche Weise diese Dichtung selbst zu verstehen ist, d.h. ob die proklischenHymnen ebenfalls nach einer allegorischen Interpretation verlangen bzw.eine solche zulassen. Heinrich Dörrie formulierte eine entsprechende Ver-mutung bereits vor über 30 Jahren. Er spricht mit Bezug auf die proklischenHymnen von einem „Textbuch für zukünftige Exegeten“.75 Michael Erler
71 Proklos, In Remp. I, 192,6–196,13 Kroll. Siehe hierzu außerdem Sheppard (1980),S. 162–202.
72 Siehe etwa Porphyrios, De antro 1, 1; Proklos, In Remp. I, 132, 8 Kroll; I, 141, 1.73 Das Phänomen verschiedener Verständnisebenen (auch) in philosophischen Tex-
ten begegnet seit Heraklit und stellt ein uraltes ‚Problem‘ philosophischen ‚Lesens‘dar. Siehe Kahn (1979), S. 93: „… a dispute which, I suggest, can only be resolved ifwe are prepared to regard ambiguity not as a blemish to be eliminated but as a mea-ningful stylistic device to be accepted and understood.“
74 Insbesondere Proklos beschränkt die Möglichkeit der Allegorese nicht auf Homer,sondern beschäftigt sich auch mit diversen Texten bzw. Textpassagen bei Hesiod(Proklos, In Remp. I, 77, 4–28 Kroll; II, 75, 12ff.) und Orpheus (Proklos, In Remp. II,74,26 – 75,12 Kroll).
75 Dörrie (1975), S. 287: „Aber es wäre falsch, den Blick allein auf das Preziöse und dasKonventionelle [sc. der proklischen Hymnen] zu richten – dies die Einseitigkeit, ander das soeben zitierte Urteil von U. von Wilamowitz krankt. (…) Die Metonymienund die Beiworte, mit denen die segensbringende Macht und die Weisheit der Göt-ter gepriesen werden, sind in aller Regel so gesetzt, dass eine Exegese, wie Proklossie pflegte, auf den theologischen Sinn führen muss – und das in bemerkenswertgrösserer Dichte, als das in den Orphischen Hymnen und in den Oracula Chaldaica derFall ist. Kurz, Proklos, als Erklärer solcher Dichtungen erfahren, spielt als Dichter
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 91
konnte seinerseits vor allem am Beispiel des proklischen Aphrodite-Hym-nos zeigen, welche Ergebnisse durch eine allegorisierende Betrachtung derproklischen Hymnen hinsichtlich ihrer wichtigen anagogischen, ja theurgi-schen Funktion gewonnen werden können, und prägte dabei die Wendungvom „Interpretieren als Gottesdienst“.76
Neuplatonische Dichtung, d.h. ‚nicht-fachwissenschaftliche‘ Literatur,ist jedoch nicht auf die Person des Proklos beschränkt: Überliefert sind etwaauch die (christlich-neuplatonischen) Hymnen des Synesios77, immerhinindirekt bezeugt sind diejenigen des Hierokles oder des Isidoros.78 Für denvorliegenden Kontext der Interpretation der AO stellt diese Tatsache, dassvon neuplatonischer Seite aus eine eigene Dichtungsproduktion existierte,die offensichtlich ihrerseits nach denjenigen Kriterien geschaffen wurde, diein den theoretischen Fundierungen, wie mit bestehender Dichtung umzu-gehen sei, formuliert sind, eine wichtige Grundlage dar. Die Grundvoraus-setzung, die AO – in Analogie zu bestehender neuplatonischer Dichtung –in einem neuplatonischen Kontext betrachten und (allegorisch) lesen zukönnen, ist so zumindest prinzipiell gegeben.
Zu berücksichtigen ist, dass die (erhaltene und als solche erkannte)neuplatonische Dichtung ihren Schwerpunkt offensichtlich im Bereich desHymnos hatte. Es stellt sich deshalb die Frage, inwiefern Rückschlüsse auf
der Hymnen ein umgekehrtes Spiel: Er verfasst eine Art Textbuch für künftige Exe-geten – nur ist eben diese Exegese nie geschrieben worden, was bis heute ein Hin-dernis für das angemessene Verständnis darstellt.“
76 Siehe Erler (1987), S. 197, der darauf hinweist, dass sich in den Kommentarendes Proklos neben der ‚Enträtselung‘ homerischer und hesiodischer Partien auchanaloge Bestrebungen in Hinsicht auf die orphische Dichtung feststellen lassen:„Dabei ist dann der doch oft gewaltsam wirkende Versuch auffällig, aus einem noe-tischen Verständnis eines Wortes heraus den ganzen Mythos auf die intellektuelleEbene zu transportieren. Es stellt sich die Frage, wie es sich bei den Gedichten ver-hält, die der Theoretiker Proklos selbst verfasst hat. Darf man nicht vermuten, dasser seine Hymnen mit ihren literarisch vorgegebenen Motiven so zu gestalten ver-sucht, dass sie eine Interpretation im Sinne des Proklos nicht nur unter Zwang, son-dern besser zulassen als die anderen von Proklos behandelten Passagen aus Homerund Hesiod?“; S. 192: „Die Interpretation inspirierter Mythen, so wurde gesagt,bedient sich wie die Theurgie bestimmter Symbole. Darunter sind Worte zu ver-stehen, welche durch ihre vielschichtige Bedeutung eine allegorische Deutung desMythos erlauben.“
77 Zu diesen siehe Gruber/Strohm (1991); außerdem Schmitt (2001).78 Siehe etwa Zuntz (2005), S. 108. Für die Bedeutung des Hymnischen im Neuplato-
nismus siehe außerdem Lattke (1991); Thraede (1994), Sp. 933–935; van den Berg(2001), S. 13–34; Erler (1987). Dichterisch tätig war nach eigener Angabe auch Por-phyrios, der anlässlich der Geburtstagsfeier Platons ein ��"��� mit dem Titel e� �«�'��« verfasste und vortrug (Porph., Vita Plotini 15).
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

92 Orphisches und Neuplatonisches
eine mögliche neuplatonische Epenproduktion – eben etwa in Gestalt derAO – zulässig sind. Eine Antwort auf diese Frage muss notwendigerweisekomplex ausfallen. Obwohl sie im Rahmen der vorliegenden Arbeit nichterschöpfend abgehandelt werden kann, haben die Erkenntnisse, die im fol-genden in bezug auf die AO gewonnen werden, grundlegenden Charakterin Hinsicht darauf, eine systematische Einordnung von Literatur und insbe-sondere Dichtung dieser Zeit in Hinsicht auf mögliche allegorische Lesartenvornehmen zu können.
Auf formaler Ebene, etwa mit Blick auf das verwendete Metrum, denHexameter79, steht einer neuplatonischen Einordnung der AO nichts entge-gen. Auch die zur Allegorese bestimmten Hymnen, von denen weiter obendie Rede war, sind teilweise (etwa im Falle des Proklos) in Hexametern ver-fasst. Das epische Genre erfreute sich ebenfalls allgemeiner Wertschätzung,wie an den Beispielen des Porpyhrios und Proklos und überhaupt der all-gemeinen Bedeutung deutlich wird, die man den Archegeten der Gattung,Homer und Hesiod, auch in Hinsicht auf ihre allegorische Auslegung entge-genbrachte. Auch unter diesem Aspekt sind die AO deshalb prinzipiell ge-eignet.80
Entsprechende Überlegungen zur Möglichkeit, hinter einer epischenKomposition Dichtung mit philosophischer Intention oder wenigstensausgesprägtem philosophischen Hintergrund zu vermuten, wurden in derVergangenheit bereits angestellt: Ernst Zinn etwa spricht für die vergilischeAeneis von einer „Umstülpung“, die Vergil – wie Dörrie dies für die prokli-schen Hymnen vermutet hat (s.o.) – vorgenommen habe, d.h. in entgegen-gesetzter Richtung zum üblichen Interpretationsverfahren, einen bestehen-den Text auf bestimmte Lesarten, z.B. allegorisch, zu interpretieren. Zinnvermutet ein Kompositionsprinzip, nach dem Vergil bei der Abfassung derAeneis ein auch theologisches Konzept vor Augen hatte, das in sein Epos ein-geflossen und durch Exegese zu erkennen sei.81 Thomas Gelzer wiederum
79 Einen Bezug zur Metrik enthält womöglich auch das allerdings nur schwer zu deu-tende *����%« !� ��λ � �)�$"�« in Platon, Pol. 399a7f.
80 Hinzu kommt das weiter oben beschriebene Phänomen der Erweiterung des Hym-nenbegriffs vor allem im Umfeld der athenischen Akademie. Eine Ausdehnung des‚Hymnischen‘ auch auf den Bereich des Epos erscheint möglich, solange dieses inseiner anagogischen Funktion ‚hymnischen‘ Kriterien gehorcht. Vor diesem Hin-tergrund ist anzunehmen, dass neuplatonische Dichtung gleichzeitig die formalenKriterien der ‚Literaturgattung Hymnos‘ nicht, ihre philosophisch relevante Hym-nen-Funktion aber doch erfüllen kann.
81 Siehe Zinn (1956), S. 18f.: „In der nächsten Generation hat Vergil in einer mit Hän-den zu greifenden Umstülpung allegorischer Interpretationsmethoden, wie sie anhomerischer Dichtung und altgriechischer Mythologie seit Jahrhunderten entwik-kelt waren, in ein dementsprechend allegorisch erfindendes, planendes und gestal-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 93
beschreibt Musaios’ Hero und Leander als ein (christlich) neuplatonischesEpos. Er sieht in diesem Epyllion die in ein literarisches Gewand gekleideteDarstellung des Lebens der philosophischen Seele in Anlehnung an die pla-tonische Schilderung im Phaidros. Die Verse 28–231 bei Musaios repräsen-tierten demnach das Leben der Seele vor ihrer ersten Einkörperung (���+),die Verse 232–288 das irdische Leben (� ��$�«) und die Verse 289–343 dieErlösung der Seele von den Ketten der Körperlichkeit (���! �+).82
In Hinsicht auf den eher andeutenden als detailliert ausführenden Cha-rakter der genannten Studien von Zinn und Gelzer83 muss eine systema-tische Auseinandersetzung, welches (vor allem spätantike) Epos einen(neu-)platonischen Hintergrund haben könnte, breiter angelegt werden. An-hand der im gesamten platonischen Œuvre verstreut zu findenden Krite-rien, wie Dichtung in bestimmten Kontexten und unter bestimmten Bedin-gungen zu bewerten ist, sowie anhand der entsprechenden Äußerungen undInterpretationen bei Neuplatonikern soll ein Maßstab rekonstruiert werden,anhand dessen zu beurteilen ist, ob ein Epos (neu-) platonischen ‚Qualitäts-kriterien‘ entspricht. Dies ist die prinzipielle Voraussetzung dafür, dass einWerk allegorisch bzw. im neuplatonischen Sinne anagogisch, ja theurgischgelesen und verstanden werden kann. Es geht mit anderen Worten darum,eine ‚neuplatonische Poietik‘ zu rekonstruieren, die – so wäre zu vermuten –sämtlichen oder zumindest einem wesentlichen Teil neuplatonischer Dich-tungsproduktion, die (in den Worten Dörries) zur Exegese bestimmt ist, zu-grunde liegen dürfte. Die formulierte Vermutung, dass eine solche neupla-tonische Poietik im Sinne gemeinsamer Kriterien zur Bewertung, aber auchzur Schaffung von Dichtung existierte, baut zunächst grundsätzlich auf denErkenntnissen auf, die inzwischen für eine Poetologie bei Platon selbst ge-wonnen werden konnten.84 Es zeigt sich, dass das lange Zeit als disparatempfundene „Literatur“-Konzept85 Platons, wie es sich in seinem gesamten
tendes Dichtverfahren, seine Aeneis geschaffen, ein völlig neuartiges ‚Sakral-Gedicht‘ (wie R.A. Schröder es genannt hat), römisch zentriert, aber welt-umspan-nend, Raum und Zeit umgreifend; mit epischer Form, historischem Gegenstande,theologischer Überwölbung und Durchdringung: nun nicht mehr von außen, vonPhilosophie und Theologie, System oder Entwurf oder Bezugspunkt borgend, son-dern schöpferisch setzend und deutend aus dichterischem Eigenrecht.“
82 Siehe Gelzer (1975), S. 316–322.83 Die weitere Ausführung und nähere Interpretation von Hero und Leander in einem
allegorischen Sinne auf neuplatonischer Ebene, die Gelzer a.a.O., S. 317 Anm. a(„I am preparing a book on this subject“) ankündigte, ist, soweit ich sehen kann,bislang nicht erschienen.
84 Siehe Büttner (2000).85 Zur Problematik der Terminologie bei Büttner, was die Verwendung des Begriffs
‚Literatur‘ anstelle von ‚Dichtung‘ angeht, siehe Männlein-Robert (2003), S. 662–666.
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

94 Orphisches und Neuplatonisches
Werk manifestiert, mitnichten uneinheitlich ist bzw. dass es als Konzeptüberhaupt besteht, auch wenn einzelne Stellungnahmen zur Dichtung undihrer Bewertung kontextbedingt voneinander abweichen können. Der Be-griff einer „immanenten Poetik“86 des platonischen Werks, der in diesemKontext immer wieder genannt wird, bringt genau das zum Ausdruck, wasfür den Bereich des Neuplatonismus noch zu leisten ist.
Die Grundzüge, an denen sich eine solche Aufgabe wird orientieren müs-sen, sind absehbar und sollen deshalb in der vorliegenden Arbeit Berück-sichtung finden. Sie sollen so gleichsam auf ihre Anwendbarkeit hin geprüftwerden. Dabei stellt sich ein grundlegendes Problem. Wichtige Kriterienin Hinsicht auf die Beurteilung des (neu-)platonischen Gehalts der AO undihrer ‚Kompatibilität‘ in dieser Hinsicht wären naturgemäß einerseits dieentsprechenden und bei Büttner gesammelten platonischen Bewertungs-maßstäbe für Dichtung vor allem im zweiten, dritten und zehnten Buch derPoliteia (etwa eine anzustrebende maßvolle Schilderung von Affekten87, dierichtige und verantwortungsvolle Darstellung des Göttlichen88, die konse-quente Vermeidung, den Tod und das Totenreich als schrecklich zu schil-dern89 usw.), im Phaidros (etwa die verschiedenen Formen des Wahns undder Inspiration90), im Symposion (etwa die Analogie von verschiedenen mysti-schen Weihegraden und der Dichtung91 sowie ihre erzieherische Funktion)und in den Büchern Zwei und Sieben der Nomoi (etwa die Auswahl undunterschiedliche Bewertung verschiedener Literaturgattungen92). Anderer-seits können die verschiedenen allegorischen Deutungen insbesonderebei Proklos gerade als Kronzeugen dafür dienen, wie nicht zuletzt die (vorallem homerischen) Partien, die im Kontext der Politeia vom platonischenSokrates verurteilt werden (z.B. der ‚faule‘ Traum des Agamemnon, denZeus ihm schickt93, die Verführung des Pandaros zum Eidbruch durchdie Göttinnen Hera und Athene94 oder das maßlose Wüten des Achill95),durch die allegorischen Deutungen der Neuplatoniker ‚rehabilitiert‘ undauf ihnen inhärente ‚Verweise‘ auf Sachverhalte intelligibler Natur unter-
86 Zum Begriff siehe Flashar (1958), S. 107–111; Männlein-Robert (2003), S. 663;Erler (2007), S. 487f.
87 Pol. 389e–392c.88 Pol. 383a–c.89 Pol. 386b–387c.90 Phdr. 244a–249d.91 Symp. 201d–212a. Siehe außerdem Schölles (2010).92 Siehe etwa Nom. 810b5–812a.93 Pol. 383a7 mit Bezug auf Il. 2, 1–34.94 Pol. 379e–380a1 mit Bezug auf Il. 4, 69–126.95 Pol. 391b5–c5 mit Bezug auf Il. 24, 14–18; 23, 175–182.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 95
sucht werden.96 Gerade die vermeintlich nicht den platonisch-sokratischenIdealvorstellungen dichterischer Gestaltung entsprechenden Muster erwei-sen sich also durch neuplatonische Allegorese zum Teil als in ihrer anagogi-schen Funktion besonders relevant. Dies wiederum scheint die weiter obenkonstatierte Vermutung massiv zu schwächen, dass sich eine neuplatonischePoietik an den Idealmaßstäben für Dichtung etwa in der Politeia orientierenmüsse. Dem muss allerdings entgegengehalten werden, dass sich aus demoffensichtlichen Bemühen von neuplatonischer Seite, als anstößig empfun-dene bzw. markierte Stellen durch eine allegorisierende Deutung zu rehabi-litieren, keine Rückschlüsse auf die vermutete neuplatonische ‚Produktions-ästhetik‘ gezogen werden können. Lediglich der ‚rezeptionsästhetische‘Schluss, dass Dichtung, auch wenn sie nicht nach den Idealrichtlinien derPoliteia oder der Nomoi komponiert zu sein scheint, dennoch – durch Alle-gorese – eine wichtige anagogische Funktion haben kann, ist erlaubt.
Für die AO lässt sich nun feststellen, dass sie den Anforderungen, dieinsbesondere in der Politeia und den Nomoi an Dichtung gestellt werden,durchaus gerecht wird. In der Orpheus-Figur, der besonderen Konstellationseiner Sprechfunktion und dem damit verbundenen Wahrheitsanspruchverfügt das Epos über einen aus neuplatonischer Sicht97 geradezu idealenErzähler und Protagonisten gleichermaßen.98 Noch dazu einen, der in seinerbetont religiös-priesterlichen Charakterisierung, d.h. seinen zahlreichen er-wähnten Opfer- und Initiationshandlungen, der damit einhergehenden Be-tonung des Religiösen, seiner durchaus nicht schauderhaften Schilderungder Unterwelt und der Zurückhaltung in emotional-triebverhafteten Ange-legenheiten die Forderungen erfüllt, die der platonische Sokrates in derPoliteia (in Hinsicht auf die Ideal-Polis) für eine ideale Literatur entwirft.Darüberhinaus verfügen die AO durch die ‚Kreisstruktur‘, die ihr Verfasserseine Erzählinstanz Orpheus für seine Erzählung wählen lässt, die dezi-dierte Betonung des Hymnischen in ihnen sowie die von den anderen Ver-sionen des Argonautenepos abweichende Zuspitzung auf die Katharsis derArgonauten, die sie nach einer begangenen Verfehlung durch Wissen (näm-
96 Proklos, In Remp. I, p. 115–117 Kroll (Traum des Agamemnon); p. 103–106 Kroll(Pandaros); p. 130f. sowie p. 146–149 Kroll (Achill).
97 Zur Bedeutung der Orpheus-Figur im Neuplatonismus s.o. S. 85–89.98 So könnte etwa auch das Phänomen des Wechsels der Person in der Schilderung der
Erzählinstanz Orpheus, d.h. die unterschiedliche Verwendung von 1. Person Sin-gular, 1. Person Plural und 3. Person Plural, eine Reaktion auf die Anforderungenan eine ausgewogene Darstellungsweise sein, die der platonische Sokrates in derPoliteia formuliert (396e): Der verständige Mann bediene sich – je nachdem, was zuberichten ist – z.T. der direkten Rede, z.T. der Darstellung aus der Erzähler-Per-spektive (mit �"���« und $�+���« als den beiden Begriffsgegensätzen); andersVenzke (1941), S. 9.
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

96 Orphisches und Neuplatonisches
lich des Orpheus) erlangen, über kompositorische Spezifika, die sich eben-falls gut in den Kontext einer (neu-) platonischen Lesart des Werks einfüg-ten. Auch der auffällige Verzicht auf jede Form von Gleichnis oder Verglei-chung, der in den AO festzustellen ist99, wird in diesem Zusammenhang zusehen sein: Denn die Verwendung von Gleichnissen, die erwiesenermaßenüber eine eigene Bildlichkeit verfügen und somit selbst nicht auf der Ebeneder eigentlichen Erzählung liegen100, würde in bezug auf eine allegorischeLesart des Gesamtwerks nicht unerhebliche Probleme mit sich bringen, dain vielen Fällen nicht deutlich sein dürfte, ob das Gleichnis Teil der zu leis-tenden Allegorese sein soll oder nicht.
Über diese strukturellen Eignungskriterien hinaus soll im folgenden an-hand wichtiger Motive und Charakteristika der AO untersucht werden, ob undin welchem Maße sie den anzunehmenden Erwartungen neuplatonischer Re-zipienten entsprechen. Auf diese Weise ist festzustellen, ob die Vermutung un-termauert werden kann, die AO in einem neuplatonischen Kontext zu lokali-sieren und eine mögliche allegorische Lesart des Werks zu rechtfertigen. Dieskizzierte Gesamtstruktur der AO und Betrachtungen einzelner Szenen wieCharakteristika der AO müssen in gleichem Maße Berücksichtigung finden.
Die Charakteristika neuplatonischer Allegorese sind in verschiedenenArbeiten bereits herausgearbeitet worden.101 Ihr Wirkprinzip ist nicht dieMetonymie, sondern das Symbol. Wenn etwa Hermeias in seinem Phaidros-Kommentar erklärt102, was es bedeute, wenn es im Phaidros heißt, dass Phai-dros sich zu einem Spaziergang außerhalb der Stadtmauern aufmacht (Phdr.227a), und dabei verschiedene Möglichkeiten der Deutung betont (in bezugauf Phaidros bedeute ‚Stadt‘ soviel wie ‚Masse‘ und ausgetretene Pfade, vondenen sich Phaidros distanziere, da er sich auf ein höheres Leben vorbereite,im Falle des Sokrates aber, der die Stadt für gewöhnlich nicht verlasse [Phdr.230c], symbolisiere diese ‚Prinzipientreue‘ und eine Orientierung des Sokra-tes am Noetischen), so wird der komplexe und oft nicht eindeutige Vorgangeiner neuplatonischen Allegorese deutlich. Im vorliegenden Fall wird es des-halb nicht darum gehen, einzelne Personen, Götter, Namen oder Orte derAO durch vermeintlich dahinterstehende Begriffe zu substituieren, sondern
99 Siehe bereits oben S. 19f.100 Fränkel (1921). Siehe auch oben S. 20 Anm. 36.101 Wolfgang Bernard etwa hat die prinzipiellen Unterschiede zwischen „stoischer“,
d.h. substitutiver, und „neuplatonischer“, d.h. dihairetischer, Allegorese herausge-arbeitet und zeigen können, dass „die dihairetische Allegorese die Personalität derFiguren bewahrt und die Folge der vom Dichter gebotenen Vorstellungen be-stimmten intelligiblen Sachverhalten zuordnet (die aber nicht als Sachverhalte, son-dern als denkende Personen aufgefasst werden)“, siehe Bernard (1990), S. 276.
102 Hermeias, In Phaedr. 14, 1–16 Couvreur.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 97
zu prüfen, ob die Komposition der AO Rückschlüsse darüber erlaubt, dassdas Epos in seiner literarischen Form über sich hinaus auf Sachverhalteintelligibler Natur weist und so den wichtigen theurgischen Zweck von Al-legorese103, den Proklos ihr zuweist, unterstützt.104
4.2.3 Neuplatonisches in den AO
4.2.3.1 #O �0« ¹� �'�!�« und die neuplatonische Philosophenvita:Das Wirken des Orpheus in den AO
Der ausgeprägte religiöse Zug des Neuplatonismus, von dem weiter obenbereits die Rede war105, blieb offensichtlich nicht ohne ‚lebenspraktische‘Auswirkungen auf den Alltag.106 So lässt sich feststellen, dass einem neupla-tonischen Philosophen und insbesondere dem Schuloberhaupt der Athe-ner Akademie im Laufe der Zeit auch eine priesterliche Funktion zukam.107
Marinos schreibt in seiner Biographie des Proklos108, dass dieser auf seinerReise durch Kleinasien (Vita Procli 15) nicht nur zahlreiche Kulte ken-nenlernte bzw. sich in der Ausübung des jeweiligen Ritus unterweisen ließ,sondern dass er überhaupt ein Verständnis pflegte, nach dem für einen(neuplatonischen) Philosophen eine umfassende Beachtung nicht nur ein-heimischer, d.h. attischer oder griechischer Kulte, sondern auch auswärtigerangebracht sei – die Beschäftigung mit verschiedenen theurgischen Prakti-
103 Zur Bedeutung der Allegorese bei Proklos grundlegend Pichler (2006) passim.104 Zur Parallelisierung von Allegorese und Theurgie sowie der unterschiedlichen
Funktion platonischer (didaktischer) und homerischer (entheastischer und damitanagogischer) Mythen siehe Proklos, In Remp. I, 78, 18 – 79, 18 Kroll.
105 S.o. S. 86 Anm. 54.106 Zur Frage der Lebensform neuplatonischer Philosophen siehe auch Hadot (1999),
S. 199f.107 Siehe van den Berg (2001), S. 30 mit Bezug auf Marinos, Vita Procli 19: P»�� �B
G��� ��λ ���� !�1 ���µ« ��$; � �$����+�« "!��, R�� $λ !B« ��%���"�« (��� 7«���!�(�� ��κ ¹� �� ��7«, ��λ !B« �� B �»«� $�, ³« �,����, ���+��%« <� !B« ��!B!B �� ’ <�'!��« �'! �� $ 7� ��*���« $��!�(��, ��λ �/$; !��!�« —�� >!� ��� ���� ������!� $�����(�« !��µ« ν ��λ �(� 8��« !�1 8��!�«, ��!%��7� $;$� ����� ��λ 6��)�$"�« ��λ !7� ²��"��α $�(�� $; π !7� C���� �/!�1 � ����!�"��/ !7� �� B !��« 5E((�� ����� !���*��!�� ���8��� �� ����%� […], ��λ !�0«Ν((�%« 4�(7« Ϊ���!�«.
108 Zur Frage der Authentizität bzw. der literarischen Überformung der Proklos-Vitanach idealtypischen Maßstäben, d.h. verschiedenen Tugendgraden, durch Marinossiehe Saffrey/Segonds (2002), S. XLI–C; außerdem O’Meara (2006), v.a. S. 78–89,der in der Darstellung der Isidoros-Vita des Damaskios die Orientierung an verschie-denen neuplatonischen Tugendgraden nachweist.
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

98 Orphisches und Neuplatonisches
ken und ihre genauen Kenntnisse eingeschlossen.109 Ein Philosoph sei imIdealfall der Ρ(�% ����% ¹� �'�!�«.110 Diese Vorstellung findet sich in ver-schiedenen Formulierungen und in unterschiedlichen Intensitätstufen aus-gedrückt in zahlreichen neuplatonischen Abhandlungen, etwa zu Beginn derproklischen Theologia Platonica, wenn dort Platon als Hierophant bezeichnetwird, der die heiligen Gegenstände der Philosophie „ans Licht gebrachthabe“.111 Das aus dem Mysterienkontext stammende Bild des Priesters vonEleusis, des Hierophanten, wird adaptiert und auf die Philosophie übertra-gen. Wie der Priester von Eleusis die Mysten in die Geheimnisse des Kul-tes einweihe, so habe Platon (seinen ‚Nachfolgern‘ in der Philosophie) dieMysterien der Philosophie offenbart.112 Bei Proklos ist sogar von einerP(�!����κ ����!�"� die Rede, als deren �)���!�" – immer noch im Bilde desMysteriengeschehens – Plotin und die in dessen Nachfolge stehenden Neu-platoniker bezeichnet werden.113 Doch die Verwendung der Mysterienbild-lichkeit ist nicht auf Proklos beschränkt. Porphyrios etwa wird nach demVortrag seines Gedichts bei der Platon-Geburtstagsfeier als ����!+«, �(�-��« und ¹� �'�!�« zugleich bezeichnet.114
Wenn nun die Sprechinstanz Orpheus innerhalb der Rahmenhandlungzu Beginn der AO einen Bericht ihrer Reisen und ihres kultischen Wissensgibt (AO 33–46) und zudem, wie gesehen, unter Einbeziehung der ,enzyklo-pädischen‘ Technik ihre profunde Kenntnis von Kulten, die mit Mysterienri-ten in Verbindung stehen, demonstriert (AO 20–32), erscheint die Frage
109 Marinos überliefert verschiedene Werktitel des Proklos, die auf ein tiefergehendesInteresse in dieser Hinsicht schließen lassen. So ist u.a. die Rede von einem Werkdes Proklos über die ‚Göttermutter‘ (vgl. Marinos, Vita Procli 33: !&� M�! �)��κ��/!�1 �"�(��), einem über Hekate (wobei für die Bezugsquelle Marinos, Vita Procli28 die gleichen Vorbehalte gelten müssen wie für die vorige Angabe zu Marinos 33),und einem Werk P� λ $���&«, wobei dies, wie vermutet wurde (vgl. Beutler [1956],Sp. 206), als P� λ $���&« *��% ���&« zu verstehen ist (ebd. mit Verweis auf den Su-da-Eintrag zu Proklos und Marinos, Vita Procli 28).
110 Marinos, Vita Procli 19: … G(���� ² *�����!�!�« $�+ [sc. Proklos], Ρ!� !µ� �(��-�� � �+��� �/ ��»« !���« ��(��«, �/$; !7� �� ’ ��"��« ��! "�� �ρ��� *� ���%!+�,����9& $; !�1 Ρ(�% ����% ¹� �'�!��. Zum Bild des Hierophanten im Neuplatonis-mus vgl. auch van den Berg (2001), S. 29f.
111 Proklos, Theol. Plat. 1,1 (p. 5, 6–8, 15f.). Zur Deutung der Passage vgl. Saffrey/Wes-terink (1968) ad. loc., S. 6 Anm. 1: „Platon est celui qui dévoile les objets de la phi-losophie comme, dans les mystères, le hierophante dévoile les objets sacrés.“
112 Proklos, Theol. Plat. 1,1 (p. 6, 2) Saffrey/Westerink: (…) $%�������« ����&��� $�’<�µ« $�$ �« (…).
113 Proklos, Theol. Plat. 1,1 (p. 6, 16) Saffrey/Westerink. An anderer Stelle bezeichnetProklos auch alle „Nacheiferer“ Platons als „Hierophanten“, vgl. In Remp. I, 71,22–24 Kroll.
114 Porphyrios, Vita Plotini 15, 5f.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 99
plausibel, ob nicht in der beschriebenen Gestaltung der Rahmenhandlungeine literarische Verarbeitung eines ‚allgemeinen Hierophantentums‘ gesehenwerden kann. In dieser nimmt allerdings nicht Proklos oder Platon, sonderneben Orpheus diese Hierophanten-Rolle ein. Aufgrund seines hohen my-thenchronologischen Alters stellte Orpheus nach dieser Deutung den ‚Urtyp‘eines Hierophanten, einen Proto-Hierophanten, dar. D.h. wie es sich füreinen neuplatonischen Philosophen (von Marinos am Beispiel des Proklosexemplarisch demonstriert) gehört, umfassende Kenntis einer möglichst gro-ßen Zahl von Kulten und ihrer Riten zu haben, so lässt der Verfasser der AOauch seine Sprechinstanz Orpheus Zeugnis abgeben von dessen umfassen-dem Wissen in diesen Angelegenheiten.115 Die Passage der Verse 33–46, dieweiter oben als ‚biographisch-didaktischer‘ Teil der Versgruppe 12–46 be-schrieben wurde, stellte nach dieser Deutung in Hinsicht auf das Hierophan-tentum des Orpheus einen Rekurs auf Vorstellungen eines neuplatonischenIdeal-Bios dar, wie ihn z.B. Marinos in der Vita Procli schuf. Ganz im Sinneund Stile einer neuplatonischen Philosophenvita ist von den Reisen des Or-pheus (Ägypten, AO 43–45) sowie seiner Kenntnis und Vermittlung zahlrei-cher Riten und theurgisch anmutender Praktiken (an Musaios) die Rede (AO33–39).116 Die Sicht, Orpheus in der Rolle des Proto-Hierophanten zu sehen,fügt sich zudem gut in das weiter oben skizzierte Bild der Verarbeitung desMotivs der Philosophenreise in den AO und der Verankerung der griechi-schen ‚Theologie‘ durch Orpheus in der ferneren Vergangenheit ein.117
Vor diesem Hintergrund ist der in früheren Kapiteln beschriebene Cha-rakter bzw. die Funktion der Verspartie AO 12–46 erneut bedeutsam: Eshat sich gezeigt, dass diese Partie in gleichem Maße als Folie zu verstehen ist,vor der sich die Komposition der AO abheben soll (vor allem in Hinsicht aufdas von Hunter konstatierte gattungstheoretisches Spiel wie auch die Kon-zeption der Orpheus-Figur)118, wie als Reverenz an die in ihr verarbeitetenInhalte (wiederum in bezug vor allem auf die Orpheus-Konzeption). Derbeschriebene Rekurs der Verse 33–46 auf Traditionen und Vorstellungender idealen neuplatonischen Philosophenvita wird deshalb ebenfalls in demSpannungsfeld von Anerkennung einerseits und Zuordnung zur (auf denfiktiven Bios des Orpheus bezogen) Vergangenheit und damit zum Zustand
115 S.o. S. 43ff.116 Bemerkenswert ist in diesem Kontext einer angenommenen Parallelisierung von
Philosophenvita und Orpheus-Konzeption der AO auch das Detail, dass der Ver-fasser der AO Orpheus von seinen Verkündigungn als von Ν�� (AO 11) sprechenlässt: Nach Marinos (Vita Procli 20) schrieb auch Proklos dem Vortrag von Hym-nen, insbesondere orphischen Hymnen, heilsame Wirkung zu.
117 S.o. S. 61ff.118 S.o. S. 20–25.
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

100 Orphisches und Neuplatonisches
des Überholtseins andererseits zu sehen sein: D.h. obgleich wichtige Krite-rien einer gelungenen Philosophenvita auch in der Orpheus-Lebensskizzeder Verse 33–46 bereits erfüllt sind, ist zu berücksichtigen, dass die ‚idealphi-losophisch‘ anskizzierte Orpheus-Vita der Verse 33–46 vor der ‚retardieren-den Gesamtfunktion der Passage‘ erst in der Argonautenfahrt selbst ihreVollendung erfährt.119 Auch in der ‚Vita‘ des Orpheus ist somit ein Elementder allmählichen Steigerung angelegt, das sich in der Anlage neuplatonischerPhilosophenviten widerspiegelt: Sowohl für die Vita Procli des Marinos alsauch die Vita Isidori des Damaskios lassen sich Stufenabfolgen hinsichtlichder erreichten ‚Tugendgrade‘ ablesen.120 Die Analogie zur Darstellung derAO und der impliziten Konzeption der Orpheus-Vita dort wird nicht über-zustrapazieren sein. Doch mit der wiederholten Erwähnung gerade Ägyp-tens in der Rahmenhandlung der AO wird ein Stichwort genannt, das dieAssoziationen des Rezipienten auf die Verbindung von Orpheus (und damitOrphischem) mit Ägypten lenkt, die spätestens seit Herodot (2, 81) eineenge Verbindung eingegangen ist. Es klingt also – um in der bislang verwen-deten Terminologie zu bleiben – die Orphik im Burkert’schen, d.h. religiös-kultischen, Sinne an. Damit ergibt sich wiederum konsequenterweise derSchluss, dass dieser – wenn auch in Grundzügen bereits idealphilosophischgezeichnete – ‚orphische Orpheus‘ der Rahmenhandlung der Vergangenheitzugeordnet wird. Der ‚neuplatonische Orpheus‘ tritt erst in der Erzählungder Argonautenfahrt selbst hervor, in der der Aufenthalt der Argonauten inNordafrika (d.h. ein markanter Bezugspunkt zur Verbindung von Orpheusund Orphisch-Ägyptischem) bezeichnenderweise ausgespart bleibt bzw. innur einem einzigen Vers angedeutet wird (AO 1348).
4.2.3.2 6����� in den AO und in neuplatonischer Literatur
Eng verbunden mit dem Aspekt des Hierophantentums ist die neuplatoni-sche Auseinandersetzung mit dem Aspekt des 6����� und seine begrifflicheAusgestaltung. Diese lässt sich in besonderem Maß an der Person des Pro-klos nachvollziehen, ist aber nicht auf diesen beschränkt.121 Über seine
119 Zum Prinzip der aemulatio, die in der Komposition der AO auch in Hinsicht auf neu-platonische Philosophenviten angelegt ist, s.o. S. 40–42.
120 S. o. S. 97 Anm. 108.121 Programmatisch ist etwa die Aussage bei Porphyrios, De abst. 2, 34, 10–16: $�� Ν �
%��*��!�« ��λ ²����*��!�« �/!)7 !κ� �6!7� $�����κ� *%"�� ¹� B� � �'���� !)7*�)7, !κ� �/!κ� $; ��λ C���� �σ�� ��λ π�7� �!� "��. �� $��*�")� Ν � !&« J%�&«, !�1$; *��1 *�� ")� π *%"� �C!� !�(��!��. !��« $; �/!�1 �������«, ���!��« $; *���« b$� ��λ!κ� �� !�1 (���% 6��)�$"�� � �*�!���.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 101
Grundbedeutung hinaus kommt dem Bereich des ‚Hymnischen‘ im Neupla-tonismus und vor allem im Umfeld der athenischen Akademie122 die philo-sophische Dimension zu, im Rahmen des zyklischen Ontologie-Modells,das Proklos in seinen drei ‚Stationen‘ ���+, � ��$�« und ���! �+ dar-stellt123, den Prozess der ���! �+ entscheidend zu unterstützen124, ja ihnzu repräsentieren.125 Insbesondere das ‚Singen‘ von Hymnen erfüllt einengebetsartigen Zweck, indem es den Hymnensingenden in der Bewegung derSeele zurück zu ihrem Ursprung, dem intelligiblen Bereich, unterstützt. Vondiesem ist sie nach Auffassung des Proklos im Unterschied zu Plotin ja striktgetrennt.126
Der Begriff ‚Hymnos‘ erfährt dabei im Neuplatonismus insofern einewesentliche Erweiterung, als er sich nicht mehr ausschließlich auf den üb-lichen Hymnosbegriff, d.h. den im Idealfall dichterisch überformten, durchMenschenhand bzw. -mund geschaffenen Hymnos, bezieht, sondern jeg-liche Hinwendung aller Dinge (jeden !�’s) zur jeweils nächst höheren Instanzin der �� ' alles Seienden bezeichnet. Als Hymnos kann deshalb gleicher-maßen die Hinwendung einer Blume zur Sonne wie das dichterisch an-spruchsvoll komponierte Philosophengebet, etwa in Form der sich an dieorphischen Hymnen anlehnenden proklischen Hymnen, bezeichnet wer-den.127 Angedeutet ist die Relevanz des Hymnenbegriffes sowie seine spä-tere, ausgeprägte Verwendung und Funktionalisierung bereits bei Plotin, derdazu mahnt, „die noetischen Gottheiten hymnisch zu preisen“.128 Die be-
122 Siehe van den Berg (2001), S. 27f., hier 27: „The idea that doing philosophy is sin-ging hymns to the gods was peculiarity of the Athenian Academy.“
123 Siehe Proklos, Elem. 29–39; außerdem Proklos, In Tim. I, 44, 15 Diehl: �+��!� �B f$�� !�1!� !&« $�* ��"��« �!κ� $*���"�« �κ ���% 2�« !µ �Κ!� ��«, *�µ« $; �»«�/!' ��« ��λ � µ« !)7 �/!' ��� $�B !µ ��!B !&« �/!� ��"�« 6�� �(� �« �(� 7� �;� !B��$��!� � !7� $��*7�, �,$�������« $; �/$;� $�’ �/!7�. ν ��λ �, ��$;� �,$����!� !µ*����, Ϊ!� ¹���µ� ��λ $���$��«, Ρ��« ��*��« !���« �� ’ π�7� $���!�� ��λ $����B« !&«�/���"�«, !κ� ²��(��"�� !&« �' �!�« ��λ !κ� �/���������, $�’ i� ���! ����� �,«�/!�0« ��λ �(� ����*� ���@���� $��*7�. Zum Problem der bildlich-metaphori-schen Darstellung eines nicht in zeitlicher Abfolge zu denkenden Prozesses sieheSonderegger (2004), S. 221.
124 Erler (1987), S. 185: „Wie alles strebt auch die Seele zu ihrem Ursprung zurück.Diese Bewegung kann das Gebet unterstützen. (…) Dies gilt ausdrücklich auch fürdie Hymnen.“
125 van den Berg (2001), S. 20: „Proclus, who (…) whished to honour the divine ‚in ac-cordance with the ancestral traditions‘, reinterprets the singing of hymns as an epi-strophe to the gods.“
126 Siehe Erler (1987), S. 183–185.127 Proklos, De sacrificio et magia 148, 3–18.128 Plotin, Enn. II 9 [33] 9, 26–33: $((B � κ ³« Ν �!�� �;� �/!µ� ��� »*�� �"��*�� […]
��λ !�0« ���!�0« 6����� *��0« … Für die Frage, ob es sich bei der Passage Plotin,
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

102 Orphisches und Neuplatonisches
reits erwähnten diversen neuplatonischen Hymnen stellen einen möglichenAusdruck dieses bei Plotin formulierten Ansatzes dar. (Ob die gewählteForm eines literarischen Hymnos dabei von jenem intendiert war, ist aller-dings zu bezweifeln.) Die förmliche Anlehnung etwa der proklischen Hym-nen insbesondere an die orphischen demonstriert gleichwohl noch einmaldie Archegeten-Funktion auch in literarisch-hymnischer Hinsicht und diegroße Anziehungskraft, die die Orpheus-Figur auf Neuplatoniker ausübte.
Es erscheint daher vielversprechend, zunächst die neuplatonischenHymnen und die AO auf mögliche Parallelen hinsichtlich ihrer formalenAnlage, ihrer lexikalischen Ebene, aber auch der Vorstellungen zu untersu-chen, die in ihnen zum Tragen kommen. Aus Gründen der Textüberliefe-rung sollen dabei die proklischen Hymnen als Exemplum dienen. Auf dieformale Übereinstimmung des Auftakthymnos zu Beginn der AO mit denproklischen Hymnen, die darin wiederum mit den orphischen Hymnen kor-relieren, wurde bereits hingewiesen.129 Die dichte Häufung von Epithetaund Epiklesen ist hier ein wichtiges gemeinsames Element. Auch die Kennt-nis orphischer Literatur durch Neuplatoniker wurde bereits thematisiert.130
Interessant in Hinblick auf die AO ist aber vor allem die Bildlichkeit, die inden proklischen Hymnen Verwendung erfährt, und damit auch die Ebeneder Wortwahl. So wird in den proklischen Hymnen immer wieder das Bildeines Schiffs bzw. einer Seereise für das menschliche Leben verwendet, sieheProklos, Hymnos 4, 1 (�(1!�, *��", �"�« ¹� &« �f���« G���!�«); 4, 10 (��λ����� ���!��%��� J%�+�); 6, 11f. (��", ("!����, $�!� ��� �, ��λ 6��!� ���$+!��« | Ρ ��� �« �/��"�« �� ��('�!� �����7!�); 7,32 ($µ« $� ��� F(����Ρ ��� $(�����)� �� λ �����); 7,47 ($µ« ���!)� �(8��!� ��(������!�« $+!�«).131
Enn. V 1 [10] 2, 1–27 um einen eigenen kleinen Hymnos handelt, siehe Philipps(1983). Ohne, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit darauf eingegangen werdenkann, sei zudem darauf hingewiesen, dass Plotin vom hymnischen Preis der noeti-schen Götter spricht, die Götter der proklischen Hymnen vermutlich aber unterenHypostasen und Unterhypostasen zuzuordnen sind, siehe van den Berg (2001),S. 38: „My claim is that the gods invoked in the hymns are notably the lower classesof gods, and these classes happen to be partly left out of consideration in the Theol.Plat.“; außerdem S. 42: „We must conclude, then, that the gods invoked in thehymns are minor deities.“
129 Siehe Erler (1987) mit Verweis auf weitere Literatur, S. 181: „Beim Abfassen seinerHymnen hat er [sc. Proklos] offenbar vor allem die homerischen und orphischenGedichte vor Augen gehabt.“
130 Von Proklos ist jedenfalls mit Sicherheit nachzuweisen, dass er den orphischenHymnos auf die Zahl (zu diesem siehe frr. 695–704 Bernabé) kannte, vgl. Prokl., InRemp. II, 169, 25–27 Kroll; Kern fr. 315.
131 Zum Bild der Seefahrt vgl. auch den Kommentar zu den Versen AO 66–69 sowieHermeias, In Phaedr. 214, 4–24 Couvreur. Dieser beschreibt mit Bezug auf die Odys-see und die Irrfahrten des Odysseus dessen Seefahrt ebenfalls allegorisch als das Le-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 103
Auch das Mysterien-Motiv begegnet immer wieder, etwa in Hymnos 4, 3f.(>(��!’ �« $*���!�0«, ��!��� ��%*�7�� (�����« [sc. J%�B«] | C����$ +!��� ��*� �����« !�(�!9&�) und 4, 15 (F ��� ��λ !�(�!B« ¹� 7� $��-�"��!� ��*��) sowie die Vorstellung, von im Leben (d.h. also während der‚Lebensseefahrt‘) erfahrenen Verunreinigungen gereinigt werden zu müssen(Hymnos 1, 36f.: �� $� �� (%� 7� | L ��� ��("$��, P���7� $’ $�'��%*� %('-��«; 6, 7: >(��!’ ��� ������ ��*� ������ [sc. J%�κ�] !�(�!9&�).
Die Parallelen zur Komposition der AO hinsichtlich ihrer Gesamtanlageund der Bedeutung einzelner wesentlicher Elemente in ihnen (Reinheits-Motiv, Reise-Motiv, Befleckungs-Motiv, Mysterien-Motiv) sind augenfälligund lassen sich über die demonstrierten Beispiele hinaus in Details feststel-len: So formuliert die Sprechinstanz des 1. Hymnos, sie wolle „nach den Ge-schenken“, d.h. nach Maßgabe der Musen singen, eine Vorstellung, die sichauch zu Beginn der AO findet (Hymnos 1, 44 ~ AO 6). Helios, die in diesemHymnos angerufene Gottheit, wird als „feuerumkränzt“ bezeichnet, einBild, das gleichsam in der Schilderung der Kirke, d.h. der Helios-Tochter, inden AO verwendet wird (AO 1218–1221); in bezug auf Helios als „Vater“werden auch Apollon und Dionysos als dessen Abkömmlinge eng miteinan-der verbunden (1. Hymnos 18–24), eine Verbindung, die ebenfalls in den AObegegnet (AO 9).132 Thematisiert wird in den Hymnen die „schaudervolleUnruhe nicht heiliger Begierden“ im Anruf an Aphrodite (2. Hymnos 21f.),ein Aspekt, der im Kontext der AO offensichtlich berücksichtigt wird(s.o. S. 10). Auch vom Lethe-See ist die Rede (3. Hymnos 6), eine Vorstellung,die sowohl in orphischen Kontexten relevant ist als auch in die AO womög-lich hereinspielt (s.o. S. 82).133
Letztlich ist auch auf der Ebene der Götter-Epiklese festzustellen, dasssich interessante Parallelen zwischen den Hymnen des Proklos und den AOfinden lassen. So etwa im Fall der LE�'!� � �*� ���, die im 6. Hymnos desProklos angerufenen wird. Eine gewisse Übereinstimmung findet sich zurDarstellung der AO, wenn in diesen die Statue, die am Tor der Burg des Aie-tes in Kolchis angebracht ist, als die der 5A !���« ���%("� (AO 902) bezeich-net wird. Robert van den Berg hat auf den seltenen Gebrauch des Adjektivs� �*� ���« hingewiesen sowie darauf, dass es überhaupt nur in Verbindungmit Artemis (und zwar in den orphischen Hymnen) und Hekate (eben in un-
ben und – interessanterweise – die einzelnen Stationen (etwa die Sirenen, Kirke, dieKyklopen und Kalypso) als Gefahren, die Odysseus an der (ebenfalls allegorisch zuverstehenden) Rückkehr in seine Heimat (das Noetische) hindern.
132 Siehe den Kommentar ad loc.133 Im Kontext des Er-Mythos der Politeia ist nicht von einem See des Vergessens, son-
dern von einer ‚Ebene des Vergessens‘ die Rede, die vollkommen trocken undbaumfrei sei, sowie einem ‚Fluss der Sorglosigkeit‘, siehe Pol. 621.
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

104 Orphisches und Neuplatonisches
serem Proklos-Hymnos) belegt ist. Es ist also eng mit Artemis-Hekate ver-bunden.134 Das in den AO verwendete Wort ����(��« ist wiederum außer-halb der AO nicht belegt und könnte somit eine Erfindung ihres Verfassersdarstellen. Zumindest umschreibt die sonderbare Wortwahl exakt das aufArtemis-Hekate zugeschnittene Epitheton aus dem Proklos-Hymnos. Einebesondere Nähe zu diesem scheint (vor dem beschriebenen Hintergrundder übrigen Parallelen) deshalb trotz fehlender lexikalischer Korrelation vor-zuliegen. Eine vergleichbare Analogie in der Wahl eines göttlichen Epithe-tons mag auch die Bezeichnung der Aphrodite als � �!�!���« in Proklus’ 2.Hymnos, Vers 13 bzw. als � �!�! ��« in AO 478.868 darstellen.
Fasst man die lexikalische Gestaltung der Proklos-Hymnen näher insAuge, ergibt sich zugleich eine grundlegende Erkenntnis, die die Frage derdichterischen Gestaltung von philosophischen Modellen betrifft. Sie istinsofern auch für den Untersuchungskontext der vorliegenden Arbeitrelevant. Die Betrachtung der proklischen Hymnen lässt erkennen, wie ihrVerfasser eine Transformation bestimmter für sein Werk wesentlicher Vor-stellungen und entsprechender Termini vornimmt. Der fachterminologi-sche Begriff ���! �+ etwa, der – wie ausgeführt – das wesentliche Ziel der(neuplatonischen) Hymnen darstellt135, findet (natürlich auch aus metri-schen Gründen) im hymnisch-hexametrischen Bereich ein adäquates Pen-dant offensichtlich im >(����, von dem mehrfach die Rede ist.136 Dies ist einwichtiger Beleg dafür, wie in Dichtung in der ihr eigenen Sprache über phi-losophisch relevante Sachverhalte gehandelt werden kann, ohne dass diesexplizit und unter Verwendung der in Prosa-Texten üblichen Termini kennt-lich gemacht werden müsste. Betrachtet man nun erneut den 6. Proklos-Hym-nos und dessen Anrufung auch der Hekate-Prothyraia, so wird deutlich, dassexakt dies den Inhalt der Anrufung ausmacht, wenn es dort (Hymnos 6, Vers6f.) heißt: J%�κ� $; �� λ �*��λ �� ��"��%�� | >(��!’ ��� ������ ��*�- ������ !�(�!9&�. Der Hymnensprecher bittet um nichts anderes als Unter-stützung in der ���! �+ seiner Seele von seinem Dahinirren auf Erden,wobei Mysterienweihen als Mittel der Reinigung explizit genannt werden.137
Der philosophische Terminus ���! �+ entspricht also dem dichterischen>(����.
134 Siehe van den Berg (2001), S. 261f.135 S.o. S. 100f.136 Proklos-Hymnen 3, 15; 4, 3; 6, 7.137 Weitere Belege für das Bild des >(���� bzw. >(��*�� der Seele finden sich in den
Proklos-Hymnen 3, 15 und 4, 3.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 105
4.2.3.3 ���! �+: Die Fahrt der Argonauten
Da der Aspekt der Epistrophe für die neuplatonische Hymnenkonzeption,ja für das neuplatonische Konzept von Dichtung insgesamt, die durch Alle-gorese entschlüsselt werden kann, wie gesehen von so zentraler Bedeutungist, lohnt es sich, seiner Relevanz auch für die AO weiter nachzugehen. Be-ginnen wir grundsätzlich. Der dichterische Terminus ‚>(����‘, wie er an dengenannten Stellen in den proklischen Hymnen zum Ausdruck der erbetenenund erwünschten ���! �+ zum Ausdruck kommt, impliziert einen Wen-depunkt, an dem der Hymnensprecher sich sieht bzw. zu stehen hofft, oderzumindest einen Positions- bzw. Richtungswechsel, den er wünscht, wenner – im Fall des 6. Proklos-Hymnos – Hekate Prothyraia und die anderen an-gerufenen Gottheiten darum bittet, ihn „zu ziehen“. Wenn man als die Rich-tung und als Zielpunkt dieses Ziehens das in Hymnos 6, Vers 9 genannte„hochgepriesene Licht“ hinzunimmt sowie die Beschreibung des zum Zeit-punkt des Hymnensprechens bestehenden bedauernswerten Zustands der„dunklen Geburt“, d.h. doch offenbar seiner Erdverhaftetheit, ist sogar voneinem „emporziehen“ auszugehen, um das gebeten wird. Das bereits mehr-fach erwähnte Kreismodell ���+-� ��$�«-���! �+, auf das Proklos im-mer wieder rekurriert, steht offenkundig hinter einer solchen Hymnenkon-zeption und hymnischen Bitte. Die Bitte um Epistrophe legt dabei denSchluss nahe, dass diese Phase in bezug auf den Hymnensprecher nochnicht erreicht ist (und er sich noch im Zustand der � ��$�« sieht) oder die���! �+ zumindest weiterhin göttlicher Unterstützung und Förderungbedarf.
Wenn in den AO nun, wie bereits gesehen, von der Statue der 5A !���«���%("� die Rede ist, die sich an dem Tor befindet, durch das die Argonautenbzw. Orpheus schreiten müssen, um das Goldene Vlies zu rauben (AO 902),so wird hier Artemis-Hekate (von der bei Apollonios und Valerius Flaccusbezeichnenderweise keine Rede ist; es handelt sich also um ein Motiv, dasden AO eigen ist) exakt zu dem Zeitpunkt der Fahrt erwähnt, der den Wen-depunkt von Hin- und Rückfahrt ausmacht. Das Goldene Vlies stellt ja dasmythosinhärente Ziel der gesamten Fahrt dar. Der Aufenthalt in Kolchisstellt für die Argonauten also diejenige Episode der Fahrt dar, in der – bild-lich gesprochen – ihre � ��$�« zur ���! �+ wird. An der Kernstelle diesesverhältnismäßig ausführlich geschilderten Kolchis-Aufenthaltes, eben beimBetreten der Burg des Aietes, in deren Garten das Goldene Vlies aufbewahrtwird, steht Artemis-Hekate.
Dieses Umschlagen von der Hin- zur Rückfahrt, von der � ��$�« zur���! �+, ist in der Konzeption der AO zudem in besonderer Weise mar-kiert bzw. im Vergleich mit den Schilderungen bei Apollonios und Valeriusmit einem besonderen Umstand verknüpft (der Raub des Vlieses stellt ja
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

106 Orphisches und Neuplatonisches
notwendigerweise immer den Wendepunkt der Argonautenfahrt dar): Wiebereits beschrieben (s.o. S. 19), ist der Mord der Argonauten an Apsyrtosin den AO im Vergleich zu den beiden anderen epischen Gestaltungen desMythos vorverlegt138 und findet noch in Kolchis, direkt im Anschluss an denRaub des Vlieses, statt. Fragt man nach einer möglichen Funktion einer sol-chen Mythenkorrektur, so wird im Fall der AO schnell klar, dass der Mordnoch in Kolchis, d.h. am Wendepunkt der Fahrt, die wesentliche Vorausset-zung dafür ist, die Rückkehr der Argonauten in ihrer Gesamtheit unter demGesichtspunkt eines zweiten Ziels gestalten zu können, nämlich der Reini-gung der Argonauten von dem Miasma, mit dem sie durch die Ermordungdes Medea-Bruders befleckt sind. In der Tat wird diese Reinigung der Argo-nauten durch die Anwendung ritueller Handlungen, die nach dem Wissendes Orpheus verlaufen, wie erwähnt139 zum eigentlichen Ziel der Heimfahrt.Konsequenterweise endet die Beschreibung der Fahrt durch die ErzählinstanzOrpheus mit der erfolgten Reinigung und Verrichtung der Orpheus-Riten.Nach Erfüllung dieser elementar wichtigen Ausgabe wird der Thraker Argound Argonauten verlassen.
So wie also die Ermordung des Apsyrtos in Kolchis für die Argonautenauf der Ebene der Erzählung an ihrem Wendepunkt von Hin- und Rück-fahrt den Tiefpunkt darstellt, der eine schmerzliche und mühevolle Rück-fahrt bis an die Grenzen des Jenseits nach sich zieht, so stellt derselbeUmstand, d.h. die Ermordung des Apsyrtos in Kolchis, in allegorischerHinsicht am Wendepunkt von der � ��$�« zur ���! �+ den Punkt tiefs-ter Verstrickung in menschliches und irdisches Unheil dar. Von dieser wer-den sie, wie es auch der Hymnensprecher des 6. Proklos-Hymnos erbit-tet, nach langem Leiden und Umherirren erst durch göttliche Weisung undHilfe (in Form der Argo und Kirkes) und Verweis auf die reinigende Kraftvon Riten, die nach den Anweisungen des Orpheus durchgeführt werden,erlöst.
Die Zeichnung der Orpheus-Figur in den AO ist vor diesem Hinter-grund äußerst präzise. Seine vorsichtige Haltung, die er beim Besuch Iasonszum Ausdruck bringt, deutet auf die Gefahren und vor allem Mühen einer‚Seefahrt‘ (zum philosophischen Gehalt des Motivs s.o. S. 102f.) bereits hin.Sie stehen in offensichtlichem Kontrast zu seinem Zustand der Ruhe – bzw.���+ – in seiner Höhle, in die er gegen Ende der Erzählung zurückkehrenwird.140 Lediglich die Einsicht in die göttliche Notwendigkeit lässt ihn eine
138 Für die Frage, inwiefern eine solche Vorverlegung des Mordes bereits literarisch –etwa in der Tragödie – vor den AO realisiert wurde, siehe den Kommentar zu denVersen AO 1019–1035.
139 S.o. S. 19 und 81f.140 AO 97–102.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 107
Teilnahme an der Fahrt nicht ablehnen.141 In seiner Haltung, auf das Anlie-gen Iasons und der Argonauten einzugehen, demonstriert Orpheus (in einergewissen Vorbildfunktion, an der sich ein ‚Betender‘ im Sinne eines neupla-tonischen Hymnos orientieren soll?) sowohl den Gehorsam gegenüber den‚Litai‘ seines Gegenüber (AO 108) als auch, so muss man schließen, Ver-trauen in einen guten Ausgang des Unternehmens mit göttlicher Hilfe. Dasletztendliche Gelingen der Fahrt trotz aller Mühen und Gefahren bringt erden Argonauten gegenüber anlässlich seines Opfers und des feierlichenTreueschwures, den die Heroen dem Iason gegenüber erbringen müssen,sogar explizit zum Ausdruck: Solange sich alle Fahrtteilnehmer an den ge-leisteten Schwur, Iason als ihren Anführer zu akzeptieren, halten, wird ihnendie sichere Heimkehr zu ihren Erzeugern gewiss sein.142 Denn Iason sei vorallem aufgrund göttlichen Willens zum Anführer auserkoren, worauf Hera-kles, dem das Amt des Anführers zunächst angetragen wird, hinweist.143 DieBeachtung des göttlichen Willens sichert den Argonauten also ihre sichereHeimkehr und Epistrophe, die ihnen Orpheus für ihre Treue zu ihrem An-führer Iason zugesichert hat. Die Ermordung des Apsyrtos hingegen amWendepunkt der Fahrt und die daraus resultierenden Leiden der Argonau-ten stellen die Leiden dar, die Orpheus beim Verlassen der Höhle bereitsvorhergesehen hat und die ‚naturgemäß‘ die Begleitumstände einer ‚See-fahrt‘ im Sinne einer ‚Lebensseefahrt‘ bilden. Unterstützt wird eine solcheDeutung dadurch, dass die Höhle des Orpheus als „hochgelegen“ bezeich-net wird (AO 50.1373), der Mord des Apsyrtos aber am Ufer der Phasis-mündung, d.h. auf dem Niveau des Meeresspiegels, erfolgt. Die Fahrt derArgonauten verfügt damit nicht nur über eine kreisförmige Struktur in‚horizontaler‘ Ausrichtung (Oikoumene und Okeanos), sondern – wie der6. Proklos-Hymnos (s.o.) – auch eine ‚vertikale‘ Dimension, die in den AOkonkret in Abstieg und Wiederaufstieg zur Höhle besteht.
Kehrt man zu der Frage zurück, in welchem Maß und in welcher Hin-sicht in bezug auf die AO von einem Hymnos gesprochen werden kann144,so wird deutlich, dass unter dem Gesichtspunkt der ���! �+ eine Antwortgegeben werden kann, die über den Aspekt bestehender Gattungskonven-tionen hinausgeht. Die AO in ihrer Gesamtheit erfüllen zwar nicht die Kri-terien eines Hymnos in struktrueller Hinsicht. Dafür bilden sie aber in derkreisförmigen Strukur ihrer Erzählung und ihrer partiellen Parallelität zurKonzeption und Ausdrucksform der proklischen Hymnen das Kernanlie-gen eines neuplatonischen Hymnos, die ���! �+, bildlich-literarisch nach.
141 AO 106–109.142 AO 347–352.143 AO 296–300.144 Hierzu siehe auch Köhnken (2007), S. 273.
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

108 Orphisches und Neuplatonisches
Nicht auf formeller, aber auf inhaltlicher Ebene erfüllen die AO damit denwichtigsten Anspruch, der aus neuplatonischer Sicht an einen Hymnos ge-stellt werden kann. Gleichzeitig erfüllen sie so eine wichtige Voraussetzungfür eine potentielle Allegorese: Indem sie das Prinzip des Kreislaufs, wie esauch im Modell von ���+-� ��$�«-���! �+ zum Ausdruck kommt, abbil-den, verweisen sie über sich hinaus auf eine Struktur intelligibler Natur, dieder entsprechend sensibilisierte Rezipient durch Allegorese des Textes her-ausarbeiten kann.
4.2.3.4 �&(�, ���! ��, �ρ! �« – das Motiv des ‚Wahns‘
In den AO kommen weiterhin verschiedene Aspekte der Orpheus-Figurzum Tragen, die v.a. in der Rahmenhandlung in eine zeitliche Beziehung zu-einander gesetzt werden.145 Dies wird durch den von Luiselli stark betontenGegensatz von �1� (AO 7 und 47) und � �*�� (AO 8) deutlich, der grund-sätzlich zwei Orpheus-Zustände markiert146: Einen, der vom Zeitpunkt derRahmenhandlung aus gesehen in der Vergangenheit liegt, sowie den Zu-stand, dem die AO selbst zugehörig sind. In diesem Kontext ist von diversenEinflüssen die Rede, unter denen Orpheus zu verschiedenen Punkten seinesLebens gestanden haben will und von denen sowohl in der Rahmenhand-lung (AO 1–49) als auch innerhalb der erzählten Handlung (AO 50–1376)die Rede ist.
Auffällig ist dabei die Verwendung des Begriffes �ρ! �«. Durch diesenunterscheidet Orpheus den erwähnten früheren von einem späteren Zu-stand, und zwar sowohl innerhalb der Rahmenhandlung (AO 47) als auch inder Erzählung selbst (AO 103f.). An letztgenanner Stelle heißt es, dass IasonOrpheus einst in dessen Höhle besuchte. Bei dieser Gelegengheit habe er,Orpheus, seinem Gast bereits von einem früheren Zustand berichtet, derdurch den Umstand, von einem �ρ! �« befallen gewesen zu sein, gekenn-zeichnet gewesen sei. Eine solche Feststellung ist in zweierlei Hinsicht wich-tig: Erstens vor dem Hintergrund der in der vorliegenden Arbeit vertretenenThese, dass es sich bei den AO um ein Werk handelt, das auch in Hinsichtauf eine zu vollziehende neuplatonische Allegorese geschaffen wurde. Denndie Ebene der Erzählung selbst (narrative) wird mit dieser feinen Unterschei-dung ebenfalls, wie die des Erzählers (narrator), als dem �1� zugehörig erwie-sen: Orpheus ist ja zum Zeitpunkt des Iason-Besuchs und damit der gesam-ten folgenden Erzähl-Handlung vom �ρ! �« bereits befreit. Sie ist somitder Allegorese in neuplatonischem Sinn zugänglich. Die Sprechinstanz Or-
145 S.o. S. 20ff.146 Vgl. Luiselli (1993), S. 269.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 109
pheus und der Protagonist der Erzählhandlung Orpheus stehen in Hinsichtauf ihre Befreiung vom �ρ! �«, von dem sie zuvor befallen waren, auf einerStufe. Zweitens in Hinsicht auf die aufgestellte Forderung zu untersuchen,inwiefern die AO mit platonischen und neuplatonischen Dichtungskon-ventionen korrelieren.147 Denn mit dem Wahn-Motiv ist ein Kernpunkt pla-tonischer Dichtungsauffassung berührt, da von einem göttlichen und inspi-rierenden Wahn in verschiedenen platonischen Dialogen (vor allem imPhaidros) und neuplatonischen Kommentaren (etwa dem proklischen Poli-teia-Kommentar) immer wieder die Rede ist.
Wenn an den genannten Stellen in den AO vom �ρ! �«-Wahn die Redeist, so ist damit ein Zustand der Vergangenheit bezeichnet, der weder fürden Zeitpunkt der Rahmenhandlung noch der erzählten Handlung ange-nommen werden soll, sondern von dem sich die Sprechinstanz Orpheusausdrücklich distanziert. Der ‚Wahn‘, der durch �ρ! �« ausgedrückt wird,ist nicht mehr Teil der Identität, die der Orpheus-Figur der AO eigen ist.Was diesen vormaligen Zustand des �ρ! �«-Wahns ausmachte, wird eben-falls ausgesagt, wenn der Verfasser der AO seine Sprechinstanz Orpheuskundtun lässt, dass er früher (� �*��), „durch den Stachel des Bakchos unddes Herren Apollon | angetrieben (���! )� �(�%������«), Schauder erre-gende Pfeile (�&(�) bekanntmachte, | Allheilmittel für sterbliche Menschen,gewaltige Mysterien für die Eingeweihten“ (AO 9–11).
Luiselli folgert aus dieser dezidierten Betonung der ‚Nüchternheit‘ desOrpheus der AO einen vor allem künstlerischen Anspruch ihres Verfassers,sein eigenes literarisches Können (im Gegensatz zu einer von Luiselli inFrage gestellten religiösen Inspiration) zu betonen und sich von anderer un-ter dem Namen des Orpheus umlaufender Literatur abzusetzen.148 Be-schränkt man einen solchen Ansatz einmal auf die Frage der Inspiration unddes Wahns, der in den AO durch die Negierung des �ρ! �«-Motivs ausge-schlossen werde, so ist hinzuzufügen, dass es sich beim �ρ! �« nicht umeinen allgemein aufgefassten und unspezifischen Wahn handelt, sondern umeinen Wahn im Sinne einer plötzlichen, schädlichen Ergriffenheit vor allemvon niederen Begierden.149 Von einem solchen erbittet z.B. die Sprechin-stanz der proklischen Hymnen Erlösung und Befreiung150 und macht da-durch deutlich, dass hiermit nicht die in platonischen Kontexten immer wie-
147 S.o. S. 94–96.148 Siehe Luiselli (1993), S. 299–301.149 Mit �ρ! �« wird etwa in der Odyssee (22, 300) eine Stechfliege, die das Vieh quält, be-
zeichnet, bei Herodot (2, 93) die Haltung von Fischen, die zum Laichen in einen Seeschwimmen, bei Euripides ist gar von den �f! ��« #E ����� die Rede (IT 1456) undbei Platon ist der �ρ! �« das Prinzip der tyrannischen Seele (Pol. 577e).
150 Prokl., 5. Hymnos, Vers 14f.
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

110 Orphisches und Neuplatonisches
der positiv konnotierten Erwähnungen der verschiedenen Formen der‚Mania‘ gemeint sind.151 Es findet in den AO also keine Abgrenzung zumBegriff der ���"� statt, sondern nur zum �ρ! �«, dessen Wirken sich in derVergangenheit in der Verkündung von �&(� (AO 10) und der Tatsache, voneinem ���! �� angetrieben zu sein (AO 10), äußerte. Zu diesen Begriffenwird damit ebenfalls Distanz aufgebaut. Über das Verhältnis des Orpheuszur ‚Mania‘ wird in den AO dagegen weder in der Rahmenhandlung noch imBereich der Binnenerzählung explizit etwas ausgesagt. Es stellt sich deshalbdie Frage, ob eine – nach (neu-)platonischer Dichtungsauffassung notwen-dige – göttliche Mania, über die ein Dichter verfügen muss, damit seineDichtung im höchsten Bereich der drei Dichtungs-����, von denen Proklosspricht, angesiedelt ist, in Hinsicht auf die Konzeption der AO erkennbar ist.
Eine Schlüsselvoraussetzung, die AO der höchsten der drei proklischenDichtungs-����, d.h. der entheastischen, zuordnen zu können152 und sie da-mit als allegorisch lesbar zu erweisen, ist einmal in der Figur des Orpheusselbst angelegt: Als Sohn der Muse Kalliope (AO 77) verfügt er bereits überein Höchstmaß an göttlicher ‚Ergriffenheit‘, die allerdings in der Vergangen-heit durch den ‚falschen‘ Wahn, nämlich den �ρ! �«, überlagert wurde. Be-zeichnenderweise ist es seine musische Mutter, die ihn von diesem befreit(AO 103f.). Die Wahl der Orpheus-Figur zum Narrator der AO kann des-halb bereits als ein wichtiges Charakteristikum der AO verstanden werden,das Vorhandensein einer göttlichen Ergriffenheit in der Darstellung der AOaus dem Mund des Orpheus kenntlich zu machen. Allerdings wird ein sol-cher Ansatz zunächst scheinbar dadurch erschwert, dass die Muse zu Beginnder AO dezidiert nicht angerufen wird, obwohl der Musenanruf die sonstfür einen epischen Beginn durchaus gängige Form einer Versicherung vonInspiration bedeutet, d.h. die bewusste Bitte um die dichterische Mania. Esist in diesem Kontext hilfreich, den Begriff der Mania weiter zu präzisieren.Im Phaidros ist erklärtermaßen von vier verschiedenen Formen der ‚Mania‘die Rede153, wobei die ersten drei Formen als mantische, kathartische undmusische Maniai bezeichnet werden. Der Eros dagegen, nach Hermeias’ an-tikem Phaidros-Kommentar der ��« ����« des Phaidros154, wird nach einer eini-germaßen ausführlichen Schilderung eines platonischen Mythos155 erst als
151 Plat., Pol. 573a–b152 S.o. S. 89f.153 Siehe Platon, Phdr. 244a–249d.154 Vgl. Hermeias, In Phaedr. 1, 8f. Couvreur.155 Platon, Phdr. 246a3–d3. Auf die komplexe Frage, was genau einen platonischen My-
thos ausmacht und ob es sich bei der Schilderung des Seelenwagens im Phaidros tat-sächlich um einen ‚Mythos‘ handelt, kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nichtweiter eingegangen werden. Zur Einordnung der Phaidros-Stelle als ‚Mythos‘ vgl.aber Most (2002), S. 10.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 111
vierte Form der Mania eingeführt und zielt bekanntermaßen vor allem aufdie philosophische Natur des von ihm Ergriffenen.156
Eine solche Differenzierung der verschiedenen ‚Maniai‘ ist in den AOauf subtile Weise aufgegriffen. In der bereits mehrfach behandelten Passageder Verse 12–46, die in bezug auf die Orpheus-Figur dem Zustand der Ver-gangenheit zugeordnet wird157, ist vor allem von den mantischen und ka-thartischen Fähigkeiten des Orpheus die Rede (AO 33–39), die sein SchülerMusaios von ihm erlernt habe, d.h. solchen Fähigkeiten, die in ihrem Zu-schnitt den ersten beiden Formen der Mania im Phaidros entsprechen. Diesewerden also bereits für den ‚alten Orpheus‘ geltend gemacht.158 Auch diedritte Form der ‚Mania‘ aus dem Phaidros, die musische, ist bereits in der Ver-gangenheit vorhanden, denn die ‚orphische‘ Dichtung spielt im Rahmen derVerse 12–46 im Bild der ��8$�� �&(� (AO 10), v.a. in Form der beschrie-benen Kosmo- und Theogonie, ebenfalls eine wesentliche Rolle. Auch diemusische Mania wird somit bereits für den ‚alten‘ Orpheus in Anspruch ge-nommen. Der Funktion der Verse 12–46 entsprechend bedeutet die Nen-nung der drei genannten Formen der Mania dabei nicht, dass sie ausschließlichder Vergangenheit zugeordnet wären; auch in der Erzählung des Orpheus,d.h. auf der Ebene des ‚�1�‘, wird von ihnen immer wieder die Rede sein:Auch der ‚neue‘ Orpheus wird einen kosmogonischen Hymnos singen (AO421–431), und während der Fahrt wird immer wieder von den Fähigkeiten,die in den Versen AO 33–39 als Lehrgegenstände für Musaios genannt wur-den, die Rede sein.159
Es bleibt die Frage nach der vierten Form der Mania, der philosophi-schen. Diese wird im Rahmen der Verse 12–46 als einzige ausgespart und istsomit der ‚alten‘ Orpheus-Figur in der Darstellung und Konzeption der AOnicht eigen. Es sei die These formuliert, dass aber eben die vierte Mania hin-ter der Ankündigung des ‚Neuen‘, bislang niemals Verkündeten, als das Or-pheus seine Erzählung einleitet, zu sehen ist. Wenn davon die Rede war, dassOrpheus innerhalb der Rahmenhandlung bei der Ankündigung dessen, wasniemals zuvor aus seinem Munde zu hören gewesen sei (vgl. AO 49: „����9$ ’ π��!� &« ����&«, ²��� � λ� G��%*��“) eine „Verrätselungsstrategie’verfolge160, die die AO als ein zu dechiffrierendes Werk markiere, so ist ebendurch diesen Hinweis die ‚Sphäre‘ der vierten Form von Mania, d.h. der phi-losophischen und mit ihr verbunden der neuplatonischen Dichtungs-Alle-gorese, bezeichnet. Der Zustand des ‚neuen‘ Orpheus, der sich sowohl auf
156 Vgl. Platon, Phdr. 249d4ff.157 S.o. S. 22ff.158 Zur Unterscheidung zwischen ‚altem‘ und ‚neuem‘ Orpheus s.o. S. 20–25.159 Siehe den Kommentar zu AO 33–39.160 S.o. S. 28.
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

112 Orphisches und Neuplatonisches
die Ebene der Rahmenhandlung wie auch auf die Erzählung der Fahrt selbstbezieht, steht somit unter der Ägide der wahrhaft philosophischen Mania,die die AO insgesamt für eine Allegorese erst würdig und geeignet macht.Erst auf der Ebene des ‚�1�‘, d.h. in bezug auf den neuen Orpheus, sind allevier Formen der im Phaidros genannten Maniai vereint. Erst die Erzählungdes neuen Orpheus, d.h. die AO, ist somit einer allegorischen Interpretationin vollem Umfang zugänglich. Eine solche Deutung hilft wiederum zu ver-stehen – und damit sei abschließend auf die weiter oben gestellte Frage zu-rückgekommen –, warum zu Beginn der AO kein Anruf der Muse erfolgt:Nicht die musische Mania soll offensichtlich den Auftakt der AO bilden(und somit notwendigerweise beim Rezipienten den Eindruck erwecken, eshandelte sich um ein ‚gewöhnliches‘ Epos), sondern die philosophische Ma-nia soll als im wesentlichen hinter der Komposition der AO stehend erkanntwerden. Ohne dabei namentlich genannt zu werden, ist sie bezeichnender-weise nur demjenigen überhaupt sichtbar, der entsprechend sensibilisiertbzw. geschult ist – und bewahrt die in den AO enthaltenen allegorischenMuster so vor ‚unbefugtem Zugang‘.
4.2.3.5 Das Motiv der ‚Höhle‘
In einem letzten Abschnitt sei auf das Motiv der Höhle eingegangen, das so-wohl in der Komposition der AO als auch in platonischen und neuplatoni-schen Kontexten von Bedeutung ist. Es erscheint deshalb lohnend, seineVerwendung in den AO näher zu untersuchen. Das ‚Phänomen Höhle‘ istim griechischen Denken und in der griechischen Literatur äußerst präsent.Götter werden in Höhlen aufgezogen (Zeus)161, Weise fallen in Höhlen inSchlaf und werden auf diese Weise göttlicher Offenbarungen teilhaftig (Epi-menides)162, Orakel werden in Höhlen erteilt (Delphi).163 Platon hingegenhat zu einer solchermaßen einflussreichen Vorstellung der Höhle als einemOrt „ekstatischer Bewusstseinsveränderungen, Visionen und Jenseitskon-
161 Diod. 5, 70, 2.162 So etwa Diog. Laert. I, 109.163 So lautet zumindest die antike communis opinio, ausgedrückt etwa bei Strabon 9, 3, 5
(!µ ���!���� Ν�! �� ���(�� ��!B �'*�%«). Eine umfassende Untersuchung zumThema ‚Höhle‘ hat zuletzt Yulia Ustinova (2009) unternommen (mit den Seiten121–155 zum Adyton in Delphi); siehe aber auch Speyer (1982), der den Topos derHöhle in seiner kaum einzugrenzenden Komplexität aufzeigt, S. 192: „Insofernumfasst die Höhle das Ganze der sichtbaren Welt: sie ist Ort des Dunkels und desLichts, sie ist Stätte des Todes, der Zeugung und der Geburt, sie ist die Stelle, an dersich Diesseits und Jenseits begegnen, und demnach der eigentliche Offenbarungs-ort.“
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 113
takte“164 in der Konzeption der Politeia in Form des Höhlengleichnisseseinen fundamentalen Gegenentwurf entwickelt. Hier ist die Höhle nicht Ortgöttlicher Offenbarung und damit mit einem Nimbus des Jenseitigen ver-sehen, sondern steht im Gegenteil bildlich für einen anthropologischenZustand, der von Ignoranz und fehlendem Wissen in bezug darauf gekenn-zeichnet ist, wie die Dinge außerhalb der Höhle beschaffen sind; d.h. in derKonstruktion des Höhlengleichnisses, wie der Bereich des Noetischen,nicht Schattenhaft-körperlichen im Unterschied zum massiv eingeschränk-ten Wahrnehmungsbereich der Höhlenbewohner beschaffen ist.165 DieHöhle steht in der Konzeption des platonischen Höhlengleichnisses für Er-kenntnisfeindlichkeit und Philosophieferne.166
In den AO ist gleich mehrfach von Höhlen die Rede. An prominentesterStelle ist die Höhle des Orpheus selbst zu nennen, die den Ausgangs- undEndpunkt seiner Fahrtteilnahme und damit der Erzählung derselben aus-macht (AO 75.1375).167 Gleichzeitig wird der Kentaur Cheiron als in einerHöhle wohnend beschrieben (AO 379). Auch das Gesangsduell zwischenOrpheus und Cheiron wird in der Höhle des letzteren lokalisiert. Zuletztwird angedeutet, dass auch die mit dem Hapax „limnakisch“ bezeichnetenNymphen, die Hylas in den Tod ziehen, in einer Höhle wohnen (AO 645).Es stellt sich deshalb die Frage, ob für die AO eine einheitliche Konzeptionvon ‚Höhle‘ vorliegt.
Vor allem im letztgenannten Fall scheint eine Verweisfunktion auf dieSchrift des Porphyrios zur allegorischen Deutung der odysseischen Nym-phengrotte (De antro Nympharum) angelegt zu sein, die trotz der Knappheitder Darstellung in den AO evoziert wird. Die erwähnte Wortwahl deutet vordem Hintergrund, dass auch bei Porphyrios explizit gesagt wird, dass es sichbei den odysseischen Höhlennymphen um Wassernymphen handelt, in einesolche Richtung. Der Kontext der Hylas-Episode lässt weitere Vermutun-gen zur (literarisch-transtextuellen) Intention einer solchen Evokation zu168,ohne dass an dieser Stelle der AO allerdings eine eigentliche ‚Höhlenkon-zeption‘ erkennbar wäre.
Auch die Darstellung der Cheiron-Höhle scheint allein literarischen Zie-len untergeordnet zu sein. Nicht zuletzt die Schilderung seiner Höhle erfüllt(neben der Schilderung seiner Person selbst) die Funktion, als Folie zur
164 Männlein-Robert (2011), S. 1.165 Siehe Platon, Pol. 516e-517a.166 Ausführlich herausgearbeitet hat diese spezielle platonische Charakterisierung der
Höhle in der Politeia Männlein-Robert (2011), v.a. S. 9–15.167 Zum Problem der Verortung der Rahmenhandlung, d.h. zur Frage, wo man sich
den Erzähler Orpheus vorzustellen hat, s.o. S. 17–18.168 Siehe den Kommentar zu AO 643–648.
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

114 Orphisches und Neuplatonisches
odysseischen Polyphem-Höhle (die Höhle hier als Sinnbild für fehlende Zi-vilisation) zu dienen und auf diese Weise die gesamte Cheiron-Episode mitdem Kentauren als vorbildlichem Gastgeber in starkem Kontrast zur Schil-derung des Aufenthaltes der Odysseus-Gefährten beim Kyklopen zu zeich-nen.169
Es bleibt die Höhle des Orpheus, in der er nach eigener Aussage auf„seine Vollendung im Tod“ wartet (AO 105), als Iason ihn zur Teilnahme ander Argonautenfahrt zu überreden versucht. Nach der in der vorliegendenArbeit vorgeschlagenen allegorischen Lesart der AO steht die Höhle damitbildlich auch für den Zustand der ���+, aus dem heraus Orpheus wie auchdie Gruppe der Argonauten zunächst in den Zustand der � ��$�« und an-schließend (mit dem Kolchis-Aufenthalt, der dort als Mysterienweihe be-schriebenen Gewinnung des Goldenen Vlieses170 sowie der Ermordung desApsyrtos gleich im Anschluss als Tief- und Wendepunkt der Fahrt) in denZustand der ���! �+ gelangen. Für ein solchermaßen allegorisches Bildeines zyklischen Ontologie-Modells leistet die Höhle als Symbol allerdingskeinen relevanten Beitrag. Es ist zu vermuten, dass auch ein anderer Aufent-halts- bzw. Wohnort des Orpheus die Funktion eines Symbols für den Zu-stand der ���+ erfüllen könnte. Das Motiv der Höhle scheint von dem deszyklischen Kreislaufs sauber zu trennen zu sein. Auch eine Deutung der Or-pheus-Höhle im Sinne des Porphyrios, der davon spricht, dass eine Höhleals Symbol für den geschaffenen Kosmos gelten kann171, scheint nicht vor-zuliegen. Vielmehr verlässt Orpheus seine Höhle, um mit den Argonautendie notwendigen Abenteuer der ‚Lebensseefahrt‘172 zu bestehen.
Und damit nicht genug: Nicht ohne weiteres ist auch das oben erwähnteplatonische Höhlenmodell der Politeia auf die Konstellation der AO über-tragbar. Zwar wird auch Orpheus aus seinem Zustand der Höhle durchfremden Impetus – vergleichbar dem Geschehen im Höhlengleichnis – zumVerlassen der Höhle veranlasst, doch weiterführende Parallelen sind nichtohne weiteres festzustellen. So steht erstens die Figur des Orpheus selbsteiner Deutung entgegen, dass es sich beim Verlassen der Höhle um einenWissensgewinn für Orpheus, den Höhlenbewohner, handeln könnte. Seinegesamte Zeichnung als desjenigen, der außerhalb der Höhle nicht ‚geführt‘werden muss, sondern vielmehr selbst derjenige ist, der den Argonauten im-mer wieder helfend zur Seite steht (sei es in kultischen Dingen beim Stapel-
169 S.u. S. 267.170 S.u. S. 319–321.171 Porphyrios, De antro 5: 5A�! � �;� $κ ������7« �¹ ��(���λ ��λ �+(��� !)7 ���)� ��*-
�� �%� ��*’ Ρ(�� !� �/!µ� ��λ ��!B �� � (���'���!�«, ����(�� �;� !&« C(�« �) j« ²����« !κ� �&� �� �$�$��!�« �!(.
172 S.o. S. 103.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

Die AO im Kontext des Neuplatonismus 115
lauf der Argo, bei der Versöhnung der Kyzikosseele oder bei der Gewinnungdes Goldenen Vlieses selbst, sei es in der Funktion eines Wegweiser wie imFalle der Kyanischen Felsen), steht dem Bild des platonischen Höhlen-gleichnisses entgegen. Iason erfüllt in der Konzeption der AO offensichtlichnicht die Funktion des platonisch-sokratischen ‚!�«‘.173 Für eine Einordnungdes in den AO angelegten Motivs der Höhle in einen (neu-) platonischenExegeserahmen kann deshalb nicht der Aspekt des Verlassens der Höhledurch Orpheus im Vordergrund stehen.
Bedeutsam ist vielmehr das Moment der Rückkehr bzw. der Berichtüber die Fahrt für Musaios, den primären, internen Adressaten dieser Er-zählung.174 Obwohl über den Ort des eigentlichen Vortrags keine Angabenerfolgen175, legen die letzten Verse der AO doch zumindest den Schlussnahe, dass die Heimkehr des Orpheus in seine Höhle eine endgültige ist.176
Aus diesem Grund wird auch der Bericht der Fahrt in seiner durch Allego-rese zu dechiffrierenden Komplexität nicht vom Komplex der Höhle zutrennen sein, in der Orpheus – zu welcher Zeit und wo auch immer dieseHöhle existieren mag – seinem Schüler Musaios im Gestus des in die HöhleZurückgekehrten von den Erlebnissen außerhalb der Höhle berichtet. Da-mit ergibt sich gleichzeitig die entscheidende Wendung, dass durch die Iden-tität des primären Zuhörers Musaios mit der Person des Rezipienten, der dieSchüler-Rolle des Musaios annimmt177, der Rezipient selbst zum Zuhörerdes Orpheus im Kontext der Höhle, ja zum Höhlenbewohner wird. Füreinen Rezipienten in der Rolle des Orpheus-Schülers stellt dessen Berichtdeshalb in seiner allegorischen Komplexität gleichsam den Bericht desjeni-gen dar, der aus der intelligiblen Welt zurück in die beschränkte Welt derHöhle, d.h. des menschlichen Daseins, zurückkehrt.
173 Platon, Pol. 515d2: �, !�« �/!)7 (���� …174 S.o. S. 12.175 S.o. S. 17f.176 Siehe den Kommentar zu AO 1370–1376.177 S.o. S. 17.
Die AO im Kontext des Neuplatonismus
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM

116 Orphisches und Neuplatonisches
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:42 AM