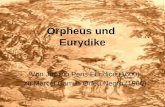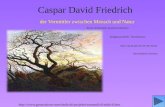Kern, Otto - Orpheus. Eine Religionsgeschichtliche Untersuchung
Orpheus in der Spätantike (Studien und Kommentar zu den Argonautika des Orpheus: Ein literarisches,...
Transcript of Orpheus in der Spätantike (Studien und Kommentar zu den Argonautika des Orpheus: Ein literarisches,...

3
1. Einleitung
Hermann Fränkel1 und Martin West2 formulierten vor über 60 bzw. fast30 Jahren das Desiderat einer eingehenden Untersuchung der Argonautikades Orpheus (fortan AO). Es handelt sich hierbei um ein 1376 Verse langesEpos eines anonymen Verfassers, der die Erzählung der Argonautenfahrtdem Orpheus in den Mund gelegt hat.3 Mahnte Fränkel eine Auseinander-setzung vor allem unter kompositorischen und quellenhistorischen Ge-sichtspunkten an, versprach sich West vertiefte Erkenntnisse hinsichtlichder ‚Orphic literature‘, die zur Zeit der Abfassung der AO (zumindest derenVerfasser) bekannt war und in die Komposition eingeflossen ist. BeiderAnliegen sind in die Fragestellungen, die der vorliegenden Arbeit zugrundeliegen, eingegangen. Eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Werkließ allerdings schnell erkennen, dass es bei den genannten Ansätzen nichtbleiben konnte. Es erscheint vielmehr angebracht, sich nicht auf einen odermehrere Teilaspekte zu beschränken, sondern eine möglichst umfassendeUntersuchung anzustreben, um die AO sowohl in ihrer strukturellen wie in-haltlichen Komplexität zu untersuchen. Neben der Frage poetischer Gestal-
1 Fränkel (1944), S. 398: „If Pseudo-Orpheus were a normal writer, the nature of hisimitation could be properly determined, with some significant features showing upin salient relief. But his diction and his entire artistic character are irrational andcapricious. Perhaps this is one good reason why today (…) the way in which hehandled his source material has not yet been described in a satisfactory fashion.“Diese Forderung hatte zuvor bereits Otto Kern (1933), S. 504 in seiner Rezensionder Dottin’schen Ausgabe erhoben: „… zielt meine lebhafte Bitte darauf, es mögesich eine junge, philologisch geschulte Kraft endlich dieser so lange vernachlässig-ten Dichtung annehmen.“
2 West (1983), S. 38: „If we could identify all the poems and date the Argonautica, weshould have an exact record of the state of Orphic literature as seen by one personat a known epoch; but the first can never be done, and the second has not beendone yet.“
3 In der vorliegenden Arbeit ist bewusst nicht von den orphischen Argonautika, sondernvon den Argonautika des Orpheus die Rede, ihrem handschriftlich bezeugten Titel(O��E�� A��ONAΓTIKA). Obwohl das „Orphische“ im Titel mittlerweile etab-liert ist, führt es leicht zu irreführenden Assoziationen; es sei auf den weiteren Gangder vorliegenden Untersuchung verwiesen. An der üblichen Abkürzung „AO“(für Argonautiques Orphiques, etabliert vor allem durch Vian) kann jedoch ohneweiteres festgehalten werden (eben für Argonautika des Orpheus).
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:55 AM

4 Einleitung
tung und poetologischer Grundlagen erweist sich die Einbeziehung des‚geistigen Milieus‘, d.h. philosophischer, religiöser und kultureller Kontexte,die sich in diesem Epos manifestieren, in den Interpretations-Prozess als be-sonders notwendig und fruchtbar.
1.1 Forschungsstand
Gottfried Hermanns Orphica aus dem Jahr 1806 enthalten den bis heute ein-zigen umfassenden Kommentar zu den AO. Obwohl diese vollständig über-liefert sind und in der Zeit zwischen der Florentiner editio princeps im Jahr1500 durch Philipp Junta bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zahlreiche Aus-gaben und Übersetzungen erstellt wurden4, überwiegen seit dem 19. Jahr-hundert kritische Beurteilungen.5 Bis heute werden die AO im wissenschaft-lichen Diskurs nur am Rande wahrgenommen.6
Die Frage ihrer Datierung bildet seit Hermann einen roten Faden in derReihe der Abhandlungen zu den AO in den vergangenen 200 Jahren. Diesergrenzte die mögliche Entstehungszeit zunächst auf die Alternative einerKomposition zwischen Quintus von Smyrna (vermutlich 3. Jh.)7 und Non-
4 Für einen Überblick über die Überlieferungs- und Editionsgeschichte sei auf dieAusgabe von Vian (1987) sowie die Arbeiten von Piñero (1990) und Sánchez (1996)verwiesen.
5 So etwa Keydell (1942), Sp. 1337, der dem Verfasser der AO dichterische Unfähig-keit vorwirft, seinen Stil massiv kritisiert (eine „unerfreuliche Mischung verschie-dener Elemente“) und ihm Pseudo-Gelehrsamkeit unterstellt. Keydell steht damitfür eine Tradition, die ihren Ausgang bei Hermann selbst nimmt. Dieser bezeichnetden Verfasser der AO schlicht als malum scriptorem (a.a.O., S. VIII). Ähnliche Urteilefinden sich seitdem in zahlreichen Untersuchungen auch zu Detailproblemen,die allgemeine Äußerungen hinsichtlich der Qualität des Gesamtwerks aber nichtscheuen, z.B. Ludwich (1887), S. 647: „Eine solche Geschmacklosigkeit kann ichselbst diesem Orphiker nicht zutrauen.“ Positiver urteilt Radermacher (1938),S. 172, der dem Verfasser der AO immerhin zugesteht, von Apollonios Rhodios un-abhängige Überlieferungen eingebracht zu haben und sich bisweilen „an eigenenErfindungen zu erfreuen“. Auch Fränkel (1944), S. 395f. fällt über die AO einUrteil, das im Kontext der zeitgenössischen Kritik geradezu positiv erscheint:„Despite all this, however, the poem is not wholly bad.“
6 Siehe etwa Graf/Johnston (2007), S. 166, bei denen es im Kontext der Darstel-lung der orphischen Literatur und der Rolle des Orpheus als Argonaut heißt:„The two [!] epic versions of Jason’s voyage that we possess, one written by theGreek poet Apollonius of Rhodes (…), the other by the Roman poet Valerius Flac-cus (…).“
7 Siehe zuletzt Bär (2009), S. 14–23; Gärtner (2010), S. X.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:55 AM

Forschungsstand 5
nos (5. Jh.)8 oder erst auf die Zeit nach Nonnos ein.9 Aufgrund einer peni-blen Untersuchung v.a. metrischer Charakteristika und des Gebrauchseiniger Pronomina wie �� und �� argumentiert er für eine Abfassung vorNonnos. Die Angemessenheit einer solchen Herangehensweise wurde aller-dings von Keydell in Frage gestellt, der es für denkbar hält, dass ein Verfas-ser, der unter dem Namen des Orpheus schreibt, auch nach Nonnos nichtdessen (strengerem) Gebrauch des Hexameters folgt, sondern versuchenwird, den Eindruck hohen Alters und archaischer Komposition zu erwe-cken.10 Insgesamt sind bislang Einordnungen vom 6. Jahrhundert vor Chris-tus11 bis ins 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung12 diskutiert worden. EineEinordnung in das 4./5. Jahrhundert n. Chr. kann heute als communis opiniogelten.13 Insgesamt gilt es festzustellen, dass die Debatte um die Entste-hungszeit der AO trotz ihrer Intensität bislang ohne einen eigentlich inter-pretativen Gewinn geführt worden ist.
Einen wegweisenden Schwerpunkt für die Untersuchung der AOsetzte Helmut Venzke in seiner 1941 erschienenen Dissertation: Diese be-schäftigt sich v.a. mit dem Verhältnis der AO zum Argonautenepos desApollonios Rhodios14, behandelt allerdings nur die ersten gut 800 Verseausführlich und ist – da der Verfasser im Krieg fiel – offensichtlich unvoll-endet. In einer Rezension hebt Fränkel15 den unfertigen Charakter dieserArbeit hervor. Venzke arbeitet als eine mögliche Funktion der AO die Ver-herrlichung der Orpheus-Figur durch ihren anonymen Verfasser heraus.16
Gleichwohl kommt ihm das Verdienst zu, die in den AO angelegten Paral-lelen auch zu lateinischer Literatur zu thematisieren, was vor dem zeitlichen
8 Vian (1976), S. IX–XVIII; Diehle (1989), S. 609.9 Hermann (1806), S. 675–687.
10 Keydell (1942), Sp. 1333.11 In der Suda (s.v. ‚#O ��«‘ Bd. III, Nr. 657 [S. 565] Adler) wird ein Orpheus von
Kroton genannt, der als Verfasser von Argonautika und Zeitgenosse des TyrannenPeisistratos bezeichnet wird. Zur Diskussion um die frühe Ansetzung siehe Her-mann (1806), S. 675ff., der v.a. die Positionen von Ruhnken ([6. Jh.? bis alexandri-nische Zeit) und Schneider (Werk eines Alexandriners) zusammenstellt.
12 Eine solche Annahme erwähnt Luiselli (1993), S. 265 Anm. 1 ohne Angabe desUrhebers.
13 So etwa West (1983), S. 37: „It can hardly be earlier and may well be later than thefourth century AD.“ Vian (1987), S. 46 urteilt ähnlich, vermeidet aber die Fest-legung eines terminus ante quem: „… le poème pourrait donc être postérieur à la pre-mière moitié du Ve siècle ap. J.-C.“
14 Vgl. Kerns bereits erwähnte diesbezügliche Forderung (1933), S. 504.15 Fränkel (1944).16 Venzke (1941), S. 8: „(…) daß O [sc. der Verfasser der AO], der sein Werk zur Ver-
herrlichung des Orpheus schuf, (…)“
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:55 AM

6 Einleitung
Hintergrund der Entstehung der Arbeit keine Selbstverständlichkeit dar-stellt.17 Auch die komplizierte Gestaltung der Fahrtroute der Argo in denAO – eine für alle Versionen des Argonautenmythos relevante Frage –sowie diverse geographische Probleme, die bereits Thema einer ausführ-licheren Abhandlung bei Bacon18 waren, werden bei Venzke angerissen.
Eine für die Beschäftigung mit den AO wesentliche Arbeit stellt die1987 von Francis Vian nach verschiedenen Vorarbeiten besorgte und bis-lang maßgebliche wissenschaftliche Ausgabe mit einer hilfreichen Einlei-tung dar.19 Eine solche war von Kern auch nach dem Erscheinen der Aus-gabe von Dottin 1930 als noch immer ausstehend bezeichnet worden.20
Indem Vian neben der Textüberlieferung und sprachlichen Aspekten so-wohl auf die in den AO breit angelegte literarische Rezeption, die ein beacht-liches Spektrum der antiken Literatur umfasst, als auch auf Parallelen zuorphischer Literatur eingeht, orientiert er sich – bewusst oder unbewusst –an den beiden Motiven, die Fränkel und West das Desiderat einer eingehen-deren Beschäftigung mit den AO formulieren ließen. Spätestens seit denÜberlegungen Wests (1983) und Vians (1987) zum Vorhandensein des„orphisme dans le poème“21 stellt die Frage nach dem orphischen Gehaltder AO einen wichtigen Gesichtspunkt der seitdem erschienenen Arbeitendar. Dieses Faktum ist umso bemerkenswerter, als Keydell das völlige Feh-len eines solchen Aspektes konstatierte.22
Ähnlich skeptisch zeigt sich Raffaele Luiselli23 in seinen 1993 veröffent-lichten Ausführungen zum Proöm derselben: Er bestreitet einen wie auchimmer gearteten religiösen Gehalt24 und deutet, wenn er von einer „orphi-schen Matrix“ des Werks spricht, gleichzeitig als erster die Möglichkeit an,dass es sich bei den AO um ein Werk handeln könnte, das nicht einschichtig,nicht eindimensional konzipiert ist, sondern das mit verschiedenen Ebenenoperiert und womöglich anders beschaffen ist, als eine Lektüre, die nichtüber die Literarebene hinausgeht, ahnen lässt. Auch nach der Intention fürdie Verwendung der von ihm postulierten orphischen Matrix fragt Luiselliund formuliert dabei u.a. die Vermutung, dass eine fingierte Autorschaft desOrpheus dem Werk eine andernfalls nur schwer zu erreichende Publizität
17 Eine tabellarische Zusammenstellung findet sich bei Venzke (1941), S. 111f.18 Bacon (1931).19 Siehe auch Vian (1981), Vian (1982) und Vian (1983).20 S.o. S. 3 Anm. 1.21 Siehe Vian (1987), S. 5.22 Keydell (1942), Sp. 1336: „Von orphischer Lehre enthalten die Argonautika nichts.“23 Luiselli (1993), S. 265–307.24 Luiselli (1993), S. 306.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:55 AM

Forschungsstand 7
sichern sollte.25 Ein solcher Ansatz mag einer gewissen Grundlage nicht ent-behren, er erschwert eine inhaltliche Auseinandersetzung aber eher, als dasser sie fördert. Er verleitet dazu, nicht über die Feststellung hinauszukom-men, dass ein Dichter ein an sich angeblich belangloses Werk unter demPseudonym des Orpheus verfasste, weil er hoffte, auf diese Weise seinem‚Produkt‘ ein Überleben zu sichern. Mögliche tiefergehende Intentionen derPsyeudonymwahl werden so nicht berücksichtigt.26
Den 1996 erschienenen Studien von Manuel Sánchez liegt als erster wei-terführender Untersuchung seit Hermannn das gesamte Textcorpus der AOzugrunde. Die beiden Hauptschwerpunkte der Arbeit bilden Untersuchun-gen zur Textüberlieferung (in Auseinandersetzung und Ergänzung zu ViansAusgabe) und eine Beschreibung der in den AO angelegten narrativenStrukturen. In einem kurzen dritten Teil seiner Arbeit widmet sich Sánchezzudem – wie Vian – der Frage nach dem orphischen Gehalt der AO, be-schränkt sich dabei aber fast ausschließlich (wie Luiselli, dessen Arbeit of-fensichtlich noch nicht eingearbeitet werden konnte) auf das Proöm der AOund gelangt in dieser Frage nicht zu über seine Vorgänger hinausgehendenErgebnissen.27 Richard Hunter griff die von Sánchez thematisierte Frage derErzählstruktur auf und arbeitet in seiner Arbeit aus dem Jahr 2005 als ersterdas in den AO angelegte Spiel mit verschiedenen Facetten epischer Dich-tung zwischen den Polen Lehr- und Erzählepos heraus.28 Auch Adolf Köhn-ken (2007) geht am Beispiel ausgewählter Szenen auf die narrativen Struk-turen der AO ein und analysiert eine durch intensive Auseinandersetzungmit der mythischen Tradition und Apollonios Rhodios, dem „Vorbildtext“29
für die AO, konstruierte „Führungsfunktion“ der Orpheus-Figur. DamianNelis (2005) widmete sich dagegen vor allem der Untersuchung von Paral-lelen zu lateinischer Epik (v.a. Silius Italicus) in den AO und geht dabei auch
25 Luiselli (1993), S. 305f.: „Certo è che l’intento primario della composizione delleAO è quello assolutamente letterario di conseguire la notorietà poetica: un motivo,questo, non isolato nella cultura greca dell’età postclassica. È possibile che proprioquesto intento sia la ragione sostanziale dell’operazione di mistificazione della tra-dizione orfica compiuta dall’ autore delle AO. (…) Orfeo garantiva valore artisticoindiscutabile, ma soprattutto quell’ antichità che sola poteva garantire agli occhi delpubblico la reale veridicità del canto e perciò stesso la fama.“
26 Dazu s.u. das Kapitel 2.1. ‚Orpheus als Erzähler‘, S. 12–20.27 Sánchez (1996), S. 231: „A nuestro entender, el poeta anónimo no escribe bajo el
nombre de Orfeo sólo para dar a sus creencias un sabor órfico. El motivo pri-mordial parece ser otro: él sabía que la composición de un autor de recursos tanlimitados hubiese quedado pronto en el olvido; en cambio, si pasaba como obra deun poeta de renombre su fortuna a buen seguro sería otra.“
28 In: Paschalis (2005), S. 149–168.29 So Köhnken (2007), S. 283.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:55 AM

8 Einleitung
der Frage von Rekonstruktionsmöglichkeiten uns verlorengegangener (or-phischer) Texte aus den AO nach.30
Im Sinne eines Fazits lassen sich aus diesem Forschungsbericht für denZeitraum der vergangenen zwei Jahrhunderte (vor allem für die Arbeiten vorHunter, Nelis und Köhnken) folgende Tendenzen ablesen beziehungsweiseDesiderate erkennen: Die Frage der Abfassungszeit nahm seit Hermann denwohl größten Raum innerhalb der Forschungsliteratur zu den AO in An-spruch. Eine Datierung auf sicherer Grundlage ist bislang dennoch nichterreicht worden31, wenngleich die communis opinio inzwischen von einer Ein-ordnung in den Kontext der Spätantike und frühestens ins 4. Jahrhundertausgeht. Die Frage nach dem orphischen Gehalt der AO bzw. dem Vorhan-densein entsprechender Elemente stellte spätestens seit West und Vian einenwichtigen Aspekt innerhalb der einzelnen Untersuchungen dar, bislangallerdings ohne eindeutige Ergebnisse. So gibt Vian zwar einen detailliertenKatalog von Passagen der AO, die einen orphischen Hintergrund erkennenlassen32, doch lässt sich seiner Auffassung nach keine tiefergehende orphi-sche Prägung erkennen. Nach einer Einleitung (nach Vians Auffassung derVerse AO 12–45), deren orphischer Charakter offensichtlich sei, wirkten diePerson des Orpheus sowie der Orphismus in einem weiteren Sinne wie eineunbeholfene Fassade der eigentlichen Erzählung. Gleichwohl enthalte dasgesamte Werk – in Ergänzung zur Einleitung – Anspielungen bzw. Tenden-zen („développements“), die man im Kontext eines degenierten Orphismus(„orphisme abâtardi“) sehen könne.33 Von dieser Erkenntnis bis zu LuisellisModell der „orphischen Matrix“ war es kein weiter Weg. Dessen Ansatz um-geht aber die von Vian beschriebene Problematik eher, als dass er sie löst:Die von ihm postulierte Distanz der AO zu anderer orphischer Literaturlässt sich mit den außerhalb des Proömiums der AO auszumachenden undvon Vian aufgelisteten orphischen Passagen nicht recht in Einklang bringen.Die Auffassung eines „degenerierten Orphismus“, wie Vian es ausdrückt,der sich in den AO präsentiere, stellt deshalb bis heute die maßgebliche, aberunbefriedigende Sicht auf das Vorhandensein orphischer Elemente in den
30 In: Paschalis (2005), S. 169–192.31 Für eine Einordnung von Teilen der AO ins 4. oder sogar 6. Jh. v. Chr. plädiert er-
neut Fabre (1972), S. 269–313. Anders Rovira Soler (1978), S. 204f., die wiederumfür eine deutlich spätere Einordnung der AO ins 4. Jahrhundert nach Christus argu-mentiert.
32 Vian (1987), S. 5–18.33 Vian (1987), S. 14f.: „Après ce prélude [sc. die Verse 12–45], dont le caractère
orphique est évident, le personnage d’Orphée et l’orphisme, entendu au sens large,apparaissent comme un placage maladroit sur le recit. (…) Cependant le poèmecontient des allusions ou des développements qu’on peut rattacher plus ou moins àun orphisme abâtardi et qui completent le prélude.“
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:55 AM

Ansätze und Ziele der vorliegenden Arbeit 9
AO dar. An der Ratlosigkeit, die in einer solchen Auffassung zum Ausdruckkommt, ändert auch nichts die Tatsache, dass dem anonymen Verfasser derAO immerhin zugestanden wird, über ein gutes Wissen orphischer Schriftenzu verfügen, für die er wiederum selbst ein interessantes Zeugnis darstelle.34
1.2 Ansätze und Ziele der vorliegenden Arbeit
Ein wichtiger Grund für die geschilderten und in der Tat unleugbarenSchwierigkeiten für ein adäquates Verständnis der AO hinsichtlich ihrerorphischen Elemente dürfte in zwei Gründen bestehen: Zum einen wird inder Beschäftigung mit den AO entweder nicht definiert, was mit dem Be-griff ‚orphisch‘ gemeint ist (Vian), oder die Untersuchung wird auf die Frageeingeengt, ob der Verfasser der AO „ein Orphiker war“ (Sánchez).35 Zumanderen – und damit einhergehend – dominiert eine Auffassung der AOals eines ‚Reservoirs‘ von ‚orphischen‘ Auffassungen, Theogonien, Opfer-schilderungen und sonstigen Belegen, das aufgrund seiner Heterogenitätseinerseits Rätsel aufgibt (s.o.).36 Dass die AO ein organisches, literarischesKunstwerk darstellen, rückt bei einer solchen Betrachtungsweise in denHintergrund. Vor allem die Möglichkeit, dass für das Vorhandensein orphi-scher Elemente in einem Werk, das der Kaiserzeit bzw. Spätantike zuzuord-nen ist, Bezugspunkte wie die Verbindung von Orphischem mit Neuplato-nischem, die seit den Arbeiten Brissons37 deutlich geworden ist, bei derKomposition der AO eine Rolle gespielt haben könnten, ist weitgehendunberücksichtigt geblieben. Die Bedeutung der Orpheus-Figur im Neupla-tonismus hat bislang keinen Eingang in die Auseinandersetzung mit denAO und ihrer Verortung im geistig-literarischen Spektrum der Spätantikegefunden.38
Die neuen Ansätze der vorliegenden Arbeit sind deshalb folgende: Nar-rative Aspekte wie das Vorhandensein der Erzählerinstanz Orpheus sowie
34 Vgl. Vian (1987), S. 18 und West (1983), S. 38. Zur Vorstellung, dass es sich bei denVersen 12–46 um einen literarisch verbrämten „Katalog“ orphischer Werke han-deln könnte, siehe bereits Kern (1922), S. 67 [im Anschluss an t. 224].
35 Sánchez (1996), S. 229: „El estudioso que aborda este poema ha de tratar de averi-guar qué conocimientos sobre el orfismo tenía su autor y si es posible concluir quefuese un órfico, en el sentido de que formase parte de una congregación de inicia-dos en los misterios.“
36 Siehe auch Köhnken (2007), S. 273 Anm. 5.37 Brisson (1987) und Brisson (1990).38 Sánchez (1996), S. 231f. deutet die Bedeutung der Orpheus-Figur in der Spätantike
im Kontext neuplatonischer Autoren zwar an, geht dieser Frage allerdings nichtweiter nach.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:55 AM

10 Einleitung
seines fiktiven Zuhörers und Schülers Musaios, die daraus resultierendeRolle auch für den Rezipienten, hymnische Elemente sowie die strukturelleKonzeption der Erzählung von der Argonautenfahrt durch Orpheus sollenherausgearbeitet werden. Zu letztgenannen gehören etwa ihre Kompositionals Kreisbewegung, aber auch inhaltliche Konzeptionen wie die textinterneAuseinandersetzung mit verschiedenen Funktionen der Orpheus-Figur.Die in den Strukturen angelegten literarischen wie religiösen und philo-sophischen Implikationen müssen analysiert und in ihrer Relevanz für einerweitertes Verständnis der AO erläutert werden. Neben dem Aspekt derTranstextualität39, der für die Untersuchung der AO in der Nachfolge deralexandrinischen Argonautika des Apollonios in besonderem Maße bedeut-sam ist, wird vor dem Hintergrund der Forschungen Luc Brissons und demoffensichtlichen Interesse, das viele Neuplatoniker an der Figur des Orpeussowie an unter seinem Namen umlaufenden Schriften zeigten, zu überprü-fen sein, ob sich für die Struktur und einzelne Motive der AO Parallelen zuneuplatonischen Vorstellungen feststellen lassen und wenn ja, ob sich da-raus Schlüsse auf eine eventuelle Nähe der AO zum Neuplatonismus erge-ben.40 Dabei ist auch die Frage, was im Kontext der AO ‚orphisch‘ genanntwerden kann, erneut anzugehen. Mit dem Interpretationsansatz, der in dervorliegenden Arbeit angeboten wird, finden diverse bislang als Schwächender AO empfundene Spezifika zumindest plausible Erklärungen: Etwadie als Emotionslosigkeit beschriebene Zurückhaltung in der Schilderungaffektbezogener Handlungen41, die explizit als Kreisbewegung angelegteKomposition der Erzählung des Orpheus von der Argonautenfahrt oder dieim Vergleich zu anderen Argonautenepen in stärkerem Maße betonten hym-nischen Komponenten. Einen letzten Schritt stellt die Untersuchung einerallegorischen Lesart der AO dar.
39 Für eine Einordnung der in der vorliegenden Arbeit verwendeten Fachtermini s.u.S. 12 und S. 29.
40 Anders dagegen Keydell (1942), Sp. 1337: „Von einer Sublimierung der Theurgiedurch philosophische Spekulation, wie die Neuplatoniker sie boten, ist bei diesemtrockenen Bücherwurm nicht die Rede.“ Dass Keydell allerdings auch jeglichesVorhandensein „orphischer Lehre“ bestritten hatte (s.o. S. 6 Anm. 22), sollte nachden Entwicklungen der AO-Forschung der letzten Jahrzehnte auch hinsichtlichseines Neuplatonismus-Diktums nachdenklich stimmen.
41 Dies hebt bereits Vian (1987), S. 15 hervor: „Il réprouve l’amour ou évite d’y faireallusion: il dépouille l’épisode d’Hylas de toute connotation érotique; il condammela passion de Médée sans apporter les mêmes atténuations qu’Apollonios.“; außer-dem Hunter (2005), S. 157: „… be connected with the narrator’s notorious rejectionof the love of women …“
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:55 AM