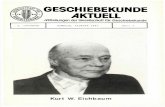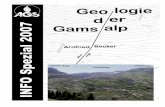OSTRACODEN AUS DEM MITTLEREN KAMBRIUM VON ÖLAND
-
Upload
dietmar-andres -
Category
Documents
-
view
227 -
download
7
Transcript of OSTRACODEN AUS DEM MITTLEREN KAMBRIUM VON ÖLAND
O S T R A C O D E N A U S D E M M I T T L E R E N KAMBRIUM VON O L A N D
D I E T M A H A N D R E S
ANDRES, D.: Ostracoden aus dem mittleren Kambrium von (>land. Lethaia, Vol. 2, pp. 165-180. Oslo, September 15th, 1969.
Middle Cambrian Archaeocopida (Sylvester-Bradley 1961) are described. They are characterized by a shell consisting of three layers and the presence of pore canals. The attribution of this group to the Ostracoda is corroborated. The bearing of the Middle Cambrian forms on the phylogeny and the systematic subdivision of the order Archaeocopida is discussed. Descriptions : Hipponicharion loczrlatum n. sp., Longispinu oelandica n. g., n. sp., Bradoria sp.
Es werden neue mittelltambrische Archaocopiden (Sylvester-Bradley 1961) mit dreischichtiger Schale und Porenkanalen beschrieben. Ihre Einstufung als primitive Ostracoden wird begrundet, und die Phy- logenie und Moglichkeiten zur systematischen Untergliederung der Archaocopiden werden diskutiert. Neubeschreibungen : Hipponicharion loczrlatzim n. sp., Longispina oelandica n. g., n. sp., Bradoria sp.
Die taxonomische Einordnung der kambrischen zweiklappigen Crustaceen ist schwierig. Da stets nur die Schalen erhalten sind, fehlen die meisten Kriterien zur Beurteilung der verwandtschaftlichen Beziehungen. Es beste- hen Unterschiede zu allen in Frage kommenden rezenten Gruppen.
Bisher wurde fur die systematische Einordnung der kambrischen zwei- klappigen Crustaceen fast nur die Schalenmorphologie benutzt. Die Morpho- logie der Schale allein ist aber fur den Zweck einer phylogenetisch ausge- richteten Systematik ein gefahrliches Mittel, da sie bei ahnlicher Umwelt in genetisch nicht nahe verwandten Gruppen unabhangig voneinander ahnlich entwickelt werden kann. Deshalb ist es wichtig, neben der Gestalt der Schale andere Merkmale zu finden, die bei der systematischen Ein- ordnung der kambrischen zweiklappigen Crustaceen benutzt werden konnen.
Fundumstande Die Fundstelle ist ein 150 m langes und drei Meter hohes Kliff bei Albrunna an der sudlichen Westkiiste der Insel Oland. Das Gestein ist der sogenannte Paradoxissimus-Sandstein (mittleres Mittelkambrium), dessen quarzitische Anteile in Norddeutschland als Geschiebe bekannt sind. Die Ausbildung ist bei Albrunna nicht einheitlich. Der Gehalt an Quarz, Glimmer, Kalk und Ton andert sich in der Vertikalen und auch horizontal. Es handelt sich um
17 - Lethaia 1 : 3
166 DIETMAK ANDRES
eine flachmarine, sehr kustennahe Fazies; man beobachtet Wellenrippeln, Schragschichtung, Diskordanzen und kleinere konglomeratische Bestand- teile. Dem entspricht eine starke Brekziierung der Fauna. Die Fossilien sind in einzelnen Lagen stark angereichert, die aber horizontal nicht weit aushalten. Im allgemeinen handelt es sich bei den fossilreichen Lagen um einen hellgrauen yuarzitischen Sandstein mit mehr oder weniger Kalk im Bindemittel.
Den Hauptanteil der Fauna bildet eine Trilobitenbrekzie, auBerdem kom- men Hyolithen und kleine Inarticulaten vor. In dieser Trilobitenbrekzie sind vereinzelt die hier beschriebenen Ostracoden zu finden. Sogar diese kleinen Schalen sind meistens fragmentar. Es wurden drei Spezies gefunden, die sich morphologisch recht stark unterscheiden. Der Aufbau der Schalen und andere Eigenschaften sind jedoch gleichartig, es handelt sich offenbar um die gleiche taxonomische GroBgruppe.
Gemeinsame Merkmale aller Arten Die Schalen sind gleichklappig und haben einen angenahert dreieckigen UmriR. Der Dorsalrand ist gerade und lang. Es ist kein SchloB vorhanden. Eine erhaltungsfahige Innenlamelle gibt es ebenfalls nicht. Der Schalen- schluR ist vollkommen.
Der Schalenaufbau ist dreischichtig. Die relative Dicke der einzelnen Schichten ist etwa so, wie sie fur moderne Ostracoden angegeben wird, mit einer dunnen inneren, einer dicken mittleren und einer sehr dunnen auBeren Schicht (vgl. Fig. 1 und Fig. 2). Die mittlere Schicht erscheint in frischem Zustand heller als die innere und die auBere Schalenschicht. Meist sind nicht alle Schichten erhalten. Die oberen beiden oder auch alle drei Schichten konnen abgesplittert oder weggelost sein. Die ursprungliche Matrix kann
Fig. 1. Querschnitt durch die Schale. Schema.
Schematic transverse section through v a l w .
Fig. 2. A. Longispina oelandica. Stuck B10. Innenansicht, Ausschnitt, I 61. Wo die Grub- chen sich durchpausen, liegt die sehr dunne obere Schicht frei. Man sieht den Abbruch der dicken mittleren Schicht (hell) und am Ventralrand und an anderen Stellen Reste der dunnen Innenschicht. B. Longispina oelandica. Stuck B11. Linke Klappe mit abgebrochenern Stachel, . 25. Es ist die obere und mittlere Schalenschicht xu sehen. C. Longispina oelandica. Stuck B11. Ausschnitt der Schalenoberflache, 87. Es ist die sehr dunne obere Schicht und die dicke mittlere Schicht zu sehen. D. Longispinu oelandica. Stuck €311. Ausschnitt der Schalenoberflache, ' x 170. Es ist die sehr dunne obere Schicht und die dicke mittlere Schicht zu sehen. E. Longispina oelandica. Stuck B11. Detail der Schale, = 370. Abbruch der sehr dunnen ausseren Schicht und Oberflache' der dicken mittleren Schicht; auf der Oberflache der dicken mittleren Schicht pragen sich noch die Grubchen durch.
A. Longispina oelendica. Specimen B10. Detail of internal view, 61. Distinct (white)
~C~ITTELI~AMBRISCHE OSTHACODEN 167
edges delimit the middle lajier. I'ragments q f the inner layer are seen best along the etentral margin. The outer laycr is discrrnible around the pits. B. Longispina orlandica. Specimen B l l , I 25. Left valve with spine broken off. Outer and middle layer visible. C. Longispina oelandica. Specimen B11. Detail, I 87. [Jpper left : outer layer. Lower right : outer layer stripped off , middle layer exposed. D. Longispina oelandica. Specimen B11, 170. Outer and middle layer exposed. E. Longispina oelandica. Specimen B l l , I 370. The edge .from lozoer left corner to middle right. T h e outer layer is preseroed; below it is stripped. The pits are still risible on the sirrface of the middle l a ~ ~ i v .
168 DIETMAR ANDRES
durch Kalk oder - dies meist nur oberflachlich - durch Pyrit ersetzt sein. Nur bei wenigen Stucken ist die Schale im ursprunglichen Zustand und nicht angewittert.
Die Oberflache der Schalen zeigt Grubchen. Da die auI3ere diinne Schicht uberall die gleiche Dicke beibehalt, sind die Grubchen noch auf der Ober- flache der mittleren Schicht zu sehen; tiefer pragen sie sich jedoch nicht mehr durch (vgl. Fig. 2). Oberflachliche Grubchen sind von anderen Archaeo- copiden bekannt, u. a. von der mittelkambrischen Bradoria sp. (Bolton & Copeland 1963) und einer oberkambrischen von Palmer (1954) beschriebenen Spezies.
Fig. 3. Kontakt der Klappen am freien Rand. Schematischer Querschnitt.
Schematic section through contact zone of right and left elalve along ventral margin.
Am freien Rand der Schale ist eine Lippe ausgebildet, deren unterer Anteil dem dichten SchalenverschluB dient. Diese Lippe bricht leicht und ist nur an wenigen Stucken gut erhalten. Da ein ahnliches Element auch bei einigen Abbildungen in der Arbeit von Ulrich & Bassler 1936 und bei Bradoria sp. (Bolton & Copeland 1963) zu erkennen ist, halte ich es fur moglich, daI3 diese Ausbildung des freien Randes fur viele oder alle unter- und mittelkambrischen Archaeocopida zutrifft. Schlechte Erhaltung und mangelnde Praparation konnen die Ursache fur ihr Fehlen bei den anderen Spezies sein. Fig. 3 stellt die Verhaltnisse am freien Rand schematisch dar (vgl. auch Fig. 2A).
Die Klappen sind am Dorsalrand nicht vollig getrennt. An der Grenze zwischen beiden Klappen bemerkt man eine starke Verdunnung der Schale und einen Knick im Querschnitt ; dies wirkte wie ein Scharnier ahnlich dem Knick eines gefalteten Papiers und gab den beiden Klappen eine Bewegungs- moglichkeit gegeneinander. Es wurden ganz geschlossene, leicht klaffende und vollig aufgeklappte assoziierte Schalen gefunden. Die am Dorsalrand stark verdunnte Schale muI3 also biegsam gewesen sein. Die dicke mittlere Schicht ist am Scharnier nicht vorhanden, was die Biegsamkeit ermoglicht. Die durchgehende auI3ere Schicht verbindet linke und rechte Klappen und bildet das Scharnier, unter Umstanden ist daran auch die innere Schicht beteiligt (vgl. Fig. 4).
MITTELKAMBRISCHE OSTRACODEN 169
Dies entspricht den Verhaltnissen bei der Unterordnung Phosphatocopina (Muller 1964) ; Die Phosphatocopina besitzen eine dickere innere und eine dunne au8ere Schalenschicht ; die dorsale Verbindung am Scharnier zwi- schen beiden Klappen geschieht ausschliefllich durch die au8ere dunne Schicht.
Fig. 4 . Dorsaler Zusammenhang der Klappen. Schematischer Querschnitt. Die dicke mitt- lere Schicht ist am Scharnier nicht vorhanden.
Schematic section through junction of right and left valve along dorsal margin.
Etwa ein Prozent des vorliegenden Materials besteht aus zusammen- hangenden Schalen, die ubrigen Exemplare sind isolierte am Scharnier abgetrennte Klappen. Bei den Phosphatocopina ist der Anteil an assoziierten Schalen groI3er. Der Grund hierfiir durfte die wesentlich dunnere und leich- tere Schale der Phosphatocopina und das ruhigere Wasser der oberkam- brischen Stinkkalk-Fazies sein.
Die Schale besitzt Porenkanale, die senkrecht zur Schalenoberflache ver- laufen. Je ein Porenkanal scheint in einem Grubchen nach auBen zu munden (vgl. Fig. 5 ) . Die Porenkanale sind nur in zwei Fallen gut zu sehen. Sie wer- den vermutlich nur sichtbar, wenn ihre sekundare Fullung anders gefarbt oder anders verwittert ist als die ubrige Schalensubstanz. Daher konnte auch nicht studiert werden, wie sich die Porenkanale am Schalenrand ver- halten.
Die chemische Zusammensetzung der Schalen wurde mit Hilfe dcr Mikrosonde von Herrn Dr. A. Willgallis vom Mineralogischen Institut der
Fig. 5 . Raumliche Darstellung der Schale mit Griibchen und darin miindenden Poren- kanalen. Schema.
Schematic block-diagram of detail of valve showing pore canals ending in the centres of the pits.
170 DIETMAK ANDRE
Freien Universitat Berlin untersucht. Die Ergebnisse in1 einzelnen und die Arbeitstechnik sind im AnschluB an diese Arbeit dargestellt (Willgallis 3969). Es wurde nur die mittlere Schalenschicht untersucht. Sie besteht aus ca. 80"" Calciumphosphat, ca. 5"; Calciumcarbonat und ca. 10°;, freiem Iiohlenstoff.
Hipponichavion Ioculatum n. sp. DERIVATIO NOMINIS. - Lateinisch loculatiis - mit Gruben versehen.
HOLOTYP. - Stuck B6; Fig. 7A.
PARATYPEN. - 54 annahernd vollstandige Exemplare; aunerdem ca. 100 Fragmente.
STRATUM TwIcunI UNI) LOCUS TTPICUS. - Paradoxissimus-Sandstein, mitt- leres Mittelkambrium; Kliff bei Albrunna an der Sudwestkuste der Insel Oland, Sudschweden.
I~IAGNOSE. - Hipponichavion niit einer anteroventralen mit Gruben ver- sehenen Erhebung und zwei dem freien Rand parallelen durchlaufendcn Rippen.
RESCHREIBUNG. - Der UmriB ist angenahert dreieckig. Dem freien Rand laufen zwei Kamme parallel, die zu den Ecken hin hoher sind als ventral. Die gesamte Morphologie ist bemerkenswert steil. Im anteroventralen Teil liegt cin langlicher Buckel, der nach ventral gerundet endet und zum Dorsalrand in einen Kiel auslauft (Fig. 7A, B, D). Auf diesem Buckel befinden sich 2 bis 10 Gruben, deren Funktion nicht geklart werden konnte (Muskelansatzstellen ? Brutpflegeorgan ?). Auf der Innenseite pragen sich diese Gruben als Zapfen durch. Sind nur zwei oder drei Gruben vorhanden,
Fig. 6. Hipponicharion loczilatum Gesamtansicht einer rechten N a p - pe ; unter Beriicksichtigung des Ho- lotpps und aller Paratypen. Lange 1,48 mm.
Hipponicharion loculatum. Recon- struction of y i f i h t valve. Length 1.38 mm.
~CZITTELKAMBRISCHE OSTRACOIIEM 171
Fig. 7. A. Hipponicharion loculatum. Holotyp, Stuck B6, rechte Klappe, = 40. Nur die innere Schalenschicht ist erhalten. B. Hipponicharion loculatum. Stuck B4, rechte Klappe,
= 45. Nur die innere Schalenschicht ist erhalten. C. Hipponicharion loculatum, Stuck B1, linke Klappe, x 70. Schrag von hinten unter einem Winkel von 66’. Nur die innere Schalen- schicht ist vorhanden. D. Hipponicharion loculatum. Holotyp, Stuck B6, anteroventraler Buckel mit Gruben. ,.’ 100.
A. Hipponicharion loculatum. Specimen B6, Holotype, : 30. Right valz>e. Only the inner layer is preserved. B. Hipponicharion loculatum. Specimen B-l, ~ 35. Right valve. Only the inner layer is preserved. C. Hipponicharion loculatum. Specimen B l , = 70. LeJt valve foto- graphed obliquely f r o m behind. D. Hipponicharion loculatum. Specimen B6, 1 100. Detail. Anteroe1entral lobe with pits.
so liegen sie in dorsoventraler Richtung linear hintereinander, wobei die dorsalen und zentralen Gruben groljer sind als die ventralen; sind es mehr als drei, so ist eine zweidimensionale Anordnung vorhanden (vgl. Fig. 7). Die kleinsten Gruben liegen nach ventral hin an den Flanken der Erhebung. Es liegt nahe, hierin eine ontogenetische Entwicklung zu sehen. Die groljen dorsalen und zentralen Gruben waren die zuerst angelegten, die kleinen an der ventralen Flanke des Buckels die jungsten. Eine Statistik, in der die Lange der Exemplare zur Anzahl der Gruben in Beziehung gebracht wurde, brachte jedoch keine klare Abhangigkeit der Grubenzahl von der Lange (vgl. Fig. 8). Es ist aber moglich, daB durch wechselnde Umweltbedingungen
172 DIETMAR ANDRES
9. 8 . 7 .
GroBe und ontogenetisches Alter nur wenig korreliert sind ; dadurch konnte eine ontogenetische Zunahme der Grubenzahl iiberpragt und vertuscht sein. Funktion und ontogenetische Entstehung der Gruben sind jedenfalls noch nicht geklart.
Eine ahnliche (Locularstruktur)) komnt in den Familien Hollinidae und Tetradcllidae vor. Hier ist jedoch die Position der Gruben weiter marginal
.
GRU BENZAH L lot
6 . 5 . 4 . 3 - 2 . 1 '
.a ... . 0 . ..*..*.. . . .. *... 0 . . . .. ........ .. m. 0
, L#NGE
. . .. .
und die Ausrichtung ist dadurch anders. Bei den Hollinidae liegen die Gru- ben zwischen Histium und freiem Rand, bei den Tetradellidae zwischen Histium und Velum. Die Funktion der Locularstruktur ist auch hier nicht geklart (vgl. Pokorn9, 1958 S. 105).
Die Ausrichtung der Schalen wurde wie bei Ulrich & Bassler (1931) vorgenommen. Vergleicht man jedoch den UmriB mit dem von Longispina oelandica (s. u.), bei der die Ausrichtung durch die Neigung des Stachels relativ gesichert ist, so spricht dies fur eine entgegengesetzte Ausrichtung. Auch die Verteilung der Breite der Iilappen spricht gegen die iibliche Orientierung der Hipponicharion-Schalen. Da diese Grunde nicht beweis- kraftig genug schienen, wurde die klassische Ausrichtung beibehalten.
An 84 annahernd vollstandigen Exemplaren wurden Lange und Hohe vermessen. In Fig. 9 wurde die Hohe in Abhangigkeit von der Lange graphisch dargestellt. Das Verhaltnis Lange zu Hohe bleibt im groBen und ganzen konstant. Ontogenetische Veranderungen, Dimorphismus, Hautungs- stadien sind nicht zu ersehen.
Es liegen funf assoziierte Schalen vor, davon vier in geschlossenem Zustand und eine vollig aufgeklappt.
MITTELKAMBRISCHE OSTRACODEN 173
1,5-
1
BEMERKUNGEN. - Der innere dem freien Rand parallele Kamm ist ventral nicht unterbrochen, was sonst nur bei Hipponicharion confruens und bei H. matthewi der Fall ist. Die Gruben auf der anteroventralen Erhebung treten nur bei der hier beschriebenen Spezies auf. Die Erhebung selbst erstreckt sich wesentlich weiter nach ventral als bei den ubrigen Arten der Gattung.
. . . . . . . . 0 .
e . 0 . . . .. . ' 0 .* ...
0 .0 . . . . .- t! t!.
0 mb . .. .
e m .
HOHE I
0
LANGE 1 1,5 2 i n m m
Fig. 9. Hipponicharion loculaturn. Darstellung der Hohe in Abhangigkeit von der Lange. Die grosseren Punkte deuten 2, 3 oder 4 iibereinstimmende Werte an.
Hipponicharion loculatum. Measurements of height and length. There is no allometric growth. Height and length increase proportionally.
Longispina oelandica n. g . n. sp. DERIVATIO NOMINIS. - Longispina : niit langem Stachel; oelandica : von Oland stammend.
TYPSPEZIES. - Longispina oelandica (monotypische Gattung).
HOLOTYP. - Stuck B 8, Fig. 11.
PARATYPEN. - 12 annahernd vollstandige Exemplare ; auBerdem ca. 30 Fragmente.
STRATUM TYPICUM UND LOCUS TYPICUS. - Paradoxissimus-Sandstein, mittleres Mittelkambrium; Kliff bei Albrunna an der Sudwestkuste der Insel Oland, Sudschweden.
GENUS-DIAGNOSE. - Dickschalige Ostracoden der Ordnung Archaeocopida, mit einem groRen Stachel auf der hinteren Schalenregion.
174 DIETMAR ANDRES
SPEZIES-DIAGNOSE. - Der UmriB zeigt am dorsalen Hinterrand einen Knick. Im anterodorsalen bis anterozentralen Schalenfeld befindet sich eine flache Delle. Der nach hinten gerichtete Stachel hat distal einen runden, nahe der Wurzel einen langlichen Querschnitt.
Fig. 10. Longispina oelandica. Ge- samtansicht einer linken Klappe, Lange 2,48 mm. Unter Beruck- sichtigung des Holotyps und aller Paratypcn.
Longispima oelandica. Reconstrzic- tion of a l e f t vahw. Length 2.18 mm.
RESCHREIBUNG. - Der Vorderrand und der Ventralrand sind gerundet, der posterodorsale Anteil des freien Randes unterhalb des Stachels zeigt einen Knick. Im anterodorsalen Feld befindet sich eine flache Delle. Der Stachel zeigt cine Neigung, die durch verschieden starke sekundare (diagenetische u.a.) Einwirkungen sehr schwankend ist. Je toniger die Matrix ist, desto starker sind die sekundaren Verformungen ; im allgemeinen liegt eine Komprimierung senkrecht zur Schichtebene und eine Plattung und Ver- groBerung der Stucke in der Schichtebene vor. Der Stachel ist wahr- scheinlich nach hinten gerichtet und erlaubt eine relativ sichere Orientierung der Spezies. In seinem proximalen Teil hat er einen langlichen Querschnitt und erstreckt sich parallel zum Hinterrand. Im posterodorsalen Feld vor dem Stachel liegt eine kurze Rinne.
Hinter und unter dem Stachel erstreckt sich parallel zum freien Rand eine schwach angedeutete kurze Senke, hinter der die Schale endgultig zum Rand abfallt (vgl. Fig. 10 und Fig. 11).
Die Lange der 13 annahernd vollstandigen Exemplare liegt zwischen 1,3 und 3,2 mm, die Hohe zwischen 0,9 und 2,2 mm. Acht der dreizehn Stiicke sind zwischen 2,l und 2,6 mm lang.
Es sind drei assoziierte vollig geschlossene Schalen und ein nur leicht klaffendes Exemplar vorhanden. Weit klaffende Schalen dieser relativ groBen Spezies wurden wahrscheinlich bei der starken Wasserbewegung bald am dorsalen Scharnier getrennt.
BEMERKVNGEN. - Stacheln kommen innerhalb der Ordnung Archaeocopida sonst nur bei den wesentlich dunnschaligeren Phosphatocopinen (Unter- ordnung Phosphatocopina, Muller 1964) vor. Da die beschriebene Spezies
Fig. 11. Longispinu oelandica. Holotyp, Stuck B8, linke Klappe, Lange 2,48 mm. Steinkern mit Schalenresten. Der Stachel ist ahgebrochen.
Longispina oelandica. Specimen R8, Holotype, length 2.38 mm, left v a l ~ e . Internal cast zcith remains of shell. T h e spine is hroken qff.
jedoch zu der Unterordnung Bradoriina gehort und die ubrigen Merk- male nicht eindeutig auf ein bekanntes Genus dieser Unterordnung hin- weisen, wurde ein neues Genus aufgestellt.
Die Familienzugehorigkeit ist unbestimmt.
Bvadovia sp. Von eincr dritten Spezies wurde nur eine einzige linke Klappe gefunden (Fig. 12). Das Stuck wurde wahrend der Bearbeitung stark beschadigt. Der UmriB ist fur die Gattung Bradoria kennzeichnend; im Gegensatz zu
Fig. 12. Bradoria sp. Gesamtansicht einer linken Klappe.Langel,28mm.
Bradoria sp., length 1.28 mm, left valt*e.
176 DIETMAR ANDRES
den beiden vorher beschriebenen Arten zeigt dieses Exemplar einen typischen ((backward swing)), eine starke Betonung der hinteren Ventralpartie. Die kleine Erhebung auf dem vorderen Grat ist durch einen hellen Fleck gekenn- zeichnet und konnte der Augenhocker sein. Die groBte Breite der Klappen liegt posterozentral.
Die Lange betragt 1,28 mm, die Hohe 1,04 mm. Die Spezies der Gattung Bradoria sind gewohnlich groBer, doch UmriB, Morphologie und der ver- mutliche Augenhocker sprechen fur eine Zugehorigkeit zu dieser Gattung.
Beziehungen zu Conchostracen und Ostracoden Altere Autoren ordneten die Archaocopiden bei den Ostracoden ein. Ulrich &; Bassler (1931) stellten sie jedoch naher zu den Conchostracen, obwohl auch zu diesen wesentliche Unterschiede bestehen. Einer Zuordnung zu den Ostracoden widersprachen nach Ulrich & Bassler vor allem
1. der Chemismus der Schale,
2. das dorsale Zusammen hangen der Klappen, (Kein Schloss)
3 . dauerndes Klaffen der Schale an bestinimten Partien des freien Randes
4. ein weit vorn ventral hinter dem Augenhocker liegender SchlieB- muskel fleck.
Punkt 3 und 4 werden von Sylvester-Bradley (1961) angezweifelt. K. J. NIuller (1 964) halt nach seinen Beobachtungen an Phosphatocopinen die weit vorne liegenden Narben (Punkt 4) nicht fur SchlieBmuskelnarben. Punkt 3 trifft fur das hier beschriebene Material und fur viele andere Arten nicht zu. Zu Punkt 2 bemerkt Sylvester-Bradley, daB es dorsal zusammenhangende schlonlose Formen auch innerhalb der Ostracoden gibt.
Als wesentliche Unterschiede zu Ostracodenschalen bleiben also nur die andere Schalensubstanz (Punkt 1) und - mit Vorbehalt (s.o.) - die dorsale Verbindung der Schalen (Punkt 2). Diese Unterschiede zu den Ostracoden lassen sich aber durch die - noch hypothetische - folgende phylogenetische Entwicklung einleuchtend erklaren. Eine stammesgeschichtliche Verbindung der ordovizischen Ostracoden mit kambrischen Archaeocopiden erscheint folgerichtig (vgl. nachstes Kapitel).
Die hier beschriebene relative Dicke der drei Schalenschichten und die Porenkanale sind ebenfalls typische Ostracodenmerkmale. Derartiges ist meines Wissens bei Conchostracen nicht bekannt.
Aus diesen Grunden halte ich die Einstufung der Archaocopiden als primitive Ostracoden fur richtig, wie sie von Ivanova (1960) und Sylvester- Bradley (1961) vorgenommen wurde. Auch Hartmann (1963) verneint eine enge Verwandtschaft der Archaocopiden mit den Conchostracen und halt sie fur mogliche Vorlaufer der Ostracoden.
MITTELKAMBRISCHE OSTRACODEN 177
Ph ylogenie Die beschriebenen mittelkambrischen Formen zeigen gegenuber den modernen Ostracoden mehrere unterscheidende Merkmale. Zu den primi- tivsten ordovizischen Faunen sind die Unterschiede jedoch wesentlich geringer. Es spricht alles dafiir, daB es sich um Formen handelt, die den Vorlaufern der Ostracoden recht nahe stehen.
Das Fehlen eines bezahnten Schlosses und einer erhaltungsfahigen Innen- lamelle wurde schon von friiheren Autoren fur die Vorlaufer der Ostracoden vorausgesagt (vgl. Pokorny, 1958, S. 119). Die Entwicklung von den schloB- losen kambrischen Formen mit langem geraden Dorsalrand uber Typen mit primitivem SchloB und ebenfalls noch langem Dorsalrand zu den modernen Ostracoden mit hochentwickeltem SchloB und kurzem gebogenem Dorsal- rand erscheint logisch. Erst das leistungsfahigere SchloB ermoglichte eine Verkurzung des Dorsalrandes und Abrundung der Gesamtform.
Es ist wahrscheinlich, daB das Ligament der modernen Ostracoden sich aus denjenigen Partien der Schale bei den Archaocopiden entwickelt hat, die dort den Zusammenhalt zwischen beiden Schalenhalften bewirken (s. S. 168 und Fig. 4). Dies entspricht der Aussage von Hartmann (1966, S. 87), daB die Chitinlagen des Carapax zum Ligament wurden. Ein Vergleich der Substanz des Ligamentes der rezenten Ostracoden mit der auneren (und inneren ?) Schalenschicht der Archaocopiden ware in diesem Zusammen- hang interessant.
Eine erhaltungsfahige Innenlamelle fehlt den hier beschriebenen Formen ebenso wie den primitiveren altpalaozoischen Ostracoden.
In der Schalensubstanz liegt der groBte Unterschied zwischen den Archaocopiden und den ersten ccechtenn Ostracoden. Dies macht jedoch eine phylogenetische Verbindung zwischen beiden nicht unwahrscheinlich. Die Haufigkeit von phosphatischem Baumaterial im Tierreich nimmt vom Unterkambrium an generell ab, wahrend Calziumkarbonat immer haufiger bcnutzt wird. Weil es sich hier ziemlich sicher um einen von AuRenbeding- ungen abhangigen allgemeingiiltigen Trend handelt, erhebt sich die Frage, ob diese Entwicklung nicht auch mehrfach innerhalb der Archaocopiden vor sich gegangen ist, ob die ordovizischen kalkschaligen Ostracodengruppen nicht das Ergebnis einer langeren polyphyletischen Evolution sind. Es wurde die Erklarung der bemerkenswerten Verschiedenheit der GroBgruppen der Ostracoden im Ordoviz erleichtern, wenn man eine langere, voneinander unabhangige Entwicklung dieser Gruppen bereits wahrend des mittleren oder sogar unteren Kambriums annimmt. Es konnten sich z.B. aus den Hipponicharioniden die Beyrichiiden (die zwei randparallelen Rippen waren in beiden Gruppen homolog) und aus groBen Formen mit weniger starker Morphologie wie Bradoria die Leperditiiden entwickelt haben. Die GroBen- verhaltnisse und Umvisse der erwahnten Gruppen unterstutzen eine solche Annahme. Ahnliches nimmt Ivanova (1960) an.
Andererseits ist eine monophyletische Entwicklung aus den Archaocopiden
178 DIETMAR ANDRES
heraus durchaus denkbar. Eine wesentliche neue Errungenschaft - hier der M‘echsel des Schalenmaterials - kann andere Veranderungen nach sich ziehen und damit zu besonders schneller Evolution fuhren. Unter solchen Umstan- den erscheint der Zeitraum des oberen Kambriums durchaus lang genug fur die Entwicklung der verschiedenartigen ordovizischen Ostracodengruppen aus ejner einzigen Grnppe der Archaocopiden.
Eine dritte Moglichkcit ist, daB wir die bereits kalkschaligen mittel- oder sogar unterkambrischen Ostracoden-Vorlaufer noch nicht kennen.
Die heutigen Kenntnisse reichen nicht aus, diese Fragen zu entscheiden. Besonders im oberen Kambrium fehlen Funde, an die man die ordovi- zischen Faunen anschlienen konnte. Vielleicht liegt der Grund hierfur in der Seltenheit von gunstig exponierten oberkambrischen Flachwasser- sed imenten.
Vergleicht man die unterkambrischen mit den mittelkambrischen Archaocopiden, so lassen sich einige Entwicklungstendenzen ablesen : Augenhocker sind im unteren Kambrium relativ haufiger als im hoheren Kambrium. Der SchalenumriR wird allgemein symmetrischer und langlicher, der ((backward swing)), die starke Betonung der hinteren Ventralpartie, ist statistisch gesehen im unteren Kambrium starker ausgebildet als im hoheren Kambrium. DaB die Leperditiiden zum groBen Teil ebenfalls ((backward swing)) und Augenhocker (plesiomorphe Merkmale nach Hennig, 1966) recht typisch zeigen, spricht fur ihre Abstammung von relativ altertumlichen Archaocopiden etwa vom Typus der Gattung Bradoria. Die Leperditiiden haben anscheinend die Entwicklung zu den modernen Ostracoden nicht mitgemacht. Schalenverkalkung und SchloB hatten sie demnach unabhangig von und parallel zu den ubrigen Ostracoden entwickeln mussen. DaR vom Kambrium aufwarts Phosphat in AuBenschalen allgemein seltener und Kalk relativ haufiger wird, ist schon oben erwahnt. Daruber hinaus konnte zwi- schen dem Materialwechsel von Phosphat nach Karbonat und der Ent- wicklung von Schalenschlossern ejn ursachlicher Zusammenhang bestehen. Auch bei den Brachiopoden sind die hornschaligen Vertreter schloBlos und schon die ersten bekannten kalkschaligen Typen besitzen Schlosser. Der- artige uberlegungen machen die Parallel-Entwicklung von zwei wichtigen modernen Merkmalen in unabhangigen Archaocopiden-Gruppen wahrend des Kanibriums weniger unwahrscheinlich.
Ein anderer Entwicklungstrend zeigt sich bei den Formen, die Rippen langs des freien Randes ausbilden. Es 1aBt sich eine morphologische Reihe von Beyrirhona und Cambria uber unterkambrische Hipponicharioniden zu mittelkambrischen Hipponicharioniden konstruieren, die vermutlich dem I’erlauf der Evolution entspricht. Im Laufe dieser Reihe verlangern sich die beiden seitlichen inneren dem freien Rande parallelen Kamme, bis sie sich schlieBlich ventral vereinigen ( H . corijluens, H. matthewi, H. lorulatzim). Alle randparallelen Kamme werden steiler und die Erhebung in der vorderen Schaltnhalfte wird langer und markanter. Unter Umstanden sind die beiden randparallelen Kamme dentn der Beyrichien homolog.
MITTELKAMBRISCHE OSTRACODEN 179
S y stematik Bei den geringen Kenntnissen ist eine systematische Untcrgliederung der Ordnung Archaevcopida nach phylogenetischen Gesichtspunkten noch nicht moglich. Die Unterteilung wurde bisher hauptsachlich nach der Morphologie durchgefuhrt. Als weiteres Merkmal bieten sich Struktur und Chemismus der Schalen an. Sekundare Losungserscheinungen und Ablagerungen werden hier jedoch bei dem hohen Alter der Formen stets ein Unsicherheitsfaktor sein und miissen sorgfaltig ausgeschlossen werden. Auch die Verwitterung kann storend und tauschend wirken.
Es fragt sich, ob die hier beschriebene Schalenstruktur und Schalen- chemie die Norm bei der Ordnung Archaocopida darstellt oder ob sich auf Grund dieser Merkmale groBere Gruppen trennen lassen. Die Phosphato- copinen, die Gattung Polyph-vma und Aluta primordidis sind z.B. wegen ihrer dunneren Schale leicht gegen die diclrschaligeren Formen abzu- grenzen, untereinander jedoch morphologisch und in der GroRe stark verschieden. Bisher sind jedoch nur die Phosphatocopina in der Systematik deutlich gegen die ubrigen Archaocopiden abgesetzt worden (Muller 1964). Bei vermehrten Kenntnissen werden sich vermutlich neben den Unter- ordnungen Bradoriina und Phosphatocopina (Muller 1964) weitere ergeben. Die hier beschriebenen Formen sind bei den Bradoriina einzuordnen.
Die Arbeit wurde am Lehrstuhl fur Palaontologie der Freien Univrrsitat Berlin durch- gefuhrt. An erster StelIe danke ich meinem 1,ehrer Prof. W. G. Iiuhne fur seine Hilfe. Besonderen Dank schulde ich auch Fraulein Birgid Duilger und Prof. W. Schwarz von der Bundesanstalt fur Materialprufung fur die rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen.
Die Untersuchungen der Schalensubstanz mit Hilfe der Mikrosonde wurden von Frau Gisela Gunther und Dr. A. Willgallis vom Mineralogischen Institut der Freien Universi- tat durchgefuhrt. Fur fototechnische Arbeiten habe ich Frau Gesa Rilat, fur wichtige Hinweise Herrn Dr. G. Hartmann vom Zoologischen Staatsinstitut Hamburg zu danken.
Das Material wird im Lehrstuhl fur Palaontologie der Freien Universitat Berlin auf- bewahrt.
Lehrstiihl .fur Palaontologie der Freien Uniuersitiit Berlin Schwendener StraJ3e 8, 1 Berlin 33,
den 25. 2. 1969.
L I T E R A T U R V E R Z E I C H N I S BOLTON, T. E., Q COPELAND, M. J. 1963: Cambrotrypa and Rradoria from the middle
HARTMANN, G. 1963 : Zur Phylogenie und Systematik der Ostracoden. Zeitschrift fur
HARTMANN, G. 1966 [IN BRONN]: Klassen zind Ordnungen des Tierreiches ; funfter Band:
HENNING, W. 1966 : Phylogenetic systematics. 263 S. University of Illinois Press. Urbana,
Cambrian of western Canada. Journal of Paleontology 37, 1069-1 070.
zoologische Systernatik find Evolutionsforschung 1 , 1-201. Frankfurt am Main.
Arthropoda; I. Abt.: Crustacea; 2. Buch, IV. Tell; 1. Lieferung, 1-216. L,eipzig.
Chicago, London.
noxneki. naneoHTonorPisecKxii mypaan 1960, 21-27. MocKBa.
jroin the Palaeontological Institute of the Uni tws i t y of tlppsnla No. 62, Stockholm.
IVANOVA, VALENTINA (LlBaHOBa, B. .4.) 1960 : 0 IIpOkiCXoXneHkiM II 4MJIOTeHI111 OCTpaKO-
MARTINSSON, A. 1965: Aspects of a Middle Cambrian Thanatotope on Oland. Publications
180 DIETMAR ANDRES
MtiLLER, I(. F. 1964: Ostracoda (Bradorina) mit phosphatischen Gehiiusen aus dem Ober- kambrium von Schweden. N. Jh. Geol. Palaontolog. Abh. 121 ; 1 , 1-46. Stuttgart.
PALMER, A. R. 1954: The faunas of the Riley Formation in Central Texas. Jozrrnal of Palae- ontology 28, 709-787.
POKORN'~, V. 1958: Grundziige der zoologischen Mikropalaontologie II . 453 S. VEB Deut- scher Verlag der Wissenschaften, Berlin.
SYLVESTER-BRADLEY, P. C. 1961 : Archaeocopida. In MOORE, R. C . [editor] : Treatise on invertebrate paleonzolog-y Q, Arthropoda 3 , Crustacea, Ostracoda, 100-105. Geological Society of America and University of Kansas Press.
ULRICH, E. O., 8r BASSLER, R. S. 1931 : Cambrian bivalved Crustacea of the order Concho- straca. Proceedings U.S. National Museum 78 : 4 , 1-130.
\TILLGALLIS, A. 1969: Untersuchung des chemischen Aufbaus von Ostracodenschalen mit Hilfe der Mikrosonde. Lethaia 2, 181-183. Oslo.