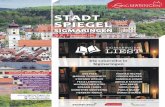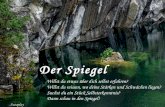Ovids verkehrte Exilwelt (Spiegel des Erzählers - Spiegel des Mythos - Spiegel Roms) || 1....
Transcript of Ovids verkehrte Exilwelt (Spiegel des Erzählers - Spiegel des Mythos - Spiegel Roms) || 1....

1 Einleitung
Dass der Protagonist einer Geschichte in Ich-Form spricht, bedeutet nicht, dass er auch mit dem Autor gleichzusetzen ist. Für die römische Lyrik des ausgehen-den 1. Jahrhunderts v. Chr. hat der Begriff der persona in der Forschung ver-schiedentlich Verwendung gefunden, auch wenn eine allgemein anerkannte Definition nicht vorliegt und noch kein Konsens hinsichtlich seiner Angemes-senheit besteht.1 Eine endgültige Antwort darauf wird auch in der vorliegenden Arbeit nicht gegeben werden können. Doch es ist ihr Ziel, den in Ovids Exillite-ratur sich präsentierenden Ich-Sprecher mit den Methoden der modernen Lite-raturwissenschaft zu untersuchen, insbesondere mit den bereits erfolgreich auf die antike Literatur angewandten narratologischen Techniken,2 und die sich daraus ergebenden Grundzüge der persona darzustellen.
Zwei Schwerpunkte sollen innerhalb der Untersuchung Berücksichtigung finden: Zuerst soll sich die Arbeit der Frage widmen, wie in der Exilliteratur Ovids der Ich-Sprecher (oder die persona) konstruiert, literarisch ausgestaltet und dargestellt wird.3 Hierfür sollen ausgewählte Passagen Beachtung finden, anhand derer sich die Stellung des Ich-Sprechers innerhalb von Erzähl-haltungen, -perspektiven und -funktionen studieren lässt. Als zweiter Schwer-punkt soll ein besonderes Augenmerk auf die mythologischen Vergleiche gelegt werden, die mehr sind als lediglich gelehrte Illustrationen, da durch die Art, wie sich das Ich zu den typologisch vorgeprägten Charakteren des Mythos in Bezie-hung setzt, Rückschlüsse auf das Selbstverständnis des Erzählers gezogen wer-den können. Die Einbettung der persönlichen Exilgeschichte des Ich-Sprechers in bestehende Erzähl- und Vergleichsschemata des Mythos dient der Standort-
|| 1 Drei Arbeiten seien in diesem Zusammenhang erwähnt: Clay (1998), Mayer (2003), Hose (2003). Alle kommen zu dem Ergebnis, dass der Begriff der persona bzw. des lyrischen Ich für die Interpretation antiker Texte erhebliche Probleme aufwirft. 2 Vgl. de Jong (1987) und de Jong / Nünlist / Bowie (2004). Eine Notwendigkeit, literaturwis-senschaftliche Methoden zu reflektieren, ergibt sich schon allein aus der Tatsache, dass es keinen methodenfreien Zugang zur Literatur gibt; gewisse Vorannahmen bestehen immer, auch wenn diese nicht immer bewusst sind (vgl. Nünning / Nünning [2010] 2). 3 Entstanden ist die Frage in einem Seminar, das die antike Biographie und Autobiographie in den Mittelpunkt gestellt hat. Von den ersten Zeugnissen einer Selbstdarstellung des Autors in der Sphragis eines Werks zeichnet sich eine Linie ab, die sich dann über die Selbstzeugnisse in den Briefen von Verbannten wie Cicero und Ovid verstärkt, bis hin zu den ausgeformten Auto-biographien wie Augustinus’ Confessiones. Ovid ist ein wichtiger Zeuge innerhalb dieses Pro-zesses und gerade deshalb soll hier seine Gestaltungsweise selbstdarstellender Literatur unter-sucht werden.
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 3:39 PM

2 | Einleitung
bestimmung des eigenen Selbst;4 schließlich bietet der Mythos archetypische Charaktere und Situationen, die seit alter Zeit als Spiegelbild typischer mensch-licher Erfahrungen dienen.5 Daher soll in dieser Arbeit untersucht werden, wie die mythologischen Anspielungen und Exempla von Ovid genutzt werden, um die Koordinaten der persona abzustecken, und welche Vergleichsmuster sich erkennen lassen, mit denen ihr Charakterbild verdeutlicht wird.6 Die Fragestel-lung lautet daher kurz gefasst: Wie ist die persona in Ovids Exilliteratur gestal-tet und wie wird sie anhand von mythologischen Vergleichen dargestellt?
Probleme für die Untersuchung ergeben sich in vielfältiger Weise. Die Prä-sentation der persona in den Exilbriefen ist äußerst vielfältig. Werden die Texte als Verteidigungsschriften gelesen, dann ist der Ich-Sprecher ein Dichter, der, vom Kaiser ans Schwarze Meer verbannt, die Geringfügigkeit seiner Schuld beteuert und sich für seine Rückkehr nach Rom einsetzt. Er schreibt an seine Freunde, versucht alte Beziehungen aufrecht zu erhalten und sich die Gunst und den Einsatz seiner Bekannten und seiner Frau zu sichern. Werden die Texte als sentimentale Gedichte betrachtet, dann erscheint der Ich-Sprecher als ge-quälter Geist unter widrigen Bedingungen und als Träger von Emotionen, durch die er den Lesern die Leiden am Exil drastisch vor Augen stellt. Werden die Briefe als autobiographische Texte interpretiert, wird der Leser Zeuge einer Aufarbeitung und Neubewertung des bisherigen Lebens und der Neukonstruk-
|| 4 In der augusteischen Literatur, und auch in der subjektiven Liebeselegie sind die mythologi-schen Vergleiche und Exempla ein beliebter Topos. Die Autoren waren sich bewusst, dass die Geschichten zumindest beim gebildeten Publikum der augusteischen Zeit wohlbekannt waren und auch intertextuell gedeutet und entschlüsselt werden konnten (siehe Kapitel 2.2 mit An-merkungen.). Der Zug der Selbstdarstellung, ja sogar der Selbstmythisierung, ist in Ovids Exilliteratur besonders deutlich ausgeprägt. 5 Mythen binden abstrakte Vorgänge in einprägsame und anschauliche Geschichten ein, wodurch die beteiligten Charaktere in ihrer Identität darstellbar werden (vgl. Lübbe [1979] 655: „Erst über ihre Geschichte gewinnen Individuen identifizierbare Identität.“). Über die narrative Bewusstmachung und Neubewertung vergangener Ereignisse aus seiner jetzigen Situation heraus geschieht bei der persona im Exil die Herausbildung einer neuen Identität. Vgl. auch Feichtinger (2010) 44f. 6 Es soll kein Gegenstand der Untersuchung sein, ob Ovid selbst, im religiösen Sinne, an Mythen und Götter geglaubt hat. Peter Kuhlmann (2007) 317f. geht davon aus, dass Ovid die Göttergeschichten durchaus ernst nimmt, allerdings indem er sich kritisch mit ihnen ausei-nandersetzt, im Sinne der philosophischen Tradition der Götterkritik. Ovid sei zwar kein Athe-ist, legt aber die Betonung auf die Würde des Menschen und gegen die Götterwillkür. Damit bilde er einen Gegensatz zu Pindar, der eine affirmative und menschenfreundliche Darstellung der Götter propagierte, und folge eher Euripides, der Götter häufig als destruktive Mächte darstellte (321). Vgl. auch Fondermann (2008): Der Blickkontakt, das Sehen und Gesehenwer-den durch die Götter, ist für den Menschen oft mit unheilvollen Konsequenzen dargestellt.
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 3:39 PM

Einleitung | 3
tion der eigenen Identität unter veränderten Lebensbedingungen. Werden ver-steckte politische Botschaften in den Briefen erwartet, dann erscheint der Ich-Sprecher als revolutionärer Agitator, der das Regime von Augustus aufs Schärfs-te angreift. Es sind gerade die Aspektvielfalt und Multivalenz der Texte, die die Interpretation schwierig machen und das „Ich“ nicht einheitlich fassbar er-scheinen lassen, aber auch den charakteristischen Reiz der Texte ausmachen. Die Untersuchung soll sich daher ferner der Frage widmen, inwiefern der Ich-Sprecher changiert und sich in ein breites Spektrum divergenter personae auf-fächert.7 Insofern streift die Fragestellung auch grundsätzlichere Vorstellungen von Persönlichkeit, Individualität und die Bildung von Identität in der antiken Gesellschaft.
Daraus ergeben sich weitere Fragen. Die Begriffe des Selbst, der Person, des Individuums, der Identität oder der gesellschaftlichen Rolle und die damit zu-sammenhängenden individuellen und gesellschaftlichen Aspekte sind für die Antike anders zu bestimmen, als es für eine heutige Gesellschaft der Fall wäre. Von welcher Gesellschaft müssen wir überhaupt in der Zeit Ovids ausgehen? Eine bereits weitgehend individualisierte, die – zumindest den Freien – einen hohen Gestaltungsspielraum in ihrem Leben einräumte, oder eine eher restrik-tive, die das Individuum immer noch stark an seine gesellschaftliche Rolle band, die vom alten römischen Pflichtbewusstsein geprägt war, oder diffundier-ten die Grenzen vielmehr in einer Zeit, in der Augustus versuchte, die alte Moral und die Bindung des Einzelnen an den Staat per Gesetz wiederherzustellen, dabei aber weitgehend auf Ablehnung stieß?
Zu diesen Fragen wird sich die Arbeit darauf beschränken müssen, auf eini-ge wichtige bereits bekannte Eckpunkte zurückzugreifen, wie der Tatsache, dass wir in der Antike nicht von einer modernen Vorstellung von Privatheit und Individualität ausgehen dürfen. Da der Ich-Sprecher ein Dichter ist, ist für seine persona auch die dem damaligen Dichtungsdiskurs zugrunde liegende Dicho-tomie zwischen homerischer und kallimacheischer Dichtkunst prägend. Da-rüber hinaus sind auch ideologische Vorstellungen, wie die der in der Antike vorausgesetzte Ungleichheit zwischen Barbaren und Zivilisierten, mit einzube-ziehen.8
Im Zusammenhang mit dem Mythos stellt sich die Frage, welchen Stellen-wert er für den Dichter als den für ein gebildetes Publikum arbeitenden Künstler sowie innerhalb des allgemeinen gesellschaftlichen und historischen Kontexts
|| 7 Zur Forschungsdiskussion, insbesondere der Konzepte von Claassen und Weinlich, siehe Seite 43f. 8 Siehe die Darstellung zu antiken Rollenbildern in Kapitel 3.2.2.
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 3:39 PM

4 | Einleitung
hatte.9 Offiziell war der Mythos in Rom als traditionelle Grundlage der staatlich anerkannten Religion wie in seiner neuen Funktion als Trägermedium der Herr-schaftsideologie des julischen Geschlechts bedeutsam. Gleichwohl wurde er von den Dichtern als ästhetisches Material voller Polyvalenzen verstanden, mit dem nach dem Prinzip der künstlerischen Freiheit verfahren werden konnte, auch wenn dies mit der offiziellen staatlichen Auslegung kollidierte. Im Fall von Ovid führt die Untersuchung des Mythenverständnisses daher sehr rasch zu der in der Forschung kontrovers diskutierten Frage nach dem Verhältnis zwischen Augustus und Ovid und danach, in welchem Maße sich die Schriften Ovids als augustuskritisch interpretieren lassen.10
Methodisch ist die Arbeit von einem anwendungsorientierten Eklektizismus getragen.11 Für die Untersuchung der persona in der vorliegenden Arbeit soll die zwar schon etwas ältere,12 aber immer noch grundlegende Erzähltheorie Stan-
|| 9 Zu diesem Kontext siehe Kapitel 3.3.4. 10 Siehe den Forschungsüberblick in Kapitel 2.4. 11 Die neueren literaturwissenschaftlichen Methoden, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-hunderts die Diskussion bereicherten, haben, wenn auch etwas verspätet, in der klassischen Philologie Eingang gefunden (vgl. Schmitz [2002] 14‒16). Um einige dieser Methoden ist es in den vergangenen Jahren wieder ruhiger geworden, andere haben sich im Repertoire der Inter-pretation etabliert, z.B. die Narratologie, die Intertextualität, Gender Studies etc. Die Übernah-me von Deutungsverfahren aus der Psychologie ist nicht unproblematisch, da allzu leicht der Fehler begangen wird, unhinterfragt von Merkmalen des (fiktionalen) Texts auf den (realen) Autor zu schließen. Wissenschaftlich korrekt angewandt lassen sich aber durchaus einige Ergebnisse der Psychologie in der Literaturwissenschaft verwenden, z.B. bei der Untersuchung von Erinnerungsschichten und Selbstwahrnehmungsmustern in der Autobiographie. – Ferner sollte auch deshalb der Gebrauch literaturwissenschaftlicher Methoden reflektiert werden, um nicht den Fehler zu begehen, eine Methode als Selbstzweck zu betrachten. Wichtig ist, dass der Einsatz einer Methode einen adäquaten Nutzen für die Interpretation mit sich bringt. So disku-tiert auch Mieke Bal, wie die Narratologie in der Literaturwissenschaft angewandt werden kann: „Readers are offered an instrument with which they can describe, hence interpret, narra-tive texts. This does not imply that the theory is some kind of machine into which one inserts a text at one end and expects an adequate description to roll out at the other. The concepts that are presented here must be regarded as intellectual tools for interpretation. These tools are useful in that they enable their users to formulate an interpretative description in such a way that it is accessable to others. Furthermore, discovering the characteristics of a text can also be facilitated by insight into the abstract narrative system. But above all, the concepts help to increase understanding through encouraging readers to articulate what they understand, or think they understand, when reading or otherwise processing a narrative artifact.“ (Bal [2009] 3f.; weitere Argumente zur Begründung, warum auch nicht-epische Texte narratologisch un-tersucht werden können, finden sich bei Liveley / Salzman-Mitchell [2008] 2‒6). 12 Die Erstausgabe erschien 1964. Eigentlich hatte Stanzel seine Theorie für die Untersuchung des Romans entwickelt, doch lässt sie sich auch auf andere Gattungen anwenden.
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 3:39 PM

Einleitung | 5
zels eingesetzt werden. Dabei werden die in der Exilliteratur vorliegende Erzähl-situation sowie die Erzählhaltung des Ich-Erzählers analysiert, wobei einige grundlegende Aspekte aufgedeckt werden, die für die Charakterisierung der persona wichtig sind. Ergänzt wird die Untersuchung durch die Anwendung einiger der Erzählkategorien Genettes (Diegesen / Fokalisierungen)13 und schließlich narratologischer und kognitionswissenschaftlicher Ansätze aus der Autobiographieforschung. Durch die Kombination dieser verschiedenen theore-tischen Ansätze kann ein vielschichtiges und erhellendes Bild der persona in Ovids Exilliteratur gezeichnet werden.
Die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Forschungsstand (Kapitel 2), die die Studie eröffnet, umfasst nicht nur die Kernthemen der Dissertation (die persona und die Verwendung mythologischer Exempla), sondern auch angren-zende, für die erweiterte Fragestellung der Arbeit relevante Themenkomplexe wie Literatur und Publikum in der frühen Kaiserzeit, Gattungstheorie und Inter-textualität, das Verhältnis von Ovid zu Augustus, die Gründe des Exils, der Aufbau der Exilwerke und auch die Fiktionsthese, die zu beweisen versuchte, es handele sich bei der Exilliteratur lediglich um ein gelehrtes Spiel, während Ovid selbst gar nicht in Tomis gewesen sei.
Zu Beginn des theoretischen Teils (Kapitel 3) soll, nach Darlegung der Grundlagen und der Begriffsdifferenzierung, untersucht werden, ob der Begriff der persona für antike Texte angemessen ist oder ob damit nicht ein Individuali-tätsverständnis unterstellt wird, das in der Antike gar nicht existierte. Schließ-lich werden einige der modernen Literaturtheorien, die sich mit dem lyrischen Ich oder dem Aufbau einer literarischen Identität beschäftigen, dargestellt und ausgeführt, wie sie für eine Untersuchung der Exilliteratur Ovids genutzt wer-den können. Selbstverständlich kann in diesem Rahmen nur eine kleine Aus-wahl Berücksichtigung finden.
Anhand der erarbeiteten Grundlagen erfolgt die theoretische Untersuchung der persona in Ovids Exilliteratur (Kapitel 4), wobei sie mithilfe von narrativen Aspekten (Erzählsituationen bzw. -haltungen, Fokalisierungen, Diegesen, Er-zählerfunktionen) analysiert werden soll. Außerdem werden Elemente der neu-eren Autobiographieforschung in die Analyse mit einbezogen, der Begriff der „wavering identity“ diskutiert sowie Aspekte der Fiktionalität der persona. Dann wird die Fragestellung erweitert und untersucht, wie sich die persona in ihren Vergleichen mit mythologischen Figuren präsentiert und welche Rück-schlüsse sich für die Selbstdarstellung der persona daraus ziehen lassen (Kapi-tel 5).
|| 13 Referiert werden die Begriffe in der theoretischen Darstellung in Kapitel 4.1.
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 3:39 PM

6 | Einleitung
Im abschließenden interpretatorischen Teil (Kapitel 6) soll speziell der My-thos von Odysseus als einer der zentralen Vergleichsmythen gesondert heraus-gegriffen und unter verschiedenen Gesichtspunkten dargestellt werden.14 Ab-schließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und in größere Zusammen-hänge eingebettet (Kapitel 7). Dabei werden die in der Arbeit immer wieder auf-getretenen Problemkreise des künstlerischen Diskurses, in den sich die persona ausdrücklich stellt, des Umgangs mit typisch römischen Ideologievorstel-lungen, der Fiktionalität der Exilgedichte und der persona sowie die Frage nach der Subjektivität und Individualität der persona im Vergleich mit Vorstellungen der modernen Zeit etwas ausführlicher diskutiert, auch wenn in dieser Kürze auf so weitreichende Fragenkomplexe nur Anworten gegeben werden können, die ihrerseits weitere Fragestellungen anstoßen.
|| 14 Der Ovid-Text wird nach der Ausgabe von Owen zitiert. Eventuell auftretende textkritische Probleme werden an gegebener Stelle in den Fußnoten diskutiert. – In das Verzeichnis der Sekundärliteratur wurde nur die zitierte Literatur aufgenommen. Da die Sekundärliteratur zu Ovid mittlerweile überbordend ist, soll auf die Datenbank der HU-Berlin verwiesen werden, die eine sehr gute Orientierungshilfe bietet (http://www.kirke.hu-berlin.de/ovid/); ausführlichere Diskussionen finden sich in den Forschungsreporten von Ulrich Schmitzer (2002, 2003 und 2007).
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 3:39 PM