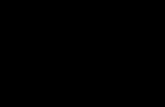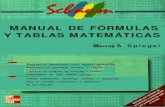Ovids verkehrte Exilwelt (Spiegel des Erzählers - Spiegel des Mythos - Spiegel Roms) || Vorrede
Transcript of Ovids verkehrte Exilwelt (Spiegel des Erzählers - Spiegel des Mythos - Spiegel Roms) || Vorrede

Vorrede
Eine verkehrte Welt ist es, in die uns Ovid mit seiner Exilliteratur entführt. Eine Welt voll eisiger Kälte, grimmiger Barbaren, ständiger Angst vor Überfällen von außen und der Angst vor dem eigenen inneren Verfall. Literatur erschafft Wel-ten – fiktive Welten, die der Leser zu betreten eingeladen wird. Das gilt univer-sell für alle Zeiten und für alle Nationen. Aber in Ovids Fall ist es eine Welt, die ganz bewusst als Gegenwelt zu dem geschaffen ist, was seine Leser gewohnt waren. Ein Leben fern der Zivilisation, auf die die Römer so stolz waren, fern der Annehmlichkeiten, die Ovid in der Ars amatoria gerühmt hatte.1 Dort freute er sich noch, in einer Zeit zu leben, die die Segnungen auskosten konnte, welche die augusteische Friedenszeit den Römern beschert hatte. Nun war er zurück-geworfen in eine Zeit des Mangels, des Kriegs, der Unsicherheit, die jedem, der den Luxus des stadtrömischen Lebens erlebt hat, wie eine „Steinzeit“ vorkom-men musste. Und diese Welt führt er nun vor und gestaltet sie in seinen Exilbriefen, nicht nur nach seinen realen Erlebnissen,2 sondern er inszeniert eine andere Welt, indem er den Kontrapunkt zum allseits bekannten Rom bil-det: Er, der bisher gefeierte Dichterfürst, wird zum Sklaven seiner schwinden-den Kräfte, aus üppigem Luxus wird elende Not, aus dem lauen italischen Früh-ling wird eisige Kälte, die selbst Wein in den Krügen gefrieren lässt, die viel gelobte Pax Augusta wird zum zermürbenden Dauerkrieg gegen Barbareneinfäl-le, der gnädige Herrscher wird zum unerbittlichen puer durus.3 Außer Kraft ge-setzt sind die Normen und Werte der römischen Gesellschaft nicht, sie sind als Referenzmodell ständig präsent in den Exilgedichten, nur werden sie bewusst in ihr Gegenteil verkehrt, ein düsteres Spiegelbild wird den Menschen in Rom vorgehalten. Ovid ist keinesfalls ein Revolutionär, der sich, nachdem er vom Kaiser verbannt wurde, als „Outlaw“ fühlt, der nun vogelfrei ist und die be-kannten Gesetze nicht mehr zu respektieren braucht. Er respektiert und schätzt sie mehr denn je und sehnt sich zurück nach einem Leben, in dem diese Gesetze ihre Gültigkeit hatten. Er beteuert standhaft seine Sittsamkeit, lediglich seine Schriften seien etwas liederlich geraten. Treu hält er zu seinem Kaiser, von dem er sich die Rettung erhofft, und bekräftigt seine Reue. Ob diese vorgetragene Reue als Inszenierung an der Oberfläche angesehen und in tieferen Schichten
|| 1 Ars 3,121f. 2 Es ist sicher nicht angebracht, die Exilliteratur Ovids gänzlich als Fiktion zu betrachten, wie in der Forschung bereits diskutiert wurde. Näheres dazu siehe Kapitel 2.9. 3 Zur Umkehrung der Motivik der Liebeselegie siehe Kapitel 2.3.
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 3:38 PM

Vorrede | VII
eine versteckte Anklage herausgelesen werden kann, darüber ist sich die For-schung nach wie vor uneins.4
Die Liebeselegien der augusteischen Dichter sind in der Ich-Form geschrie-ben, und der Liebhaber, der von seinen Abenteuern erzählt und seine Gefühls-welt vor dem Publikum ausbreitet, ist gleichzeitig ein Dichter. Dennoch bleiben sie fiktiv, wie anhand vieler fantastischer und irrealer Einlagen bewusst ge-macht wird, und der Ich-Sprecher eine Rolle5 in diesem fiktionalen Spiel. Diese Haltung behält Ovid in den Exilgedichten bei. Der Ich-Erzähler bleibt ein Dich-ter, auch wenn seine Kräfte angesichts der Umgebung erlahmen, und er bleibt ein Liebender, der sich nach seiner Gattin zurücksehnt und vor dem harten Herrscher um Einlass bittet. Die Landschaft ist ein dichterisches Gemälde, das mehr nach literarischen Vorbildern gestaltet ist als nach dem realen Tomis.6 Der Autor ist noch deutlicher der eigenen Sache verpflichtet, als es in der bisherigen Literatur der Fall war, die oft nur die Sphragis als Selbstdarstellung des Autors kannte. Er erzählt mehr über sich selbst als je zuvor und führt in einem langen Gedicht dem Leser seine Lebensgeschichte vor Augen.7 Er tritt uns deutlich als Individuum gegenüber in einer Zeit, in der noch immer die Gesellschaft mit fest verankerten Rollen- und Statusschemata vorgab, wer man zu sein hatte. Aber gerade mit der Annahme einer gesellschaftlich nicht akzeptierten Rolle, näm-lich der des Verbannten, zeigt sich immer mehr das Individuum.
Ovids Darstellung einer verkehrten Welt zeigt unentwegt, dass es für das Individuum unmöglich ist, in dieser verkehrten Welt zu existieren, ohne sich den verkehrten Sitten anzupassen und selbst ein Barbar zu werden. Und doch kämpft er um seine Existenz. Er dichtet gerade in einer Umgebung, in der dies unmöglich erscheint und allem widerspricht, das von den Lesern in Rom als normal angesehen wurde. Ein Dichter braucht Muße, ein Dichter braucht den Kontakt zum Publikum und ein zivilisiertes, wohlwollendes Umfeld, mit dem er sich austauschen kann. Ovid wusste darum, dass er als Dichter in dieser Umge-bung sein Talent, auch wenn er es vordergründig erniedrigt, umso mehr er-strahlen lassen würde, wenn er zeigen konnte, dass er selbst in dieser Umge-bung zu dichten fähig war. Vielleicht hat er auch deshalb die Umgebung ein wenig grausamer beschrieben, als sie in Wirklichkeit war, aber das verzeihen wir ihm gern.
|| 4 Siehe Kapitel 2.4. 5 Daher auch die Bezeichnung persona für den Ich-Sprecher in der subjektiven Liebeselegie. 6 Vgl. Chwalek (1996) 127f. 7 Trist. 4,10.
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 3:38 PM

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 3:38 PM