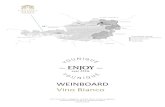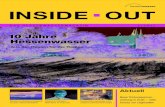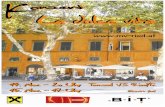Peter Dabrock, Michael Bölker, Matthias Braun, Jens Ried (Hrsg) (2011) Was ist Leben – im...
Transcript of Peter Dabrock, Michael Bölker, Matthias Braun, Jens Ried (Hrsg) (2011) Was ist Leben – im...

1 3
Rezension
Mit der entscheidung, die synthetische Biologie ins zentrum ihres jüngsten Bandes zu rücken, liegt die Reihe „Lebenswissenschaften im Dialog“ im Trend: Kaum ein Feld der Biowissenschaften wird derzeit so intensiv diskutiert wie sie. Die Disziplin beschäftigt sich – verallgemeinernd gesagt – mit der Herstellung biologischer systeme, die kein Gegenbild in der natur besitzen. Die in den letzten Jahrzehnten im Bereich der Gentechnologie und Verfahrenstechnik erzielten Fortschritte erlauben es heute in ungeahntem Ausmaß, die Bio-logie von organismen zu analysieren und zu manipulieren. Damit entstehen neue Maßstäbe dessen, was in der Forschung möglich ist.
Der von Peter Dabrock, Michael Bölker, Matthias Braun und Jens Ried herausgegebene sammelband – das ergebnis einer interdisziplinären Klausurtagung – beschreibt weniger die Details der technischen Machbarkeiten der synthetischen Biologie, sondern er setzt sich stattdessen mit dem (selbst-)Bild der im Bereich der synthetischen Biologie Tätigen und den implikationen ihres Tuns auseinander.
Die Publikation fügt sich in eine Reihe stellungnahmen und Analysen ein, die in den letzten Jahren zum Thema veröffentlicht worden sind. ihr schwerpunkt liegt allerdings auf der Betrachtung des Lebensbegriffs, der weiterführender und vielfältiger als in vorange-gangenen Auseinandersetzungen in den Blick genommen wird. in drei thematische Blöcke untergliedert widmet sich der erste Teil des Buchs möglichen Definitionen der synthetischen Biologie als Disziplin. solche stehen in einem direkten zusammenhang mit dem Lebensbe-griff, der im Mittelpunkt des sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit ihm befassenden zweiten Teils steht. Die vielschichtige Auseinandersetzung findet schließlich in einem drit-ten Teil mit Beiträgen zur synthetischen Biologie im spiegel ihrer gesellschaftlichen und ethischen Relevanz ihren Abschluss.
Die Verortung der synthetischen Biologie im Wissenschaftsgeschehen, wie sie im ersten Teil vorgenommen wird, ist kennzeichnend für die interne und externe Auseinandersetzung mit ihr. Was sich hinter der Disziplin verbirgt, ist umstritten und Gegenstand unterschied-lichster Positionierungen. Die vier Beiträge bieten entsprechend eigene Bestimmungen für
Peter Dabrock, Michael Bölker, Matthias Braun, Jens Ried (Hrsg) (2011) Was ist Leben – im Zeitalter seiner technischen Machbarkeit? Beiträge zur Ethik der Synthetischen BiologieLebenswissenschaften im Dialog, Bd. 11, Verlag Karl Alber, Kassel, 422 Seiten, 39,00 €, ISBN 978-3-495-48468-5
Julia Diekämper · Anja Hümpel
Dr. J. Diekämper () · Dr. A. HümpelBerlin, Deutschlande-Mail: [email protected]
online publiziert: 14. Dezember 2011© springer-Verlag 2011
ethik Med (2012) 24:171–172Doi 10.1007/s00481-011-0170-8

172
1 3
J. Diekämper, A. Hümpel
das, was synthetische Biologie ist und was sie bezweckt. einige der Autoren gehen dabei explizit auf die Formlosigkeit des Feldes ein (Kirsten Brukamp), zum Teil werden aber auch eigene Verortungssysteme präsentiert (Margret engelhard) bzw. diese gar nicht mehr explizit zur Disposition gestellt (Michael Bölker). Die hier entfaltete Bandbreite illustriert trefflich die gegenwärtige Fluidität des Feldes, ohne dabei jedoch einen Konsens herzustel-len. sie vermag der aktuellen Diskussion jedoch nur begrenzt etwas neues hinzuzufügen. Lediglich Tobias eichinger ergänzt sie um ihre wissenschaftspolitische Dimension.
Der den Lebensbegriff thematisierende zweite Teil des Buches ist deshalb gelungen, da – so unklar das selbstverständnis und die Potenziale der Disziplin (noch) sein mögen – doch deutlich wird, dass neue und spektakuläre Varianten von Lebewesen entstehen bzw. herge-stellt werden sollen. Das Leben wird gleichsam zu einem „Werkzeugkasten“ (Anna Depla-zes-zemp, s. 111). Lebensformen, die auf wenige nützliche elemente reduzierbar oder aus verschiedenen organismen neu zusammengestellt sind, werden denk- und machbar. Han-delt es sich aber hierbei bereits um Leben oder um Lebewesen? Wo sollte die Grenze für menschliches Handeln gezogen werden? eröffnet die synthetische Biologie hier wirklich radikal neue Möglichkeiten? Die Analysen entspannen sich von philosophischen Definitio-nen zum Lebensbegriff (Christian Martin, Martin G. Weiss, Gerhard Müller-strahl) über Betrachtungen der menschlichen „schöpfung“ von Leben und dessen Wesensmerkmalen (Reinhard Heil, Ulrich Beuttler) bis hin zur Abgrenzung von natur und Technik aus wis-senschaftstheoretischer sicht (stephan M. Fischer, norbert Walz). Die dabei thematisierte Bandbreite erweist sich als erfrischend facettenreich. sie profitiert insbesondere davon, die ausgetretenen Pfade der Folgenabschätzungen zu verlassen. in diesem sinne bildet die syn-thetische Biologie nicht zwangsläufig den Anfangspunkt, sondern sie ordnet sich vielmehr in komplexe geistesgeschichtliche Überlegungen ein (Reinhard Heil, Martin G. Weiss). Deren Kredit erweist sich allerdings phasenweise als ihre Hypothek, und zwar dann, wenn sie sich zu sehr auf disziplinäre introspektiven verlegen.
Der dritte Teil stellt schließlich die Frage ins zentrum, wie selbstverständlich der Mensch Lebewesen für seine zwecke entfremden dürfe. Mit welchen Risiken ist dabei zu rechnen? Da ergebnisse für eine breite Anwendung der synthetischen Biologie bisher noch ausste-hen, bleiben die Beiträge zwangsläufig spekulativ. neben ethischen Aspekten (Joachim Boldt, Diana Aurenque) werden auch gesellschaftliche Dimensionen analysiert (Jens Ried, Matthias Braun, Peter Dabrock; Amelie Cserer, Alexandra seiringer, Markus schmidt). Auch dieser Ausschnitt bietet zumindest punktuell genuin neues für die Auseinandersetzun-gen: Überlegungen etwa, die Ried, Braun und Dabrock angesichts der in der Öffentlichkeit kursierenden Bilder anstellen, wenn sie auf das kollektive Gedächtnis und Freuds Terminus vom kulturellen Unbehagen Bezug nehmen.
Überraschend für einen solchen sammelband ist das ende des Bandes, insofern das Buch mit einer gemeinsamen Thesenliste aller Autoren schließt. eine solche Aufstellung an die-ser stelle überrascht, weil ein wichtiger Akzent des lesenswerten sammelbandes gerade in seiner Vielfalt und seinem Perspektivenreichtum liegt. Kann eine solche Liste mehr sein als die Darstellung des kleinsten gemeinsamen nenners? Die auf diese Weise entstehende enge steht der Bandbreite mit der synthetischen Biologie verbundener Themen, die das Buch facettenreich aufbietet, diametral entgegen. Gerade ein solch multiperspektivisches Verfah-ren bietet sich an, natur- und Geisteswissenschaftlern Gesprächsgrundlage zu sein, von der diese ebenso profitieren können wie ein Publikum der experten oder der interessierten. Und das ist schließlich auch deshalb gewinnbringend, weil die Lebenswissenschaften ohne einen breit geführten Dialog nicht auskommen.