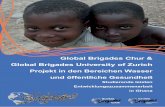Global Brigades Chur Broschüre 2014 Projekt in den Bereichen Wasser und öffentliche Gesundheit
pharma:ch 1/2014: Gesundheit und Wirtschaftswachstum
-
Upload
interpharma -
Category
Documents
-
view
217 -
download
4
description
Transcript of pharma:ch 1/2014: Gesundheit und Wirtschaftswachstum
Gesundheit und Wirtschaftswachstum – eine attraktive KombinationDer medizinische Fortschritt leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand unserer Gesellschaft.
Viel Schmerz und Leid werden gelindert oder gar vermieden. Wir leben länger und sind länger gesund.
Hinter dieser erfreulichen Entwicklung stehen Forscher, Ärzte, Pflegepersonen, Spitäler, die Medizi
naltechnik und die Pharmaindustrie. Die Gesundheitswirtschaft trägt als eine der grössten Branchen
wesentlich zum Wirtschaftswachstum bei.
Wer heute in der Schweiz zur Welt kommt, hat eine Le
benserwartung von 83 Jahren. Das ist eine der höchsten
Lebenserwartungen weltweit. Wir werden aber nicht nur
älter, sondern bleiben auch länger gesund. Hinter dieser
Entwicklung stecken ein enormer medizinischer Fort
schritt und in der Schweiz ein Gesundheitssystem, das zu
den besten der Welt zählt. Dazu leistet die Pharmaindus
trie einen wichtigen Beitrag. Neue Medikamente und The
rapien tragen erheblich zu einer besseren Lebensqualität
vieler Patientinnen und Patienten bei. Sie erhöhen die Aus
sichten auf Überleben und Heilung. Viele Medikamente
haben gar die Sterberate von ganzen Patientengruppen
– zum Beispiel Aids und Leukämie – massiv gesenkt.
Mit dem medizinischen Fortschritt ging auch eine wirt
schaftliche Entwicklung einher. In der Schweiz arbeiten
rund 351 000 Personen in der Gesundheitswirtschaft ein
schliesslich Pharmaindustrie. Das ist mehr als im Detail
handel oder im Baugewerbe. Im Zuge der Bestrebungen,
die Qualität im Gesundheitswesen im Interesse der Pati
entinnen und Patienten weiter zu verbessern, wird die
Gesundheitswirtschaft auch in Zukunft eine Wirtschafts
branche bleiben. Dabei profitieren Schweizerinnen und
Schweizer nicht nur von immer besseren medizinischen
Leistungen, sondern die Schweiz steht weltweit an der
Spitze in Forschung und Entwicklung. Die hoch innovati
ven Branchen Pharma und Medizinaltechnik werden
auch anderswo geschätzt. Deshalb ist die Pharmaindus
trie die wichtigste Exportbranche der Schweiz. Diese
wirtschaftliche Ausnahmestellung ist keine Selbstver
ständlichkeit. Und es ist alles andere als selbstverständ
lich, dass das so bleibt. Dafür braucht es enorme An
strengungen der Unternehmen, denn die Konkurrenz
schläft nicht. Es braucht aber auch beste Rahmenbedin
gungen für den Forschungsstandort Schweiz. Mit dem
Massnahmenpaket zur Verteidigung dieser Spitzenposi
tion bei der biomedizinischen Forschung und Technolo
gie hat der Bundesrat seinen Willen bekundet, dieses
weltweit einmalige und fruchtbare Nebeneinander und
Miteinander von ausgezeichneten Hochschulen und füh
renden Unternehmen zu fördern. Doch Tatsache ist vor
erst, dass die klinische Forschung in der Schweiz seit
Jahren rückläufig ist.
1/14Markt und Politik
pharma:ch
Gesundheit – ein gewichtiger Wirtschaftsfaktor wider WillenDie steigenden Gesundheitskosten und als Folge davon die regelmässigen Erhöhungen der Kranken
kassenprämien sind in der Schweiz ein Dauerthema. Die Diskussion dreht sich dabei zu einseitig
um die Kosten. Oft gehen der Nutzen für die Menschen und die Bedeutung des Gesundheitswesens
als Wirtschaftsfaktor für das ganze Land vergessen.
Dank den Fortschritten in der medizinischen Forschung
– auch der Pharmaindustrie – leben wir heute nicht nur
länger, sondern erleben das Älterwerden in einer besse
ren gesundheitlichen Verfassung. Die demografische Ent
wicklung ist eine Erfolgsgeschichte von Medizin und For
schung und hat dafür gesorgt, dass das Gesundheitswe
sen (inkl. Pharmaindustrie) zum wichtigsten Wirtschafts
zweig der Schweiz geworden ist – vor dem Baugewerbe
und dem Detailhandel.
Medikamente können Spitalaufenthalte verkürzen
Die auf die Kosten ausgerichtete gesundheitspolitische
Diskussion klammert vielfach den Nutzen neuer Behand
lungsmethoden aus. Neue Medikamente verkürzen die
Dauer oder mildern die Folgen einer Krankheit. Dadurch
entstehen auch ökonomische Vorteile. Innovative Medika
mente sind zwar teurer als ihre Vorgängerpräparate, aber
unter dem Strich können sie die Kosten reduzieren, weil
sie zum Beispiel Spitalaufenthalte verkürzen oder gar ope
rative Eingriffe vermeiden. Untersuchungen belegen, dass
neue Medikamente (neben einer gesünderen Lebens
weise) den grössten Beitrag an die gestiegene Lebenser
wartung leisten.
Innovative Medikamente können zwar teurer sein als ihre Vorgängerpräparate, aber unter dem Strich reduzieren sie die Kosten.
Auch wenn die grossen medizinischen Durchbrüche sel
ten sind, wurden in den vergangenen Jahrzehnten auf
mehreren Gebieten deutliche Verbesserungen erzielt. So
ging in den 1980erJahren eine grosse Bedrohung von der
2
pharma:ch 1/14
Aidsepidemie aus, da die Krankheit unheilbar war. 1994
starben in der Schweiz fast 700 Menschen an Aids. In der
Zwischenzeit wurden dank intensiver Forschung Medika
mente entwickelt, welche die Krankheit beherrschbar ma
chen. Heute gibt es über 50 Aidsmedikamente. Die Ster
berate reduzierte sich dadurch bis 2011 auf 12 Personen.
Ein weiteres Beispiel betrifft die Asthmakranken (5% aller
Erwachsenen, 10% der Kinder). Neue Medikamente, die
zur Erweiterung der Bronchien führen, reduzieren die Zahl
der Notfälle und verbessern die Lebensqualität der Betrof
fenen erheblich.
Selbst bei der «Volkskrankheit» Krebs konnte die For
schung gewichtige Fortschritte erzielen. Rund die Hälfte
aller Krebsleiden können heute geheilt werden. Dies gilt in
erster Linie für Krebsarten, die früh erkannt werden und
deshalb besser zu behandeln sind. Besonders erfreulich
sind die Fortschritte für Kinder, die an Krebs erkrankt sind.
Waren es in den 1970erJahren erst 40% der betroffenen
Kinder, die geheilt werden konnten, sind es heute bereits
drei Viertel. Dank besserer Früherkennung und modernen
Wirkstoffen konnte die Sterblichkeitsrate auch beim Brust
krebs in den letzten 20 Jahren um rund 30% gesenkt wer
den. Bei bösartigen Tumoren des Lymphsystems («Non
HodgkinLymphomen») gelang dank neuer Medikamente
eine Reduktion des Sterberisikos um fast 50%.
Rund die Hälfte aller Krebsleiden können heute geheilt werden. Dies gilt in erster Linie für Krebsarten, die früh erkannt werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Wer krank ist, verur
sacht nicht nur Kosten, um wieder gesund zu werden. Er
bewirkt auch indirekte Kosten wie den Produktivitätsver
lust durch das Fehlen am Arbeitsplatz, die informelle
Pflege durch Verwandte und Freunde sowie verlorene
Freizeit. Neue Medikamente tragen dazu bei, die Krank
heitskosten zu senken. In der Gesamtrechnung können
sich also höhere Ausgaben für die Gesundheit durchaus
lohnen, weil sie im Gegenzug volkswirtschaftliche Einspa
rungen erbringen.
Die höhere Lebenserwartung hat aber auch ihre Kehr
seite. Mit steigendem Alter nimmt das Risiko zu, an De
menz, Alzheimer oder Krebs zu erkranken. Gemäss einer
Studie der Schweizer Alzheimervereinigung sind hierzu
lande heute mindestens hunderttausend Menschen von
einer Demenzerkrankung betroffen. Bis im Jahre 2050
dürfte sich ihre Zahl auf über 300 000 Personen verdrei
fachen.
Alterung der Gesellschaft wird zur Herausforderung
Und noch ist kein Medikament in Sicht, das die Ursache
von Alzheimer bekämpfen könnte. Die heutigen Medika
mente zögern zwar den Krankheitsverlauf hinaus, aber die
zerstörten Nervenzellen im Gehirn können sie nicht mehr
reparieren. Alzheimer entsteht auf komplexe Weise und
verändert das Gehirn über Wege, die noch immer nicht
ganz geklärt sind. Trotzdem versuchen Forscherinnen und
Forscher weltweit Wirkstoffe zu entwickeln, welche den
Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Das Ziel muss
sein, den Betroffenen mit neuen Therapien möglichst
lange ein selbstständiges Leben zu ermöglichen oder zu
verhindern, dass die Krankheit überhaupt ausbricht.
Dem ganzen Gesundheitswesen wird künftig eine noch
grössere Bedeutung als Wirtschaftsfaktor zukommen.
Bereits heute zählt der Gesundheitssektor (Gesundheits
wesen oder Pharmaindustrie) in der Schweiz rund 351 000
Beschäftigte, womit jeder zwölfte Beschäftigte in diesem
Bereich angestellt ist. Das Gesundheitswesen dürfte in
absehbarer Zeit zum wichtigsten Arbeitgeber des Landes
werden.
Bereits heute zählt der Gesundheitssektor in der Schweiz rund 351 000 Beschäftigte.
Dabei ist die pharmazeutische Innovation der Motor für
Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliches Wachstum.
Die forschende Pharmaindustrie steht direkt und indirekt
für fast 170 000 Arbeitsplätze in der Schweiz. Im Jahre
2013 erwirtschaftete sie einen Exportüberschuss von
über 37 Milliarden Franken. Die InterpharmaMitgliedfir
men investieren allein in der Schweiz jährlich mehr als
6 Milliarden Franken in Forschung und Entwicklung,
machen hier aber nur rund 1,2 Milliarden Umsatz.
GESUNDHEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM
3
1/14 pharma:ch
GESUNDHEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM
Einige Fakten zur Bedeutung des Pharma und For
schungsstandorts Schweiz vorweg:
• Seit der Finanzkrise sind die Exporte pharmazeutischer
Produkte markant gestiegen. Sie beliefen sich 2013 auf
66 Milliarden Franken und machen damit rund einen
Drittel des Exportvolumens der Schweiz aus.
• Die Pharmaindustrie hat seit 1990 ihre um die Preisent
wicklung korrigierte Wertschöpfung von 3,3 Milliarden
auf 20,3 Milliarden Franken gesteigert. Dies entspricht
einem jährlichen Wachstum von knapp 9%. Damit hat
sich die Pharmaindustrie deutlich dynamischer entwi
ckelt als die Gesamtwirtschaft.
• Im Jahr 2012 beschäftigte die Pharmaindustrie 39 500
Personen. Mehr als 130 000 Menschen sind in ihrem
Umfeld tätig (inkl. Zulieferer).
• Die nominale Arbeitsplatzproduktivität lag im Jahr 2012
bei 488 000 Franken und somit um den Faktor 3,9 über
dem gesamtwirtschaftlichen Wert von 124 000 Franken.
Zwischen 1990 und 2012 lag das durchschnittliche jähr
liche Wachstum der Arbeitsplatzproduktivität bei 5,3%
(Gesamtwirtschaft ca. 2% pro Jahr).
• Die InterpharmaFirmen investieren in der Schweiz in
Forschung und Entwicklung jährlich rund 6 Milliarden
Franken, was einem Anteil ihrer gesamten Forschungs
ausgaben von rund 34% entspricht.
• Auch im internationalen Vergleich investiert die Phar
maindustrie überdurchschnittlich viel in Forschung und
Entwicklung. 2013 lagen Novartis und Roche unter den
ersten zehn Firmen weltweit, was die absolute Höhe
ihrer Ausgaben für Forschung und Entwicklung angeht
(an der Spitze liegt Volkswagen). Werden diese Ausga
ben auf den Gesamtumsatz umgelegt, ist Roche mit
21% führend, Novartis kommt auf Platz vier.
• Gemessen an der Zahl der gesamten Erwerbstätigen
werden in der Schweiz überdurchschnittlich viele Phar
mapatente über das Europäische Patentamt angemel
det. Übertroffen wird die Schweiz nur von Dänemark.
Bis ein Patent angemeldet werden kann, ist es aber ein
langer Weg. Überdies ist die Pharmaforschung mit gros
sen Risiken behaftet. Oftmals sind die Bemühungen nicht
von Erfolg gekrönt, weil unbefriedigende Wirkungen oder
ernste Nebenwirkungen erst in aufwendigen klinischen
Versuchen erkannt werden. Von 10 000 Substanzen
schaffen es nur 20 in die präklinische Phase. Von diesen
wiederum erreichen nur zehn die klinische Phase, in der
Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit eines neuen
Medikaments geprüft werden. Die klinische Phase, also
das dreistufige Verfahren mit freiwilligen Testpersonen so
wie kleineren und grösseren Patientengruppen, ist denn
auch mit einem Anteil von 36% der grösste Kostenblock.
Doch selbst in der Phase III ist die Erfolgswahrscheinlich
keit noch relativ gering. Ein Fünftel der gesamten Kosten
entfällt auf die Erforschung neuer Wirkstoffe.
Pharmazeutische Produkte machen rund einen Drittel des Exportvolumens der Schweiz aus.
Weil der Forschungs und Entwicklungsprozess bis zu ei
nem neuen Medikament zeitaufwendig und teuer ist,
kommt dem Patentschutz grosse Bedeutung zu. Patente
schützen eine Erfindung für die Dauer von 20 Jahren. In
dieser Zeit geniesst der Erfinder ein begrenztes Exklusiv
recht zur kommerziellen Nutzung des Produkts. Ohne Pa
tentschutz entfällt das Interesse von privaten Investitionen
in die Medikamentenforschung. Oder anders ausge
drückt: Der Patentschutz schafft die Anreize für weitere
Innovationen, auf die wir alle angewiesen sind. Nur durch
Innovationen kann die Schweiz den Ruf als wettbewerbs
fähigstes Land behaupten.
Der Forschungsplatz Schweiz muss Weltspitze bleibenDie Erforschung neuer Wirkstoffe und die Entwicklung von Medikamenten haben sich in den letzten
Jahren massiv verteuert, weil ein viel grösserer Aufwand betrieben werden muss. Breit abgestützte
klinische Versuche sind in der Schweiz seit einiger Zeit rückläufig. Um die Wettbewerbsfähigkeit
des Standortes zu erhalten, sind Reformen und bessere Rahmenbedingungen nötig. Sonst droht dem
Land der Verlust der internationalen Spitzenposition.
4
pharma:ch 1/14
Angesichts des starken Rückgangs der klinischen For
schung in der Schweiz besteht aber die Gefahr, dass un
ser Land ins Hintertreffen gerät. Waren es im Jahre 2004
noch rund 400 klinische Versuche, die hierzulande durch
geführt wurden, so sank deren Zahl im Jahre 2013 auf 205
Versuche. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwort
lich: kleine Patientenzahlen, dezentrale, langwierige Ver
fahren sowie die Verlagerung in neue Länder. Der Rück
gang schadet den Patienten und beeinträchtigt die Qua
lität der Medizin. Die Pharmaindustrie hätte es deshalb
begrüsst, wenn der Bundesrat in seinem Ende des letzten
Jahres verabschiedeten «Masterplan zur Stärkung der
biomedizinischen Forschung und Technologie» For
schungsanreize im Bereich des geistigen Eigentums auf
genommen hätte.
Positiv zu werten ist, dass bei den Verfahren in den Ethik
kommissionen neu das Leadprinzip gilt, im Gesetz eine
Limite von 60 Tagen gesetzt wurde und Swissmedic ihre
Aufgaben effizient ausführt. In die richtige Richtung geht
der Masterplan bezüglich einer besseren Qualität der Aus
bildung für die Ärzteschaft an den Universitäten und Kli
niken. Positiv zu vermerken sind die Ansätze, ein regula
torisches Umfeld zu schaffen, das fördert statt behindert.
Es ist unabdingbar, dass die Strukturen und Formen der
Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Industrie, regi
onalen und kantonalen Zentren verbessert werden müs
sen. Die Zusammenarbeit zwischen der akademischen
Forschung und der Industrie ist zu intensivieren.
Die auf Verordnungsebene bereits in Kraft gesetzten Ver
besserungen gilt es nun aber in die Praxis umzusetzen.
Dabei geht es in erster Linie um die Beschleunigung der
Verfahren für die Bewilligung von klinischen Studien sowie
die raschere Aufnahme von neuen Medikamenten auf die
Spezialitätenliste. Dadurch kann der schnellere Zugang
von Patientinnen und Patienten zu innovativen Medika
menten sichergestellt werden. Zusammengefasst kann
gesagt werden, dass der Bundesrat mit dem Masterplan
die Notwendigkeit zur Revitalisierung des Forschungs
und Pharmastandorts Schweiz erkannt hat.
5
1/14 pharma:ch
GESUNDHEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM
Die Pharmaindustrie ihrerseits ist gewillt, weiterhin auf den
Standort Schweiz zu setzen und in Forschung und Ent
wicklung zu investieren. Sie sieht den Masterplan als Be
kenntnis zum weiteren Dialog und zur Notwendigkeit eines
stärkeren Austausches zwischen Anspruchsgruppen.
Weiter sind für die Branche auch eine hohe Qualität der
Ausbildung in Schulen, in der Berufsbildung und an Uni
versitäten und der Zugang zu hoch qualifizierten Fachkräf
ten aus dem In und Ausland ein wichtiger Wettbewerbs
faktor.
Die Aidsforschung in den Neunzigerjahren ist eine Erfolgs
geschichte der Medizin. Ermöglicht wurde sie durch die
transparente Zusammenarbeit der forschenden Firmen.
Sie stellten sich gegenseitig ihre in Entwicklung befindli
chen Moleküle zur Verfügung, um so rascher wirksame
Medikamentenkombinationen zu finden. Aus HIV/Aids
wurde dadurch eine zwar nicht heilbare, aber chronisch
behandelbare Krankheit. Die Sterberate konnte massiv
gesenkt werden.
Was damals neu und eine Ausnahme war, gehört heute
zur gängigen Praxis. Um zu aussagekräftigen Daten zu
kommen, braucht es grosse Patientenzahlen, die nur über
Kollaborationen gewonnen werden können. Die «perso
nalisierte Medizin» machte die Öffnung notwendig. Sie
arbeitet mit Biomarkern, die zeigen, welche Patienten
gruppen auf ein bestimmtes Medikament ansprechen,
und benötigt deshalb möglichst viele Daten.
Trotz dieser Erfolge einer schrittweisen Öffnung schiesst
der Ruf nach absoluter Transparenz übers Ziel hinaus. Aus
drei Gründen:
1. Die Problematik des Datenschutzes. Gerade bei
hochinnovativen Medikamenten besteht das Risiko, dass
Patienten «reidentifiziert» werden können, beispielsweise
durch die Verlinkung mit den in den sozialen Medien zu
gänglichen Daten.
2. Die Integrität der regulatorischen Systeme. Die
Verantwortung über die Zulassung neuer Medikamente
liegt bei den staatlichen Arzneimittelbehörden und nicht
bei den Firmen oder Netzwerken von Wissenschaftlern.
Angesichts des Konkurrenzkampfes unter den Forschern
und der um sich greifenden Tendenz nach rascher Publi
zität und fetten Schlagzeilen überwiegen die Nachteile
einer schrankenlosen Offenlegung der Rohdaten von kli
nischen Studien.
3. Der Schutz «vertraulicher kommerzieller Daten».
Wer über eine Milliarde Franken in die Entwicklung eines
neuen Medikaments investiert, hat Anspruch auf den Un
terlagenschutz. Damit soll verhindert werden, dass Tritt
brettfahrer in den Besitz von Daten kommen und davon
profitieren.
Der Lernprozess bei der Aidsforschung hat aber zur Ein
sicht geführt, dass die Industrie offener über klinische
Studien informieren muss. Entsprechende gemeinsame
Grundsätze sind von den Dachorganisationen der
forschenden Pharmafirmen in den USA und Europa im
letzten Jahr verabschiedet worden. Der breitere Zugang
zu Daten, kombiniert mit dem technologischen Fortschritt
und der «personalisierten Medizin», kann zu neuen The
rapieansätzen führen. Und dies ist im Interesse von uns
allen, den Patienten, der Medizin und den forschenden
Firmen.
Weshalb die Transparenz nicht absolut sein kann 6
pharma:ch 1/14
INTERVIEWINTERVIEW
Dr. Müller, wie beurteilen Sie den
Stand der klinischen Forschung
in der Schweiz?
Die klinische Forschung in der
Schweiz befindet sich im Auf
wärtstrend. Vor dem Hinter
grund einer über Jahrzehnte
hinweg eher schwachen klini
schen Forschung haben der
Bundesrat, der Schweizeri
sche Nationalfonds, die Rekto
unsere Kinder – schützt und sicherstellt, dass sie in der
Forschung berücksichtigt werden. Um im internationalen
Forschungswettbewerb mitzuhalten, muss auch das
Umfeld stimmen: Forschungsgruppen müssen Zugang
zu Spezialisten haben, aber auch zu Forschungseinrich
tungen mit Core Facilities und topmodernen Geräten.
Weltklasseforschung lässt keine Barrieren innerhalb der
Schweiz zu. International dürfen wir den Zugang für Ta
lente aus dem Ausland nicht behindern. Dienstleister in
der Klinik, klinische Forscher und Grundlagenforscher
müssen sich vernetzen und auf Augenhöhe zusammen
arbeiten. Ebenso darf die «Dreifaltigkeit» der klinischen
Forscher als Dienstleister, Lehrer und Wissenschaftler
nicht zu einem Interessenkonflikt führen. Und schliesslich
müssen wir unsere Nachwuchsforscher fördern.
Dr. med. Conrad E. Müller
CEO UniversitätsKinderspital
beider Basel (UKBB)
renkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) sowie
Hochschulen und Institute Massnahmen ergriffen, um
die medizinische Forschung zu stärken. Ein Beispiel sind
Netzwerke wie die Clinical Trial Units: Klinische Studien
in der Kindermedizin werden neu in einem schweizweiten
Swiss PedNet zusammengeführt. Damit können u.a. kli
nische Multicenterstudien mit hohem Qualitätsstandard
in allen kindermedizinischen Disziplinen durchgeführt
werden. Es besteht aber nach wie vor ein Mangel an
klinischen Forscherinnen und Forschern, die mit Erkennt
nissen aus der Biomedizin und der Epidemiologie eben
so vertraut sind wie mit klinischen Krankheitsbildern.
Wie hat sich die Forschung in den letzten Jahren verän-
dert?
Mit der exponentiell ansteigenden technologischen Ent
wicklung können immer grössere Datensätze und Para
meter erfasst werden. Forschung kann deshalb heute, im
Gegensatz zu früher, nicht mehr von Einzelnen erfolg
reich durchgeführt werden. Forscherteams aus klini
schen Forschern, Genetikern, Pharmakologen, Biostatis
tikern und Bioinformatikern können dagegen komplexere
Forschungsfragen bearbeiten, als dies noch vor Jahren
möglich gewesen wäre. Dabei gibt es einen Trend zur
translationalen Forschung, d.h. zum Transfer von Grund
lagenwissen in die medizinische Anwendung.
Wo liegt aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung, damit
die Schweiz bei der klinischen Forschung nicht weiter ins
Hintertreffen gerät?
Eine Grundvoraussetzung sind angemessene Rahmen
bedingungen. Schweizer Forscher müssen freien Zu
gang zu internationalen ForschungsGrants haben und
uneingeschränkt global und vernetzt Forschung auf
bauen können. Die Schweizer Forschung braucht eine
Gesetzgebung, die qualitativ hochstehende und ethische
Forschung garantiert – ohne die Forschungstätigkeit zu
stark einzuschränken. Sie braucht ein Arzneimittelge
setz, welches Investitionen in die Forschung für die In
dustrie lohnend macht und gleichzeitig Minoritäten – wie
«Die Schweizer Forschung braucht eineGesetzgebung, die qualitativ hochstehende und ethische Forschung garantiert.»
Welchen Stellenwert hat dabei die Zusammenarbeit mit der
pharmazeutischen Industrie?
Einen sehr wichtigen Stellenwert. In Basel haben wir ei
nen hervorragenden Cluster von Pharmafirmen, und wir
sollten uns gegenseitig unterstützen. Forschung soll un
abhängig sein, aber man soll auch durch gemeinsame
Forschungsprojekte Synergien zum Wohl des Patienten
nutzen. Spitäler wie das UKBB können helfen, die Lücke
zwischen der akademischen Gemeinschaft und den Ex
perten aus der Wirtschaft zu schliessen. Nicht nur in der
Produktentwicklung, aber beispielsweise auch bei der
Nutzung von für den öffentlichen Sektor beinahe uner
schwinglicher Infrastruktur.
Als Vorsitzender der Geschäftsleitung des Universitäts-
Kinderspitals beider Basel stehen bei Ihrer Arbeit die kleins-
ten Patienten im Zentrum. Wo liegen in diesem Bereich die
Forschungsschwerpunkte?
Wenn wir nicht für unsere kleinen Patienten forschen, wer
tut es dann? Deshalb haben wir die Verpflichtung, ein erst
klassiges Forschungsportfolio aufzubauen, das mit den
Zielen der Universität einhergeht, das aber auch dort
forscht, wo in der Versorgung der Kinder Lücken beste
hen. Hier arbeiten wir oft mit Stiftungen zusammen. Dank
der EckensteinGeigyStiftung konnten wir beispielsweise
ein Zentrum für pädiatrische Pharmakologie aufbauen –
aktuell sind nur 11% der Pharmazeutika für die Behand
lung von Neugeborenen registriert. Weitere Forschungs
schwerpunkte am UKBB sind Entwicklungspädiatrie und
Pneumologie, Hämatologie und Onkologie, Immunologie
und Infektiologie sowie die Kinderorthopädie.
7
1/14 pharma:ch
ImpressumHerausgeber: Thomas B. Cueni, Sara KächRedaktion: InterpharmaLayout: Continue AG, BaselFotos: Barbara Jung, istock
Pharma:ch ist der Newsletter von Interpharma, dem Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz, Actelion, Novartis, Roche, AbbVie, Alcon, Amgen, Bayer, Biogen Idec, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen, Merck Serono, Pfizer, Sanofi, UCB und Vifor. Diese Plattform will durch differenzierte Information Verständnis für die medizinisch-pharmazeutische Forschung und Entwick-lung in der Schweiz schaffen.
www.interpharma.ch
InterpharmaPostfach, 4009 BaselTelefon 061 264 34 00Telefax 061 264 34 [email protected]
Was der Forschungsstandort Schweiz brauchtNur in wenigen Wirtschaftsbereichen ist die Schweiz globale Spitze. Sicher trifft dies auf die Pharma
industrie zu. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Qualität unseres Gesundheitswesens und erzielt eine
sehr hohe Wertschöpfung. Soll das so bleiben, müssen die Rahmenbedingungen optimiert werden.
Die Schweiz gehört zu den Ländern mit dem höchsten Le
bensstandard. Das ist bemerkenswert für ein Land fast
ohne Rohstoffe. Unser wichtigster Rohstoff ist das Wissen,
denn der Schlüssel zu unserem Wohlstand ist die Innova
tion. Wir sind darauf angewiesen, Produkte und Dienstleis
tungen zu erschaffen, die weltweit gefragt sind, weil sie
qualitativ hochwertig und in weit überdurchschnittlichem
Mass nützlich sind. Das ist anspruchsvoll, die Schweiz hat
aber immer wieder gezeigt, dass sie dazu in der Lage ist.
Sie profitiert dabei vom hohen Bildungsniveau, von der glo
balen Vernetzung und von der Präsenz multinationaler Un
ternehmen.
Die forschende Pharmaindustrie ist ein Paradebeispiel für
Wirtschaftsleistungen «à la Suisse». Und sie forscht nicht
zuletzt in der Schweiz. Mehr als sechs Milliarden Franken
geben die Mitgliedfirmen von Interpharma hier jährlich für
Forschung und Entwicklung aus. Das Ergebnis sind immer
wieder neue Medikamente, die Krankheiten heilen, die Le
bensqualität von Kranken verbessern und Leiden lindern.
Anderseits bringen solche Produkte jene Erträge ein, wel
che die Unternehmen brauchen, um immer wieder in Inno
vation investieren zu können. Dieser Kreislauf ist indes alles
andere als selbstverständlich. Und er hält sich nicht einfach
von selbst in Schwung. Voraussetzungen sind zunächst
das Nebeneinander von forschenden Pharmaunterneh
men, Hochschulen und Spitzenmedizin. Dann braucht es
genügend Wissenschaftler. Es muss auch künftig möglich
sein, Fachkräfte unbürokratisch zu rekrutieren, unabhängig
von ihrer Nationalität. Letzteres ist mit der Annahme der
Masseneinwanderungsinitiative infrage gestellt. Denn sie
schafft Unsicherheit und wirft Fragen auf zur Berechenbar
keit der politischen Stabilität, eine wichtige Rahmenbedin
gung für Unternehmen, die in der Schweiz investieren wol
len. Die bilateralen Verträge I und II und das Freihandelsab
kommen mit der EU sind angesichts der vielfältigen Han
delsbeziehungen der Schweiz von enormer Bedeutung für
die Schweizer Wirtschaft.
Andere Staaten haben ihre Rahmenbedingungen für inno
vative Industriezweige laufend verbessert und buhlen um die
Gunst der Investoren. In der Schweiz hat der Bundesrat erst
kürzlich den «Masterplan biomedizinische Forschung und
Technologie» verabschiedet. Dieser Ansatz einer proaktiven
Industriepolitik kann zweifellos Verbesserungen bringen, in
dem administrative Verfahren beschleunigt und effizienter
werden sollen. Auch die Bemühungen, die Schweiz in der
klinischen Forschung, wo sie in den vergangenen Jahren viel
und entscheidendes Terrain verloren hat, wieder attraktiver
zu machen, sind positiv. Indessen tut sich die Schweiz etwa
schwer damit, neue Forschungsanreize zu schaffen. Ein gu
tes Beispiel sind die seltenen Krankheiten, wo die USA und
die EU mit gesetzlichen und administrativen Massnahmen
die Forschungstätigkeit im Interesse der Patienten ankurbeln
konnten. Viele Jahre später ist die Schweiz erst oder nach
wie vor in der Phase der Diskussion. Das ist unverständlich,
wenn Innovation die Triebfeder für das wirtschaftliche Fort
kommen des Landes sein soll.
Thomas B. Cueni, Generalsekretär Interpharma
pharma:ch 1/14