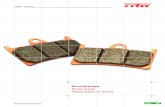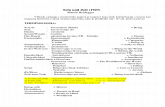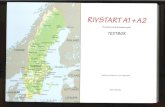PH_Madame Butterfly.pdf
-
Upload
dippelmedien -
Category
Documents
-
view
25 -
download
4
Transcript of PH_Madame Butterfly.pdf

madamebutterflyVOLKSTHEATERROSTOCK

3 MAdAME BuTTERfLyMadaMa ButterflyJapanische Tragödie in drei akTenvon Luigi iLLica und giuseppe giacosanach John LuTher Long und david BeLascoMusik von giacoMo pucciniIn italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln
/ Musikalische Leitung Peter Leonard/ Inszenierung Jay Lesenger/ Bühne Mathias Betyna nach einer Konzeption von Ron Kadri/ Kostüme Jenny Ellen Fischer Premiere am 06.10.2013/ Großes Haus

54
BeseTzung / Madame Butterfly (Cio-Cio-San) Soojin Moon/ N. N.*
/ Suzuki, Dienerin von Cio-Cio-San Takako Onodera/ F. B. Pinkerton, Marineoffizier der USA Garrie Davislim/ Sharpless, Konsul der Vereinigten Staaten in Nagasaki Olaf Lemme/ Goro, Nakodo Titus Paspirgilis/ Kate Pinkerton Maria Teresa González/ Yakusidé Nils Pille/ Der Onkel Bonze Mark Sampson/ Fürst Yamadori Hee Wook Kim/ Der kaiserliche Kommissar Günter Berdermann/ Der Standesbeamte Gerhard Stephan/ Die Mutter von Cio-Cio-San Mei Li-Schmitt/ Die Cousine von Cio-Cio-San Akane Matsui/ Die Tante von Cio-Cio-San Diana König/ „Schmerz“, Sohn von von Cio-Cio-San Julian Grau/ Simon Oldach * * Doppelbesetzungen in alphabetischer Reihenfolge
Opernchor des Volkstheaters RostockStatisterie des Volkstheaters RostockNorddeutsche Philharmonie Rostock
/ Choreinstudierung Stefan Bilz/ Dramaturgie Roland Dippel/ Studienleitung Hans-Christoph Borck/ Musikalische Einstudierung Teodora Belu, Jewgenij Potschekujew/ Regieassistentin Carola Heine/ Inspizientin Constance Schwerdt/ Souffleuse Christiane Blumeier-Braun
Biografien aller künstlerischen Mitwirkenden: www.volkstheater-rostock.de/ Aufführungsdauer 2 Stunden, 50 Minuten, eine Pause
/ Technischer Leiter Peter Martins/ Werkstattleiter Dirk Butzmann/ Bühneninspektor Holger Fleischer/ Bühnentechnik Jürgen Laube/ Leiterin der Kostümabteilung Jenny-Ellen Fischer/ Kostümanfertigung Kornelia Junge, Martina Steckert/ Kostümassistenz Jana Maaser/ Chefmas-kenbildnerin Beatrice Rauch/ Maske Katharina Britze, Michaela Schroeckh/ Leiter der Beleuchtung Andreas Lichtenstein/ Beleuchtung Ekkehart Merker/ Leiter der Tonabteilung Michael Martin/ Ton Guido Thomä/ Leiterin der Requisite Iris Rothbarth/ Requisite Claus-Peter Arfert/ Herstellung der Dekoration Werkstätten des Volkstheaters Rostock/ Es wird darauf hingewiesen, dass Ton- und/oder Bildaufnahmen der Aufführung durch jede Art elektronischer Geräte strikt untersagt sind. Zuwiderhandlungen sind nach dem Urheberrechtsgesetz strafbar.

6 7
GLOcKEnTOn VERHALLT –und ScHwinGT fORT iM BLüTEndufT. ABEnd iST ES nun.
Die HanDlung: Teil 1/ MAdAME BuTTERfLy
Basho (1644–1694)
Drei Jahre später. ● ● ● Noch immer wartet Cio-Cio-San auf Pinkerton und hofft auf beider glückliche Vereinigung, Suzuki harrt bei ihr trotz der drohenden Verarmung aus. Sharpless besucht sie, um ihr einen Brief Pinkertons vorzulesen, dessen Inhalt die vor Freude überwäl-tigte Cio-Cio-San missversteht. Goro stellt ihr die Ehe mit Fürst Yamadori in Aussicht. Doch Cio-Cio-San weist diesen zurück, sie will – wie eine gute „amerikanische Ehefrau“ – nur einen Gatten haben. Sharpless deutet an, dass Pinkerton möglicherweise nie zu ihr zurückkehren wird, die niedergeschmetterte Geisha zeigt ihm ihren und Pinkertons Sohn „Schmerz“. Cio-Cio-San ist sich sicher, dass Pinkerton, wenn er von seinem Sohn erfährt, zu ihr zurückkehren werde. Der Konsul geht, ohne ihr von Pinkertons rechtmäßiger Ehe, die dieser inzwischen eingegangen ist, zu erzählen. ● ● ● Suzuki weist Goro zurecht, weil er Lügen über den Vater des Kindes erzählt und erteilt ihm Hausverbot. Im Moment der äußersten Ungewissheit kündigt eine Kanone die Ankunft von Pinkertons Schiff im Hafen an. Während des Sonnen-untergangs schmücken Butterfly und Suzuki das Haus für seinen Besuch und beginnen eine nächtliche Wache. ● ● ● Im Morgengrauen bringt die erschöpfte Butterfly ihren Sohn zu Bett. Pinkerton und seine legitime Ehefrau Kate, die das Kind mit sich nach Amerika nehmen will, treffen in Begleitung von Sharpless ein. Pinkerton wird von Selbstvorwürfen überwältigt. Cio-Cio-San verspricht, ihm den Sohn zu überlassen, wenn er ihn persönlich abholt. Allein findet sie die einzige mögliche Lösung aus ihrer grausamen Situation. Jay Lesenger/rd
MAdAME BuTTERfLy \ Die HanDlung: Teil 2
Am Hafen von Nagasaki, Japan um 1900 ● ● ● Zur Erholung von seinen militärischen Pflichten hat der amerikanische Marineleutnant F. B. Pinkerton den japanischen Heiratsvermittler Goro mit dem Arrangement einer „Ehe auf Zeit“ beauftragt. Dieses beinhaltet einen bezugs-fertigen Hausstand, Dienstboten, die schöne junge Geisha Cio-Cio-San, eine traditionelle Hochzeitsfeier und eine schriftliche Vereinbarung, dass die Ehevereinbarung durch den Mann jeweils zum Monatsende gekündigt werden kann. ● ● ● Nach Besichtigung des Hauses erhält Pinkerton Besuch durch den amerikanischen Konsul Sharpless. Pinkerton betrachtet die japanische Trauung als beiläufiges Freizeitvergnügen. Sharpless gibt ihm zu bedenken, dass die Braut dieses Arrangement wesentlich ernster nimmt als er. Pinkerton will diese Bedenken zerstreuen und trinkt auf den Tag seiner Verheiratung mit einer Amerikanerin als rechtmä-ßiger Ehefrau. ● ● ● Cio-Cio-San trifft in Begleitung ihrer Verwandten und ihres betrunkenen Onkels Yakusidé ein. Verborgen vor den Hochzeitsgästen zeigt sie ihrem „Bräutigam“ ihre wenigen Habseligkeiten – darunter den Dolch, mit dem sich ihr Vater nach dem Verlust seiner Ehre im Auftrag des Kaisers umbringen musste. Aus Sympathie für Pinkerton ist Cio-Cio-San zum Christentum übergetreten, was sie ihren Verwandten verheimlicht. ● ● ● Die Trauungs-zeremonie wird durch ihren Onkel Bonze, einen Shinto-Priester, unterbrochen. Er beschul-digt Cio-Cio-San des Verrats an Religion, Vorfahren, Tradition – und er zwingt ihre Verwand-ten, sie zu verstoßen. ● ● ● Pinkerton umwirbt sie mit leidenschaftlichen Worten. Cio-Cio-San ist sich der Tragweite ihres Tuns bewusst, sie gibt sich ihm hin.

98
ein DurcHfall bei Der urauffüHrung/ MAdAME BuTTERfLy
Erstaufführung in französischer Sprache (Opéra-Comique Paris) am 28. Dezember 1906 vor-genommene Einrichtung war die Basis für den ersten Druck der Partitur. Auch später ließ Puccini weitere Änderungen zu, z. B. für eine Vorstellung am Teatro Carcano Mailand 1919. ● ● ● Puccinis Madame Butterfly erlangte erst mit der Aufführung in Brescia jenen sprichwört-lichen Erfolg, den die „Japanische Tragödie“ bis heute hat. Seit ca. 1980 werden gängige Kli-schees und Sentimentalitäten in Frage gestellt, denen das Werk bis heute ausgesetzt ist. Die zunehmende Bekanntheit der von J. Smith bei Ricordi edierten Urfassung hatte überdies zur Folge, dass szenische Umsetzungen seither vielerorts von „Kirschenblüten-Poesie“ zum „in-terkulturellen Beziehungsdrama“ tendieren. ● ● ● Giacomo Puccini hatte mit seinen Libret-tisten Luigi Illica (1857–1919) und Giuseppe Giacosa (1847–1906) einen Stoff veropert, der viele modische Bestandteile enthielt: Exotismus, eine leidende und sterbende Heldin, diese fügt sich in ihr Schicksal und begehrt weder gegen die Normen ihres eigenen Kulturkreises noch gegen die brutale Behandlung durch ihren amerikanischen Pseudobräutigam auf. ● ● ● Doch was waren die Gründe des Misserfolges in der Mailänder Scala, zumal das Werk mit retuschie-renden Veränderungen wenige Wochen später einen ersten Erfolg hatte? Vermutlich hatte der Komponist mit dem Selbstmord der Geisha Cio-Cio-San und der Charakterisierung des ame-rikanischen Marineleutnants B. F. Pinkerton das anwesende Publikum nicht gerührt, sondern empört. Das lag gewiss nicht an Puccinis Musik, deren fernöstliches Tonmaterial den Wohl-klang äußerst raffiniert unterwanderte.
die auf Pinkerton wartende Geisha Cio-Cio-San – „Madame Pinkerton“ – ist eine der Opernfiguren schlechthin. Und so kommt es, dass Puccinis bis zu ihrer Entstehung fortschrittlichste Partitur, seine bei der Urauffüh-rung durchgefallene Oper heute noch immer für Kitsch und Sentimen-talität stehen. Vollkommen zu Unrecht. ● ● ● Nie riskierte der toskani-
sche Komponist Giacomo Puccini (1858–1924) mehr. Nach seinen Welterfolgen La bohème und Tosca suchte er neuartige musikalische und szenische Effekte. Zur Komposition recherchierte er sogar originales japanisches Tonmaterial. Ergebnis war eine Oper, deren Gestaltung für den ersten Druck der Partitur erst über zwei Jahre nach der Uraufführung festgelegt wurde. ● ● ● Puccini erhielt die Rechte für die Vertonung 1901. Vor der Komposition unterrichtete er sich bei der japanischen Schauspielerin Sada Jacco über die Sprachmelodie des Japanischen und setzte sich mittels Tonaufzeichnungen mit fernöstlicher Musik auseinander. Aufgrund schwerer Verletzungen bei einem Autounfall musste Puccini die Komposition unterbrechen, die er am 27. Dezember 1903 abschloss. ● ● ● Die Uraufführung an der Mailänder Scala am 17. Februar 1904 war ein totaler Misserfolg, wie ihn Puccini sonst nie erlebt hatte. Er zog das Werk sofort zurück und nahm für die Wiederaufführung am Teatro Grande in Brescia am 28. Mai 1904 die ersten Überarbeitungen vor. ● ● ● Für die Premieren am 10. Juli 1905 im Opern-haus Covent Garden London und an der Washington Opera im Oktober 1905 (der ersten Aufführung in englischer Sprache) setzte er weitere kleinere Änderungen um. Erst die für die

11
MAncHMAL wiLL dER AAL dES MAnnES diE HöHLE dER fRAu BESucHEn.
Die Geisha (Film, USA 2005) – Regie: Rob Marshall, Drehbuch: Robin Swicord
10
MAdAME BuTTERfLy \ änDerungen aus erfolgsDruck
in der Hochphase des Kolonialismus hatte Puccini Partei ergriffen für die Ange-hörige eines Volkes, das gerade am Beginn einer beispiellosen technisch-indus-triellen Entwicklung stand und zur Entstehungszeit der Oper und ihrer litera-rischen Quellen aus europäisch-amerikanischer Perspektive noch nicht als gleichwertig betrachtet wurde. ● ● ● So lässt sich sein Verfahren bis zur ersten
gedruckten Notenausgabe erklären: Zunehmend entschärfte er die fremdenfeindlichen Äu-ßerungen Pinkertons und gestand diesem, der in heutigen Rezensionen wiederholt als Sex-tourist interpretiert wird, sogar ein emotional aufgeladenes Solo zu. In diesem beklagt er den Verlust seines japanischen „Abenteuers“: „Addio, fiorito asil“ ● ● ● Parallel machte Puccini in zahlreichen kleinen Veränderungen und Retuschen aus Cio-Cio-San ein naives Geschöpf, das sich einer Rückkehr in ihre traditionelle Gemeinschaft entzieht und für ihre Liebe in den Tod geht – ohne Aussicht auf ein persönliches Glück oder ehrenhafte Anerkennung durch ihre Familie. Gestrichen hatte Puccini auch jene Stelle im sog. „Liebesduett“ am Ende des ersten Aufzugs, in dem Cio-Cio-San selbstbewusst ihre die „Ehe auf Zeit“ überragende Liebe bekennt und für alle Konsequenzen dieser Entscheidung einsteht. So wurde aus einem selbst-bewussten ein naiver Charakter. Ähnlich ließ Puccini die Charaktere der Protagonistinnen Manon Lescaut und Mimì in La bohème von seinen Librettisten entschärfen – das belegen auch die Opern Manon von Jules Massenet (1884) und La bohème von Ruggero Leoncavallo, deren Textbücher die literatischen Vorlagen viel präziser und stimmiger dramatisieren.

12 13
überlänge?/ MAdAME BuTTERfLy
12
diE VERnunfT SucHT. ABER dAS HERz findET.
Die Geisha (Film, USA 2005) – Regie: Rob Marshall, Drehbuch: Robin Swicord
MAdAME BuTTERfLy \ geisHas vor Dem WirTscHafTsWunDer
Während der Meiji-Zeit (1868–1945) stand Japan als Kaiserreich in der Hochphase von Kolo-nialismus und Imperialismus unter dem Druck, sich durch technisch-industrielle Reformen sowohl innerhalb Asiens, als auch gegen die aufstrebende Weltmacht USA zu behaupten: Entscheidende Stationen waren die Abschaffung des Ständesystems, die Geldsteuer, die Iwakura-Mission mit dem Ergebnis einer nationalen Verfassung nach amerikanischem Vor-bild, die Übernahme des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches als Basis für die konstitutio-nelle Monarchie und nicht zuletzt die Siege über China in Korea und Russland in der See-schlacht bei Tsushima. ● ● ● In dieser historischen Periode war das Ansehen der Geisha ein anderes als das heute vermittelte. Früher, in den höfischen Perioden, und dann wieder nach der internationalen Anerkennung Japans betrachtete man Geishas als Repräsentantinnen traditioneller japanischer Kultur. Um 1900, zum Zeitpunkt der Handlung der Oper, waren Geishas auch aufgeschlossen für die Beschäftigung mit den Kulturen jener Länder, aus denen Japan Anregungen für die eigenen Reformen zog. ● ● ● Die Geisha mit den rituellen Wurzeln in den Strukturen einer archaischen Gesellschaft ist eine Fiktion aus der Perspektive des Westens ebenso wie die Titelfigur von Sydney Jones’ Operette Die Geisha (1897). Japan galt in Europa als Staat von traditioneller Grausamkeit, so ironisch überspitzt dargestellt in Gilbert & Sullivan’s Operette Der Mikado (1885).
1906 teilte Puccini den zweiten Teil von Madame Butterfly zwischen dem Summchor und dem Orchesterzwischenspiel, weil dieser mit etwa 90 Minuten Spieldauer als zu lange kritisiert wurde. Auch in vielen Aufführungen der üblichen Fassung werden heute der zweite und letzte Akt zusammengezogen und bezie-
hen sich auf Puccinis ursprüngliche Absicht, die quälende Situation der wartenden Cio-Cio-San durch die „reale“ zeitliche Dimension zu verdeutlichen. Durch den Verzicht auf die Soli von Cio-Cio-Sans alkoholisiertem Onkel Yukusidé entsteht in der kurzen Hochzeitsszene das nur wenig differenzierte Bild einer traditionsverhafteten Sippe, aus deren Starre die Titelheldin in die Verheißungen der „Schönen Neuen Welt“ flüchtet. ● ● ● In mehreren Schritten wurde die Begegnung der beiden Frauen, zu der Kate Pinkerton Cio-Cio-San Geld für den Sohn anbietet, und Pinkertons Anrede „Schnauze“ an Cio-Cio-Sans Diener im ersten Akt gestrichen. Der Arie „Che tua madre“ unterlegte man einen veränderten Text: Anstelle einer Vision Cio-Cio-Sans von der Glorifizierung ihres Sohnes steht an dieser Stelle die für Cio-Cio-San schreck-liche Vorstellung einer Rückkehr in das Leben einer heimatlosen Geisha.

14 15
erfolgsDruck/ MAdAME BuTTERfLy MAdAME BuTTERfLy \ liTerariscHe vorbilDer
David Belasco fand die Handlung für sein Drama in der Kurzgeschichte von John Luther Long (1861–1927), der allerdings nie selbst den Fernen Osten bereist hatte und die Stoffe für sein literarisches Schaffen aus Erzählungen seiner Schwester Sarah Jane nahm, die mit Dr. Irvin Henry Correll, dem Direktor der Chinzei-Gakkan-Knabenschule in Nagasaki, verheiratet war und aus ihrem Gastland zahlreiche Erlebnisse zu berichten hatte. ● ● ● Inspiriert war er auch durch den französischen Romancier Pierre Loti (1850–1923), der aus seinen Reisen in die Türkei, nach Japan, China und Jerusalem die Stoffe für seine Prosa gezogen hatte. Sein Roman Madame Chrysanthème (1887) bildet mit Japoneries de l'automne (Herbstliches Japan) und La troisième jeunesse de Mme. Prune (Die dritte Jugend der Madame Prune) eine Japan-Trilogie. Madame Chrysanthème wurde 1893 auch als Oper von André Messager an der Opéra-Comique in Paris ein Erfolg. ● ● ● Pierre Loti befindet sich an der Schwelle zwischen Reiseerzählung, Reisebericht und Symbolismus. Sein Roman von einer Ehe auf Zeit zwischen einem Franzo-sen und einer Japanerin endet so: Der Mann wird sentimental, die Frau prüft nüchtern ihr Honorar auf seine Echtheit. In einem übergeordneten Sinne ist dieses Ende auch eine Chiffre für die Unmöglichkeit einer dauerhaften Beziehung zwischen den Geschlechtern.
Puccini sah sich nach La bohème und Tosca einem enormen Erfolgsdruck ausgesetzt und wollte die gegenüber Komponisten wie Alberto Franchetti und Umberto Giordano errungene Spitzenstellung nach dem Tod Verdis 1901 nicht verlieren. Wie Richard Strauss war er äußerst skeptisch in der Auswahl seiner Sujets. ● ● ● Den Butterfly-Stoff lernte er in London in einer Aufführung des Stücks von David Belasco (1853–1931) kennen. Der jüdische Regisseur und Bühnenautor war in Hinblick auf Aufführungsstil und Sujets ein Pionier des jungen ameri-kanischen Theaters. Puccini zeigte sich besonders von der Lichtgestaltung der ausgedehnten Warteszene beeindruckt, die ihn zu dem umfangreichen symphonischen Block vom Summ-chor über das Intermezzo bis zum Matrosenchor inspirierte. Belascos Einakter Madame But-terfly – a tragedy of Japan (Uraufführung am 5. März 1900 im Herald Square Theatre/New York) entsprach dem ungewöhnlich langen zweiten Teil der Oper Puccinis. Ihm folgten die Librettisten Illica und Giacosa ziemlich genau, im ersten Aufzug zogen sie auch andere Quellen heran.

16 17
zWiscHen symbolismus unD naTuralismus/ MAdAME BuTTERfLy
die Falkenaugen des Leutnants waren jetzt fest auf seine Frau gerichtet. Er umfasste das Schwert mit beiden Händen, richtete sich ein wenig in den Hüften auf und neigte den Oberkörper über die Schwertspitze. Die Art, wie sich die Uniform über den Schultern spannte, verriet, dass er alle Kraft aufbot, als er die Klinge tief in die linke Bauchseite stieß.
Sein scharfer Aufschrei zerriss die Stille. ● ● ● Trotz der Kraft, die er aufgewendet hatte, kam es ihm vor, als hätte er selbst nichts getan; ein anderer schien ihm mit einem überaus scharfen Stoß eine dicke Eisenstange in den Leib gebohrt zu haben. Im ersten Augenblick schwindelte dem Leutnant derart, dass er nicht mehr klar denken konnte. Die Klinge war tief eingedrungen, bis zu der weißen Tischhülle, die er mit der Faust umklammert hielt. ● ● ● Das Schwindel-gefühl verflog. Der Leutnant war sicher, dass die Klinge die Magenwand durchbohrt hatte. Er atmete mühsam, sein Herz hämmerte, und irgendwo tief in ihm – in einer Körpergegend, die nicht mehr zu ihm zu gehören schien, wühlte ein furchtbarer Schmerz. Es war, als sei die Erde geborsten und speie einen kochenden Lavastrom aus. Mit erschreckender Geschwin-digkeit stieg der Schmerz höher und höher. Der Leutnant biss sich auf die Unterlippe und erstickte das Stöhnen, das sich ihm unwillkürlich entrang. ● ● ● Das also ist „Seppukru“, dachte er. Ringsum schien ein unvorstellbares Chaos zu herrschen; ihm war, als sei der Him-mel eingestürzt und die Erde wirble trunken umher. Seine Willenskraft und sein Mut, die er für gewaltig und unerschütterlich gehalten hatte, waren nun so weit zusammengeschrumpft,
der entstehungszeitgeschichtliche Kontext von Décadence und Sym-bolismus findet in der Betrachtung von Puccinis Madame Butterfly oftmals keine Erwähnung. Puccini selbst hatte sich mit Ausnahme seiner Frühopern Le Villi und Edgardo nach Alfred de Musset sowie Turandot, die der Stilrichtung des „Decantismo“ folgt, kein Sujet
jener Stilrichtungen gewählt, die das Spannungsfeld menschlicher Entfremdung von Frau und Mann im Bürgertum symbolisch überlagern. ● ● ● Doch durch die Quellenautoren Pierre Loti, John Luther Long und David Belasco sowie seinen Tagesmoden folgenden Librettisten Illica und Giacosa enthielt Puccinis Oper Ansätze zu aktuellen Analogien der Entstehungszeit. ● ● ● Auch an der Oper Madame Butterfly wird Puccinis Absicht deutlich: Er bemühte sich mit Erfolg um Originalität. Er wollte nicht polarisieren wie Richard Strauss mit Salome (1905) oder Claude Debussy mit Pelléas und Mélisande (1902), deren Partituren Puccini sehr genau studierte. ● ● ● Möglicherweise wurde Puccini zum erfolgreichsten Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts in Italien und darüber hinaus, weil er es instinkt- und geschäftssicher ver-stand, Moden und Innovationen in seinen Werken ausbalanciert zu publizieren. Madame Butterfly ist dafür ein ebenso plakatives wie hintergründig-raffiniertes Beispiel.
AM MAuLBEERBAuME nun MORGEn füR
MORGEn ScHOn diE ERSTEn BLäTTER!
Issa (1763 - 1827)
MAdAME BuTTERfLy \ Der eHrenvolle ToD

18 19
dass sie einem haarfeinen Stahlfaden glichen, und der Leutnant hatte das beängstigende Gefühl, er müsse sich, verzweifelt an diesen Faden geklammert, am Rande eines Abgrunds entlang tasten. Seine geballte Faust war feucht, und als er hinsah, entdeckte er, dass nicht nur die Hand, sondern auch das um die Klinge gewundene Tuch von Blut trieften. Das Lendentuch hatte sich ebenfalls dunkelrot gefärbt. Unglaublich, dass inmitten dieser Höllenqual sichtbare Dinge noch sichtbar und vorhandene Dinge noch vorhanden waren. Yukio Mishima aus der Erzählung Patriotismus
Vielen Dank für die Unterstützung beim Tag der offenen Tür am 31.08.2013 im Großen Haus des Volkstheaters Rostock:
P h i l h a r m o n i s c h e g e s e l l s c h a f t e . V.
iMpressuMVolkstheater Rostock GmbHSpielzeit 2013/2014/ Intendant Peter Leonard / Kaufmännischer Geschäftsführer Stefan Rosinski/ Redaktion Roland Dippel/ Konzept + Design usus.kommunikation, Berlin/ Layout und Satz Christiane Scholze/ Fotos Dorit Gätjen (Klavierhauptprobe am 01.10.2013)/ Quellen Basho und Issa www.djg.passau.de/japan-info/kirschbluetehaiku; Yukio Mishima: Tod im Hochsommer. Erzählungen (deutsch von Ulla Hengst); Reinbek b. H. 1986/ Zitat der Rückseite Die Geisha (Film, USA 2005) – Regie: Rob Marshall, Drehbuch: Robin Swicord/ Druck Druckerei Weidner GmbH/ Programmheft 1,00 2

KEinEM VOn unS BEGEGnET Auf
diESER wELT SO ViEL fREundLicHKEiT, wiE ER VERdiEnT.