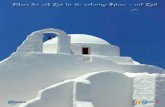Polyphenole: Vielseitige Pflanzeninhaltsstoffe
Transcript of Polyphenole: Vielseitige Pflanzeninhaltsstoffe

In Garten, Industrie, Medizin und Nahrung
Polyphenole: Vielseitige Pflanzen inhaltsstoffeNIKOLAI KUHNERT
Die Substanzklasse der Polyphenole gehört, vom Namenher, sicherlich zu den weniger bekannten Naturstoffen,
im Vergleich zu Proteinen, Fetten, Nukleinsäuren, Zuckernoder den Alkaloiden. Dennoch sind die der Gesundheit för-derlich geltenden Polyphenole jedermann als Antioxidan-tien geläufig.
Polyphenole zählen mengenmäßig zu den wichtigstenVerbindungsklassen in der Natur. Bezogen auf die gesamteBiomasse sind sie nach den Zuckern die zweithäufigsteGruppe aller organischen Verbindungen, mit einem Ge-samtanteil von etwa 30 % der Gesamtbiomasse auf der Er-de. Die meisten Polyphenole werden von Pflanzen produ-ziert. An ihrer Menge gemessen sind die wichtigsten Ver-
Alle Pflanzen stellen als Sekundärmetaboliten beachtlicheMengen an Polyphenolen her, die ihnen als Blütenfarbe, UV-Lichtschutz und Fraßschutz dienen. Polyphenole gelten alsgesund, da sie den Menschen vor Zivilisationskrankheiten wieHerz-Kreislauferkrankungen, Krebs oder Diabetes schützensollen. Doch welche Verbindungen sind für diese krankheits-vorbeugenden Wirkungen verantwortlich und wie wirken diese? Dieser Artikel fasst chemische, biologische und ernäh-rungswissenschaftliche Aspekte der Chemie der Polyphenolezusammen.
DOI: 10.1002/ciuz.201300589
80 © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Chem. Unserer Zeit, 2013, 47, 80 – 91
Punicalagin ausGranatapfel, Cynarin aus Arti-schocke undTheaflavindigal-lat aus schwar-zem Tee sind Bei-spiele für gesund-heitsförderlichePolyphenole.
O
O
O
O
HO
HO
OH
OH
OO
OO
OOH
HO
HOOH
HO
HOOH
OHHO
HO
OHOHHO
O
O
O
O
O O
OHOH
HOOHOOC
O O
OHOH
OHOH
O
OH
OH
OH
O
O
O
O
OH
HO
HO
HO
O
O
HOOH
HO
OH
OHOH

P O LY P H E N O L E N AT U R S TO F F E
treter Holz (chemisch: Lignin, ein Copolymer aus Zuckernund Polyphenolen) und Huminsäure, das Abbauprodukt vonabgestorbenen Pflanzenteilen. Neben Lignin und Humin-säure produzieren alle Pflanzen auch eine große Anzahl nie-dermolekularer Polyphenole mit einem Molekulargewichtvon unter 1000 Da. Etwa 6000 unterschiedliche chemischeVerbindungen dieses Typs sind bisher entdeckt worden.
Für uns Menschen spielen Polyphenole besonders inder Nahrung eine wichtige Rolle. Der Mensch als Alleses-ser nimmt täglich mit pflanzlicher Nahrung ungefähr 10 gPolyphenole zu sich. Seit vielen Jahrhunderten ist bekannt,dass ein hoher Anteil an pflanzlicher Nahrung, vor allemObst und Gemüse gesund ist. In den letzten beiden Jahr-zehnten wurde dieses überlieferte Wissen wissenschaftlichüberprüft, mit dem Ergebnis, dass der Verzehr von größe-ren Mengen an Obst und Gemüse zu einer Reduktion desAuftretens von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Osteo-porose oder Diabetes führt. Als Verursacher dieses positi-ven Gesundheitseffektes wurden neben Vitaminen und Mi-neralien hauptsächlich Polyphenole identifiziert. Daher sollin diesem Aufsatz der Stand des Wissens über Polyphenolegegeben und ein besonderer Schwerpunkt auf die Poly-
phenole in der menschlichen Nahrung und deren Wirkungauf die menschliche Gesundheit gesetzt werden.
Polyphenole: Eine DefinitionWas ist ein Polyphenol? Ein Phenol ist zunächst einmal einaromatischer Alkohol (Struktur 1 in Abbildung 1), d.h. ei-ne chemische Verbindung mit einem aromatischen Ben-zolring und einer alkoholischen OH-Gruppe. Sind in einerchemischen Verbindung mehrere solcher Ringe vorhandenwie in Theaflavindigallat 2 aus schwarzem Tee, so sprichtman von einem Polyphenol (von Griechisch: „poly“ fürviel). In der Natur stellen Pflanzen viele Verbindungen her,die bis zu 30 solcher aromatischen Phenolgruppen enthal-ten können.
Zumeist findet man am aromatischen Ring nicht nur ei-ne OH-Gruppe, sondern zwei bis vier. Verbindungen, dieein Molekulargewicht über 600 Da haben und mehr als zweiPhenolringe tragen, werden als Polyphenole bezeichnet.Verbindungen mit einem oder zwei Ringen sollten korrek-terweise als Phenole bezeichnet werden, fälschlicherweisewerden diese jedoch zumeist auch den Polyphenolen zu-geordnet [1].
Chem. Unserer Zeit, 2013, 47, 80 – 91 www.chiuz.de © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 81
R
OO
R
OO
H
R
OO
Mn+
MetallionenChelatkomplexe
R
OO
H
H
R
OO-
HNu
El
El
Nu
PhenolischeUmpolungPhenolatanion
Phenoxyradikal
- H+
- H
- Elektron
- H
- H+
- 2 Elektronen
Mn+
O
OH
OH
OH
O
O
O
O
OH
HO
HO
HO
O
O
HOOH
HO
OH
OHOH
2
OH
Ein PolyphenolTheaflavindigallataus schwarzem Tee
1Phenol
3
4
5
6
7
R
OO
H
HUV Absorption
270-320 nm
H-Donor
H-Akzeptor
Hydrophobπ-Wechselwirkungen
3
A B B . 1 PH E N O L E : S T R U K T U R E N U N D R E A K T I V I T Ä T E N
Chemische Struktur von Phenol und eines Polyphenols und grundlegende chemische Reaktivitäten von Phenolen

Warum stellen Pflanzen Polyphenole her?Ausnahmslos alle Pflanzen stellen Polyphenole in fast allenPflanzenteilen her. Den höchsten Anteil findet man in Blät-tern und Früchten. Der primäre Nutzen der Polyphenole fürdie Pflanzen ergibt sich aus ihrer Fähigkeit, UV-Licht zu ab-sorbieren [1, 2]. Somit schützen Polyphenole die Pflanzenauf der Erde vor schädlichem, zerstörerischem UV-Licht.
Generell unterscheidet man zwei Verbindungsklassennach ihrer Fähigkeit, die Pflanzen vor UV-Licht zu schützen:zum einen die Flavonoide, die im Bereich von 220–300 nmabsorbieren und die Pflanze vor UV-A-Licht schützen, undzum anderen die Hydroxyzimtsäuren, die im Bereich von
300–350 nm absorbieren und die Pflanzen vor UV-B-Lichtschützen.
Gestützt auf genetische Untersuchungen wird ange-nommen, dass pflanzliche Lebewesen auf der Erde, als die-se das Wasser der Ozeane verließen und sich an Land an-siedelten, einen UV-Schutz benötigten. Dieser Selektions-druck führte zunächst zu der Fähigkeit, Polyphenole zubilden. Tiere und auch der Mensch haben allerdings im Lau-fe der Evolution weitestgehend die genetische Informationverloren, um Polyphenole biosynthetisch herzustellen. DerGrund hierfür war die Entwicklung einer vor UV-Strahlungschützenden Haut. Trotz allem nutzen wir aber immer noch
82 © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.chiuz.de Chem. Unserer Zeit, 2013, 47, 80 – 91
HOOC
OH
OH HOOC
OH
OMe HOOC
OH
OH
O
O
HO
HO
OH OH
OHO
HOOC
O
OH
OHO O
OHOH
HOOC
O O
OHOH
OHOH
O
COOHHOOC
OOO
OHHO HO OH
Kaffeesäure Ferulasäure Rosmarinsäure
5-Caffeoyl-Chinasäure(Chlorogensäure aus Kaffee)
Cynarin(aus Artischocke)
Chicoreesäure
8 9
1011
12
13
O
OH
HO
OH
OH
OHO
O
HO
OH
OH
OH
O
OH
OH
OH
OH
O
OH
HO
OH
OH
OH
OHO
OH
OH
OH
OHHO
OH
OH
OH
O
O
O
HO OH
OH
Quercetin(Äpfel und Zwiebeln)
Naringenin(Citrusfrüchte)
Luteolin
Resveratrol(aus rotem Wein)
OHO
OH OOH
Genestein(aus Soja)
1415
16
1718
19
20
Epicatechin(aus grünem Tee und Cacoa) Epigallocatechingallat
(aus grünem Tee)
A B B . 2 CHEMISCHE STRUK TUREN VO N HYDROX Y ZIMTSÄURED ERIVATEN 8–13 UND FLAVONOIDEN 14–1 9

P O LY P H E N O L E N AT U R S TO F F E
deren Fähigkeit, UV-Licht zu absorbieren, denn das schüt-zende Hautpigment Melanin ist ein Oxidationsprodukt derphenolischen Aminosäure Tyrosin.
Im Laufe der Evolution haben Pflanzen sich einer gan-zen Reihe weiterer Eigenschaften der Polyphenole zu Nut-zen gemacht und optimiert. So schützen PolyphenolePflanzen vor Fraßfeinden, sowohl vor Mikroorganismenwie Bakterien und Viren, als auch vor größeren Pflanzen-fressern. Das ist u.a. bedingt durch ihren schlechten Ge-schmack (mehr dazu später). Polyphenole kommen wei-terhin als Blütenfarbstoffe und Farbpigmente in allen Pflan-zenteilen zum Einsatz oder sind in der Lage, Insekten
anzulocken (z.B. die 5-Caffeoylchinasäure 10 in Abbil-dung 2).
Chemische EigenschaftenPolyphenole sind per Definition Verbindungen mit vielen aro-matischen Ringen mit vielen OH-Gruppen. Da eine OH-Grup-pe einen aromatischen Ring durch ihre freien Elektronenpaareelektronenreich macht, sind generell alle Polyphenole 3 sehrgute Nucleophile und lassen sich leicht oxidieren. Da sieElektronen abgeben, wirken sie reduktiv oder anders ausge-drückt als Antioxidantien. Letzteres ist einer der Gründe, wa-rum sie in Lebensmitteln verwendet werden. (Abbildung 1).
Chem. Unserer Zeit, 2013, 47, 80 – 91 www.chiuz.de © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 83
O
OH
HO
OH
OH
OH
O
OH
HO
OH
OH
OH
O
OH
HO
OH
OH
OH
OHO
OHHO
OHHO
O
O
HO
OH
OH
O
OH
HO
OH
OH
OH
OH
O
OH
HO
OH
OH
OH
O
OH
HO
OH
OH
OH
23
24
25
Proanthocyanidin B Proanthocyanidin A
Tetrameres ProanthcyanidinHydrolysierbare Tannine
OHO
O
OHOH
O
OHOO
OOH
O
OHOH
HO
HO
HO
OH
O
OO
HO
HOOH
OH
O
O
O
OHOH
OH
OHO
HO
HO
OH26 27
Galloylglucose Ellagitannin
Nicht hydrolysierbare Tannine
A B B . 3 C H E M I S C H E S T R U K T U R E N VO N TA N N I N E N 2 1 – 2 7

Polyphenole sind chemisch sehr reaktive Verbindungenmit einer ganzen Reihe von bemerkenswerten Eigenschaf-ten [1, 2]. So sind sie in der Lage, mit Metallionen Chelat-komplexe 4 zu bilden. Darüber hinaus ist der Wasserstoffan der phenolischen OH-Gruppe für die besonderen che-mischen Eigenschaften dieser Substanzklasse verantwort-lich. Dieser Wasserstoff lässt sich chemisch auf zweierleiWeise – im Rahmen einer Säure-Base-Reaktion oder radika-lisch – leicht entfernen. Phenole weisen einen niedrigerenpKs-Wert auf (sie reagieren saurer) als konventionelle Al-kohole wie Ethanol, d.h. das Proton kann relativ leichtdurch eine Base abgespalten werden. Unterstützt wird die-se Reaktion durch die chemische Struktur der zugrunde lie-genden Verbindung, die die entstehende negative Ladung(Phenolation 6) mit Hilfe des aromatischen Rings durch Resonanz stabilisieren kann. Wird der Wasserstoff radika-lisch abgespalten, bleibt am Phenolsauerstoff ein freies, un-gepaartes Elektron zurück (in 5). Wie schon bei der Säure-Base-Reaktion spielt auch hier die Resonanzstabilisierung –in diesem Falle des Radikals – eine wichtige Rolle. Aufgrundder dadurch bedingten Stabilität des Radikals wird ein Phe-nol zu einem guten Reaktionspartner für andere Radikale.
Diese Eigenschaft ist umso ausgeprägter je mehr OH-Gruppen sich am aromatischen Ring befinden. Sowohl dasPhenoxyradikal 5 als auch das Phenolatanion 6 können ineinem weiteren Oxidationsschritt zu einem ortho-Chinon7 oxidiert werden. Dieses wiederum ist ein reaktives Elek-trophil, welches mit nucleophilen Zellkomponenten rea-gieren kann. Durch Oxidation wird somit die chemischeReaktivität des Phenols von einem Nucleophil in ein Elek-trophil geändert und somit eine Umpolung der Reaktivitäterreicht. Diese Reaktionsfolge führt dazu, dass Phenole mit-einander reagieren und unter Ausbildung neuer C-C-Bin-dungen oligomerisieren und polymerisieren, eine Reaktiondie vor allem bei der Bildung von Lignin wichtig ist.
Des Weiteren besitzen alle Phenole mit ihren OH-Grup-pen die Möglichkeit, Wasserstoffbrückenbindungen mit an-deren biologischen Molekülen einzugehen. Ihr elektronen-reicher, aromatischer Ring erlaubt Wechselwirkungen mitKationen und anderen aromatischen Ringen. Als Konse-quenz stehen Polyphenole vor allem mit Proteinen in Wech-selwirkung. Aufgrund dieser „verbindenden“ Eigenschaft
können Phenole auch als natürliche „Klebstoffe“ für Pro-teine bezeichnet werden.
Ihre chemische Natur, vor allem die hohe Reaktivitätund Neigung, mit anderen Stoffklassen zu interagieren, er-schwert die experimentelle Arbeit mit Polyphenolen. Poly-phenole gelten daher unter Naturstoffchemikern als äußerstschwierig und als sehr undankbar für die wissenschaftlicheProduktivität. Dies mag ein Grund sein, warum sich heutenur sehr wenige chemische Arbeitsgruppen mit der Poly-phenolchemie beschäftigen – trotz ihrer großen Relevanz.
StoffklassenPolyphenole lassen sich auf viele Arten klassifizieren. Mankann sie nach der Funktion (UV-A- und UV-B-Schutz) odernach ihrer chemischen Struktur (groß oder klein, Zahl derPhenolringe etc.) einteilen.
Für einen Chemiker am sinnvollsten ist die Einteilungnach den chemischen Eigenschaften und der Grundstruk-tur, wie sie sich aus der Biosynthese ableitet. So werden diePhenole in Hydroxyzimtsäuren (mit 9 C-Atomen), Fla-vonoiden (mit 15 C-Atomen) und Tanninen (mit vielen C-Atomen) unterschieden (Abbildung 3). Diese werden wie-derum in Unterklassen eingeteilt: bei den Hydroxyzimtsäu-ren gibt es freie Säuren wie die Kaffeesäure 8 (derTrivialname der Verbindung verrät in der Regel ihre Her-kunft), oder die Ferulasäure 9, oder Ester der Kaffesäure wieChlorogensäure 10, Cynarin 11 oder Chicorreesäure 12 wieauch andere Verknüpfungsprodukte wie die Rosmarinsäu-re 13. Bei den Flavonoiden unterscheidet man nach Oxi-dationsgrad des ungesättigten Pyranringes, so gibt es Fla-vanole (mit OH-Gruppen z.B. Epicatechin 14 oder Epigal-locatechingallat 15), Flavanone (mit C=O-Gruppen, z. B.Luteolin 16) oder Flavanolone (z.B. Quercitin 17), offen-kettige Derivate (z.B. Naringenin 18) oder isomere Isofla-vone wie Genestein 19.
Eine wichtige Verbindung wie das Stilben Resveratrol 20lässt sich allerdings nicht in eine dieser Klassen einordnen.Die Tannine (Abbildung 3) teilt man ein in hydrolysierbareTannine wie 21 und 22 (diese können durch Base in klei-nere Moleküle gespalten werden) und nicht-hydrolysierba-re Tannine wie 23-25, die durch Oxidation aus Flavanolen14 entstehen. Die Nomenklatur ist verwirrend und zum Teil
84 © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.chiuz.de Chem. Unserer Zeit, 2013, 47, 80 – 91
O
OGlc
HO
OGlc
OHO
O
OGlc
HO
OGlc
OHOH
O
OGlc
HO
OGlc
OHOH
OH
- H+
+H2O
Mg2+
blaues Pigment
)reuas hcawhcs( ttelovi)reuas( rot farblos (neutral)
Cyanin
2829
30
A B B . 4 S T R U K T U R U N D FA R BV E R Ä N D E R U N G E N VO N A N T H O C YA N I N E N A L S P F L A N Z E N PI G M E N T E

P O LY P H E N O L E N AT U R S TO F F E
chaotisch, da sie historisch gewachsen und leider nie sys-tematisiert wurde.
Analyse und StrukturaufklärungWie bei anderen Naturstoffen steht am Anfang der Struk-turaufklärung immer die chemische Trennung. Diese wirdmeist durch Flüssigkeitschromatographie unter Verwen-dung unterschiedlicher Säulenmaterialien durchgeführt.Nach Isolierung der Reinverbindung aus Pflanzenmaterialwird deren Struktur durch moderne spektroskopische Me-thoden wie NMR-, IR-, UV-/Vis-Spektroskopie und Massen-spektrometrie aufgeklärt.
Polyphenole sind jedoch, wie erwähnt, schwierig zuhandhabende Verbindungen. Zum einen sind sie sehr re-aktiv, so dass bei allen analytischen Schritten Vorkehrun-gen getroffen werden müssen, um ihre Zersetzung zu ver-hindern. Zum anderen kommt in Pflanzen mitunter einegroße Anzahl von Verbindungen (im Durchschnitt um die50) vor. Der Rekordhalter in dieser Hinsicht ist die Kaffee-pflanze (Caffea conifera), die allein 120 verschiedene phe-nolische Chlorogensäuren bilden kann (Isomere von 10 und11) [3].
Meist handelt es sich zudem bei dieser großen Anzahlan Verbindungen um Isomere, d.h. chemische Strukturenmit identischer Summenformel, aber unterschiedlicherräumlicher Anordnung der Substituenten. Diese Diversitäterschwert nicht nur die Isolierung und Reinigung von Ein-
zelverbindungen, sondern stellt auch immense Herausfor-derungen an die Strukturaufklärungsmethoden.
In den letzten Jahren hat sich vor allem die Massen-spektrometrie (MS) als ideale Methode zur Charakterisie-rung von Polyphenolen erwiesen. Sie besitzt das höchsteAuflösungsvermögen aller verfügbaren analytischen Me-thoden; eine sehr große Anzahl an Verbindungen kann ineinem einzigen Experiment gleichzeitig und sehr empfind-lich detektiert werden. Die Massenspektrometrie eignetsich darüber hinaus hervorragend zur Kopplung mit chro-matographischen Trenntechniken (LC-MS-Methoden). Sokönnen in einem LC-MS-Experiment Hunderte von Verbin-dungen getrennt, durch Massenspektrometrie ihre Sum-menformel bestimmt und im Anschluss durch Fragmentie-rungsexperimente an Hand der resultierenden Spektren ih-re Struktur bestimmt werden. Selbst zur Zuordnung vonisomeren Verbindungen existieren bereits einige zuverläs-sige MS-Methoden [4].
Polyphenole im AlltagDurch ihre chemische Struktur und den daraus abgeleitetenEigenschaften haben Polyphenole eine Reihe interessanterindustrieller Anwendungen gefunden. Ihre Eigenschaft, sichstark an Proteine zu binden und diese zu denaturieren, d.h.unlöslich zu machen, wird z.B. in der Lederherstellung aus-genutzt. Die Tierhaut wird hierbei mit phenolischen Gerb-stoffen behandelt. Dies führt zur Bindung der Phenole an
Chem. Unserer Zeit, 2013, 47, 80 – 91 www.chiuz.de © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 85
Polyphenole
Hydroxyzimtsäuren (8-12 s. Abb. 2)
Tannine (23-27 s. Abb. 3)
Proanthocyanidine und Anthocyane (23-25 s. Abb. 3)
Flavone (18 s. Abb. 2)
Flavanole (16-17 s. Abb. 2)
Catechine (14-15 s. Abb. 2)
Isoflavone 19
A B B . 5 PH E N O L I S C H E S TO F F K L A SS E N I N AU S G E W Ä H LT E N N A H R U N G S M I T T E L N

die Proteine in der Tierhaut, wobei diese ausgefällt werdenund es zu Ausbildung von Leder kommt. Die Möglichkeit,Proteine zu fällen, wird auch bei der Bierherstellung ge-nutzt. Durch den Zusatz von Polyphenolen zu naturtrübemBier werden Proteine denaturiert und ausgefällt und könnenanschließend leicht abfiltriert werden [1].
Auch auf der menschlichen Zunge sind Polyphenole inder Lage, Proteine zu fällen, insbesondere sogenannte ungeordnete Speichelproteine. Die Fällung dieser Spei-chelproteine wird vom Menschen als Adstringenz (lat. ad-stringere = zusammenziehen), d.h. der Ausbildung einesrauhen pelzigen Mundgefühls, wahrgenommen. Viele Po-lyphenole interagieren zudem mit den Bitterrezeptoren aufder Zunge. Wahrscheinlich wollten Pflanzen diesen Effektnutzen, um Pflanzenfresser am Verzehr phenolreicher Pflan-zenteile zu hindern. Viele Menschen und auch Tiere habensich jedoch an Adstringenz und bitteren Geschmack ge-wöhnt und sie zum Teil sogar schätzen gelernt.
Weiterhin findet man jede Menge Polyphenole im eige-nen Garten in Form von Blütenfarbstoffen [5]. Viele Phenoleder Verbindungsklasse der Anthocyanine sind farbig undkommen in Pflanzen als Blütenfarbstoffe oder auch als Pig-mente in anderen Pflanzenteilen vor – z.B. rot, blau undschwarz in den Johannis-, Heidel-, Brom-, Him- oder Preis-selbeeren, auch das Rot in Rote Beete oder Rotkohl und inApfelschalen.
Die Polyphenole verändern hierbei ihre Farbe abhängigvom pH-Wert ihrer Umgebung, genauso wie Lackmus oderandere pH-Indikatoren (Abbildung 4). Weiterhin könnenFarbänderungen durch Komplexierung von Anthocyanenmit Metallionen wie Magnesium, Aluminium, Kalium oderEisen oder auch durch Copigmentierung erzeugt werden.Hierbei lagern sich die Anthocyanfarbstoffe an andere Po-lyphenole wie Flavonoide an. Somit sind viele Blumendurch leichte Veränderungen des pH-Wertes in der Lage, An-reicherung von Metallionen oder Copigmentierung in derBlüte, mehrere Farben gleichzeitig zu realisieren. Ein zwei-farbiges Stiefmütterchen benutzt also denselben Farbstoff,stellt allerdings den pH-Wert in unterschiedlichen Teilender Blüte unterschiedlich ein, während eine rote Rose und
die blaue Kornblume denselben Farbstoff Cyanin 28 ent-halten, in der Kornblume die blaue Farbe jedoch durchKomplexierung an Magnesium gebildet wird.
Viele Blumen eignen sich somit zur pH-Wert-Messungdes Bodens. Besonders bei Bauernhortensien ist dieses Phä-nomen zu beobachten. Wer eine blaue Hortensie kauft undsie in schwach sauren (pH 6) Boden einpflanzt, kann imnächsten Jahr eine rote Blüte erwarten.
Polyphenole und die menschliche GesundheitWoher wissen wir, dass Polyphenole gesund sind? Die ers-ten Hinweise hierzu ergaben sich historisch aus epidemio-logischen Studien [6]. In ihnen erfassen Statistiker die Häu-figkeit des Auftretens bestimmter Krankheiten in großenBevölkerungsgruppen. Beobachtet man nun in einer Be-völkerungsgruppe eine Verringerung des Auftretens vonHerz- Kreislauferkrankungen, Krebs oder Diabetes, kann eshierfür prinzipiell drei Ursachen geben.
Erstens: Die Bevölkerungsgruppen sind genetisch un-terschiedlich – so leiden Bewohner des Indischen Subkon-tinents häufiger unter Herz-Kreislauferkrankungen als Eu-ropäer oder Asiaten, sie vertragen schlechter Milchprodukteund Alkohol als Europäer.
Zweitens: Eine Bevölkerungsgruppe leidet unter widri-gen Umwelteinflüssen z.B. unter starker Luft- oder Wasser-verschmutzung,
Drittens: Es könnte an der Nahrung liegen. Besteht derVerdacht einer Reduktion bestimmter Krankheiten, so kanndas auf Ernährungsgewohnheiten zurückzuführen sein. Be-legt werden kann dies mit epidemiologischen Studien, in-dem man die Krankheitshäufigkeit mit dem Nahrungs -mittelverbrauch korreliert. Als Ergebnis einer solchen Untersuchung erhält der Epidemiologe eine statistischeWahrscheinlichkeit, die den Zusammenhang zwischen demVerzehr eines Lebensmittels mit der Verminderung oder derErhöhung des Auftretens einer bestimmten Krankheit zeigt.
Aus den epidemiologischen Studien ergibt sich aller-dings kein kausaler Zusammenhang, sondern nur eine sta-tistische prozentuale Wahrscheinlichkeit, mit der Krankheitund Ernährung zusammenhängen. Selbstverständlich erhältman hieraus auch keine Information über die chemischenVerbindungen, die für diesen Effekt verantwortlich sindoder den Wirkmechanismus der hinter den Effekten steckt.
Die älteste bekannte epidemiologische Studie zum The-ma Polyphenole stammt aus dem Jahre 1934. Desire Cor-dier, Gründer eines berühmten Weinhauses, stellte fest, dassin der Provinz Bordeaux mehr Hundertjährige lebten als ir-gendwo sonst im Lande und organisierte ein „longue vie-Festival“ unter dem Motto „Wein, das Elixier des Lebens“(auch heute noch leben in Frankreich mehr Hundertjährigein Europa als in jedem anderen Land; zum Vergleich: von10 000 Menschen 102 in Frankreich und nur 45 in Deutsch-land). Die beiden berühmtesten dieser Studien sind die „Zut-phen Elderly Study“ und die „French Paradoxon Study“. Inder Zutphen Studie wurde in den 1990er Jahren erstmals inder niederländischen Stadt Zutphen der statistische Zusam-
86 © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.chiuz.de Chem. Unserer Zeit, 2013, 47, 80 – 91
Zeit [h]
Konzentration
tmax
Cmax
A B B . 6 B I OV E R F Ü G BA R K E I T . . .
... von Polyphenolen. Stoffkonzentration gemessen im Humanplasma.

P O LY P H E N O L E N AT U R S TO F F E
menhang belegt, dass eine Nahrung, die reich an Obst undGemüse ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs redu-ziert. In der French Paradoxon Studie konnte gezeigt wer-den, dass die Franzosen in Europa eine der geringsten Häu-figkeiten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufweisen, obwohlsie sich relativ fettreich ernähren. Die Reduktion der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und somit eine gesteigerte Lebens-erwartung wurde auf den hohen Konsum von Rotwein zu-rückgeführt, der besonders reich an Polyphenolen ist undspeziell auf dessen Hauptinhaltsstoff Resveratrol 20.
Nach der Arbeit der Epidemiologen bedarf es nun zwei-er weiterer Schritte, um einen Zusammenhang zwischenErnährung und Gesundheit herzustellen. Als nächstenSchritt werden in der Regel klinische Interventionsstudiendurchgeführt. Hierbei werden menschliche Versuchsper-sonen (Tiermodelle sind natürlich auch möglich, aber nichtso aussagekräftig) mit ausgewählten Lebensmitteln oder Le-bensmittelinhaltsstoffen ernährt und im Anschluss eine Rei-he messbarer physiologisch relevanter Parameter bestimmt.Beispielsweise ließ sich zeigen, dass der regelmäßige Kon-sum von grünem Tee oder Schokolade zu einer Reduktiondes Blutdrucks, zu einer Erhöhung der Blutdurchflussge-schwindigkeit und zu einer Verminderung von Entzün-dungsmarkern im Blut führte. Ebenso konnte der Konsumvon Kaffee mit einer Absenkung des Blutzuckerspiegels inVerbindung gebracht werden [6].
In einem letzten wissenschaftlichen Schritt muss die fürden Gesundheitseffekt verantwortliche chemische Verbin-dung aus dem Nahrungsmittel identifiziert, isoliert und ihrWirkmechanismus aufgeklärt werden. Dies ist die gemein-same Aufgabe von Chemikern, Biochemikern und Pharma-kologen.
Entdeckung biologisch aktiver SubstanzenDie nächste Frage ist, wie ein Chemiker die für die mensch-liche Gesundheit relevanten Polyphenole identifiziert.
Im ersten Schritt müssen alle in der Pflanze in Fragekommenden Verbindungen getrennt, isoliert und ihre che-mische Struktur bestimmt werden. Mit den aufgereinigten
Substanzen lassen sich in vitro Enzymassays oder anderebiologische Tests durchführen, die einen Hinweis auf die Re-levanz der Verbindung und ihren möglichen Wirkmecha-nismus geben. Die Vorgehensweise ist hierbei vergleichbarmit der Wirkstoffentwicklung in der pharmazeutischen In-dustrie. Allerdings gibt es einen wichtigen Unterschied. DerPharmaforscher kennt zumindest meist sein biologischesZielmolekül (z.B. ein Enzym oder einen Rezeptor, der ir-gendetwas mit der Krankheit zu tun hat und zu Beginn derForschungsaktivitäten aus eben diesen Grund gezielt aus-gewählt wurde), welches er mit einem neuen Wirkstoff in-hibieren möchte, der Lebensmittelforscher dagegen leidernicht, so dass seine Aufgabe eher der Suche nach einer sehrkleinen Nadel in sehr vielen Heuhaufen gleicht.
Trotzdem gelang es in den letzten zwei Jahrzehnten, eine Reihe von biologisch aktiven Polyphenolen zu identi-fizieren, die bestimmte Enzyme im menschlichen Körperinhibieren können. So konnte gezeigt werden, dass Quer-cetin 17 die Phosphoinositid-3-Kinase und die Toposiso-merase II, EGCG 15 die DNA-Methyltransferasen 1 und 3ainhibieren oder Chlorogensäuren 10 mehrere Enzyme desZuckerstoffwechsels inhibieren.
Polyphenole in der NahrungAlle Pflanzen stellen größere Mengen an Polyphenolen her.Der menschliche Konsum dieser Verbindungen wird auf un-gefähr 10 g am Tag geschätzt [1, 6]. Welche Nahrungsmit-tel sind gute Polyphenolquellen, welche Strukturen sind be-sonders dominant vertreten und wie bestimmt man sie? Da-zu werden zwei grundsätzliche Methoden angewendet.Zum einen lässt sich eine Gruppenbestimmung aller phe-nolischen Verbindungen durchführen; dazu verwendet mandas Folin-Ciocalteu-Reagenz, eine Mischung aus Phospho-molybdat und Tungstat, welches sich in Gegenwart vonPhenolen blau verfärbt und somit eine Bestimmung des Ge-samtphenolgehaltes erlaubt. Alternativ können alle unter-schiedlichen Phenole in einer Pflanze durch Chromatogra-phie getrennt und im Anschluss durch UV- oder Massen-spektrometrie einzeln quantifiziert werden.
Chem. Unserer Zeit, 2013, 47, 80 – 91 www.chiuz.de © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 87
OH OH
OHO
HOOC
O
OH
OHOH
O
OH
OH
OH
O
OH
O
OHOOC
HOHO
OH
OH
O
OH
OMe
OH
O
OSO3H
OHMetabolismusvermittelt durch Darmflora
10
31 32
33
34
A B B . 7 K A F F E E- M E TA B O L I T E
Darmflorametabolite der 5-Caffeoylchinasäure detektiert in Blutplasma von Kaffeetrinkern.

Der Rekordhalter unter dem Obst in Sachen absoluterPolyphenolgehalt ist der Granatapfel. Dieser zeigt im Folin-Ciolcateu-Test den höchsten bislang bekannten Gesamt-phenolgehalt, gefolgt von grünem Tee und Kaffee. AndereFrüchte mit hohem Phenolgehalt sind Äpfel, Zwiebeln, Bee-ren, Artischocken, Tomaten, Mandeln oder Aprikosen. Einhoher Phenolgehalt lässt sich auch für den Laien leicht ander Tendenz einer Pflanze zur Braunfärbung erkennen. DieBraunfärbung ist eine Oxidationsreaktion von Phenolen,die z.B. nach Zerstörung des Pflanzengewebes durch dasAuseinanderschneiden von Äpfeln abläuft. Wirft man einenBlick auf die Gesamtmenge an Phenolen, die der durch-schnittliche Europäer jeden Tag zu sich nimmt, so ergibtsich für die unterschiedlichen Nahrungsmittel das folgende,eher überraschende Bild (Abbildung 5) Kaffee > Frucht säfte> Tee (grün und schwarz) > Schokolade > Rotwein ≥Obst≥ Gemüse ≥ Cerealien ≥ Andere.
Dem an detaillierten Daten interessierten Leser sei andieser Stelle die Datenbank Phenol Explorer empfohlen,der alle derzeit verfügbaren quantitativen Daten zu Poly-phenolen in Lebensmittel enthält [7].
BioverfügbarkeitMit einem Lebensmittelinhaltsstoff verhält es sich genausowie mit einem Arzneimittel. Um seine Wirkung zu entfalten,muss die Verbindung aus dem menschlichen Verdauungs-trakt in die Blutbahn aufgenommen werden und von dortan ihren Wirkort (ein bestimmtes Organ oder Gewebe) ge-bracht werden. Ist dies der Fall, bezeichnet man eine Ver-bindung als bioverfügbar.
Obwohl die Wirkung von einigen Polyphenolen aufmenschliche Enzyme schon lange bekannt war, begann dieUntersuchung ihrer Bioverfügbarkeit erst in den letzten
10 Jahren. Das Ergebnis war sehr überraschend, denn aufder Basis dieser Studien zeigen nur ganz wenige Polyphe-nole aus der menschlichen Nahrung eine hinreichende Bio-verfügbarkeit. Diese wird als Cmax-Parameter angegeben undbeschreibt die maximale Plasmakonzentration der Verbin-dung im Blut nach dem Verzehr. Aus der Zeit tmax ,bei derCmax auftritt, lässt sich schließen, in welchem Teil des Ver-dauungsapparates die Verbindung aufgenommen wurde(z.B. 5–10 min im Mund, bis 30 min im Magen, 30 min–2 him Dünndarn, 2–10 h im Dickdarm) (Abbildung 6).
Obere Cmax-Werte liegen im Bereich von 1–2 µM z.B. fürdie isoflavonen Genesteine und Daidzeine aus Soja. Diemeisten Werte liegen allerdings im nanomolaren Bereich,und viele Polyphenole wie die Anthocyanidine aus Beerenoder die Proanthocyanidine aus Rotwein zeigen fast keineBioverfügbarkeit. Für alle diese Verbindungen ist es alsokomplett irrelevant, ob sie in einem Enzymtest eine tolleWirkung zeigen, denn sie erreichen das menschliche Blutnie [6]! Dennoch ist unbestritten, dass die polyphenolhal-tigen Lebensmittel eine Wirkung zeigen.
Antioxidantien und RadikalfängerAlle Polyphenole sind bedingt durch ihre chemische Struk-tur elektronenreich. Sie lassen sich somit leicht oxidierenund sind allesamt Antioxidantien. Sie lassen sich durch Oxi-dation in stabile Radikale überführen und sind somit in derLage, schädliche biologische Radikale abzufangen (siehe Ab-bildung 1 und vorherige Diskussion). Radikale wie das Hy-droxylradikal •OH und das Peroxidradikal •OOH entstehenbei der Zellatmung in jeder Zelle, dazu vermehrt bei Rau-chern und können als Folge die Zelle schädigen, indem siebeispielsweise DNA mutieren oder Proteine und Lipide zer-stören und dadurch zu Krankheiten führen. Antioxidantienentfalten ihre positve Wirkung durch Abfangen freiwer-dender Radikale (Antioxidantienhypothese).
In den letzten Jahrzehnten wurde die Antioxidantien-hypothese zur Erklärung der positiven Wirkung der Poly-phenole auf die menschliche Gesundheit herangezogen. Siewird weiterhin von der Lebensmittelindustrie und den Her-stellern von Nahrungsergänzungsmitteln als erfolgreicherWerbeträger zur Vermarktung poylphenolreicher Nah-rungsmittel und Produkte eingesetzt.
Leider ist sie meiner Meinung nach falsch. Warum ist dasso? Die Polyphenole zeigen eine sehr geringe Bioverfüg-barkeit. Generell gilt, je polarer ein Polyphenol, desto bes-ser ist seine Wirkung als Antioxidans. Dies steht allerdingsnicht im Einklang mit seiner Bioverfügbarkeit. Hier verhältes sich genau umgekehrt: Wasserlösliche (polare) Verbin-dungen können nur schwerlich die lipophile Zellwand derDarmzellen überwinden und finden somit nur selten denWeg ins Blut. Also können sie dort auch nicht als Antioxi-dantien wirken.
Vergleicht man die Konzentration von Polyphenolen imBlut mit den im menschlichen Körper vorkommenden, na-türlichen Antioxidantien wie Vitamin C (Cmax 50 µM), oderVitamin E (30 µM), so erreichen alle Phenole zusammen
88 © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.chiuz.de Chem. Unserer Zeit, 2013, 47, 80 – 91
O
O
O
O
HO
HO
OH
OH
OO
OO
OOH
HO
HOOH
HO
HOOH
OHHO
HO
OHOHHO
O
O
O
O
O
O
OH
HO
Urolithin A
Punicalagin(aus Granatapfel)
Darmmikroflora
35
36
A B B . 8 G R A N ATA P F E L- M E TA B O L I T E
Darmflorametabolit von Punicalagin aus Granatapfel.

P O LY P H E N O L E N AT U R S TO F F E
niemals auch nur annähernd solche Konzentrationen. Wei-terhin werden die meisten Polyphenole von der bakteriel-len Darmmikroflora reduziert und somit ihre potenzielleWirkung vermindert.
Polyphenole zeigen auch einen sogenannten pro-oxi-dativen Effekt. Hierbei sind Phenole als Reduktionsmittel inder Lage, Fe3+ zu Fe2+ oder Cu2+ zu Cu+ zu reduzieren. Diereduzierten Metallionen ihrerseits können über die Fen-tonreaktion •OH-Radikale erzeugen. Dieser Wirkmechanis-mus wurde z.B. für die antikarzinogene Wirkung von EGCG15 aus grünem Tee herangezogen: Phenole aus grünem Teeerzeugen schädliche Radikale, die Krebszellen abtöten. Ei-ne Reihe neuerer Arbeiten hat weiterhin gezeigt, dass sichbei einer polyphenolreichen Nahrung der Redoxstatus desmenschlichen Körpers nicht verändert. Vor allem Isopro-stane, die als Markerverbindungen nach oxidativem Stressdurch Radikale gebildet werden, finden sich nach poly-phenolhaltiger Ernährung unverändert im menschlichenUrin.
Man darf also die Antioxidiantienhypothese getrost zuden Akten legen und muss nach einer alternativen Erklärungfür die gesundheitlichen Effekte der Polyphenole suchen.Neue Ansätze, die einem Paradigmenwechsel in der Poly-phenolwissenschaft darstellen und zur Erklärung deren bio-logischer Effekte dienen, beinhalten momentan z. B. dieAktivierung des NF-kB-Signalweges, die Stimulierung desActivator Protein-1 (AP-1), die Aktivierung von Phase II-En-zymen und von Nrf2 sowie die Beeinflussung der Signal-kaskade des mitogen-aktivierten Proteins Kinase (MAPK)[6]. In vereinfachten Worten ärgern und trainieren Poly-phenole hierbei den menschlichen Körper, indem sie eineReihe von Signalkaskaden einschalten, die der Körper zurAbwehr nutzt.
Darmmikroflora, Metabolismus und Nahrungsmittelprozessierung
Wie lassen sich nun die positiven Wirkungen der meistenPhenole auf die menschliche Gesundheit erklären, wennsie doch nie das Blut erreichen?
Zur Erklärung ihrer Wirkung auf die menschliche Ge-sundheit bedarf es eines radikalen Umdenkens. Nach Jah-ren der Forschung muss zugegeben werden, dass die meis-ten bisherigen Arbeiten in die falsche Richtung liefen. NeueIdeen sind also notwendig. Wie überall in der experimen-tellen Forschung werden Hypothesen entwickelt und be-dürfen der experimentellen Falsifikation, wie für die Poly-phenolforschung hier beschrieben.
Zur Erklärung der positiven Gesundheitswirkungen derPolyphenole gibt es momentan drei wissenschaftliche Er-klärungsansätze:
Die ersten beiden berücksichtigen die Darmmikroflora.In unserem Darm leben etwa 1013 Bakterien. Polyphenolewerden von den Darmbakterien aufgenommen und inten-siv metabolisiert, d.h. chemisch umgewandelt. Für vieleDarmbakterien sind Polyphenole toxisch, und somit ver-ändern Polyphenole das Spektrum der Darmflora drama-
tisch, welches zu gesundheitsfördernden Wirkungen füh-ren könnte. Weiterhin stellen die Darmbakterien eine Viel-zahl neuer chemischer Verbindungen aus den Polypheno-len her. Diese zeigen in der Regel eine weitaus bessere Bio-verfügbarkeit als ihre Ausgangssubstanzen aus den Pflanzenund könnten wiederum für die biologische Wirkung ver-antwortlich sein.
Dieses soll an Hand von zwei Beispielen weiter erläu-tert werden. Arbeiten von Alan Crozier konnten zeigen,dass aus den Chlorogensäuren des Kaffees mindestens 10 verschiedene Metabolite gebildet werden (z. B. 31–34),die in das Blut aufgenommen werden (Abbildung 7) [8].Hier werden diese Metabolite weiter von menschlichen Zel-
Chem. Unserer Zeit, 2013, 47, 80 – 91 www.chiuz.de © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 89
Abb. 9 Bilder ausgewählter Flavanoiddrogen [12]: a) Weißdorn, b) Mariendistel, c) Arnika, d) Kamille, e) Johanniskraut, f) Ginkgo.
a) b)
c) d)
e) f)

len metabolisiert, vor allem in der Leber, wobei sich eineAnzahl neuer Verbindungen bildet. Alle diese Metabolitenzirkulieren im Blut und könnten eine biologische Reaktionauslösen.
Für eine Klasse an Metaboliten wurde sogar bereits ei-ne solche positive Wirkung auf die menschliche Gesundheitnachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die Urolithine36, die von Darmbakterien aus Granatapfelpolyphenolen,den Ellagitanninen und dem Punicalagin 35, gebildet wer-den (Abbildung 8) [9].
Diesen Verbindungen wurde eine tumorhemmende Wir-kung nachgewiesen, so dass der Granatapfelextrakt mo-mentan vor der Zulassung als pflanzliches Arzneimittel zurBehandlung von Prostatakrebs steht.
Zu guter Letzt gilt es zu bedenken, dass Menschen diemeisten pflanzlichen Nahrungsmittel nicht im rohen Zu-stand verzehren, sondern sie durch Lebensmittelprozessie-rung wie Kochen, Braten, Backen, Dämpfen, Rösten, Fer-mentieren, Pökeln oder Einlegen chemisch dramatisch verändern. Welche chemische Veränderungen hierbei her-vorgerufen werden, ist weitestgehend unbekannt. In unse-ren eigenen Arbeiten konnten wir zeigen, dass aus nur sechsPhenolen in einem grünen Teeblatt durch Fermentierung30 000 verschiedene Polyphenole in einer Tasse schwar-zem Tee entstehen [10] oder aus 80 Phenolen in einer grü-nen Kaffeebohne etwa 1000 neue Verbindungen durch dasRösten. Für eine besondere Klasse dieser Röstprodukte, denChlorogensäurelactonen, konnte eine biologische Aktivitätnachgewiesen werden. Sie sind nicht nur bitter, sondernauch in der Lage, an den menschlichen Opioidrezeptor zubinden, – und sind somit Schmerzmittel!
Inwieweit Prozessierungsprodukte oder Metaboliten fürweitere Wirkmechanismen der Phenole verantwortlich sind,bleibt abzuwarten, macht diese Forschung aber auf jedenFall sehr spannend.
Polyphenolhaltige ArzneipflanzenPolyphenole sind nicht nur in der pflanzlichen Nahrung,sondern auch in allen Arzneipflanzen enthalten. ManchePflanzen enthalten diese Verbindungsklasse in hohen Kon-zentrationen, so dass ihre pharmakologische Wirkung sichzum großen Teil auf ihre polyphenolischen Inhaltsstoffe zu-rückführen lässt. In der Deutschen Sprache werden dieseArzneipflanzen bedingt durch ihren hohen Flavanoidanteilmeist als Flavanoiddrogen bezeichnet. Arnica, Birkenblätter,Cistus, Gingko, Goldrute, Holunder, Hopfen, Johanniskraut,Kamille, Katzenpfötchen, Mariendistel, Passionsblume, Pe-largonium Sidoides (Umckaloabo), Ringelblume, RömischeKamille, Stiefmütterchen, Süssholz und Weissdorn (Crate-gus) gehören zu den bekannteren, ja klassischen Flava-noiddrogen, die in Deutschland verwendet werden. (Ab-bildung 9) [11].
Es gibt auch andere Arzneipflanzen, die hohe Phenol-anteile enthalten. Das sind vor allem Pflanzen aus den Familien der Lamaceae, Rutaceae, Asteraceae und Rubia-ceae. Alle diese Arzneipflanzen besitzen allgemeine medi-
zinische Wirkungen, die sehr ähnlich denen der polyphe-nolhaltigen Lebensmittel sind. Ihre Wirkungen lassen sichallgemein als antiallergisch, antiphlogistisch, antimikrobiell,antiviral, antikarzinogen und antioxidativ beschreiben. Ent-sprechend ihrem relativ breiten Wirkspektrum werden die-se Pflanzen in der Phytotherapie bei einer ganzen Reihevon Krankheitsbildern eingesetzt.
Interessanterweise zeigen einige dieser Arzneipflanzenauch weitere unerwartete Wirkungen, Johanniskraut solldemnach antidepressiv, Hopfen sedativ, Umckaloabo im-munstimulierend und Gingko antidementiv wirken. Allendiesen Pflanzen ist weiterhin gemeinsam, dass bisher eineindeutiges Wirkprinzip, also eine definierte chemische Ver-bindung, welche für diese Wirkungen verantwortlich ist,nicht identifiziert werden konnte. Man darf daher speku-lieren, dass es die Polyphenole sind, die zu diesen einzig-artigen Wirkungen beitragen. Wie bereits bei den Lebens-mittelpflanzen ausgeführt, gelten auch für die Phenole ausArzneipflanzen dieselben Problemstellungen. Die Polyphe-nole an sich zeigen eine geringe Bioverfügbarkeit, denn sieunterliegen chemischen Veränderungen durch Prozessie-rung und werden durch Darmflora und menschliche Enzy-me stark metabolisiert und somit chemisch verändert. Diesbedeutet, dass auch auf diesem Gebiet die Forschung nochin den Kinderschuhen steckt.
ZusammenfassungAlle Pflanzen stellen Polyphenole her, die sowohl strukturell alsauch in ihren chemischen und biologischen Eigenschaften ei-ne faszinierende Vielfalt zeigen. Während den pflanzlichenOrganismen Polyphenole als UV-Lichtschutz, als chemischeVerteidigung gegen Mikroorganismen und Pflanzenfresserdienen und durch ihre Färbung Insekten anlocken, nutzenMenschen ihre Eigenschaften in industriellen Prozessen, dabeivor allem zur Verbesserung unserer Gesundheit. Polyphenolesind sowohl als Bestandteil unserer täglichen Nahrung alsauch als Bestandteil traditioneller Arzneipflanzen in der Lage,in vielfältiger Weise mit den biochemischen Strukturen desmenschlichen Stoffwechsels zu interagieren und Symptomewie auch Ursachen vieler Erkrankungen zu beeinflussen. DieWirkung der Polyphenole als Antioxidantien, die viele Jahrelang zur Erklärung der gesundheitsförderlichen Eigenschaf-ten der Polyphenole herangezogen wurde, ist nach neuestenErkenntnissen in den Hintergrund getreten. Neue Ansätze zurErklärung der biologischen Eigenschaften der Polyphenole ha-ben sich in den letzten Jahren entwickelt, die die chemischenVeränderungen der Polyphenole durch Lebensmittelprozes-sierung und Metabolismus berücksichtigen und sich nur aufVerbindungen konzentrieren, die gut bioverfügbar sind. DieVerstoffwechselung und die Wirkweise der Polyphenole immenschlichen Körper hat sich in den letzten Jahren als kom-plizierter erwiesen als lange angenommen. Eine klare Ant-wort auf die Frage, welche Verbindungen gesund sind und wiediese wirken, ist erneut Gegenstand aktueller Forschung geworden.
90 © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.chiuz.de Chem. Unserer Zeit, 2013, 47, 80 – 91

P O LY P H E N O L E N AT U R S TO F F E
SummaryPolyphenolics are ubiquitous secondary plant metabolites.Polyphenolics serve in plants as UV protecting agents, flowerpigments und protecting agents against microorganisms andherbivores. Humans have taken advantage of the chemicalproperties of phenolics for centuries in leather tanning, herbalremedies or food production. Most importantly all dietaryplants contain ample amounts of polyphenolics able to pro-tect them from multifactorial diseases such as cardiovasculardisease, cancer or diabetis. Which compounds, however, areresponsible for the beneficial health effect of a diet rich inplants and how do they function in the human body? Thiscontribution summarises various aspects of polyphenol chem-istry and biology with an emphasis on polyphenolics in the human diet.
Literatur[1] S. Quideau, D. Deffieux, C. Douat-Casassus, L. Pouysegu, „Plant
Polyphenols: Chemical Properties, Biological Activities and Synthe-sis“, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2011, 50, 586–621.
[2] Flavanoids – Chemistry, Biochemistry and Applications, O. M.Anderson, K. R. Markham (Hrsg.), 2006, Taylor and Francis, BocaRaton, London, New York.
[3] N. Kuhnert, R. Jaiswal, PO. Eruvichera, M. El-Abassy, B. von derKammer and A. Materny, „Scope and limitations of principalcomponent analysis of high resolution LC-MS data: The analysis ofthe chlorogenic acid fraction in green coffee beans as a case study“Anal. Meth. 2011, 3, 144–155.
[4] M. N. Clifford, K. L. Johnston, S. Knight, N. Kuhnert, „HierarchicalScheme for the LC–MSn identification of chlorogenic acids“, J. Agr.Food. Chem. 2003, 51, 2900–2911.
[5] T. Goto, T. Kondo, „Structure and molecular stacking of anthocya-nins – Flower color variation“, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1991, 30,17–33.
[6] A. Crozier, I. B. Jaganath, M. N. Clifford, „Dietary phenolics: chemis-try, bioavailibility and effects on health“ Nat. Prod. Rep. 2009, 26,1001–1043.
[7] Phenol explorer database: www.phenol-explorer.eu[8] B. Cerda, R. Llorach, J. J. Cernon, J. C. Espin, F. A. Tomas Barberan,
„Evaluation of bioavailability and metabolism in the rfrat ofpunicalagin an antioxidant polyphenol from pomegranate juice“Eur. J. Nutrition 2003, 42, 18–28.
[9] A.Stalmach, W. Mullen, D. Barron, K. Uchida, T. Yokota, C. Cavin, H.Steiling, G. Williamson, A. Crozier, „Metabolite profiling of hydroxy-cinnamate derivatives in plasma and urine after the ingestion ofcoffee by humans: Identification of biomarkers of coffee consumpti-on“, Drug Metabol. Disp. 2009, 37, 1749–1758.
[10] N. Kuhnert „Unravelling the structure of black tea thearubigins“,Arch. Biochem. Biophys. 2010, 501, 37–51.
[11] M. Wichtl (Hrsg.), „Teedrogen und Phytopharmaka“, 3. Aufl.Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 1997; T. Dinger-mannn, K. Hiller, G. Schneider, I. Zündorf, „Schneider Arzneidro-gen“, Elsevier – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 5. Aufl.2004.
[12] Ich bedanke mich für die Bilder der Arzneidrogen bei Herrn Dr.Hermann Hauer (Dr. Wilmar Schwabe Pharmaceutics).
SchlagwörterPolyphenole, Pflanzeninhaltsstoffe, Ernährung, Gesundheit,Antioxidantien
Der AutorNikolai Kuhnert, geb. 1967, studierte in WürzburgChemie und promovierte 1995 unter der Anleitungvon Prof. W. A. Schenk. Nach Postdoktorandenauf-enthalten in England an den Universitäten Cam-bridge und Oxford wurde er auf seine erste akademi-sche Stelle als Lecturer/Senior Lecturer in OrganicChemistry an die University of Surrey berufen. Seit2006 ist er Professor für Analytische und OrganischeChemie an der Jacobs University Bremen. SeineForschungsarbeiten beschäftigen sich mit derChemie pflanzlicher Polyphenole insbesondere ausLebensmitteln. Hierbei geht seine Arbeitsgruppe derFrage nach, wie sich pflanzliche Phenole bei derLebensmittelprozessierung und durch Metabolismuschemisch verändern und welche Auswirkungendieses auf die menschliche Gesundheit hat.
Korrespondenzaddresse:Prof. Dr. Nikolai KuhnertJacobs University BremenCampusring 828759 BremenE-Mail: [email protected]
Chem. Unserer Zeit, 2013, 47, 80 – 91 www.chiuz.de © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 91