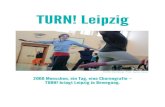Prävention || Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen — ein Beitrag zur Förderung der...
Transcript of Prävention || Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen — ein Beitrag zur Förderung der...
Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen267
Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen – ein Beitrag zur Förderung der öffentlichen Gesundheit
Michael Tiemann*
Abstract
Die Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung der Gesundheit sind nicht nur elementare individuelle Anliegen, sondern auch in vielerlei Hinsicht be-deutsame gesellschaftliche und sozialpolitische Ziele. Angesichts der dramati-schen, für die öffentliche Gesundheit (Public Health) lange Zeit unterschätzten Folgen von Bewegungsarmut und körperlicher Inaktivität werden seit einiger Zeit von verschiedenen Institutionen und Organisationen verstärkt Anstren-gungen zur Steigerung der körperlichen bzw. sportlichen Aktivität in der Bevöl-kerung unternommen sowie weitergehend spezifische Gesundheitssportpro-gramme für verschiedene Zielgruppen entwickelt und umgesetzt. In diesem Kontext spielen nicht zuletzt die Sportverbände sowie die fast 89 000 Turn- und Sportvereine, in denen rund 27 Millionen Menschen aus allen Altersgruppen organisiert sind, eine wichtige Rolle.
Der Beitrag fokussiert zunächst auf grundsätzliche Potenziale körperlicher und (gesundheits-)sportlicher Aktivitäten zur Förderung der öffentlichen Ge-sundheit. Vor diesem Hintergrund werden dann Meilensteine der Entwicklung des Gesundheitssports im organisierten Sport seit Beginn der 1970er-Jahre nachgezeichnet, wichtige Maßnahmen zum Qualitätsmanagement beschrieben sowie insbesondere Bedeutung und Rolle der Turn- und Sportvereine in einem »Netzwerk Gesundheitssport« erörtert. Ferner wird auf den Ansatz der Lebens-welten orientierten Gesundheitsförderung (Setting approach) und den dies-bezüglichen Beitrag der Turn- und Sportvereine als »gesunde Lebensorte« ein-gegangen.
* email: [email protected]
268 B · Prävention und Lebenswelten
Schlüsselworte: Sportvereine, Gesundheitssport, Public Health, Qualitäts-management, Settingansatz
1 Einleitung
Die Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung der Gesundheit sind nicht nur elementare individuelle Anliegen, sondern auch in vielerlei Hinsicht bedeutsame gesellschaftliche und sozialpolitische Ziele (Schwartz 2003). Ein zentrales, nach Blair (2000) sogar das zentrale Gesundheitsproblem unserer Zeit, mit dem viele der heute vorherrschenden Krankheiten (z.B. Herz-Kreis-lauferkrankungen, Diabetes mellitus, Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes, psychische/psychosomatische Krankheiten) direkt oder indirekt zusammenhängen, stellt die zunehmende körperliche Inaktivität weiter Teile der Bevölkerung dar. In Deutschland sind – ebenso wie in anderen Industrieländern – mittlerweile etwa 80% bis 90% aller Erwachsenen (Woll 1998; Woll u. Tittlbach 1999) sowie bereits bis zu 20% der Kinder und Jugend-lichen (Bös 2003; Bös et al. 2002; Kurz u. Tietjens 2000) von Bewegungsmangel betroffen.
Angesichts dieser dramatischen, hinsichtlich ihrer Folgen für die öffentliche Gesundheit lange Zeit unterschätzten Entwicklung werden nunmehr von ver-schiedenen Institutionen und Organisationen verstärkt Anstrengungen zur Steigerung der körperlichen bzw. sportlichen Aktivität in der Bevölkerung un-ternommen sowie spezifische Gesundheitssportprogramme für verschiedene Zielgruppen entwickelt und umgesetzt. In diesem Kontext spielen nicht zuletzt die Sportverbände, mit dem Deutschen Sportbund (DSB) als Dachverband an der Spitze, sowie die fast 89 000 Turn- und Sportvereine, in denen rund 27 Millionen Menschen aus allen Altersgruppen organisiert sind, eine wichtige Rolle (Banzer u. Bürklein 2003; Hartmann et al. 2002).
Der vorliegende Beitrag fokussiert zunächst auf Potenziale körperlicher und (gesundheits-)sportlicher Aktivität zur Förderung der öffentlichen Gesundheit (Kap. 2). Vor diesem Hintergrund werden dann die Entwicklung des Gesund-heitssports im organisierten Sport seit Beginn der 1970er-Jahre (Kap. 3), wich-tige Maßnahmen zum Qualitätsmanagement (Kap. 4) sowie Bedeutung und Rolle der Turn- und Sportvereine in einem »Netzwerk Gesundheitssport« be-schrieben (Kap. 5). Danach wird auf den Ansatz der Lebenswelten orientierten Gesundheitsförderung und den diesbezüglichen Beitrag der Turn- und Sport-
Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen269
vereine als »gesunde Lebensorte« eingegangen (Kap. 6) sowie ein kurzes Resü-mee gezogen (Kap. 7).
2 »Gesundheitssport« als Element eines New Public Health-Ansatzes
Lange Zeit wurden populationsbezogene Maßnahmen zur Prävention und Ge-sundheitsförderung von einem medizinischen Public Health-Modell dominiert. Dieses stellt Krankheiten in den Mittelpunkt der Betrachtung und sucht die Ursachen für Gesundheitsstörungen hauptsächlich im mikrobiologischen Be-reich der Individuen. Demzufolge beziehen sich die präventiven Maßnahmen in erster Linie auf die Identifizierung und Beeinflussung einzelner Risikofakto-ren. Dieses Modell der öffentlichen Gesundheit erscheint jedoch in zunehmen-dem Maße als ineffizient und wird immer mehr infrage gestellt: »Einer Maxi-mierung von Kosten steht eine Minimierung von Wirkungen gegenüber; die verfügbaren Ressourcen werden auf das Kurieren von Symptomen konzentriert, während die Ursachen aktueller Gesundheitsprobleme weitgehend unberührt bleiben« (Rütten 1998a, S. 6).
Angesichts der deutlich zu Tage tretenden Grenzen des medizinischen Public Health-Modells werden seit Beginn der 1970er-Jahre alternative An-sätze zur Förderung der öffentlichen Gesundheit erarbeitet und auf die ge-sundheitspolitische Agenda gesetzt. Einen Meilenstein für die Entwicklung eines neuen Modells von Public Health stellte die Ottawa Charta für Gesund-heitsförderung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 1986 dar. Darin wurde ein positives Verständnis von Gesundheit – als Ressource für erhöhte Lebensqualität – in den Vordergrund gerückt und insbesondere die Bedeutung einer gezielten Förderung physischer, psychischer und sozialer Gesundheitsressourcen sowie die Schaffung gesundheitsförderlicher Lebens-welten hervorgehoben (vgl. Troschke et al. 1996, S. 182).
Anders als beim »alten«, medizinischen Modell der öffentlichen Gesundheit steht beim New Public Health-Ansatz damit nicht mehr (nur) die Krankheits-verhütung, sondern die Gesundheitsförderung im Zentrum aller Bemühungen. Folgerichtig betrachtet dieses neue, gesellschaftliche Modell von öffentlicher Gesundheit auch nicht isoliert einzelne Risikofaktoren, sondern fokussiert auf komplexe gesundheitsrelevante Verhaltensmuster in der Bevölkerung, die mit verschiedenen – ökonomischen, ökologischen, sozialen, politischen und kultu-
270 B · Prävention und Lebenswelten
rellen – Kontexten in Beziehung gesetzt werden (McQueen 1989a, b, 1996). Diese grundlegende Neuorientierung in der Förderung der öffentlichen Ge-sundheit hat Breslow (1999) auch als die dritte Public Health-Revolution – nach der Bekämpfung der Infektionskrankheiten und der Prävention von Risikofak-toren – bezeichnet.
Heute ist unstrittig, dass körperliche und (gesundheits-)sportliche Akti-vität ein großes gesundheitsförderliches Potenzial beinhalten und ein wich-tiges Element einer Förderung der öffentlichen Gesundheit im Sinne der Paradigmen des New Public Health-Ansatzes darstellen können. Allerdings lassen sich auf der Grundlage vorliegender Meta-Analysen (Knoll 1997; Schlicht 1994, 2003) keine generellen Zusammenhänge zwischen sportlicher Aktivität und der physischen sowie der psychischen Gesundheit nachweisen. Ähnliches gilt vermutlich für viele körperliche Alltagsaktivitäten, wie z.B. solchen am Arbeitsplatz (Brehm u. Rütten 2004). D.h., Gesundheit stellt sich weder bei allgemein körperlicher noch bei sportlicher Aktivität »automa-tisch« ein. Gesundheitseffekte sind vielmehr abhängig von den Qualitäten der körperlich-sportlichen Aktivitäten bzw. auch von den Qualitäten der Verhältnisse, unter denen die Aktivitäten realisiert werden (z.B. im Rahmen eines angeleiteten, profilierten Gesundheitssportprogramms). Ferner zeigen längsschnittlich realisierte Evaluationen von Gesundheitssportprogram-men, dass eine nachhaltige Gesundheitswirksamkeit nur erreicht werden kann, wenn in das Interventionskonzept – wie für moderne Gesundheits-förderungsmaßnahmen generell gefordert – das Verhalten sowie die Verhält-nisse einbezogen werden (Abele et al. 1997; Bös u. Brehm 1998, 2003; Bouchard et al. 1994; Brehm, Bös et al. 2002; Brehm et al. 2005; Wagner et al. 2004).
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse haben etwa seit Mitte der 1990er- Jahre Konzepte zur »Gesundheitsförderlichen körperlichen Aktivität« (vgl. hierzu den Beitrag von Brehm in diesem Band) sowie zum »Gesundheitssport« immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das Konzept von Gesundheitssport bezieht sich dabei – im Unterschied zum praktisch alle muskulären Beanspru-chungen umfassenden Konzept einer gesundheitsförderlichen körperlichen Aktivität – ganz gezielt »auf solche körperlichen Aktivitäten, die hoch struktu-riert auf gesundheitsförderliche Effekte bei spezifischen Zielgruppen ausgerich-tet sind« (Brehm u. Rütten 2004, S. 92). Gesundheitssport unterscheidet sich damit auch wesentlich von anderen, traditionell auf den Leistungsvergleich im Wettkampf ausgerichteten, Feldern des Sports und stellt einen genau umrisse-
Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen271
nen Ausschnitt aus gesundheitsförderlicher Aktivität im Schnittbereich von Sport- und Gesundheitssystem dar.
Das aus den Forderungen der Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung (WHO 1986) und der New Public Health-Diskussion abgeleitete »Konzept des Gesundheitssports« ist – insbesondere von Mitgliedern der Kommission Ge-sundheit der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) – sukzessive immer weiter ausdifferenziert und über sechs Kernziele konkretisiert und be-gründet worden (Bös u. Brehm 1998; Brehm 1997; Brehm et al. 1997; Brehm, Bös et al. 2002): 1. Stärkung physischer Gesundheitsressourcen, 2. Verminde-rung von Risikofaktoren, 3. Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen, 4. Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden, 5. Bindung an gesundheits-sportliches Verhalten, 6. Schaffung und Optimierung unterstützender Settings bzw. gesundheitsförderlicher Verhältnisse (ausführlich hierzu vgl. auch den Bei-trag von Brehm in diesem Band). Kennzeichnend für das »Konzept von Ge-sundheitssport« sind weiterhin verschiedene Initiativen zur Verbesserung der Evidenzbasierung entsprechender Interventionen auf der Income- (Programme/Aktivitäten) ebenso wie auf der Outcome-Seite (Effekte) (Brehm u. Bös 2003; Brehm u. Rütten 2004).
In neuerer Zeit wurde dieses »Konzept von Gesundheitssport« sowohl von den großen deutschen Sportverbänden (DSB 2000; DTB 2003) als auch von den Spitzenverbänden der Krankenkassen (AG SpiK 2003) aufgegriffen und für ihre jeweiligen Qualitätsinitiativen verwendet.
3 Entwicklung des Gesundheitssports im organisierten Sport
Obwohl Körperübungen bereits seit dem Altertum gesundheitsförderliche Wir-kungen zugeschrieben werden (Krüger 1998; Lüschen 1998) und »Gesundheit« für drei Viertel aller Erwachsenen das zentrale Zugangsmotiv zu körperlicher bzw. sportlicher Aktivität darstellt (Woll et al. 2004), ist Prävention und Ge-sundheitsförderung im Sportsystem lange Zeit nur eine nachrangige Bedeutung beigemessen worden. Primäres Ziel des organisierten Sports ist traditionell der Leistungsvergleich im Wettkampf, für dessen erfolgreiches Bestehen nicht sel-ten sogar Gefährdungen der Gesundheit toleriert und bewusst in Kauf genom-men werden.
Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte hat sich das Angebotsspektrum der Vereine jedoch immer mehr erweitert und ausdifferenziert und umfasst heute
272 B · Prävention und Lebenswelten
– neben den traditionellen Sportarten wie Ballspielen, Gerätturnen, Leichtath-letik und Schwimmen – eine große Vielfalt an unterschiedlichsten Bewegungs-formen. Einen wahren Boom erleben dabei seit Mitte der 1980er-Jahre gesund-heitsorientierte Angebote, die bereits in vielen Turn- und Sportvereinen – be-sonders den Großvereinen – zum Standard gehören und zu einer wichtigen Säule des organisierten Sports geworden sind. Breuer (1999) spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Zeit des Umbruchs des Sportsystems von der leistungs- zur gesundheitssportlichen Orientierung. Nach Hartmann et al. (2002) entwickelt sich durch die steigende Nachfrage nach Gesundheitssport-angeboten im Verein allmählich ein »eigenständiges Gesundheitssystem im Sportsystem« (S. 43). Exakte Zahlen, wie viele Vereine bundesweit Gesundheits-sport anbieten und wie viele gesundheitsorientierte Sport- und Bewegungsan-gebote es insgesamt gibt, liegen bislang allerdings (noch) nicht vor (Brehm, Bös et al. 2002).
Erste Ansätze zur Erweiterung des traditionellen, am Wettkampfgedanken orientierten Sportverständnisses und zur Öffnung der Sportvereine für breite Bevölkerungsschichten stellen das im Jahr 1972 vom DSB-Bundestag ver-abschiedete Programm »Sport für alle« sowie die von 1970 bis 1994 durchge-führten Trimm-Aktionen des DSB dar. Hauptziel dieser Initiativen war, in der Bevölkerung ein verstärktes Bewusstsein zu entwickeln, dass Sport mehr ist als Wettkampfsport und möglichst jeder in seiner Freizeit sportlich aktiv sein sollte. Weiterhin sollten vermehrte und differenzierte Voraussetzungen zur Sportbetätigung geschaffen werden, um einen Sport für alle zu verwirklichen (DSB 1971).
Der Erfolg der Trimm-Aktionen wird allerdings, je nach Standpunkt und Blickwinkel, unterschiedlich bewertet. Auf der einen Seite weisen Vertreter des DSB sowie andere Befürworter der Aktionen darauf hin, dass diese zu einem deutlichen Anstieg der Mitgliederzahlen und der Sportaktivität sowie zu einer Öffnung der Vereine für verschiedene, bis dahin nicht oder kaum erreichte Zielgruppen geführt haben (zusammenfassend Mörath 2005). Demgegenüber machen Experten insbesondere aus dem Bereich der Sportwissenschaft (z.B. Rütten 2004) deutlich, dass die Mitgliederentwicklung des DSB bereits in den fünf Jahren vor Beginn der Trimm-Aktion vergleichbare Zuwächse aufwies. Mörath (2005) kommt in ihrer umfangreichen Studie zu folgendem Resümee:
»Tatsächlich lässt sich kaum quantifizieren, wie viele Menschen unmittelbar durch die Trimm-Aktionen zu vermehrter sportlich-körperlicher Aktivität an-geregt wurden, inwieweit auch nichtaktive Bevölkerungsgruppen und nicht nur
Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen273
die ohnehin Aktiven im Verlauf der Trimm-Aktionen angesprochen und moti-viert wurden. Die jährlichen EMNID-Untersuchungen zwischen 1970 bis 1984 lassen aufgrund ihres (zudem uneinheitlichen) Forschungsdesigns diesbezüg-lich nur vage Aussagen zu. Als gesichert kann gelten, dass die Trimm-Aktionen einen hohen Bekanntheitsgrad erreichten, der sich aber – wenn überhaupt – nur in einer mäßig erhöhten sportlichen Aktivierung der Bevölkerung nieder-schlug« (S. 71f.).
Weitgehender Konsens besteht hingegen darüber, dass die Trimm-Aktionen die bis dahin vorherrschende Ausrichtung des organisierten Sports auf den Wett-kampf- und Leistungssport relativiert und ein weiter gefasstes Sportverständnis ermöglicht haben (Fuchs 2003; Hartmann et al. 2002; Wopp 1995). Insofern können die Trimm-Aktionen, trotz ihrer wohl eher bescheidenen Auswirkungen auf das reale Sportverhalten der Bevölkerung, in gewisser Weise durchaus als Wegbereiter und »Katalysator« des Gesundheitssports angesehen werden.
Einen ersten – verbandspolitischen – Meilenstein in der Entwicklung des Gesundheitssports im organisierten Sport stellt die im Dezember 1995 vom Hauptausschuss des DSB verabschiedete »Gesundheitspolitische Konzeption« dar (DSB 1995). Mit dieser Konzeption haben der DSB und seine Mitgliedsor-ganisationen den Bereich »Sport und Gesundheit« zu einer zentralen Zukunfts-aufgabe der Verbände und Vereine erklärt. Auf der Grundlage der Forderung aus der Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung der WHO (1986), möglichst alle Menschen zu befähigen, ihr Gesundheitspotenzial so gut wie möglich aus-zuschöpfen, wurde die Verpflichtung eingegangen, mittelfristig eine entspre-chende Qualität der Angebote und der Ausbildung zu sichern.
Ein weiterer wichtiger Schritt war die Verabschiedung von »Qualitätskrite-rien zur Durchführung gesundheitsorientierter Angebote im Sportverein« durch den Bundesvorstand Breitensport des DSB im Januar 1996 (DSB 1996). Diese Kriterien bezogen sich dabei auf sechs Aspekte: 1. Zielsetzung der An-gebote, 2. zielgruppengerechte Inhalte, 3. Qualifikation der Leiter, 4. Räumlich-keiten/Personenzahl, 5. Gesundheitsvorsorgeuntersuchung sowie 6. weiterfüh-rende Programmangebote.
Ausgehend von diesen Grundlagen wurde die Zielsetzung, qualitativ hoch-wertige gesundheitsorientierte Sportprogramme flächendeckend in Deutsch-land über die Verbände und Vereine anzubieten, mit den DSB-Leitlinien »Ge-sundheitsprogramme im Sportverein« vom Dezember 1997 weiter konturiert (DSB 1997). Diese Leitlinien betonen insbesondere die Notwendigkeit eines einheitlichen Profils gesundheitsorientierter Sportprogramme (u.a. durch eine
274 B · Prävention und Lebenswelten
Orientierung an Kernzielen) sowie einer Sicherung der Qualität der Angebote. Bei der Formulierung dieser Leitlinien konnte auf Erfahrungen des DTB mit seinem »Schwerpunktprogramm Gesundheitssport« und das hierzu 1996 vor-gelegte Konzept »Gesundheitsförderung und Gesundheitssport im DTB« zu-rückgegriffen werden (DTB 1996). In diesem Konzept wurden als Gestaltungs-schwerpunkte im gesundheitsorientierten Sport bereits in ähnlicher Weise u.a. eine differenzierte Bewertung vorhandener Angebote sowie eine schrittweise Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung gefordert.
Von großer Bedeutung für die Weiterentwicklung und Verbreitung des Ge-sundheitssports waren und sind ferner verschiedene Initiativen zur Verbesse-rung der Verhältnisse für die Durchführung von Gesundheitssport bzw. zum Aufbau eines entsprechenden Qualitätsmanagements. Wesentliche Schritte wa-ren dabei die einheitliche Orientierung an »Kernzielen von Gesundheitssport« (vgl. Kap. 2; etwa seit 1998), die Einführung der Qualitätssiegel »Pluspunkt Gesundheit.DTB« (1994) und »SPORT PRO GESUNDHEIT« (2000), mehrma-lige Modifikationen der Rahmenrichtlinien für die Übungsleiteraus- und -fort-bildungen sowie die Einführung von Qualitätszirkeln für Übungsleiter im Ge-sundheitssport (2001). Auf diese wichtigen Bausteine des Qualitätsmanage-ments von Gesundheitssport wird im folgenden Kapitel noch ausführlicher eingegangen.
Zusammenfassend sind wichtige (ausgewählte) Meilensteine in der Ent-wicklung des Gesundheits- bzw. des gesundheitsorientierten Sports in Tabelle 1 nochmals im Überblick dargestellt.
4 Qualitätsmanagement von Gesundheitssport im organisierten Sport
Im Kontext der allgemeinen Anstrengungen zur Qualitätssicherung der Prävention und Gesundheitsförderung haben die Sportverbände vor eini-gen Jahren begonnen, qualitätssichernde Maßnahmen für Angebote im Gesundheitssport einzuführen. Neben dem DSB und einigen größeren Lan-dessportbünden ist hier insbesondere der DTB1 zu nennen, der – neben zahlreichen weiteren Maßnahmen – im Jahr 2000 eigens für den Gesund-heitssport einen wissenschaftlichen Beirat eingerichtet hat, dem führende Persönlichkeiten aus der Sportwissenschaft und dem Public Health-Bereich angehören2.
Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen275
. Tabelle 1. Wegbereiter und Meilensteine in der Entwicklung des Gesundheitssports
1972 DSB: Programm »Sport für alle«.
1970–94 DSB: »Trimm-Aktionen« – »Trimm Dich durch Sport« (1970–74);»Ein Schlauer trimmt die Ausdauer« (1975–78); »Spiel mit – da spielt sich was ab« (1979–82); »Trimming 130 – Bewegung ist die beste Medizin« (1983–86); »Im Verein ist Sport am schönsten« (1987–94).
1993 DTB: Beginn des »Schwerpunktprogramms Gesundheitssport«.
1994 DSB: »Leitfaden Sport und Gesundheit für Fachverbände und Lan-dessportbünde«; Rahmenrichtlinien für den Ausbildungsgang »Sport in der Prävention und Rehabilitation«.DTB: Qualitätssiegel »Pluspunkt Gesundheit.DTB«.
1995 DSB: »Gesundheitspolitische Konzeption« – Verpflichtung, auf der Grund-lage der Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung (WHO 1986) die Quali-tät der Angebote und der Ausbildung zu verbessern und zu sichern.DSV: Qualitätssiegel »Gesund & fit im Wasser«.
1996 DSB: »Qualitätskriterien zur Durchführung gesundheitsorientierter Ange-bote im Sportverein«; WIAD-Studie »Sport und Gesundheit« – Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der Ärzte Deutschlands im Auftrag des DSB.DTB: Konzept »Gesundheitsförderung und Gesundheitssport im DTB«.
1997 DSB: Leitlinien »Gesundheitsprogramme im Sportverein«; Rahmenrichtli-nien zur Aufteilung der Ausbildungsgänge in Übungsleiter »Sport in der Prävention« und »Sport in der Rehabilitation«.
1997–98 Expertise »Gesundheitsorientierte Sportprogramme im Verein« (Bös, Brehm, Opper u. Saam) im Auftrag des DSB – Veröffentlichung 2001: Gesundheitssportprogramme in Deutschland. Hofmann, Schorndorf.
1 Der DTB, mit über 5 Millionen Mitgliedern der zweitgrößte Fachverband des Sports, hat seit den 1990er-Jahren die Verbreitung von Gesundheitssport zu einem Schwerpunkt seiner Verbandsarbeit erklärt. Zur Unterstreichung dieser Schwerpunktsetzung hat sich der Verband 1992 umbenannt in »DTB – Verband für Leistungs-, Freizeit- und Gesundheitssport«.
2 Dem wissenschaftlichen Beirat‚ »Gesundheitssport« des DTB gehören zurzeit (2005) an: Prof. Dr. K. Bös (Universität Karlsruhe), Prof. Dr. W. Brehm (Universität Bayreuth), Prof. Dr. C. Breuer (Deutsche Sporthochschule Köln), Prof. Dr. I. Pahmeier (Universität Vechta), Dr. H.-J. Schulke (Bundesvereinigung für Gesundheit), Dr. M. Tiemann (DTB) und Prof. Dr. J. v. Troschke (Univer-sität Freiburg).
6
276 B · Prävention und Lebenswelten
Drei wesentliche, im Folgenden etwas weiter ausgeführte Module des Qua-litätsmanagements von Gesundheitssport im Bereich des organisierten Sports sind »Qualitätssiegel« (Kap. 4.1), »Qualitätsgesicherte Programme« (Kap. 4.2) und »Qualitätszirkel« (Kap. 4.3).
4.1 Qualitätssiegel für gesundheitsorientierte Sportangebote
Seit Mitte der 1990er-Jahre existieren Qualitätssiegel im Gesundheitssport, mit denen Sportverbände bestimmte Angebote (nicht Vereine) auszeichnen. Als erster Fachverband hat der DTB im Jahr 1994 mit dem »Pluspunkt Gesundheit.DTB« ein solches Qualitätssiegel für gesundheitsorientierte Sport- und Bewe-gungsangebote im Verein entwickelt (DTB 1996). Es folgte der Deutsche
. Tabelle 1. Fortsetzung
1999 DSB: Politische Vertretung der Sportorganisationen bei der Formulierung des »Leitfadens der Krankenkassen zur Umsetzung von § 20 SGB V«.
1999–2002
Forschungsprojekt des Instituts für Sportwissenschaft der TU Darmstadt »Qualitätsmanagement von Gesundheitssport im Verein« (Hartmann, Opper u. Sudermann) im Auftrag des DTB (mit finanzieller Unterstützung des DSB).
2000 DSB: Bundeseinheitliches Qualitätssiegel »SPORT PRO GESUNDHEIT« – gemeinsam mit der Bundesärztekammer in Abstimmung mit dem DTB, dem DSV und den Landessportbünden.DTB: Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats‚ »Gesundheitssport«.
2001–02 DTB: 20 Modell-Qualitätszirkel für »Pluspunkt«-Übungsleiter; Neukonzep-tion der Übungsleiterausbildung – insbesondere »Stärkung psychosozia-ler Ressourcen« (Brehm, Pahmeier, Tiemann, Ungerer-Röhrich, Wagner u. Bös 2002).
2003 DSB: Qualitätssiegel »SPORT PRO REHA« – in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer, dem Deutschen Behindertensportverband und dem DTB.
2004 DSB: »Praxisleitfaden Qualitätszirkel«.
Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen277
Schwimm-Verband (DSV), der seine gesundheitsorientierten Angebote seit 1995 mit dem Siegel »Gesund & fit im Wasser« auszeichnet. Im Jahr 2000 hat dann der DSB, gemeinsam mit der Bundesärztekammer sowie in Abstimmung mit dem DTB, dem DSV und den Landessportbünden, mit »SPORT PRO GE-SUNDHEIT« eine Dachmarke für Qualitätssiegel im Gesundheitssport einge-führt (DSB 2000).
Mit diesen Qualitätssiegeln soll einerseits nach außen deutlich gemacht werden, dass Turn- und Sportvereine über qualitativ hochwertige gesundheits-orientierte Sportangebote verfügen. Darüber hinaus sollen die Siegel anderer-seits eine Orientierungshilfe für alle diejenigen darstellen, die an Gesundheits-sport interessiert sind und ein passendes Angebot für sich suchen. Die zertifi-zierten gesundheitsorientierten Angebote können im Internet unter www.pluspunkt-gesundheit.de und www.sportprogesundheit.de abgerufen werden.
Die Zertifizierung der Angebote orientiert sich an folgenden acht Qualitäts-kriterien (ausführlich vgl. DSB 2000, 2002; DTB 2003):(1) Die Angebote sollen eine ganzheitliche Zielsetzung aufweisen, d.h. an den
Kernzielen von Gesundheitssport (Stärkung von physischen Gesundheits-ressourcen, Verminderung von Risikofaktoren, Stärkung von psychosozia-len Ressourcen und Wohlbefinden, Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden, Herausbildung eines gesunden Lebensstils; vgl. hierzu auch den Beitrag von Brehm in diesem Band) orientiert sein.
(2) Zu den Angeboten soll eine spezifizierte Maßnahmenplanung mit einer genauen Beschreibung der Inhalte, Zielgruppe und Belastungsvorgaben vorliegen.
(3) Die Angebote sollen von qualifizierten Übungsleitern mit einer Ausbildung auf der zweiten Lizenzstufe »Sport in der Prävention« oder »Sport in der Rehabilitation« durchgeführt werden.
(4) Fortlaufende ebenso wie zeitlich begrenzte Angebote sollen durch einheitli-che Organisationsstrukturen gekennzeichnet sein. So sollen Kursangebote z.B. wenigstens 12 Einheiten umfassen und mindestens einmal wöchentlich durchgeführt werden.
(5) Teilnehmern – insbesondere Neu- und Wiedereinsteigern – über 35 Jahre soll die Teilnahme an Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen empfohlen werden.
(6) Die Übungsleiter sollen den Teilnehmern Informationen und Rückmeldun-gen zum Kurs (z.B. über Zusammenhänge zwischen sportlicher Aktivität und Gesundheit) und zu ihren persönlichen Fortschritten geben.
278 B · Prävention und Lebenswelten
(7) Weiterhin sollen die Übungsleiter Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Dokumentation und Evaluation des Angebots (z.B. Ausfüllen eines Doku-mentationsfragebogens, Befragung der Teilnehmer) durchführen.
(8) Die Vereine sollen eine Vernetzung mit anderen kommunalen Akteuren und Einrichtungen (z.B. niedergelassenen Ärzten, Krankenkassen, Schulen, Kindergärten, Gesundheitsämtern, Kommunen) anstreben.
Seit der Einführung des ersten Qualitätssiegels für gesundheitsorientierte Sport-angebote – des »Pluspunkt Gesundheit.DTB« – im Jahr 1994 wurden weit über 30 000 Angebote zertifiziert. Dazu ist allerdings kritisch anzumerken, dass letzt-lich nur die Übungsleiterqualifikation ein »hartes«, weil nachzuweisendes Kri-terium darstellt. Die Erfüllung aller anderen Kriterien wird mittels eines An-tragsbogens lediglich abgefragt, aber nicht weiter überprüft. Objektiv betrach-tet, sind die Anforderungen der Qualitätssiegel somit als relativ niedrig zu bewerten. Dies ist auch der Grund dafür, dass die Spitzenverbände der Kran-kenkassen Angebote mit dem Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT nur dann als erstattungsfähige Leistungen im Rahmen der Primärprävention (§ 20 Abs. 1 SGB V) anerkennen, wenn diese weiterhin auch alle anderen im GKV-Leitfaden (AG SpiK 2003) genannten Kriterien (insbesondere Vorliegen von Trainermanual und Teilnehmerunterlagen, Nachweis der Wirksamkeit des Pro-gramms im Rahmen einer wissenschaftlichen Evaluation) erfüllen.
4.2 Qualitätsgesicherte Programme
Wie bereits ausgeführt (vgl. Kap. 2), ist Gesundheitssport ein hoch strukturiert auf gesundheitliche Effekte ausgerichteter Ausschnitt aus gesundheitsförderli-cher körperlicher Aktivität im Schnittbereich von Sport- und Gesundheitssys-tem. Gesundheitssportprogramme umfassen dabei spezifische Interventions-konzepte, mit denen die Kernziele von Gesundheitssport Zielgruppen gerecht und möglichst weitgehend evidenzbasiert auf der Income- (Programme/Akti-vitäten) und der Outcome-Seite (Effekte) angesteuert werden.
Die Income- (oder Input-)Evidenz von Gesundheitssportprogrammen kann insbesondere gesichert werden durch:4 einen stringenten Zielgruppenbezug.4 eine schriftliche Fixierung des Programms (im Normalfall als Trainerma-
nual).
Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen279
4 Vernetzung und adäquate institutionelle Bedingungen.4 Aus- und Fortbildung der Kursleiter.
Die Outcome- (oder Output-)Evidenz der jeweiligen Programme kann sicher-gestellt werden insbesondere durch:4 die praktische Erprobung ihrer Durchführbarkeit und4 die Evaluation ihrer (Gesundheits- und Verhaltens-)Effekte (im Idealfall
durch kontrollierte Längsschnittstudien mit parallelisierten Interventions- und Kontrollgruppen) (AG SpiK 2003; Brehm u. Bös 2004; vgl. auch Brehm in diesem Band).
Zur möglichst lückenlosen Erfassung aller in Deutschland publizierten bzw. zugänglichen Gesundheitssportprogramme hat der DSB im Jahr 1997 die Expertise »Gesundheitsorientierte Sportprogramme im Verein« bei unabhän-gigen Sportwissenschaftlern (Brehm, Bös, Opper u. Saam) in Auftrag gegeben. Im Rahmen dieser Erhebung wurde zunächst eine umfassende Literatur- und Internetrecherche durchgeführt. Um darüber hinaus auch (bislang) nicht ver öffentlichte Programme in die Analyse einbeziehen zu können, erfolgte weitergehend eine schriftliche Befragung der Sportverbände sowie weiterer Institutionen (Krankenkassen, sportwissenschaftliche Institute etc.), die po-tenziell als Anbieter, Träger bzw. »Urheber« von gesundheitsorientierten Sportprogrammen auftreten (N=699). Zudem wurden auch die »Vereine des Freiburger Kreises« (N=158), d.h. die größeren deutschen Sportvereine, in die Erhebung einbezogen (Brehm, Bös et al. 2002).
Diese Ende 2000 abgeschlossene Studie hat ergeben, dass es in Deutschland nur relativ wenige Programme gibt, die die oben genannten Anforderungen allein im Hinblick auf eine »Income-Evidenz« durchgängig erfüllen. Legt man darüber hinaus das Kriterium der »Outcome-Evidenz« – d.h. eines Wirksam-keitsnachweises des Programms in Bezug auf Gesundheits- und Verhaltenspa-rameter – als Qualitätsmaßstab an, dann verringert sich die Zahl der Program-me noch einmal erheblich (Brehm, Bös et al. 2002; vgl. auch Mühlig u. Tempel 2004).
In diesem Kontext ist das Engagement des DTB hervorzuheben, der sich zusammen mit seinem wissenschaftlichen Beirat »Gesundheitssport« um eine Verbesserung der Situation durch die Herausgabe von Trainermanualen in ei-ner eigenen Buchreihe (Verlag Meyer & Meyer) bemüht.
280 B · Prävention und Lebenswelten
4.3 Qualitätszirkel
Qualitätszirkel sind ein elementarer Baustein eines modernen, umfassenden Qualitätsmanagements. Als Instrument zur internen Qualitätssicherung sind sie in der industriellen Produktion schon lange bekannt und erfolgreich ange-wandt worden (Bungard 1992; Deppe 1992). Seit einigen Jahren finden Quali-tätszirkel zunehmend auch in vielen Bereichen der Medizin und des Gesund-heitswesens Anwendung, um die Qualität der jeweiligen Interventionen zu steigern bzw. zu sichern (Ollenschläger 2001). In erster Linie geht es bei Quali-tätszirkeln »um eine kritische Selbstüberprüfung des eigenen Handelns und der das Handeln beeinflussenden Rahmenbedingungen, um Selbstentwicklung, gegenseitige Entwicklung, Kontrolle und Entwicklung des Arbeitsgebietes und um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Sinne des Qualitätsma-nagements« (Schalnus et al. 2004, S. 5).
Im Bereich des Gesundheitssports wurde das Instrument der Qualitätszirkel erstmals durch den DTB eingesetzt, der im Jahr 2001 bundesweit 20 Modell-Qualitätszirkel für »Pluspunkt«-Übungsleiter einrichtete und durch das Institut für Sportwissenschaft der Technischen Universität Darmstadt evaluieren ließ. Aufgrund der positiven Ergebnisse dieser Studie (vgl. hierzu Hartmann et al. 2002) wurde seitens des DTB und des DSB fortan mit dem Aufbau und der dauerhaften Einrichtung von bundesweiten Qualitätszirkeln für Übungsleiter im Gesundheitssport begonnen.
Anders als bei der traditionellen Aus- und Fortbildung der Übungsleiter – die in den letzten Jahren mehrfach modifiziert und an neue Entwicklungen im Bereich des Gesundheitssports, z.B. die stärkere Betonung psychosozialer Ressourcen, angepasst wurde – stehen bei Qualitätszirkeln der Austausch von Wissen und Erfahrungen sowie das gemeinsame Erarbeiten von Problem-lösungen im Vordergrund. Im Einzelnen ergeben sich insbesondere folgende zentrale Zielsetzungen für die Qualitätszirkel-Arbeit im Gesundheitssport (Hartmann et al. 2002, S. 146; vgl. auch Hartmann u. Opper 2000; Schalnus et al. 2004):4 Sicherung der Kommunikation zwischen Verband, Vereinen und Übungs-
leitern.4 Beschreibung, Rekonstruktion und Bewusstmachung des alltäglichen
Handelns in der Übungspraxis.4 Übungsleiter-Fortbildung im Sinne von Kompetenzschulung (vor allem
Fach- und Sozialkompetenz).
Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen281
4 Hilfen für die Übungsleiter bei individuellen Schwierigkeiten und Proble-men.
4 Unterstützung der Vereine bei der Entwicklung neuer Programme und beim Aufbau neuer Gruppen.
4 Kooperation und Vernetzung mit anderen Feldern der Gesundheitsförde-rung auf kommunaler Ebene.
Da die Teilnehmer eines Qualitätszirkels einen ähnlichen Erfahrungshorizont haben und in vergleichbaren Situationen und Tätigkeiten stehen, erleben sie ähnliche Probleme. Die von Moderatoren geleiteten Zirkel verlaufen aus diesem Grund in der Hauptsache erfahrungsbezogen, d.h., die Qualitätszirkel-Teilneh-mer sind als Experten anzusehen, die sich selbst und ihr Handeln in die Ge-spräche einbringen. Zudem wird in Qualitätszirkeln themenzentriert, zielge-richtet, systematisch und kontinuierlich gearbeitet (Bahrs 2001; Hartmann et al. 2002).
5 Turn- und Sportvereine als wichtige Partner in einem »Netzwerk Gesundheitssport«
Im Sinne der Paradigmen des New Public Health-Ansatzes wird seit Beginn der 1990er-Jahre vermehrt gefordert, dass Gesundheitssport und Gesundheits-sportprogramme – über rein verhaltensbezogene Maßnahmen hinaus – auch verhältnisbezogene Interventionen zu umfassen haben (z.B. Kolb 1995; Rütten 1993, 1998a, b). Deshalb stellt auch die »Schaffung und Optimierung unterstüt-zender Settings bzw. gesundheitsförderlicher Verhältnisse« eines von insgesamt sechs Kernzielen des Gesundheitssports dar (vgl. Kap. 2 sowie den Beitrag von Brehm in diesem Band). Wichtige Elemente gesundheitsförderlicher Bewe-gungsverhältnisse sind entsprechend profilierte Gesundheitssportprogramme, qualifizierte Übungsleiter und Trainer, adäquate Räumlichkeiten und Geräte, Maßnahmen und Verfahren zur Qualitätssicherung und wissenschaftlichen Evaluation sowie – worauf hier etwas näher eingegangen werden soll – kommu-nale und regionale Vernetzungen und Kooperationen zwischen verschiedenen im Gesundheitssektor tätigen Akteuren und Institutionen (Brehm, Bös et al. 2002).
In den letzten Jahren hat sich zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt, dass Gesundheitsförderung und Prävention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
282 B · Prävention und Lebenswelten
darstellen, die nur gemeinsam von einer Vielzahl von Akteuren, wie der Ärzte-schaft, dem Öffentlichen Gesundheitsdienst, der Gesetzlichen Unfallversiche-rung, der Gesetzlichen Krankenversicherung etc., zu leisten ist. Die Turn- und Sportvereine sind dabei bislang noch wenig wahrgenommen und »die heraus-ragenden Möglichkeiten dieser Species von Organisation [...] kaum verortet, erkannt oder gewürdigt worden« (Hartmann 1997, S. 13). Gleichwohl besitzen die Vereine ein großes gesundheitsförderliches Potenzial für die öffentliche Ge-sundheit, das Schulke (1998) wie folgt umreißt (vgl. auch Hartmann et al. 2002; Opper 2003): » 4 Ihre Popularität und soziale Akzeptanz erleichtert nahezu allen Bevölke-
rungsgruppen einen niedrigschwelligen Zugang zu den Angeboten.4 Die in den Vereinen organisierte Bewegungs- und Sportaktivität ist den
Menschen ›leibhaftig‹; Sport ist einer der großen Diskurse in der heutigen Gesellschaft und ermöglicht insofern thematisch viele Zugänge zur Ge-sundheit und gesunden Lebensführung.
4 Die Vereine als gemeinnützige Einrichtungen sind im Vergleich mit anderen Anbietern von gesundheitsfördernden Maßnahmen kostengünstig bzw. niedrigpreisig.
4 Die im Deutschen Sportbund organisierten Vereine bilden in den Städten wie in ländlichen Gemeinden ein flächendeckendes System.
4 Die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft gewährleistet bedarfsgerechte Ange-bote. Die flexiblen Strukturen (sportart- und altersübergreifend) sichern ein rasches Eingehen auf neue gesundheitsbezogene Bedürfnisse und Motive.
4 Sie verstehen sich aufgrund ihrer Tradition und der gesundheitlichen Mo-tive bei ihren Mitgliedern zumindest im weiteren Sinne bzw. unspezifisch als gesundheitsfördernde Einrichtungen.
4 In den Vereinen hat sich über 150 Jahre eine hohe Kompetenz für motori-sches und soziales Lernen sowie eine große Organisationserfahrung ange-sammelt.
4 Ein in allen Regionen praktiziertes fachlich differenziertes und mehrstufiges Ausbildungssystem zur Laienkompetenz leistet ein hohes (oft semiprofessi-onelles) Niveau auch bei den gesundheitssportorientierten Angeboten, das durch hauptamtliche Kräfte in spezifischen Angeboten und Schlüsselfunk-tionen stabilisiert wird.
4 Die unterschiedlichen Angebotsformen von dauerhaften Sportgruppen und zeitlich befristeten Kursinhalten mit spezifischen Themen ermöglichen
Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen283
den unkomplizierten Wechsel zwischen Angeboten für aktuelle gesund-heitliche Gefährdungen und solchen mit langfristigen sozialen Bindungen« (S. 136f.).
Bei aller Heterogenität und dem nach wie vor bestehenden »Leistungsgefälle« im Bereich gesundheitsorientierter Sport- und Bewegungsangebote (Hartmann 1997), spricht also vieles für eine stärkere Nutzung des präventiven Potenzials der Turn- und Sportvereine und deren systematische Einbindung in ein »Netz-werk Gesundheitssport«.
Als beispielgebend kann in diesem Zusammenhang das »Kooperative Konzept Gesundheitssport zur Förderung der öffentlichen Gesundheit« (KoKoSpo) genannt werden, das seit 1998 in Nordrhein-Westfalen (Landesteil Westfalen-Lippe) erfolgreich in der Fläche realisiert wird. Dieses kooperative Konzept sieht eine enge Zusammenarbeit zwischen Krankenkassen (im kon-kreten Fall der AOK Westfalen-Lippe), niedergelassenen Ärzten sowie auf dem Gebiet des Gesundheitssports besonders engagierten Sportvereinen und Fitness-Studios vor. Ein besonderes Kennzeichen dieses Ansatzes ist die prä-zise Festlegung und Umgrenzung der jeweiligen – systematisch aufeinander abgestimmten – Aufgaben der Mitglieder des Netzwerkes sowie die genaue Beschreibung der einzelnen Schritte der Interventionsmaßnahmen (Tiemann et al. 2003a).Die spezifischen Aufgaben der Ärzte im Rahmen von »KoKoSpo« sind:4 Diagnose und Zuordnung der in Frage kommenden Patienten zu den Pro-
grammen.4 Information und Beratung der Patienten über die Gesundheitssportpro-
gramme sowie über die physischen und psychischen Wirkungen einer Teil-nahme an den Programmen.
4 Empfehlung und Motivation zur Teilnahme an den Programmen.4 Soziale Unterstützung der Patienten vor und – wenn möglich – auch wäh-
rend der Kursteilnahme (z.B. durch interessierte Nachfragen).
Die Krankenkassen (hier die AOK Westfalen-Lippe) haben im Rahmen dieses Konzepts insbesondere folgende Aufgaben:4 Information der Ärzte über die Zielsetzung der Kooperation, die Teil-
nahmevoraussetzungen und Zielgruppen (Indikationen und Kontraindi-kationen), Struktur, Ziele und Inhalte der Programme, Maßnahmen zur Qualitätssicherung sowie ihre spezifischen Aufgaben.
284 B · Prävention und Lebenswelten
4 Institutionalisierung und regelmäßige Durchführung der – als Einstiegsan-gebote konzipierten – Gesundheitssportprogramme (ggf. in Kooperation mit Turn- und Sportvereinen).
4 Sicherung der Qualität der Gesundheitssportprogramme und ihrer Durch-führung.
4 Vernetzung/Kooperation mit Turn- und Sportvereinen zur Erleichterung bzw. Sicherstellung des Übergangs der Teilnehmer vom Kursangebot in ein adäquates Folge- bzw. Dauerangebot (Ziel: Aufbau von Bindung, Sicherung der Nachhaltigkeit).
Den Turn- und Sportvereinen kommt insbesondere im Hinblick auf den Aufbau von Bindung an gesundheitssportliche Aktivitäten eine Schlüsselrolle zu. Ihre konkreten Aufgaben im Kontext von »KoKoSpo« sind:4 Durchführung langfristiger Folgeangebote für die Teilnehmer an den Ein-
stiegsprogrammen, im Idealfall mit den bestehenden Gruppen und ohne zeitliche Verzögerung (direkter Übergang vom Kurs- in ein Folgeangebot).
4 Integration von Angeboten und Teilnehmern in den Verein.4 Sicherung der Qualität der Vereinsangebote durch entsprechende Program-
me, qualifizierte Übungsleiter, adäquate Räumlichkeiten und Rahmenbe-dingungen sowie ein kontinuierliches Qualitätsmanagement.
Beim Übergang von den zeitlich befristeten Einsteigerprogrammen in entspre-chende Folgeangebote kommt es dabei entscheidend darauf an, dass bekannte Barrieren (Orts-, Termin- oder Übungsleiterwechsel) möglichst konsequent vermieden werden. Deshalb werden die Einstiegsprogramme in der Regel bereits dort durchgeführt, wo auch entsprechende Fortsetzungsangebote vorge-halten werden. Des Weiteren wird versucht, Einstiegs- und Folgeprogramme so zu terminieren, dass sie am gleichen Wochentag und möglichst auch zur glei-chen Uhrzeit stattfinden. Wenn der Übergang in ein Folgeangebot mit einem Übungsleiterwechsel verbunden ist, soll der Übungsleiter des Fortsetzungsan-gebotes an einer der letzten Einheiten des Einstiegsprogramms teilnehmen und sich auf diese Weise frühzeitig bei den Teilnehmern bekannt machen. Dadurch soll die Unsicherheit in Bezug auf die neue Übungsleitung abgebaut und diese potenzielle Hürde bereits während des noch laufenden Einstiegsprogramms überwunden werden.
Die Evaluation des »kooperativen Konzepts« (Tiemann et al. 2002, 2003a, b) zeigt, dass dieses greift und erfolgreich in der Praxis umgesetzt werden kann. So
Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen285
ist es beispielsweise gelungen, in Westfalen-Lippe im Zeitraum von 1998 bis 2003 Kooperationen mit über 1000 niedergelassenen Ärzten aufzubauen und die Gesundheitssportprogramme dort flächendeckend zu institutionalisieren. Ferner konnten mit diesem Ansatz auch und vor allem solche Personengruppen erreicht werden, die einerseits gesundheitlich besonders gefährdet bzw. belastet, andererseits aber nur schwer zu erreichen und in Gesundheitssportprogram-men ansonsten deutlich unterrepräsentiert sind (z.B. Arbeiter und Handwerker, Arbeitsunfähige, Erwerbslose). Damit leistet das »kooperative Konzept Ge-sundheitssport« – dem Grundgedanken des New Public Health-Ansatzes ent-sprechend – nicht zuletzt auch einen Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen.
6 Turn- und Sportvereine als »gesunde Lebensorte«
Moderne Ansätze zur Prävention und Gesundheitsförderung haben die Be-deutung der Lebenswelten von Menschen für die Entwicklung, Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit erkannt (Setting approach). Gemäß der Maxime, dass Gesundheit im Alltagskontext hergestellt wird, werden gesund-heitsfördernde Maßnahmen deshalb an wichtigen Lebensbereichen aus-gerichtet.
Turn- und Sportvereine sind Lebenswelten mit einer langen Tradition, in denen Menschen aller Lebensalter nicht nur körperlich aktiv sind, sondern auch ihre psychosozialen Ressourcen entwickeln können. Als originärer Knoten-punkt befindet sich der Turn- und Sportverein in einem kommunalen Netzwerk mit unterschiedlichen Institutionen und Settings, die sich gegenseitig auch in der Entwicklung von gesunden Lebensstilen beeinflussen. Dabei kann der Ver-ein auf einige Rahmenbedingungen von Gesundheit Einfluss nehmen:4 Speiseangebote im Clubhaus oder am Getränkeautomaten verhindern oder
ermöglichen die Auswahl gesundheitsfördernder Nahrungsmittel.4 Mit der Architektur wird – u.a. durch Beschallung und Beleuchtung, Raum-
größe und Farbgebung – auch das Wohlbefinden beeinflusst.4 Ökologische Aspekte wie die Begrünung einer Anlage, schadstofffreie Bau-
materialien, funktionierende Frischluftzufuhr können positive Auswirkun-gen auf die »Ökologie des Körpers« haben.
4 Sanitäre Einrichtungen wie komfortable Duschen, Entmüdungsbecken, Sauna und Ruheräume können den Gesundheitsgewinn intensivieren.
286 B · Prävention und Lebenswelten
Neben diesen Rahmenbedingungen, die in einem »Gesundheits-Audit« zusam-mengefasst und z.B. durch einen Vorstandsbeauftragten weiterentwickelt wer-den können, verfügt der Verein häufig über zahlreiche Kontakte mit gesund-heitsfördernder Relevanz. So können z.B. durch die Zusammenarbeit mit Kin-derärzten und Kindergärten frühzeitig Angebote für Kinder mit motorischen Dysbalancen gemacht, über Krankenkassen eher vereinsferne Zielgruppen an-gesprochen (vgl. Kap. 5), durch die Kooperation mit Schulen oder karitativen Einrichtungen die Fortsetzung von gesundheitsförderlichen Sportangeboten in den jeweiligen Einrichtungen sichergestellt werden (Bös et al. 2005).
7 Resümee
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das flächendeckende Ange-bot an Turn- und Sportvereinen in Deutschland ideale Voraussetzungen für eine – bewegungszentrierte – Förderung der öffentlichen Gesundheit im Sinne der Paradigmen des New Public Health-Ansatzes sowie moderner Konzepte der Lebenswelten orientierten Gesundheitsförderung bietet. Unabdingbare Vor-aussetzung hierfür ist allerdings, dass die Ansätze zur Qualitätsentwicklung und -sicherung der Angebote des Gesundheitssports weiter entwickelt und struktu-rell noch mehr in den Sportverbänden und –vereinen verankert werden. Beson-ders wichtig sind in diesem Kontext die systematische Prüfung von Gesund-heitssportprogrammen sowie deren flächendeckende Institutionalisierung und Umsetzung.
LiteraturAbele A., Brehm W., Pahmeier I. (1997) Sportliche Aktivität als gesundheitsbezogenes Handeln.
Auswirkungen, Voraussetzungen und Förderungsmöglichkeiten. In: Schwarzer R. (Hrsg) Gesundheitspsychologie. Ein Lehrbuch. Hogrefe, Göttingen Bern Toronto Seattle, S 117–149
AG SpiK (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen) (2003) Gemeinsame und einheitliche Handlungsfelder und Kriterien der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Umsetzung von § 20 Abs. 1 und 2 SGB V in der Fassung vom 12.09.2003 (Federführend für die Veröffentlichung: IKK-Bundesverband, Bergisch Gladbach)
Bahrs O. (2001) Was ist ein Qualitätszirkel? In: Bahrs O., Gerlach F. M., Szecsenyi J. (Hrsg) Ärzt-liche Qualitätszirkel. Leitfaden für den Arzt in Praxis und Klinik. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, S 19–70
Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen287
Banzer W., Bürklein M. (2003) Entwicklung des Themas Gesundheit innerhalb des Deutschen Sportbundes. Public Health Forum 11 (41): 13
Blair S. N. (2000) Physical inactivity. The major public health problem of the next millennium. In: Avela J., Komi P.V., Komulainen J. (eds) Proceedings, 5th Annual Congress of the Euro-pean College of Sport Science, Jyväskylä, LIKES Research Centre
Bös K. (2003) Motorische Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen. In: Schmidt W., Hartmann-Tews I., Brettschneider W.-D. (Hrsg) Erster Deutscher Kinder- und Jugendsport-bericht. Hofmann, Schorndorf, S 85–107
Bös K., Brehm W. (1998) Zugänge zum »Gesundheitssport«. In: Bös K., Brehm W. (Hrsg) Gesund-heitssport. Ein Handbuch. Hofmann, Schorndorf, S 7–14
Bös K., Brehm W. (2003) Bewegung. In: Schwartz F. W., Badura B., Busse R., Leidl R., Raspe H., Siegrist J., Walter U. (Hrsg) Das Public Health Buch. Gesundheit und Gesundheitswesen. Urban & Fischer, München Jena, S 156–162
Bös K., Brehm W., Breuer C., Hartmann H., Pahmeier I., Pauly P., Rühl J., Schulke H.-J., Tiemann M., Troschke J. v. (2005) Gesundheitsfördernde Lebenswelten in Turn- und Sportvereinen. Prävention (i.Dr.)
Bös K., Heel J., Romahn N., Tittlbach S., Woll A., Worth A., Hölling H. (2002) Untersuchungen zur Motorik im Rahmen des Kinder- und Jugendsurveys. Das Gesundheitswesen 64: 80–87
Bouchard C., Shephard R. J., Stephens T. (eds) (1994) Physical activity, fitness, and health. In-ternational proceedings and consensus statement. Human Kinetics, Champaign, Il.
Brehm W. (1997) Qualitäten im Gesundheitssport. In: Schulke H.-J., Troschke J.v., Hoffmann A. (Hrsg) Gesundheitssport und Public Health. Deutsche Koordinierungsstelle für Gesund-heitswissenschaften, Universität Freiburg i.Br., S 46–59
Brehm W., Bös K. (2003) Kernziele als Qualitätskriterien von Gesundheitssport. Public Health Forum 11 (41): 11–12
Brehm W., Bös K. (2004) Ziele und deren Sicherung im Gesundheitssport mit der Orientierung Prävention und Gesundheitsförderung. In: Woll A., Brehm W., Pfeifer K. (Hrsg) Intervention und Evaluation im Gesundheitssport und in der Sporttherapie. Czwalina, Hamburg, S 11–26
Brehm W., Rütten A. (2004) Chancen, Wirksamkeit und Qualität im Gesundheitssport – Wo steht die Wissenschaft. Bewegungstherapie und Gesundheitssport 20: 90–96
Brehm W., Bös K., Opper E., Saam J. (2002) Gesundheitssportprogramme in Deutschland. Analysen und Hilfen zum Qualitätsmanagement für Sportverbände, Sportvereine und andere Anbieter von Gesundheitssport. Hofmann, Schorndorf
Brehm W., Janke A., Sygusch R., Wagner P. (2005) Gesund durch Gesundheitssport. Zielgrup-penorientierte Konzeption, Durchführung und Evaluation von Gesundheitssportpro-grammen. Juventa, Weinheim München
Brehm W., Pahmeier I., Tiemann M. (1997) Gesundheitsförderung durch sportliche Aktivie-rung. Qualitätsmerkmale, Programme, Qualitätssicherung. Sportwissenschaft 27: 38–59
Brehm W., Pahmeier I., Tiemann M., Ungerer-Röhrich U., Wagner P., Bös K. (2002) Psycho soziale Ressourcen. Stärkung von psychosozialen Ressourcen im Gesundheitssport. Deutscher Turner-Bund, Frankfurt am Main
Breslow L. (1999) From disease prevention to health promotion. JAMA 281: 1030–1033
288 B · Prävention und Lebenswelten
Breuer C. (1999) Gesundheitsnachfrage im Sport – Möglichkeiten der institutionellen Nut-zung. In: Klein M. (Hrsg) Spiel ohne Grenzen? – Bedeutung und Entwicklungstendenzen des Sports in der Gegenwartsgesellschaft. Pädagogische Hochschule Erfurt, S 114–124
Bungard W. (Hrsg) (1992) Qualitätszirkel in der Arbeitswelt. Ziele, Erfahrungen, Probleme. Verlag für angewandte Psychologie, Göttingen
Deppe J. (1992) Quality Circle und Lernstatt. Ein integrativer Ansatz. Gabler, WiesbadenDSB (Deutscher Sportbund) (Hrsg) (1971) Memorandum zur Aktion »Trimm Dich durch Sport«.
Deutscher Sportbund, Frankfurt am MainDSB (Deutscher Sportbund) (Hrsg) (1995) Gesundheitspolitische Konzeption des Deutschen
Sportbundes. Deutscher Sportbund, Frankfurt am MainDSB (Deutscher Sportbund) (Hrsg) (1996) Qualitätskriterien zur Durchführung gesundheitso-
rientierter Angebote im Sportverein. Deutscher Sportbund, Frankfurt am MainDSB (Deutscher Sportbund) (Hrsg) (1997) Leitlinien »Gesundheitsprogramme im Sport verein«.
Deutscher Sportbund, Frankfurt am Main (Mitglieder-Rundschreiben 1: 8–11)DSB (Deutscher Sportbund) (Hrsg) (2000) Qualitätssiegel »SPORT PRO GESUNDHEIT«. Deut-
scher Sportbund, Frankfurt am MainDSB (Deutscher Sportbund) (Hrsg) (2002) SPORT PRO GESUNDHEIT. Qualität für präventive
Bewegungsprogramme. Deutscher Sportbund, Frankfurt am MainDTB (Deutscher Turner-Bund) (Hrsg) (1996) Gesundheitsförderung und Gesundheitssport im
Deutschen Turner-Bund. Deutscher Turner-Bund, Frankfurt am MainDTB (Deutscher Turner-Bund) (Hrsg) (2003) Pluspunkt Gesundheit.DTB. Das Gütesiegel
des Deutschen Turner-Bundes für gesundheitsorientierte Vereinsangebote. Deutscher Turner-Bund, Frankfurt am Main
Fuchs R. (2003) Sport, Gesundheit und Public Health. Hogrefe, Göttingen Bern Toronto SeattleHartmann H. (1997) Die Bedeutung von Turn- und Sportvereinen im Hinblick auf die
Ent wicklung einer New Public Health in Deutschland – Vergangenheit und Gegenwart. In: Schulke H.-J., Troschke J.v., Hoffmann A. (Hrsg) Gesundheitssport und Public Health. Deutsche Koordinierungsstelle für Gesundheitswissenschaften, Universität Freiburg i.Br., S 13–16
Hartmann H., Opper E. (2000) Adel verpflichtet! Die Qualitätszirkel der Pluspunkt-Übungs-leiter/innen vor dem Start. Pluspunkt Gesundheit.DTB – Das Magazin 1 (4): 6–7
Hartmann H., Opper E., Sudermann A. (2002) Qualitätsmanagement von Gesundheitssport im Verein. Abschlussbericht zum Forschungsprojekt, Institut für Sportwissenschaft der TU Darmstadt
Knoll M. (1997) Sporttreiben und Gesundheit – Eine kritische Analyse vorliegender Befunde. Hofmann, Schorndorf
Kolb M. (1995) Gesundheitsförderung im Sport. Sportwissenschaft 25: 335–359Krüger M. (1998) Zur Entstehung und Entwicklung von Gesundheitskonzepten im Sport. In: Bös
K., Brehm W. (Hrsg) Gesundheitssport. Ein Handbuch. Hofmann, Schorndorf, S 71–81Kurz D., Tietjens M. (2000) Das Sport- und Vereinsengagement der Jugendlichen. Ergebnisse
einer repräsentativen Studie in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Sportwissen-schaft 30: 384–407
Lüschen G. (1998) Sport und öffentliche Gesundheit in Europa und Amerika. In: Rütten A. (Hrsg) Public Health und Sport. Naglschmid, Stuttgart, S 37–58
Gesundheitssport in Turn- und Sportvereinen289
McQueen D. V. (1989a) Thoughts on the ideological origins of health promotion. Health Promotion 4: 339–342
McQueen D. V. (1989b) Chapter 1 & 2. In: Research unit in health and behavioural change (ed) Changing in public health. Wiley, Chichester, pp 1–28
McQueen D. V. (1996) Gesundheitsförderung und die Neue Public Health Bewegung im inter-nationalen Vergleich. In: Rütten A., Rausch L. (Hrsg) Gesunde Regionen in internationaler Partnerschaft. Verlag für Gesundheitsförderung, Gamburg, S 1–12
Mörath V. (2005) Die Trimm-Aktionen des Deutschen Sportbundes zur Bewegungs- und Sport-förderung in der BRD 1970 bis 1994. Veröffentlichungsreihe der Forschungsgruppe Public Health, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
Mühlig S., Tempel G. (2004) Zur Bewertung vorliegender Evaluationen von AOK-Modell-projekten in den Bereichen Sekundär- und Tertiärprävention. Gutachten für den AOK- Bundesverband, Dresden Bremen
Ollenschläger G. (2001) Von der Qualitätskontrolle zum Total Quality Management. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg) Qualitätsmanagement in Gesund-heitsförderung und Prävention. Grundsätze, Methoden und Anforderungen. Bundes-zentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln, S 98–112
Opper E. (2003) Qualitätsmanagement von Gesundheitssport im Verein. Eine empirische Untersuchung von Übungsleitern und zertifizierten Angeboten im Gesundheitssport. In: Eisfeld K., Wiesmann U., Hannich H.-J., Hirtz P. (Hrsg) Gesund und bewegt ins Alter. Inter-disziplinäre Ansätze für die Community Medicine. Afra Verlag, Butzbach-Griedel
Rütten A. (1993) Sport, Lebensstil und Gesundheitsförderung. Sozialwissenschaftliche Grund-lagen für eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Sportwissenschaft 23: 345–370
Rütten A. (1998a) Public Health und Sport – Prolegomena für einen transdisziplinären Ansatz. In: Rütten A. (Hrsg) Public Health und Sport. Naglschmid, Stuttgart, S 5–35
Rütten A. (1998b) Sportliche Aktivität und öffentliche Gesundheit. In: Bös K., Brehm W. (Hrsg) Gesundheitssport. Ein Handbuch. Hofmann, Schorndorf, S 52–62
Rütten A. (2004) Stellungnahme zu einem Schreiben von Prof. Hollmann/Institut für Kreislauffor-schung und Sportmedizin, Köln, zu Rüttens Artikel im Public Health Forum (2003), 41: 2–3. www.manuskript-submission.de/journals/files/phf/antwortruetten.pdf
Schalnus R., Emrich G., Wedekind S. (2004) Praxisleitfaden Qualitätszirkel. Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT. Deutscher Sportbund, Frankfurt am Main
Schlicht W. (1994) Sport und Primärprävention. Hogrefe, Göttingen Bern Toronto SeattleSchlicht W. (2003) Sport und Bewegung. In: Jerusalem M., Weber H. (Hrsg) Psychologische
Gesundheitsförderung. Diagnostik und Prävention. Hogrefe, Göttingen Bern Toronto Seattle, S 213–231
Schulke H.-J. (1998) Zur Differenzierung von Public Health und Sport – Über die Vernach-lässigung der Integrationspotentiale zweier gesellschaftlicher Praxisfelder in der Gesund-heitsförderung. In: Rütten A. (Hrsg) Public Health und Sport. Naglschmid, Stuttgart, S 131–155
Schwartz F. W. (2003) Public Health – Zugang zu Gesundheit und Krankheit der Bevölkerung, Analysen für effektive und effiziente Lösungsansätze. In: Schwartz F. W., Badura B., Busse R., Leidl R., Raspe H., Siegrist J., Walter U. (Hrsg) Das Public Health Buch. Gesundheit und Gesundheitswesen. Urban & Fischer, München Jena, S 3–6
290 B · Prävention und Lebenswelten
Tiemann M., Brehm W., Sygusch R. (2002) Flächendeckende Institutionalisierung evaluierter Gesundheitssportprogramme. In: Walter U., Drupp M., Schwartz F. W. (Hrsg) Prävention durch Krankenkassen. Zielgruppen, Zugangswege, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. Juventa, Weinheim München, S 226–238
Tiemann M., Brehm W., Sygusch R. (2003a) Gesundheitssport als »Rezept«. »KoKoSpo« – Kooperatives Konzept Gesundheitssport zur Förderung der öffentlichen Gesundheit. Heft 9 der Bayreuther Beiträge zur Sportwissenschaft, Universität Bayreuth
Tiemann M., Brehm W., Sygusch R. (2003b) Die Rolle des Arztes bei einer gesundheitssportli-chen Intervention am Beispiel des Kooperationsmodells Westfalen-Lippe. Sportmedizin 54 (7–8): 41
Troschke J.v., Reschauer G., Hoffmann-Markwald A. (Hrsg) (1996) Die Bedeutung der Ottawa Charta für die Entwicklung einer New Public Health in Deutschland. Koordinierungsstel-le Gesundheitswissenschaften/Public Health, Universität Freiburg i.Br.
Wagner P., Brehm W., Sygusch R. (2004). The seven-sequence intervention: sedentary adults on their way to fitness and health. Research in Sports Medicine 12: 265–282
WHO (World Health Organization) (1986) Ottawa charter for health promotion. Health Promo-tion 1: III–V
Woll A. (1998) Erwachsene. In: Bös K., Brehm W. (Hrsg) Gesundheitssport. Ein Handbuch. Hofmann, Schorndorf, S 108–116
Woll A., Tittlbach S. (1999) FINGER – FINnish-GERman study about the relationship of physical activ-ity, fitness and health. CESS-Sport and Health Magazine 4: 16–19
Woll A., Brehm W., Pfeifer K. (Hrsg) (2004) Intervention und Evaluation im Gesundheitssport und in der Sporttherapie. Czwalina, Hamburg
Wopp C. (1995) Entwicklungen und Perspektiven des Freizeitsports. Meyer & Meyer, Aachen