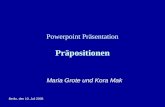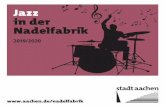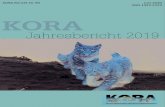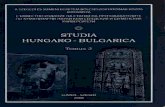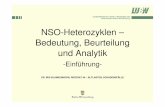Berlin, den 10. Juli 2008 Powerpoint Präsentation Präpositionen Maria Grote und Kora Mak.
Rechtsgestaltung mit der Methode KORA
Click here to load reader
Transcript of Rechtsgestaltung mit der Methode KORA

Einleitung
Eine wesentliche Gemeinsamkeit von Technik und Recht ist der Einfluss, den beide auf die gesellschaftliche Entwicklung ausüben. Sowohl das Recht als auch die Technik können Einfluss auf die in-dividuellen Lebensbedingungen haben und so zu Veränderungen der Gesellschaft insgesamt führen.1 Dabei stehen Technik und Recht nicht isoliert nebeneinander, sondern beeinflussen sich auf unterschiedliche Weise. Beispielsweise können rechtliche Rah-menbedingungen technische Innovationen – je nach ihrer Aus-gestaltung – bremsen oder fördern. Rechtliche Regelungen sind dabei oft die Voraussetzung für die Etablierung technischer Inno-vationen.2 Dies gilt insbesondere dann, wenn neue Techniken in bestehende gesellschaftliche Strukturen und Abläufe eingeführt werden sollen. Als Konsequenz des stetig beschleunigten Fort-schritts technischer Entwicklungen muss damit auch das Recht in immer schnellerer Folge agieren und reagieren.
1 Roßnagel, Rechtswissenschaftliche Technikfolgenforschung – am Beispiel der Informations- und Kommunikationstechniken, in: Schulte (Hrsg.) Technische Innovation und Recht, 1997, S. 139 ff.
2 Roßnagel, Rechtliche Regelungen als Voraussetzung für Technikgestal-tung, in: Müller/Pfitzmann (Hrsg.), Mehrseitige Sicherheit in der Kommunikati-onstechnik, 1997, S. 367.
Bei der rechtlichen Erfassung der neuen Technik steht der Ge-setzgeber jedoch vor dem Problem, eine angemessene Regelung zu treffen.3 Bei Erlass sehr abstrakter, nahezu technikneutraler Regelungen besteht zwar der Vorteil, dass das Recht nicht ständig der sich durch Forschung und Wissenschaft verändernden Tech-nik angepasst werden muss. Jedoch ist in diesem Fall die Steue-rungswirkung des Rechts sehr gering. Andererseits dürfen die Re-gelungen auch nicht so spezifisch sein, dass Innovationen faktisch verhindert werden. Für den Gesetzgeber besteht damit die Aufga-be, Regelungen zu gestalten, die zum einen ausreichende Rechts-sicherheit gewährleisten, zum anderen die technischen Entwick-lungen nicht bremsen. Zudem muss der Gesetzgeber eine Prog-nose über die neue Technik und ihren Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft treffen. Dies erfordert ein methodisches Vorge-hen, um zielführende Regelungen zu treffen und Widersprüche zu vermeiden. Das Vorgehen muss überprüfbaren Regeln folgen und einen rationalen, nachvollziehbaren Prozess darstellen. Hier-durch wird sichergestellt, dass der Weg zu den rechtlichen Rege-lungen willkürfrei und unabhängig von politischen Interessen ist.
Wie ist nun bei der Ausarbeitung von Gesetzen und Normen für eine neue Technik vorzugehen? Wie wird gewährleistet, dass die gesetzlichen Regelungen sowohl den verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechen als auch der technischen Innovation ge-recht werden? Der folgende Beitrag wird diesen Fragen nachge-hen und darstellen, wie die für die Technikgestaltung entwickel-te Methode der Konkretisierung rechtlicher Anforderungen (KORA)4 für die Rechtsgestaltung nutzbar gemacht werden kann.
3 Roßnagel, Das Neue regeln, bevor es Wirklichkeit geworden ist – Recht-liche Regelungen als Voraussetzung technischer Innovation, in: Sauer/Lang (Hrsg.), Paradoxien der Innovation, 1999, S. 193 ff.
4 Vgl. z. B. Hammer/Pordesch/Roßnagel, Betriebliche Telefon- und ISDN-An-lagen rechtsgemäß gestaltet, 1993, 43 ff.; Pordesch, Die elektronische Form und das Präsentationsproblem, 2003, 257 ff.; Roßnagel, Rechtswissenschaftliche Ge-staltung von Informationstechnik, in: Kortzfleisch/Bohl (Hrsg.), Wissen, Vernet-zung, Virtualisierung, FS Winand, 2008, 381 ff.
Ass. jur. Anna Kahlert
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Technik und Umweltrecht im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel und Mitglied in der „Projektgruppe verfassungsverträg-liche Technikgestaltung“ (provet).
E-Mail: [email protected]
Anna Kahlert
Rechtsgestaltung mit der Methode KORA
Entwicklung von Vorschlägen für die Gesetzgebung am Beispiel der Internetwahl bei Sozialwahlen
Um sowohl technikadäquate Regelungen als auch Rechtssicherheit zu erreichen, bedarf es bei der gesetzlichen Regelung einer Technik einer Gesamtschau der technischen Innovation einerseits und der rechtlichen Regelungstechniken andererseits. Bestehende Ansätze in der Wissenschaft und Praxis, wie die Formulierung von Generalklauseln oder technikneutralen Rechtssätzen, sind hierfür nicht ausreichend. Der Beitrag zeigt, wie auf Grundlage der Methode KORA technikgerechte Vorschläge für die Gesetzgebung entwickelt werden können.
86 DuD • Datenschutz und Datensicherheit 2 | 2014
SCHWERPUNKT

1 Erfordernis einer Methode zur technikadäquaten Rechtsgestaltung
Der immer schnellere wissenschaftlich-technische Fortschritt bringt – insbesondere im Informations- und Kommunikations-sektor – nicht nur immerwährend neue Technologien hervor, er impliziert für das Recht auch die Herausforderung, wie mit die-sen neuen Bereichen umgegangen werden soll. Die Aufgabe des Rechts, hierfür rechtliche Lösungen zu finden, ist jedoch nicht neu. Schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung, musste sich der Norm-geber beispielsweise mit der damals noch jungen Dampfkessel-technologie befassen.5 Demnach existieren in Wissenschaft und Praxis bereits verschiedene Vorgehensweisen bei der Rechtsge-staltung, die dem besonderen Verhältnis von Recht und Technik gerecht werden sollen.
Bei der Methode der Verwendung von Generalklauseln wer-den Rechtsregeln formuliert, indem auf wissenschaftliche und technische Standards Bezug genommen wird.6 Ein technisches System entspricht dann den rechtlichen Vorschriften, wenn es zum Beispiel „den allgemein anerkannten Regeln der Technik“7, dem „Stand der Technik“8 oder dem „Stand von Wissenschaft und Technik“9 entspricht. Hierdurch wird der rechtliche Maß-stab des Erlaubten und Gebotenen auf außerhalb der Rechtsord-nung stehende Ordnungsgefüge, namentlich standardisierte wis-senschaftlich-technische Entwicklungen, übertragen. Mit Hilfe des Verweises auf technische Standards werden diese zum Maß-stab dessen, was rechtlich erforderlich ist.10 Durch den Erlass von Generalklauseln überlässt der Gesetzgeber somit die Ausgestal-tung des Rechts Dritten. Dadurch wird er jedoch insbesondere in grundrechtsrelevanten Bereichen seiner parlamentarischen Ver-antwortung nicht gerecht.11 Durch das nicht verbundene Neben-einander von rechtlichen Generalklauseln und der technischen Entwicklungsdynamik wird keine adäquate Beeinflussung der Technik bewirkt. Vielmehr erfolgt eine Freigabe der Technik zur Selbststeuerung.12
Ein weiterer Ansatz besteht darin, gesetzliche Regelungen tech-nikneutral zu formulieren. Dabei besteht jedoch keine einheitli-che Auffassung von Technikneutralität.13 Eine moderate Forde-rung von Technikneutralität verlangt, dass Regelungen keine be-stimmte technische Lösung vorschreiben und grundsätzlich kei-ne konkrete Technik erwähnen sollen. Ein darüber hinaus gehen-des Verständnis von technikneutralen Regelungen besteht, wenn gefordert wird, dass eine Technikregelung möglichst keine oder so wenig wie mögliche technikbezogene Regelungen treffen soll.14
5 Vgl. die Dampfkesselverordnung in RGBl. 1909, S. 3.6 Bundesministerium der Justiz (BMJ), Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 3.
Aufl., 2008, Rn. 252 ff.7 Vgl. u.a. § 3 Abs. 1 GerätesicherheitsG und § 17 Abs. 2 SprengstoffG.8 Vgl. u.a. § 14 S. 2 BundesimmissionsschutzG und §§ 43 Abs. 1, 49
StraßenverkehrszulassungsO.9 Vgl. u.a. §§ 4 Abs. 2 Nr. 3, 5 Abs. 1 S. 2 AtomG und § 4 Abs. 1 Nr. 1
SprengstoffG.10 Nicklisch, NJW 1982, 2633 (2634).11 Vgl. hierzu ausführlich Roßnagel, ZRP 1992, 55.12 Roßnagel, ZRP 1992, 55 (60).13 Vgl. hierzu ausführlich Roßnagel, „Technikneutrale“ Regulierung: Mög-
lichkeiten und Grenzen, in: Eifert/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Innovationsfördernde Regulierung, 2009, S. 323 ff.
14 Roßnagel, „Technikneutrale“ Regulierung: Möglichkeiten und Grenzen, in: Eifert/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Innovationsfördernde Regulierung, 2009, S. 325.
In diesem Fall wird in der Regel mit Generalklauseln, wie sie zu-vor dargestellt wurden, gearbeitet.
Unabhängig davon, welches Verständnis dem Begriff der Tech-nikneutralität zugrunde gelegt wird, ist festzuhalten, dass durch die Verwendung technikneutraler Regelungen die Regulierung der Technik auf andere als den Gesetzgeber, insbesondere auf die Rechtsprechung und technische Sachverständige, verlagert wird. Die Folge ist eine geringe Rechtssicherheit, da verschiedene Ge-richte, insbesondere auch durch unterschiedliche Ansichten ver-schiedener Sachverständigen zu divergierenden Entscheidun-gen kommen können. Zudem kann es zu langwierigen Prozes-sen kommen, sodass die Beteiligten erst nach Abschluss des In-stanzenzuges Rechtssicherheit erlangen.
Sofern der Gesetzgeber Normen mit einem hohen Konkretisie-rungsgrad erlässt, besteht zwar der Vorteil einer hohen Rechts-sicherheit. Jedoch ist es nachteilig, dass Technologien, die nach dem Erlass der Normen entwickelt oder fortentwickelt werden, nicht erfasst sind. Hierdurch entsteht ein fortwährender Rege-lungsbedarf.
Die Herausforderung liegt nach alldem darin, rechtliche Rege-lungen zu entwickeln, die zum einen der jeweiligen Technik ge-recht werden und zum anderen Rechtssicherheit für Anwender und Behörden bewirken. Wie die Methode KORA hierfür einen Beitrag leisten kann, soll im Folgenden dargestellt werden.
2 Die Methode KORA
Die Projektgruppe verfassungsverträgliche Technikgestaltung (provet) entwickelte die Methode KORA mit dem Ziel, die Gestaltung von Technik möglichst frühzeitig juristisch zu begleiten.15 Hier-für werden in einem interdisziplinären Diskurs abstrakte rechtli-che Vorgaben in mehreren Schritten zu technischen Gestaltungs-vorschlägen konkretisiert. Das gestufte Vorgehen ermöglicht es, die Lücke zwischen den größtenteils unspezifischen rechtlichen Vorgaben und konkreten technischen Zielen zu schließen. Im Er-gebnis gelangt man so zu technikadäquaten und technikspezifi-schen Formulierungen für die Technikgestaltung.
Vorab sind die für eine neue Technik einschlägigen rechtli-chen Vorgaben zu identifizieren. Diese können aus dem europäi-schen Recht, dem Grundgesetz und einfachen Gesetzen entnom-men werden. Bei der Auswahl der rechtlichen Vorgaben sind so-wohl die Anwendungsbereiche der Technik als auch der rechtli-che Kontext zu beachten.
Nach der Identifizierung der Vorgaben sieht die Methode KO-RA einen vierstufigen Prozess vor. Dieser gliedert sich wie folgt:
In einem ersten Schritt werden die rechtlichen Vorgaben zu rechtlichen Anforderungen konkretisiert. Hierzu werden die Chancen und Risiken beschrieben, die durch den Einsatz der Technik für die soziale Funktion der rechtlichen Vorgaben ent-stehen. Die rechtlichen Anforderungen sind damit auf die je-weilige Technik präzisiert, werden jedoch in der Sprache des Rechts formuliert.
Die rechtlichen Anforderungen werden in einem zweiten Schritt zu rechtlichen Kriterien konkretisiert. Diese beschreiben, wie die einzelnen Aspekte der Anforderungen von der spezifi-
15 Vgl. über Fn. 4 hinaus z. B. Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß ge-stalten, Baden-Baden 2012; Laue, Vorgangsbearbeitung in der öffentlichen Ver-waltung, 2009; Scholz, Datenschutz beim Interneteinkauf – Gefährdungen – An-forderungen – Gestaltungen, 2003.
DuD • Datenschutz und Datensicherheit 2 | 2014 87
SCHWERPUNKT

schen Technik erfüllt werden können. Eine Entscheidung für einen bestimmten technischen, organisatorischen oder rechtli-chen Lösungsansatz wird dabei indes nicht getroffen. Vielmehr sollen alle Gestaltungslösungen auf dieser Ebene noch mög-lich bleiben. Die Kriterien sind bereits techniknäher formu-liert, werden jedoch ebenfalls noch in der Sprache des Rechts beschrieben.
Aus den rechtlichen Kriterien werden in einem dritten Schritt technische Ziele abgeleitet. Hierdurch werden elementare Funk-tionen beschrieben, die erfüllt sein müssen, damit die Technik den rechtlichen Kriterien entspricht. In diesem Schritt findet ein Wechsel in die technische Sprache statt.
In einem vierten und letzten Schritt werden aus den techni-schen Zielen konkrete technische Gestaltungsvorschläge für Her-steller und Anwender abgeleitet. Die Vorschläge werden gefun-den, indem mögliche technische Lösungen der Ziele diskutiert werden. Die Gestaltungsvorschläge gewährleisten letztendlich, dass sich die zu gestaltende Technik im Einklang mit den (ver-fassungs-)rechtlichen Vorgaben befindet.
Die Methode KORA ist somit eine systematische Vorgehensweise zur Ableitung technischer Ziele und Gestaltungsvorschläge aus abstrakten rechtlichen Vorgaben. Dabei wird ein interdiszipli-närer Diskurs zwischen Rechtswissenschaftlern und Technikern geführt.
3 Erweiterung für die Rechtsgestaltung
Obwohl die Methode KORA in erster Linie der rechtsverträgli-chen Technikgestaltung dient, kann sie auch für die verfassungs-konforme und technikadäquate Rechtsgestaltung herangezogen werden. Der Grundgedanke der Methode, technische Innovatio-nen bereits vor oder während ihrer Entwicklung rechtlich zu be-gleiten, kann für die Situation herangezogen werden, dass eine neue Technik zwar dem Grunde nach existiert, jedoch sowohl eine konkrete Umsetzung als auch eine gesetzliche Normierung derselben noch nicht erfolgt ist. Das Recht dient in beiden Fällen dazu, die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen einer In-novation zu steuern.
Um eine Rechtsgestaltung zu unterstützen, die zum einen dem höherrangigen Recht entspricht, als auch den Chancen und Ri-siken der jeweiligen Technik bestmöglich Rechnung trägt, wird die Methode KORA folgendermaßen erweitert:
Aus verfassungsrechtlichen Vorgaben werden zunächst rechtli-che Anforderungen und daraus rechtliche Kriterien abgeleitet. Die ers-ten beiden Stufen von KORA bleiben damit unverändert. In ei-nem dritten Schritt werden dann jedoch aus den rechtlichen Kri-terien rechtliche Regelungsziele abgeleitet. Die Regelungsziele um-schreiben den Inhalt möglicher rechtlicher Normierungen, die notwendig sind, um die rechtlichen Kriterien zu erfüllen. Die Re-gelungsziele müssen dabei die gesetzlich einzuführende Technik im Blick haben. Nur so wird eine sachgerechte Technikregulie-rung gewährleistet. Konkrete technische Aspekte müssen dem-nach – soweit es erforderlich ist – beachtet werden. Es kann zwi-schen drei Arten von Regelungszielen unterschieden werden: Ers-tens Regelungsziele, die Anforderungen an die Beschaffenheit von Technik stellen. Zum zweiten Regelungsziele, die die Organisati-on betreffen und insoweit Lücken schließen. Drittens Regelungs-ziele, die verbleibende Risiken ausgleichen, z.B. die Haftung zum Gegenstand haben.
In einem vierten Schritt werden anschließend rechtliche Gestal-tungsvorschläge erarbeitet. Um zu vermeiden, dass bereits geregelte Sachverhalte erneut erfasst werden, müssen hierfür die zuvor for-mulierten Regelungsziele mit bereits existierenden Normen des je-weiligen Rechtsgebiets abgeglichen werden. Sofern eine existieren-de Norm ein Regelungsziel ausreichend erfasst und geeignet ist, die rechtlichen Kriterien zu gewährleisten, muss nicht zwangsläufig ein neuer rechtlicher Gestaltungsvorschlag ausgearbeitet werden. Wenn es sich jedoch um einen Aspekt handelt, der bislang in keiner rechtlichen Normierung zum Ausdruck kommt, muss zwingend ein Gestaltungsvorschlag ausformuliert werden. Es wird somit der Regelungsbedarf festgestellt. Dieser besteht nur dann, wenn kon-krete Normen fehlen, existierende Normen ungeeignet oder un-vollständig im Hinblick auf die rechtlichen Kriterien sind.
Bei der konkreten Ausformulierung der als notwendig erkann-ten rechtlichen Gestaltungsvorschläge ist dann zu klären, welche Art der Regelung in Frage kommt. So können die Vorschläge bei-spielsweise ihren Niederschlag in einem Gesetz oder in einer Ver-ordnung finden. Besondere Details können überdies in einer An-lage oder Richtlinie geregelt werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Regelungsdichte des Gestaltungsvorschlags zu erar-beiten. Dabei ist der Frage nachzugehen, wie konkret und aus-führlich er geregelt werden muss, damit er seine volle Wirkung entfalten kann und technische Innovationen nicht verhindert.
In formaler Hinsicht ist bei dem Entwurf eines gesamten Ver-ordnungs- oder Gesetzesvorschlags auf die Vorgaben des Bun-desjustizministeriums zurückzugreifen.16 Diese Vorgaben dienen dazu, eine formal übersichtliche, verständliche und insbesonde-re bundesweit einheitliche Formulierung von Gesetzesentwür-fen zu gewährleisten.
Nach alldem kann die Methode KORA als eine Art „heuris-tisches Hilfsmittel“ zur Rechtsgestaltung herangezogen werden. Auf Grundlage der ersten beiden Stufen können nicht nur techni-sche Gestaltungsziele und technische Gestaltungsvorschläge ge-macht werden. Vielmehr kann KORA auch als Methode genutzt werden, um rechtspolitische Themen zu identifizieren und diese in die Normierung zu führen. Die beiden methodischen Vorge-hensweisen von KORA, die Technikgestaltung einerseits und die Rechtsgestaltung andererseits, müssen jedoch nicht unabhängig voneinander stehen. Vielmehr können die beiden Pfade parallel verfolgt werden, sodass sie sich gegenseitig ergänzen.
Wie KORA zur Rechtsgestaltung angewendet werden kann, soll am Beispiel der Internetwahl bei Sozialwahlen deutlich ge-macht werden.
4 Anwendungsbeispiel: Internetwahl bei Sozialwahlen
Bei den alle sechs Jahre stattfindenden Sozialwahlen werden die Vertreter in den Gremien der Sozialversicherungsträger gewählt. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Sozialversicherungen, also sowohl die Versicherten als auch die Arbeitgeber. Die Stimmabga-be bei den Sozialwahlen erfolgt derzeit ausschließlich brieflich. Ins-besondere nach der letzten Wahl im Jahr 2011 wurde im Rahmen eines Modernisierungsvorschlags der Verantwortlichen die Emp-
16 Bundesministerium der Justiz (BMJ), Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 3. Aufl., 2008.
88 DuD • Datenschutz und Datensicherheit 2 | 2014
SCHWERPUNKT

fehlung abgegeben, die Sozialwahlen auch online durchzuführen.17 Die Ermöglichung von Onlinewahlen ist zudem auch Gegenstand des Koalitionsvertrages der neuen Bundesregierung.18
Im Folgenden werden anhand des bereits dargestellten metho-dischen Vorgehens, gesetzliche Vorschläge für eine fakultative, zusätzlich zum derzeitigen Briefwahlverfahren mögliche Inter-netwahl vorgestellt. Ein vollständiger Gesetzgebungsvorschlag würde dabei jedoch den Rahmen dieses Beitrags überschreiten, sodass hier ausgehend von lediglich zwei verfassungsrechtlichen Vorgaben die Erarbeitung von Gesetzgebungsvorschlägen exem-plarisch gezeigt wird.
Der Fokus liegt hierbei auf den Vorgaben der geheimen und der öffentlichen Wahl. Diese beiden Wahlrechtsgrundsätze sind in der Verfassung verankert. Während die geheime Wahl aus-drücklich in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG genannt wird, folgt der Öf-fentlichkeitsgrundsatz aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG in Verbin-dung mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG.19 Unmittelbar gelten die Wahlgrundsätze zwar nur für parlamentarische Wahlen. Jedoch entfalten sie als allgemeine verfassungsrechtliche Grundsätze ei-ne objektivrechtliche Ausstrahlungswirkung.20 Bei Wahlen in der funktionalen Selbstverwaltung, die ebenfalls der demokratischen Übertragung von hoheitlichen Entscheidungskompetenzen auf bestimmte Vertretungsorgane dienen, sind sie damit grundsätz-lich ebenfalls heranzuziehen.21 Ob sie in derselben Strenge wie bei den Parlamentswahlen gelten, wird im Rahmen der Konkretisie-rung zu den rechtlichen Anforderungen zu klären sein.
4.1 Rechtliche Anforderungen
Aus der rechtlichen Vorgabe der geheimen Wahl wird zunächst die rechtliche Anforderung der Unbestimmbarkeit22 abgeleitet. Dies bedeutet, dass die Wahlentscheidung des Wählers zu kei-nem Zeitpunkt mit seiner Person in Verbindung gebracht wer-den darf. Lediglich der Wähler selbst darf den Inhalt seiner Stim-me kennen. Es darf dem Wähler nicht ermöglicht werden, seine Wahlentscheidung gegenüber Dritten zu beweisen. Selbst wenn er seine Wahlentscheidung gegenüber anderen offenbart, darf der Wahrheitsgehalt dieser Aussage nicht überprüfbar sein. Unbe-stimmbar muss jedoch nicht nur die einzelne Wahlentscheidung sein. Bis zum Ablauf der offiziellen Wahlzeit darf auch das Ge-samtergebnis nicht bestimmbar sein. Das Ergebnis aller abgege-benen Stimmen darf erst nach Ende der Wahlhandlung errech-net werden. Damit ist es unzulässig, Zwischenstände bekannt zu geben. Ein Internetwahlverfahren wird somit der rechtlichen An-forderung der Unbestimmbarkeit gerecht, wenn sowohl die indi-viduelle Wahlentscheidung des Wählers als auch Zwischenergeb-nisse nicht erkennbar sind.
Aus der rechtlichen Vorgabe der öffentlichen Wahl wird die rechtliche Anforderung der Expertenkontrolle23 abgeleitet. Der Öf-
17 Schlussbericht des Bundeswahlbeauftragten für die Sozialwahlen zu den Sozialwahlen 2011, S. 222 f.; vgl. dazu auch: BT-Drs. /17/14779 (Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion - BT-Drs. 17/14500) - die Bundesregierung prüft demnach aktuell die seitens des Bundeswahlbeauftragten für die Sozialwahl 2011 getätigten Vorschläge zur Modernisierung der Sozialversicherungswahlen.
18 „Deutschlands Zukunft gestalten“ - Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode, S. 74.
19 BVerfGE 123, 39 ff.20 Morlok, in: Dreier, 2006, Art. 38 GG, Rn. 60;Trute, in: Münch/Kunig, 2001,
Art. 38 GG, Rn. 2 und 6.21 Baier, in: Krauskopf, 2013, § 45 SGB IV, Rn. 7.22 Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 140.23 Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S.159 f.
fentlichkeitsgrundsatz beinhaltet, dass alle wesentlichen Schritte der Wahl durch die Öffentlichkeit, also durch jeden Wähler sowie interessierte Bürger, überprüfbar sein müssen.24 Denn nur wer die Schritte des Wahlablaufs erfassen kann, vertraut auch in dessen Richtigkeit. Die Nachvollziehbarkeit des Wahlverfahrens ist dem-nach wesentliche Voraussetzung für die Existenz von Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der Wahl.25 Der Demokratiegrundsatz er-fordert dieses Vertrauen bei Parlamentswahlen insoweit, als die Wahl hier den grundlegenden Legitimationsakt für die Über-tragung der Staatsgewalt vom Volk auf das Parlament darstellt. Den Sozialwahlen kommt jedoch nicht dieselbe demokratische Bedeutung zu. Bei den Gremien der Sozialversicherungsträger steht vielmehr die fachbezogene Aufgabenerfüllung im Vorder-grund, sodass das Demokratieprinzip insofern zurücktritt. Da-rüber hinaus besteht auch ein geringeres Risiko im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit von Manipulationen der Wahl sowie be-züglich zu erwartender gesellschaftlicher Schäden. Für die Ablei-tung der rechtlichen Anforderung bedeutet dies, dass eine unein-geschränkte Nachvollziehbarkeit aller – auch technischen – Vor-gänge im Zusammenhang mit einer Internetwahl für den tech-nischen Laien nicht zu fordern ist. Jedoch muss grundsätzlich Transparenz des Wahlgeschehens bestehen, sodass noch von ei-ner demokratisch ausgeformten Wahl gesprochen werden kann und im Hinblick auf die Wahlprüfung eine Kontrolle des kor-rekten Wahlablaufs möglich ist. Konkret beinhaltet die rechtli-che Anforderung der Expertenkontrolle somit die Notwendigkeit der Etablierung eines Prüfverfahrens bei der Sozialwahl, welches die Nachvollziehbarkeit des Wahlgeschehens ermöglicht. Dabei ist es ausreichend, wenn dieses lediglich für technisch vorgebil-dete Personen möglich ist. So könnten beispielsweise unabhängi-ge Technikexperten die Kontrolle des Wahlverfahrens überneh-men und den Laien die Ergebnisse mitteilen.
4.2 Rechtliche Kriterien
Aus der rechtlichen Anforderung der Unbestimmbarkeit wer-den die rechtlichen Kriterien der Unerkennbarkeit und der Unver-knüpfbarkeit abgeleitet.26
Unerkennbarkeit bedeutet, dass die Wahlentscheidungen der Wähler vom Zeitpunkt der Stimmabgabe bis zum Ende der Wahl-zeit so geschützt werden müssen, dass keine anderen Personen hier-von Kenntnis erlangen können. Für die Berechnung des Wahler-gebnisses muss der Inhalt der Stimmen jedoch eingesehen werden. Die Unerkennbarkeit endet somit zu diesem Zeitpunkt. Davor darf ein Auslesen der Stimmen aber in keinem Fall möglich sein. Sofern bereits während der andauernden Wahlzeit ein Zwischenergebnis ermittelt wird, kann gegebenenfalls auf das Gesamtergebnis und somit den Ausgang der Wahl geschlossen werden. Dies könnte die-jenigen Wähler in ihrer Wahlentscheidung beeinflussen, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben.27
Die Schwierigkeit liegt bei einem Internetwahlverfahren da-rin, dass die Stimmabgabe nicht vor Ort in öffentlichen und von den Wahlvorständen kontrollierbaren Wahlräumen, sondern in einem privaten Umfeld ausgeführt wird. Bei der Stimmabgabe in einem privaten Bereich kann die Wahlentscheidung des Wäh-
24 BVerfGE 123, 39.25 BVerfGE 123, 39 (69).26 Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 144 ff.27 Hierdurch wäre nicht nur die geheime Wahl, sondern gleichermaßen die
freie Wahl betroffen.
DuD • Datenschutz und Datensicherheit 2 | 2014 89
SCHWERPUNKT

lers nicht umfassend vor der Einsichtnahme durch andere Per-sonen geschützt werden. So ist es denkbar, dass ein Wähler wäh-rend der Ausübung der Wahlhandlung am heimischen Computer unter der Beobachtung einer weiteren anwesenden Person steht, die somit den Stimminhalt des Wählers erkennen kann. Dies ist bei der Sozialwahl aber keine Verschlechterung im Vergleich zu der aktuellen Situation. Derzeit ist hier die Briefwahl obligato-risch, sodass sie grundsätzlich ebenfalls der Kontrolle durch den Wahlausschuss entzogen ist. Im Rahmen des rechtlichen Krite-riums der Unerkennbarkeit ist bei der Internetwahl darüber hi-naus das Verhindern von lesenden Zugriffen auf den zur Stimm-abgabe genutzten Rechner und das Mitlesen während der Über-tragung der Stimme zu fordern. Das Internetwahlverfahren muss durch wirksame Maßnahmen vor diesen Zugriffen auf den Inhalt der Stimme geschützt werden.
Das Kriterium der Unverknüpfbarkeit besagt, dass der Inhalt der Wahlentscheidung zu keinem Zeitpunkt mit der Person des Wählers in Verbindung gebracht werden darf. Die Unerkennbar-keit gewährleistet dies bereits bis zum Ende der Wahlzeit, indem der Stimminhalt von Dritten nicht einsehbar sein darf. Das Krite-rium der Unverknüpfbarkeit erfasst das Wahlgeschehen über das Ende der Wahlzeit hinaus. Bei der Zählung der Stimmen darf es demnach nicht möglich sein, die Wahlentscheidung mit der Iden-tität des Wählers zu verknüpfen. Ferner darf es dem Wähler nicht möglich sein, eine Verbindung zu seiner Wahlentscheidung der-gestalt herzustellen, dass er gegenüber einem Dritten beweisen kann, dass diese tatsächlich von ihm stammt. Der Wähler darf weder bewusst noch versehentlich einen Beweis seiner Wahlent-scheidung generieren können.
Eine dauerhafte Trennung von Stimme und Wähler im Sin-ne der Unverknüpfbarkeit gestaltet sich bei der elektronischen Stimmabgabe als schwierig. Die im Rahmen des Wahlverfah-rens anfallenden informationstechnischen Daten müssen hier-für so getrennt werden, dass sich aus ihnen keinerlei Rückschlüsse auf die Wahlentscheidung eines Wählers ziehen lassen. Dies lässt sich technisch durch eine Verschlüsselung sowohl der Stimme als auch der Wählerdaten erreichen. Jedoch besteht die Gefahr, dass die Verschlüsselung durch den Einsatz leistungsfähiger Rechner geknackt werden kann. Ferner könnte die Verbindung zwischen dem Wähler und seiner Stimme bereits bei der Stimmabgabe end-gültig getrennt werden. Jedoch erschwert dies eine nachträgliche Kontrolle der Stimme durch den Wähler.
Aus der rechtlichen Anforderung der Expertenkontrolle erge-ben sich die rechtlichen Kriterien der Individual- und Publikums-kontrolle28 im Hinblick auf technisch vorgebildete Wähler und Interessierte.
Die Individualkontrolle bezieht sich auf den einzelnen Wäh-ler. Diesem muss die Kontrolle seiner Stimme dahingehend mög-lich sein, ob sie korrekt gespeichert und in das Wahlergebnis ein-bezogen wird. Der gespeicherte und gezählte Stimminhalt muss mit dem von ihm gewollten Inhalt im Zeitpunkt der Abgabe über-einstimmen. Dies muss nicht zwingend auch technischen Laien möglich sein. Bei Sozialwahlen ist es ausreichend, wenn ledig-lich Wählern mit technischem Fachwissen die Individualkon-trolle möglich ist. Zwingend muss jedoch beachtet werden, dass trotz der Bereitstellung einer Kontrolle der eigenen Stimme sei-
28 Richter, Wahlen im Internet rechtsgemäß gestalten, 2012, S. 146 f.
tens der Experten eine Verknüpfung von Wähler und Stimmin-halt für Dritte nicht möglich ist.29
Das Kriterium der Publikumskontrolle beinhaltet die Nach-vollziehbarkeit des Wahlablaufs durch alle Bürger. Hierzu zäh-len im Gegensatz zum Kriterium der Individualkontrolle auch Nichtwahlberechtigte30 sowie Nichtwähler. Der Öffentlichkeits-grundsatz wird grundsätzlich auch so verstanden, dass die Wahl insgesamt „vor den Augen der Öffentlichkeit“ stattfinden soll.31 Diese kollektive Seite des Öffentlichkeitsgrundsatzes muss ent-sprechend Berücksichtigung finden.
Die Publikumskontrolle erfordert daher, dass jeder Interessier-te die Wahl beobachten und die einzelnen Schritte des Wahlver-fahrens nachvollziehen können muss. Dies ist freilich bei der der-zeitigen Briefwahl auch schon nur eingeschränkt möglich, da die Stimmabgabe nicht in einem öffentlich einsehbaren Wahlraum geschieht. Das Kriterium ist demnach so aufzufassen, dass dort, wo eine öffentliche Beobachtung des Geschehens möglich ist – beispielsweise bei der Auszählung der Stimmen – sie auch er-möglicht werden muss. Bei der Kontrolle durch die Öffentlich-keit darf es allerdings ebenfalls zu keiner Beeinträchtigung des Wahlgeheimnisses kommen.
4.3 Regelungsziele
Aus den dargestellten rechtlichen Kriterien werden nunmehr rechtliche Regelungsziele entwickelt. Diese beschreiben den Inhalt notwendiger gesetzlicher Regelungen näher und konkretisieren dabei die rechtlichen Kriterien im Hinblick auf eine technikad-äquate Regelung. Sie stellen damit das Ziel einer zu erlassenden Regelung in Bezug auf eine konkrete Technik, hier das Internet-wahlverfahren, heraus.
Aus dem Kriterium der Unerkennbarkeit folgt die Sicher-stellung der Vertraulichkeit der elektronischen Stimme. Die Stimminhalte dürfen danach bis zum Ende der Wahlzeit über-haupt nicht eingesehen werden können. Es darf Dritten nicht möglich sein nachzuverfolgen, für welche Wahloption der Wäh-ler seine Stimme abgegeben hat. Zur Ermittlung des Wahlergeb-nisses müssen die Stimminhalte für Berechtigte, wie den Wahl-vorstand oder -ausschuss, offengelegt werden. Nur bestimmten Personen wird somit der Zugriff auf die elektronischen Stimmen erlaubt. Durch den Schutz der Vertraulichkeit der Stimme wird gleichzeitig das Ermitteln von Zwischenergebnissen verhindert. Der Zugriff auf die Stimmen und auch die Auszählung derselben darf erst nach dem Ende der Wahlzeit möglich sein.
Das Regelungsziel des Ausschlusses der Erstellung von Wahl-belegen folgt aus den rechtlichen Kriterien der Unverknüpfbar-keit und der Unerkennbarkeit. Der Wähler darf demnach kei-nen Beleg über den Inhalt seiner Wahlentscheidung bekommen. Durch einen schriftlichen Ausdruck oder einen anderen Beleg lie-ße sich sowohl die Stimmabgabe an sich, also die Tatsache dass man gewählt hat, als möglicherweise auch der Inhalt der Stim-me auslesen. Sofern eine Quittung über den Inhalt der abgege-benen Stimmen erstellt wird, würde somit die Möglichkeit ge-schaffen, die Wahlentscheidung der Wähler durch Bestechung
29 Dies würde sonst dem rechtlichen Kriterium der Unverknüpfbarkeit widersprechen.
30 Dies wären bei der Sozialwahl z.B. Personen, die bei einem Sozialversiche-rungsträger kein Mitglied sind.
31 So Schreiber, BWahlG, § 31, Rn. 2 für die Bundestagswahl.
90 DuD • Datenschutz und Datensicherheit 2 | 2014
SCHWERPUNKT

oder Erpressung zu beeinflussen. Eine Regelung muss demnach ausschließen, dass solche Wahlbelege generiert werden können.
Aus den rechtlichen Kriterien der Unerkennbarkeit und der Unverknüpfbarkeit folgt schließlich auch das Regelungsziel der Gewährleistung der Wähleranonymität während des gesamten Wahlverfahrens. Dieses beinhaltet, dass eine Verknüpfung von Wähler und Stimme zu keinem Zeitpunkt herstellbar sein darf. Eine Regelung muss dies somit sicherstellen. Bis zum Ende der Wahlzeit wird dies durch das Regelungsziel der Sicherstellung der Vertraulichkeit der Stimme abgedeckt. Jedoch erfolgt zum Zweck der Auszählung nach Beendigung der Wahlzeit eine Offenlegung des Stimminhalts. Danach muss der Wähler vor der Zuordnung des Inhalts seiner Wahlentscheidung geschützt werden. Es ist da-bei unerheblich, wie die Wähleranonymität gewährleistet wird. Dies kann durch die gleichzeitige Geheimhaltung von Stimme und Wähleridentität geschehen. Ausreichend ist es jedoch auch, wenn entweder die Wahlentscheidung oder die Person des Wäh-lers geheim bleibt. Es kann zu Kontrollzwecken auch notwendig sein, eins von beiden offenzulegen.Aus dem rechtlichen Kriterium der Individualkontrolle ergibt sich das rechtliche Regelungsziel der Überprüfungsmöglichkeit der eigenen Wahlentscheidung. Demnach muss eine rechtliche Normierung erfolgen, die eine Kontrolle der Stimme durch den Wähler gewährleistet. Es muss für den einzelnen Wähler nach-vollziehbar sein, dass seine Stimme in das Wahlergebnis einge-flossen ist. Dies setzt zunächst voraus, dass die Stimme nach der Abgabe korrekt gespeichert wird und der Wähler dies erkennen kann. Anschließend muss er ebenfalls die ordnungsgemäße Be-rücksichtigung seiner Stimme im Gesamtergebnis nachvollzie-hen können. Der technische Sachverstand, der dabei vom Wäh-ler verlangt werden kann, entspricht dem eines technisch versier-ten Menschen. Eine gesetzliche Regelung könnte demnach sicher-stellen, dass die korrekte Speicherung, Übertragung und Zählung der Stimme von technischen Experten überprüfbar sein muss.
Aus dem rechtlichen Kriterium der Publikumskontrolle folgt das rechtliche Regelungsziel der Prüfung der Wahlhandlung durch die Öffentlichkeit. Hiernach müssen alle Bürger nach-vollziehen können, dass die Wahlhandlung korrekt verläuft. Al-le im Zusammenhang mit der Wahl wesentlichen Handlungen müssen durch die Öffentlichkeit nachvollzogen werden können. In Bezug auf die Durchführung einer Internetwahl bei der Sozial-wahl gilt also, dass die Nachvollziehbarkeit der einzelnen Schritte der Wahlhandlung durch eine gesetzliche Regelung sichergestellt werden muss. Die Nachvollziehbarkeit der einzelnen Schritte in-klusive der technischen Vorgänge orientiert sich dabei wieder an Personen mit technischer Fachkenntnis.
Das Regelungsziel der Prüfung der Stimmenauszählung durch die Öffentlichkeit beinhaltet, dass jeder Bürger das ord-nungsgemäße Zustandekommen des Wahlergebnisses prüfen können muss. Es folgt ebenfalls aus dem rechtlichen Kriterium der Publikumskontrolle. Demnach muss nachvollziehbar sein, dass das Wahlergebnis korrekt ermittelt wird. Im Rahmen der Prüfung der Auszählung muss erkennbar sein, ob Veränderun-gen an den abgegebenen Stimmen vorgenommen wurden. Eine Regelung muss demnach die ordnungsmäßige Zählung der Stim-men zum Gegenstand haben und die Prüfung derselben durch die Öffentlichkeit sicherstellen. Maßstab für die Verständlichkeit des elektronischen Auszählungsvorgangs im Detail ist wie bei den anderen Regelungszielen der technische Experte.
Zur Verwirklichung der Kriterien der Individualkontrolle und der Publikumskontrolle sowie der entsprechenden Regelungsziele muss der Ablauf der Wahl aufgezeichnet werden. Hierauf bezieht sich das Regelungsziel der Aufzeichnung des Wahlablaufs. Da-mit die Ordnungsmäßigkeit des Wahlablaufs nachvollzogen wer-den kann, ist es erforderlich, sicherheitsrelevante Vorkommnisse zu protokollieren. Dabei sind in erster Linie die verschiedenen Phasen der Wahl, wie der Beginn der Wahlzeit, die Fortsetzung nach einer etwaigen Unterbrechung, das Ende der Wahlzeit und das Starten der Auszählung zu dokumentieren. Des Weiteren sind eventuell vorkommende technische Unregelmäßigkeiten sowie Angriffs- und Manipulationsversuche aufzuzeichnen. Es ist darauf zu ach-ten, dass keine Daten aufgezeichnet werden, die einen Schluss auf die Wahlentscheidung des jeweiligen Wählers zulassen, da andern-falls die Vertraulichkeit der Stimme nicht mehr sichergestellt und die Anonymität der Wähler nicht gewährleistet wäre. Die aufge-zeichneten Daten müssen derart geschützt werden, dass sie weder von einem Mitglied des Wahlvorstands noch von anderen Perso-nen verändert werden können. Ein Zugriff auf die aufgezeichneten Daten darf nur zur Kontrolle der Wahl möglich sein.
Aus den rechtlichen Kriterien der Individualkontrolle und der Publikumskontrolle folgt schlussendlich auch das Regelungsziel der Aufbewahrung der Wahldurchführungsdaten zum Zweck der Überprüfung des Wahlverfahrens. Zu den Wahldurchfüh-rungsdaten zählen vornehmlich das Wählerverzeichnis, die Da-ten der Stimmzettel, die abgegebenen Stimmen und die Daten der zuvor beschriebenen Aufzeichnung des Wahlablaufs. Es muss si-chergestellt werden, dass diese Daten vollständig und lesbar vor-liegen und nicht manipuliert werden können. Sie müssen nach-vollzogen werden können, um gegebenenfalls Fehler im Wahl-verfahren aufzudecken und diese beweisen zu können. Eine Re-gelung muss demnach sicherstellen, dass die Daten, die im Rah-men der Wahldurchführung anfallen, über das Ende des Wahl-geschäfts hinaus für ein etwaiges Wahlprüfungsverfahren aufbe-wahrt werden. Die Sicherung der Daten muss dabei in nachvoll-ziehbarer Form erfolgen, sodass sie zu Beweiszwecken geeignet sind. Bei alldem darf jedoch keine Zuordnung von Wähler und Stimme möglich sein. Es muss insoweit auch den Regelungszielen der Vertraulichkeit der Stimme und der Anonymität der Wähler Rechnung getragen werden.
4.4 Rechtliche Gestaltungsvorschläge
Bei der Erarbeitung von rechtlichen Gestaltungsvorschlägen für die Internetwahl ist ein Abgleich der entwickelten Regelungszie-le mit den bereits existierenden Rechtsvorschriften für die Sozi-alwahl vorzunehmen. Hierdurch wird vermieden, dass ein Vor-schlag ausformuliert wird, obwohl bereits eine Norm existiert, die das jeweilige Regelungsziel ausreichend erfasst.
Wahlrechtliche Vorschriften, die das Verfahren der heutigen Sozialwahl regeln, existieren im Vierten Sozialgesetzbuch (SGB IV) und in der Wahlordnung für die Sozialversicherung (SVWO).
Die Regelungsziele der Sicherstellung der Vertraulichkeit der Stimme und der Gewährleistung der Wähleranonymität könnten möglicherweise durch § 45 Abs. 2 Satz 1 SGB IV und §§ 43 Abs. 1, 45 Abs. 4 SVWO erfasst sein. Die Norm des § 45 Abs. 2 Satz 1 SGB IV legt grundsätzlich fest, dass die Wahl ge-heim erfolgen muss und § 43 Abs. 1 SVWO regelt das Vorgehen bei der Briefwahl (z.B. Trennung von Stimmzettel und Wahlaus-weis mit den Daten des Wählers und Verwendung eines einheit-
DuD • Datenschutz und Datensicherheit 2 | 2014 91
SCHWERPUNKT

lichen Briefumschlags), wodurch die Wähleranonymität gewahrt wird. Jedoch wird hierdurch nicht den spezifischen Gefahren ei-ner Internetwahl Rechnung getragen. Auch die Vertraulichkeit der Stimme bis zum Ende der Wahlzeit wird nur im Ansatz ge-regelt, indem nach § 45 Abs. 4 SVWO die Öffnung der Wahlbrie-fe erst am Tag nach dem Ende der Wahlzeit geöffnet und ausge-zählt werden dürfen. Die Vorschriften sind nach ihrem Wortlaut somit ausschließlich auf die derzeitige papierbasierte Briefwahl anwendbar und können nicht auf eine Internetwahl übertragen werden. Die Regelungsziele müssen demnach in einen rechtlichen Gestaltungsvorschlag für Internetwahlen einfließen. Bezüglich des Regelungsziels des Ausschlusses der Erstellung von Wahl-belegen finden sich überhaupt keine passenden Vorschriften. Das Regelungsziel muss somit ebenfalls zu einem konkreten Gestal-tungsvorschlag formuliert werden.
Hinsichtlich der Regelungsziele der Überprüfungsmöglichkeit der eigenen Wahlentscheidung, der Prüfung der Wahlhandlung durch die Öffentlichkeit und der Prüfung der Stimmenauszäh-lung durch die Öffentlichkeit sind keine passenden Vorschrif-ten im SGB IV und der SVWO zu finden. Das Ziel der Prüfung der Stimmenauszählung durch die Öffentlichkeit war zwar in § 51 SVWO a.F. ursprünglich geregelt. Die Norm wurde jedoch mit Wirkung zum 1.10.2005 aufgehoben.32 Derzeit existieren damit kei-nerlei Vorschriften dazu, wie eine Nachvollziehbarkeit der eigenen Stimme, der Wahlhandlung insgesamt und der Auszählung ge-währleistet wird.33 Die Regelungsziele müssen bei der gesetzlichen Regelung einer Internetwahl insgesamt berücksichtigt werden.
Das Regelungsziel der Aufzeichnung des Wahlablaufs ist für das derzeitige Briefwahlverfahren in den §§ 5 Abs. 7, 57 Abs. 2 SVWO geregelt. Danach ist durch die Briefwahlleitung eine Nie-derschrift über die Ermittlung des Wahlergebnisses anzufertigen, wofür nach § 58 Abs. 5 SVWO ein Muster in der Anlage 14 exis-tiert. Die Regelungen sind jedoch sehr konkret für die Briefwahl formuliert und werden den Technik spezifischen Umständen ei-ner Internetwahl nicht gerecht. Hierzu müsste vielmehr geregelt werden, dass und wie die Aufzeichnung des elektronischen Wahl-verfahrens geschehen soll.
Für das Regelungsziel der Aufbewahrung der Wahldurchfüh-rungsdaten könnte § 91 SVWO einschlägig sein. Danach sind die Wahlunterlagen bis zum Ablauf der Amtsdauer der gewählten Organe aufzubewahren. Den Begriff der Wahlunterlagen könnte man so auslegen, dass hierunter auch die anhand des Regelungs-ziels beschriebenen Wahldurchführungsdaten fallen. Jedoch wird man der Technik der Internetwahl besser gerecht, wenn man ei-nen Gestaltungsvorschlag speziell für die elektronische Speiche-rung der Daten ausformuliert.
Die im Rahmen dieses Beitrags dargestellten Regelungsziele münden somit alle in rechtliche Gestaltungsvorschläge, die fol-gendermaßen formuliert werden können:
Die verwendete Internetwahltechnik muss so beschaffen sein, dass bis zum Beginn der Auszählung gemäß § 45 Abs. 4 SVWO die Stimmen nicht einsehbar sind.
Eine Verknüpfung von Wählerdaten und elektronischer Stim-me darf nicht möglich sein. Hierzu sind beispielsweise die elek-tronische Urne und das Wählerverzeichnis technisch zu tren-nen und die Übertragungswege so zu gestalten, dass keine Zu-ordnung der Wahlentscheidung zum Wähler möglich ist. 32 Vgl. BGBl. I S. 3242.33 Hier besteht insoweit möglicherweise eine Regelungslücke im Hinblick
auf die rechtliche Vorgabe des Wahlgrundsatzes der öffentlichen Wahl, aus dem sich die drei genannten Regelungsziele ableiten.
Die verwendete Internetwahltechnik darf die Erstellung eines Belegs über die Wahlentscheidungen nicht ermöglichen.
Es ist technisch sicherzustellen, dass dem technisch versierten Wähler eine verlässliche Kontrolle seiner Wahlentscheidung möglich ist.
Es ist technisch sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses nach-vollziehen kann. Die direkte Nachvollziehbarkeit kann dabei durch den technisch versierten Anteil der Öffentlichkeit, ins-besondere durch Experten vorgenommen werden. Das Ergeb-nis der Überprüfung wird dann für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Der Ablauf der Wahl muss in nachvollziehbarer und beweissi-cherer Form so protokolliert werden, dass technische Unregel-mäßigkeiten sowie versuchte und vollendete Angriffe und Ma-nipulationen des elektronischen Wahlsystems erkennbar sind.
Die Wahldurchführungsdaten werden entsprechend der Frist des § 91 SVWO sicher und in nachvollziehbarer Form aufbe-wahrt. Wahldurchführungsdaten sind dabei insbesondere die Wählerverzeichnisse, Stimmzetteldaten, die abgegebene Stim-men und die Protokollaufzeichnungen
Entsprechend der hier vorgestellten Vorgehensweise auf Grundla-ge der Methode KORA können für die übrigen verfassungsrecht-lichen Vorgaben für die Durchführung von Sozialwahlen weitere rechtliche Gestaltungsvorschläge abgeleitet werden, sodass im Er-gebnis ein vollständiger Vorschlag für den Gesetzgeber vorliegt. Die Gestaltungsvorschläge können bei Überführung in konkrete Normen noch angepasst werden, wobei der Inhalt der Vorschlä-ge zu gewährleisten ist.
5 Fazit
Anhand der Methode KORA lassen sich in erster Linie Vorschlä-ge für die Gestaltung verfassungskonformer Technik erarbeiten. Darüber hinaus kann die Methode aber zur Entwicklung von Vorschlägen für die Gesetzgebung herangezogen werden. Die Methode KORA in ihrer ursprünglichen Bestimmung und in ih-rer Erweiterung zur Rechtsgestaltung stehen jedoch nicht in ei-nem alternativen Verhältnis zueinander. Vielmehr können sie in einem interdisziplinären Diskurs von Technikern und Rechtswis-senschaftlern parallel angewendet werden und sich so gegensei-tig ergänzen. Hierdurch entsteht ein ganzheitliches Konzept zur optimalen Technik- und Rechtsgestaltung.
Bei der Entwicklung von Vorschlägen für die Gesetzgebung bedarf es einer Erweiterung von KORA durch die aufgezeigten Schritte rechtliche Regelungsziele und rechtliche Gestaltungsvorschlä-ge. Aus verfassungsrechtlichen Vorgaben werden durch die Ein-beziehung der konkreten Technik Gesetzgebungsvorschläge ab-geleitet. Dies wurde anhand der Wahlrechtgrundsätze der gehei-men und der öffentlichen Wahl für die gesetzliche Einführung ei-ner Internetwahl bei den Sozialversicherungswahlen dargestellt.
Gegenüber anderen Methoden, wie der Formulierung von technikneutralen Regelungen und Generalklauseln, besteht in-soweit der Vorteil der erhöhten Rechtssicherheit für Anwender und Adressaten von Rechtsregeln. Es können technikadäquate Rechtsregeln erarbeitet werden, die den jeweiligen Chancen und Risiken der Technik und gleichzeitig den verfassungsrechtlichen Vorgaben bestmöglich gerecht werden.
92 DuD • Datenschutz und Datensicherheit 2 | 2014
SCHWERPUNKT