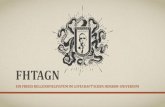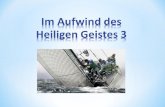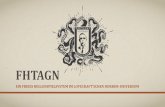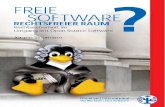Rights / License: Research Collection In Copyright - Non ...21565/eth-21565-01.pdf · Prinzip der...
Transcript of Rights / License: Research Collection In Copyright - Non ...21565/eth-21565-01.pdf · Prinzip der...
Research Collection
Doctoral Thesis
Zur Unterscheidung von natürlichen Fruchtessenzen undkünstlichen Fruchtäthern
Author(s): Landolt, Alphons
Publication Date: 1913
Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-000104564
Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted
This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For moreinformation please consult the Terms of use.
ETH Library
Zur Unterscheidungvon natürlichen Fruchtessenzen
und künstlichen Fruchtäthern.
ODD
Von der
EidgenössischenTechnischen Hochschule
in Zürich
zur Erlangung der
Wurde eines Doktors der technischen Wissenschaftengenehmigte
Promotionsarbeit
vorgelegt von
ALPHONS LANDOLT, dipl. Chemiker
aus AARAU
Referent: Herr Prof. Dr. F. P. TREADWELL
Korreferent: Herr Prof. Dr. C. HARTWICH
70
ZÜRICH d 1913
Dissert.-Druckerei Oebr. Leemann & Co.
Stockerstr. 64
Die vorliegende Arbeit wurde auf Anregung von
Herrn Prof. Dr. Kreis (Basel) im chemischen Labora¬
torium des Kantons Aargau in der Zeit vom Juni 1910
bis Juli ,1912 ausgeführt.
Es freut mich, dem verehrten Leiter dieser Ar¬
beit, HerrnKantonschemikerDr. J.Werder,
für sein freundliches Entgegenkommen und die tat¬
kräftige Unterstützung auch an dieser Stelle meinen
herzlichsten, bleibenden Dank aussprechen zu dürfen.
Allgemeiner Teil.
Die in der vorliegenden Abhandlung zu beschrei¬
benden Essenzen aus Früchten bilden einen Bestand¬
teil wohl der meisten, gegenwärtig im Handel be¬
findlichen, nach Früchten bezw. Fruchtaromas be¬
nannten Limonaden. Während der Handel mit Limo¬
naden früher in der Weise geschah, dass man ent¬
weder unmittelbar vor Abgabe des Getränkes an den
Konsumenten Fruchtsyrupe (namentlich Himbeer- und
Zitronensyrup) mit dem geeigneten Quantum Wasser
verdünnte oder Sio verdünnte Fruchtsyrupe, mit Kohlen¬
säure imprägniert, in Flaschen zum Verkaufe vor¬
rätig hielt, ist die Herstellung von Limonaden mit
dem infolge der unbestreitbaren Zunahme der Ab¬
stinenzbewegung stark gestiegenen Verbrauche eine
mehr fabrikmässige geworden. Es liegt auf der Hand,
dass den in der beschriebenen WTeise hergestellten
Produkten namentlich der Mangel geringer Haltbar¬
keit anhaftete und dass sie keinenfalls, wie dies heute
nötig, dazu bestimmt sein konnten, längere Zeit auf
Vorrat gehalten zu werden. Den von Natur aus
farbigen Syrupen wird nachgesagt, dass sie unter
dem Einfluss der Alkalinität des Wassers ihren Farb¬
stoff verlieren und missfarbig braun werden. Trübende
Ausscheidungen von Pektinstoffen und Terpenen tragen
weiter dazu bei, das Produkt unansehnlich zu machen.
Nicht selten treten auch noch Gärungserscheinungen
- 8 -
hinzu, die die Verderbnis vollenden. Anderseits wird
allerdings geltend gemacht, dass bei Verwendung tadel¬
los vergorenen und daher nahezu pektinfreien Himbeer¬
saftes, frisch destillierten, d. h. sterilen Wassers und
peinlicher Sauberkeit sehr wohl haltbare Limonaden
erzeugt werden können. Zweifellos ist das in grösseren
fachmännisch geleiteten Betrieben möglich.'
Seit aber
die Limonadefabrikation Gemeingut eigentlich eines
jeden geworden ist, der hiezu Neigung verspürt und
über die nötigen Einrichtungen und Apparaturen ver¬
fügt, dürfte es schwer halten, auf den puristischen
Standpunkt zurückzukehren und als Limonaden nur
aus reinen Fruchtsäften und kohlensäurehaltigem
Wasser hergestellte Produkte zuzulassen. Die relativ
hohen Erstellungskosten boten einen weiteren Anlass,
Mittel und Wege zu anderen, für den Fabrikanten
bequemeren und vorteilhafteren Herstellungsarten zu
suchen. Es darf nicht verwundern, wenn sich hiebei
Abweichungen vom geraden Wege ergaben und Pro¬
dukte in den Handel kamen, die auf die Bezeichnung
Fruchtlimonade keinen Anspruch mehr zu erheben be¬
rechtigt waren, sei es, dass man den natürlichen,
wenig haltbaren Farbstoff durch Zusatz eines künst¬
lichen verstärkte, sei es, dass der Fruchtsaft ge¬
streckt und mit künstlichen organischen Säuren ver¬
setzt wurde, sei es, dass man das natürliche, aro¬
matische Prinzip der Fruchtfleischpressäfte ganz oder
zum Teil durch sogen. Limonade-Essenzen er¬
setzte. Diese Essenzen weisen sowohl bezüglich Her¬
stellungsart als Zusammensetzung recht grosse Ver¬
schiedenheitein auf. Vor allem ist hier zu unter¬
scheiden zwischen den aus frischen Früchten nach
unten zu beschreibenden Methoden gewonnenen, eigent¬lichen Fruchtessenzen und den künstlich her-
— 9 —
gestellten Fruchtäthern, die mit den Früchten,nach denen sie benannt werden, nur insofern eine
Beziehung haben, als sie das Aroma derselben mehr
oder weniger gut nachzuahmen vermögen.
Die natürlichen Fruchtessenzen werden
aus den entsprechenden Früchten durch Zerquetschen
der letztern und Ausziehen mit Alkohol, manchmal
erst nach stattgehabter Vergärung, gewonnen. Viele
dieser Auszüge werden destilliert, andere direkt ver¬
wendet. Oft stellen diese Essenzen einfach alkoholische
Lösungen der betreffenden ätherischen Oele und Riech¬
stoffe dar. Mit Beythien1) wollen auch wir die Frage
unerörtert lassen, ob nicht gelegentlich an Stelle der
frischen Früchte nur die Rückstände der Fruchtsaft¬
fabrikation, also die betreffenden Fruchttrester, das
Ausgangsmaterial für diese natürlichen Fruchtessenzen
bilden, lieber die Produktion und die Herstellung
speziell von Zitronen-, Orangen- und Bergamotte-Essenzen berichtet H. v. Wuntsch sehr ausführlich
in seiner Arbeit über die Essenzen-Produktion auf
der Insel Sizilien und in Calabrien.2) Welchen Um¬
fang und welche Bedeutung die Herstellung dieser
allgemein als Messineser-Essenzen bezeichneten Er¬
zeugnisse für die betreffenden Produktionsstriche be¬
sitzt, mag aus der Tatsache hervorgehen, dass die
Städte Messina, Reggio, Catania und Palermo im Jahre
1899 allein 797,145 kg Essenzen im Werte von un¬
gefähr 10 Millionen Lire ausführten. Das üppigste
Fruchtgebiet ist die Conca d'oro bei Palermo, für
die Bergamottefrucht Calabrien und speziell Reggio.
Das ätherische Oel ist in den Fruchtschalen enthalten
i) Ztsch. f. U. d. N. u. G., 1906, 12.
2) Pharm. Post 1902, 35.
— 10 —
und wird durch Handpressung aus solchen Früchten
gewonnen, die entweder vorzeitig heruntergefallen
sind oder sich aus anderen Gründen nicht zum Ex¬
port eignen. Das ausspritzende Oel wird durch unter¬
gehaltene Schwämme aufgefangen und aus diesen her-
ausgepresst. Bezüglich der Details sei auf die Ori¬
ginalarbeit verwiesen. Während über die Natur der
in Himbeeren und Erdbeeren vorhandenen aromatischen
Stoffe wenig oder nichts bekannt ist, sind die das
Aroma der Zitronen, Orangen, Mandarinen und Pome¬
ranzen bedingenden ätherischen Oele recht gut cha¬
rakterisiert. So besteht das aus Citrus Limonum
Risso gewonnene Zitronenöl zu 9/10 aus Kohlenwasser¬
stoffen (Limonen, Phellandren, Camphen etc.). Der
Geruch wird durch Aldehyde, namentlich durch das
zu etwa 7 °/0 vorhandene Citral und das Citronellal
bedingt. Spez. Gewicht 0,857—0,861; Drehung bei
20 °— 64 bis 67 °. Das Orangenöl (süsses Pomeranzen-
öl, aus Citrus Aurantium Risso) besteht zu 90 °/o aus
Limonen und enthält nur wenig Citral. Spez. Gewicht
0,848—0,852, Drehung zwischen — 96 und — 98 bei
20 °. Eine ähnliche Zusammensetzung weist das bittere
Orangen- oder Pomeranzenöl (aus Citrus Bigaradia
Risso) auf. Der Hauptbestandteil des Mandarinen¬
öles (aus Citrus madureusis Loureiro) bildet das d-
Limonen, während das Bergamotteöl (aus Citrus
Bergamia Risso) zu 34—42 % aus Linalylacetat be¬
steht. Während früher die Bezeichnung Oel und Essenz
für diese ätherischen Oele gleichbedeutend war,
werden in neuerer Zeit namentlich in England und
Amerika als Essenzen auch Produkte bezeichnet, die
durch Ausziehen der frischen Früchte mit Alkohol
gewonnen, mit Zusätzen von Citral, Citronellal, Va¬
nillin etc. versehen und in enormen Mengen zur
- 11 —
Limonadenfabrikation verwendet werden. Wuntsch be¬
zeichnet sie als Kunstprodukte. Wir werden später
noch darüber zu sprechen haben, ob diese Bezeich¬
nung allseits geteilt wird. Neuestens sind auf dem
Markte terpen- und sesquiterpenfr,eie Zitronen- und
Pomeranzenöle erschienen, die vor den gewöhnlichen,
terpenhaltigen oder lediglich terpenfreien Oelen den
Vorzug wesentlich höherer Alkohollöslichkeit und
stärkerer Ergiebigkeit besitzen sollen, da es nament¬
lich die Sesquiterpene seien, die die geruchlich minder¬
wertigen und schwer löslichen Bestandteile der äthe¬
rischen Oele bilden.3)
Die künstlichen Fruchtäther sind mit
Alkohol verdünnte Mischungen verschiedener Ester¬
arten, die das Aroma bestimmter Früchte nachahmen
sollen. Ihre Hauptverwendung finden sie bei der
Fabrikation von Liqueuren und Konditoreiwaren.
Nicht selten werden sie aber auch als Limonade-
Essenzen und als Zusatz zu Fruchtsyrupen gebraucht.
Das aromatische Prinzip fast aller dieser künstlichen
Fruchtäther besteht aus Estern des Amylalkohols mit
Fettsäuren. Wender1) erwähnt, dass schon 1851 auf
der Londoner Industrie - Ausstellung verschiedene
solcher „Essenzen" ausgestellt waren, die in ver¬
dünntem Zustande das Aroma der Früchte zeigten,
deren Namen sie führten und dass sie als Ersatz¬
mittel für dieselben empfohlen wurden. Er wies auch
auf die nicht immer unbedenkliche Zusammensetzung
einzelner dieser Fruchtäther hin, die die Tatsache er¬
klärlich mache, dass nach dem Genüsse von mit der¬
artigen Essenzen erzeugten Brauselimonaden häufig
%) E. Sachsse & Co. Leipzig, Preisliste, Nov. 1911.
*) Ztschr. f. U. d. N. u. G. 1900, 3.
— 12 —
Gesundheitsstörungen beobachtet wurden. So soll nach
einer Vorschrift von Kletzinsky Ananas-Fruchtäther
bereitet werden aus: 10 Teilen Chloroform (!), 10
Teilen Aldehyd, 50 Teilen Buttersäureäthylester, 100
Teilen Buttersäurpamylester und 30 Teilen Glyzerin
in 1 Liter Alkohol von 90° gelöst. Eine Zitronen¬
essenz bestand aus: 10 Teilen Chloroform, 10 Teilen
Salpeteräther, 20 Teilen Aldehyd, 100 Teilen Essig -
säureäthylester, 100 Teilen Zitronenöl und 10 Teilen
Bernsteinsäure.
Ueber die Bereitung von künstlichen Fruchtäthern
existieren eine ganze Anzahl weiterer Angaben, von
denen hier nur folgende angeführt seien:
Ananasäther konz.
Amyloxyd valerianic. 0,520
Butteräther absolut 0,200
Spiritus 95 % 8,000
Ananasäther englisc h.
Sebacyläther pur. 80,0
Essigsaures Amyloxyd 30,0
Buttersaures Amyloxyd 30,0
Essigäther 30,0
Butteräther, absolut 250,0
Ananasessenz aus Früchten 40,0
Vanilletinktur 10,0
Spiritus 95 % 2 Kilo.
Birnäther konz.
Essigsaures Amyloxyd 1,200
Essigäther 0,200
Spiritus 95 % 8,600
Zitronenäther konz.
Spiritus 95 o/o 0,500
Zitronenessenz Excels. 0,500
- 13 -
Erdbeeräther konz.
Himbeeräther konz. 4,070
Ananasäther konz. 0,900
Vanilleessenz 0,030
Aepfeläther konz.
Amyloxyd valerianic. 260,0
Essigäther 260,0
Butteräther absolut 100,0
Spiritus 95 % 4 kg.
Aprikosenäther englisch.
Buttersaures Amyloxyd 200,0
Bittermandelöl, echt 40,0
Spiritus 95 «/0 860,0
Bergamottäther englisch.
Ananasäther engl. 200,0
Bergamottöl 15,0
Spiritus 95 °/o 1kg.
Birnäther eng]lisch.
Essigsaures Amyloxyd 1,800
Essigäther 1,200
Salpeteräther 1,200
Spiritus 95 % 1,800
Himbeeräther englisch.
Essigsaures Amyloxyd 0,300
Essigäther 0,040
Chloroform 0,080
Spiritus violar. 0,400
Oel rosar. 0,008
Spiritus 95 <y0 3,000
— 14 —
Himbeeräther konz.
Essigsaures Amyloxyd 0,300
Essigäther 0,040
Chloroform 0,080
Spiritus violar. 0,400
Oel rosar. 6,6 g
Spiritus 95 % 7,200
Orangenäther.
Ananasäther konz. 0,100Oel aurantior cort. 0,050Oel neroli ver. 0,010
Spiritus 95 % 1,115
Dass solche und ähnliche künstliche Fruchtäther
in grossem Masstabe als Zusatz zu Fruchtsäften und
Limonade-Essenzen auch anderwärts gedient haben und
wahrscheinlich noch dienen, geht aus einer Publikation
von A. L. Winton, A. W. Ogden' und W. L. Mitchell
über kohlensäurehaltige, alkoholfreie Getränke und
Fruchtessenzen hervor.5) Von 116 untersuchten Frucht¬
säften erwiesen sich 24 als mit künstlichen Riech¬
stoffen versetzt. Ausserdem waren 45 Muster mit
Teerfarbstoffen aufgefärbt, 19 enthielten Salicylsäure,2 Benzoesäure. Winton gelangt zu dem Schlüsse, dass
in allen Fällen, in denen künstliche Farben in Frucht¬
säften gefunden wurden, die ganze Probe mehr oder
weniger ein Kunstprodukt gewesen sei.
Es liegt angesichts solcher Verhältnisse auf der
Hand, dass die Nahrungsmittelgesetzgebung regelndauch in dieses Gebiet eingreifen musste. Die in der
Literatur erwähnten Vorschläge zu einer solchen
6) Ztsch. f. U. d. N. u. G. 1901, 4, Auszug aus dem 23.
Jahresbericht der Connecticut Agric. Experim. Stat. 1899, New
Haven 1900.
- 15 -
Regelung sind nicht gerade zahlreich und nicht über¬
einstimmend. Allerdings betrifft die Mehrzahl der ein¬
schlägigen Veröffentlichungen nur Versuche zur Fest¬
stellung analytischer Unterschiede zwischen echten
und gestreckten, sowie anderweitig verfälschten Säften,
welche Feststellungen durch die seit einer Anzahl
von Jahren systematisch fortgeführte deutsche Frucht¬
saftstatistik den wünschenswerten Ausbau erfahren
haben. Gelegentlich nur ist auch von den Zusätzen
die Rede, die man als erlaubt, als nur unter Dekla¬
ration zulässig oder als verboten zu betrachten habe
und von denen uns hier vorwiegend die aromatischen
Stoffe interessieren. Es ist vor allem die Frage auf¬
zuwerfen, ob eine nur aus reinem Fruchtsaft mit
Zucker und kohlensäurehaltigem Wasser hergestellte
Limonade nicht das Anrecht auf eine besondere Be¬
handlung erheben dürfe gegenüber denjenigen Pro¬
dukten, in denen der Fruchtsaft durch das auf irgend
eine der gebräuchlichen Arten gewonnene aromatische
Prinzip der betreffenden Frucht ersetzt ist. So klar
und richtig die Frage durch die heute geltenden ge¬
setzlichen Vorschriften in der Schweiz, Deutschland
und Oesterreich beantwortet ist, hat es doch nicht
an Stimmen gefehlt, die mit der Gewährung von Zu¬
sätzen zu Fruchtsäften oder wenigstens zu Limonade-
syrupen weiter gehen wollten, als der Gesetzgeber
gegangen ist. W. Rassmann6) fordert geradezu andere
Beurteilungsnormen für Limonadesyrupe als für die
offizinellen Fruchtsäfte. Nach ihm bedürfen Limo-
nadensyrupe „des Zusatzes eines dauerhaften Farb¬
stoffes, eines kräftigen Aromas und einer schaum¬
gebenden Substanz (!); sie sind reine Kunstprodukte,
«) Ztschr. f. öffentl. Chemie 1897, III, 300.
- 16 -
gleichviel, ob nur ein Teil der Säure und des Aromas
aus den Früchten direkt oder indirekt gewonnen
worden ist oder nicht." Es sei im fernem zu er¬
wägen, ob zur Verstärkung des Aromas die sogen.
Fruchtäther, meist Ester des Amylalkohols, zulässig
sein sollen, deren anzuwendende Menge gering sei.
Die Ansicht, ein Limonadensyrup müsse schaum¬
bildende Mittel enthalten, mochte damals, als Rass¬
mann diesen Vorschlag machte, einer gewissen Be¬
rechtigung nicht entbehren, ist aber heute wohl dochi
definitiv überwunden. Das gleiche ist bezüglich der
Zulässigkeit der künstlichen Fruchtäther als Zusatz
zu dieser oder jener Art von Fruchtsäften und
-Syrupen zu hoffen. Es ist oben mitgeteilt worden,
dass diese künstlichen Fruchtäther nicht bloss aus
Estern des Amylalkohols bestehen, über deren Schäd¬
lichkeit man zum mindesten geteilter Meinung sein
kann, sondern dass sie mitunter Zusätze, wie Chloro¬
form, Ester der Salpetersäure etc. erhalten, die ge¬
sundheitlich keineswegs unbedenklich sind. Das radi¬
kale Verbot der künstlichen Fruchtäther ist schon
aus diesem Grunde einer Auslese vorzuziehen.
Juckenack7) gibt in seiner Arbeit über die Beur¬
teilung der Brauselimonaden auf Grund der Reichs¬
gesetze betr. den Verkehr mit Nahrungs- und Ge¬
nussmitteln vom 14. Mai 1879 eine Klassifizierung
der Handelsfruchtsäfte nach folgendem Schema:
„I. Echte Fruchtsäfte: Klasse A umfasst die¬
jenigen, welche nur aus Fruchtfleischpressaft und
Zucker hergestellt werden; Klasse B diejenigen, deren
Aroma ausschliesslich den sogenannten Südfrüchten
entstajmmt und zu deren Herstellung die in ent-
') Apoth.-Ztg. 1899, 14.
- 17 -
sprechender Weise gereinigten Auszüge oder Destil¬
lationsprodukte aus Bestandteilen dieser Früchte, so¬
wie Zuckersaft und auch die der betreffenden Frucht
eigentümliche Säure Verwendung finden.
IL Künstliche Fruchtsäfte: Klasse A umfasst
1. die mit Hülfe von fremden Farbstoffen, sowie
Zuckersaft bezw. Wasser und auch organischen Säuren
gestreckten natürlichen Fruchtsäfte der Klasse IA;2. die den unter IA aufgeführten echten Frucht¬
säften entsprechenden künstlichen Fruchtsäfte aus
Zuckersaft, organischen Säuren, fremden Farbstoffen
und a) Destillationsprodukten aus Früchten oder Be¬
standteilen derselben, b) künstlichen Fruchtestern und
c) Gemischen aus a und b. Klasse B umfasst die der
Klasse I B entsprechenden künstlichen Fruchtsäfte,welche ausser iden dort angeführten Bestandteilen noch
fremde Farbstoffe, fremde Säure oder künstliche
Fruchtessenzen bezw. sogen. Verstärkungsmittelenthalten."
Limonaden, die mit Fruchtsäften der Kategorie I
hergestellt worden sind, dürfen nach dem Namen der
betreffenden Frucht, z. B. als Himbeerlimonade, de^
klariert werden, während für Erzeugnisse aus Kate¬
gorie II die Bezeichnung: Limonade mit Himbeer-
Geschmack oder -Aroma vorgeschlagen wird. Fest¬
zuhalten ist, dass ein Zusatz von künstlichen Frucht-
äthern zu den als künstlich taxierten Fruchtsäften
der Kategorie II gestattet sein soll.
Auf den gleichen Standpunkt stellt sich der Ver¬
fasser des Kapitels Fruchtsäfte im Entwurf zu den
Vereinbarungen zur einheitlichen Untersuchung und
Beurteilung von Nahrungs- und Genussmitteln für das
Deutsche Reich.
- 18 -
Hlärtel und Soiling8) verlangen, dass ein Zusatz
von künstlichen Fruchtäthern zu Marmeladen und
Geleefrüchten deklariert werden müsse, obwohl in
der gleichen Arbeit der Ansicht Ausdruck gegeben
wird, ein Zusatz von künstlichen Fruchtäthern sei
unzulässig, da für den Fall, als ein Fruchtaroma zu¬
gesetzt werden müsse, konzentrierte Fruchtsäfte ver¬
wendet werden können.
Am 1. internationalen Kongress des Weissen
Kreuzes in Genf 1908 wurde für Limonaden die
folgende Definition aufgestellt: „Les limonades
gazeuses sont des eaux gazéifiées aditionnées de
sucre, d'acides végétaux, de substances aroma¬
tiques reconnues inoffensives."9) Es wird
hier also keine Unterscheidung zwischen künstlichen
und natürlichen Aromastoffen gemacht. Es bliebe im
fernem noch festzustellen, ob unter diesen unschäd¬
lichen Aromastoffen nur die natürlichen Frucht¬
essenzen oder eine gewisse Auswahl und welche künst¬
lichen Fruchtäther zu verstehen sind. Auf alle Fälle
sind diese letztern nicht expressis verbis ausge¬
schlossen, da die Schädlichkeit einzelner künstlicher
Fruchtäther einstweilen zum wenigsten noch um¬
stritten ist. Der Fall, dass man die Zulässigkeit der
Beimischung fremder Stoffe zu Nahrungs- und Ge¬
nussmitteln von ihrer Unschädlichkeit abhängig macht,
steht bekanntlich nicht vereinzelt da. Ein Analogen
Meten, u. a. Teerfarbstoffe, deren Verwendung in der
Nahrungs- und Genussmittelbranche in gewissen Fällen
ebenfalls unter der Bedingung der Unschädlichkeit
gestattet ist.
8) Ztschr. f. U. d. N. u. G. 1910, 20.
9) Compte-Rendu des travaux du 1er congrès international,Genève 1908.
— 19 —
Es wäre indessen zu bedauern, und würde einem
Kückschritte gleichkommen, wenn, was übrigens kaum
anzunehmen ist, die erwähnte, in Genf getroffene inter¬
nationale „Vereinbarung" je Gültigkeit für die Be¬
urteilung von Limonaden erhalten sollte, wenigstens
soweit sie sich auf den Zusatz von Aromastoffen be¬
zieht. Denn abgesehen davon, dass die Ausscheidung
der schädlichen von den unschädlichen, künstlichen
Fruchtäthern schwierig durchzuführen wäre, würden
sich weitere und noch grössere Schwierigkeiten er¬
geben, wenn es sich darum handelt, analytisch fest¬
zustellen, was für ein Fruohtäther, ob ein schädlicher
oder unschädlicher, im konkreten Falle vorliegt. Ist
aber der Analytiker zu einer solchen Unterscheidung
nicht im Stande, so hat es keinen Sinn, sie durch
gesetzliche Vorschriften statuieren zu wollen. Da hilft
nur das gänzliche Verbot des Zusatzes von künst¬
lichen Aethern, zu dessen Erlass man um so eher be¬
rechtigt ist, als eine zwingende Notwendigkeit der
Verwendung dieser Art Aromastoffe zu Fruchtsäften
und Syrupen micht besteht.
Sind im vorstehenden Stimmen angeführt worden,
die sich zu Gunsten der Zulassung von künstlichen
Fruchtäthern, wenn auch unter gewissen Einschrän¬
kungen, ausgesprochen haben, so erübrigt es sich
noch, die Vertreter des gegenteiligen Standpunktes
kurz zum Worte kommen zu lassen.
Der Codex alimentarius anstriacus10) verweist die
künstlichen Bouquetstoffe und Ester ausdrücklich
unter die verbotenen Zusätze sowohl zu reinen als
zu sogen. Handelsfruchtsäften, unter welch letztere
Kategorie namentlich die Limonadensäfte und -Syrupe
fallen.
10) Forschgs. Ber. f. Lebensm.-Hyg., forens. Chem. I 309.
— 20 —
Beythien11) führt an, dass die sogen. Frucht¬
äther, die zur Aromatisierung der künstlichen Brause¬
limonaden zunächst verwendet wurden, den Geruch
der entsprechenden Natursäfte nur unvollkommen
nachzuahmen vermögen. Ihr Gebrauch sei deshalb aus
der modernen Mineralwasserfabrikation mehr oder
weniger verschwunden und durch denjenigen der
Essenzen ersetzt, d. h. alkoholischer Lösungen der
durch Extraktion oder Destillation isolierten Riech¬
stoffe der natürlichen Pflanzenteile. Er empfiehlt
folgende Fassung: Brauselimonaden ohne den
Namen einer bestimmten Fruchtart sind
künstlich gefärbte Mischungen von Zucker und kohlen¬
säurehaltigem Wasser mit organischen Säuren und
aromatischen Auszügen oder Destillaten
von Pflanzenteilen.
Analog wurde für den Regierungsbezirk Koblenz
die Verwendung von künstlichen Fruchtäthern durch
Verordnung vom 14. August 1903 verboten.12)
Desgleichen enthält die 1. Auflage des vom
Schweizerischen Verein analytischer Chemiker heraus¬
gegebenen Lebensmittelbuches im Kapitel künstliche,
kohlensaure Wasser und Limonaden das ausdrückliche
Verbot eines Zusatzes von künstlichen Fruchtäthern
zu Limonaden. Dieses Verbot ist in den-Artikel 125
der bundesrätlichen Verordnung vom 29. Januar 1909
zum eidgenössischen Lebensmittelgesetz vom 8. De¬
zember 1905 und in die 2. Auflage des Schweizerischen
Lebensmittelbuches übergegangen. Die Art. 111 und
114 der genannten Verordnung statuieren die Unzu-
lässigkeit eines solchen Zusatzes auch für Frucht-
n) Vortrag, gehalten an der 5. Jahresversammlung der
freien Vereinigung deutscher Nahrungsmittelohemiker 1906.
12) Veröffentl. des Kaiserl. Gesundheitsamtes 1903, 27, 1163.
- 21 -
safte und -Syrupe, gleichviel, ob sie nach Früchten
oder einfach als Limonadensyrupe bezeichnet werden.
Ueberblickt man die Gründe, die für und gegen
die Verwendung der künstlichen Fruchtäther in der
Fruchtsaft- und Limonadenindustrie vorgebracht
worden sind und wägt man ihre Berechtigung gegen¬
einander ab, so muss man zu folgenden Schlüssen
kommen:
1. Eine Notwendigkeit, die künstlichen Frucht¬
äther neben oder an Stelle der natürlichen Essenzen
zu verwenden, besteht praktisch nicht, zumal sie die
natürlichen Essenzen nicht vollkommen zu ersetzen
vermögen.
2. Die Zulassung der künstlichen Fruchtäther ist
auch vom hygienischen Standpunkte aus verwerflich,
da sie zum Teil direkt gesundheitsschädliche Stoffe
enthalten.
3. Die Ausscheidung der unschädlichen von den
schädlichen Aethern ist praktisch nicht durchführbar.
4. Es ist von Seite der Vertreter der Nahrungs-
miittelchemie auf ein generelles Verbot der Verwen¬
dung von künstlichen Fruchtäthern in der Nahrungs¬
und Genussmittelindustrie zu dringen.
Spezieller Teil.
Die Lebensmittelgesetzgebung kann sich mit der
blossen Aufstellung des Verbotes der Verwendung
künstlicher Fruchtäther zu Fruchtsäften, Syrupen und
Limonaden etc. natürlich nicht begnügen. Es erwächst
ihr mit der Statuierung eines solchen Verbotes die
weitere Aufgabe, Methoden anzugeben, die die Unter¬
scheidung des Kunstproduktes von den zulässigen
natürlichen Essenzen ermöglichen. Ueber bezügliche
Untersuchungen ist indessen recht wenig bekannt.
Beythien1) bemerkt, dass der chemische Nach¬
weis synthetischer Säure-Ester bei der ausserordent¬
lich geringen Menge, in der die Riechstoffe den Limo¬
naden zugefügt werden, nicht immer mit Sicherheit
zu führen sei. Wender und Gregor2) berechnen, dass
man z. B. aus 1000 g Zitronenessenz rund 4000
Flaschen Limonade erzeugen kann. Eine Flasche mit
ca. 3 Dezilitern enthält also bloss 0,25 g Essenz. Man
wird also im konkreten Falle höchstens auf eine Ge¬
ruchsprobe abstellen können und bei Anlass zu Ver¬
dacht auf die vom betreffenden Fabrikanten ver¬
wendeten Essenzen zurückgreifen müssen. Daneben
empfiehlt sich eine periodische Kontrolle der Essenzen
so gut wie der übrigen Rohmaterialien zur Frucht-
syrup- und Limonadenfabrikation.
!) Ztschr. f. U. d. N. u. G. 1906. 12.
2) ibidem 1900, 3.
- 23 -
Bertschinger und Kreis3) schlagen vor, die Ge¬
ruchs- und Geschmacksprobe dadurch zu verschärfen,
dass man den In'halt einer Flasche Limonade der
Destillation unterwirft. Bei Beginn der Kohlensäure¬
entwicklung tritt der Geruch nach künstlichem Aether
oder natürlicher Essenz intensiv hervor und die ersten
5—10 cm3 von dem Destillat enthalten den gesamten
Aether. Essenzen sollen nach Verdünnung mit Wasser
durch die Geruchs- und Geschmacksprobe, eventuell
verschärft durch die eben angegebene Destillations¬
methode, auf das Vorhandensein von künstlichen
Fruchtäthern geprüft werden. Eine genauere Methode
soll darin bestehen, dass man die Essenz oder, falls
diese nicht flüchtige Bestandteile, wie Farbstoffe,
Weinsäure etc. enthält, das Destillat derselben durch
Kochen mit wässeriger Kalilauge verseift. Wenn hie-
bei Amylalkohol auftrete, sei das Vorhandensein von
künstlichen Fruchtäthern erwiesen. Diese Methode ist
in der 2. Auflage des Schweizerischen Lebensmittel¬
buches wie folgt abgeändert worden: „Es ist ein Teil
der Substanz (Essenz) eventuell nach Verdünnung mit
Wasser abzudestillieren und im Destillat auf Amyl¬
alkohol zu prüfen."
Schon Kreis4) hat auf die Unzulässigkeit dieser
Methode hingewiesen. „Wie der Amylalkohol," führt
Kreis aus, „nachgewiesen werden soll, ist nicht ge¬
sagt. Gewöhnlich geschah es einfach durch die Ge¬
ruchsprobe, und da hat es sich in der Tat gezeigt,
dass bei natürlichen Essenzen von Amylalkohol nichts
zu bemerken ist, während der Geruch desselben bei
künstlichen Aethern sehr stark hervortritt."
3) Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 1904.
i) Chemiker-Zeitung 1907, Nr. 86.
— 24 -
Man wird nun aber ohne weiteres zugeben, dass
einem bloss auf dem Geruch beruhenden Nachweise
von Amylalkohol ein beweisender Wert nicht zu¬
kommen kann. Kreis schlug deshalb vor, das durch
Verseifung von Essenzen erhaltene und auf 30 °/o VoL
Alkohol gebrachte Destillat nach Kommarowsky zu
prüfen. Hiebei machte er die überraschende Beobach¬
tung, dass auch die natürlichen Fruchtessenzen höhere
Alkohole, natürlich in Form von Estern, enthalten,
ja, dass sich für die natürlichen Essenzen sogar ein
grösserer Gehalt ergibt als für die künstlichen Frucht¬
äther, wenn man den Gehalt an höheren Alkoholen
auf je 100 Esterzahl berechnet. Die auf den ersten
Blick frappierende Erscheinung, dass trotzdem in
natürlichen Essenzen der Amylalkohol durch die Ge¬
ruchsprobe nicht wahrzunehmen ist, erklärt Kreis
durch den Umstand, dass die natürlichen Essenzen
meistens einen geringern Gehalt an Estern besitzen
als die künstlichen Fruchtäther, die man sozusagen
in beliebiger Stärke herstellen kann. Immerhin wäre
es nicht ausgeschlossen, dass ein Analytiker Amyl¬
alkohol in natürlichen Essenzen auch mit der Geruchs¬
probe nachweisen kann, sofern er für die Verseifung
nur genügende Quantitäten Essenz verwendet. Ein
solcher Fall ist um so eher möglich, als die aus dem
Lebensmittelbuch zitierte Methode keine Angaben über
die zur Prüfung auf künstlichen Fruchtäther anzu¬
wendenden Essenzenmengen enthält.
Eine Erweiterung und eventuell Verbesserung
dieser doch recht problematischen Methode erschien
wünschenswert. Wenn auch zuzugeben ist, dass in
vielen Fällen künstliche Fruchtäther von den natür¬
lichen Fruchtessejizen ohne chemische Prüfung schon
durch den Geruch unterschieden werden können, so
— 25 —
bildet ein zahlenmässiger Ausdruck des Befundes doch
in allen Fällen eine sehr wertvolle Ergänzung der
immerhin subjektiven Beurteilung durch eine blosse
Sinnenprüfung, der indessen ein gewisser Wert nicht
abzusprechen ist und die das Lebensmittelbuch des¬
halb mit Recht berücksichtigt.
Als Material für die nachfolgenden Unter¬
suchungen dienten notorisch echte Fruchtessenzen der
Firmen Sachsse & Cie., Leipzig, Haaf-Viganello &
Wender, Dresden. Die künstlichen Fruchtäther wurden
von der chemischen Fabrik A.-G. vorm. B. Siegfriedin Zofingen, von C. Erdmann in Leipzig-Lindenau be¬
zogen. Daneben gelangten eine Anzahl Muster zur
vergleichenden Prüfung, die dem Laboratorium des
Kantons Aargau von Limonadefabrikanten teils direkt,
teils durch Vermittlung der Gesundheitskommissionen
eingingen.In den Essenzen wurde bestimmt:
1. Die Dichte der Essenz.
2. Die Dichte des Destillates, letztere erhalten
dadurch, dass von 50 cm3 Essenz ohne vorhergehende
Verdünnung 40 cm' abdestilliert wurden. Man ver¬
meidet durch Weglassen eines Wasserzusatzes störende
Trübungen.3. Der Gelialt an Estern, ausgedrückt durch den
Verbrauch an cm1 n/i Lauge für 100 cm3 des wie
sub 2 beschrieben erhaltenen Destillates.
4. Der Gehalt an flüchtigen Estersäuren, eben¬
falls in cm3 n/i Lauge für 100 cm3 Destillat ange¬
geben.
1. und 2. wurden pyknometrisch ermittelt. Zur
Bestimmung der Esterzahl verwendeten wir 5 cm3
Destillat, neutralisierten eventuell vorhandene freie
Säuren durch Zusatz von n/2 alkoholischer Lauge,
- 26 -
fügten einen starken Ueberschuss an dieser hinzu
(40—50 cm8) und erhitzten y2 Stunde am Rückfluss¬
kühler. Bei natürlichen Essenzen genügt eine viel
kleinere Laugenmerige (ca. 10 cm3). Auch geht die
Verseifung schon mit wässeriger Lauge glatt und
vollständig vor sich. Bei gewissen künstlichen Aethern
dagegen erhielten wir bei Anwendung wässeriger
Lauge Differenzen im Estergehalt, die auf eine un¬
vollständige Verseifung schliessen Hessen. Man ver¬
meidet bei Verwendung alkoholischer Lauge auch das'
lästige Stossen.
Das von der Bestimmung der Esterzahl her¬
rührende, mit n/2 Schwefelsäure zurücktitrierte Re¬
aktionsprodukt wurde mit 5 cm3 einer 20 prozentigen
Schwefelsäure angesäuert und daraus im Dampfstrom
500 cm1 abdestilliert. Im Destillat wurden die voll¬
ständig übergegangenen Säuren durch Titration mit
n/i0) eventuell "/» Lauge ermittelt.
Nachstehend die Untersuchungsergebnisse, bei
denen die zur Limonadenfabrikation vorwiegend ver¬
wendeten Himbeeressenzen stärker als die anderen be¬
rücksichtigt sind.
Dichte d.
Essenz
1. Himbeeressenz, nat. S. L. 0,9733,
2. Himbeeressenz W. 0,9791
3. Himbeerlimonadenessenz H. V. 0,9954
4. Himbeeressenz Seh. Wohlen (Handelsmuster) 0,9954
5. Himbeeressenz R. Basel (Handelsmuster) 0,9894
6. Essence de framboises Verrières (Handels¬
muster) 0,9748
7. Himbeeressenz Suhr (Handelsmuster) 0,9845
8. Himbeeressenz Nr. 2 Lenzburg (Handels¬
muster) 0,9548
— 27 —
Dichte d.
Essenz
9. Himbeeressenz Nr. 4 Lenzburg (Handels¬
muster) 0,9840
10. Himbeeressenz Nr. 2 Wohlen (Handels¬
muster) 0,955911. Himbeeressenz Nr. 2 Zofingen (Handels¬
muster) 1,052912. Himbeeraroma H. V. 0,891713. Essence Easpberry „Special" 1,001814. Himbeeräther konz. farbl. E. L. künstl. 0,9037
15. Himbeeräther konz. S. Z. 0,823716. Himbeeräther engl. S. Z. 0,8392
17. Himbeeräther konz. rot E. L. 0,9151
18. Erdbeeressenz, nat. S. L. 1,133519. Walderdbeeressenz Wd. 0,9421
20. Erdbeeräther konz. farbl. E. L. 0,892221. Erdbeeräther engl. konz. S. Z. künstl. 0,897122. Zitronenessenz, nat. S. L. 0,930223. Zitronenessenz S. A. • 0,923524. Zitronenessenz S. B. 0,905825. Zitronenessenz S. C. 0,9358
26. Zitronenessenz S. D. 0,9054
27. Zitronenessenz S. E. 0,830128. Zitronenessenz Wd. 0,8553
29. Zitronenessenz H. V. 0,8518
30. Zitronenessenz R. Basel (Handelsmuster) 0,9905
31. Zitronenessenz Seh. Wohlen (Handelsmuster) 0,9546
32. Zitronen-Aroma f. Confiserie-Zwecke H. V. 0,8696
33. Zitronenäther konz. S. Z. 0,8668
34. Zitronenäther E. L. 0,8781
35. Pomeranzenessenz S. A. 0,8950
36. Pomeranzenessenz S. B. 0,8816
37. Pomeranzenessenz S. C. 0,9083
- 28 -
Dichte d.
Essenz
38. Pomeranzenessenz S. D. 0,9439
39. Pomeranzenessenz S. E. 0,9839
40. Pomeranzenessenz S. L. nat. 0,8894
41. Pomeranzenessenz Wd. 0,8282
42. Apfelsinenessenz, nat. S. L. 0,8134
43. Orangenäther E. L. 0,8746
44. Mandarinenessenz S. L. nat. 0,8144
45. Orangenäther konz. S. Z. 0,8157
46. Aprikosenäther engl.S. Z. künstl 0,8344
Dichte von Estergehalt Flüchtige Säuren
4/5 d. Destillates in cm3 n/i Länge pro in cm3 n/10 Lauge pro
100 cm3 Destillat 100 cm3 Destillat
1. 0,9734 2,40 0,78
2. 0,9632 4,75 8,20
3. 0,9651 3,50 -7,10
4. 0,9565 1,37 1,89
5. 0,9800 2,90 3,55
6. 0,9748 2,80 2,20
7. 0,9759 1,50 3,00
8. 0,9286 1,10 2,50
9. 0,9753 1,20 3,00
10. 0,9209 1,40 3,50
11. 0,9534 1,50 4,50
12. 0,8552 1,75 3,20
13. 0,9240 18,2 14,60
14. 0,8379 70,0 35,0
15. 0,8373 43,0 20,0
16. 0,8245 72,0 33,0
17. 0,8900 32,6 156,0
18. 0,9625 1,40 1,7019. 0,9191 1,25 2,1020. 0,8671 44,35 19,20
— 29 —
Dichte von Estergehalt Flüchtige Säuren
4/5 d. Destillates in cm3 n/i Lauge pro in cm3 n/10 Lauge pro
100 cm3 Destillat 100 cm3 Destillat
21. 0,8276 46,0 27,0
22. 0,8810 0,56 2,80
23. 0,8834 1,0 1,2024. 0,8685 2,75 3,0025. 0,9096 0,75 2,00
26. 0,8722 2,25 2,00
27. 0,8283 0,50 1,5028. 0,8416 0,50 1,2529. 0,8361 0,50 1,4030. 0,9266 1,70 1,3031. 0,9511 1,40 1,0032. 0,8478 11,0 8,233. 0,8436 5,0 2,5
34. 0,8809 292,25 139,0
35. 0,8559 1,75 1,25
36. 0,8385 0,75 1,15
37. 0,8626 0,50 2,25
38. 0,9222 0,50 2,0039. 0,9518 1,50 1,7540. 0,8326 3,5 1,0
41. 0,8188 0,75 1,5042. 0,8455 0,90 0,8443. 0,8811 317,75 191,044. 0,8159 3,0 3,045. 0,8158 8,0 2,5
46. 0,8329 48,0 36,0
Wie zu erwarten war, zeichnen sich also die
künstlichen Fruchtäther allgemein durch einen viel
höheren Gehalt an Estern und Estersäuren aus. Die
unter Nr. 13 angeführte Essenz qualifiziert sich als
Verschnitt einer natürlichen Essenz mit künstlichen
— 30 —
Aethern. Nr. 12, Himbeeraroma, weicht lediglich in
den spez. Gewichten der Essenz und des Destillates
von den natürlichen Essenzen ab. Reichliche Zusätze
von künstlichen Fruchtäthern müssen die sub 34 und
43 verzeichneten Zitronen- und Orangenäther erfahren
haben. Nr. 32, Zitronenaroma für Gonfiseriezwecke,ist als Verschnitt zu taxieren, während die doch als
Zitronen ä t h e r im Handel befindliche Essenz Nr. 33,
abgesehen von den spezifischen Gewichten, noch in
das Schema für die natürlichen Essenzen passt.
Zugegeben, dass die vorliegenden Daten noch
keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen können,
so sind sie vielleicht doch geeignet, dem Analytikerden Weg zur Untersuchung und zur Beurteilung besser
zu weisen als es die im Lebensmittelbuch angegeben^Methode vermochte. Namentlich sind künstliche Bim--
beeressenzen und bis zu einem gewissen Grade auch
Verschnitte von solchen mit natürlichen Himbeer-
äthern auf die beschriebene einfache Art relativ leicht
voneinander zu unterscheiden. Auch bei Erdbeer¬
essenzen dürfte der Nachweis, ob sie als künstlich
oder natürlich anzusprechen sind, nach diesem Ver¬
fahren unschwer zu führen sein. Von den Südfrüchte¬
essenzen und -Aethern wird bezüglich Differenzierung
später noch zu sprechen sein. Empfiehlt sich somit
die Ausführung der angegebenen Bestimmungen an
Stelle der im Schweizerischen Lebensmittelbuch ent¬
haltenen Methode, so wird man doch in Grenzfällen,
die bei massigen Verschnitten mit künstlichen Aethern
eintreten können, sich mit der Ermittelung der oben¬
genannten analytischen Daten nicht begnügen dürfen.
Aehnlich wie man sich bei Serienuntersuchungen z. B.
- 31 -
von Butter auf die Ausführung der gewöhnlichen Be¬
stimmungen, wie Ermittelung des spez. Gewichtes und
Fettgehaltes der Refraktion und des Säuregrades be¬
schränken, in Verdachtsfällen aber die Bestimmungder Reichert-Meissl'schen Zahl oder anderer für den
speziellen Nachweis fremder Fettarten dienlicher Daten
stets vornehmen wird, so muss auch hier ein weiterer
Ausbau der Methode gesucht werden. Abgesehen da¬
von, schien es auch vom rein wissenschaftlichen Stand¬
punkte aus wünschenswert, Aufschluss über die Art
der in den künstlichen Fruchtäthern einerseits und
in den natürlichen Fruchtessenzen anderseits ent¬
haltenen Esterbestandteile zu bekommen. Es konnte
nach den mitgeteilten Resultaten keinem Zweifel unter¬
liegen, dass wenigstens ein Teil der in den natürlichen
Essenzen enthaltenen Riechstoffe ebenfalls ester¬
artiger Natur war.
1. Identifizierung der Esfersäuren.
Wie schon Jensen in seiner Arbeit: „Biologische
Studien über den Käsereifungsprozess unter spezieller
Berücksichtigung der flüchtigen Fettsäuren"5) aus¬
geführt hat, gibt es eine Anzahl von Reaktionen, die
für den qualitativen Nachweis von flüchtigen Fett¬
säuren geeignet erscheinen können, sofern nur eine
Säure allein und in reinem Zustande vorliegt, denen
aber nur ein geringer Wert beizumessen ist, sobald
mehrere Säuren zusammen vorliegen. Jensen zählt zu
6) Landwirtschaft!. Jahrbuch der Schweiz 1904, 314 ff.
— 32 —
diesen Reaktionen den Geruch der Ester, sowie die
verschiedene Löslichkeit der Barytsalze in absolutem
Alkohol. Nach Luck soll buttersaurer Baryt in ab¬
solutem Alkohol 41 mal leichter löslich sein als essig¬
saurer Baryt. Und doch gelingt es nicht, diese zwei
Salze mittelst Alkohol voneinander zu trennen. Aehn-
lich verhält es sich mit der einzigen bis jetzt be¬
kannten Reaktion auf Propionsäure. Nach Linnemann
soll, wenn wässerige Propionsäure mit überschüssigem
Bleioxyd auf dem Wasserbade eingedampft wird, ein
in kaltem Wasser leicht lösliches, in heissem Wasser
aber schwer lösliches, basisches Salz gebildet werden.
In einem Gemisch von flüchtigen Fettsäuren mit wenig*
Propionsäure aber versagt diese Art des Nachweises
vollkommen auch dann, wenn man die in der Hitze
ausgeschiedenen Salze heiss abfiltriert und in anderer
Weise analysiert. Denn die Ausscheidungen enthalten
namentlich dann, wenn nicht gerade viel Propion¬
säure vorliegt, entweder nur eine Spur flüchtiger Fett¬
säuren oder dann auch sämtliche Homologen. Dass
man auf Geruchsreaktionen namentlich in Gemischen
von Fettsäuren nicht abstellen kann, liegt auf der
Hand. Wohl vermögen sie in gewissen Fällen wert¬
volle Anhaltspunkte für die Gegenwart dieser oder
jener Säure zu bieten, können aber niemals den exakten
Nachweis einer oder gar mehrerer Säuren ersetzen.
Etwas besser steht es mit den quantitativen, auf
der Bestimmung des Gehaltes der Salze an Basen be^
ruhenden Reaktionen. Fällt man die Lösungen der
Baryumsalze der flüchtigen Fettsäuren mit Schwefel¬
säure oder raucht man sie mit Schwefelsäure ab, so
kann man aus dem Gewichte des aus den Ba-Salzen
erhaltenen Biaryumsulfats auf die Art und Menge der
vorhandenen Säure schliessen. Abgesehen von dem
- 33 -
grossen Materialverbrauch, erweist sich diese Methodet
aber auch deswegen nicht als geeignet, weil, wie
Jensen konstatiert hat, das vorausgehende Trocknen
der Ba-Salze nicht ohne eine schwache Dissoziation
verläuft und Gemische von verschiedenen Fettsäuren
Mengen von Baryum ergeben, die naturgemäss zwischen
denjenigen der Ba-Salze der höheren und der nied¬
rigeren Fettsäuren liegen müssen. Da eine Fraktionier
rung mit Alkohol, wie oben schon dargestellt, nicht
zum Ziele führt, ist die Identifizierung der flüchtigen,
Fettsäuren aus einem Gemische auf dem Wege über
die Ba-Salze aussichtslos. Als die beste Methode hie¬
für betrachtet Jensen die Bestimmung des Silber¬
gehaltes der Silbersalze, die sich, wie auch hier be¬
stätigt werden konnte, aus den Lösungen der Alkali¬
salze mit Silbernitrat ausfällen lassen, kein Kristall¬
wasser enthalten, nach dem Auswaschen im Gooch-
tigel zuerst mit 70°/oigem, dann 96%igem Alkohol
und Aether leicht getrocknet werden können und
nach kurzem Glühen im Muffelofen ihr Silber in reinem
Zustand hinterlassen. Wie die folgende, von Jensen
angegebene Tabelle zeigt, nimmt die Löslichkeit der
Silbersalze der flüchtigen Fettsäuren mit steigendem
Molekulargewicht stark ab, ebenso der Silbergehaltder Salze.
100 Teile Wasser0/ Qîllm
losen bei 20° C '0 oiioe
Essigsaures Silber 1,037 Teile 64,67
Propionsaures Silber 0,836 „ 59,67
Buttersaures Silber 0,485 „ 55,38Valeriansaures Silber 0,185 „ 51,67
Ist demnach die fraktionierte Fällung der Silber¬
salze unter Umständen ein recht bequemes Orientie¬
rungsmittel für den qualitativen Nachweis und für
— 34 "
—
die Trennung der flüchtigen Fettsäuren, so versagt
dieses Mittel unter anderen Umständen. So wurde
in einer aus 11 g Essigsäure und 2 g Propionsäure
bereiteten, mit Wasser auf 1 Liter aufgefüllten
Mischung nach starker Anreicherung der höheren
Säure der Silbergehalt der ersten Fraktion zu 60,070/0,
also zwischen demjenigen von Propion- und Essig¬
säure gefunden, während in einer gleichbereiteten und
behandelten Mischung von 11 g Essigsäure und 1,26 g
Buttersäure der Silbergehalt der ersten Fraktion
61,03 °/o betrug, also ebenfalls zwischen Propion- und
Essigsäure, aber näher an der letztern lag. Zum
mindesten bot die Ermittelung der Art der flüchtigen
Fettsäuren auf dem Wege über die Silbersalze keinen
Vorteil gegenüber der im folgenden angewendeten,
von Duclaux angegebenen Methode, die Jensen mit
Erfolg zur Bestimmung der beim Käsereifungsprozess
entstehenden und der in der Butter und im Palmfett
vorhandenen flüchtigen Fettsäuren benutzte.
Das Verfahren von Duclaux, das, von der er¬
wähnten Publikation Jensens abgesehen, in der Lite¬
ratur nirgends weiter verfolgt werden konnte, ist vom
Verfasser im Traité de Microbiologie, Tome 3, 1900
beschrieben. Es ermöglicht sowohl die quantitativeals auch die qualitative Bestimmung der flüchtigen
Fettsäuren und zwar auch in Gemischen von solchen.
Bei der geringen Verbreitung, die das Verfahren
bisher gefunden hat, dürfte eine ausführlichere Be¬
schreibung desselben angezeigt sein. Im einfachsten
Falle, d. h. wenn nur eine einzige Säure vorliegt,verfährt man so, dàss man zunächst! 110 ctoi3 einer im
Maximum 2%igen, wässerigen Lösung der betreffen¬
den Säure herstellt. Von dieser Lösung werden aus
einem zirka 300 cm3 fassenden, mit einem gewöhn-
— 35 —
lichen Kühler verbundenen Destillationskolben 10
Fraktionen zu je 10 cm3 abdestilliert, und jede Frak¬
tion für sich in einem Messzylinderchen aufgefangenund der Inhalt jedes Messzylinderchens mit einer Laugevon beliebigem, aber gleichbleibendem Gehalt (wir ver¬
wendeten "/so Natronlauge), unter Zusatz von Phenol-
phtalein bis zur bleibenden Rotfärbung titriert. Man,notiert sich die für jede Fraktion gebrauchte Mengevon Lauge, die wir im folgenden als Titer der be¬
treffenden Fraktion bezeichnen, und wird beobachten,dass diese Titer je nach der Art der vorhandenen
Säure von der ersten Fraktion zur letzten beständigabnehmen oder beständig zunehmen. Die Ab¬
nahme des Titers wird umso rascher erfolgen, je
flüchtiger die betreffende Säure mit Wasserdämpfenist oder, da die höheren Fettsäuren flüchtiger und
schwerer löslich sind als die niedrigen, je höher das
Molekulargewicht der betreffenden Säure ist. Valerian-
säure z. B. 'wird also eine bedeutend raschere Abnahme
der Titer zeigen als Butter- oder gar Propionsäure.
Man wird im ferneren beobachten, dass von dem zur
Destillation angewendeten Quantum der Säure bei den
niedrigeren Säuren (Ameisen- bis und mit Buttersäure)
nur ein bestimmter, für die betreffende Säure stets
gleich bleibender Teil der vorhandenen Säuremenge,
von Valeriansäure aufwärts in den 10 Fraktionen der
letzte Rest zum Ueberdestillieren gebracht werden
kann. Schon aus den bisher erwähnten Tatsachen er¬
gibt sich die Möglichkeit, nicht bloss die A r t, sondern,
was uns zwar hier weniger interessiert, auch die
Menge der vorhandenen flüchtigen Fettsäure er¬
mitteln zu können, immer noch vorausgesetzt, dass
nur eine einzige Säure vorliegt. Duclaux hat ge¬
funden, dass von Ameisensäure nur 59 %, von Essig-
— 36 —
säure 80,' von Propionsäure 95, von Buttersäure 97,5^von Valeriansäure 100 % der zur Destillation ver¬
wendeten Säuremenge in 100 cm3 Destillat übergehen.Diese Zahlen stellen ein direktes Mass für die Flüch¬
tigkeit der betreffenden Säuren dar.
Oben sahen wir, dass die Zu- oder Abnahme der
Titer der einzelnen Fraktionen von der Art der vor¬
handenen Säure abhängig ist. Es verbrauchten z. B.
in oben beschriebener Art destillierte Lösungen von
Essigsäure einerseits und Isovaleriansäure anderseits
in den einzelnen Fraktionen folgende Mengen von "/so
Lauge:
Fraktion Essigsaure Isovaleriansäure
1 2,42 5,522 2,70 4,193 2,78 2,984 3,07 2,165 3,23 1,356 3,36 0,857 3,42 0,518 3,87 0,339 4,33 0,30
10 5,02 0,12
Nun wird sich die Grösse der Titer der einzelnen
Fraktionen auch bei der gleichen Säure mit der Kon¬
zentration der zur Destillation verwendeten Säure
natürlich ändern. Was sich aber bei der gleichenSäure gleich bleibt, das ist das Verhältnis der
Titer der einzelnen Fraktionen. Um dieses Verhältnis
zur Anschauung zu bringen, addieren wir zunächst die
Titer der Fraktionen und zwar so, dass wir zum Titer
der zweiten Fraktion denjenigen der ersten, Izur Summ©der Titer der zwei ersten Fraktionen denjenigen der
— 37 —
dritten u. s. w. zuzählen. Im' vorhin angeführten Falle
erhalten wir demnach folgende Zahlen (Summe der
Titer):
Fraktion Essigsäure Isovaleriansäure
1 2,42 5,521 + 2 5,12 9,71
1+2 + 3 7,90 12,69
1+2+3+4 10,97 14,85etc. 5 14,20 16,20
6 17,56 17,157 20,08 17,668 24.85 - 17,99
9 29,18 18,2910 34,20 18,41
Hieraus berechnen wir, wieviel Prozent des Ge¬
samtverbrauches an Lauge (34,20 cm3 bei Essig-,
18,41 bei Isovaleriansäure) die vorstehenden Zahlen
repräsentieren und erhalten so °/o der Summe der
Titer:
raktion Essigsäure Isovaleriansäure
1 7,1 30,02 14,9 52,8
3 23,1 69,14 32,1 80,7
5 41,5 88,16 51,3 93,2
7 61,3 96,1
8 72,6 98,0
9 85,3 99,410 100,0 100,0
Diese Zahlen bezeichnet man als die Verhältnis¬
zahlen der Essigsäure, bezw. der Isovaleriansäure.
— 38 —
Duclaux ist für Essigsäure und Isovaleriansäure zu
folgenden Verhältniszahlen gekommen:
Fraktion Essigsäure Isovaleriansäure
1 7,4 30,52 15,2 53,0
3 23,4 69,54 32,0 81,0
5 40,9 88,5
6. 50,5 93,5
7 60,6 96,58 71,9 98,39 84,4 99,5
10 100,0 100,0
Jede andere flüchtige Säure liefert andere Ver¬
hältniszahlen, wie die folgende Tabelle zeigt:
Ameisensäure Propionsäure Buttersäure
5,9 12,1 17,6
12,2 24,0 33,6
19,0 35,3 47,5
26,4 46,2 50,0
34,4 56,8 70,6
43,2 66,7 79,5
52,8 76,2 86,5
64,6 85,0 92,5
79,6 93,0 97,0
100,0 100,0 100,0
Trägt man die Verhältniszahlen einer Säure als
Abszissen, die Fraktionen als Ordinaten auf, so lässt
sich der Verlauf der Destillation der verschiedenen
Säuren, wie Duclaux gezeigt hat, in Form von Kurven
darstellen, wie sie Fig. 1 zeigt:
— 39 —
Fig. 1.
Das Verfahren ist nachgeprüft worden, um fest¬
zustellen, ob sich die hier erhaltenen Zahlen mit den
von Duclaux ermittelten deckten. Unter Anwendung
eines 300 cm3 fassenden Destillierkolbens und eines
Kühlers mit einer Mantellänge von 42 cm1 wurden
bei einer Destillationsdauer von durchschnittlich 45
Minuten Resultate erhalten, die mit den von Duclaux
angegebenen im allgemeinen befriedigend überein¬
stimmten. Bedingung dafür ist die absolute Reinheit
der verwendeten Säuren, wie folgender Versuch zeigt:
Verhältniszahlen.
a) Mit dem gewöhnlichen Eisessig des
Laboratoriums:
1 8,4
2 17,2
— 40 —
3 25,9
4 34,9
5 44,4
6 54,5
7 64,1
8 74,7
9 86,4
10 100,0
b) Mit Eisessig Kahlbaum:
1 7,1
2 14,9
3 23,0
4 32,0
5 41,2
6 51,2
7 61,0
8 72,3
9 84,9
10 100,0
Die mit dem gewöhnlichen Eisessig erhaltenen
Zahlen sind also durchwegs höher, was auf die Gegen¬
wart einer höheren Säure und damit auf die nicht
völlige Reinheit des Präparates schliessen lässt. Auch
in andern Fällen hat sich das Duclauxverfahren als
ein ganz vorzügliches Mittel zur Prüfung der Rein¬
heit flüchtiger Fettsäuren erwiesen und verdient des¬
halb auch in dieser Beziehung alle Beachtung.
Noch auf einen anderen Umstand ist hier auf¬
merksam zu machen, der sich anlässlich eines in
anderem Zusammenhange stehenden Versuches, näm¬
lich der Prüfung der aus Isobutylalkohol durch Oxy¬
dation erhaltenen Säure nach dem Verfahren von
Duclaux ergab. Die Verhältniszahlen dieser Säure
stimmten nicht mit den von Duclaux für Buttersäure
— 41 —
angegebenen. Ein mit dieser Buttersäure angestellter
Kontrollversuch belehrte sofort darüber, dass die
Zahlen der Isosäure wesentlich höher sind als die¬
jenigen der normalen Säure, auf welche sich die An¬
gaben Duclaux's beziehen. Diese Beobachtung fand
sich nachträglich durch eine Angabe Jensens be¬
stätigt, und ergibt sich auch aus der Ueberlegung,dass von zwei Säuren mit dem gleichen Molekular¬
gewicht diejenige mit dem niedrigeren Siedepunkt als
die leichter flüchtige zuerst übergehen und somit
höhere Verhältniszahlen liefern muss.
Ist für den Fall,, als nur eine einzige Säure vor¬
liegt, deren Nachweis nach der Methode Duclaux klar
und unzweideutig zu führen, so werden die Verhält¬
nisse etwas schwieriger, wenn Gemische von zwei
Säuren vorhanden sind. Nach Duclaux verhält sich in,
solchen Fällen jede der vorhandenen Säuren so, als
ob sie allein wäre, würde also den Gesetzen folgen,die für ihre Destillation gelten. Wenn z. B. eine
Mischung von äquivalenten Mengen Essig- und Butter¬
säure vorliegt, so werden die bei der Destillation
erhaltenen Verhältniszahlen dem arithmetischen Mittel
derjenigen von Essig- und Buttersäure entsprechen.Die Kurve würde also in der Mitte zwischen den
beiden Säuren liegen. Sind 2 Molekülen entsprechende
Mengen Essigsäure und nur 1 Molekül entsprechende
Mengen Buttersäure vorhanden, so ergeben sich die
Verhältniszahlen für diese Mischung dadurch, dass
man die Verhältniszahlen der einzelnen Fraktionen
der Essigsäure mit 2 multipliziert, hiezu die der be¬
treffenden Fraktion entsprechende Verhältniszahl der
Buttersäure addiert und die Summe durch 3 dividiert.
Um dem Analytiker, der sich dieses Verfahrens
bedienen will, die Berechnung der Verhältniszahlen
— 42 —
für die. verschiedenen Säuregemische zu ersparen, hat
Duclaux die betreffenden Zahlen für die am meisten'
vorkommenden Säuren und für eine Anzahl von ver¬
schiedenen Mischungsverhältnissen in Form von Ta¬
bellen zusammengestellt, die wir der vorliegendenArbeit als Anhang beigeben.
Eine Vergleichung der betreffenden Zahlen be¬
lehrt ohne weiteres darüber, dass es Fälle geben
kann, in denen die Verhältniszahlen einer Mischungvon zwei Säuren sich fast genau mit denjenigen eines
anderen Mischungsverhältnisses von zwei anderen
Säuren decken. Als Beispiel sei hier folgender Fall
angeführt:
Verhältniszahlen für eine Mischung von
Fraktion
3
4
5
6
7
8
Da Abweichungen von den Duclaux'schen Zahlen
um 0,2 bis 0,3 nicht selten sind, so wird dem Ana¬
lytiker eine Entscheidung darüber, ob es sich im
konkreten Falle um die eine oder die andere Mischung
handelt, lediglich auf Grund dieser Zahlen nicht mög¬lich sein. Hier würde aber auch die Ermittelung des
Silbergehaltes der fraktioniert gefällten Silbersalze
nicht teum Ziele führen. Denn es liegt auf der Hand,dass selbst bei ausgiebiger Fraktionierung doch Ge¬
mische von Silbersalzen erhalten würden, deren Silber¬
gehalt zwischen demjenigen des ipropion^- und des essig-
1 Buttersaure l Propionsäure- 10 Essigsäure + 5 Essigsäure
25,6 25,4
34,5 34,4
43,6 43,6
53,1 53,2
63,2 63,2
73,8 74,0
- 43 —
sauren Silbers liegen muss. Ein Beispiel für einen
solchen Fall ist auf Seite 34 angeführt worden.
In derartigen Grenzfällen muss man sich mit
Unterfraktionen behelfen, ein Verfahren, das
auch dann angezeigt ist, wenn Gemische von mehr als
zwei Säuren vorliegen. Zweckmässig verbindet man
die Unterfraktionierung mit einer Anreicherungder höheren (und deshalb flüchtigeren) Säuren, in¬
dem man von der zu untersuchenden Lösung nur etwa
den dritten oder vierten Teil abdestilliert und diesen
Teil zur Prüfung speziell auf die Art der höheren Säure
verwendet. Man neutralisiert ihn zu diesem Zwecke
mit n/10 Barytlauge, notiert sich die Anzahl der ver¬
brauchten cm3 derselben, füllt mit Wasser auf zirka
100 cm' auf oder engt auf dieses Quantum ein, fügt
je nach der Konzentration der Lösung nur V«. bis Vio
der zur völligen Zerlegung der vorhandenen Baryum-
salze nötigen Menge N-Schwefelsäure hinzu und füllt
auf 110 cm3 auf. Von dieser Lösung destilliert man
10 Fraktionen zu je 10 cm3 ab. Wenn eine höhere
Säure vorliegt, so wird man namentlich in den ersten
Fraktionen bedeutend höhere Verhältniszahlen be¬
kommen, als wenn man direkt destilliert. Bestünde
nach den vorhin angeführten Beispielen die zu unter¬
suchende Mischung aus Propion- und Essigsäure, so
wird die erste Fraktion sicher nicht mit einer höheren
als der ersten Verhältniszahl der Propionsäure ein¬
setzen können, während im Falle des Vorhandenseins
von Buttersäure in den ersten Fraktionen Zahlen er¬
halten werden, die über die Verhältniszahlen der Pro¬
pionsäure hinausgehen und damit die Anwesenheit einer
höheren Säure verraten. Etwas schwieriger gestaltetsich die Beurteilung der nach weiterem Zusatz von
Schwefelsäure erhaltenen Unterfraktionen, wogegen
— 44 —
die niederste der vorhandenen Fettsäuren in den
letzten, nach nahezu vollständiger Zerlegung der
Baryumsalze noch verbleibenden Destillationsrück¬
ständen mit grosser Sicherheit erkannt werden kann.
Zur Bestätigung des Gesagten mögen die nachfol¬
genden Kontrollversuche dienen, die Herr Prof.
Dr. Treadwell anlässlich der Begutachtung der
vorliegenden Arbeit von uns verlangte. Es wurden uns
vier verschiedene, von ihm selbst hergestellte, mit
Nummern 1—4 bezeichnete, in ihrer Zusammensetzung
uns natürlich nicht bekannte wässerige Lösungen von
Gemischen flüchtiger Fettsäuren mit dem Auftrage
übergeben, die Art und das Mengenverhältnis der in
diesen Lösungen vorhandenen Säuren zu bestimmen
und damit die Brauchbarkeit des Duclauxverfahrens
zu beweisen. Wir geben nachstehend eine gedrängte
Beschreibung des Arbeitsverfahrens und der erhaltenen
Resultate:
1. Je 3,0 cm3 der betreffenden Lösungen wurden
auf 110 cm3 verdünnt und aus dieser verdünnten Lö¬
sung 10 Fraktionen zu je 10 cm3 abdestilliert, wobei
folgende Verhältniszahlen erhalten wurden:
Lösung 1.
Fraktion
123456789 10
8,0 16,2 25,4 34,3 43,6 53,3 63,5 74,0 85,8 100,0
Lösung 2.
8,3 16,8 25,8 34,4 43,3 53,2 63,3 73,8 85,6 100,0
Lösung 3.
10,0 19,4 28,2 37,4 45,8 54,9 63,9 74)0 85,5 100,0
Lösung 4.
12,6 24,6 36,3 47,3 57,8 67,9 76,9 85,4 93,3 100,0
- 45 -
Vergleicht man die hier gefundenen mit den in den
Tabellen von Duclaux enthaltenen Zahlen, so wird man
finden, dass nach dem Ergebnis der direkten Destil¬
lation Lösung 1 eine Mischung von 1 Teil Propion-mit 5 Teilen Essigsäure, aber ebenso gut auch eine
solche von 1 Teil Buttersäure mit 10 Teilen Essig¬säure sein kann. — Die Verhältniszahlen von Lösung2 sind namentlich von der 3. Fraktion an ähnlich wie
diejenigen der Lösung 1. Auch bei diesem Gemisch
lässt sich auf Grund der direkten Destillation noch
nicht sagen, ob es aus Propion- und Essigsäure oder
aus Buttersäure und Essigsäure bestehe. — Lösung3 lässt nach ihren Verhältniszahlen auf eine Mischungvon Valeriansäure (1 Teil) und Essigsäure (8 Teile)schliessen. Immerhin stimmen die Fraktionen 6, 7, 8
und 9 nicht ganz befriedigend weder auf das eine,noch das andere Verhältnis. — Die Verhältniszahlen
von Lösung 4 liegen um ein weniges höher als die¬
jenigen der Propionsäure und kommen einem Gemische
von 1 Teil Buttersäure mit 8 Teilen Propionsäure am
nächsten.
2. Bei den Lösungen 1 und 2 musste also auf dem
Wege der Unterfraktionierung zu entscheiden versucht
werden, ob sie neben Essigsäure entweder Propion-oder Buttersäure enthielten. Bei Lösung 3 schien uns
der unzweideutige Nachweis von Valeriansäure wün¬
schenswert, in Lösung 4 derjenige von Buttersäure.
Im weitern war einwandfrei festzustellen, ob die nie¬
derste der in den Lösungen 1, 2 und 3 vorhandenen
Säure wirklich Essigsäure, in Lösung 4 Propionsäurewaf. Die schlecht stimmenden Zahlen der mittleren
und letzten Fraktionen von Lösung 3 gaben uns ferner
Anlass, nachzusuchen, ob diese Lösung nicht noch
eine dritte, zwischen Valeriansäure und Essigsäure
— 46 —
liegende Fettsäure enthielt. Hiezu verfuhren wir fol-
gendermassen:
Lösung 1: 100 cm3 wurden mit 198 cm' n/i0
Barytlauge neutralisiert, auf ca. 150 cm3 eingeengt
und mit 5 cma N-Schwefelsäure versetzt. Hievon
destillierten wir 100 cm3 ab, stellten den Rückstand
(1) vorläufig bei Seite, neutralisierten das Destillat
mit 16,7 cm3 n/i0 Barytlösung, dampften auf 110 cm3
ein und fügten zur Abscheidung einer ersten Unter¬
fraktion zunächst 0,4 cm3 N-Schwefelsäure hinzu. Von
der so erhaltenen Flüssigkeit wurden 10 Fraktionen
zu je 10 cm3 abdestilliert, wobei sich folgende Ver¬
hältniszahlen ergaben:
123456789 10
10,7 20,8 30,9 41,0 51,1 61,2 71,1 80,7 90,0 100,0
Vergleicht man diese Zahlen mit den bei der di¬
rekten Destillation von Lösung 1 erhaltenen, so wird
man eine durch die Anreicherung der höheren Säure
und durch die Unterfraktionierung bedingte Erhöhungder Verhältniszahlen beobachten, aber zugleich auch
erkennen können, dass die höchste der vorhandenen
Säuren nicht Buttersäure, sondern nur Propionsäuresein kann. Die oben erhaltenen Zahlen stimmen recht)
befriedigend auf eine Mischung von 2 Teilen Propion-mit 1 Teil Essigsäure.
Zum Rückstand 1 wurden 14 cm3 N-Schwefelsäure
gefügt, auf 110 cm3 aufgefüllt und daraus 100 cm3
abdestilliert. Das Destillat wurde nicht untersucht,wohl aber der Destillationsrückstand 2, der die nied¬
rigste der vorhandenen -Säuren, vorläufig noch als
Ba-Salz, enthalten musste. Wir fügten zu diesem Rück¬
stand 0,8 cm3 N-Schwefelsäure, füllten auf 110 cm3
— 47 —
auf und destillierten daraus 10 Fraktionen zu je 10
cm1 ab. Die Verhältniszahlen lauteten:
7,0 14,3 22,3 30,7 39,7 49,3 59,7 70,9 83,7 100,0
Diese Zahlen liegen etwas unter den Verhältnis¬
zahlen für Essigsäure, was auf die Anwesenheit von
Spuren von Ameisensäure zurückgeführt werden
könnte. In der Tat ergab die qualitative Prüfung der
Lösung 1 mit Natriumacetat und Quecksilberchloriddurch Ausscheidung von wahrnehmbaren Mengen
Calomel die Gegenwart von Spuren von Ameisensäure,die indessen lediglich als Verunreinigung der ver¬
wendeten Essigsäure aufzufassen sind.
Lösung 1 musste demnach als eine Mischung von
Propionsäure und Essigsäure angesprochen werden.
Nach dem Ergebnis der direkten Destillation war das
Mischungsverhältnis 1 Propion- zu 5 Essigsäure, wäh¬
rend, wie uns nachher mitgeteilt wurde, die Lösungdurch Mischen von 10,5 g Essigsäure und 1,98 g
Propionsäure und Verdünnung auf 1 Liter hergestelltworden war. Daraus ergibt sich effektiv ein Mischungs¬verhältnis von 2 Teilen Propion- und 11 Teilen Essig¬säure, oder abgerundet 1 P : 5 E.
Lösung 2: Diese Lösung hatte bei der direkten
Destillation ähnliche Zahlen wie die Lösung 1 er¬
geben. Durch Anreicherung der höheren Säure und
Unterfraktionierung, wie bei 1 beschrieben, wurde eine
erste Unterfraktion mit folgenden Ver'hältniszahlen er¬
halten:
13,2 25,9 37,5 48,7 58,5 67,9 76,3 84,5 92,3 100,0
Diese Zahlen sind höher als die Verhältniszahlen
der Propionsäure und lassen demnach mit Bestimmt¬
heit auf die Gegenwart der nächst höheren Säure,
— 48 —
also Buttersäure, schliessen. Sie entsprechen ziem¬
lich genau dem Verhältnis 1,5 Butter- zu 1 Essigsäure.
Die mittleren Unterfraktionen, die wir nach
weiterem sukzessivem Zusatz von N-Schwefelsaure er¬
hielten, ergaben dagegen Verhältniszahlen, die ebenso
gut auf Gemische von Propion- mit Essigsäure, wie
mit Butter- und Essigsäure stimmten. Es konnte also
ohne eine weitere Unterfraktionierung nicht mit Sicher¬
heit gesagt werden, ob nicht neben Butter- auch noch
Propionsäure vorhanden sei. Jede andere Methode
würde hier aber ebenfalls im Stiche gelassen haben.
Das mag schon aus der Seite 34 erwähnten Tatsache
hervorgehen, wonach der Silbergehalt der ersten Frak¬
tion eines mit der höheren Säure stark angereicherten,Teiles von Lösung 2 zu 61,03 % gefunden wurde,
während buttersaures Silber nur 55,38, propionsauresSilber 59,67 °/o, essigsaures Silber 64,67 °/o Silber ver¬
langt. Auf diesem Wege hätte sich also die Butter¬
säure schon in der ersten Fraktion dem Nachweis
völlig entzogen.
Die letzten Unterfraktionen lieferten die Verhält¬
niszahlen der Essigsäure und diejenigen eines Ge¬
misches von Essigsäure mit Spuren von Ameisensäure.
Lösung 2 enthielt demnach sicher Buttersäure und
Essigsäure. Nach dem Ergebnis der direkten Destil¬
lation war das Verhältnis auf 1 Teil Buttersäure und
10 Teile Essigsäure zu veranschlagen, während sie
effektiv aus 1 Teil Butter- und 8 Teilen Essigsäure
hergestellt worden war.
Lösung 3: Vorbehandlung wie bei Lösung 1
und 2. Die erste Unterfraktion lieferte folgende Ver¬
hältniszahlen:
25,7 45,1 60,3 72,9 82,5 89,3 94,0 96,9 98,7 100,0
— 49 —
Der Wert der Anreicherung und der Unterfrak-
tionierung ergibt sich zur Evidenz gerade aus diesem
Beispiel. Denn während bei der direkten Destillation
die ersten 10 cm3 mit einer Verhältniszahl von nur
10,0 einsetzten, ist diese infolge der Vorbehandlung!nun auf 25,7 gestiegen. Die Gegenwart von Valerian-
säure ist damit erwiesen. Denn eine höhere Säure kann,
nach dem reichlichen Unterfraktionieren nicht in Be¬
tracht kommen, da die oben erhaltene Verhältniszahl von
25,7 noch etwas unter derjenigen liegt, mit der Va-
leriansäure in der ersten Fraktion einsetzt (30,5), und
um eine niedrigere Säure kann es sich in dieser Frak¬
tion deswegen nicht handeln, weil Buttersäure mit
der Verhältniszahl 17,6 beginnt.
Merkwürdigerweise stimmten aber die oben bei
der ersten Unterfraktion erhaltenen Verhältniszahlen
nur zum Teil auf das nach dem Ergebnis der direkten
Destillation zu erwartende Gemisch von Valerian- und
Essigsäure. Die Uebereinstimmung ist in den ersten
Fraktionen eine hinreichende für ein Gemisch von 4
Teilen Valerian- mit 1 Teil Essigsäure. Von der 4.
Fraktion an aber zeigen die Zahlen eine Steigerung,die eher für eine Mischung von Valerian- mit Butter¬
säure passt, eine Erscheinung, der wir schon bei der
direkten Destillation der Lösung 3 begegnet sind. Die
von Duclaux für Valeriansäure (es handelt sich um
Isovaleriansäure) angegebenen Verhältniszahlen sind
s. Z. von Jensen nachgeprüft und ihre Richtigkeit
bestätigt worden. Auch wir haben mit einem über
das Silbersalz mehrfach gereinigten Präparate
identische Zahlen erhalten. Die Differenzen in den
mit der Lösung 3 erhaltenen Verhältniszahlen müssen
also zweifellos nur der nicht völligen Reinheit der
verwendeten Valeriansäure zugeschrieben werden. In
- 50 -
der Tat erhielten wir bei mehrfach angestellten Ver¬
suchen mit dem ohne vorhergehende Reinigung ver¬
wendeten Präparate Kahlbaum weder bei der direkten
Destillation, noch nach Unterfraktionierung Zahlen,
die mit den von Duclaux angegebenen stimmten. Denn
die direkte Destillation ergab:
29,6 51,3 67,3 79.3 87,1 92,9 96,2 98,1 99,2 100,0
statt
30,5 53,0 69,5 81,0 88,5 93,5 96 5 98,3 99,5 100,0
Nach Unterfraktionierung setzte die erste Frak¬
tion der Unterfraktion mit der Verhältniszahl 33,1
ein, ein Beweis dafür, dass das Präparat höhere Säuren
enthalten musste. Die nachfolgenden Unterfraktionen
lieferten Verhältniszahlen, die ganz gut als diejenigen
eines Gemisches von Valerian- und Buttersäure ge¬
deutet werden konnten, wie folgende Fraktion beweist:
29,5 51,1 67,5 79,3 87,2 92,4 95,8 97,4 98,6 100,0
entsprechend einem Gemisch von 1 Teil Butter- mit
10 Teilen Valeriansäure :
29,3 51,2 67,5 79,1 86,9 92,2 etc.
Nach weiter getriebener Unterfraktionierung
wurde eine letzte Fraktion mit folgenden Verhältnis¬
zahlen erhalten:
26,1 46,1 61,1 72,7 81,1 87,0 91,2 94,3 97,0 100,0
entsprechend einem Gemische von zirka 1 Butter- mit
2 Valeriansäure.
So ist es nicht unerklärlich, dass wir in Lösung
Nr. 3 einzelne Fraktionen isolieren konnten, die als
Mischungen von Valerian- mit Buttersäure aufzufassen
waren, während diese Lösung tatsächlich keine Butter-
säure zugesetzt erhalten hatte, sondern aus einer
Mischung von Valeriansäure (1 Teil) mit Essigsäure
(6 Teile) bestand.
— 51 —
Die letzten Unterfraktionen ergaben die typischen
Verhältniszahlen der Essigsäure, wobei Spuren von
Ameisensäure sich auch hier wieder zeigten.
Es bilden diese zuletzt angeführten Tatsachen
einen neuen Beweis für die Empfindlichkeit der Me¬
thode Duclaux, der wir schon anlässlich der Ver-
gleichung verschiedener Präparate von Essigsäure Er¬
wähnung getan haben.
Lösung 4: Vorbehandlung wie bei den Lösungen
1, 2 und 3. Verhältniszahlen der ersten Unterfraktion;
14,3 27,8 40,3 52,0 62,6 72,1 80,8 88,6 95,0 100,0
Da diese Zahlen zwischen den Verhältniszahlen
für Butter- und Propionsäure liegen, so konnte die
höchste der vorhandenen Säuren nur Buttersäure sein.
Die Zahlen entsprechen wenigstens in den vorderen
Fraktionen fast genau einer Mischung von 1 Teil
Buttersäure mit 1,5 Teilen Propionsäure, welche
Mischung folgende Verhältniszahlen aufweist:
14,3 27,8 40,1 51,7 62,3 71,8 80,3 88,0 94,6 100,0
In den folgenden Unterfraktionen nahm das Ver¬
hältnis dieser zwei Säuren zu Ungunsten der Butter¬
säure ab, bis die Verhältniszahlen der reinen Propion¬
säure erhalten wurden. In den allerletzten Fraktionen
machten sich Spuren von Essigsäure an der Ernied¬
rigung der Verhältniszahlen bemerkbar.
Nach dem Ergebnis der direkten Destillation war
das Verhältnis der in dieser Lösung 4 enthaltenen
Säuren auf 1 Teil Buttersäure zu 8 Teilen Propion¬
säure zu veranschlagen, was mit der Zusammensetzung
der Lösung in der Tat stimmte.
— 52 —
Zusammenfassend ist also' festzustellen, dass das'.
Duclauxverfahren es uns ermöglichte, sowohl die Art
als das ungefähre Mengenverhältnis der in den vier
Kontroilösungen enthaltenen Fettsäuren zu bestimmen..
Ist die Anreicherung der höheren Säuren und die
Herstellung von genügend zahlreichen Unterfraktionen
unter Umständen schon bei Gegenwart von nur zwei
Säuren angezeigt, so wird diese Operation direkt zur
Notwendigkeit, wenn mehr als zwei Säuren vorliegen.
Ein Beispiel hiefür liefert folgender Versuch:
Eine' Mischung von je 0,14 g Essig-, Propion-,
Butter- und Valeriansäure wurde mit 70,6 cm3 n/10,
Barytlauge neutralisiert, mit 2,0 cm3 N-Schwefelsäure
versetzt, auf 110 cm3 aufgefüllt und daraus in 10
Fraktionen je 10 cm3 abdestilliert. Für diese 10 Frak¬
tionen ergaben sich folgende Verhältniszahlen:
1. 17,0
2. 31,5
3. 43,5
4. 56,5
5. 66,9
6. 76,0
7. 83,6
8. 90,3
9. 95,9
10. 100,0
Nun setzt aber Valeriansäure mit 30,5, ein Ge¬
misch von 1 Teil derselben mit 10 Teilen Buttersäure»
mit 18,8 und Buttersäure selbst mit 17,6 ein. Die
Valeriansäure hatte sich also dem Nachweis völlig-
entzogen. Was überdestilliert war, erwies sich dem-
— S3 —
nach als ein nach diesem Verfahren unentwirrbares
Gemisch verschiedener der angewendeten Säuren, in
welchem Gemisch wahrscheinlich nur die Essigsäurefehlte. Und wo lag die Ursache? Einzig an der zu
wenig ausgiebigen Unterfraktionierung, wie aus dem
folgenden Versuch hervorgeht, der nach den nötigen
Vorarbeiten mit Kontrollmaterial an einer künstlichen
Essenz von bekannter Zusammensetzung ausgeführtwurde. Dieser Versuch mag gleichzeitig als Beschrei¬
bung des Verfahrens dienen, das zur näheren Unter¬
scheidung künstlicher von natürlichen Essenzen ur¬
sprünglich angewendet worden ist:
2. 50 cm3 eines als „konzentrierter Erdbeeräther"
bezeichneten und wie auf Seite 13 beschrieben zu¬
sammengesetzten Fruchtäthers wurden bis auf einen
geringen Rest abdestilliert, das Destillat durch Kochen,mit alkoholischer Kalilauge verseift, wieder abdestil¬
liert, der Rückstand mit Schwefelsäure angesäuertund daraus im Dampfström 2,5 1 abdestilliert. Dieses
letztere Destillat wurde behufs Ueberführung der
übergegangenen, flüchtigen Säuren in die Baryum-salze mit n/io Barytlösung neutralisiert, wozu 200,1cm3 nötig waren. Das neutralisierte Destillat wurde
auf etwa 100 cm3 eingedampft, mit 4 cm3, d. h. nur
Vä der zur vollständigen Zerlegung der Ba-Salze
nötigen Menge N-Schwefelsäure versetzt, auf 110 cm3
aufgefüllt und daraus 100 cm3 abdestilliert. Die
gleiche Prozedur wurde noch 4 mal wiederholt. Diese
Unterdestillate wurden wieder mit Barytlösung neu¬
tralisiert, mit je 0,5 cm3 N-Schwefelsäure, wie oben»
fraktioniert, gefällt und in Unterfraktionen von je
10 mal 10 cm3 zerlegt. So erhielt man 5 Destillate
und aus jedem 4 mal 10 Fraktionen von je 10 cm3.
Den Verlauf der Verhältniszahlen einiger dieser Frak-
— 54 —
tionen stellen wir in Form von Kurven in Figur 2
dar:
0 10 20 30 10 50 6 1 0 i>0 Qu 100
Nach dem Verlauf dieser Kurven müssen wir die
in dieser künstlichen Brdbeeressenz enthaltenen, flüch¬
tigen Fettsäuren als Valerian-, Butter- und Essig¬
säure ansprechen. Dieses Ergebnis deckt sich mit
der uns vom Fabrikanten dieser Essenz nachträglicherst mitgeteilten Zusammensetzung. Sie enthielt näm¬
lich an Estern Valeriansäureamyläther, Butter- und
Essigsäureäther.
Dieses Verfahren wurde auf eine Anzahl natür¬
licher Fruchtessenzen und künstlicher Fruchtäther anj
gewendet, wobei sich ergab, dass Abkürzungen be¬
züglich der Zahl der Fraktionierungen in einzelnen
Fällen zulässig waren und die Brauchbarkeit der Me¬
thode aus nachher noch zu besprechenden Gründen
— 55 —
nicht beeinträchtigen. Im fernem konnte in der Folge
die zur Untersuchung anzuwendende Menge unbe¬
schadet der Genauigkeit der Methode auf 10 am6 bei
den künstlichen und 200 cm? bei den natürlichen
Essenzen reduziert werden, während ursprünglich für
die ersteren 50, für die letzteren 500 cm' verwendet
wurden.
Als Gegenstück zu dem vorhin beschriebenen
künstlichen Erdbeeräther mögen hier etwas ausführ¬
licher als es bei den übrigen untersuchten Essenzen
geschehen wird, der Gang der Untersuchung und der
Verlauf der einzelnen Fraktionen einer natürlichen
Erdbeeressenz beschrieben werden.
Angewendete Menge: 500 g. Die stark extrakt-
haltige Essenz wurde so vollständig als möglich ab¬
destilliert, das Destillat mit 50 cm3 40°/oiger wässe¬
riger Natronlauge verseift, wieder abdestilliert, der
Rückstand mit Schwefelsäure angesäuert und daraus
im Dampfstrom 2 Liter abdestilliert. Das Destillat
wurde mit 86,1 cm5 n,10 Barytlauge neutralisiert.
(Man beachte den geringen Laugenverbrauch bei dieser
natürlichen Essenz gegenüber dem künstlichen Erd¬
beeräther, von dem die zehnmal kleinere Substanz¬
menge 200,1 cms n/10 Barytlauge zur Absättigung
der Estersäuren benötigte.) Die Lösung der Baryum-
salze wurde, wie vorhin beschrieben, eingeengt, auf
110 cm1 gebracht und daraus durch Zusatz von 5 mal
je 2 cm3 "/i Schwefelsäure und jedesmaligem Abdestil-
lieren von 100 cm1 5 Destillate hergestellt, die
nach Neutralisation mit Barytlauge und Auffüllen auf
je 110 cm3 zur Abscheidung der Unterfraktionen
dienten.
Zum 1. Destillat wurden zunächst 0,4 cms n/iSchwefelsäure gegeben und nur 10 Fraktionen zu je
— 56 —
10 cm1 abgeschieden. Sie lieferten folgende Verhältnis¬
zahlen:
123456789 10
9,1 18,9 28,8 38,7 48,4 58,2 68,6 78,8 89,0 100,0
entsprechend dem Verhältnis 1 Propion¬
säure: 1 Essigsäure:
29.3 39,1 48,9 58,6 68,5 78,5
Der Destillationsrückstand wurde mit Wasser
wieder auf 110 cm3 aufgefüllt und daraus nach Zu¬
satz von 0,6 cm3 wieder 10 Fraktionen abdestilliert.
Verhältniszahlen dieser Fraktionen:
123456 789 10
7,9 16,3 25,2 34,3 43,8 53,7 64,0 74,6 86,6 100,0
1 Propionsäure : 4 Essigsäure:
16,9 25,8 34,8 44,1 53,7 64,0 74,5
1 Propionsäure : 5 Essigsäure:
25.4 34,4 43,6 52,2 63,2 74,0
Das 2. Destillat wurde in ähnlicher Art unter¬
fraktioniert.
1. Unterfraktion mit 0,6 cm % Schwefelsäure.
Verhältniszahlen :
123456 789 10
8,1 16,4 25,3 33,6 43,4 53,1
2. Unterfraktion mit 0,6 cm3 n/t Säure:
123456 789 10
8,0 16,5 25,0 33,6 43,1 53,2 63,2 74,0
1 Propionsäure : 6 Essigsäur e:
16,5 25,1 34,0 43,1 52,8 62,8 73,8
3. Destillat.
1. Unterfraktion mit 1,0 cm* % Säure:
123456789 10
7,9 16,2 24,7 33,5 42,8 52,6 62,9 74,0 85,9 100,0
— 57 —
2. Unterfraktion mit 0,6 cm3 n,'1 Säure:
123456789 10
"7,6 15,8 24,3 32,9 42,4 52,2 62,4 73,6 85,5 100,0
Nähern sich 1 Propionsäure : 7 Essigsäure.
4. Destillat.
1. Unterfraktion mit 1,0 cm3 Säure:
123456789 10
8,1 16,5 25,0 34,0 43,2 52,7 62,8 73,6 85,9 100,0
Vorwiegend Essigsäure, wenig Propionsäure.
2. Unterfraktion mit 0,8 cm3 Säure:
123456789 10
7,4 15,1 23,4 32,0 41,4 51,3 61,2 72,4 84,8 100,0
Nahezu reine Essigsäure.
Wie aus dem Verlaufe der Destillationen ersicht¬
lich, bestehen die in dieser natürlichen Erdbeeressenz
enthaltenen Estersäuren ausschliesslich aus Propion¬
säure und Essigsäure, wobei die letztere quanti¬
tativ überwiegt.
Das allmähliche Zurückweichen der Propionsäure,
wie das Hervortreten der Essigsäure wird durch den
Destillationsverlauf recht anschaulich.
Es zeigt dieses Beispiel auch ohne weiteres, dass
man bei Gegenwart von nur zwei Säuren einer so
starken Unterfraktionierung nicht bedarf. Sie musste
aber angewendet werden, solange man über die An¬
zahl der in den natürlichen Essenzen vorhandenen
Ester-Säuren nicht im Klaren war.
Nachstehend die Untersuchungsresultate einer
Anzahl anderer, natürlicher und künstlicher Essenzen:
— 58 —
Walderdbeeressenz W. & Oie., D.
Weiss, 2fach, naturrein.
Farblose Essenz mit ausgeprägtem, natürlichem
Erdbeeraroma. Verwendet 200 cm1 Essenz. Behand¬
lung wie oben angegeben. 2 Fraktionen mit je 0,3 cm3.
1. Fraktion.
1234567 89 10
11,6 22,2 32,2 41,5 50,8 60,1 69,5 78,9 100,0
2. Fraktion.
8,4 16,9 25,5 34,0 43>3 52,8 62,6 73,5
Die erste Fraktion stellt ein Gemisch von Pro¬
pionsäure und Essigsäure dar, in welchem in
den ersten Anteilen die Propionsäure überwiegt. Die
letzten Anteile lassen die Essigsäure stärker hervor¬
treten. Die zweite Fraktion entspricht einem Gemisch
von 1 Teil Propionsäure und 6 Teilen Essigsäure fast
theoretisch.
Himbeerlimon&denessenz Dr. H.
Höchstkonzentriertes Extrakt und
Destillat aus frischen Himbeeren.
Rote Essenz mit tadellosem natürlichem Himbeer¬
aroma. 3 Fraktionen mit je 0,8 cm1 Säure.
1. Fraktion.
12.3456 789 10
7,4 15,5 23,8 32,8 42,2 51,9 62,4 73,5
2. Fraktion.
7,4 15,4 23,7 32,4 41,7 51,3 61,8 72,9
3. Fraktion.
7,2 15, L 23,4 32,0 41,0 50,7 61,9 72,3
— 59 —
Auch hier sind an Estersäuren also nur Propion¬säure und Essigsäure, letztere vorherrschend, nach¬
weisbar. Die 3. Fraktion repräsentiert reine Essig¬säure.
Himbeeressenz W. & Cie., D.
Eot, Ia höchstkonzentriert, extra, nat.
Tadelloses, natürliches Himbeeraroma. 3 Frak¬
tionen mit 0,3 cm3 und 0,6 cm3 und 0,8 cm3.
1. Fraktion.
123456789 10
9,1 18,0 26,9 36,1 45,4 55,0 65,4 75,7
2. Fraktion.
8,3 16,5 25,4 34,2 43,4 53,0 63,2 74,6
3. Fraktion.
7,5 15,2 23,5 32,0 41,6 51,5 61,8 72,8
Propionsäure und Essigsäure, letztere überwiegend.
Himbeeressenz S. & Cie., L.
Nr. 1933a.
Farblose Essenz mit ausgesprochenem, natür¬
lichem Himbeeraroma. 2 Fraktionen mit je 0,8 cm3.
1. Fraktion.
12 3 4 5 6 7 8
7,7 15,6 24,1 32,7 41,8 51,2 61,4 72,4
2. Fraktion.
6,9 14,8 23,2 32,1 41,2 51,0 61,0 71,9
Wenig Propionsäure, Rest Essigsäure.
— 60 —
Essence Raspberry „Special" A. B., R. & Co.,
Ltd.
Nighly concentradid, guaranteed pure.
Rote Himbeeressenz mit deutlich hervortretendem
Geruch nach künstlichen Fruchtäthern. 3 Fraktionen
mit 1,0, 0,8 und 0,8 cm3.
1. Fraktion.
12 3 4 5 6 7 8
8,7 17,5 26,5 35,5 44,9 54,2 64,1 74,6
2. Fraktion.
Lediglich abdestilliert.
3. Fraktion.
7,3 15,5 23,4 32,9 42,1 51,7 62,0 73,5
Propionsäure und vorherrschend Essigsäure.
Erdbeeräther, konz., farblos, E., D.
Künstlicher Aether, durch den Geruch als solcher
(erkennbar. 3 Fraktionen mit je 0,5 cm3.
1. Fraktion.
12 3 4 5 6 7
11,5 23,1 34,0 44,1 54,5 64,4 73,8
5 Propionsäure : 1 Essigsäure.
33,3 43,8 54,2 64,0 73,6
2. Fraktion.
11,1 22,4 33,1 43,5 53,4 63,5 73,2
4 Propionsäure : 1 Essigsäure.
32,9 43,3 53,6 63,4 73,0
3. Fraktion.
10,9 22,0 32,4 42,7 52,8 62,5 72,3
3 Propionsäure : 1 Essigsäure.
32,3 42,6 52,8 62,6 72,4
— 61 —
Die Estersäuren bestehen vorwiegend aus Pro¬
pionsäure, daneben Essigsäure.
Erdbeeräther, konz., englisch, E., D.
Künstlicher Aether.
3 Fraktionen mit je 1,0 cma.
1. Fraktion.
12 3 4 5 6 7
10,8 21,4 32,0 42,5 52,8 63,0 72,9
3 Propionsäure : 1 Essigsäure.
2. Fraktion.
10,8 21,3 31,6 42,1 52,2 62,5 72,3
3 Propionsäure : 1 Essigsäure.
3. Fraktion.
9.8 19,5 29,6 39,3 49,2 58,8 68,8
1 Propionsäure : 1 Essigsäure.
29.3 39,1 48,9 58,6 68,5
Vorwiegend Propionsäure, wenig Essigsäure.
Himbeeräther, konz., S., Z.
Künstlicher Aether.
2 Fraktionen mit 0,3 und 0,6 cm3.
1. Fraktion.
8,7 18,1 27,5 36,7 46,0 55,3 65,8
1 Propionsäure : 2 Essigsäure.
27.4 36,7 46,2 55,9 66,0"
2. Fraktion.
7.9 16,2 24,7 33,4 42,9 52,9 63,1
Wenig Propionsäure, viel Essigsäure.
— 62 —
Die vorliegenden Zahlen lehren folgendes:
1. Die natürlichen Essenzen enthalten an Ester¬
säuren Propion- und Essigsäure. Das Verhältnis dieser
beiden Säuren wechselt nach der Art der Essenz.
2. In den künstlichen Aethern kommen je nach
ihrer Herstellungsart verschiedene Estersäuren vor.
Die Mehrzahl der untersuchten Proben enthielt Pro¬
pion- und Essigsäure. Nur der auf Seite 53 be¬
schriebene Erdbeeräther war frei von Propionsäure,enthielt aber neben Essigsäure noch Valerian- und
Buttersäure.
3. Ein analytischer Unterschied lässt sich be¬
züglich der Art der Estersäuren zwischen natürlichen
und künstlichen Essenzen nicht immer ableiten. Sind
in einer Essenz Valerian- oder Buttersäure nachweis¬
bar, so ist sie mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht
natürlicher Herkunft, sondern ein Kunstprodukt. Die
Abwesenheit dieser ßäuren berechtigt nicht zum gegen¬
teiligen Schlüsse.
Diese Resultate mögen insofern überraschen, als
in den natürlichen Essenzen keine Ester höherer Säuren
als der Propionsäure angetroffen wurden, obwohl deren
Gegenwart nach Analogie der Vorgänge bei der Wein¬
gärung anzunehmen gewesen wäre. Allerdings soll
ja auch unter den im Wein vorkommenden Ester¬
arten der Essigsäureäthylester präponderieren.
Das Auftreten der Propionsäure ist offenbar als
Begleiterscheinung der Gegenwart von Essigsäure auf¬
zufassen. Wie weiter vorn mitgeteilt, ist die Propion¬säure ein recht häufiger Begleiter der Essigsäure auch
in Handelsware. Es kann deshalb auch nicht ver¬
wundern, dass in einigen künstlichen Essenzen, zu
— 63 —
deren Bereitung nach den Angaben der Fabrikanten
an Estern nur Amylacetat verwendet wurde, sich kleine
Mengen von Propionsäure nachweisen Hessen.
2. Identifizierung der Esteralkohole.
Dass die künstlichen Fruchtäther höhere Alkohole
in Form von Estern enthalten, bedarf eigentlich keiner
besonderen Erwähnung mehr. Es erübrigte noch ihr
analytischer Nachweis und die vergleichende Unter¬
suchung von natürlichen Frucht essenzen, deren Ester
bezüglich Zusammensetzung noch nicht genügend be¬
kannt waren. Wohl hat Kreis6) darauf hingewiesen,
dass nach dem Ergebnis der Reaktion Komarowskydie Gegenwart höherer Alkohole auch in natürlichen
Essenzen anzunehmen sei, wobei natürlich noch zu
beachten ist, dass nicht bloss der Amyl-, sondern
auch Propyl- und Butylalkohol mit Salicylaldehyd und
Schwefelsäure Färbungen liefern, die Art der höheren
Alkohole durch die Komarowsky-Reaktion also nicht
ermittelt werden kann.
Für diesen letztern Zweck, nämlich die Identi¬
fizierung der in künstlichen und natürlichen Essenzen
enthaltenen höheren Alkohole schien sich das von L.
Marquardt7) zur Bestimmung des Fuselöles in Brannt¬
weinen vorgeschlagene Verfahren applizieren zu lassen.
Das Verfahren beruht auf dem Prinzip, die im Fuselöl
vorhandenen höheren Alkohole durch Oxydation in die
entsprechenden Säuren überzuführen. Durch Kochen
mit Baryumkarbonat werden die letzteren in die Ba-
«) Chem.-Ztg. 1907, Nr. 80.
7) Bericht der deutschen ehem. Gesellsch. 1882, 1370, 1661.
- 64 —
Salze verwandelt und aus der Menge des in ihnen ent¬
haltenen Baryums auf die Menge der Säure und da¬
mit des ursprünglich vorhandenen Amylalkohols ge¬
schlossen. Dem Verfahren haftet der Nachteil an,
dass man bei der Oxydation von Fuselöl als eines
Gemenges von verschiedenen höheren Alkoholen nicht
eine einheitliche Säure erwarten darf, eine qualitative
Unterscheidung also nicht möglich ist, und dass die
quantitative Bestimmung der Fettsäuren mit Hülfe
der Baryumsalze aus weiter vorn schon erwähnten
Gründen keine zuverlässigen Resultate liefert.
Es wurde deshalb eine Kombination der Verfahren
von Marquardt mit der Duclaux-Methode versucht und
zwar in der Weise, dass die nach der Vorschrift von
Marquardt durch Oxydation der Esteralkohole er¬
haltenen Säuren nach dem Verfahren von Duclaux
auf ihre Art geprüft wurden.
Kontrollversuch: 0,4 cm3 Amylalkohol des
Handels wurden in 150 cm3 reinstem Chloroform ge¬
löst, nach Vorschrift mit einer Lösung von 5 g Ka-
liumbichromat in 30 cm3 Wasser, sowie mit 2 g konz.
Schwefelsäure übergössen und das Ganze in einem
Kolben am Rückflusskühler sechs Stunden im Wasser¬
bade bei Siedetemperatur unter öfterem Umschütteln
erhitzt. Nach beendigter Oxydation wurde der In¬
halt der Flasche einschliesslich Chloroform in einen
Destillierkolben gebracht und bis auf etwa 20 cm3
abdestilliert. Hierauf wurden 80 cm3 Wasser zuge¬
fügt und weiter bis auf 5 cm3 abdestilliert.
Das Destillat wurde mit n/io Barytlauge neutrali¬
siert (erforderlich 23,4 cm3), die Lösung der Baryum¬salze eingeengt, auf 110 cm3 aufgefüllt und nach
Duclaux destilliert, zunächst unter Zusatz von 0,5 cm3
n/i Schwefelsäure.
— 65 —
Fraktion : Titer: Summe d. Titer : Verhältatszahl
1. 1,65 1,65 7,12. 1,91 3,56 15,43. 2,02 5,58 24,14. 2,07 7,65 33,15. 2,08 9,736. 2,20 11,93
7. 2,34 14,278. 2,56 16,839. 2,80 19,63
10. 3,50 23,13
D. h. nach dem Verlaufe dieser Destillation be¬
stand die durch Oxydation erhaltene Säure zum über¬
wiegenden Teil aus Essigsäure, statt der zu erwarten¬
den Valeriansäure. Diese letztere setzt in der ersten
Fraktion mit der Verhältniszahl 30,5 ein, während die
vorliegende Säure mit 7,1, Essigsäure mit 7,4 beginnt.Das Baryumsalz dieser Säure gab beim Erwärmen mit
Schwefelsäure in der Tat den stechenden Geruch nach
Essigsäure.
Ein zweiter Versuch führte zum genau gleichenRes ultate.
Nun wurde auch noch die auf Seite 60 als Rasp-
berry-Essenz bezeichnete, nach dem Geruch unzweifel¬
haft Amylacetat enthaltende Himbeeressenz genau
nach der Vorschrift Marquardts durch Ausschütteln
des nach der Verseifung erhaltenen Destillates erst
mit Chloroform und dann mit Wasser vorbehandelt und
oxydiert. Die Verhältniszahlen für das erste Destillat
(0,3 cmjn
! H,S04) lauteten:
1. 8,42. 17,4
— 66 —
3. 26,2
4. 35,5
5. 44,7
6. 54,2
7. 64,2
8. 74,8
was annähernd einem Verhältnis von 1 Teil Propion¬
säure und 3 Teilen Essigsäure entspricht.
Es lag nahe, die Unbrauchbarkeit der so er¬
haltenen Resultate auf die Unzweckmässigkeit des
Oxydationsverfahrens zurückzuführen. A. Lasserre,8)
der die Methode Allen-Marquardt9) zur Bestimmung
des Butyl- und Amylalkohols in alkoholischen Flüssig¬
keiten weiter ausgearbeitet hat, nimmt die Oxydation
dieser Alkohole nicht in einer Chloroformlösung vor,
sondern schüttelt die in Schwefelkohlenstoff gelöst
enthaltenen Alkohole mit massig konzentrierter
Schwefelsäure aus und oxydiert diese letztere Lösung.
Kontrollversuch: 1,0 cm3 Amylalkohol
wurde in 30 cm3 Schwefelsäure 1 : 2 gelöst, mit 5 g
Kaliumbiehromat, gelöst in 30 cm' warmem Wasser,
versetzt und % Stunde im Wasserbade auf 50° ge¬
halten. Nach Verdünnung mit 100 cm3 Wasser wurde
abdestilliert und das Destillat mitn
,'i0 Barytlauge
(erforderlich 71,7 ehr3) neutralisiert. Die auf 110 cm3
gebrachte Lösung der Baryumsalze wurde nach Duclaux
fraktioniert destilliert, wobei nach Zusatz von 1,0 cm3
n/i Schwefelsäure folgende Zahlen gefunden wurden:
8) Chem. Zentralblatt 81, II, 1563.
-">) Analyst 1891 u. Ztschr. f. anal. Chem. 1911, 12, 773.
— 67 —
Titer : Summe Verhältnis- % Valerian
d. Titer: zahl: 1 Butters.
1. 12,55 12,55 25,6 26,22. 9,75 22,30 45,5 46,53. 7,55 29,85 61,0 62,24. 6,12 35,97 73,4 74,0
5. 4,55 40,52 82,6 82,56. 3,22 43,74 89,2 88,87. 2,24 45,98 93,88. 1,43 47,41 —
9. 0,89 48,30 —
10. 0,65 48,95 100,0
Man beachte, dass der nach dem Verfahren von
Marquardt in Chloroformlösung oxydierte Amylalkohol
gleicher Herkunft mit der Verhältniszahl 7,1 ein¬
setzte, statt wie hier mit 25,6.
Das Verfahren zur Identifizierung der Ester¬
alkohole in Essenzen und Aethern wurde nun wie
folgt ausgearbeitet:200 cm8 natürlicher oder 10 cm3 künstlicher Es¬
senz werden, wie vorn angegeben, verseift und die
alkalische Lösung abdestilliert. Der Destillationsrück¬
stand wird bei Seite gestellt und zur Ermittelungder Estersäuren verwendet. Das Destillat bringt man
auf 12—15 % Vol. Alkohol und schüttelt dreimal mit
je 50 cm3 reinstem Chloroform je 15 Minuten. Die
Chloroformauszüge werden vereinigt und behufs Ent¬
fernung des Aethylalkohols dreimal mit je 50 cm3
Wasser ausgeschüttelt. Die im Chloroform noch ent¬
haltenen höheren Alkohole entzieht man diesem durch
zweimaliges Ausschütteln mit je 20 cm3 Schwefel¬
säure 1: 2, wobei man als Kontrolle mit einer dritten
Ausschüttelung die Komarowsky-Reaktion anstellt,.die negativ oder nur ganz schwach ausfallen muss.
— 68 —
Zu der Lösung der höheren Alkohole in Schwefel¬
säure gibt man allmählich eine solche von 5 g
K2Cr207 in 30 cm3 warmem Wasser, schüttelt um
und erwärmt 30 Minuten im Wasserbade auf 50°.
Dann wird mit 80 cm3 Wasser verdünnt und abdestil¬
liert. Das Destillat neutralisiert man mit n/10 Baryt¬
lösung, bringt auf 110° und destilliert, fraktioniert
nach Duclaux.
Im folgenden sind die nach dieser Methode mit
einer Anzahl von künstlichen und natürlichen Essenzen,
des Handels erhaltenen analytischen Resultate ange¬
führt, wobei an Stelle der nachgewiesenen Säuren
natürlich die entsprechenden Alkohole zu setzen sind.
1. Natürliche Himbeeressenz S. & Cie., L.
Nr. 1933 a.
Zur Neutralisation des nach der Oxydation er¬
haltenen Destillates wurden verbraucht 12,5 cm3 n/m
Ba(0H)2.1. Fraktion mit 0,3 cm3 "/j H2S04:
8,7 17,7 26,8 35.9 45,3 54,2 64,2 75,0
entsprechend 1 Propionsäure + 3 Essigsäure.
2. Natürliche Himbeerlimonadenessenz
H. V.
12,4 cm» n/io Ba (OH)2
1. Fraktion mit 0,3 cm3:
8,9 18,2 26,8 35,9 45,2 54,5 64,5 75,1
entsprechend 1 Propionsäure + 3 Essigsäure.
3. Natürliche Himbeeressenz W. & Cie., D.
23,1 cm8 n/io Ba (OH)2
1. Fraktion mit 0,3 cm3:
8,6 17,6 26,5 35,5 44,9 54,3 64,5 74,8
entsprechend 1 Propionsäure + 3 Essigsäure.
— 69 —
4. Himbeeraroma H. V.
(Für Confiseriezwecke.)
145,5 cm" n/10 (BaOH)2 (!)1. Fraktion mit 0,2 cm3:
9,0 18,4 27,5 37,0 46,3 55.Ç 65,9 76,0
entsprechend 1 Propionsäure + 2 Essigsäure.
2. Fraktion mit 0,3 cms:
8,0 16,6 25,4 34,3 43,4 52,2 63,3 74,2
1 Propionsäure -+- 5 Essigsäure.
Zugegeben 5,0 cm3 n/i Schwefelsäure und 100 cm3
.abdestilliert, Rückstand auf 110 cm3 aufgefüllt.
4. Fraktion mit 0,3 cm8:
7,2 15,1 23,3 32,0 41,1 50,6 60,9 72,0
entsprechend reiner Essigsäure.
5. Essence Raspberry „Special", A. B.,R. & Cie., Ltd.
Zur Verfügung standen nur noch 20 cm3 dieser
Essenz, 'weshalb von einer eingehenden Unterfraktionie-
jrung abgesehen werden musste. n/10 Ba(OH)2. 7 cm3.
1. Fraktion mit 0,3 cirf:
14,6 27,8 39,9 50,9 61,4 70,6 79,2
entsprechend Buttersäure -f- 2 Propionsäure.
2. Fraktion mit 0,3 cm3:
11,3 21,9 32,3 42,1 51,8 61,1 70,4
entsprechend ca. 2 Propionsäure + 1 Essigsäure.
6. Himbeeräther, konz., farblos, E. L.
(künstlich).
37,7 cm» n/io Ba (OH),.1. Fraktion mit 0,3 cm3:
21,3 39,1 54,1 66,2 75,9 83,3
»entsprechend 1 Valeriansäure + 2 Buttersäure.
— 70 —
2. Fraktion, mit 0,3 cm3:
21,1 38,3 53,4 65,5 75,5 83,3
entsprechend 1 Valeriansäure + 3 Buttersäure.
3. Fraktion mit 0,3 cm3:
18,0 33,7 47,7 59,6 70,2 79,0 86,5 92,7
entsprechend Buttersäure.
4. Fraktion mit 0,5 cm3:
16,8 31,2 44,2 55,8 66,2 75,3 83,3
entsprechend 2 Buttersäure -j- 1 Propionsäure.
5. Fraktion mit 0,5 cm3:
13,6 26,2 37,8 48,6 58,9 68,3 77,2 85,4
entsprechend 1 Buttersäure + 4 Propionsäure.
Essigsäure.
7. Himbeeräther, engl., S. Z. (künstlich)-
9,20 cm8 n/io Ba (0H)2
1. Fraktion mit 0,3 cm3:
21,0 39,4 54,7 67,3 77,2 84,1 90,1 94,4
entsprechend 1 Valeriansäure + 2 Buttersäure.
2. Fraktion mit 0,3 cm3:
18,6 35,3 49,5 61,7 72.2 80,9
entsprechend 1 Valeriansäure + 10 Buttersäure.
3. Fraktion mit 0,3 cm3:
14.2 27,5 39,7 50,9 60,8 69,8 78,1 85,5
entsprechend 2 Buttersäure +- 1 Essigsäure.
8. Himbeeräther, konz., engl., E. L.
(künstlich).
29,1 cm8 *|io Ba (0H)„
1. Fraktion mit 0,3 cm3:
20.3 37,8 52,5 64,8 75,0 85,0
entsprechend 1 Valeriansäure + 3,5 Buttersäure..
— 71 —
2. Fraktion mit 0,5 cm3:
16,1' 29,9 42,6 54,1 64,7 73,8 81,8 88,7
entsprechend 4 Buttersäure + 1 Essigsäure.
3. Fraktion mit 0,5 cm3:
12,9 24,8 36,2 46,8 56,9 66,1 74,8 83,2
4. Fraktion mit 0,5 cm3:
9,5 9,0 28,4 37,8 46,9 56,5 66,1 76,2
entsprechend 1 Buttersäure + 4 Essigsäure.
9. Walderdbeeressenz, natürliche, Wd.
24,40 cm8 n/io Ba (0H)2
1. Fraktion mit 0,3 cm3:
8,5 17,4 26,2 35,0 44,3 54,1 63,9 74,9
entsprechend 1 Propionsäure + 4 Essigsäure.
10. Erdbeeressenz, natürliche, S. L.
4,30 cm3 n/10 Ba (0H)2
1. Fraktion mit 0,2 cm3:
8,3 17,2 26,2 35,3 44,7 54,4 64,2 74,9 86,6
entsprechend 1 Propionsäure + 3 Essigsäure.
2. Fraktion mit 0,2 cm3:
7,0 14,9 23,1 31,4 40,3 50,0 60,7
entsprechend Essigsäure.
11. Erdbeeräther, konz., farblos, E. L.
(künstlich).
31,50 cm8 n/io Ba (0H)2
1. Fraktion mit 0,3 cm3:
19,3 36,0 50,1 62,1 72,7 81,1
entsprechend 1 Valeriansäure + ca. 8 Buttersäure.
2. Fraktion mit 0,3 cm3:
17,9 34,2 48,4 60,7 71,3 79,9
Spur Valeriansäure + Buttersäure.
— 72 —
3. Fraktion mit 0,5 cm3:
17,3 32,2 45,6 57,3 67,9 76,9 84,7 91,2
entsprechend 10 Buttersäure + 1 Essigsäure.
4. Fraktion mit 0,5 cm3:
11,8 22,8 33,6 43,8 53,8 63,7 72,8 81,9
entsprechend 1 Buttersäure + 1,5 Essigsäure.
5. Fraktion mit 0,5 cm3:
9,0 28,0 27,0 36,1 45,4 55,0 65,0 75,5
entsprechend 1 Buttersäure + 5 Essigsäure.
12. Erdbeeräther, konz., S. Z. (künstlich).
25,0 cm3 n/io Ba (0H)2
1. Fraktion mit 0,3 cm3:
20,7 38,2 52,8 65,0 77,8 82,8
entsprechend 1 Valeriansäure + 3 Buttersäure.
2. Fraktion mit 0,3 cm3:
17,7 33,4 47,3 59,6 70,0 78,5
Buttersäure.
3. Fraktion mit 0,3 cm3:
13,6 26,2 37,9 48,8 58,1 66,9 75,4 83,5
entsprechend 1,5 Buttersäure -+- 1 Essigsäure.
4. Fraktion mit 0,3 cm3:
8,6 17,0 25,3 34,0 43,0 52,5 62,8 73,2
entsprechend 1 Buttersäure + 10 Essigsäure.
13. Erdbeeräther, konz., engl., E. L.
(künstlich).
19,90 cm8 n/io Ba (OB),
1. Fraktion mit 0,3 cm3:
21,3 38,8 53,6 65,8 76,0 84,0 90,0 94,2 97,4
entsprechend 1 Valeriansäure -f- 2,5 Buttersäure.
— 73 —
2. Fraktion mit 0,5 cm3:
19.5 36,3 50,6 62,8 72,9 81,4 88,3
entsprechend 1 Valeriansäure + 5 Buttersäure.
3. Fraktion mit 0,5 cm3:
16,2 30,6 43,7 55,2 65,3 74,5 82,1 82,0
entsprechend 5 Buttersäure + 1 Essigsäure.
4. Fraktion mit 0,5 cm3:
11,4 22,3 32,5 42,2 51,8 61,3 70,4 79,9
entsprechend 1 Buttersäure + 2 Essigsäure.
14. Ananasäther, konz., farblos, E. L.
(künstlich).
32,0 cm8 n/io Ba (OH)*
1. Fraktion mit 0,3 cm3:
19.6 36,6 51,0 63,1 73,4 81,6 88,2
entsprechend 1 Valeriansäure + 5 Buttersäure.
2. Fraktion mit 0,3 cm3:
16,4 31,3 43,9 55,6 65,8 75,0 82,5
entsprechend 5 Buttersäure + 1 Essigsäure.
3. Fraktion mit 0,3 cm3:
11,0 21,5 32,0 41,9 51,4 60,8 69,9 79,3
entsprechend 1 Buttersäure + 2 Essigsäure.
4. Fraktion mit 0,3 cm3:
8,0 15,9 23,8 32,6 41,1 50,8 60,6 71,8 84,6
Essigsäure.
Nach den im Vorstehenden mitgeteilten analyti¬
schen Daten enthalten die hier untersuchten natür¬
lichen Himbeer- und Erdbeeressenzen an höheren Al¬
koholen nur Propylalkohol. Was an Estern sonst
noch vorhanden ist, sind solche des Aethylalkohols.
In den künstlichen Aethern sind ausnahmslos Ester
des Amylalkohols nachweisbar. Zahlenmässig unter-
— 74 —
scheiden sich künstliche von den natürlichen Essenzen,
abgesehen davon, dass die ersteren, wie sich aus dem
höheren Estergehalt übrigens ohne weiteres ergibt,
bedeutend mehr Alkohol enthalten, auch dadurch, dass
sie bei der fraktionierten Destillation in der ersten
Fraktion mit bedeutend höheren Werten einsetzen,
entsprechend den hohen Verhältniszahlen der Valerian-
säure.
Interessant liegen die Verhältnisse bei der unter
Nr. 5 angeführten Essence Raspberry. Liessen schon
die Zahlen für den Estergehalt und die Estersäuren
auf einen Verschnitt mit künstlichen Aethern
schliessen, so wird diese Vermutung durch die Er¬
mittelung der Verhältniszahlen der aus den Alkoholen
durch Oxydation gewonnenen Säuren vollends be¬
stätigt. Die erste Fraktion setzt mit 14,6 ein gegen¬
über 8,6—9 bei natürlichen Essenzen.
Gelingt es mit der beschriebenen Methode, die
Art der in künstlichen und natürlichen Fruchtessenzen
enthaltenen Esteralkohole zu bestimmen, so wird man
für die Untersuchungspraxis doch gerne auf ein
weniger umständliches Verfahren greifen, namentlich,
wenn es sich um den ja gewöhnlich vorkommenden
Fall handelt, zu entscheiden, ob eine natürliche oder
künstliche Essenz oder eventuell ein Verschnitt vor¬
liegt.
Für diesen praktischen Zweck schien die Heran¬
ziehung der Reaktion Komarowsky gegeben. Es ist
bereits auf Seite 63 darauf hingewiesen worden, dass
sich Kreis dieser Reaktion zu gleichem Zwecke be¬
dient hat. Er stellte auf diesem Wege fest, dass eine
— 75 —
natürliche Himbeeressenz 0,45 0/0o, eine künstliche
0,36 °/00 Amylalkohol enthielt. In der Tat zeigte sich
bei einer hier untersuchten, natürlichen, hochkonzen¬
trierten Himbeeressenz eine auffallend starke, blau-
stichige, ganz an Amylalkohol erinnernde Färbung,
als 5 cm' der destillierten Essenz mit 2,5 cms l°/oigem
Salicylaldehyd und 2,5 cm3 -Wasser vermischt und
20 cm1 (konzentrierte Schwefelsäure erstünterschichtet,
dann geschüttelt wurden. Bei anderen natürlichen
Himbeer- und Erdbeeressenzen dagegen resultierten
bei gleicher Behandlung rötliche, etwas ins Bräun¬
liche spielende Färbungen, die den mit Isopropyl-
alkohol erhaltenen vollkommen glichen. Da in der
abnorm reagierenden Essenz nach dem Oxydations¬
verfahren kein Amyl-, sondern nur Propylalkohol nach¬
gewiesen werden konnte, lag es nahe, das abweichende
Verhalten entweder auf den hohen Konzentrations¬
grad der Essenz oder dann auf die Gegenwart von
ätherischen Oelen zurückzuführen, welch letztere ja
nach Kreis10) mit Salicylaldehyd-Schwefelsäure Fär¬
bungen ergeben, die ganz an die mit Amylalkohol
erhaltenen erinnern. Es erwies sich auf alle Fälle
zweckmässig, analog dem von v. Fellenberg11) vor¬
geschlagenen Verfahren, die störenden Nebenbestand¬
teile durch vorausgehende Behandlung mit Natron¬
lauge und Silbernitrat zu beseitigen. Nachstehend das
Verfahren, das sich zum Nachweis der höheren Alko¬
hole nach Komarowsky bei natürlichen Himbeer- und
Erdbeeressenzen als geeignet erwiesen hat:
Von 50 cm3 Essenz werden 40 cm3 abdestilliert.
Das Destillat wird mit Wasser auf 100 cm3 aufgefüllt,
10) Chem.-Ztg. 1910, Nr. 53.
u) Mitteilungen des Schweiz. Gesundheitsamtes 1910, Bd. I,Heft 6.
— 76 —
mit 1 cms Schwefelsäure 1: 1 fünf Minuten stehen
gelassen, mit 1 Tropfen Phenolphtalein versetzt und
mit 30 % iger Natronlauge neutralisiert. Von dieser
Natronlauge werden weitere 8 cm3 zugegeben, 10 cm3
n/5 Silbernitrat zugefügt und Va Stunde am Rückfluss¬
kühler gekocht. Man destilliert so vollständig als
möglich ab und füllt auf 100 cm3 auf. 5 cm3 des
Destillates werden in einem ca. 100 cm3 fassenden
Kölbchen mit 2,5 cm3 Salicylaldehyd, und 2,5 cm3
Wasser versetzt und mit 20 cm3 konzentrierter
Schwefelsäure erst unterschichtet, dann sorgfältig um¬
geschwenkt.
Natürliche Essenzen geben hiebei erst rein gelb¬
liche, nach einiger Zeit bräunlichrote Färbungen, die
man nach Ablauf von 30—45 Minuten und nach Ver¬
dünnen mit 50 cm3 Schwefelsäure 1: 1 kolorimetrisch
mit gleichzeitig angesetzten Typen von Isopropyl-alkohol vergleichen kann.
Liegen künstliche Fruchtäther vor, was aus der
Sinnenprüfung und dem Gehalte an Estern und Ester¬
säuren unschwer zu schliessen ist, so verwendet man
höchstens 5 cm3 der destillierten Essenz und füllt sie
mit 30 % igem Alkohol auf 100 cm3 auf. Im übrigenverfährt man in gleicher Weise, nur dass man an
Stelle von Isopropyl Typen von Amylalkohol zum Ver¬
gleiche verwendet.
Nach diesem Verfahren gab auch die vorhin als
abnorm reagierend bezeichnete Himbeeressenz Fär¬
bungen, die in der Nuance dem Isopropylalkohol
glichen.
Es dürfte damit erwiesen sein, dass die bei der
SalicylaldehydnSchwefelsäure-Reaktion mit natürlichen
Essenzen erhaltenen Färbungen nicht von Amylalkohol
— 77 —
herrühren, sondern nur dem Isopropylalkohol zuzu¬
schreiben sind.
Zweckmässig ist eine vergleichende Untersuchung
mit notorisch echten Essenzen der gleichen Art.
Ein spezieller Abschnitt ist hier den
Zitronen- und Pomeranzenessenzen
zu widmen. Es dürfte aus der Seite 26 ff. gegebenen Zu¬
sammenstellung hervorgehen, dass die bei Bestimmung
des spez. Gewichtes, des Estergehaltes und der flüch¬
tigen Estersäuren erhaltenen Zahlen bei Südfrüchten¬
essenzen keinerlei Schlüsse auf deren Echtheit zu¬
lassen, sofern nicht gerade ein Zusatz von künstlichen
Estern stattgefunden hat. Ueberhaupt ist der Begriff
Echtheit bei diesen Essenzen schwer festzustellen und
zwar nicht bloss in analytischer Hinsicht. Es ist schon
früher erwähnt worden, dass H. v. Wuntsch Zitronen-
und Pomeranzenessenzen, die durch Extraktion der
betreffenden Fruchtschalen mit Alkohol gewonnen
werden, als Kunstprodukte bezeichnet. Nun kommt
es aber praktisch genommen offenbar auf dasselbe her¬
aus, ob man das in den Schalen enthaltene Oel mit
Sprit auszieht oder ob man die Schalen, wie es in
Italien geschieht, mit der Hand ausgepresst und das
so gewonnene Oel dann mit Sprit verdünnt, namentlich
wenn die Essenzen, wie es zur Limonadenfabrikation
wohl allgemein üblich ist, zur Vermeidung von Trü¬
bungen noch destilliert werden. In einer solchen destil¬
lierten Essenz, ob sie so oder anders gewonnen wurde,
ist also nichts mehr anderes enthalten als das in
Alkohol gelöste ätherische Oel. Ausser Zweifel liegt,
dass der Kenner an einem durch Pressung erhaltenen
Zitronenöl gegenüber einem durch Destillation ge¬
wonnenen Oele Qualitätsunterschiede feststellen kann.
— 78 —
Man behauptet, in gepressten Oelen sei der Aldehyd¬
gehalt höher. Ferner sollen diese Oele nichtflüchtige
Pflanzenteile enthalten, die in Destillationsprodukten
natürgemäss fehlen. In Essenzen aber würde eine
solche Differenzierung wenigstens analytisch voll¬
kommen versagen.
Wender und Gregor,12) von deren Arbeit über
Zitronen- und Pomeranzenessenz hier noch mehrfach
zu sprechen sein wird, führen an, dass diese Essenzen
zum Zwecke der Hebung des Aromas oder um minder¬
wertigen Produkten den Schein einer besseren Be¬
schaffenheit zu verleihen, oft Zusätze von Verstär-
kungsmitteln, wie Zitronen- und Pomeranzenöl, Zitral
sowie Vanillin erfahren.
Was den Zusatz von Zitronen- und Pomeranzenöl
anbelangt, so wird man im Ernste von einer Ver¬
fälschung infolge dieses Zusatzes nicht reden
können. Wird einer Essenz nachträglich noch Oel zu¬
gesetzt, so hat das im Grunde genommen doch genau
die gleiche Wirkung, wie wenn zur Herstellung dieser
Essenz mehr Schalen verwendet worden wären. Um
eine Täuschung kann es sich also hier nicht handeln.
Anders liegt der Fall beim Zusatz von Zitral. Dieser
Aldehyd ist zwar ein natürlicher Bestandteil des
Zitronenöls und ist in diesem zu ca. 7 % enthalten.
Darüber, ob ein Zusatz von Zitral zu Zitronen¬
essenz zulässig sei oder nicht, kann eine Diskussion
nicht entstehen. Nur wird man ohne weiteres zugeben
müssen, dass eine Zitronenessenz mit einem beliebig
bemessenen Zitralzusatz nicht mehr Anspruch auf die
Bezeichnung „natürliche Essenz" erheben kann, um-
somehr, als die gewerbsmässige Darstellung des Zitral^
12) Ztschr. f. U. d. N. u. G. 1900, 3, 449.
— 79 —
vorteilhaft nicht aus Zitronen-, sondern aus Limon-
grasöl geschieht. Dieses aus dem Zitronengras (An-
dropogon citratus) durch Destillation gewonnene, nach
Zitronen riechende und schmeckende Oel enthält näm¬
lich (neben wenig Geramiol, Dipenten und Limonen)
70—85 % Zitral. Will man, wie es durchaus gerecht¬
fertigt ist,- einen Unterschied ziehen zwischen Limo¬
nadessenzen, die mit und die ohne Zitralzusatz her¬
gestellt sind, so erhebt sich sofort die Frage nach
der Möglichkeit des Nachweises eines solchen Zusatzes.
Zur Bestimmung des Zitrals wird wohl allgemein die
Bisulfitmethode verwendet, deren Resultate sich aller¬
dings nicht durch grosse Zuverlässigkeit auszeichnen.
Uebrigens ist dieser Umstand im vorliegenden Falle
bedeutungslos. Denn die neulich in den Handel ge¬
brachten terpen- und sesqui terpenfreien Zitronenöle
weisen nach Angabe der betreffenden Fabrikanten
einen Zitralgehalt von 65—75 °/o auf. Es dürfte unter
solchen Verhältnissen schwerlich eine Methode ge¬
funden werden können, die es ermöglicht, einen Zu¬
satz von Zitral aus Lemongrasöl in Essenzen nachzu¬
weisen und dadurch wirklich terpen- und sesquiterpen-
freie, echte Zitronenöle von sogen, konzentrierten,
künstlich mit reichlichen Zitralzusätzen versehenen
Oelen zu unterscheiden. So bedauerlich diese Tatsache
für den reellen Fabrikanten ist, so wenig kommt sie
für den Nahrungsmittelchemiker in Betracht, wenn
es sich lediglich um die Beantwortung der Frage
handelt, ob eine künstliche und deshalb unzulässige
oder eine mit diesen oder jenen zulässigen Zusätzen
(worunter auch das Zitral zu rechnen ist) versehene
Essenz vorliegt.
Sind einer Südfrüchtenessenz künstliche Frucht¬
äther zugesetzt worden, so ergibt sich ein solcher Zu-
— 80 —
satz sowohl aus dem erhöhten Estergehalt als aus
dem höheren Gehalt an Estersäuren. Dafür liefern
die unter Nr. 34 und Nr. 43 der Tabelle auf Seite
29 angeführten Zitronen- und Orangenäther ein spre¬
chendes Beispiel.
Schwieriger liegt der Fall, wenn es sich um die
Bestimmung der Qualität von mehr oder weniger
natürlichen Essenzen handelt. Wender und Gregor,
deren Arbeit vorhin zitiert worden ist, schlagen zur
Gewinnung von Beurteilungsmomenten allgemein die
Ermittelung des Gehaltes an wertvollen Bestandteilen,
sowie die Löslichkeit der Essenzen in Wasser und
speziell die Vornahme folgender Bestimmungen vor:
a) des Alkoholgehaltes;
b) des Gehaltes an ätherischen Oelen und Charakteri¬
sierung der letztern;
c) der relativen Ergiebigkeit, d. h. der Aromati-
sationsfähigkeit, welche den Zweck hat, die Preis¬
würdigkeit festzustellen;
d) den Nachweis etwa vorhandener fremder Riech-
und Farbstoffe.
ad a) Die Bestimmung des Alkoholgehaltes mag
für zoll- und Steuertechnische Zwecke recht angebracht
sein, für welch letztere auf die Publikation Wender
und Gregors verwiesen sei. Ein BeuTteilungsmoment
für die Qualität der Essenz vermag sie schon des¬
wegen nicht zu bieten, weil jeglicher Anhaltspunkt
fehlt, von welchem Alkoholgehalt ab eine Essenz als
richtig oder nicht richtig hergestellt zu betrachten
ist. Es würde angesichts der ausserordentlich ver¬
schiedenen Bereitungsart dieser Essenzen in der Tat
sehr schwer halten, hier eine Norm aufzustellen, was
— 81 —
seitens Wender und Gregor übrigens auch gar nicht
geschehen ist.
ad b) Von ausschlaggebender Bedeutung scheint
die Ermittelung des Gehaltes an ätherischen Oelen
zu sein. Liegt doch die Annahme nahe, dass die
ätherischen Oele die Träger des Geruches seien und
dass deshalb eine Essenz bezüglich Qualität um so
höher eingeschätzt werden müsse, je grösser ihr Ge¬
halt an ätherischen Oelen ist. Wender und Gregor
haben zur Bestimmung dieser letztern ein recht sinn¬
reiches und praktisches Verfahren in Vorschlag ge¬
bracht und zur Ausführung desselben einen besonderen
Apparat konstruiert, dessen Beschreibung der Original¬
arbeit zu entnehmen ist. Ira Prinzip lehnt sich die
Methode an das Eöse'sche Verfahren der Fuselöl¬
bestimmung in Sprit und Branntweinen an, bei dem
aus der Volumvergrösserung des Lösungsmittels auf
die Menge der höheren Alkohole oder hier aus der
Volumverminderung der Essenz ein Schluss auf die
Menge des vorhandenen Oeles gezogen wird. Als Lö¬
sungsmittel wird Petroläther vom spez. Gewicht 0,670
verwendet. Ist der Prozentgehalt an Oel abgelesen,
so kann die Petrolätherlösuag der ätherischen Oele
noch zur Bestimmung des polarimetrischen Verhaltens
benutzt werden. Wender und Gregor fanden in:
Citronen-
Essenzen
No. 1
«2
»3
»4
»5
Oelgehali,
0,1 %
0,6 %
0,4 %
0,6 %
0,5 %
Spez. Drehung der
Petrolätherlösung
+ 0,25°
0,00°
+ 0,30°
— 0,05°
+ 0,35°
— 82 —
Pomeranzen- Spez. Drehung der
Essenzen Oelgehalt Petrolatherlosung
No. 1 0,4 % + 0,30°
n2 0,7 % -f- 0,80°
„3 0,6 % + 0,60°
»4 0,7 % + 0,20°
,5 0,8 % + 0,15°
Die Schlussfolgerungen, die die Autoren daran
knüpfen, lauten:
„Aus diesen Versuchen ist zu entnehmen, dass
die Zitronen-Essenzen Nr. 2 und Nr. 4 mit terpen-
freiem Oel dargestellt wurden, was auch mit der hohen
Löslichkeit dieser Essenzen in Wasser im Einklänge
steht, desgleichen die Pomeranzenessenzen Nr. 4
und 5.
Nach bewährten Vorschriften aus frischen Frucht¬
schalen selbst dargestellte Essenzen besassen einen
durchschnittlichen Oelgehalt von 0,80 °/o. Die Polari¬
sation entsprach dem Oelgehalt. Die Löslichkeit im
Wasser war jedoch nur gering."
Auf der folgenden Tabelle sind eigene Beobach¬
tungen, die nach der Methode Wender und Gregor
erhalten wurden, zusammengestellt. Die Zitronen¬
essenzen 1—5 und die Pomeranzenessenzen 15—19
inklusive sind durch freundliches Entgegenkommen der
Firma E. Sachsse & Co. in Leipzig zum Teil eigensfür diesen Zweck hergestellt und zur Verfügung ge¬
stellt worden. Nachstehend findet sich die Bereitungs*art dieser Essenzen:
Citronen-Essenz A,
hergestellt aus frischer Zitronenhaut durch Ansetzen
mit der gleichen Menge 96 % igen Sprit, Abfiltrieren
und Abpressen nach mehrtägigem Stehen.
Ausbeute aus 100 kg Gesamt-Ansatz: 76 kg.
— 83 —
Citronen-Essenz B
ist durch Rektifikation aus Zitronenessenz A gewonnen
und zwar aus 50 kg A — 42 kg B erhalten. Beide
Essenzen sind also reine Zitronenessenzen aus frischen
Schalen.
Zitronen-Essenz C
besteht aus
2 gr Zitronenöl, terpen- und sesquiterpenfrei,
5 gr gelber Farblösung (1 % Teerfarbstoff ent¬
haltend), und
993 gr 50"/oigem Sprit.
Zitronen-Essenz D
besteht aus
5 gr Zitronenöl, terpen- und sesquiterpenfrei,
995 gr Zitronenessenz B.
Zitronen-Essenz E
ist eine Mischung von
50 gr Zitral,23 gr Zitronenöl,
22,5 gr Pomeranzenöl,
20 gr Limetteöl, westind., destilliert,
886,5 gr Sprit, 96 °/o ig.
Pomeranzen-Essenz A,
hergestellt aus
25 kg frischen Pomeranzenschalen,
50 kg 96 % igem Sprit. Ausbeute 64 kg.
Pomeranzen-Essenz B.
66 kg trockene Pomeranzenschalen,
134 kg 90 % igem Sprit. Ausbeute — 110 kg.
Pomeranzen-Essenz C.
24 kg frische Curacaoschalen,
34 kg Sprit, 96Va%. Ausbeute — 39 kg.
—'84 —
Pomeranzen-Essenz D.
100 kg frische Pomeranzenschalen.
100 kg Sprit, 60 o/o ig. Ausbeute 160 kg.
Von diesem Auszug
999 gr.
1 gr Pomeranzenöl, bitter, terpen- und sesqui-
terpenfrei.
Pomeranzen-Essenz E.
0,5 gr Pomeranzenöl, terpen- und sesquiterpenfrei,
4 gr Farbstofflösung (1 o/o),
995,5 gr Spiritus, 45 °/o ig.
Die übrigen Essenzen sind Handelsprodukte von
unbekannter Bereitungsweise. Nr. 14, Zitronenäther
E. L., und Nr. 23, Orangenäther, beide konz., farblos,
zeigten deutlich den Geruch nach Estern höherer Al¬
kohole. Sie sind auch durch die auf Seite 29
mitgeteilten Ester- und Estersäurezahlen als Kunst¬
produkte charakterisiert.
— 85 —
Verhalten beim Ver¬ %4a
a D- | [«] D
der Petrol-Art der Essenzmischen von 50 cm3
Essenz m. 40 cm3 an¬
gesäuertem Wasser0) ^ C> ätherlosung
1. Citronenessenz S. A. starke Trübung
/o
0,80 1,20° 0,37°
2.„
S. B.n J) 0,82 1,00° 0,30°
3.„
S. C. sehr geringe Trübg. 0,22 0,20° 6,23°4.
„S. D. starke Trübung 1,60 1,25° 0,20°
5.„
S. E. starke Trübung u.
sofort. Ausscheid.
von viel Oel 12,00 12,32° 0,24°6.
,H.V. starke Trübung 2,10 2,76° i 0,33°
7.„
S. L.n » 0,30 1,01° 0,85°
8.„ Zfg keine Trübung 0,10 0,04° 0,09°
9.„ Wtgl sehr starke Trübg. 1,50 3,60° 0,63°
10.„ „2 geringe „ 0,40 0,16° 0,11°
11.„
Wd starke Trübung und
reichl. Oelabscheid. 11,00 14,50° 0,44»12. Citronenaroma H. V. starke Trübung 2,90 2,39° 0,22°13. Citronenäther Sg.
konz. schwache Trübung 0,20 0,10° 0,13°14. Citronenäther E. L.
konz. farblos reichl. Oelabscheid. 40,0 3,75° 0,04°
15. Pomeranzeness. S.A. starke Trübung 0,80 2,37° 0,61°16.
„B
» » 1,70 2,51° 0,37°17.
„C
» « 1,00 3,50° 0,87°18.
„D kaum merkl. Trbg. 0 0 —
19.„
En w n
0 o —
20.„
Wd starke Trübg. und
reichl. Oelabscheid. 23,0 41,52° 0,60°21. '
„S. L. starke Trübung 1,95 3,32° 0,40°
22. Mandarineness. S. L. starke Trübg und
reichl. Oelabscheid. 1 5,80 11,51° 0,55°23. Orangenäther konz starke Trübg und*|
farblos E. L. reichl. Oelabscheid. 32,0 a -
— 86 —
Soweit aus den vorliegenden Versuchen ge¬
schlossen werden kann, bestätigt sich die von Wender
und Gregor gemachte Beobachtung, dass aus frischen
Fruchtschalen durch Ausziehen mit Sprit erhaltene
Essenzen einen durchschnittlichen Oelgehalt von 0,8%
aufweisen und dass die Polarisation bei „natürlichen"
Essenzen mit dem Oelgehalt mehr oder weniger parallel
geht. Deswegen verwischen sich die Unterschiede im
polarimetrischen Verhalten, sobald man nicht die ab¬
solute, sondern die spezifische Drehung anführt. Die
terpen- oder terpen- und sesquiterpenfreien Essenzen
zeigen einen auffallend geringen Gehalt an ätherischein
Oelen, trotzdem sie geruchlich den nach gewöhnlichen
Verfahren hergestellten Essenzen mindestens eben¬
bürtig, wenn nicht überlegen sind. Es dürfte diese
Tatsache einen Beweis dafür abgeben, dass man bei
der Beurteilung von Essenzen nicht einseitig auf den
Gesamt-Gehalt an ätherischen Oelen abstellen darf.
Die Essenzen Nr. 5, 11, 20 und 22 sind, wie
sich bei Nr. 5 aus der mitgeteilten Zusammensetzung,
bei Nr. 11, 20 und 22 aus dem abnorm hohen Oel¬
gehalt und der sta,rken Drehung ergibt, durch Zu¬
satz von Oelen verstärkt worden.
Die Kunstprodukte Nr. 14 und Nr. 23 zeigenauch bei dieser Prüfungsart starke Abweichungen,charakterisiert durch die auffallende Volumverminde¬
rung nach dem Schütteln mit Petroläther und das
geringe Drehungsvermögen der Petrolätherlösung.ade. Bezüglich der Bestimmung der Löslichkeit
in Wasser und der Ergiebigkeit sei auf die Arbeit von
Wender verwiesen.
Was schliesslich add den Nachweis fremder Riech¬
stoffe und Farbstoffe anbetrifft, so können für die
Ermittelung von künstlichen Estern, wie mehrfach er-
— 87 —
wähnt, die in dieser Arbeit vorgeschlagenen Methoden,
zur Anwendung kommen. Zum Nachweis von Vanillin
empfehlen Wender und Gregor folgendes Verfahren:
„Es werden 25 bis 100 gr der Essenz erst durch
Abdampfen von Alkohol und durch Fällen mit Blei-
acetat von den Extraktivstoffen befreit und mit Aether
ausgeschüttelt. Der ätherische Auszug, welcher Vanil¬
lin nebst andern in Aether löslichen Stoffen enthält,
wird mit verdünntem Ammoniak ausgeschüttelt, wo¬
durch Vanillin als Aldehydammoniak in die wässerige
Ammoniaklösung geht. Letztere wird mit Salzsäure
angesäuert, mit Aether ausgeschüttelt und der äthe¬
rische Auszug nach dem Verdunsten des Aethers mit
Ligroin aufgenommen.
Es ergibt sich nach dem Filtrieren und Ver¬
dunsten ein aus Vanillin bestehender Rückstand, den
man mit Phloroglucin und Salzsäure identifizieren
kann. Zu diesem Zwecke wird der Rückstand in einer
Porzellanschale mit einigen Tropfen alkoholischer
Phloroglucinlösung (2 : 30) gelöst, dazu ein bis zwei
Tropfen Salzsäure (1 °/o) hinzugegeben und dann das
Gemisch vorsichtig über der Flamme erwärmt. Es
entstehen zunächst am Rande, später in der Mitte
carmoisinrote Streifen. Die Anwesenheit von Zitronen¬
oder Pomeranzenöl stört die Reaktion nicht."
Der Nachweis fremder Farbstoffe geschieht nach
den gebräuchlichen Verfahren.
Anhang.
Destillations-Tabellen nach Duclaux.
1. Für Misch ungen von V aleriansäure mit
Essig säure.
cm3 20 30 40 50 60 70
Valeriansäure 53,0 69,5 81,0 88,5 93,5 96,520 Val. 1 Essigsäure 51,2 67,3 78,6 86,2 91,4 94,810
, *j) 49,5 65,3 76,5 84,2 89,6 93,3
8,
*JT 48,8 64,4 74,4 83,2 88,7 92,5
6,
*J) 47,6 62,9 74,0 81,7 87,3 91,4
5,
1» 46,7 61,8 72,8 80,6 86,1 90,6
4, *
)? 45,4 60,2 71,2 79,0 84,9 89,43
,^
ÎÏ 43,5 58,0 68,8 76,6 82,8 87,62
,*
55 40,4 54,1 64,7 70,1 79,2 84,6*-
Î) 34,1 46,4 56,5 64,7 77,0 78,7
2 27,8 38,8 48,3 56,8 64,8 72,8
3 24,6 34,4 44,4 52,8 61,2 69,84 22,8 32,6 41,8 50,4 59,1 67,85 21,5 31,1 40,1 48,8 57,7 66,86 20,6 30,0 39,0 47,7 56,6 66,08 19,4 28,5 37,4 46,2 55,3 64,8
10 18,6 27,6 36,4 45,2 54,4 64,1
20 17,0 25,1 34,3 43,1 52,5 63,1Ei Sigsäure 15,2 23,4 32,0 40,9 50,5 60,9
- 89 -
2. Für Mischungen von Buttersäure
Essigsäure.
mit
Buttersäure
10 Butters.
5„
4„
3„
2„
1 Eisigs.
2
3
5
10
30 40 50 60 70 80
47,5 60,0 70 6 79,5 86,5 92,5
45,3 57,5 67,9 76,9 84,2 90,6
43,5 55,3 65,6 74,7 82,2 89,1
42,6 54,4 64,6 73,7 81,3 88,4
41,5 53,0 63,2 72,2 80,1 87,3
39,5 50,8 60,7 69,8 78,0 85,6
35,2 46,0 55,7 65,0 73,7 82,2
31,4 41,3 50,8 60,2 69,4 78,8
29,4 39,0 48,8 57,7 67,3 77,0
27,4 36,7 45,8 55,3 65,2 75,3
25,6 34,5 43,6 53,1 63,2 73,8
Für Mischungen von Propionsäure mit
Essigsäure.cm 30 40 50 60 70 80
Propionsäure 35,3 46,2 56,8 66,7 76,2 85,05 Propions. 1 Essigs. 33,3 43,8 54,2 64,0 73,6 82,84 1
» 32,9 43,3 53,6 63,4 73,0 82,23 1
» 32,3 42,6 52,8 62,6 72,4 81,72 1
m 31,2 41,1 51,3 61,3 71,1 80,6* JJ
1jj 29,3 39,1 48,9 58,6 68,5 78,5
*))
2» 27,4 36,6 46,2 55,9 66,0 76,3
*ÏÎ
3jj 26,4 35,5 44,9 54,5 64,7 75,2
*J)
4)) 25,8 34,8 44,1 53,7 64,0 74,5
*Ï»
5>j 25,4 34,4 43,6 53,2 63,2 74,0
4. Für Mischungen von Valeriansäure mit
Buttersäure.
cm3 10 20 30 40 50 60
10 Valerians. 1 Butters. 29,3 51,2 67,5 79,1 86,9 92,25
„ 28,3 49,8 65,8 77,5 85,5 91,24
„ 27,9 49,1 65,1 76,8 84,9 90,73
„ 27,3 48,1 64,0 75,8 84,0 90,02
„ 26,2 46,5 62,2 74,0 82,5 88,8*-
m 24,1 43,3 58,5 70,5 79,5 86,5
*»
2
'
21,9 40,1 54,8 67,0 76,6 84,2
*>>
3, 20,8 38,4 52,8 65,2 75,1 83,0
*h
4, 20,2 37,5 51,9 64,2 74,2 82,2
ATÎ
5, 19,8 37,0 51,2 63,5 73,6 81,8
^»
10, 18,8 35,4 49,5 61,8 72,2 80,8
— 90 —
Für Mischungen von Valeriansäure mit
Propionsäure.cm3 20 30 40 50 60 70
10 Valerians. Propions. 50,4' 66,4 77,8 85,5 91,0 96,55
„ 48,2 63,8 75,2 83,2 89,0 93,24
„ 47,2 62,6 74,0 82,2 88,1 92,43
„ 45,7 60,9 72,3 80,6 86,8 91,42
„ 43,3 58,1 69,4 77,9 84,6 89,7
38,5 52,4 63,6 72,6 80,1 86,31
„2 33,7 46,7 57,8 66,7 75,6 83,0
1 4 29,8 42,1 53,2 63,2 72,1 80,21 10 26,6 38,4 48,4 59,7 69,1 78,0
6. Für Mischungen von Buttersäure
Propionsäure.
mit
cm3 20 30 40 50 60 70
1 Propions. 32,5 46,1 58,5 69,1 78,1 85,31
„ 31,7 45,0 57,2 67,8 77,0 84,41
„ 31,2 44,4 56,5 67,1 76,3 83,91
„ 30,4 43,4 55,4 66,0 75,1 83,31
» 28,8 41,4 53,1 63,7 73,1 81,33 26,5 38,3 49,6 60,2 69,9 78,84
„ 25,9 37,6 49,0 59,5 69,2 78,28
„ 25,0 36,7 47,7 58,3 68,1 77,3
Lebenslauf.
Geboren am 18. Dezember 1885, besuchte ich
die Gemeinde- und Bezirksschulen Aarau und hierauf
die technische Abteilung der aargauischen Kantons¬
schule. Nach bestandener Maturitätsprüfung trat ich
in die chemisch-technische Abteilung des Eidgenös¬
sischen Polytechnikums ein und erwarb im März 1909
das Diplom als technischer Chemiker. Als kantonaler
Lebensmittelinspektor und Assistent nach Aarau ge¬
wählt, rückte ich dort nach einem Jahr zum I. Assi¬
stenten und Stellvertreter des Kantonschemikers vor
und befinde mich auch heute noch in dieser Stellung.
Alphons Landolt.