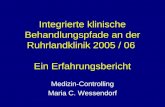Sitzung 7, Vortrag 4: Reduktion des Dokumentationsaufwandes durch klinische Behandlungspfade
Transcript of Sitzung 7, Vortrag 4: Reduktion des Dokumentationsaufwandes durch klinische Behandlungspfade

izin
2dtSsuatA
d
SlS
U
E
EdcZeebgdMnHSmtisPd
d
Sa
O
Akutschmerztherapie im Zentrum Perioperativer Med
dargestellt, das seit 2009 im DIAKO Bremen eingeführtwird.
doi:10.1016/j.periop.2010.10.024
Sitzung 6, Vortrag 4: Neue Aus- und Weiterbildungs-konzepte in der Schmerztherapie
M. Thomm
Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedi-zin –Schmerzzentrum-Uniklinik Köln
E-mail: [email protected]
Hintergrund: Die Verbesserung der Versorgungsquali-tät chronischer Schmerzpatienten verlangt es, Schmerzim Versorgungsalltag mehr Aufmerksamkeit zu schenkenund für eine hinreichende Qualifikation und Koopera-tion der Gesundheitsprofessionen Sorge zu tragen. In derhäuslichen Versorgung schwerkranker Menschen nimmtdie Pflege ihre zukommende Rolle als ,,caring profession“und Mittlerinstanz wahr; in der Regelversorgung schei-tert sie vielfach an ihrer Position im Kooperationsgefügeder Gesundheitsprofessionen. Es ist angezeigt, dass auchdie Pflege mit ihrer spezifischen Kompetenz von derMedizin als Kooperationspartner anerkannt wird. Vorrau-setzung für eine solche Positionierung sind der Ausbaupflegerischer Fachexpertisen auf der Ebene psychoso-zialer, edukativer, aber auch auf der Ebene klinischerFachkompetenz.Methodik: Zur Erweiterung der Qualifikation undFachkompetenz im Schmerzmanagement werden inDeutschland spezifische Fort- und Weiterbildungskurseangeboten. Mit Gründung des Arbeitskreises Kran-kenpflege und med. Assistenzberufe der DGSS 1991und Erstellung eines Basiscurriculums für die Kranken-pflegeausbildung (1996-1998, 2. Auflage 2004-2006,3. Auflage 2010) unter Berücksichtigung nationa-ler und internationaler Literatur hat der Arbeitskreisdazu beigetragen, dass das Thema Schmerz Eingangin den Wissensbestand der Pflege und Pflegefor-schung gefunden hat. Im Jahre 2001 hat der Akzum 1. Mal auf Grundlage des Curriculums Wei-terbildungskurse zur ,,zertifizierten AlgesiologischenFachassistenz“ der Deutschen Gesellschaft zum Stu-dium des Schmerzes (DGSS) angeboten, die von großerResonanz geprägt waren und weiterhin mit großemInteresse wahrgenommen werden. Der Lehrplan dieserKurse umfasst 41,5 Unterrichtseinheiten (UE), aufge-teilt in Grund- und Aufbaukurs (3 und 2 Präsenztage)mit abschließender Lernerfolgskontrolle. Insgesamt sind
bis heute ca. 1.500 Pflegende von der DGSS zur,,Algesiologischen Fachassistenz“ zertifiziert worden.Mit Erstellung des evidenzbasierten nationalen Experten-standards ,,Schmerzmanagement in der Pflege“ im Jahre E/ Periop. Med. 2 (2010) 212–239 231
004 ist ein weiterer Schritt für die Professionalisierunger Pflege im schmerztherapeutischen Bereich vorberei-et worden.chlussfolgerung: Das bestehende Ausbildungsangebotchafft nicht nur Klarheit über die spezifischen Aufgabennd Verantwortung der Pflege im Schmerzmanagementkuter, postoperativer, chronischer tumor- und nicht-umorbedingter Schmerzsyndrome, sondern bietet auchrgumentationshilfen im Dialog mit der Medizin.
oi:10.1016/j.periop.2010.10.025
itzung 7, Vortrag 1: Verbesserung der Prozessqua-ität am Patientenbett unter Berücksichtigung derchmerztherapie
. Ronellenfitsch
Chirurgische Klinik, Universitätsmedizin Mannheim
-mail: [email protected]
ine adäquate Schmerztherapie ist integraler Bestandteiler perioperativen Prozessqualität, da sie direkt das Out-ome der operierten Patienten im Sinne von Morbidität,ufriedenheit und Liegedauer beeinflusst. Die Umsetzunginer Schmerztherapie, die den Patienten zielgerichtetrreicht, ist im klinischen Alltag jedoch alles andere alsanal. Fehlende standardisierte Vorgaben spielen hierbeienau so eine Rolle wie die oft mangelnde Entschei-ungskompetenz des den Patienten direkt behandelndenitarbeiters (Pflegekraft oder Arzt). Klinische Pfade kön-en ein effektives Instrument zur Überwindung dieserürden darstellen, indem sie sowohl ein Analgesie-chema definieren als auch die am Patientenbett Tätigenit der notwendigen Entscheidungskompetenz ausstat-
en. Anhand einer Literaturrecherche wird gezeigt,nwiefern sich diese theoretischen Überlegungen tat-ächlich in einen messbaren Einfluss von Klinischenfaden auf die perioperative analgetische Therapie sowieie eingangs genannten Outcomes transferieren lassen.
oi:10.1016/j.periop.2010.10.026
itzung 7, Vortrag 4: Reduktion des Dokumentations-ufwandes durch klinische Behandlungspfade
. Vargas Hein
Zentrales Qualitätsmanagement der Charité, CCM
-mail: [email protected]

2 Pe
EsddvBbzuwAACslodZzedAfvBÜtiaisBzdumnamBpdCvADbljdv
d
St
P
sB
E
EiDpOtVäbdddAomisemAdDedbvuDMd
d
Sb
M
z
32 Akutschmerztherapie im Zentrum
in außerordentlich effektives Instrument, um Prozes-optimierung mit effizienten und effektiven Einsatzer Personal- und Sachressourcen zu betreiben undabei die Behandlungsqualität zu optimieren undereinheitlichen, ist die Einführung von klinischenehandlungspfaden. Die zu erbringenden Leistungenei einer Prozessoptimierung sind hoch, da Pro-esse identifiziert, analysiert, definiert, dokumentiertnd schließlich implementiert werden müssen. Einenesentlichen Anteil im Projekterfolg hat der amnfang der Erarbeitung durchzuführende IST-SOLL-bgleich. Das Projekt Klinische Behandlungspfade in derharité-Universitätsmedizin Berlin erarbeitet gemein-am mit allen beteiligten Berufsgruppen einen optima-en Behandlungsablauf für bestimmte Krankheitsbilderder Symptomenkomplexe. In den Behandlungspfa-en sind inhaltlich und zeitlich alle Abläufe unduständigkeiten genau definiert und tägliche Qualitäts-iele benannt. Das Instrument zur Umsetzung ist dierstellte papiergebundene Behandlungspfadkurve, dieie bestehende Patientenkurve ersetzt. Während desbgleichs des IST- mit dem SOLL-Zustand werden alleür dieses Krankheitsbild benötigten Dokumentations-orlagen gesichtet und auf Integration in die klinischeehandlungspfadkurve überprüft. So ist es z.B. möglichberwachungsbögen, BZ-Profilkurven, Schmerzmedika-ionsprotokolle, etc. in die Behandlungspfadkurve zuntegrieren. Auch ist es möglich die Dokumentationnderer Berufsgruppen, wie z.B. die Physiotherapie,n die Behandlungspfadkurve mit reinzunehmen. Somitchafft man Transparenz der Vorgänge für alle an derehandlung beteiligter Berufsgruppen. Dadurch kannum Teil eine Doppeldokumentation vermieden wer-en und damit eine Reduktion des Dokumentations-nd Kommunikationsaufwands erzielt werden. Allerdingsuss man sehr darauf achten, die Behandlungspfadkurveicht zu überfrachten und dadurch unübersichtlich undnwenderunfreundlich zu gestalten. Im Zuge der zuneh-enden Digitalisierung der Patientenakte und weitererehandlungsunterlagen minimieren sich die Vorzüge derapiergebundenen Behandlungspfadkurve. Hinzu kommter Medienbruch. Das Folgeprojekt der Papierpfade an derharité-Universitätsmedizin Berlin ist die Erarbeitungon digitalen Behandlungspfaden. Durch die digitalebbildung des Behandlungsverlaufs als verknüpfte To-o–Liste im Krankenhausinformationssystem kann eineessere Transparenz und Einsehbarkeit der Behand-ungsschritte für alle an der Behandlung Beteiligtenederzeit und ortsunabhängig erfolgen. Zudem könnenie Schnittstellen direkt in den Behandlungsschrittenerlinkt werden und zu Nahtstellen werden.
oi:10.1016/j.periop.2010.10.027
Erioperativer Medizin / Periop. Med. 2 (2010) 212–239
itzung 8, Vortrag 1: Sekundäreffekte der Schmerz-herapie - Ileusprävention und Stressprohphylaxe
.H. Tonner
Klinik für Anästhesie, Operative und Allgemeine Inten-ivmedizin, Notfallmedizin, Klinikum Links der Weser,remen
-mail: [email protected]
ine suffiziente Analgesie in der postoperativen Phasest für die Patienten von entscheidender Bedeutung.aneben wird aber auch das postoperative Outcomeositiv beeinflusst. Während systemisch verabreichtepioide zur Entstehung eines postoperativen Ileus bei-ragen können, führt die Epiduralanästhesie zu einererbesserung der Darmfunktion. Durch die Epiduralan-sthesie werden afferente und efferente Nervenfasernlockiert. Es kommt zu einer Sympathikusblockade, ohneass vagale parasympathische Efferenzen inhibiert wer-en. Das relative Überwiegen cholinerger Effekte aufen Darm trägt zu einer vermehrten Darmmotilität bei.uch wenn hinterfragt wurde, ob eine frühe post-perative Aktivität des Darms nach Darmresektionenit Anastomosen nicht die Heilung verzögert, konnte
m Gegenteil demonstriert werden, dass der verbes-erte mukosale Blutfluss nach einer Epiduralanästhesieinen günstigen Effekt auf die Heilungsrate von Dar-anastomosen hatte. Patienten mit einer epiduralennästhesie/Analgesie können schneller mobilisiert wer-en und haben eine kürzere Liegedauer im Krankenhaus.ie Reduktion der sympathischen Aktivität im Rahmeniner suffizienten Analgesie trägt auch zu einer Vermin-erung der Stressantwort auf einen chirurgischen Eingriffei. Die Analgesie führt zu einem geringeren Auftretenon Tachykardie, Hypertonus, Fieber, Immunsuppressionnd Proteinkatabolismus in der postoperativen Phase.ies schlägt sich in einer Reduktion der postoperativenorbidität nieder, insbesondere bei kardial vorgeschä-igten Patienten.
oi:10.1016/j.periop.2010.10.028
itzung 8, Vortrag 2: Wie sinnvoll sind Koanalagetikaei der kontinuierlichen Epiduralanästhesie
. Krämer
Klinik für Anästhesiologie m. S. operative Intensivmedi-in CCM/CVK, Charité- Universitätsmedizin Berlin
-mail: [email protected]