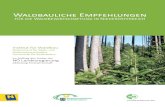Standörtliche, vegetationskundliche und waldbauliche Beurteilung von Seegras-Fichtenbeständen auf...
-
Upload
hannes-mayer -
Category
Documents
-
view
218 -
download
5
Transcript of Standörtliche, vegetationskundliche und waldbauliche Beurteilung von Seegras-Fichtenbeständen auf...

Beurteilung von Seegras-Fichtenbestlinden
erlaubt die kontinuierliche Bestimmung des Gaswechsels yon Gesamtpflanzen getrennt in Sprot~- und Wurzelzone und erschlief~t damit der pflanzenphysiologischen Grund- lagenforschung, auch auf dem Gebiet der Forstpflanzenztichtung, grunds~.tzlich neue methodische M/Sglichkeiten. Das Prinzip der Messung sowie met~technische M/Sglich- keiten und Funktionsweise der Gaswechselmei~anlage werden beschrieben und erste Untersuchungsergebnisse mitgeteilt.
Summary
Gas exchange determination on shoot and roots of silver fir (Albies alba) in a precision phytotron for practical use in forest tree breeding.
For research of gas exchange physiology under special regard to forest tree breeding a precision growth chamber with 1 m '~ usuable space was developed by Forstbotanisches Institut, Mtinchen, Institut fiir Waldbau and Institut fiir Boden- kunde, Freiburg, in cooperation with Forschungszentrum der Siemens AG, Er- langen. Gas exchange of plants can be determined separately in shoot and root zone by continuous measuring. By this precision phytotron absolute new methodological systems are available for plant physiology as well as for fundamental research in forest tree breeding. The principles of determination and the technical properties and functions of the gas exchange chamber are described. First results obtained with this chamber are presented.
Literatur
KOCH, W., KLEIN, E., und WAtZ, H., 1968: Neuartige Gaswechsel-Mel~anlage fiir Pflanzen in Laboratorium und Freiland. Siemens-Zeitschritt, 42, H. 5, 392-404. - - BLUM, W. E., 1970: ,Vermiculit" als N~.hrsubstrat ftir angewandte und experimentelle PflanzenSkologie. Allg. Forst- u. J.-Ztg., 141, 205-209.
StandSrtliche, vegetationskundliche und waldbauliche Beurteilung yon Seegras-Fichtenbest~inden
auf der mittelschw~ibischen Iller-Lech-Platte
(Forst~imter Welden und Zusmarshausen)
Von HANNES MAYER
Aus den Instituten ]iir Waldbau und Forstliche Ertragskunde
der Forstlichen Forschungsanstalt Miinchen
Einleitung
Bei n~iherer waldbaulicher und ertragskundlicher Untersuchung der auf den mittel- schw~ibischen Feinlehmstandorten dominierenden Fichte ergeben sich sehr verschieden- artige Gesichtspunkte, deren optimale Bewertung eine mSglichst intensive und viel-
Forstw. Cbl. (1972), 9--37 �9 1972 Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin

10 H. Mayer
seitige Grundlagenerhebung sowie eine enge fachliche Zusammenarbeit voraussetzt. Den Vorst~inden der beiden Institute, Herrn Professor Dr. J. N. K6SVLER und Herrn Professor Dr. E. ASSM*NN, gilt mein besonderer Dank fiir die Unterst~itzung der Untersuchungen. Dank schuldet der Verfasser auch dem ehemaligen Waldbau-Refe- renten der Oberforstdirektion Augsburg, Herrn Regierungsdirektor TREVZEL, dessen langj~ihrige lokale Erfahrung wesentlich zur Kl~irung oftener Fragen beitrug. Die Untersuchungsergebnisse (Abschluf~ des Manuskriptes Sommer 1965) bildeten die spe- ziellen standorts- und waldkundlichen Grundlagen fiir die Habilitationsarbeit yon F. FR,NZ (Die Ergebnisse standortskundlich-ertragskundlicher Forschung als Grund- lage zuverl~issiger Ertragssch~itzungen auf gegebener Standortseinheit in Mittelschwa- ben. Habilitationsarbeit, Universidit Miinchen 1968). Die geplante gemeinsame Ver- 8ffentlichung der beiden Arbeiten lief~ sich nicht verwirklichen.
Bei den Lichtmessungen unterstikzte reich Herr cand. forest. R. FZLt)NER. Herr Dipl.- Fo~stw. K. Tm~LE analysierte die B~Sden. Mein Dank gilt augerdem meiner Mitarbeiterin, Frau U. LAePLER, flit die Fertigung der Zeichnungen, ebenso den Forstamtsvorst~nden, den Herrex~ Oberregierungsforstr~.ten WErss und HrLD f(ir mannigfache Unterst(itzung.
Fragestellung
Die Untersuchungen verfolgten verschiedene Ziele: 1. UberpriKung der Wuchsreihen auf stand6rtliche Einheitlichkeit. 2. Ursachenanalyse der unterschiedlichen Leistungsf~ihigkeit der Wuchsreihen. 3. Waldbauliche Beurteilung der Seegras-Fichtenbest~/nde mit einheitlichem Ertrags-
niveau auf den verschiedenen Standortseinheiten.
1. StandSrtliche Charakteris t ik des Untersuchungsgebietes
Die Forst~mter Welden und Zusmarshausen.liegen auf der Iller-Lech-Platte (400 bis 500 m) im Wuchsbezirk Mittelschw~ibische Schotterriedellandschai% (ST*DLEI~, 1962). Terti~ire Molasseschichten stehen nur in tiefer eingeschnittenen T~ilern an. W~.hrend der verschiedenen Eis- und Zwischeneiszeiten entstand diese Schotterlandschaflc rnit ihren typischen Hochfl~.chen, Riedeln, Terrassen und eingeschnittenen T~ilern, wobei meist rigeiszeitliche Schotter das grobe Plateau-Relief formen. Zum Tell sehr m~ichtige L~Sg- ablagerungen (bis 20 m) gleichen das Relief weitgehend aus, so dag die ausgedehnten, mehr oder minder ebenen Hochfl~ichen nur durch wenig ausgepr~igte Mulden gegliedert sind. Nahezu zwei DritreI der mittelschw~bischen Watdfl~iche nehmen Feinlehm- Plateaustandorte ein.
Zur klimatischen Orientierung dienen nachstehende Werte: Jahresmitteltemperatur 7-8 ~ C; Januar -1/-2 ~ C, Juli 16-17 ~ C, Jahresschwankung 18,5-19,0 ~ C; 150 bis 155 Tage (iber 10 ~ C; 25-30 Sommertage. Durchschnittlicher Jahresniederschlag 750 bis 800 mm, davon im Winter 130-140 mm (geringe Schneelage), FrCihjahr 180 bis 200 mm, Sommer 280-300 ram, Herbst 160 ram. Mit erheblicher Sp~itfrostgefahr ist auf den Hochfl~ichen zu rechnen, ebenso mit Kingeren Trockenperioden im Fr~ihjahr und Herbst. Extrem trockene und gleichzeitig sehr warme Jahre (Augsburg 574 ram, Ulm 474 ram) sind waldbaulich zu beriicksichtigen, w~ihrend nasse Jahre (1000 bis 1100 mm) keine akute Gefahr mit sich bringen:
Die Standortserkundung der Oberforstdirektion Augsburg (STADLER 1957--1958) schied auf den graswiichsigen Feinlehmstandorten drei grogfl~ichig vorkommende

Beurteilung von Seegras-Fichtenbestiinden 11
Standortseinheiten aus, die als Grundlage fi.ir die ertragskundlichen Untersuchungen dienten. A. Zur Verdichtung und oberfl~ichlicher Vern~ssung neigende Standorte, Deschampsia
caespitosa - Carex-brizoides-Typ auf grauem, wechselfeuchtem Feinlehm; meist mit Humusverschlechterung.
B. Zur Verdi&tung und oberfl~ichlicher Vern~ssung neigende Standorte, Carex-brizoi- des-Typ auf wechselfeuchtem, fahlem Feinlehm bis Oxalis - Carex-brizoides-Typ auf frischem, braunem Feinlehm.
C. Weniger stabite, abet leistungsf~ihige Standorte, Eurhynchium~Typ, Buchen-Eichen- wald, ausgeglichen frische Standorte, brauner Feinlehm his lehmiger Sand.
Diese drei Standortseinheiten entsprechen den Wuchsreihen und umfassen im wesent- lichen die fi.ir Mittelschwaben so charakteristischen Seegras~-Fichtenbest~inde. Eine gut orientierende altgemeine standortskundliche Einf/ihrung gibt MOHL,~USSrR (1964) f~ir das benachbarte Oberschwaben.
2. Bodenkund l i che Verhiiltnisse
Innerhalb der Wuchsreihen wurde in einer ertragskundlich wie stand/Srttich und vege- tationskundlich repr~sentativen Probefl~iche der Boden n~iher untersucht , u m tiber die Ergebnisse der auf ein gr/Sf~eres Waidgebiet abgestellten Standortserkundung (STAr)LER, 1957--1958) hinaus die lokalen Besonderheiten n~iher zu erfassSfi und auf den bisheri- gen Erfahrungen aufbauend den Einblick zu vertiefen. Eine Wiederhotung der Unter- suchungen zur besseren Sicherung der standortskundlich ziemlich typischen Ergebnisse iief~ sich nicht realisieren.
a. Bodenprofile
Wuchsreihe A 1
Probefl~iche: 14; Forstamt Welden/Binderle, III 4c ~ Geologie: Diluvial-L6~lehm (umgelagerter De&lehm). Relief: ebene Hochfl~.che. Standortseinheit: Seegras-Eichen-Buchenwald; Neigung zur Verdi&tung und oberfl~ichli&er
Vern~issung; Deschampsia caespitosa - - Carex-brizoides-Typ auf wechselfeuchtem, grauem Feinlehm; OxaIis-Schreberi-Typ (schwache Humusverschlechterung).
Bodenvegetation: 60 ~ Nadelstreu, Polytrichum formosum. Thuidium tamariscinum, Hyloco- mium splendens, Pleurozium schreberi, Carex brizoides. Bodenvegetationstyp: Typische moosreiche Ausbildung (Dicranum scoparium). Natiirllche Waldgesellschafl: Artenarmer Seegras-Eichen-Buchenwald (Melampyro-Fagetum
caricetosum brizoides). Bodentyp: Sehr stark ausgepr~gter Pseud'ogley in ebener Lage; trockene Phase ann~ihernd
gleich fang wie nasse Phase (vgl. Profil 36, MOC~ENHaUSEN, 1962). Profilaufbau: A0 0-- 2cm A I 2-- 8cm
A2g 8-- 17cm
g 1 17-- 38 cm
g 2 38-- 84 cm
rohhumusartiger Moder fahl schwarzbrauner, humoser, etwas feinkiesiger (schluffiger) Lehm, Hauptwurzelhorizont (pH in n KC1 3,5) fahlgrauer, schluffiger, kaum noch humoser Lehm, br~Sckelig, m~igig dicht, m~iffig kleinere, schwarzbraune Konkretionen, noch durchwur- zelt (pH 4,0) rostbraun bis fahlgrau gefle&ter, schluffiger Lehm mit vielen feinen bis mittleren, st~irker verkrusteten Konkretionen, dicht, vereinzelte Wurzeln (pH 4,1) rotbraun bis fahlgrau, stark gefleckter, schluffiger Lehm mit vielen bis erbsengrogen Konkretionen, plastisch, dicht; letzte Fichtenwurzeln bei 65 cm (pH 4,0)

12 H. Mayer
Abb. 1. Schematische Bodenprofile der Wuchsreihen. Dutch den unterschiedlidaen Grad der Pseudovergleyung ist s&on die wedlseinde Bodenf{irbung ~ihnli& aufsdllul~rei& w~e t3oden-
k6rnung und Verteilung der Konkretionen
g 3 84--130 cm rotbrauner schluffiger Lehm, schwach grau gefle&t, mit feineren schwarzbraunen Konkretionen, dicht; (ehemaiige Eichenwurzelr/Shren) (pH 3,9)
Wuchsreihe A 2
Probefldche: 78; Forstamt Zusmarshausen/Nasse Gehau X 8a ~ Geologie: Diluvia-L~Sf~lehm (umgelagerter De&lehm). Relief: Eben bis beginnend sanflt geneigter Muldenanfang. Standortseinheit: Standorte mit Neigung zur Verdi&tung und oberfl~ichlicher Vern~.ssung;
Deschampsia caespitosa - - Carex-brizoides-Typ auf wechselfeuchtem, grauem Feinlehm. Bodenvegetation: Polytrichum formosum, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Carex
brizoides; 40 ~ Fi&tennadets~reu. Bodenvegetationstyp: Dicranum-Mnium-Ausbildung. Natiirliche Waldgesellschafl: Artenarmer Seegras-Eichen-Buchenwaid (Me[ampyro-Fagetum
caricetosum brizoides). Bodentyp: Stark ausgeprligter Pseudogley am Rand einer sanften Mulde, trockene Phase an-
n~hernd gleich lang wie nasse Phase. Profilaufbau: A 0 0- - 5 cm schwarzer, schwa& verpilzter, zum Tell rohhumusartiger Moder bis
Graswurzelfilzmoder, stark durchwurzelt A 1 5-- 8 cm fahl braunschwarzer, humoser, schluffiger Lehm mit etwas Feinsand,
br/Sckelig, Hauptwurzelhorizont (pH 2,9) A 2g 8-- 36 cm fahlgrauer, schluffiger Lehm mit reichlich kleineren, schwarzbraunen
Konkretionen, plattig bis rein br~Sckelig, schwa& por~Ss; einzelne schwache rostbraune Fle&en; noch etwas durchwurzelt (pH 3,6)
g 1 36-- 61 cm fahlgrau land rotbraun, stark gefleckter bi~ senkrecht gestreifl:er schluf- tiger Lehm, dicht, reichlich feinere schwarzbraune Konkretionen (pH 3,7)

Beurteilung von Seegras-Fichtenbestanden 13
g 2 61--130 cm r~Stlichbrauner (rostig), fahlgrau gefleckter bis vertikal gestreifier, schluffiger Lehm mit iSrtlicher Anreicherung yon gr/Si~eren (bis erbsen- korngrof~en) schwarzbraunen Konkretionen (60--80 cm), (pH 3,7)
Wuchsreihe B
Probefldche: 34; Forstamt Welden/Langenberg V 8a ~ Geologie: Diluvial-L~Sfflehm (umgelagerter Decklehm) fiber Deckenschotter. Relief: Sanfi geneigter Hoehfl~ichenrand. Standortseinheit: Standorte mit Neigung zur Verdichtung und oberfl~chlicher Vern~ssung;
Oxalis-Carex-brizoides-Typ auf frischem braunem bis wechselfeuchtem fahlem Feinlehm. Bodenvegetation: Carex brizoides bodendeckend (Milium effusum, Oxalis, Thuidium tama-
riscinum). Bodenvegetationstyp: Typische Carex-brizoides-Ausbildung. Natiirliche Waldgesellschafl: Seegras-Eichen-Buchenwald (Melampyro-/Caerx-pilosae-Fagetum
caricetosum brizoides). Bodentyp: Braunerde-Pseudogley (schwach ,,verbraunter" Pseudogley - - stark pseudogley-
artige Braunerde). Profilaufbau: A 0 0-- 4 cm schwarzbrauner Graswurzelfilzmoder, sehr stark durchwurzelt, Haupt-
wurzelhorizont A 1 4-- 11 cm stark humoser, braunschwarzer, sandiger Lehm, krfimelig, noch st~irker
durchwurzelt (pH 3,3) (B) g 11-- 37 cm hellbrauner, schwach sandiger Lehm, einzelne schwach angedeutete
r6tlich braune Flecken und wenige feine schwarzbraune Konkretionen, br/Sckelig (pH 3,7)
g (B) 37 - -56 cm brauner, schwa& graubraun gefle&ter, sandiger, etwas schluffiger Lehm, reichlich fein-mittlere Konkretionen, dicht, br/Scketig bis klum- pig (pH 3,8)
g 1 56-- 82 cm braungrau gefle&ter, etwas kiesiger, sandiger Lehm mit zahlreichen feinen, schwarzbraunen Konkretionen (pH 3,8)
Dg 2 82--130 cm sandiger lehmiger Kies, braungrau gefleckte Feinerde mit ~Srtlich ge- h~u~en gr6f~eren schwarzbraunen Konkretionen (pH 4,0)
Wuchsreihe C 1
Probeflliche: 51; Forstamt Zusmarshausen/Meierholz I 4b 4. Geologie: Diluvial-L/SBlehm- und Deckenschotter-Kolluvium. Relie]: Sanfier Unterhang in einer breiten Talmulde. Standortseinheit: Frischer Buchen-Eichenwald auf anlehmigem Sand, Eurhynchium-Typ; 6rt-
lich m~t~ige Humusverschlechterung (Oxalis-Schreberi-Typ). Bodenvegetation: Oxalis, Viola silvatica, Carex brizoides, Eurhynchium striatum, Thuidium
tamariscinum, Mnium, Polytrichum formosum, 10 % Fichtennadelstreu. Bodenvegetationstyp: Carex-pilosae-Ausbildung. Natiirliche Waldgesellschafl: Artenreicher Seegras-Eichen-Buchenwald (Carex pilosae-Fagetum
caricetosum brizoides). Bodentyp: Pseudogley-Braunerde (schwach pseudovergleyte Braunerde). Profilaufbau: Ap 1 0-- 4cm schwarzbrauner, stark humoser (Mull), lehmiger Sand, kriimelig,
reichlich Regenwiirmer (pH 3,2) Ap 2 4-- 13 cm dunkelbrauner, schwach humoser, lehmiger Sand mit ecwas Fein- bis
Mittelkies, Regenwiirmer, Feinwurzelhaul~thorizont, kriimelig (pH 3,7) (B) 13-- 47 cm hellockerbrauner, schwach feinkiesiger, lehmiger Sand, reichlich Regen-
wiirmer; Hauptwurzelhorizont; kriimelig bis br~Sckelig, etwas dichter (pH 3,9)
g (B) 47-- 92 cm ockerbrauner und schwa& hellbraun gefle&ter kieshaltiger sandiger Lehm, br/S&elig, wenige feine, schwarzbraune Konkretionen, m~.flig Regenwlirmer, schwach durchwurzelt (pH 4,0)
g 1 92--106 cm brauner, gelbbraun bis fahlgrau gefleckter, schluffiger Lehm, reichlich feine Konkretionen, noch m~l~ig durchwurzelt, dicht, zeitweise wasser- stauend (pH 3,7)
g 2 106--130 cm hellbraun bis grau gefleckter, kieshaltiger, sandiger Lehm bis lehmiger Sand, reichlich mittlere bis groSe schwarzbraune Konkretionen, klum- piges Gefiige, vereinzelte Fichtenwurzeln bis ans Profilende (pH 4,1)

14 H. Mayer
Wuchsreihe C 2
Probeflache: 70; Forstamt Zusmarshausen/Salcbgraben VI 6b ~ Geologie: Deckenschotter tiber sandige, oberer Siii~wasser-Molasse (Pfohsand). Relief: Sanfi geneigter Mittelhang. Standortseinheit: Weniger stabile, aber leistungsf~.bige Standorte; Buchen-Eichenwald bzw.
Eurhynchium-Typ; anlehmige Sande bis sandige Lehme. Bodenvegetation: Carex brizoides, Melica nutans, Festuca gigantea, Eurhynchium striatum,
Mnium affine et undulatum. Bodenvegetationstyp : Festuca-silvatica-Ausbildung. Natiirliche Waldgesell.schafl: Seegras-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum caricetosum
brizoides). Bodentyp: Braunerde mit geringem bis mittlerem Basengeixait. ProfiLa;r A 1 0-- 6 cm (Moder-)Mull; sehr humoser, schwarzbrauner, s&wach kiesiger, leh-
miser Sand, stark durchwurzelt, por/ss, gekriimelt (pH 3,3) (B) 1 6-- 20 cm o&erbrauner, im oberen Tell noch schwa& humoser, sandig lehmiger
Kies, por~Ss, gekriimelt, Hauptwurzelhorizont (pH 3,9) (B) 2 10--52cm r/StIich brauner, lehmig-sandiger Kies mit Br6&elgefiige, schwach
por/Ss bis dicbt, m~i~ig durchwurzelt (pH 4,2) D 1 52--73 cm rostbraun-bellbraun, stark querstreifiger, schwach anlehmiger Fein-
bis Mittelsand, Einzelkorngefilge, noch sehr schwach durchwurzelt (pH 5,8)
D 2 73--130 cm schwa& braun bis hellbraun, ab 102 cm hellgrauer, querstreifiger Fein- his Mittelsand, Einzelkorngefiige, vereinzelte Fichtenwurzeln (pH 5,8)
Stark ausgepr~igte Pseudogleye mit den bekannten Eigenschafien (MOcliEI'qHAUSErq, 1962; dichte Bodenlagerung, Wechsel yon oberfl~ichlicher Vern~issung im Friihjahr und sommerlicher Austrocknung; grau, rotgelb und rotbraun gefle&tes, ,,marmoriertes" Profilbitd, starke Entbasung, Lut~mangel, teilweise Tonzerst/Srung) sind fiir die Wuchs- reihe A charakteristisch. ~m allgemeinen dominiert in Mittels&waben die Vern~issungs- phase (STADLeR, 1962), wenngleich zeitweise die sommerliche Austro&nung sehr stark sein kann (BIuELR~E:ri~Er<, 1962). Eel den lokalen Profilen dauern die trockene und nasse Phase anMihernd gleich lang. Der extreme Wasserhaushalt diirl~e sich im ProfiI A 2 durch die beginnende Hangneigung am Rand einer schwa& ausgepr~igten Mulde etwas besser gestalten. Die erhebliche Versauerung verz/Sgert die Zersetzung des Be- standesabfalles stark, wie die Rohhumus- und Moderbiidung zeigt. Geringere M~chtig- keit der Feinlehmiibertagerung und merklichere Hangneigung fiihren im Profil B zur schw~icheren Pseudovergleyung bei noch vorhandener bzw. beginnender Braunerde- dynamik im Oberboden. Nut no& beim Mittel- und Unterboden zeigt sich im Profil C I eine schwache Pseudovergleyung infolge zeitweiser Staun2isse, w~ihrend geoiogisch bedingt ausschlief~Iich Braunerdemerkmale das Profi[ C 2 kennzdchnen. Die B(Sden der Wuchsreihe C sind wesentlich besser durchliiftet und besitzen einen ausgeglicheneren Wasserhaushalt als 5ene der Wuchsreihe A. Der unterschiedlichen Korngr/5t~enzusam- mensetzung kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Weniger ausgepr~igt als bei C sind die morphologischen Profilunterschiede innerhalb der Wuchsreihe A, in deren extremeren BiSden geringeren Unterschieden gr~Sgere waldbauliche Bedeutung zukommt.
b. Bodenk/Srnung
L6f~lehme (zum Tell umgelagert) bilden das Ausgangsgestein ftir die Profile A und B. Die Sieb- und Sedimentanalysen geben ein ziemlich einheitliches Bild: 10-15 0/o Ton, 33-41 0/0 Schluff, 37-45 ~ Feinsand, 4-10 0/0 Grobsa~d und unbedeutende Mengen yon Feinkies. Schluffiger Lehm (~Srtliche Bezeichnung Feinlehm) bedingt also unter dem gegenw~irtigen Klima eine Bodenentwicklung in Richmng Pseudogley. Am fein- erdereichsten ist das Profil A 2. _Khnlich ist die Korngr/513enzusammensetzung des Pro- ills B, bei dem aber im Unterboden sandiger (lehmiger) Kies die Drainage erh/Sht. Dem-

~eu~e~.lung yon Seegrc~3-f~fbr~,n~estAnden "15,
Abb. 2. Bodenk~,tnung {Kc, r~grgfgenverteilung) und Velumenve~hXl~r~i~se (Porenvolume~) ill dea BodenprofiIen der WuchsreJhen

16 H. Mayer
gegeniiber sind die B~iden C 1 und C 2 erheblich feinerde~irmer, wobei die grobe Sand- komponente stark iiberwiegt oder wie im Oberboden yon C 2 der Kiesanteil ton- angebend ist. Die Entwicklung yon Pseudogleyen in den Wuchsreihen A und B und yon Braunerden in der Wuchsreihe C hiingt also prim~ir vom unterschiedlichen Fein- erdegehalt ab (Abb. 2).
Wie auch aus den Kornverteilungs-Summierungskurven fiir den Oberboden (0 bis 40/50 cm) hervorgeht (Abb. 3), liegt in der Bodenk~irnung der qualitative Unterschied zwischen den Wuchsreihen A/B und C. Gegeniiber den schluffreichen B~iden der Pseu- dogleye setzt sich deutlich der lehmige Sand vom Profil C 1 und mehr noch der leh- mige Schotter yon C 2 ab.
c. Bodendurchlii~ung
Bodengefiige, Luff- und Wasserhaushalt spielen fiir die Bewurzelung der Baumarten und damit ihre Leistungsf~.higkeit eine wesentliche Rolle. Im Friihjahr (Mitre Mai 1965) lag das Luffvolumen im Oberboden bei den Profilen der Wuchsreihe A zwischen 7 und 12 Vol.-~ (Profil A 2 Werte unter 10 ~ Nur wenig h/ihere Werte ergaben sich beim Profil B. Selbst im Profil C 1 betrug die Luffkapazit~it im Oberboden nur 12 bis
20 ~ Erwartungsgem~ifl nimmt die Bodendurchliiffung mit der Tiefe ab. Eine Ausnahme davon bildet Profil C 2, das schon im Oberboden am besten durchl/if- tet (20 bis 30 ~ ist. Die aus- gepr~.gte Verdichtungszone zwi- schen 20 und 52 cm besitzt eine wesentlich geringere Luffkapa- zitiit (rund 15 ~ Im lockeren Pfohsand des Unterbodens wer- den dann wieder erhebliche Werte erreicht. Von Wuchs-
WUeHSREmEN: A~.----A2.- . . . . B,-----Cl. ............... C2 reihe A zu Wuchsreihe C nimmt also die Durchliiffung deutlich zu. In den schluffreichen Fein- erdeb/Sden mit hoher Verdi&- tungsbereitschaff und zu vielen
Fein- bzw. zu wenig Grobporen bilden physikalische Faktoren den wuchsentscheiden- den Faktorenkomplex (RICHARD, 1953). Durch die Intensitiit der Wasserbindung ist nur ein geringer Teil des Wassergehaltes leicht dr~.nierbar (RIcriARD, 1955). Die n~ihere Bestimmung der Grob-, Mittel- und Feinporen (vgl. RICHARD, 1959) w~.re wiinschenswert gewesen.
Bei den Profilen A und B liegt die Wasserkapazit~it zwischen 32 und 38 ~ Da fie beim Profil A 2 iiberdurchschnittliche H/She erreicht, ist das Porenvolumen der Pro- file A 1 und A 2 unter Beriicksichtigung der Luffkapazit~it ann~ihernd gleich: Erber das Profil B (rund 35 %) nimmt die Wasserkapazit~it zu den Profilen C (rund 30 %) ab. Das relativ hohe Erdvolumen der Profile A (55-60 ~ erkl~irt bereits die geringere stand~Srtliche Leistungsf~ihigkeit (vgl. RIC~tARD, 1953), w~ihrend die anderen Profile nur Werte zwischen 50 und 55 Vol.-~ erreichen.
Abb. 3. Kornverteilung (Summierungskurven) im Ober- boden (0--40/50 cm) der Wuchsreihen. Grobkies und
Steine wurden nicht n~iher analysiert

Beurteilung yon Seegras-Fichtenbestiinden 17
d. pH-Werte
Die (ira Mai 1965) in KCI gemessenen nur wenig streuenden pH-Werte belegen eine sehr saure Bodenreaktion. Unter dem Einfluf~ der Fichtenbestockung liegen die Werte in der obersten Bodenschicht (0-20 cm) zwischen 2,9 und 3,5. Im Mittel- und Unter- boden erh6hen sich die Werte nur unwesentlich (3,5-4,2). Die Entbasung der Feinlehm- b6den mul3 ziemlich welt fortgeschritten sein. Eine Ausnahme macht das zweischichtige Profil C 1, wo im terti~iren Pfohsand-Horizont der pH-Wert pl/Stzlich auf 5,8 ansteigt.
e. Durchwurzelung
Der Hauptwurzelhorizont in den Pseudogleyen ist wenig m~ichtig (0-20/30 cm). Dar- unterliegende Schichten sind yon der Fichte nur noch sehr schwach und nicht tiefer als 40 (70) cm durchwurzelt. Noch gut kenntliche Eichenwurzelr~hren bit in 100-130 cm Tiefe zeugen von einem friiher intensiveren BodenaufschlutL Bei den Braunerden der Wuchsreihe C reicht der Hauptwurzelhorizont bis in 50 cm Tiefe. Bis zum Profilende (130 cm) konnten noch vereinzelte Fichtenwurzeln festgestellt werden (vgl. BIBEL- RI~THZR, 1962).
Die biologische Bodenaktivit~it war in den Pseudogleyen auf~erordentlich gering und ein Bodenleben auf den obersten Horizont beschr~inkt, w~ihrend in den Braun- erden auch unter Fichte ein m~it~iger Regenwurmbesatz vorhanden war (vgl. RONDE, 195t, 1957; MEYER, 1960).
f. Zusammenfassung
Fi.ir die Wuchsreihe A sind stark ausgepr~.gte Pseudogleye charakteristisch, deren dichte Feinlehmb6den mit geringem Luf~volumen durch st~indigen Wechsel yon Vern~issung und Austrocknung einen extremen Wasserhaushalt besitzen und durch weitgehende Entbasung stark saure Bodenreaktion aufweisen. Braunerdedynamik kennzeichnet bei m~it3igem Basengehalt die B6den der Wuchsreihe C. Dutch wesentlich geringeren Fein- erdeanteil, h6here Lufikapazit~it und gr~Sfiere Porosifiit ist der Wasserhaushalt ausge- glichener. B6den der Wuchsreihe B haben intermedi~iren Charakter.
3. Vegetationskundlicher Befund
Atis Raummangel kann die zusammenge.fai~te Vegetationstabelle der A[tersphasen (36 Auf- nahmen) und jene der jiingeren BestSnde (50 Aufnahmen) nicht ver/Sffentlicht werden.
a. Bodenvegetation in 51teren Probefl~ichen
Die Seegras-Fichtenbest~.nde erscheinen oberfl~ichlich betrachtet physiognomisch sehr einheitlich. Das Seegras dominiert +_ stark, w~.hrend andere Gr~.ser (Luzula luzuloides, Deschampsia caespitosa) zuri~cktreten. Neben der trotz ansehnlicher Deckungsgr~.de wenig auff~iltigen Moosschicht (Polytrichum formosum, Hylocomium splendens, Thui- dium tamariscinum) tritt die off nur fleckenweise reichlichere Krautschicht mehr in den Hintergrund (Oxalis acetosella, Moehringia trinervia, Cicerbita muralis, Luzula pilosa,

18 H. Mayer
Dryopteris spinulosa, Arthyrium fi!ix-femina). Obwohl die ~ilteren Best~.nde nicht ganz vergleichbaren Entwicklungsphasen angeh/Sren, lassen sich die Wuchsreihen vegetations- kundlich gut unterscheiden (Abb. 4).
Wuchsreihe A 1
Die randliche typische rnoosreiche (Dicranum scoparium-)Ausbil- dung setzt sich in der Altersphase dutch geringe mittlere Artenzahl (23-30), Zur~icktreten der Kraut- schicht und Dominanz der Moos- schicht nach Zahl und Deckungs- wert deutlich ab. Als Trennarten gelten Calluna vulgaris, Carex pallenscens, Holcus lanatus, Ma- stigobryum trilobatum, w~ihrend Dicranum scoparium, Leuco- bryum glaucum und Carex pilu- lifera hier die gr~Sf~te Menge er- reichen. Laubwaldarten kommen nut sporadisch vor. Dagegen sind sekund~ir begiinstigte Nadelwald- arten am st~irksten vertreten. Ein- deutig dominieren Zeiger f~ir saure bis sehr saure Rohhumus- Moderstandorte bei allgemein wechselfrischem bis frischem Was- serhaushalt.
Wuchsreihe A 2
Abb. 4. Soziologische und ~SkoIogische Kennzeichnung der Wuchsreihen durch die standortsanzeigende Bo- denvegetation. Zwecks besserer Vergleichbarkeit wur- de eine Kurvendarstellung an Stelle des iiblichen Blockdiagramms gew~.hlt. Die einzelnen Arten wur- den unter Ber/icksichtigung ihrer Artm~ichtigkeit und Stetigkeit zu lokal erarbeiteten soziologisch-6kologi- schen Artengruppen zusammengefaf~t. Einzelheiten der
Darstellungsweise in MAYER (1963)
Infolge des durchschnittlich ge- ringen Alters ist die Bodenvege- tation noch nicht ganz charak- teristisch ausgebildet. Bei naher floristischer Verwandtschafi mit der Wuchsreihe A 1 ist die Dicra- num-Mnium-Ausbildung durch Moose von grof~er Artm~ichtig- keit, wie Hypnum cupressiforme, Campylobus flexuosus und auch Plagiochila asplenioides, ausge- zeichnet. Immerhin kommen schon einige Laubwaldarten (Viola sil- vatica, Festula silvatica) mit ge- ringer Vitalit~.t vor, die zusam- men mit Mnium affine s. I. gegen die typische moosreiche Ausbil-
dung abgrenzen und zur Wuchsreihe B iiberleiten. Zeiger fl.ir saure bis sehr saure Roh- humusstandorte gehen zur/.ick, so dal~ auf weniger extreme Humus- und Azidit~its- verh~ltnisse als in Wuchsreihe A 1 zu schliei~en ist.

Beurteilung yon Seegras-Fichtenbestlinden 19
Wuchsreihe B
Eine breite Zwischenstellung nimmt vegetationskundlich die typische Carex-brizoides- Ausbildung ein. Nach rascher Ausbreitung dominiert bald das Seegras in der relativ artenarmen Bodenvegetation mit m~il3ig entwickelter Moosschicht. Daneben ist die Ausbildung durch die Trennarten Agrostis alba und Holcus mollis (Rhytidiadelphus triquetrus, Lycopodium annotinum) kenntlich. Laubwaldarten treten schon reichlicher auf. Standortsweiser far die verschiedenen S~iurestufen halten sich die Waage und zeigen mittteren, m~/ISig sauren Oberboden bei eindeutig wechselfrischem Wasserhaus- halt an.
Wuchsreihe C
Diese Wuchsreihe setzt sich durch eine artenreiche Krautschicht mit gut entwickelter, aber relativ artenarmer Moosschicht (Gesamtartenzahl 30-50), vielen Laubwaldarten (Dryopteris filix-mas, Viola silvatica, Eurhynchium striatum, Maianthemum bifolium, Galium rotundifolium) sowie dutch reichlich Oxalis deutlich ab. Carex brizoides er- reicht unterdurchschnittliche Mengen. - N~iher beim typischen Seegras-Fichtenforst steht die Carex-pilosa-Ausbildung (C 1), fiir die neben der Wimpersegge, einige rand- lich vorkommende bodensaure Moose (Hypnum cupressiforme, Pleurozium schreberi) und die Dominanz yon Catharinaea undulata eigentiimlich sin& M~.t~ig saute Stand- ortsweiser dominieren. Laubwaldarten erreichen mittlere Mengen, wobei einzelne Laubmischwaldarten bemerkenswert sind. - Ausgepr~igt eigenst~indig ist die seltenere, ungemein artenreiche Festuca-silvatica-Ausbildung (C 2). In der gut ausgebildeten Strauchschicht fallen vital entwickelte Jungwiichse yon Quercus robur, Carpinus betulus und Tilia cordata auf. Als wichtigste Trennarten gelten Impatiens noli- tangere, Festuca gigantea, Asperula odorata, Convallaria majalis, Lamium galeobdo- lon, Epilobium montanum und Galium silvaticum. Carex pilosa bildet nut lokal Herden. Laubwaldarten dominieren ausgepr~igt. Miif~ig saurer Oberboden, Mull- Moder-Humus sowie gleichm~it~ig hangfrischer Boden werden angezeigt.
Die Wuchsreihen A, B und C unterscheiden sich vegetationskundlich deutlich. Inner- halb der Wuchsreihen, vor allem bei A und weniger bei C, sind die quantitativen und qualitativen Vegetationsunterschiede geringer. Durch das teilweise mosaikartige Auf- treten der Ausbildungen sind alle ~3berg~inge vorhanden.
b. Natiirliche Waldgesellschatt
Auch nach mehreren Fichten-Generationen fehlen charakteristische nati.irliche Nadel- waldarten (Piceion-Charakterarten, z.B. Lycopodium annotinum) nahezu, w~hrend Versauerungs- und Rohhumuszeiger sekund~ir gef~Srdert wurden. Besonders in leicht h~ingiger Lage vorkommende soziologische Kennarten (OBERDORrER, 1957) weisen auf Laubwald-Ausgangsgesellschaf[en hin; z.B. Arten sommergriiner Laubw~.lder (Querco- Fagetea): Viola silvatica, Moehringia trinervia, Carex silvatica; Arten buchenwald- artiger Laubw~ilder (Fagetalia): Dryopteris filix-mas, Milium effusum, Catharinaea undulata; Arten yon buchenreichen W~ildern (Fagion): Festuca silvatica, Luzula luzu- loides, Plagiochila asplenioides; Arten von Laubmisch-(Eichen-Hainbuchen-)W~ildern: Carex pilosa (m. E.), Galium silvaticum, Carpinus betulus in Kraut- und Strauch- schicht. Dadurch wird ein submontanes Tieflagen-Buchenwaldgebiet im Kontakt zu ~ eichenreicheren collinen Laubmischw~ildern charakterisiert, wie auch einzelne Feuchtig- keitszeiger mit Verbreitungsschwerpunkt in Tieflagen-Auw~ildern (Alno-Ulmion) be- legen; z. B. Carex brizoides, Festuca gigantea, Mnium undulatum, Sambucus nigra.

20 H. Mayer
Abweichende floristische Zusammensetzung der Fichtenbest~inde, erhebliche Stand- orts- und wesentliche Leistungsunterschiede Weisen schon darauf bin, daf~ die gemein- sam durch Carex brizoides gekennzeichneten Fichtenbest~inde nicht auf eine einheitliche Ausgangsgesellscha~ zur/.ickgehen (vgi. HauFF, 1964).
Aufschluf~reich war die Analyse eines ,,naturn~iheren" (abet durch Saat und Pflan- zung entstandenen), m~f~ig ausgeformten 120j~ihrigen Stieleichen-Buchen-Bestandes mittlerer Wuchsleistung (FA Welden V 2, Waldhaus), der am Randeeiner grof~fl~/chi- gen feinlehmbedeckten Schotterhochfl~.che auf einem sanfi nach Osten-S/.idosten ab- fallenden Ri.icken stockt. Der sandige Feinlehm ist im Oberboden stark verbraunt, locker und biologisch aktiv (Mull-Moderauflage, Pseudogley-Braunerde).
Baumschicht 80 %: 4 Fagus silvatica (20--24 m), 3 Quercus robur (25 m), + Pinus siI- vestris (32 m);
Strauchschicht 1%: + Picea abies, r Rubus spec.; Krautschicht 60 %." 3 Carex pilosa, 2 Luzula luzuloides, 2 Oxalis acetoseIla, 1 Carex pilu-
lifera, 1.3 Carex brizoides, + Deschampsia flexuosa, + Luzula piIosa, + Dryopteris spinulosa, 1 Fagus silvatica, 1 Quercus robur, + Picea abies, r Sorbus aucuparia;
Moosschicht 5 %." 1 Polytrichum formosum, + Dicranodontium denudatum, r l--Iylocomium splendens.
Es handelt sich urn eine wechselfeuchte Untereinheit des bodensauren Alpenvor- land-Eichen-Buchenwaldes (vgl. Fagetum finicola, EvvER, 1947, bzw. Carex-pilosae- Fagetum, caricetosum brizoides, O~ERDORFER, 1957). Nach Standortsvergleich und nat/.irlichen Vegetationsresten ist die Carex-pilosa-(C 1-)Ausbildung der Seegras-Fich- tenbestiinde aus dieser Waldgesellscha~ hervorgegangen. Die Festuca-silvatica-Aus- bildung (Wuchsreihe C 2) in tiefer gelegener, lokalklimatisch beg~instigter, sonnseitiger Lage belegt durch starke Einwanderungstendenz von Hainbuche und Sornmerlinde, gr~5~ere Vitatit~it yon Laubmischwaldarten (Galium silvaticum, Carex pilosa stellen- weise), mit ihren reicheren Unterhangvorkommen eine Entstehung aus einem buchen- reichen Lehm-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum caricetosum brizoidis, O~ER- DORVER, 1957), der hier in Arealrandlage und in Kontakt mit dem Wimperseggen- Eichen-Buchenwald vorkommt.
Im Gebiet herrschen fl~chenhatt die stark bodensauren und artenarmen rnoosreichen Ausbildungen (A) der Seegras-Fichtenbest~inde vor. F~ir die entbasten, wechselfrischen Feinlehmstandorte der grol~fl~chigen Verebnungen kommt der artenarme Seegras- Eichen-Buchenwald (Melampyro-Fagetum caricetosum brizoidis, O~ERDORi=~R, 1957) als ,,nat[irliche Waldgesellschaf~ von heute" in Frage, wobei der Wuchsreihe A 1 eine ~irmere und A 2 eine typische Ausbildung entspricht. Unter Ber~icksichtigung der ein- getretenen Degradierung d/.irfie vielleicht sogar ein ,,Asperulo-Fagetum caricetosum brizoidis" den ,,einstigen" nat[irlichen Wald gebildet haben. HAisvF (1964) t ra f verein- zelt noch derartige naturnahe Seegras-Eichen-BuchenwSlder im n6rdlichen Oberschwa- ben an (siehe auch FREHNER, 1963). Weniger bodensaure und sandigere Standorte der Wuchsreihe B tendieren schon zum seegrasreichen Wimperseggen-Eichen-Buchenwald. Trotz des zum Tell mosaikhaf~en Vi~rkommens und der durch die Fichte verSnderten Standorts- und Vegetationsbedingungen l~if~t sich das naturnahe Waldbild noch mit ausreichender Sicherheit rekonstruieren. Die physiognomisch einheitlichen Seegras- Fichtenbest~nde entstammen also verschiedenen nati~rlichen Waldgesellschafien. Gegen- iiber den leichter zu erhebenden bodenkundlichen Faktoren diirfen vegetationskund- liche Merkmale nicht vernachl~/ssigt werden, die abet erst nach ~ihnlich intensiver, methodisch einwandfreier Auswertung in einem gr~Sf~eren Bereich gesicherte ]Srgebnisse erwarten lassen. Erst die ausgewogene boden- und vegetationskundiiche (ira weitesten Sinne) Analyse f/.ihrt zum gew/.inscht ersch6pfenden standortskundlichen Einblick.
Bestandesgeschichtliche Erhebungen, erg~.nzt dutch archivalische Untersuchungen und pollen- analytische Rohhumusanalysen unter weitgehender Beriicksichtigung der Nichtbaumpollen k~Snnen die lokale Umwandlung der Waldgesellschafien im einzelnen aufzeigen.

Beurteilung yon Seegras-Fichtenbest~inden 21
c. Zeitliche Entwicklung der Bodenvegetation
Zwei Fragen sollen beantwortet werden. Warm kann die Standortseinheit friihestens vegetationskundlich angesprochen werden? Welche Hinweise ergeben sich fiir die Be- standsbehandlung (z. B. kritischer Bestockungsgrad bzw. entsprechende Stammzahl), um die vorzeitige Ausbreitung des verjiingungshemmenden Seegrases zu verhindern? Mit zunehmendem Alter der Fichtenbest~inde ver~indert sich das Bestandesinnenklima (W~irme, Lut%feuchte, Niederschlagsangebot). Der LichtgenuB, der dabei am auff~illig- sten zunimmt, bildet fiir die Bodenvegetation einen entscheidenden Faktor.
Lichtmessungen
Uber die Methode und Problematik yon Lichtmessungen orientiert eine Reihe yon VerSffent- lichungen (NX~zLI, 1939; BRECnTZL, 1962; SChmALTZ, 1964). In neuerer Zeit wurden in Fich- tenbest~nden Lichtuntersuchungen durch RHZINHZIMER (1957, 1959) und VkZINA (1960) durch- gefiihrt.
Einflufl der Auflenlichtstarke: Sieht man von Probefl~ichen mit besonderem Licht- klima ab, dann ergeben sich bei starker Schwankung der Einzelmessungen ann~ihernd folgende Rahmenwerte ftir die durchschnittliche Grundhelligkeit:
Tabelle 1
Grundhelligkeit (Bestandeshelligkeit ohne Lichtfle&en)
! Relative Bestandeshelligkeit in ~ des StammzahI Freilandli&tes
je ha i i wolkenlos (30 000 bis bew/51kt bis triib
50 000 Lux) (4 000--10 000 Lux)
Absolute Bestandeshelligkeit in Lux
wolkenlos (30 000 bis bew61kt bis tr/ib 50 000 Lux) (4 000--10 000 Lux)
4000--3000 0,4--1,0 2-- 4 120-- 500 80-- 400 3000--2000 0,7--1,6 3-- 7 210-- 800 120-- 700 2000--1500 1,0--2,0 5-- 9 300--1000 200-- 900 1500--1000 1,2--3,0 6-- 10 360-- 1500 240-- 1000 1000-- 600 1,6--4,0 8--12 480--2000 320--1200 600-- 300 3,0--6,0+ 10--25+ 900--3000+ 400--2500+
Die relative Bestandeshelligkeit h~ingt stark v o n d e r Intensit~it des Freilandlichtes ab. An bew~51kten bis trtiben Tagen, wo die Gesamtstrahlung haupts~.chlich bis aus- schliei~lich aus diffusem Licht besteht (vgl. V~ZINA, 1960), ist die relative Grundhellig- keit an gleichen Stellen der Best~.nde bis vier- und fiinfmal so grog wie an wolkenlosen Strahlungstagen (Abb. 5). Im Bestand 'ist die Lichtverteilung an triiben Tagen mit allm~.hlichem ~3bergang yon der Grundhelligkeit zu lichteren Stellen ausgeglichener als an sonnigen Tagen. Die jahreszeitliche Abh~ingigkeit der relativen Beleuchtungs- stiirke yon der Lichtintensit~.t (Hochsomrner helleres Licht, Frtihjahr und Herbst schw~icheres Licht mit h6herer relativer Beleuchtungsst~rke; SCHMALTZ (1964) kann in diesem Zusammenhang auger Betracht bleiben.
Nach SCUMALTZ (1964) nimmt die absolute Beleuchtungsst~irke in Buchenbest~inden mit steigender Intensit~it des Auf~enlichtes zu, wenngleich sie im Verh~iltnis zur Frei- landhelIigkeit geringer wird (vgl. TRAPP, 1938). Auch in den untersuchten Fichten- best~inden ist bei starker Bew~51kung, insbesondere bei tier ziehenden schwarzen Regen- wolken, die absolute Beleuchtungsst~irke ganz erheblich (ein FiinRel bis ein Siebente!) geringer als an wolkenlosen Tagen. Andererseits k6nnen aber bei klarem Wetter die

22 H. Mayer
absoluten Lichtwerte geringer sein als an Tagen mit d/inner, yon der Sonne aufge- hellter Hochnebeldecke, ebenfalls bei niedrigem Sonnenstand amMorgen oder Abend, wenn sich die Schattenwirkung der St~imme verst~irkt. Die absolute Grundhelligkeit ~indert sich bei wechselndem Aui~enlicht/iberraschend wenig. Uber die Dauer der ein- zelnen Helligkeitsstufen auf gleichem Standort bei heiterem und bewSlktem Himmel geben die Untersuchungen yon ZUKRmL-ECKHART-NATHER (1963) wertvolle Auf~ schl~isse. SCHMALTZ (1964) betont mit Recht, dai~ die Angaben yon relativen Beleuch- tungsst~irken nur in einem weiten Rahmen oder als Durchschnittswert langfristiger (selbstregistrierender) Messungen mSglich sind. V~ZINA (1961) hat yon April bis Ok- tober die Globalstrahlung in drei 40j~.hrigen Fichtenbest~inden (Umgebung yon Z/irich) mit dem Pyranometer gemessen. Da sich wolkenlose und tr/ibe Tage ausgleichen, sind mittlere Werte der relativen Bestandeshelligkeit zu erwarten. Die Lichtmenge in ~ der Freilandhelligkeit betrug bei einer Stammzahl yon 1720 Fichten/ha 2,4 0/0, bei 1137 Fichten/ha 2,6 ~ und bei 825 Fichten/ha 7,3 ~
Einflufl der Starnmzahl: An zwei wolkenlosen Tagen (1. und 2. April 1965) wur- de in den Probefl~ichen an 40 bis 50 zuf~illig verteilten Einzelpunkten mit einem Luxmeter der Fa. Metrawatt, N~irnberg, die Bestandeshelligkeit in BrusthShe ge- messen. Der Tagesgang der Gesamtheliigkeit schwankte an beiden Tagen nur un- wesentlich. Die durchschnittlichen Werte der Freitandstation betrugen:
zoi 18.00 j84 194s i10 0 1,00 11200 1,3 s 11430 ji lS j lS O 1,6.30
Kilolux 20 30 40 45 48 50 45 40 35 30 20
Zusammenh~/nge zwischen Stammzahlabnahme und Zunahme der relativen Hellig- keit in den einzelnen Probefl~ichen l~ii~t Abb. 5 erkennen, in der die vom diffusen Licht gespeiste relative Grundhetligkeit in ihrer typischen Schwankung (also ohne klein- fl~ichig verteilte und kurzfristig wechselnde Licht- und Sonnenflecken) dargestellt ist. Die bestandesindividuelle Amplitude ist erheblich. Sie umfai~t in stammzahlreichen Best~inden bis 80 0/o und mehr der gemessenen Einzelwerte. Bei einer Stammzahl yon 1000/ha repr~isentieren noch rund die H~il~e der Messungen die diffuse Grundhellig- keit, im Altbestand sinkt dieser Wert auf 30 ~ und darunter. Ungleichm~itgigkeit der Bestockung, Schneebruchl/icken, Seitenlicht durch Bestandesr~.nder und Verj/ingungs- gruppen verursachen bei i.iberdurchschnittlicher Streuung eine grSl~ere gesamte Be- standeshelligkeit. Deutlich zeigt sich die nur langsame Zunahme der Grundhelligkeit, solange die Best~.nde (bis etwa 600-700 Fichten/ha) noch + geschlossen sind.
Nach einer zusammenfassenden Auswertung (Abb. 6) ist in den j/ingeren, sehr stammzahlreichen Best~inden (4500-3000/ha, 18-22 m OberhShe) die ,,Grundhellig- keit" aus diffusem Licht mit 0,5-1~5 ~ relativer Freilandhelligkeit gering. Flecken abgeschw~ichten direkten Lichtes erreichen hSchstens Werte yon 3 ~ w~.hrend Sonnen- flecken im Fr/ihjahr in der Regel noch nicht den Waldboden erreichen. Dadurch ist die absolute Schwankung der Bestandeshelligkeit klein. In j/ingeren Baumholzbest~nden (3000-1500/ha, 20-27 m OberhShe) steigt die Grundhelligkeit auf 1,0-2,5 (3,5) o/0 an. Bei wesentlich grSl3erer Amplitude spielen Lichtflecken verschiedener Intensit~it und vereinzelt schon Sonnenflecken eine gewisse Rolle (Anteil rund 5 ~ Einen Eindruck yon der zeitlichen Variabilit~.t und der Auswirkung der unterschiedlichen I-Ielligkeits- stufen vermittelt Abb. 96 in ELLENB~RG (1963). Im Ubergang zum Altholz (Stz. 1500-600/ha, 25-34 m OberhShe) nimmt bei gleichm~if~ig geschlossenen Best~inden die Grundhelligkeit wenig, 1,0-3,5 (4,5) ~ dagegen der Anteil an Lichtflecken und Son- nenflecken st~irker zu (Anteil rund 16 ~ so dat~ sich fiir die Bodenvegetation das

Abb. 5. Mittlere Bestandeshelligkeit (Grundhelligkeit) in den einzelnen Probefl~ichen an wol- kenlosen Strahlungstagen und bei + triibem Wetter

24 H. Mayer
re(at iver Lichtgenu~3 in "/. der Frr162162 (woikcn[ose Strahtungstczge)
GRUNDHELLIGKEtT L I C H T F L E C ~ E N - SONNENFLECKEN
Abb. 6. Zunahme der Bestandeshelligkeit an wolkenlosen Strahlungstagen in Fichtenbesfiinden mit unterschiedlicher Stammzahl. Mit abnehmender Individuenzahl nimmt gesetzm~Big der
Anteil der Grundhelligkeit ab und jener der Licht- bzw. Sonnenflecken zu
Lichtklima deutlich verbessert. Die Bestandeshelligkeit streut in aufgelockerten, lichten Fichten-Altholzbesdinden (Stz. 600-300/ha, 32-42 m Oberh6he) in einem weiten Be- reich; Grundhelligkeit (2-8 ~ und Lichtflecken gehen kleinfl~ichig wechselnd inein- ander iiber. Helle und ged~mpi~e Sonnenflecken treten in grol~er Zahi auf (Anteil fund 30 ~
Von dicht geschlossenen, stammzahlreichen Fichtenstangenorten bis zum individuen- armen Altholz nimmt die Bestandeshelligkeit zun~ichst sehr langsam zu. Erst wenn in den untersuchten Fichtenbest~inden bei Stammzahlen unter 700-600/ha der Schlut~grad unregelm~if~ig und durchbrochen wird, steigt die Bestandeshelligkeit sehr schnell. Ge- fade das Verh~.ltnis von Grundhelligkeit, Anteil der Licht- und Sonnenflecken zeigt deutlich die unterschiedliche Licht~Skologie und damit auch die kleinklimatisch wech- selnden Lebensbedingungen fiir die Vegetation und die Mikroorganismen. In normal geschlossenen, stammzahlreichen Fichtenbest~.inden der Ilter-Lech-Platte wird sich also erst relativ sp~t eine lichtanspruchsvolle Bodenvegetation und damit auch eine Ver- j/.ingung der Baumarten einstellen k~Snnen.
Entwicklung der l/egetationsschichten
In gleichm~ii~ig bestockten Fichtenstangenorten (30- bis 40j~ihrig; 3500-4500 St~.mme je ha; 0,3-0,5 o/o relative Grundhelligkeit) an wolkenlosen (1-3 ~ an bew~Slkten - Werte jeweils in Klammern) Tagen fehlen h/Shere Pflanzen. Von gelegentlichen Resten der Kahlschlagflora abgesehen treten nur Pike (Algen) auf. Bei einer gleichm~iBig ver- teilten Stammzahl von etwa 3000/ha (0,7-1,0 ~ bzw. 3-4 ~ relativer Grundhellig- keit) stellen sich die ersten Kleinmoose ein (nicht n~iher bestimmte Lebermoose, wie Scapania, Cephalozia, Blepharostoma, Radula, Madotheca), die als d/inne ~berz~ige Nadeln und Rindenst~icke ~iberziehen. Damit beginnt eine ganz charakteristische Vege-

Beurteilung yon Seegras-Fichtenbest~inden 25
tationsentwicklung, die nicht gleichm~igig einsetzt, da in den Best~inden tiber- und unterdurchschnittliche Belichtungsbedingungen mosaikartig wechseln,-wie kombinierte Licht- und Vegetationskarten aufschluf~reich belegen (RH•INHEIMEI<, 1957, 1959). Auf progressive Entwi&lungen nach Durchforstungseingriffen k/Snnen beim anschliet%nden Zusammenwachsen der Best~inde auch wieder regressive Stadien oder Stillstandsphasen auftreten. Die ungleiche Altersstruktur der Entwicklungsreihen erlaubt nur eine Skizzie- rung der wesentlichen Zusammenh~inge.
Die Entwicklung der Vegetationsschichten in den Fichtenbest~inden mit zunehmendem Lichtgenuf~ vollzieht sich in allen Ausbildungen der Seegras-Fichtenforste vergleichbar (Abb. 7). Geringste Lichtansprtiche stellt die Moosvegetation. Bei 1,0-1,5 ~ (4-6 ~ relativer Grundhelligkeit siedeln sich die echten Waldmoose fleckenweise an, die dann bei steigender Helligkeit (1,7-2,5 bzw. 7-10 ~ dichte Polster bilden k~Snnen. Erst in dieser Phase entfaltet sich die Kraurschicht, die dann bei 3-4 (12-16)o/o relativer Grundhelligkeit ausreichende Lebensbedingungen finder. Noch sp~iter stellt sich die
RELATIVE BELEUCHTUNGSST~.RKE (GRUNDHELLIGKEIT) BEi 25-50 KILOLUX
Abb. 7. Entwicklung der Vegerationsschichten und Verjiingungsbereitschaflt der Baumarten in verschiedenen Ausbildungen der Seegras-Fichtenforste mit zunehmender Bestandeshelligkeit. Die in der Altersphase physiognomisch ziemlich einheitlichen Seegras-FichtenbestRnde zeigen in den einzelnen Ausbildungen auff~illige standortsbedingte Unterschiede in der Vegetations-
rhythmik und im Verjtingungsgang
Strauchschicht ein, die gegentiber den Schattenmoosen eine 5-10fach gr~Si~ere Licht- menge zur Deckung des h/Sheren Assimilationsbedarfes ben~Stigt.
In den verschiedenen Ausbildungen der Seegras-Fichtenforste erkennt man charak- teristische, stand6rtlich bedingte Unterschiede der Fegetationsentwicklung. Auf starl~ ausgepr~gtem Pseudogley (A) dominiert auch in lichten Altbest~inden die Moosschicht,

26 H. Mayer
w~ihrend die Krautschicht nur geringe Deckungswerte erreicht. Nach anf~.nglicher starker Entwi&lung der Moosschicht nimmt die Krautschicht (vor allem Carex brizoi- des) auf Braunerde-Pseudogley der typischen Ausbildung (B) stark zu und deckt bald die ganze Flgche, so dab die Moose durch sekund~iren Lichtmanget erheblich zur{i&- gehen. Nach BAUMGARTNER (1955) k~Snnen am Grunde dichter Grasdecken nur 2-5 ~ des Oberlichtes (Bestandeshelligkeit) erwartet werden. Auf schwa& pseudovergleyten Braunerden (C) entfaltet sich nach vori.ibergehendem Moos-Maximum eine lo&ere Krautschicht. Bald kommt auch eine Strauchschicht mit mittlerem De&ungsgrad auf, so dal~ schliet~lich eine typische Mischvegetation mehrschichtig aufgebaut ist. Offem
Abb. 8. Vegetationsentwicklung mit zunehmender Bestandes- helligkeit innerhalb der Moos- und Krautschicht in moos- reichen, typischen und krautreichen Seegras-Fichtenbest~inden. Es ergibt sich jeweils eine Trennung in licht~Skologische Arten- gruppen mit z. B. h6herer Schattenertriignis (obere Reihe) und gr~Sf~erem Lichtbediirfnis (untere Reihe), so daf~ die einzelnen Schichten eine ganz charakteristische Entwicklungsfolge durch-
laufen
sichtlich herrschen bei den Wuchsreihen unter- schiedliche Zusammen- h~inge zwischen dem Licht- genut~-Minimum und der beginnenden Vegetations- entwicklung. Auf den etwas reicheren und besser durchliiffeten Braunerde- Standorten des krautrei- chen Seegras-Fichtenfor- stes (C) stellt sich die Krautvegetation bereits bei geringerer Grundhel- ligkeit ein als in den ober- fl~ichlich verarmten, aus- gepr~igten Pseudogley- Standorten des moosrei- chen Seegras-Fichtenfor- stes (A). Auch die in allen Ausbildungen vorkom- menden Moore verhalten sich ~ihnlich. Experimen- telle Untersuchungen miis- sen die Zusammenh~inge im einzelnen kl~iren.
Bei der Entstehung der Moosschicht kann man drei/Skologische Gruppen unterscheiden (Abb. 8). Die kleinwiichsigen Schat- tenmoose stellen sich schon bei 0,5-1,0 (2-4)~ rela- tiver Grundhelligkeit ein. Zu ihnen geh6ren u. a. Lophocolea heterophylla et bidentata, Plagiothe- cium curvifolium et den- ticulatum, Lepidozia rep- tans, Calypogeia tricho- manis, Campylobus flex- uosus und weitere Leber- moose. Sie gedeihen bei

Beurteilung yon Seegras-Fichtenbestiinden 27
ung~instigeren Humusformen und auf ~irmeren B/Sden besser. Schon bald treten sie durch ihre geringe Menge zuriick, da bei zunehmender Bestandeshelligkeit (1-2 bzw. 4-8 ~ Arten der Hypnum-Thuidium-Gruppe mit mittleren Lichtanspri.ichen ihr ~Skologisches Optimum erreichen (Hypnum cupressiforme nut am Boden bzw. auf Nadeln, Thui- dium tamariscinum, Plagiochila asplenioides, Catharinaea undulata, Mastigobryum trilobatum, Leucobryum glaucum). Konkurrenzbedingt bleibt der Deckungswert ge- ring, w~ihrend die Polytrichum-Hylocomium-Gruppe durchschnittlich dreifach gr~51~ere Mengen erreicht und auff~illige Polster und Herden bildet (Polytrichum formosum, Flylocomium splendens, Eurhynchium striatum, Mnium affine s. 1., Pleurozium schre- beri). In den einzelnen Ausbildungen dominieren yon den beiden letzten Gruppen ver- schiedene Arten.
Mit der yon RHEIN~tEIMEr (1957, 1959) aufgestellten licht~Skologischen Moosreihe besteht weitgehende 173bereinstimmung. Durch vergleichende Kartierung der relativen Belichtungsst~irke (bedeckter Himmel) und der Bodenvegetation in Fichten- und Kiefernforsten (ehemalige Eichen-Buchenw~Ider) bei Hamburg stellt er lest, daf~ bei einem relativen Lichtgenuf~ von 5--7 ~ gr/.ine Pflanzen fehlen, von 9--20 ~ eine dichte Moosvegetation vorhanden ist und erst ab 20 ~ relativer Beleuchtungsst~irke sich eine Krautvegetation einstellt. Gerade bei be- ginnendem Moosanflug beeinflussen geringste Unterschiede in der relativen Beleuchtungsst~.rke die Vegetation entscheidend.
~ihnlich, aber weniger deutlich abgestui~, verh~ilt sich die Krautschicht (Abb. 8). Relativ schattenfest sind Arten wie Oxalis acetosella, Luzula pilosa, Luzula luzuloides, Moehringia trinervia, Dryopteris spinulosa, Veronica officinalis, Deschampsia flexuosa, Carex pilulifera, Viola silvatica. Dagegen stellen sich anspruchsvollere Kr~iuter erst bei doppelt so hohem Lichtgenu~ mit gr/Sf~eren Mengen ein (z. B. Lactuca muralis, Festuca silvatica, Dryopteris filix-mas, Maianthemum bifolium, Galium rotundifo- lium, Carex pilosa, Milium effusum, Gateopsis usw.). Anspruchsvollere Kr~iuter sind auf Braunerden schon bei geringerem Lichtgenuf~ konkurrenzkr~.i~iger als auf extre- meren Pseudogleyb6den.
Mittlere Lichtanspri~che stellt das Seegras, das bei etwa 1,5-2,0 (6-8 ~ relativer Grundhelligkeit aufkommt und sich dann auf den wechselfrischen Feinlehmb6den un- gemein rasch ausbreitet. Auf ~rmeren stark ausgepr~igten Pseudogleyb~Sden (A) und auf gering pseudovergleyten Braunerden (C) erlangt Carex brizoides in der Regel geringere Vitalit~it. Sehr geringe Belichtungsunterschiede erm6glichen bereits eine pl6tz- lich einsetzende, fl~ichendeckende Ausbreitung des Seegrases, sobald die Einwanderung in die Best~inde begonnen hat. Nur eine relativ stammzahlreiche (/.iber 600-700 Fich- ten/ha), gleichm~.f~ige und m~Sglichst gestuite Bestockung verhindert eine verj~ingungs- gef~ihrdende Ausbreitung des Seegrases, dessen Biologie einer eingehenden Untersu- chung bedarf.
Nach dem licht6kologischen Verhalten der Trennarten k~Snnen die einzelnen Aus- bildungen der Seegras-Fichtenforste bei der Standortskartierung nach vegetationskundJ lichen Merkmalen erst bei mittterer Entwicklungsphase mit ausreichender Sicherheit angesprochen werden. Relativ fr~ih und gen/.igend deutlich differenziert sich der moos- reiche Seegras-Fichtenforst (1,0-1,3/4-5 ~ relative Beleuchtungsst~irke, 1700 bis 1200 Stammzahl/ha, 60- bis 70j~ihrig), w~ihrend die kraut- und strauchreiche Ausbildung erst bei gr~51~erem Lichtgenuf~ (1,4-1,8/6-7 ~ geringerer Stammzahl (1500-1000/ha) aber durch den rascheren Wuchs bei ann~ihernd gleichem Alter (55- bis 70j~.hrig) gen~i- gend sicher erkennbar ist.
Der typische Seegras-Fichtenforst mit seiner charakteristischen Physiognomie steht dazwischen. Durch die relativ fri.ihe vegetationskundliche Ansprechbarkeit der ver- schiedenen Ausbildungen der Seegras-Fichtenforste wird die Standortskartierung er- Ieichtert. Nahezu die H~il~e der Waldfl~ichen m~issen aber nach prim~ir bodenkund- lichen Merkmalen kartiert werden.

28 H. Mayer
~- ~ ~ =~.~
Z
c~
0 0 0 ~
c~
C~ O ~. % ~ ~ . ~
I I I I I I = ~ =
~ - ~ ~.
~.~.~:~ ~ ~ : = o~
. . ~1 I I I I I
g_
>
m
E
g-
0

Beurteilung yon Seegras-Fichtenbest2inden 29
Verjiingung der Baumarten
Nur in den moosreichen Ausbildungen (A) verji.ingt sich die Fichte befriedigend. Erst wenn sich lichtanspruchsvollere Moose (Polytrichum-Hylocomium) starker entfalten, reicht auch fiir die Fichte der Lichtgenuf~ (1,5-2,0 ~ bzw. 6,0-8,0 ~ relative Grund- helligkeit) zur Weiterentwicklung der S~imlinge aus. Bei dieser Helligkeit breiten sich auch gleichzeitig GrS.ser und Kr~iuter aus. Die geringere Fichtenansamung in den beiden anderen Ausbildungen ist u. a. konkurrenzbedingt, da sich der Lichtgenuf~ fiir den Fichtenanwuchs dutch Seegras-Dominanz (B) oder starke Entwicklung der Strauch- und Krautschicht (C) trotz zunehmender Bestandeshelligkeit sekundS.r wieder ver- schlechtert (BAUMCARTNEI~, 1955). Von den iibrigen Baumarten (Buche, Tanne, Fohre, Eiche) setzt die Ansamung spS.ter ein und erreicht in den stiirker pseudovergleyten Standorten unbedeutende Werte. Nur im krautreichen Seegras-Fichtenforst stellt sich auch unter relativ dichtem Schirm bei geringem Lichtgenuf~ eine rasch in die Strauch- schicht durchwachsende Verjiingung von LaubbS.umen ein (Sorbus aucuparia, Carpinus betulus, Tilia cordata, Ulmus montana). Eine gewisse Ersetzbarkeit der Umwelt- faktoren scheint auch verjiingungs6kologisch wirksam zu sein.
4. Standort und Ertragsleistung
Vergleicht man die natiirlichen Produktionsgrundiagen in dem klimatisch und geolo- gisch einheitlichen Gebiet, dann treten die Ursachen ftir die unterschiedliche Leistungs- fiihigkeit der Seegras-Fichtenbest~inde klar hervor (Tabelie 2, Abb. 9). Die besten Wuchsleistungen (Wuchsreihe C) erreicht die Fichte auf gleichmiit~ig frischen, gut durch- liifteten Braunerden, die sich nur bei geringerem FeinerdeanteiI, gr6berer Bodenk/Sr- nung, insbesondere in Hanglage, bei verst~irkter Drainage entwickeln. Selbst unter reiner Fichtenbestockung und nach mehreren Nadelbaumgenerationen ist die bioio- gische BodenaktivitS.t relativ hoch, so dat~ die Fichtennadelstreu abgebaut wird. Auf diesen stabilen Standorten stocken von Natur aus artenreiche, gut gepufferte Wald- gesellschaf~en, die eine gr(513ere Resistenz gegeniiber anthropogenem Einflut~ zeigen, wie die starke Einwanderungstendenz natiirlicher Laubbaumarten und die noch relativ naturnah zusammengesetzte Bodenvegetation belegen. Eine Umwandlung dieser Fich- tenreinbest~inde in betriebssichere MischbestS-nde dr~ingt aus stand6rtlichen Griinden nicht, da der Bodenaufschluf~ durch die flach- bis mitteltiefwurzelnde und daher stand- festere Fichte vorerst noch ausreicht. StS.ndige kritische ~berwachung ist abet geboten.
Spitzenleistungen werden im selteneren strauchreichen Seegras-Fichtenwald mit Festuca silvatica (C 2) auf Braunerden in Hangmulden mit besonders ausgeglichenem frischem Wasserhaushalt erreicht. Auf diesen weniger versauerten und noch basen- reicheren Standorten stockt yon Natur aus eine Buchen-Variante des anspruchsvolleren Seegras-Eichen-Hainbuchenwaldes. In krautreichen Seegras-FichtenbestS.nden mit Ca- rex pilosa (C 1) geht infolge grof~en Feinlehmanteils, geringerer Bodendurchliiftung und unausgeglicheneren Wasserhaushaltes die Wuchsleistung bereits zuriick. Auch die wechselfeuchte Seegras-Ausbildung des artenreichen Wimperseggen-Eichen-Buchenwal- des, der fiir das Gebiet typisch ist, erm/Sglicht noch iiberdurchschnittliche Wuchsleistun- gen (Carex pilosae bzw. Asperulo-Fageturn, vgl. MAYER, 1964) der Fichte.
Bei stS.rkerer Pseudovergleyung, hohem Feinlehmanteil, geringerer Bodendurch- Itit~ung, extrem wechselfeuchtem Wasserhaushalt und mangelnder biologischer Boden- aktivitS.t erzielt die Fichte die geringsten Wuchsleistungen, da extrem flache Bewurze- lung (in der Jugend- und Altersphase, nach BIBELRIETHER mdl., voriibergehende Senkerbildung his 40/70 cm Tiefe in mittlerem Alter) und Rohhumusbildung auch den

30 H. Mayer
Abb. 9. Oberh/She der Fichte in den Probefl~.chen der Wuchsreihen
N~.hrstoffkreistauf empfindlich st~Sren (Wuchsreihe A). Diesen schon von Natur aus labilen Standorten entspricht ein artenarmer, bodensaurer Seegras-Eichen-Buchenwald (Melampyro-Fagetum caricetosum brizoidis) als ,,gegenw~irtige" naturnahe Waldge- sellschaflq die nur ein geringes Pufferungsverm~Sgen gegeniiber st~irkerem anthropo- genera Einfluf~ besitzt. Eine Umwandlung dieser Fichtenbest~inde mit erh/Shter Wind- wurfgefahr in krisenfestere und nachhaltig betriebssichere Mischbest~.nde ist waldbau- tich am vordringlichsten. Die bedeutenden Leistungsunterschiede innerhalb der Wuchs- reihe A gehen auf verschiedene zusammenwirkende Ursachen zuriick, die noch ein- gehender Untersuchung bediirfen. Welter fortgeschrittene Degradationsstufen der moosreichen Seegras-Fichtenbest~inde (Bodenverflachung, Humusverschlechterung durch gr(Sf~ere Zahl yon Fichtengenerationen) wirken sich ungiinstig auf die Leistung aus (A 1), w~ihrend schon bei geringer Verbesserung des Wasserhaushaltes durch unbedeu- tende Hangneigung oder giinstigere' Bodenk(Srnung die Leistung auff~illig ansteigt (A 2). Insgesamt belegt auch die auf~erordentliche Schwankung der Ertragselemente die Labilit~it dieser Standorte, die sehr viel feiner auf Aut~eneinfltisse (Behandlung) reagieren als jene der Wuchsreihen B und C. Typisch ist auch der starke Leistungs- abfall (hohe natiirliche Abgangswerte) im Alter yon 70-80 Jahren, w~ihrend bis zu diesem Zeitpunkt das Ertragsniveau verh~iltnism~ii~ig hoch bleibt.
Die Wuchsreihe B umfat~t auch nach dem stand~Srtlichen und vegetationskundlichen Befund Fichtenbest~inde mittlerer keistungsf~ihigkeit. Weitgehend nach dem Grad der Pseudovergleyung und damit nach dem Bodenwasserhaushalt streut die Wuchsleistung. Dies ist nicht verwunderlich, da es sich ja um das Kontaktgebiet des artenarmen und artenreichen Seegras-Eichen-Buchenwaldes bzw. um gegen Degradation durch Fichten- bestockung verschieden resistente Ausbildungen handelt. Leistungsf~ihigere Standorte

Beurteilung von Seegras-Fichtenbestlinden 31
sind auf oberfl~ichlich braunem Feinlehm im allgemeinen weniger umwandlungsbediirffig als Best~inde auf fahlem Feinlehm. Im Vergleich zur Wuchsreihe A .stehen diese Be- st~inde erst in zweiter Linie fiir Umbaumaflnahmen heran.
Mosaikartige Verzahnung der Standortseinheiten, erhebliche Auswirkungen gerin- get bodenkundlicher Unterschiede in den stark ausgepriigten Pseudogleyen auf die Fichtenwuchsleistung und methodisch bedingte Unsicherheiten der auf ein gr~Sfleres Gebiet abgestellten Standortserkundung (Zwang zur Vereinfachung, lokale Rolle der f3berg~inge usw.) bewirken die erhebliche ertragskundliche Streuung innerhalb der Wuchsreihen. Sie sind im engeren Sinne stand~Srtlich nicht einheitlich. Wollte man die Zusammenh~inge zwischen Standort und Wuchsleistung in allen Einzelheiten kliiren, w~re es notwendig, auf die Ergebnisse und Erfahrungen der bisherigen Standorts- erkundung gestiitzt eine nur im 5rtlichen Bereich durchzufiihrende Feingliederung als Grundlage fiJr derartige Untersuchungen zu erarbeiten. Darauf aufbauende Ergebnisse sind fiir die Grundlagenforschung von erheblichem Wert, nicht aber f/ir die Praxis in gleichem Marie verwendbar, da damit die fiJr die Groflfl~iche iibliche Streuung der Standortseinheit und damit der ertragskundlichen Elemente ausgeschaltet v<~iren. Von der Praxis der Standortserkundung her gesehen k~Snnen die Wuchsreihen durchaus als stand6rtlich einheitlich im weitesten Sinne angesehen werden. Sp~ter wird ohnehin eine standortskundliche und ertragskundliche Uberarbeitung notwendig werden, wenn in fernerer Zukunff die Fichte in Mischbest~inden und auf sanierten Standorten der mittelschw~ibischen Schotterriedellandschaff ein anderes Gepr~/ge gibt.
5. Waldbauliche Beurteilung
Die mittelschw~ibischen Seegras-Fichtenbest~inde k~Snnen (vgl. Oberschwaben; HAUFF- SCHLENKER-KRAuSS, 1950) waldbaulich nicht einheitlich beurteilt werden, wie bereits aus der Standortserkundung hervorgeht. Eingehendere bodenkundliche, vegetations- kundliche und ertragskundliche Untersuchungen belegen wesentliche quantitative und qualitative Unterschiede. Auf den stark ausgepr~/gten Pseudogleyen (A) stocken extrem flachwurzelnde Fichtenbestiinde m~ifliger Wuchsleistung, die aus stand(Srtlichen (Boden- verflachung) und forstschutztechnischen (Windwurfgefahr) Gri.inden vordringlich um- wandlungsbedi.irffig sind. Wenngleich auch fiir die sehr leistungsf~ihigen Seegras-Fich- tenbest~.nde auf h~ingigen, schw~icher pseudovergleyten Braunerden (C) eine gr~Sfiere Betriebssicherheit auf l~ingere Sicht anzustreben ist, so gestatten stand6rtliche Gri~nde auch fiir die n~ichste Waldgeneration den relativ h~Schsten Fichtenanteil (nach M/Sglich- keit keinen Fichtenreinbestand). Dutch die geringere Sanierungsbediirffigkeit gerade der wi.ichsigeren Fichtenstandorte k~Snnen bei der waldbaulichen Planung die arbeits- intensiven und betriebswirtschafflich anspruchsvollen Umbauschwerpunkte (vgl. TRET- ZEL, 1962; RUVF, 1959; vgl. Fichtenforste der MiJnchener Schotterebene, ATTENBERGER, 1951) mit Vorrang beriicksichtigt werden.
a. Umbau der moosreichen Seegras-Fichtenbest~inde auf stark ausgepr~igtem Pseudogley
Durch den Umbau sollen die durch den Fichtenreinanbau hervorgerufene Bodendegra- dierung aufgehalten, nach M6glichkeit rl.ickg~ingig gemacht und die latente Sturm-, Insekten- und Pilzgef~/hrdung durch krisenfeste Mischbest~inde beseitigt werden. Wie bei dem auf Gleyboden stockenden Erlen-Eschenwald finder man regelmiifiig Seegras- Laubmischw~ilder auf + ausgepr~igten Pseudogleyen (z. B. Melico-Fagetum, Poa-Car-

32 H. Mayer
pinetum et Melampyro-Fagetum caricetosum brizoidis; OBERDORFER, 1957; vgl. HAUFF, 1964). Durch den Bestockungswechsel kiSnnen also die _yon Natur aus zur Verdichtung und Vern~issung neigenden Feinlehmb/Sden nicht grunds~itzlich ver~indert werden. Es geht vielmehr darum, in den nattirlichen Pseudogleyen den infolge der Fichtenreinbestockung verlorenen Bodenaufschluf~ durch eine naturn~ihere Bestockung wiederherzustellen und gleichzeitig eingetretene Versauerungserscheinungen im Ober- boden zu beseitigen. WERNER (1964) konnte vor kurzem zeigen, dal~ der naturgegebene Bodentyp, vor allem auch die Bodenf~irbung des Pseudogleys, dutch die Fichtenmono- kultur nicht wesentlich ver~indert wurde, wohl aber recht einschneidend die Struktur und der Chemismus des Oberbodens (vgl. GENSSLER, 1959). Dies spricht ftir eine tr~.ge Bodendynamik. Bodenanschliffproben yon vergleichbaren grauen FeinlehmbiSden (stark ausgepr~igter Pseudogley) lassen unter Starkeiche im Oberboden noch eine hohlraum- reiche, aufgelockerte und schwammige Struktur erkennen, w~ihrend im benachbarten Fichtenreinbestand eine erhebliche Verarmung an Hohlr~iumen (Dichtlagerung) bei gleichzeitig starker Bodenversauerung festzustellen ist.
Notwendig zur Sanierung der degradierten Pseudogleyb/Sden ist daher (KREuTzER, 196t) eine Behebung der Oberbodenversauerung zur Verhinderung weiterer Tonzer- st~rung und eine Verbesserung der Humusverh~iltnisse und des N~ihrstoffumlaufes durch Beimischung biologisch wirksamer Baumarten; evtl. Untersttitzung durch eine Mineralstoffdtingung. Durch Tiefwurzler und F/Srderung der biologischen Bodenakti- vit~it (Regenwiirmer, RONDE, 1951, 1957) ist der Lull- und Wasserhaushalt (ErhiShung des Grobporenvolumens) besonders im Unterboden zu verbessern. Dauerbestockung soll den zeitweiligen Wasserstau abmildern.
Baumartenwahl
Nach archivalischen Untersuchungen bestockten um 1515 gut erwachsene Buchenbe- st~nde den Streitheimer Forst (STADLZR, 1957--58). Waldgeschichtliche Erhebungen in Mittelschwaben (LANCER, 1958; eingehendere Untersuchung des Subatlantikums unter Berticksichtigung der Nichtbaumpollen ncch erwtinscht) und gut fundierte pollenanaly- tische Ergebnisse aus dem benachbarten niSrdlichen Oberschwaben (HAu~F, 1964) be- legen/.ibereinstimmend, daf~ gegen Ende des ~ilteren Subatlantikums (Buchenzeit) vor Beginn eines st~rkeren anthropogenen Einflusses Buche die entscheidende Rolle gespielt hat, w~ihrend neben der wichtigsten Mischbaumart (wohl) Stieleiche die I-tainbuche nur unbedeutend am Bestandesaufbau beteiligt war. Bei natiirlichern Bestockungs- gefiige war die Buche auf Pseudogley die Hauptbaumart. Winterlinde, Bergahorn, Bergulrne, Kirsche, Birke, Aspe und Eberesche erreichten als weitere standortsheimische Baumarten nut unbedeutende Mengen.
Das Untersuchungsgebiet liegt welt n/Srdlich der Fichtenvorstof~grenze im 16. Jahr- hundert (HoI<NSTEIN, 1951), SO dat~ ein reichiicheres Auftreten lediglich an Moor- r~indern zu erwarten war (LANGER, 1'959). Ein natiirliches Tannenvorkommen ist nach pollenanalytischen (LANCER, 1958, 1963) und archivalischen (Streitheimer Forst, 1574, lange Fohren und Fichten-Tannen) Untersuchungen im Gebiet unzweifelhafl: und auch fiir typische Pseudogleystandorte dutch einzelne Alttannen in Walden/Hirschkopf (180-200j~ihrig, bis 44 m hoch bei 120-134 cm Durchmesser) nachgewiesen (Nos~K, 1955). Sie war sicherlich nur mit einem geringen Anteil und aufgelockert im Laub- mischwald vertreten, so dai~ auch kiini~ig ein hoher Tannenanteil in naturferneren Bestandestypen waldbaulich nicht gerechtfertigt erscheint.
Zu den standortstauglichen Baumarten geh~Srt zweifellos die Kiefer (1575 erwb;hnt), die auch auf stark ausgepr~igtem Pseudogley eine intensive Vertikalbewurzelung durch zahlreiche kr~iftige und schw~ichere Senker ausbildet (BIBELRIZTH~I<, 1963, Abb. 3, 105j~ihrige Kiefer aus Welden) und bei enger gruppenweiser Erziehung (geeignete

Beurteilung yon Seegras-Fichtenbestlinden 33
Provenienz vorausgesetzt; vgl. Bodensee-Kiefer, MAYER, 1964) auch auf frischen Standorten qualitativ durchaus entsprechen kann, wie vereinzelte Alffohren beweisen. Zu den tiefwurzelnden Baumarten k~nnen auf m~ii~igem Pseudogley durch Bildung zahlreicher Senker noch Japanische L~irche und Strobe gerechnet werden, w~ihrend Europ~iische L~irche (ScHREIBER, 1926) und Douglasie erst bei st~irkerer Oberboden- verbraunung in Erw~.gung gezogen werden sollten.
Nach eingehenden Untersuchungen von BIBELRIET~ER (1962) und Sr (1964) eignen sich vor allem Stieleiche und Tanne fiir den Tiefenaufschlui~ der Pseudogleye. Nach rascher Entwicklung einer starken Pfahlwurzel verlagert sich das Hauptwurzel- wachstum bei Stieleiche auf seitliche Verzweigung, so dal~ schlief~lich die Bewurzelung unregelm~iffig herzwurzelartig erscheint. Gegen~iber diesem intensiven Feinwurzel- system bildet die Tanne mehr kr~ii~igere und tiefer vordringende Wurzeln aus, so dat~ ein tieferer Bodenaufschlul3 dadurch gew~ihrleistet wird, wenn auch die Gesamtdurch- wurzelung ungleichm~if~iger wird (K6sTL~I~, 1962). Fi~r die Meliorierung degradierter Pseudogleyb6den eignen sich besonders Schwarzerle (intensives Herzwurzelsystem, siehe auch LEIBUNDGUT, DAFIS, RICHARD, 1963) und Aspe, w~ihrend Roteiche (starke Durchwurzelung und kr~iitige Wurzelbildung im Oberboden) und Hainbuchen (inten- sives oberfl~ichennahes Wurzelwerk mit extensivem Tiefwurzelsystem; evtl. Well, erie) mittlere, dagegen Buche (dichte und stark verzweigte Oberbodendurchwurzelung mit sporadischen Tiefwurzeln) schw~ichere Erschliel~ungsarbeit leisten (KREuVZER, 1961). Durch intensive Zwischenfl~ichenbewurzelung eignet sich Buche zur Beimischung bei Stockraumtiefwurzlern. Eine Ertragssicherheit ist ohne nachhaltige Bodenraumdurch- wurzelung nicht m/Sglich (LAA~SC~, 1963; SCHOOl, 1964).
Das Verh~iltnis yon biologisch erforderlichen und betriebswirtschai~lich erw/.inschten Baumarten mit m~Sglichst hohem Fichtenanteil f/.ir den Meliorations-Bestandestyp kann nut gutachttich angegeben werden, solange w~inschenswerte eingehende Untersuchun- gen /.iber die Wechselwirkungen zwischen unterschiedlicher Mischung und Standort ausstehen. Durcl-r die auf~erordentliche Raschw/.ichsigkeit der Fichte und die langsame Wuchsentwicklung m6glicher Mischbaumarten, wie Stieleiche, Hainbuche (Bergahorn), Winterlinde, l~ii~t sich der ideale Sanierungs-Bestandestyp praktisch nicht auf Grol~- fl~ichen realisieren.
Um fi~r die Einbringung des erforderlichen Laubbaumanteils nicht zu schablonen- ha~en, waldbaulich wie betriebswirtschat~lich letzttich unbefriedigenden Verfahren (streifenweiser Naturbestandestyp, auf Laubholz-Sanierungsstreifen sollte man nur im Notfali zur/.ickgreifen, wenn die Entwicklung nicht mehr aktiv gesteuert werden kann) greifen zu m~issen, ist eine st~irkere Beteiligung yon Licht-Nadelbaumarten (Kiefer, m. E. Japanische L~irche) in Kauf zu nehmen, selbst wenn auch bei entsprechender Pflege nur teilweise befriedigende Quality/ten erwartet werden k~nnen. Sie erm~Sg- lichen den gleichzeitigen Einbau der Umbaubaumarten und die erforderliche gleich- m~.ffige Sanierung des Standortes.
Meliorierungs-Bestandestyp
In dem Laubhotz-Tannen-Kiefern-(Japanl~irchen-)Fichtenbestand soll das Mischungs- verh~.ltnis ausgewogen sein. ~3ber trupp- und gruppenweise Mischung in der Jugend ist Einzelmischung im Alter anzustreben. Fichte (25-50 ~ mui~ einzeln bis truppweise (kleingruppenweise) /.iber die ganze Fl~iche verteilt werden. Tanne mit relativ rascher Entwicklung im allgemeinen truppweise eingebracht, bei gruppenweiser Mischung auf- gelockert durch Laubbaumarten, kann auch einzeln bei oberschichtigen Kiefern (L~ir- chert) die Stufung verbessern. Eng begr~indete, trupp-, gruppen- bis horstweise (je nach Pflegeintensit~it) Kiefer geeigneter Herkun~ (Bodensee) erfordert st~indige Laubbaum- (Tannen-)Beimischung, ebenso Japanl~irche auf weniger extremen Standorten. Ge-

34 H. Mayer
eignete Laubbaumarten ffir den H~.uptbestand, zum Tell nach Auszug der L~irchen- Zeitmischung, sind Stieleiche, Roteiche und ftir den Nebenbestand Buche, Hainbuche, Winterlinde. Als Vorwaldbaumarten f[ir Kahlfl~ichen eignen sich Schwarzerle, Fohre, Aspe. Im extremen Fall ist ein zeitlich begrenzter Schwarzerlen-Zwischenumtrieb (Fohre) durchaus vertretbar, wenn sich nur dadurch ein planm~/fliger Umbau erm6g- lichen Eiflt. Gerade bei frtihzeitig zusammenbrechenden Fichtenbesfiinden verliert man zu rasch die waldbauliche Bewegungsfreiheit.
Ftir das Untersuchungsgebiet kommt ein mit Laubholz beigemischter Tannen- Kiefern-Bestandestyp ftir die Meliorierung in Frage (vgl. K~rUTZEI~, 1961; HOCH- TANNER, 1962), der auch einen ertragskundlich erwfinschten Fichtenanteil nachhaltig erm/Sglicht und betriebswirtschafflich durchaus realisierbar ist. Eine zu starke Beteili- gung der Tanne bringt ~ihnlich wie bei Fichte eine Reihe von Gef~.hrdungen mit sich, da das Klima schon relativ trocken-warm ist (vgl. KI~SCHrELD, 1964). In diesem kommen Fichte und Kiefer (entsprechende Facies nach HOCHTANNER, 1962) als stand- ortstaugliche wie betriebswirtschafflich erwtinschte Baumarten in Frage, wie auch be- nachbarte Standorte zeigen (n/Srdlicher Tell der M~inchener Schotterebene, Inn-Salzach- platte mit anschlieflendem Weilharter Forst in ObertSsterreich). Waldbaulich unerl~.fl- lich ist eine lokal erarbeitete, bestandesindividuelle Nuancierung dernur groflr~iumig klar heraustretenden Behandlungsgrunds~itze. Eine Reihe von Ersatzl/Ssungen (F~AN~, 1963) aus waldbautechnischen oder betriebswirtschafflichen Grtinden ergeben sich bei zwangsweisem Verzicht yon Tanne oder bzw. und Laubbaumarten. Dann w~ire aber der Anteil der Kiefer entsprechend zu erh6hen.
Ein Mischbestand aus Kiefer und Fichte, der gegentiber der unbedingt zu vermei- denden Fichtenreinbestockung intensiveren Bodenaufschlufl und gr6flere Betriebssicher- heit verbiirgt, l~iflt sich auf jeden Fall realisieren und bei entsprechender Pflege aus- formen und evtl. sp~iter mit Laubbaumarten und Tanne ,aufwerten" (HOCHTANNER~ 1965) als vorbereitenden Schritt ffir die endgiiltige Sanierung.
Waldbauliche Durchfiihrung
Die Best~inde sind im Stangenort durch kr~iffige (Standfestigkeit, Erh6hung der Vitali- t~it) und in der Baum- und Altholzphase durch m~iflige bis schwache gestaffelte Durch- forstung zur Wahrung des Bestandesschlusses und damit Verhinderung der Vergrasung vorzubereiten. Z~iunung ist unumg~inglich. Tanne, durch Mischung aufgelockert, erfor- dert rechtzeitigen Vorbau in kteinen Liicken und Mulden. Kurzfristige (Vergrasung) zonenweise lockere Schirmstellung dient zur sofortigen Laubholzeinbringung (RuPF, 1949) und niitzt die reichlich sich einstellende Fichtennaturverjfingung (Abb. 7) aus, wobei reine Gruppen und Horste zu vermeiden und verhockende Trupps kr~ffig zu durchschneiden sind.
Nach kleinfl~ichiger R~iumung und entsprechender Lichtung ktSnnen die Lichtbaum- arten unter gleichzeitiger Aufl6sung und Auflockerung fl~ichiger, reiner Anwuchs- partien eingebracht werden. Mischungsregelung durch besonders intensive Jungwuchs- pflege ist eine unerliiflliche Voraussetzung. Im iibrigen gelten die yon der Arbeits- gemeinschaff Oberschw~ibische Fichtenreviere fiir den wechsetfeuchten Carex-brizoides- Typ des Eichen-Buchenwaldgebietes gegebenen waldbaulichen Anregungen, wie keine Stock- und Grasnutzung und st~indige Bodendeckung durch Kahlschlagverbot (HAurF, SCHLENKER, KRAt3SS, 1950).
Im Vergleich zu ~ihnlichen oberschw~.bischen Fichtenbest~inden (Zeil, MOOSMAYER, 1953; RUPF, 1959; Oberschwaben, KIRSCHFELD, 1964) ist die Humusverschlechterung und Oberbodenversauerung, vermutlich durch die geringe Zahl der Fichtengenera- tionen, im Untersuchungsgebiet weniger welt fortgeschritten, so daf~ eine die Umwand- lung unterstiitzende D/ingung nicht unumg~inglich notwendig erscheint. Zur Herab-

Beurteih:ng yon Seegras-Fichtenbestiinden 35
setzung der oberfl~ichlichen Bodenversauerung und zur Beschleunigung der \Vc'uchsent- wicklung der anspruchsvolleren Laubbaumarten ist eine Initiald~ngung kurz vor oder mit Umwandlungsbeginn w~inschenswert (je ha 30 dz kohlensaurer Kalk, 5 dz Hyper- phos, 5 dz Kalkammonsalpeter; weitere Hinweise bei HAUSSER, 1964; vgl. ASSMANN, 1965).
Durch die besonderen lokalen Verh~iltnisse ergibt sich naturgem~it~ eine Variierung der f/.ir das ganze Wuchsgebiet erarbeiteten vorl~iufigen allgemeinen Waldbauricht- linien (Oberforstdirektion Augsburg, 1958). Planm~iffige Versuche in der Praxis sollen die Frage der geeigneten Fohren-Provenienz (Bodenseekiefer; Terti~.rkiefer ungeeignet) kl~iren und praktische Hinweise fiir das technische Vorgehen (zweckm~ffige Tannen- einbringung) liefern. Eingehende wissenschat~liche Untersuchungen haben noch die 5kologische Bedeutung der verschiedenen gemischten Umbau-Bestandestypen abzu- kl~iren.
b. Typische Seegras-Fichtenbest~inde auf (Braunerde-)Pseudogley
Diese Standorte stehen in zweiter Linie zu einem Umbau heran. Bei geringerer Pseudo- vergleyung und zunehmender Braunerdedynamik besteht gr6i~ere waldbauliche Frei- heir in der Bemessung des Fichtenanteiles (etwa 1/~ bis 3/4) und in der Auswahl der Mischbaumarten (auch europ~iische L~irche und Buche). Mit einem geringen Aufwand (Startd~ngung kaum erforderlich) l~if~t sich der auch hier erforderliche Umbau durch- fi.ihren, wobei diese am st~irksten graswiichsigen Best~inde eine besonders sorgf~ltige Vorbereitung und bis zur Verji.ingung gleichm~ii~igen Schluf~ (siehe Lichtmessungcn) erfordern. Auch hier ist auf eine gleichm~il~ig aufgelockerte Verteilung der Fichte Be- dacht zu nehrnen.
L~rche (Japanl~irche auf fahlem Feinlehm, Europ~iische L~irche auf oberfliichlich braunem Feinlehm) mit Buche (Linde, t-tainbuche) in der Unterschicht kann bier weit- gehend die Aufgabe der Stieleiche iibernehmen. Da die Lichtbaumarten yon der Fichte in der Altersphase [iberwachsen werden, ist eine umgebende hauptst~indige Laubbei- mischung nicht zu umgehen (auch Roteiche). Als Hilfsbaumart zum Anschlul~ an Fichtengruppen kann auch die Fohre dienen. FiJr Tanne sollte man nur wechselfrischere Kleinstandorte reservieren, denen auch mit Schwerpunkt die Umbaumaflnahmen zu gelten haben.
c. Kraut- und strauchreicher Seegras-Fichtenbestand auf Pseudogley-Braunerde bis Braunerde
Bei der Umbaudringlichkeit der groi~fl~ichigen Seegras-Fichtenbest~inde auf den beiden anderen Standortseinheiten m/issen diese Best~inde fi.ir einen Umbau zur~ickgestellt werden. Dies ist um so leichter zu verantworten, da erkennbare offensichtliche Stand- ortssck~idigungen unter reiner Fichte nicht vorliegen. Zur Erh~Shung der Sturrnfestig- keit der Fichtenbest~inde ist eine locker verteilte Beimischung der Europ~iischen L~irche in Laubholzumgebung und mit entsprechendem Unterbau zweckm~.i~ig (evtl. auch Douglasie), die durch die ungiinstige Wuchsrelation aber erh6hter Pflege bedarf. Die sich meist in ~lteren Fichtenreinbest~-nden selbst einstellende Laubbaumverj~ingung sollte mit der Strauchschicht zur Unterdriickung der Verunkrautung und Vergrasung bewui~t gepflegt werden. Auf ausreichende Fichtennaturverjiingung kann nicht ge- wartet werden. Auf diesen leistungsf~ihigen Standorten sind selbst bei rascher zonen- weiser Verjiingung (Fichtenpflanzung) Aufwendungen f[ir Schlag- und Jungwuchs- pflege nicht unerheblich, die abet auf dieser Standortseinheit yon besonders grof~em Effekt sind.

36 H. Mayer
Zusammenfassung
Bei der ertragskundlichen Bearbeitung der mittelschw~ibischen Seegras-Fichtenforste ergaben sich drei Wuchsreihen mit unterschiedlichem Ertragsniveau auf verschiedenen Standortseinheiten. Weitgehend yon physikalischen Bodenfaktoren, insbesondere vom Grad der Pseudovergteyung, h~ingt die Wuchsleistung der Fichte ab. Die physiogno- misch ziemlich einheitlichen Seegras-Fichtenbest~nde entstammen verschiedenen natiir- lichen Waldgesellschaffen mit unterschiedIicher Ukologie, Vegetationsdynamik, Ver- jiingungsbereitschaff und Leistungsf~ihigkeit. Sie k~Snnen daher waldbaulich nicht ein- heitlich beurteilt werden. Auf den stabilen Standorten des artenreichen natiirlichen Seegras-Eichen-Buchenwaldes mit vorherrschender Braunerdedynamik kann auch zu- kiinffig die iiberdurchschnittlich ieistungsf~ihige Fichte den Bestandestyp pr~igen. Da- gegen sind die labilen Standorte der artenarmen Gesellschaff auf stark ausgepr~igtem Pseudogley vordringlich zu meliorieren. Far diese Umbauschwerpunkte wird ein aus- gewogen gemischter, biologisch wie betriebswirtschafflich realisierbarer Bestandestyp aus Laubbaumarten (Stieleiche, Buche, Hainbuche, Winterlinde), Tanne, Kiefer (Japan- l~irche) und Fichte vorgeschlagen.
Summary
A yield study of Carex brizoides-Picea abies forests in Middle Schwaben showed the existence of three growth series with different yield levels. The physiognomically rather uniform Carex brizoides-Picea abies stands derive from different natural forest assoziations with a different degree of surface water influence (pseudo gley), different vegetation dynamics, regenerative capacity and yield potential. At stable sites of the Carex brizoides-Quercus-Fagus forests with an abundance of species and a predominant dynamic typical of gray-brown podzolic soils, spruce-showing an above average growth capacity-may determine the stand type in the future too. The unstable sites on predominant gleyic soils, with a scantiness of species are in urgent need of amelioration by mixed stand types of deciduous species (Quercus robur, Fagus silvatica, Carpinus betulus, Tilia cordata) and fir, pine, spruce (and possibly Larix leptolepis).
Literatur
ASSMANN, E., 1965: Diingung und Melioration yon WaldbestS.nden in ertragskundlicher Sicht. Allg. Forstztschr. - - ATTEr;BERGER, J., 1951: Die Bodenvegetation als Standortsweiser in FichtenreinbestS.nden der M/.inchener Schotterebene. Forstw. C b l . - BAUMCARTNER, A., 1955: Licht und Naturverjiingung am Nordrand eines Waldbestandes. Forstw. Cbl. - - BIBELRIETHER, H., 1962: Wurzeluntersuchungen an Tannen und Eichen in Mittelschwaben. Forstw. Cbl. - - BrBELRIETHrR, H., 1963: Zur Frage der Wurzelentwicklung yon Kiefern auf Sand und auf Pseudogley. Forstw. Cbl. - - BRrCHTEL; H., t962: Methodische BeitrS.ge zur Cikologie der f3berschirmung und Auflichtung einschichtiger WaldbestS.nde. Schriffenreihe d. Landesforst- verw. Baden-Wiirtt., 14. - - ELLEr~BERG, H., 1963: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Stuttgart. - - FRANK, A., 1963: Waldbau und Planung. Allg. Forstztschr. - - FREmaER, H., 1963: Waldgesellschaffen im westlichen Aargauer Mittelland. Beitr. z. geobot. Landesaufnahme der Schweiz, H. 44. - - GENSSLER, H., 1959: Veriinderungen yon Boden und Vegetation nach generationsweisem Fichtenanbau. Diss. Hann.M~inden. - - HAurF, R., 1964: Kurzer f3berblick iiber die Vegetation Oberschwabens. In: Standort, Wald und Waldwirtschaff in Oberschwaben; Arbeitsgemeinschaff ,,Oberschwiibische Fichtenreviere", Stuttgart. - - HAUFF, R., SCHLENKER, G., und KRAUSS, G. A., 1950: Zur Standortsgliederung irn n6rdlichen Oberschwaben. Allg. Forst- u. Jagdztg. 122. - - HAUSSER, K., 1964: Wachstumsgang und Ertragsleistung der Fichte auf den vorherrschenden Standorten einiger Wuchsbezirke der Altmor~inen- und Schotterland- schaff des W~irttembergischen Oberschwabens. In: Standort, Wald und Waldwirtschaff in Oberschwaben; Arbeitsgemeinschaff ,,Oberschw~bische Fichtenreviere", Stuttgart. - - HOCH- TANNER, G., 1962: Der Waldbau und seine Probleme in Niederbayern/Oberpfalz. Allgem.

Beurteilung yon Seegras-Fichtenbest~inden 37
Forstztschr. - - HOCHTANNER, G., 1965: Stabilisieren und Aufwerten der Bestockung. Allg. Forstztschr. - - HORNSTEIN, F. v., 1951: Wald und Mensch. Ravensburg. ~ KIRSCHrELD, P., 1964: WaldwirtschafHiche Untersuchungen in Oberschwaben. In: Standort, Wald und Wald- wirts&aR in Oberschwaben; ArbeitsgemeinschaR ,,Oberschw~ibische Fichtenreviere", Stuttgart. - - K6STLER, J., 1962: Untersuchungen zur Wurzelbildung. Allg. Forstztschr. - - KREUTZER, K., 1961: Wurzelbildung junger Waldb~ume auf PseudogleybiSden. Forstw. Cbl. - - LaA'rSCH, W., 1963: Bodenfruchtbarkeit und Nadelholzanbau. Mi.inchen. - - LANGER, H., 1958: Zur Wald- geschichte yon Bayerisch-Schwaben. 9. Bet. d. Naturforsch. Ges. Augsburg, Augsburg. - - LASGER, H., 1959: Die Ausbreitung der Fichte zwischen Iller und Lech im Laufe des Post- glazials und die heutigen natiirlichen Voraussetzungen ftir ihren Anbau. Allgem. Forstzts&r. - - LANGrR, H., 1963: Einwanderung und Ausbreitung der Weil~tanne in Siiddeutschland. Forstw. C b l . - LEIZUNDGUT, H., DArIS, S., und RICHARD, F., 1963: Untersuchungen tiber das Wurzel- wachstum verschiedener Baumarten. Schweiz. Ztschr. f. Forstw. - - MAYER, H., 1963: Tannen- reiche W~.lder am NordabfaI1 der mittleren Ostalpen. Mtinchen. - - MAYER, H., 1964: Die Salemer L~rche im Bodenseegebiet. Forstw. Cbl. - - MEYER, F. H., 1960: Vergleich des mikro- biellen Abbaues yon Fichten- und Buchenstreu auf verschiedenen Bodentypen. Arch. Mikrobiol. G&tingen. - - MOOS~aAYER, V., 1953: ZeiI. Standort, Wald und Waldwirtscha~ im Ftirstl. Waldburg-Zeilschen Forst. Mitt. d. Vereins f. ForstI. Standortskartierung, H. 3. - - MfiCKEN- HAUSEN, E., 1962: Entstehung, Eigenscha~en und Systematik der B~iden der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt/Main. - - M/OULHKUSSE~, G., 1964: Die Standortsverhgltnisse im De&enschotter- und Altmor:-inengebiet. In: Standort, Wald und Waldwirtschai~ in Ober- schwaben; ArbeitsgemeinschaR ,,Oberschwiibische Fichtenreviere", Stuttgart. - - NaGELI, W., 1939: Lichtmessungen im Freiland und in geschiossenen AltbestRnden. Mitt. Schweiz. Anst. Forstl. Versuchsw. - - NOSE~, K., 1955: Die natiirliche Verbreitungsgrenze der Weif~tanne zwischen Frankenalb und Moraine. Forstw. Cbl. - - OBERDORrER, E., 1957: Stiddeutsche Pfianzengesellschaflten. Pflanzensoziologie, Bd. 10, Jena. - - OUERrORS-rDIREK'rION AUGSBURG, 1958: Vorl~ufige Waldbaurichtlinien for das Wuchsgebiet ,,Mittelschw~.bische Schotterriedel- und Htigeltandschai~ ". - - RHHNI-IEIMER, G., 1957: Ober die Standorte der Moosvegetation in Nadelholzforsten bei Hamburg. Mitt. Staatsinst. f. Alia. Bot. 11, 89-136. - - RHEINHEIMER, G., 1959: Ver~nderungen der relativen Beleuchtungsst~rke und der Bodenvegetation in einem Fichtenforst. Ber. Dt. Bot. Ges. 72. - - RICHARD, F., 1953: Physikalische BodeneigenschaRen natiirlich gelagerter Rif~morgnewaldb6den unter verschiedener Bestockung. Schweiz. Ztschr. f. Forstw. - - RICHARD, F., 1955: 17ber Fragen des Wasserhaushaltes im Boden. Schweiz. Ztschr. f. Forstw. 106. - - RICHARD, F., 1959: Wasserhaushalt und Durchliii~ im Boden. In: Bet. Geobot. Inst. Rtibel in Ztirich f. d. Jahr 1958. - - RONDE, G., 1951, 1957: Studien zur Wald- bodenkleinfauna. Forstw. Cbl. - - RUpF, H., 1949: Zum Anbau der Fichte in unseren Nadel- holzrevieren. Forstw. Cbl. - - Ruvr, H., 1959: Standortsgerechter Waldbau - dargestellt am 50j~.hrigen Waldumbau in Zeil/Allg~.u. Allgem. Forstztschr. - - SCHMALTZ, J., 1964: Unter- suchungen tiber den Einfluf~ von Beschattung und Konkurrenz auf junge Buchen. Diss. Harm. Miinden. - - SCHOCH, O., 1964: Untersuchungen tiber die Stockraumbewurzelung verschiedener Baumarten im Gebiet der Oberschwgbischen Jung- und Altmor~ne. In: Standort, Wald und Waldwirtschaf~ in Oberschwaben; ArbeitsgemeinschaR ,,OberschwRbische Fichtenreviere", Stutt- gart. - - S C ~ E R , M., 1926: Beitr~ige zur Kenntnis des Wurzelsystems der L:,irche und der Fichte. Cbl. f. d. ges. Forstw. - - SwaD~r~, H., 1957-58: Standortserkundung in den Forst- ~imtern Welden und Zusmarshausen der Oberforstdirektion Augsburg. - - ST~DLEr H., 1962: Standortserkundung und -kartierung im Bereich der Oberforstdirektion Augsburg. Allgem. Forstztschr. - - TtAeV, E., 1938: Untersuchungen tiber die Verteilung der Helligkeit in einem Buchenbestand. Bioklimat. Beiblatt. - - TRr-rz~, 1962: Standortserkundung und waldbau- liche Planung. Allg. Forstztschr. - - V~ZI~A, P. E., 1960: Recherches sur les conditions de lumi}re et de precipitation dans les for&s trait&s par la coupe progressive par groupes. Mitt. Schweiz. Anst. Forstl. Versuchsw. - - V~ZINA, P. E., 1961: Variation der Globalstrahlung in drei Fichtenbest~nden. For. Sc. Washington. - - W ~ e R , J., 1964: Zur Frage der Wirkung yon Fichtenmonokulturen auf staun~sseempfindliche B6den. In: Standort, Wald und Wald- wirtschal~ in Oberschwaben; Arbeitsgemeinscha~ ,,Oberschwktbische Fichtenreviere", Stuttgart. - - WER~ER, J., 1964: Grundziige einer regionalen Bodenkunde des stidwestdeutschen Alpen- vorlandes. Schrii~enreihe Landesforsrverw. Baden-Wtirtt. 17, Stuttgart. - - ZU~RmL, K., EC:<HAR'r, G., und NA'rHeR, J., 1963: Standortskundliche und waldbauliche Untersuchungen in Urwaldresten der niederiSsterreichischen Kalkalpen. Mitt. Forstl. Bundesversuchsanst. Maria- brunn, H. 62.